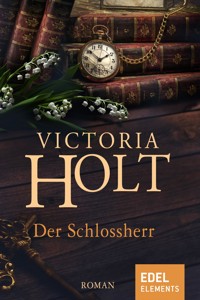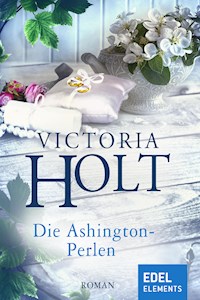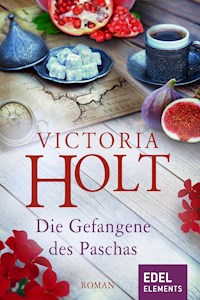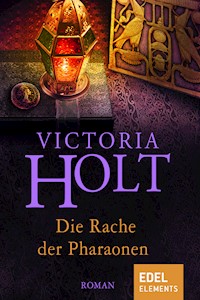4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein opulenter, atmosphärischer Roman um eine außergewöhnliche junge Frau im viktorianischen England. Ein fesselndes Meisterwerk der großen Erzählerin Victoria Holt! Als Tochter einer gefeierten Künstlerin erlebt Noelle zwar eine glückliche Kindheit, doch später meint das Leben es nicht immer gut mit ihr. Ein Schicksalsschlag nach dem anderen fordert Noelle heraus – doch mit Willenskraft und innerer Überzeugung folgt sie unbeirrt ihrem Weg ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 536
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Victoria Holt
Tochter der Täuschung
Roman
Ins Deutsche übertragen von Margarete Längsfeld
Edel eBooks
Inhalt
LONDON
Désirée
Der Unfall
Die zweite Besetzung
KENT
Leverson Manor
Feuer und Regen
Drohende Gefahr
Eine erschütternde Eröffnung
PARIS
La Maison Grise
Das Porträt
Marianne
CORNWALL
Die tanzenden Jungfern
KENT
Rückkehr nach Leverson Manor
Das Urteil
Geständnis
LONDON
Désirée
Oft frage ich mich, wie es mir ergangen sein würde, wenn Lisa Fennell nicht auf so dramatische Weise in mein Leben getreten wäre, und ich stelle verwundert fest, wenn die Beteiligten nicht in demselben Augenblick an einem bestimmten Ort gewesen wären und somit nichts voneinander gewußt hätten, wäre unser aller Dasein ganz anders verlaufen.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß es in ganz London – ja in ganz England – einen zweiten Haushalt wie den unseren gab. Ich weiß nur, daß es ein Glück für mich war, dazuzugehören, denn dieses Hauswesen wurde von der leichtlebigen, ganz und gar unkonventionellen, unnachahmlichen und bewunderungswürdigen Désirée beherrscht.
Zu jener Zeit, als der gesellschaftliche Status in allen Schichten eine gewichtige Rolle spielte, wurde das Protokoll in den Dienstbotenquartieren um nichts weniger strikt beachtet als in höheren Kreisen. Nicht so bei Désirée. Dem Hausmädchen Carrie wurde dieselbe Behandlung zuteil wie der Haushälterin Mrs. Crimp. Was nicht immer Mrs. Crimps Beifall fand. Aber das kümmerte Désirée nicht.
»Na, Carrie, wie geht’s uns denn heute, Liebes?« fragte sie wohl, wenn ihr Carrie im Haus über den Weg lief. Bei Désirée hießen alle »Liebes« oder »Schätzchen«. Dann strahlte Carrie vor Freude.
»Mir geht’s prima, Miß Daisy Ray«, antwortete sie. »Und Ihnen?«
»Es läßt sich aushalten«, erwiderte Désirée mit einem Lächeln, und falls sie Mrs. Crimps mißbilligenden Blick bemerkte, sah sie darüber hinweg.
Désirée wurde von allen im Hause geliebt, abgesehen von den zwei Gouvernanten, die gekommen waren, als ich fünf Jahre alt war, um mir die Grundlagen der Bildung beizubringen. Die eine ging nach wenigen Monaten, weil bei uns zu Hause bis spät in die Nacht ein ständiges Kommen und Gehen herrschte und sie ihre Ruhe brauchte; die andere verließ uns, um die Tochter eines Adligen zu unterrichten, was mehr ihren Erwartungen entsprach. Die meisten Menschen aber erlagen Désirées Charme, hatten sie sich erst damit abgefunden, daß dies ein Haushalt wie kein anderer war: Martha Gee war ihr mit aufgebrachter Anhänglichkeit ergeben und pflegte mit zuckenden Lippen zu murmeln: »Wie soll das bloß weitergehen?«; Jenny, das Stubenmädchen, diente ihr mit Feuereifer, da sie davon träumte, eine zweite Désirée zu werden; Thomas, der Kutscher, war Désirée treu ergeben und vertrat den Standpunkt, daß jemand, der so berühmt war wie sie, sich getrost ein wenig seltsam aufführen dürfe, wenn ihr der Sinn danach stünde.
Und für mich war sie der Mittelpunkt meines Lebens.
Ich erinnere mich an einen Vorfall, als ich ungefähr vier Jahre alt war. Des Nachts drang Gelächter von unten herauf, und davon war ich aufgewacht. Ich setzte mich auf und lauschte. Die Verbindungstür zwischen meinem Zimmer und dem des Kindermädchens stand immer offen. Ich schlich hinüber, und als ich sah, daß Nanny fest schlief, zog ich Morgenrock und Pantoffeln an und ging die Treppe hinunter. Das Gelächter kam aus dem Salon. Ich blieb stehen und horchte an der Tür. Dann drehte ich den Türknauf und spähte hinein.
Désirée saß in einem langen, fließenden Gewand aus lavendelblauer Seide auf der Chaiselongue; die goldblonden Haare hatte sie hochgesteckt und mit einem schwarzen Samtband umwunden, das mit glitzernden Steinen besetzt war. Jedesmal, wenn ich sie sah, war ich von ihrer Schönheit überwältigt. Sie glich den Heldinnen in meinen geliebten Märchen; aber ich sah sie vor allem als Aschenputtel, die auf den Ball gegangen war und ihren Prinzen gefunden hatte – nur daß Désirée deren etliche fand.
Sie saß zwischen zwei Herren, ein dritter stand lachend über sie gebeugt. Ihre schwarzen Röcke und weißen Hemdbrüste bildeten einen hübschen Kontrast zu der lavendelblauen Seide. Als ich eintrat, verstummten alle und sahen mich an. Es war wie auf einem Gemälde.
»Feiert ihr ein Fest?« fragte ich und gab damit zu verstehen, wenn dem so sei, wolle ich mitfeiern. Désirée breitete die Arme aus, ich lief zu ihr und ließ mich in einer süßduftenden Liebkosung umfangen.
Sie stellte mich der Gesellschaft vor. Außer ihr und den drei Herren waren nämlich noch andere Leute anwesend.
Sie sagte: »Das ist mein Schatz. Sie heißt Noelle, weil sie Weihnachten geboren wurde – mein schönstes Weihnachtsgeschenk aller Zeiten.«
Das wußte ich schon. Sie hatte es mir erzählt: »Du bist am Weihnachtstag auf die Welt gekommen, deshalb wurdest du Noelle getauft, das heißt Geburtstag ... Weihnachtsgeburtstag.« Und sie fügte hinzu, dies sei eine besondere Ehre für mich, weil ich am selben Tag Geburtstag habe wie Jesus.
Doch im Augenblick interessierte mich nur, daß hier ein Fest gefeiert wurde und ich dabei war.
Ich durfte auf Désirées Schoß sitzen, während sie mich mit gespieltem Ernst den einzelnen Leuten vorstellte.
»Das ist Charlie Claverham, das ist Monsieur Robert Bouchère ... und das ist Dolly.«
Das waren die drei, die sie umringt hatten, als ich ins Zimmer trat. Ich musterte sie – insbesondere Dolly, weil ich den Namen für einen Mann so eigenartig fand. Er war von gedrungener Statur, hatte einen rotblonden Backenbart und verströmte einen eigenartigen Geruch, den ich später, als ich in solchen Dingen mehr Erfahrung hatte, als eine Mischung aus kostspieligen Zigarren und Whisky definierte. Ich erfuhr zudem, daß er der Schauspieleragent Donald Dollington war, in Theaterkreisen despektierlich Dolly genannt.
Alle machten ein großes Getue um mich, stellten mir Fragen und schienen an meinen Antworten Gefallen zu finden, was mir das Fest um so wunderbarer erscheinen ließ. Dann aber schlief ich ein und merkte kaum, daß Désirée mich in mein Bett trug. Ich weiß noch, wie enttäuscht ich war, als ich am nächsten Morgen aufwachte und feststellte, daß alles vorüber war.
Das Haus lag in der Nähe von Drury Lane. Das Theater war bequem zu erreichen, und das war wichtig. Als ich klein war, empfand ich das Haus als riesig – ein aufregender Ort mit einer Stiege, die in den Keller führte, und einem Treppenhaus vom Erdgeschoß bis in die vierte Etage. Vom Kinderzimmerfenster aus, vor dem Désirée ein Gitter hatte anbringen lassen, damit ich nicht hinausfallen konnte, gab es stets interessante Dinge zu sehen.
Da waren Leute, die auf Schubkarren oder Bauchläden ihre Waren feilboten – heiße Pasteten, Lavendel, Obst, Blumen, Nadeln und Bänder; Kutschen und Mietdroschken brachten die Leute zum Theater und holten sie wieder ab. Ich liebte es, sie zu beobachten.
Als ich sechs Jahre alt war, kam Mathilda Grey ins Haus, um mich zu unterrichten. Miß Grey muß anfangs leicht verwirrt gewesen sein, und sie wäre wohl den Weg der beiden anderen Gouvernanten gegangen, hätte sie nicht Schauspielerin werden wollen. »Nicht so eine wie deine Mutter«, erklärte sie, »die bloß in Lustspielen singt und tanzt, sondern eine richtige Schauspielerin.«
Ich musterte Mathilda Grey. Für eine Tänzerin hatte sie kaum die richtige Figur. Meine Mutter war recht groß und besaß eine Wespentaille. Miß Grey war klein und plump und brachte nichts weiter hervor als ein kleines unmelodisches Trällern. Aber von Lady Macbeth und Portia wurde schließlich nicht verlangt, daß sie singen und tanzen konnten. Miß Greys Bestrebungen, so aussichtslos sie sein mochten, veranlaßten sie nun, in einer Stellung auszuharren, die sie etwas näher an die Welt des Theaters heranführte, als sie es sich sonst hätte erhoffen können.
Nach einer Weile aber fand sie sich mit unserem Hauswesen ab, und ich glaube, sie genoß es sogar, dazuzugehören.
Die wichtigste Person im Haushalt war Martha Gee. Sie war die Garderobiere meiner Mutter – und noch mehr; sie nahm nicht nur meine Mutter, sondern uns alle unter ihre Fittiche. Martha war eine großgewachsene Frau mit scharfen, dunklen Augen, denen fast nichts entging, und braunem, zu einem strengen Knoten geschlungenem Haar; sie ging stets schwarz gekleidet. Sie erinnerte uns gern daran, daß sie, in Hörweite von Bow Beils geboren, eine waschechte Cockney sei. Sie war scharfzüngig, gewitzt, ließ sich, wie sie sich ausdrückte, »von niemand nix« gefallen und vergalt stets »Auge um Auge ... und noch ’n bißchen mehr«.
Miß Gee lernte meine Mutter kennen, als sie noch zur Tanztruppe gehörte, und wenn Martha Gee ein Talent nicht auf Anhieb zu erkennen vermochte, dann konnte es keiner. Sie beschloß, meine Mutter in ihre Obhut zu nehmen und auf den Weg zu führen, für den sie geschaffen war. Martha war um die Vierzig. Sie war mit allen Wassern gewaschen und hatte einiges vom Leben gesehen. Sie gehöre zum Theater, sagte sie oft zu uns, und kenne alle Tricks, deren man sich dort bediene; sie wisse, vor welchen Angeboten man sich hüten und bei welchen man mit beiden Händen zugreifen müsse. Sie drangsalierte meine Mutter ebenso wie uns übrige, gab uns jedoch das Gefühl, es sei zu unserem Nutzen, und Martha wisse es am besten. Sie behandelte meine Mutter wie ein widerspenstiges Kind. Mutter ließ es sich gefallen und sagte immer: »Was würde ich nur ohne Martha anfangen?«
Die zweite Person, ohne die sie nichts anfangen konnte, war Dolly. Er kam häufig zu uns ins Haus.
In meiner überaus ungewöhnlichen Kindheit war nichts normal. Immer tat sich etwas Aufregendes, und ich wurde nie davon ausgeschlossen. Wenn ich andere Kinder mit ihren Kindermädchen brav im Park Spazierengehen sah, dauerten sie mich. Ihr Leben war ganz anders als meins. Sie waren die sprichwörtlichen Kinder, die man nur sehen und nicht hören durfte. Ich dagegen gehörte der aufregendsten Familie an, die es je gab. Meine Mutter war die berühmte Désirée. Wenn wir zusammen ausgingen, wurde sie von den Leuten bestaunt, und manche traten auf sie zu und sagten ihr, wie gut sie ihnen in diesem oder jenem Stück gefallen habe, und hielten ihr Programmhefte hin, um sich ein Autogramm geben zu lassen. Sie lächelte stets und plauderte mit ihnen, und sie waren ganz überwältigt, während ich stolz lächelnd dabeistand und mich in Désirées Ruhm sonnte.
Ich blieb abends immer wach, um sie heimkommen zu hören. Waren sie und Martha allein, ging ich zu ihnen hinunter. Sie setzten sich in die Küche und aßen belegte Brote, tranken Bier oder heiße Milch, je nach Lust und Laune. Sie lachten über ein Mißgeschick auf der Bühne oder über den alten Herrn im Publikum, der, wie Martha sich ausdrückte: » ’n Narren an der Gnädigen gefressen hat!«
Mathilda Grey hieß es nicht gut, daß ich mich zu ihnen gesellte, ließ es jedoch achselzuckend geschehen: Es war ein Meilenstein auf dem Weg zu dem Ziel, Lady Macbeth zu werden.
Manchmal kam meine Mutter sehr spät nach Hause, und ich wußte, daß Warten zwecklos war. Sie soupierte vielleicht mit Charlie Claverham oder Monsieur Robert Bouchère oder einem anderen Verehrer. Ich war dann jedesmal enttäuscht, bedeutete es doch, daß sie am nächsten Morgen lange schlafen und nur ganz wenig Zeit für unser Zusammensein bleiben würde, bevor sie ins Theater ging.
Dolly kam, wie gesagt, häufig zu uns ins Haus. Er und meine Mutter führten lange Unterredungen; sie stritten sich oft, was mich anfangs erschreckte, bis ich dahinterkam, daß die Plänkeleien nicht ernst gemeint waren.
Daß sie sich Schimpfnamen an den Kopf warfen, hätte beängstigend sein können, wenn ich das alles nicht schon öfter gehört hätte. Zuweilen marschierte Dolly aus dem Salon, knallte die Tür zu und verließ das Haus.
Wir andern saßen dann in der Küche und lauschten. Das ließ sich kaum vermeiden, selbst wenn wir es nicht gewollt hätten – was freilich nicht der Fall war.
»Hört sich diesmal schlimm an«, pflegte Mrs. Crimp dann wohl zu bemerken. »Aber er kommt zurück, dafür leg’ ich meine Hand ins Feuer.«
Und sie behielt jedesmal recht. Er kam zurück. Es folgte eine Versöhnung, und dann hörten wir die kräftige, reine Stimme meiner Mutter ein Lied aus dem neuen Stück probieren, das er für sie ausfindig gemacht hatte. Es folgten häufige Besuche, weitere Lieder wurden probiert, es gab nebenher vielleicht ein paar kleine Streitereien, aber nichts von Belang. Dann kamen die Proben, verbunden mit neuerlichen Wortgefechten, schließlich die Generalprobe und dann die Premiere.
Mrs. Crimp war in ihrem Element. Sie hatte eine Menge auszusetzen, aber es gehörte nun mal zu ihren größten Vergnügungen, alles zu kritisieren, was nicht nach ihrem Geschmack war. Der Name meiner Mutter zum Beispiel. »Désirée«, erklärte sie verächtlich. »Was für ’n Name, um sich damit ins Bett zu legen!« Was Jenny zu der Bemerkung veranlaßte, sie schätze, es gebe mehr als einen, der nichts dagegen hätte, sich mit so einem Namen ins Bett zu legen.
»Ich verbitte mir solche Reden in meiner Küche«, erklärte Mrs. Crimp streng. »Vor allem ...« Und es folgte ein vielsagendes Nicken in meine Richtung.
Ich wußte natürlich, worauf sie anspielten. Es machte mir nichts aus. Alles, was meine Mutter tat, war in meinen Augen vollkommen. Sie konnte nichts dafür, daß sich so viele Männer in sie verliebten.
Mrs. Crimp hatte ihre eigene Art, mit Namen umzugehen. Sie sprach sie so aus, wie sie nach ihrer Meinung ausgesprochen gehörten. Meine Mutter war »Daisy Ray«, und Robert Bouchère, der elegante Franzose, der so häufig bei uns zu Gast war, war »Missjöh Räuber«.
Auch ich war ein wenig verwundert über den Namen meiner Mutter, bis ich sie eines Tages danach fragte.
»Désirée ist mein Künstlername«, erklärte sie mir. »Ich bin nicht so getauft. Ich habe ihn mir selbst gegeben. Die Menschen haben ein Recht auf einen Namen ihrer Wahl, und wenn ihnen der nicht gefallt, den sie bekommen, warum sollen sie ihn nicht verändern? Findest du das nicht auch, Herzchen?«
Ich nickte eilfertig. Ich stimmte stets allem zu, was sie sagte. »Eines Tages mußt du es sowieso erfahren, da dies alles auch dich betrifft ... also hör zu, Liebes, ich erzähle dir, wie alles gekommen ist.«
Wir lagen auf ihrem Bett. Sie trug ein hellblaues Negligé. Ich war vollkommen angezogen, denn es war halb elf Uhr morgens. Ich war seit mehreren Stunden auf; sie hatte sich noch nicht erhoben. Um diese Tageszeit war sie immer besonders mitteilsam.
»Wie ist dein richtiger Name?« fragte ich.
»Kannst du ein Geheimnis für dich behalten?«
»O ja«, versicherte ich entzückt. »Ich liebe Geheimnìsse.«
»Mein richtiger Name ist Daisy. Insofern hat Mrs. Crimp den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich fand, der Name paßte nicht zu mir. Sehe ich etwa aus wie eine Daisy, ein Gänseblümchen?«
»Warum nicht? Das ist doch eine hübsche Blume.«
Sie rümpfte die Nase. »Daisy Tremaston.«
»Ich finde, das hört sich nett an, und wenn die Leute wüßten, daß es dein Name ist, würde es sich noch besser anhören.«
Sie küßte mich auf die Nasenspitze. »Das hast du hübsch gesagt, Liebes. Und das Hübscheste daran ist, daß du es ehrlich meinst. Nein, ich dachte, für die Bühne brauchte ich einen besonderen Namen ... einen, den man sich gut einprägen kann. Das ist wichtig. Auf die Verpackung kommt es an. Daran mußt du immer denken. Du könntest ein wahres Genie auf der Bühne sein, einfach umwerfend – aber wenn die Verpackung nicht stimmt, hast du es viel schwerer. Ich kann dir sagen, Liebes, um es in meinem Metier zu etwas zu bringen, brauchst du alles, was du bekommen kannst, Talent, Ausdauer, hie und da zur richtigen Zeit einen Schubs in die richtige Richtung von den richtigen Leuten.«
»Und die Verpackung?« erinnerte ich sie.
»Ganz recht.« Sie lachte anerkennend. Auch das gehörte zu ihren Gaben: den Menschen das Gefühl zu geben, daß ihre allergewöhnlichsten Bemerkungen ungemein klug seien.
»Désirée. Das hat etwas, nicht wahr, Liebes? Es bedeutet ›erwünscht‹. Das ist ein Wink an alle, die es hören. Diese Dame ist etwas Besonderes. Sag ihnen, daß du erwünscht bist, und mit ein bißchen Talent und etwas Glück hast du’s bald geschafft. Somit wurde ich Désirée für die Bühne, und dann habe ich den Namen ganz übernommen. Alles oder nichts. Sonst gibt’s bloß Kuddelmuddel!«
»Und du heißt nicht mehr Daisy.«
»Das ist verschlossen im Reich des Gestern. So hieß eines meiner ersten Lieder. Klingt gut, nicht?« Sie begann zu singen. Ich hörte sie für mein Leben gern singen.
Als das Lied von den Erinnerungen, die verschlossen waren im Reich des Gestern, zu Ende war, lenkte ich das Gespräch dorthin, wo ich es haben wollte. »Hat Dolly dir geholfen, den Namen ›Désirée‹ auszusuchen?«
»Dolly? Wo denkst du hin! Er wäre dagegen gewesen. Er findet, das sei nicht allererste Klasse. Typisch Dolly. Ich bin nicht immer mit ihm einverstanden, obwohl ich zugeben muß, daß er einen guten Riecher für erfolgversprechende Stücke hat. Nein, das war vor Dollys Zeiten, in den Tagen, als ich schwer zu kämpfen hatte. Ich könnte dir da ein paar Geschichten erzählen ...«
Ich kuschelte mich zurecht, um zuzuhören, aber es kam keine Geschichte. Es war bloß eine Redensart. Wenn sie von der Vergangenheit sprach, ging etwas mit ihr vor. Ich spürte, wie in ihrem Innern eine Jalousie heruntergelassen wurde. Einmal eröffnete sie mir, sie habe in einem Dorf in Cornwall das Licht der Welt erblickt.
»Erzähl mir von Cornwall«, bat ich sie. Ich wartete atemlos, denn meistens wechselte sie das Thema, wenn ich Näheres wissen wollte.
»Ach«, sagte sie mit verträumter Stimme, »das war nichts für mich. Schon als kleines Mädchen habe ich von London geträumt. Ich liebte es, wenn Fremde in das Dorfwirtshaus kamen. Es lag ein wenig abseits, doch hin und wieder fand sich jemand aus einer großen Stadt dort ein. Ein Herr aus London zum Beispiel. Der erzählte vom Theater. Da wußte ich, daß ich eines Tages nach London gehen würde. Ich wollte zum Theater.«
Sie schwieg, und ich fürchtete schon, sie würde das Thema wechseln.
»Es war dort so abgeschieden«, sagte sie. »Ich fühlte mich regelrecht eingesperrt. Alles war so verschlafen, wenn du weißt, was ich meine.«
»Ja, ja, ich weiß.«
»Zu viele alte Klatschweiber ... und -männer. Es gab nichts anderes zu tun, als auf die Sünden anderer zu achten. Das war ihre einzige aufregende Beschäftigung. Du würdest nicht glauben, wie viele Sünden sie in dem kleinen alten Heidedörfchen aufgespürt haben.«
»Die Heide muß wunderschön gewesen sein.«
»Rauh und öde war sie. Du hättest hören sollen, wie der Wind darüberbrauste. Die Gegend war einsam, fast menschenleer. Mit sechs Jahren hatte ich es satt. Und sobald ich wußte, was ich wollte, war ich nicht mehr zu halten. Ich habe das kleine Haus gehaßt. Beengt und finster war es. Morgens, mittags und abends Gebete, und sonntags zweimal in die Kirche. Der Gesang freilich gefiel mir. Vor allem die Weihnachtslieder. In einer Krippe, Hört die Verkündungsengel singen. Ich entdeckte, daß ich eine Stimme hatte. Großpa ermahnte mich, ich müsse mich vorsehen. Ich sei hochmütig. Ich müsse bedenken, daß alle Gaben von Gott kommen. Sie verführten zur Eitelkeit – und wehe dir, wenn der Tag des Jüngsten Gerichts kommt, und du hast dich der Eitelkeit anheimgegeben. Das würde dir nicht zur Ehre gereichen.«
Es war das erste Mal, daß ich von »Großpa« hörte, und ich wollte mehr erfahren.
»Hat er bei dir gewohnt?«
»Er würde sagen, ich habe bei ihm gewohnt. Sie haben sich meiner angenommen, als meine Mutter starb.«
Recht zaghaft fragte ich: »Und dein Vater auch?«
Ich wartete beklommen. Ich spürte, daß ich das Thema Väter behutsam angehen mußte. Es war mir nie gelungen, etwas über den meinen zu erfahren, außer daß er ein guter Mensch war, ein Vater, auf den ich stolz sein könne.
»Oh, er war nie da«, sagte sie wegwerfend. »Du hättest die Hütte sehen sollen: Fenster, durch die kaum Licht kam, Wellermauern – das ist eine Art Lehm. Die Hütten waren alle gleich. Zwei Kammern oben, zwei unten. Es ist ein Glück für dich, Noelle, in diesem Haus mitten in London zu leben. Was hätte ich nicht dafür gegeben, als ich so alt war wie du!«
»Aber später hast du es bekommen.«
»O ja, nicht wahr? Und dich, mein Engel, ich habe dich.«
»Dies Haus ist schöner als Großpas alte Hütte. Warum hast du ihn Großpa genannt?«
»So sagt man dort eben. Er hieß immer Großpa, wie alle Großväter. Die Sprechweise jener Gegend taugte nicht für die Londoner Bühne. Ich kann dir sagen, ich mußte einfach fort, Liebes. Wärst du dort gewesen, dann hättest du verstanden, warum.« Es war, als rechtfertige sie sich vor sich selbst.
»Ich bin oft in die Heide gegangen. Dort waren viele alte Steine – prähistorisch, sagten die Leute. Ich bin um sie herumgetanzt und habe aus vollem Hals gesungen. Es klang herrlich, und ich hatte ein himmlisches Gefühl von Freiheit. In der Schule habe ich Gesang geliebt. Nichts als Hymnen und Choräle. Aber ich habe auch andere Lieder aufgeschnappt. Auf zum Jahrmarkt, Eines frühen Morgens und Barbara Allen. Wenn ich ein neues Lied hörte, mußte i ch es einfach singen. Und wie ich das Tanzen geliebt habe! Singen, sofern es Psalmen und Choräle waren, war gestattet, aber Tanzen galt als liederlich, ausgenommen ländliche Tänze. Wenn der Pelzreigen getanzt wurde – das ist ein alter Cornwall-Tanz, ein Brauchtum, so daß sie nicht sagen konnten, es sei sündig –, dann war ich den ganzen Tag im Städtchen beim Tanz. Aber ich liebte es, in der Heide zu tanzen. Vor allem rund um die Steine. Bei bestimmtem Licht sahen sie aus wie junge Mädchen. Der Sage nach waren sie in Stein verwandelt worden. Das war bestimmt jemandem wie meinem Großpa zu verdanken. Wegen Tanz am Sonntag wahrscheinlich. Damals waren die Sonntage heilig. Ja, ich habe immer getanzt. Die Leute sagten, ich sei koboldswirr.«
»Was ist das?«
»Kobolde sind kleine Wesen, die dort in der Gegend alle möglichen Streiche spielen. Sie sind so etwas Ähnliches wie Elfen ... aber nicht gerade gutartig. Sie machen die Menschen wahnsinnig und stiften sie zu den merkwürdigsten Dingen an. Und das nennt man dann koboldswirr. Einmal bin ich zu der alten Hexe im Wald gegangen. Die Leute dort sind sehr abergläubisch. Sie glauben Dinge, von denen man in London nie etwas hört. Immer haben sie nach weißen Hasen Ausschau gehalten, die natürlich Unglück bedeuten, und nach Wichten in den Gruben, die Übles anrichteten, um jene, von denen sie beleidigt worden waren, zu warnen, daß es noch schlimmer kommen werde.«
»Es muß dort spannend zugegangen sein. Ich würde es gern einmal sehen.«
»Es gibt Orte, von denen sich spannend erzählen läßt, die aber unbehaglich sind, wenn man dort ist. Für mich gab es nur eines: Ich mußte fort.«
»Erzähl mir von der Hexe im Wald.«
»Sie kam aus einer Pillarfamilie. Angehörige von Pillarfamilien besitzen bestimmte Gaben, weil einer ihrer Vorfahren einmal einer gestrandeten Meerjungfrau ins Meer zurückgeholfen hat, und seither besitzen die Mitglieder dieser Familie die Gabe, in die Zukunft zu blicken. Es gibt dort auch jede Menge andere weise Leute. Die siebten Söhne von siebten Söhnen. Sie können sehen, was kommen wird. Dann gibt es noch die Füßlinge, das sind die, die mit den Füßen voran geboren wurden. Und allen diesen Menschen sagt man nach, daß sie die Gaben, die ihnen verliehen wurden, in der Familie weitervererben. Somit herrscht kein Mangel an diesen Neunmalklugen.«
»Das klingt wirklich aufregend.«
Sie ging achselzuckend darüber hinweg. »Meine Pillar sagte mir, ich könnte eine glänzende Zukunft haben. Es liege an mir. Es gebe zwei Wege. Wie gut ich mich erinnere! Ich höre sie noch heute. ›Zwei Wege stehn dir offen, liebes Kind, Nimmst du den einen, führt er dich zu Ruhm und Reichtum. Nimmst du den andern, hast du ein schönes, stilles Leben ... aber dann wirst du nie Frieden haben. Du wirst dir immer sagen, ach, hätte ich doch ... ‹«
»Und du hast die Straße zu Ruhm und Reichtum genommen. Ist das nicht phantastisch? Und wie klug von der Pillar!«
»Ach, weißt du, Liebes, so tiefsinnig war das gar nicht. Schließlich habe ich unentwegt gesungen und getanzt. Dort in der Gegend wissen alle, was alle andern tun. Man kann keine Geheimnisse bewahren. Ich muß wohl geredet haben. ›Ich geh’ nach London. Ich werd’ auf der Bühne singen und tanzen.‹ So etwas spricht sich herum. Aber sie hatte es gesagt, und da wußte ich, es mußte sein.«
»Was hat Großpa gesagt, als du fortgingst?«
»Ich war ja nicht mehr da, um es zu hören.« Sie lachte. »Ich kann es mir nur denken. Ich schätze, er ist zum Teufel gegangen und hat ihn gebeten, das Feuer zu schüren, damit es bei meiner Ankunft in der Hölle besonders heiß sei.«
»Du hast doch keine Angst, oder?«
Sie brach in Lachen aus. »Was, ich? Bestimmt nicht! Ich meine, wir sind auf der Welt, um uns zu amüsieren. Wir sind es nämlich, die in den Himmel kommen, nicht diejenigen, die den Menschen das Leben zur Hölle machen.«
»Wie bist du nach London gekommen?«
»Ich habe mich mitnehmen lassen, hier ein Stück, dort ein Stück. Unterwegs habe ich gearbeitet, meistens in Wirtshäusern. Ich habe ein bißchen Geld zusammengespart, und dann ging’s auf die nächste Etappe der Reise. Einmal arbeitete ich in einem Café nicht weit von hier. Dort verkehrten Leute vom Theater. Ein Mann – ein Stammkunde – zeigte Interesse für mich. Ich sagte ihm, ich wolle zur Bühne. Er versprach, zu sehen, was er tun könne. In meiner Freizeit ging ich zu den Theatern. Ich sah die Namen dort angeschlagen und sagte mir: Eines Tages, werde ich dort stehen.«
»Und du hast es geschafft.«
»O ja. Es hat allerdings eine Weile gedauert. Dieser Mann hat mich einem Agenten vorgestellt, der bei meinem Anblick nicht gerade aus dem Häuschen geriet. Er tat nur einem Freund einen Gefallen. Dann sang ich ihm vor, und obwohl er vorgab, nicht beeindruckt zu sein, merkte ich, daß eine Veränderung in ihm vorging. Er sah auf meine Beine, und ich führte ein paar Tänze vor. Er sagte, er würde mir Bescheid geben. Darauf bekam ich einen Platz in der letzten Reihe der Tanzgruppe. Es war ein gräßliches Stück, aber immerhin ein Anfang. Man riet mir, Tanzunterricht zu nehmen. Das habe ich getan. Viel war es nicht, aber der Anfang war gemacht.«
»Und dabei hast du Martha kennengelernt.«
»Das war ein Glückstag. Sie sagte: ›Du kannst mehr als das.‹ Als ob ich das nicht gewußt hätte! Mein Name gefiel ihnen nicht. Der reine Zungenbrecher, Daisy Tremaston. Der Agent schlug Daisy Ray vor. Ich muß jedesmal lachen, wenn Mrs. Crimp und die Mädchen mich so nennen. Daisy Ray, das geht einem leicht von der Zunge. Aber ist es ein Name, den die Leute sich einprägen? Dann kam es mir blitzartig. Daisy Ray ... Désirée. Ganz einfach. In diesem Metier kann man sich so etwas erlauben. So wurde ich Désirée.«
»Und du warst auf der Straße zu Ruhm und Reichtum.«
»Ach du liebe Güte! Was tust du, läßt mich reden und reden! Höchste Zeit, aufzustehen. Dolly wird jeden Moment hiersein.«
Ich bedauerte, daß das Gespräch zu Ende war. Aber mit jedem Mal erfuhr ich etwas mehr; allerdings mußte ich damit rechnen, daß ein Vorhang sich herabsenken konnte, wenn ich zu neugierig wurde. Am meisten aber wünschte ich mir, etwas über meinen Vater zu erfahren.
Ich war sechzehn und recht reif für mein Alter. Ich wußte eine Menge über das Theaterleben und ein wenig von der Welt. Im Haus herrschte ein stetes Kommen und Gehen von Leuten, die unaufhörlich redeten. War ich zugegen, hörte ich zu. Charlie Claverham und Robert Bouchère waren ständig bei uns zu Gast. Jeder von ihnen besaß ein Domizil in der Stadt, und Charlie hatte ein Heim in Kent, Robert eines in Frankreich. Sie hatten geschäftlich in London zu tun und waren meiner Mutter treu ergeben. Andere Verehrer kamen und gingen, diese aber blieben. Eines Tages kam Dolly in dieser besonderen Stimmung zu uns, die bedeutete, daß er ein exzellentes »Transportmittel« für Désirée gefunden hatte, wie er sich auszudrücken beliebte. Oft war das, was er für exzellent hielt, ihrer Meinung nach schlichtweg Humbug, und dann machten wir uns auf Ärger gefaßt.
Und den gab es denn auch. Ich setzte mich auf die Treppenstufen neben dem Salon und lauschte. Dazu mußte ich mich nicht etwa anstrengen. Ihre lauten Stimmen waren im ganzen Haus zu hören.
»Die Texte sind entsetzlich.« Das war meine Mutter. »Ich würde mich schämen, sie zu singen.«
»Sie sind entzückend und werden deinem Publikum gefallen.«
»Dann mußt du eine erbärmliche Meinung von meinem Publikum haben.«
»Ich kenne dein Publikum ganz genau.«
»Und deiner Ansicht nach ist es lediglich einen Mist wert.«
»Du mußt dir diese Idee aus deinem Köpfchen schlagen.«
»Wenn du eine so geringe Meinung von mir hast, dann finde ich, daß unsere Wege sich jetzt trennen sollten.«
»Meine Meinung von dir ist, daß du eine gute Singspiel-Darstellerin bist. Viele von deiner Sorte haben sich geschadet, weil sie sich einbildeten, zu gut für ihr Publikum zu sein.«
»Dolly, ich hasse dich.«
»Désirée, ich liebe dich, aber du bist ein Dummkopf, laß dir das von mir gesagt sein. Ohne mich wärst du noch immer in der letzten Reihe vom Ballett. Komm, sei ein braves Mädchen und sieh dir Maud noch einmal an.«
»Ich hasse Maud, und die Texte sind mir peinlich.«
»Du und peinlich! Dir ist in deinem Leben noch nie etwas peinlich gewesen! Glaub mir, im Vergleich zu Immer der Nase nach ist Maud eine große Oper!«
»So ein Unsinn!«
»Und der Titel ist gut. Komteß Maud. Das wird ihnen gefallen.
Alle werden die Komteß sehen wollen.«
»Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es.«
»Tja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als Lottie Langdon für die Rolle zu engagieren. Du wirst grün vor Neid, wenn du siehst, was sie daraus macht.«
»Lottie Langdon!«
»Warum nicht? Die Rolle würde gut zu ihr passen.«
»Ihre hohen Töne sind zittrig.«
»Das finden manche Leute besonders reizvoll. Sie werden die Handlung lieben. Das Ladenmädchen, das in Wirklichkeit die Tochter des Earls von Soundso ist. Das ist genau nach ihrem Geschmack. So, ich muß los ... zu Lottie.«
Eine Weile war es still.
»Na gut«, sagte Dolly schließlich. »Ich geb’ dir Zeit bis morgen früh. Dann wünsche ich eine klare Antwort. Ja oder nein.«
Er kam aus dem Salon. Als er fort war, ging ich nach oben in mein Zimmer. Ich wußte genau, daß meine Mutter sich bald in die Proben für Komteß Maud stürzen würde.
Ich behielt recht. Dolly kam häufig ins Haus. George Garland, der Klavierspieler, der meine Mutter immer begleitete, stand ständig parat, und das ganze Haus summte die Melodien aus Komteß Maud.
Dolly erschien jeden Tag mit neuen Ideen, die durchgefochten werden mußten. Martha flitzte herum, suchte und fand Schnittmuster und kaufte das Nötige ein. Dies war das Stadium, das uns allen vertraut war. Welche Erleichterung, wenn die Ängste, die während dieser Zeitspanne aufloderten, vorüber sein, die bösen Vorahnungen vor der Premiere sich als grundlos erweisen und wir uns auf eine lange Laufzeit einrichten würden.
Die Premiere rückte näher, und meine Mutter war in einem Zustand nervöser Spannung. Sie habe bei Komteß Maudvon vornherein ein unbehagliches Gefühl gehabt, erklärte sie; sie sei sich bei den Texten nicht sicher, und sie finde, sie sollte in der Eröffnungsszene Blau tragen, nicht Rosa. Ihr Kleid werde sich bestimmt mit den Kostümen des Balletts beißen; sie merke, daß sie ein wenig heiser werde. Was, wenn sie am Premierenabend eine Halsentzündung hätte?«
Ich sagte zu ihr: »Du malst dir sämtliche Katastrophen aus, die dir zustoßen könnten. Das machst du immer, und es ist nie eingetreten. Die Zuschauer werden dich lieben, und Komteß Maud wird einer deiner größten Erfolge.«
»Danke, Herzchen. Du bist mir ein Trost. Da fällt mir etwas ein: Ich kann heute abend unmöglich mit Charlie essen.«
»Ist er in London?«
»Er kommt heute an. Ich habe heute nachmittag Probe, und ich bin mit der Tanznummer mit Sir Garnett in der letzten Szene nicht zufrieden, wenn er singt, Ich würde dich lieben, und wärst du noch ein Ladenmädchen.«
»Was paßt dir nicht?«
»Ich finde, er müßte von der anderen Seite kommen ... und ich muß aufpassen, daß ich bei der schnellen Drehung am Schluß meine Federboa nicht verliere. Aber ich muß Charlie Bescheid geben. Magst du ihm ein Briefchen von mir überbringen, Liebling?«
»Natürlich. Wo wohnt er?«
Es kam mir plötzlich komisch vor, daß ich Charlies Londoner Adresse nicht kannte, obwohl wir so gut mit ihm befreundet waren. Wenn er in London war, war er ständig bei uns. Tatsächlich schien es zuweilen, als wohne er bei uns. Meine Mutter mochte ihn besucht haben, aber ich war nie dortgewesen. Mit Robert Bouchère war es dasselbe ... allerdings hatte er sein richtiges Heim in Frankreich.
Es war entschieden etwas Geheimnisvolles um diese zwei Männer. Sie kamen und gingen. Ich fragte mich oft, was sie wohl taten, wenn sie nicht bei uns waren.
Daher begrüßte ich nun die Gelegenheit, zu sehen, wo Charlie sein Londoner Domizil hatte.
Ich fand das Haus. Es war nahe beim Hyde Park, ein kleines Gebäude, typisch achtzehntes Jahrhundert, mit einer klassizistischen Tür und einem fächerförmigen Oberlicht.
Ich läutete. Ein adrettes Stubenmädchen öffnete. Ich fragte, ob Mr. Claverham zu sprechen sei.
»Soll es Mr. Charles Claverham sein, Miß, oder Mr. Roderick?«
»Oh, Mr. Charles, bitte.«
Sie führte mich in einen Salon, dessen Einrichtung zum Stil des Hauses paßte. Die schweren Samtvorhänge an den Fenstern harmonierten mit dem zarten Grün des Teppichs, und ich konnte nicht umhin, die schlichte Eleganz mit unserem eher gediegenen modernen Stil zu vergleichen.
Das Stubenmädchen kam nicht zurück. Statt ihrer trat ein junger Mann ins Zimmer. Er war groß und schlank, mit dunklen Haaren und freundlichen braunen Augen. »Sie wollten meinen Vater sprechen?« sagte er. » Leider ist er nicht zu Hause. Er wird erst am Nachmittag wieder hier sein. Kann ich Ihnen vielleicht dienen?«
»Ich habe einen Brief für ihn. Darf ich ihn Ihnen übergeben?«
»Aber natürlich.«
»Er ist von meiner Mutter, Désirée, wissen Sie.«
»Désirée? Ist das nicht die Schauspielerin?«
Konnte es sein, daß Charlie, einer der besten Freunde meiner Mutter, sie gegenüber seinem Sohn nicht erwähnt hatte?
»Ja«, sagte ich und gab ihm den Brief.
»Er wird ihn bekommen, sobald er zurück ist. Möchten Sie nicht Platz nehmen?«
Ich bin von jeher neugierig gewesen, und da es um meine eigene Herkunft etwas Geheimnisvolles gab, mutmaßte ich, daß es sich bei anderen ebenso verhalten könnte. Ich hatte immer so viel wie möglich erfahren wollen über die Menschen, denen ich begegnete, und heute war mein Interesse besonders groß. Daher nahm ich die Aufforderung nur zu gern an.
Ich sagte: »Seltsam, daß wir uns nicht schon früher begegnet sind. Meine Mutter und Ihr Vater sind gute Freunde. Ich kannte Ihren Vater schon, als ich ganz klein war.«
»Ach, wissen Sie, ich bin nicht oft in London. Ich habe soeben mein Studium beendet und werde mich wohl sehr viel auf dem Land aufhalten.«
»Ich habe von dem Landhaus gehört – in Kent, nicht wahr?«
»Ja. Kennen Sie Kent?«
»Ich weiß nur, daß es am unteren Zipfel der Landkarte ist.« Er lachte. »Das heißt wahrlich nicht Kent kennen. Es ist mehr als ein brauner Klecks auf der Landkarte.«
»Nun gut, ich kenne Kent nicht.«
»Sollten Sie aber. Die Grafschaft ist interessant. Aber das läßt sich wohl von jeder Gegend sagen, wenn man erst anfängt, sie zu erkunden.«
»Bei den Menschen ist es dasselbe.«
Er lächelte mich an. Ich hatte das Gefühl, daß er mich ebenso gern aufhalten wollte, wie ich zu bleiben wünschte, und er sich daher überlegte, welches Thema mich fesseln würde.
Ich sagte: »Der Beruf meiner Mutter erfordert es, daß wir die ganze Zeit in London sind. Entweder bereitet sie sich auf ein Stück vor, oder sie spielt in einem. Sie hat eine Menge Proben und dergleichen. Und dazwischen hat sie ihre Ruhezeiten. So nennen sie das, wenn sie warten, daß sich etwas tut.«
»Das muß hochinteressant sein.«
»Es ist spannend. Das Haus ist stets voller Menschen. Sie hat so viele Freunde.«
»Das kann ich mir denken.«
»Bald ist wieder eine Premiere. Im Moment sind wir in dem Stadium, wo sie gespannt ist, wie es laufen wird.«
»Das muß sehr aufregend sein.«
»O ja. Heute nachmittag hat sie etwas zu erledigen, und sie weiß nicht, wann sie fertig wird. Deshalb muß sie die Verabredung mit ...«
Er nickte. »Es war mir jedenfalls ein Vergnügen, Sie kennenzulernen.«
»Ihr Vater hat Ihnen bestimmt viel von ihr erzählt. Die Stücke interessieren ihn immer sehr. Er ist bei jeder Premiere zugegen.« Er machte ein leicht abwesendes Gesicht, und ich fuhr fort: »Sie werden sich also auf dem Land aufhalten, wenn Sie London verlassen?«
»O ja. Ich helfe auf dem Gutshof.«
»Auf dem Gutshof?«
»Es ist ein großer Landsitz ... mit Pächtern und so weiter. Wir müssen das alles verwalten. Das tut unsere Familie seit Jahrhunderten. Familientradition, Sie wissen schon.«
»Oh, ich verstehe.«
»Mein Großvater hat es getan, mein Vater hat es getan, und ich werde es auch tun.«
»Haben Sie Geschwister?«
»Nein, ich bin der einzige Sohn. Deshalb fällt es auf mich.«
»Ich nehme an, Sie tun es gern.«
»Natürlich. Ich liebe das Gut. Es ist mein Zuhause, und jetzt diese Entdeckung ... das ist sehr aufregend.«
»Eine Entdeckung?«
»Hat mein Vater es nicht erwähnt?«
»Ich erinnere mich nicht, daß er jemals von dem Gut gesprochen hätte. Vielleicht spricht er mit meiner Mutter darüber.«
»Bestimmt hat er ihr erzählt, was man dort gefunden hat.«
»Ich habe nichts gehört. Ist es ein Geheimnis? Dann werde ich nicht danach fragen.«
»Es ist kein Geheimnis. Die Zeitungen haben darüber berichtet. Es ist sehr aufregend. Es kam beim Umpflügen eines Feldes in Flußnähe ans Licht. Vor tausend Jahren reichte das Meer bis an unsere Ländereien heran. Im Laufe der Jahrhunderte ist das Wasser nach und nach zurückgegangen, und jetzt sind wir zweieinhalb Kilometer vom Meer entfernt. Das Aufregende aber ist, daß die Römer dort eine Art Hafen hatten, wo sie Vorräte anlandeten, und ringsum befand sich natürlich eine Siedlung. Wir haben eine ihrer Villen ausgegraben. Eine phantastische Entdeckung.«
»›Rom allein bleibt bestehen‹«, sagte ich.
»Ja, allerdings. Wir befinden uns auf dem Land der Römer. Schließlich sind sie zuerst in Kent gelandet, nicht? Ich kenne die Stelle in Deal, nur ein paar Kilometer von uns entfernt. Dort gibt es eine Gedenktafel mit der Aufschrift HIER LANDETE JULIUS CAESAR 55 A. D.«
»Wie aufregend!«
»Wenn man dort steht, kann man sich vorstellen, wie die Römer an Land gingen, zum Erstaunen der am ganzen Körper blau angemalten Bretonen. Die Armen! Aber letzten Endes wurde alles gut. Sie haben soviel für Britannien getan. Sie können sich vorstellen, wie aufgeregt wir waren, als wir Beweise fanden, daß sie auf unserem Grund gewesen sind!«
»Sie waren wohl ganz aus dem Häuschen, nicht?«
»Und ob. Zumal ich ein wenig Archäologie studiert habe. Eigentlich nur aus Liebhaberei. Eine Zeitlang hätte ich es wohl gern zu meinem Beruf gemacht, aber ich wußte, was ich zu tun hatte. Noblesse oblige, Sie wissen schon.«
»Aber Sie wären lieber Archäologe geworden?«
»Eine Weile, ja. Aber dann besann ich mich, daß dieser Beruf mit Enttäuschungen befrachtet ist. Man träumt davon, wundersame Entdeckungen zu machen ... aber das meiste ist Graben und Hoffen. Auf einen Triumph kommen tausend Enttäuschungen. Wir haben nichts gefunden als ein paar Tonscherben und hofften, daß sie Jahrhunderte alt seien und aus einem römischen oder angelsächsischen Haus stammten, doch dann stellte sich heraus, daß irgendeine Hausfrau sie vor ein paar Monaten fortgeworfen hatte!«
Ich lachte. »So ist das Leben.«
»Ganz recht. Aber ich rede die ganze Zeit von mir. Ich glaube, das zeugt von einem erschreckenden Mangel an Anstand.«
»Nicht, wenn der Angesprochene interessiert ist, und das bin ich ungemein. Erzählen Sie mir von Ihrem Landhaus.«
»Es ist uralt.«
»Das habe ich schon mitbekommen ... Generationen von Clavenhams, die auf dem Gut ihre Pflicht erfüllt haben.«
»Manchmal glaube ich, daß Häuser Familien beherrschen können.«
»Indem sie solchen Familienmitgliedern Pflichten auferlegen, die nicht sicher sind, ob sie nicht lieber die Vergangenheit ausgraben würden?«
»Ich werde mich vorsehen müssen, was ich Ihnen erzähle. Sie haben ein zu gutes Gedächtnis.«
Ich war sehr erfreut, glaubte ich doch die Andeutung herauszuhören, unsere Begegnung werde nicht die letzte sein.
»Einige Trakte des Hauses sind wirklich sehr alt – zum Teil angelsächsisch, aber vieles ist natürlich bei den Restaurierungen verlorengegangen, die im Laufe der Jahre notwendig wurden.«
»Spukt es dort?«
»Nun ja, mit Häusern, die so lange bestehen, sind immer Legenden verknüpft. Da haben sich natürlich nach und nach ein paar Gespenster eingefunden.«
»Ich würde das Haus gern einmal sehen.«
»Das müssen Sie unbedingt. Ich möchte Ihnen die römischen Funde zeigen.«
»Wir machen nie Besuche«, erklärte ich.
»Wie merkwürdig. Wir haben sehr oft Hausgäste. Meine Mutter ist eine passionierte Gastgeberin.«
Ich war überrascht. Ich hätte nicht gedacht, daß es eine Mrs. Claverham gab. »Mrs. Claverham ist wohl nicht oft in London, nehme ich an?«
»Eigentlich nennt man sie Lady Constance. Ihr Vater war ein Earl, und sie führt den Titel weiter.«
»Lady Constance Claverham«, murmelte ich.
»So ist es. Sie macht sich nicht viel aus London. Sie kommt nur gelegentlich hierher, um Kleider und dergleichen einzukaufen.«
»Ich glaube nicht, daß sie schon bei uns war. Das müßte ich wissen. Ich bin immer zu Hause.«
Ich merkte, daß er die Situation ziemlich merkwürdig, wenn nicht gar mysteriös fand.
»Bei uns zu Hause gehen so viele Leute ein und aus«, fuhr ich fort. »Besonders in Zeiten wie jetzt, wenn ein neues Stück vorbereitet wird.«
»Es muß aufregend sein, eine berühmte Mutter zu haben.«
»Ja, sehr. Sie ist der wunderbarste Mensch, den ich kenne. Alle lieben sie.«
Ich schilderte ihm, wie es zuging, wenn ein Stück herauskam. Ich erzählte ihm von dem Lärm, wenn gesungen und geprobt wurde; denn es gab immer Szenen, die meine Mutter mit bestimmten Leuten durchgehen wollte, und sie bestellte sie dafür gern ins Haus.
»Wenn sie eine Rolle spielt, wird sie gewissermaßen diese Person, und daran müssen wir uns alle gewöhnen. Im Augenblick ist sie Komteß Maud.«
»Und wer ist diese Komteß Maud?«
»Sie ist eine Verkäuferin, die in Wirklichkeit eine Komteß ist, und sie kann nicht die geringste Bemerkung machen, ohne in Gesang zu verfallen.«
Er lachte. »Dann ist es wohl eine Art Singspiel?«
»Das ist die Stärke meiner Mutter. Sie macht kaum etwas anderes. Es ist genau das Richtige für sie. Tanzen und Singen beherrscht sie perfekt. Ich bin froh, wenn Maud anläuft. Sie ist vorher immer so schrecklich nervös, obwohl sie und wir alle wissen, daß sie am Premierenabend wundervoll sein wird. Danach spielt es sich ein, und nach einer gewissen Zeit langweilt es sie ein bißchen. Dann wird das Stück abgesetzt, und alles beginnt von vorn. Ich mag die Ruhezeiten. Dann sind wir öfter zusammen und haben viel Spaß miteinander, bis sie unruhig wird und Dolly mit einem neuen Stück aufkreuzt.«
»Dolly?«
»Donald Dollington. Sie haben bestimmt von ihm gehört.«
»Der Schauspieler?«
»Ja, Schauspieler-Agent. Ich glaube, er produziert jetzt mehr und steht nicht mehr so oft auf der Bühne.«
Auf dem Kaminsims schlug eine Uhr.
Ich sagte: »Ich bin schon fast eine Stunde hier. Dabei war ich nur gekommen, um einen Brief abzugeben.«
»Es war eine sehr angenehme Stunde.«
»Zu Hause werden sie sich fragen, wo ich bleibe. Ich muß gehen.«
Er nahm meine Hand und hielt sie ein paar Sekunden fest. »Es war mir ein Vergnügen, Sie kennenzulernen«, sagte er. »Ich bin froh, daß Sie kamen, um den Brief abzugeben.«
»Ich nehme an, da Sie nun in London sind, wird Ihr Vater Sie einmal mit zu uns bringen.«
»Das würde mich freuen.«
»Sie müssen zur Premiere von Komteß Maud kommen.«
»Ich werde dasein.«
»Also bis dann.«
»Ich begleite Sie nach Hause.«
»Oh, es ist nicht weit.«
»Ich bestehe darauf.«
Da ich seine Gesellschaft genoß, machte ich keine weiteren Einwendungen. Als wir zu Hause ankamen, bat ich ihn herein.
»Ich freue mich darauf, Ihre Mutter kennenzulernen«, sagte er.
»Sie scheint bezaubernd zu sein.«
»Das ist sie«, versicherte ich ihm.
Als wir in die Diele traten, hörte ich Stimmen im Salon. »Sie ist zu Hause«, sagte ich. »Sie hat Besuch. Aber kommen Sie.«
Meine Mutter hatte mich gehört. Sie rief: »Bist du’s, Liebling? Komm, sieh, wer hier ist.«
»Soll ich ...?« murmelte Roderick Claverham.
»Aber sicher. Bei uns sind immer Leute im Haus.«
Ich öffnete die Tür.
»Dein Botengang wäre gar nicht nötig gewesen«, erklärte meine Mutter.
Neben ihr auf dem Sofa saß Charlie. Er starrte meinen Begleiter an und wurde schrecklich verlegen.
»Ich habe Charlie soeben erzählt, daß ich ihm einen Brief geschrieben habe und daß du fortgegangen bist, um ihn abzugeben«, erklärte meine Mutter.
Sie lächelte Roderick zu und wartete, daß er ihr vorgestellt würde.
»Désirée, das ist mein Sohn Roderick«, sagte Charlie.
Sie erhob sich, ergriff seine Hand, lächelte ihn an und sagte ihm, sie sei entzückt, ihn kennenzulernen.
Aber es entging mir nicht, daß es eine peinliche Situation war. Und ich war schuld daran, weil ich die Begegnung zwischen Charlie und seinem Sohn in unserem Haus herbeigeführt hatte. Meine Mutter verstand sich sehr gut darauf, peinliche Situationen zu überbrücken. Ich hatte das Gefühl, in einer Szene eines Theaterstücks mitzuwirken. Die Unterhaltung war recht gestelzt, und eine Weile schien Charlie außerstande, zu sprechen. Meine Mutter hatte gerade gesagt: »Wie nett, Sie kennenzulernen. Bleiben Sie länger in London? Das Wetter ist zur Zeit recht angenehm. Ich liebe den Frühling, Sie nicht?«
Ich merkte ihr an, daß sie die Situation genoß. Sie schlüpfte mühelos in die Rolle, die das Stück von ihr verlangte.
Ich sagte zu Charlie: »Ich habe von den wunderbaren Entdeckungen auf Ihrem Gut gehört.«
»O ja, ja«, sagte Charlie. »Sehr, sehr interessant.«
Meine Mutter wollte unbedingt mehr darüber hören. Sie meinte, das sei ja phantastisch, und sie seien gewiß sehr stolz, und was für eine wundervolle Vorstellung es sei, etwas zu finden, das die ganze Zeit dort war.
Dann fragte sie Roderick, ob er ein Glas Sherry oder sonst etwas möge. Er lehnte ab und meinte, er müsse wirklich gehen, und es sei ihm ein Vergnügen gewesen, uns kennenzulernen.
»Es ist zum Lachen«, sagte meine Mutter. »Da schicke ich Ihrem Vater einen Brief, dabei war er auf dem Weg hierher.«
Kurz danach verabschiedeten sich Charlie und sein Sohn.
Als sie fort waren, streckte Mutter sich auf dem Sofa aus und schnitt mir eine Grimasse.
»Ach du lieber Himmel«, sagte sie, »was haben wir da bloß angerichtet?«
»Wieso?« fragte ich.
»Laß uns beten, daß es der gestrengen Lady Constance nicht zu Ohren kommt.«
»Ich habe heute morgen erfahren, daß sie Charlies Frau ist. Ich hätte nie gedacht, daß Charlie eine Ehefrau hat.«
»Die meisten Männer haben eine ... sie steckt irgendwo.«
»Und Lady Constance steckt in dieser wunderbaren alten Residenz mit den römischen Ruinen.«
»Ich könnte mir vorstellen, daß sie selber wie eine alte römische Matrone ist.«
»Und wie sind die?«
»Oh – sie gehören zu den Frauen, die alles wissen, alles können, nie etwas falsch machen, sämtliche Regeln beachten und dasselbe von allen andern erwarten ... und höchstwahrscheinlich gewöhnlichen Sterblichen das Leben schwermachen.«
»Charlie hat dir bestimmt von ihr erzählt.«
»Ich wußte, daß es eine Lady Constance gab, das ist alles. Der junge Mann ist nett. Er ist nach Charlie geraten, schätze ich.«
»Charlie ist einer deiner besten Freunde, und er hat dir nie Näheres über seine Frau erzählt!«
Sie sah mich an und lachte. »Nun ja, es ist ein bißchen vertrackt. Lady Constance würde eine Freundschaft ihres Gatten mit einer flatterhaften Schauspielerin niemals dulden, nicht wahr? Deshalb hat sie nie von mir gehört, und deshalb reden wir nicht von ihr!«
»Aber wenn Charlie so oft nach London kommt ...«
»Geschäftlich, mein Liebling. Viele Männer werden durch ihre Geschäfte von daheim ferngehalten. Nun, und ich bin eben ein Teil von Charlies Geschäften.«
»Du meinst, sie hätte etwas dagegen, daß er hierherkommt, wenn sie es wüßte?«
»Darauf kannst du wetten.«
»Und jetzt weiß es ihr Sohn.«
»Ich hätte dich nicht bitten sollen, den Brief zu überbringen. Das wurde mir klar, kaum daß du fort warst. Ich hatte gedächt, du würdest ihn einfach nur abgeben.«
»Das wollte ich ja, aber das Hausmädchen hat mich in den Salon geführt. Ich erwartete, daß Charlie dasein würde, aber dann kam Roderick. Tut mir leid, es war meine Schuld.«
»Aber nein, natürlich nicht. Wenn jemand Schuld hatte, dann ich, weil ich dich geschickt habe. Komm. Grämen wir uns nicht deswegen. Charlie ist kein Kind. Und dieser Roderick auch nicht. Er wird es verstehen.«
»Was verstehen?«
»Oh ... er wird diskret sein, der junge Mann. Er wird die Situation erfassen. Ich fand ihn sehr nett.«
»Ich fand ihn auch nett«, sagte ich.
»Charlies Sohn muß einfach nett sein. Schließlich ist Charlie ein netter Mensch. Schade, daß er ausgerechnet mit der gestrengen Lady Constance verheiratet sein muß. Das ist vielleicht der Grund, weswegen er ...«
»Weswegen was?«
»Weswegen er hierherkommt, Liebes. Aber es ist nur ein Sturm im Wasserglas. Keine Sorge, Liebes. Roderick wird den Mund halten, und Charlie wird den Schrecken darüber verwinden, daß seine zwei Leben sich für ein paar Minuten berührt haben. Und dann wird alles sein wie vorher.«
Allmählich begriff ich, und ich fragte mich, ob es wirklich sein würde wie vorher.
Roderick Claverhams Besuch in unserem Hause und Charlies Reaktion waren bald vergessen, denn die Premiere von Komteß Maud stand vor der Tür. Das ganze Haus befand sich im Chaos: Fieberhafte Befürchtungen, spontane letzte Entschlüsse, dies und jenes zu ändern, grimmige Weigerungen seitens Désirée, leidenschaftliche Appelle von Dolly, lautstarke Vorwürfe von Martha. Nun gut, das war alles schon dagewesen.
Und dann der Abend selbst. Der Tag, der ihm vorausging, war von besonders großer Spannung beherrscht; mal mußte meine Mutter unbedingt allein sein, dann verlangte sie plötzlich nach uns. Sie war beunruhigt. Sollte sie die kleine Szene am Ende des ersten Aktes ändern? Konnte sie in diesen Kulissen etwas anderes probieren? Freilich war es zu spät. Oh, wie dumm von ihr, nicht früher daran gedacht zu haben. War das Kleid, das sie im ersten Akt trug, zu eng, zu weit, zu offenherzig oder schlicht langweilig? Dieses Stück werde ihr Ende bedeuten. Wer würde sie nach diesem Fiasko noch sehen wollen? Es war ein lächerliches Stück. Wer hatte je davon gehört, daß eine Komteß hinter der Theke einer Stoffhandlung bediente!
»Eben deshalb wurde ein Stück daraus«, rief Martha. »Es ist ein gefälliges Stück, und durch dich wird es großartig – das heißt, wenn du endlich mit deinen Anfällen aufhörst.«
Dolly schlich umher und nahm dramatische Posen ein, er faßte sich an den Kopf und flehte Gott an, es ihm zu ersparen, jemals wieder mit dieser Frau zu arbeiten.
»Allmächtiger Gott«, rief er. »Warum hast du mich nicht Lottie Langdon nehmen lassen?«
»Ja, lieber Gott, warum nicht?« sagte meine Mutter. »Diese alberne Komteß Maud hätte gut zu ihr gepaßt.«
Dann nahm Dolly eine Garrick-Pose ein und rief mit der Resignation eines Pontius Pilatus: »Ich wasche meine Hände in Unschuld.« Und mit einer entsprechenden Gebärde wandte er sich zur Tür.
Er meinte es natürlich nicht ernst, aber von der dramatischen Szene mitgerissen, flehte meine Mutter: »Geh nicht fort. Ich will alles spielen ... alles, was du von mir verlangst ... sogar die Maud.«
Und so ging es weiter. Früher hatte ich wohl geglaubt, es würde in einer Katastrophe enden, aber jetzt wußte ich, sie waren alle viel zu routiniert, um es so weit kommen zu lassen. Sie meinten nicht, was sie sagten. Es diente dazu, das Schicksal versöhnlich zu stimmen. Theaterleute waren die abergläubischsten Menschen auf Erden: Sie sagten nicht im vorhinein: »Dies wird ein großer Erfolg«, weil sonst das Schicksal, dieses perverse Geschöpf, dafür sorgen würde, daß der Erfolg ausblieb. Es wäre arrogant zu denken, daß es von einem selbst abhing. Wenn man aber sagte, es würde ein Mißerfolg, so höhnte das Schicksal: »Von wegen – es wird ein Erfolg.«
Endlich saß ich mit Charlie und Robert Bouchère in einer Loge im Theater und sah auf die Bühne hinunter. Der Vorhang ging vor der Stoffhandlung auf. Es wurde gesungen und getanzt, und plötzlich teilte sich die Reihe der Mädchen, und hinter der Theke stand Désirée, entzückend anzusehen in dem Kleid, das weder zu eng noch zu weit, weder zu offenherzig noch schlicht langweilig war.
Die Zuschauer brachen in den heftigen Applaus aus, der sie stets begrüßte, wenn sie auftrat, und bald sang sie Womit kann ich dienen, Madam?, bevor sie hinter der Theke hervorkam und auf ihre unnachahmliche Art über die Bühne tanzte.
Dolly kam in der Pause in die Loge. Er meinte, dem Publikum scheine es zu gefallen, und mit Désirée könne es nicht mißlingen. Sie habe die Zuschauer vom Augenblick ihres Auftretens an in ihren Bann gezogen.
»Dann tut es Ihnen am Ende doch nicht leid, daß Sie Lottie Langdon nicht genommen haben.« Ich konnte mir die Bemerkung nicht verkneifen.
Er warf mir diesen spöttischen Blick zu, der besagte: Du solltest unterdessen wissen, wie das alles gemeint war.
Er verließ uns, und wir setzten uns zureeht, um den letzten Akt zu genießen.
Bevor das Licht ausging, sah ich, daß unten im Parkett jemand versuchte, meine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ich mußte innerlich lachen. Es war Roderick Claverham. Ich hob meine Hand und lächelte zum Zeichen, daß ich ihn bemerkt hatte. Er erwiderte das Lächeln. Charlie unterhielt sich mit Robert Bouchere über das Stück und hatte seinen Sohn offensichtlich nicht gesehen. Ich machte ihn nicht darauf aufmerksam, daß Roderick im Theater war. Ich hatte eine Lektion gelernt. Und ich fragte mich, ob Roderick begriffen hatte.
Der Vorhang ging auf, und wir sahen Désirée in der letzten Szene, in der der aristokratische Bräutigam erklärt: Ich würde dich lieben, und wärst du noch ein Ladenmädchen.« Und Désirée antwortete mit ihren gelungensten hohen Tönen.
Es war vorüber. Das Publikum war begeistert. Désirée kam auf die Bühne, geführt von dem Mann, der sie lieben würde, und wäre sie noch ein Ladenmädchen. Er küßte ihre Hand und dann, zum Entzücken des Publikums, ihre Wange. Blumen wurden überreicht, und Désirée richtete ein paar Worte an die Zuschauer.
»Ihr lieben, lieben Leute ... Sie sind zu gütig. Das habe ich nicht verdient!«
»Doch, doch«, kam es aus dem Zuschauerraum.
Sie hielt in gespielter Bescheidenheit die Hand in die Höhe und versicherte den Zuschauern, sie kenne keine größere Freude, als für sie zu spielen. »Ich wußte, daß Sie Maud lieben würden. Ich liebte sie vom ersten Augenblick an, als ich sie kennenlernte.«
Ich hörte im stillen ein Echo: »Dieses blödsinnige Geschöpf, warum muß ich so ein Dummchen spielen?« Es gehörte alles zu der Schauspielerei, die ihr Leben war.
Die Leute strebten den Ausgängen zu. Noch einmal fing ich im Gedränge einen Blick von Roderick auf, der mir zulächelte. Ich sah zu Charlie hinüber. Er hatte seinen Sohn noch immer nicht gesehen.
Danach ging ich mit Charlie und Robert Bouchère in Désirées Garderobe. Martha half ihr, sich rasch umzuziehen. Man trank Champagner.
Désirée gab Dolly einen Kuß und sagte: »Ich hab’s geschafft.« Dolly sagte: »Du warst fabelhaft, Liebling. Hab’ ich’s dir nicht gleich gesagt.«
»Ich habe gespürt, wie sehr es den Zuschauern gefallen hat.«
»Du hast ihnen gefallen.«
»So ein reizendes Publikum!«
»Du bist aber auch wirklich großartig.«
»Danke, Süßer. Sag’s noch einmal. Ich höre es zu gern. Und da ist ja meine Noelle. Wie fandest du deine Mutter, Herzchen?«
»Du warst einfach phantastisch.«
»Du bist so lieb, Süßes.«
Robert sagte mit seinem amüsanten französischen Akzent: »Ist sie – Noelle – schon alt genug, um Champagner zu trinken, ah?«
»Heute abend ausnahmsweise«, sagte meine Mutter. »Kommt, ihr Lieben. Trinken wir auf eine gute Laufzeit – nicht zu lang. Ich glaube nicht, daß ich Maud sehr lange ertragen kann. Nur gerade genug, um sie zum Erfolg zu führen und bis zum Schluß ein volles Haus zu haben. Und möge sie wissen, wann die rechte Zeit ist, uns zu verlassen.«
Wir tranken auf Maud. Ungefähr eine halbe Stunde später fuhr Thomas uns nach Hause. Er hatte mit der Kutsche auf uns gewartet. Bevor wir uns trennten, gab es noch etliche weitere Küsse und Glückwünsche; in der Kutsche waren dann nur noch Martha, Mutter und ich. Auf den Straßen war nicht viel Betrieb, denn die Menge zerstreute sich rasch.
»Du bist gewiß völlig erschöpft«, sagte ich zu meiner Mutter.
»O ja, mein Liebes, und ob. Ich werde bis morgen nachmittag durchschlafen.«
»Beruhigt, weil Maud ein großer Erfolg war«, meinte ich.
»Natürlich, und ich hab’s von Anfang an gewußt, Liebling«, sagte meine Mutter.
Martha sah mich mit hochgezogenen Augenbrauen an.
»Oh, kurz vorher ist man immer nervös«, verteidigte sich meine Mutter. »Das muß so sein. Wäre man das nicht, könnte man auf der Bühne glatt scheitern. So ist nun mal das Leben, Liebling.« Als wir vor unserem Haus vorfuhren, bemerkte ich ein Mädchen. Sie stand bei einem Laternenpfahl, aber ich konnte ihr Gesicht sehen. Sie wirkte ziemlich bedrückt, und ich fragte mich, warum sie um diese nächtliche Stunde dort stand.
Meine Mutter sagte gerade: »Oh, ich bin vollkommen ermattet, und Womit kann ich dienen, Madam geht mir dauernd im Kopf herum.«
Thomas war vom Kutschbock gesprungen und hielt den Wagenschlag auf. Meine Mutter stieg aus. Ich sah das Mädchen einen Schritt vorwärts tun. Ihr Gesicht war angespannt. Bevor ich aus der Kutsche steigen konnte, lief sie hastig davon.
»Hast du das Mädchen gesehen?« fragte ich.
»Welches Mädchen?«
»Das da drüben stand. Es sah aus, als würde sie dich beobachten.«
»Um einen Blick auf die Komteß Maud zu werfen, schätze ich«, sagte Martha.
»Vielleicht. Aber sie kam mir irgendwie merkwürdig vor.«
»Wohl eine von diesen Theaterbesessenen«, meinte Martha.
»Hält sich für eine zweite Désirée. So sind sie alle.«
»Kommt jetzt«, sagte meine Mutter. »Sonst bin ich halb eingeschlafen, bevor wir im Haus sind.«
Ich wußte, daß uns das Einschlafen schwerfallen würde, wie immer nach einer Premiere. Aber in dieser Nacht war es anders als sonst. Das lag an zweierlei: an Rodericks Anwesenheit im Theater, die mich abermals veranlaßte, über Charlie, Lady Constance und Charlies Beziehung zu meiner Mutter nachzudenken, und an dem Mädchen auf der Straße. Warum beschäftigte sie mich so? Es standen oft Leute herum, um einen Blick auf meine Mutter zu erhaschen; sie warteten vor dem Theater und gelegentlich vor unserem Haus, denn die Presse hatte verraten, wo Désirée wohnte. Wie Martha gesagt hatte, das Mädchen mußte theaterbesessen gewesen sein: Sie hatte Désirée aus nächste Nähe sehen wollen. Ich hätte beruhigt sein sollen. Die Premiere war vorüber. Eine lange Laufzeit würde folgen, und meine Mutter würde mehr Zeit für mich haben.
Der Unfall
Komteß Maud hatte sich eingespielt – ein weiterer Erfolg für Désirée.
Es war etwa drei Wochen nach der Premiere, an einem Donnerstag. Meine Mutter war zu einer Nachmittagsvorstellung ins Theater gefahren. Ich wollte ein paar Einkäufe erledigen und nach der Vorstellung ins Theater kommen, dann könnte Thomas uns zusammen nach Hause fahren. So hielten wir es öfter. Es verschaffte uns ein wenig Zeit miteinander, bevor meine Mutter zur Abendvorstellung enteilte.
Als ich das Haus verließ, kam Roderick Claverham die Straße entlang.
»Guten Morgen«, sagte er. Wir standen uns ein paar Sekunden gegenüber und lächelten uns an.
Ich fand als erste die Sprache wieder. »Sie sind also noch in London?«
»Ich war unterdessen zu Hause, und jetzt bin ich wieder hier.«
»Was machen die Ausgrabungen?«
»Keine weiteren Entdeckungen. Das würde mich auch wundern. Ich hatte gehofft, Sie zu sehen. Ich bin in dieser Absicht schon ein –, zweimal hergekommen. Diesmal habe ich Glück.«
Er hatte also nach mir Ausschau gehalten. Das stimmte mich froh.
»Wollten Sie uns besuchen?« fragte ich.
»Ich dachte, unter den gegebenen Umständen sei es vielleicht nicht erwünscht, habe ich recht?«
»Vielleicht.«
»Wohingegen eine zufällige Begegnung ...«
» ... freilich etwas anderes wäre.«
»Wollten Sie ausgehen?«
»Nur Einkäufe machen.«
»Darf ich Sie begleiten?«
»Es würde Sie langweilen.«
»Das glaube ich nicht.«
»Es sind keine notwendigen Besorgungen. Anschließend wollte ich zum Theater und mit meiner Mutter nach Hause fahren.«
»Vielleicht kann ich Sie zum Theater begleiten?«
»Die Vorstellung ist erst in zwei Stunden zu Ende.«
»Dann lassen Sie uns ein wenig Spazierengehen. Sie könnten mir diese Gegend von London zeigen. Vielleicht trinken wir irgendwo eine Tasse Tee? Oder finden Sie das langweilig?«
»Ganz im Gegenteil.«
»Schön, wo fangen wir an?«
»Sie sind natürlich an der Vergangenheit interessiert«, sagte ich, als wir uns auf den Weg machten. »Ich glaube nicht, daß wir hier etwas so Altes haben wie Ihre römischen Ruinen. Meine Gouvernante kennt sich in dieser Gegend sehr gut aus. Sie interessiert sich für alles, was irgendwie mit dem Theater zu tun hat.«
»Vielleicht, weil sie in einem Theaterhaushalt tätig ist.«