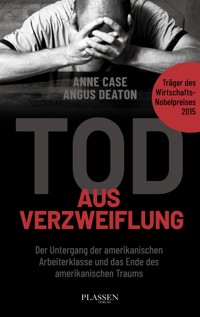
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Plassen Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der "American Dream" ist im Niedergang begriffen. Für die weiße Arbeiterklasse ist das heutige Amerika zu einem Land der zerrütteten Familien und der mangelnden Perspektiven geworden. Während College-Absolventen immer gesünder und wohlhabender werden, sterben Erwachsene ohne Abschluss immer häufiger an Alkohol, Drogen und Suizid – ein Tod aus Verzweiflung. Die wachsende Macht der Konzerne und ein skrupelloser Gesundheitssektor sind nur zwei der Gründe. Der Kapitalismus, der in zwei Jahrhunderten unzählige Menschen aus der Armut befreite, zerstört nun das Leben der amerikanischen Arbeiter. Die renommierten Ökonomen Anne Case und Angus Deaton legen diese Misere in ihrem Buch schonungslos offen. Drohen auch uns amerikanische Verhältnisse? Die Autoren geben brandaktuelle Antworten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 516
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ANNE CASEANGUS DEATON
TODAUSVERZWEIFLUNG
Der Untergang der amerikanischen Arbeiterklasse und das Ende des amerikanischen Traums
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
DEATHS OF DESPAIR AND THE FUTURE OF CAPITALISM
ISBN 978-0-691-19078-5
Copyright der Originalausgabe 2020:
Copyright© 2020 by Princeton University Press.
Copyright für das Vorwort zur amerikanischen Taschenbuchausgabe 2021:
Copyright© 2021 by Princeton University Press.
Epigraf auf Seite 125 aus „In a Time” aus Just Give Me a Cool Drink of Water ‘Fore I Diiie: Poems by Maya Angelou. Copyright © 1971 by Maya Angelou. Used by permission of Little, Brown Book Group Limited and Random House, an imprint and division of Penguin Random House LLC.
All rights reserved.
Copyright der deutschen Ausgabe 2022:
© Börsenmedien AG, Kulmbach
Übersetzung: Petra Pyka
Gestaltung Cover: Karl Spurzem
Gestaltung, Satz und Herstellung: Timo Boethelt
Lektorat: Sebastian Politz
ISBN 978-3-86470-769-8
eISBN 978-3-86470-770-4
Alle Rechte der Verbreitung, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe und der Verwertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen vorbehalten.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
Postfach 1449 • 95305 Kulmbach
Tel: +49 9221 9051-0 • Fax: +49 9221 9051-4444
E-Mail: [email protected]
www.plassen.de
www.facebook.com/plassenbuchverlage
www.instagram.com/plassen_buchverlage
Für Julian, Celestine, Lark, Andrew, Ryan, James, John, Marie und Will
Auf dass sie eine gerechtere Welt mit weniger Verzweiflung erleben dürfen.
INHALT
Vorwort zur amerikanischen Taschenbuchausgabe
Vorwort
Einleitung – Tod am Nachmittag
Erster Teil:Die Vergangenheit als Vorspiel
Erstes Kapitel: Die Ruhe vor dem Sturm
Zweites Kapitel: Wie alles aus dem Ruder läuft
Drittes Kapitel: Die Verzweiflungstoten
Zweiter Teil:Die Anatomie des Schlachtfelds
Viertes Kapitel: Leben und Sterben der Höher- (und Geringer-)qualifizierten
Fünftes Kapitel: Der schwarze und der weiße Tod
Sechstes Kapitel: Die Gesundheit der Lebenden
Siebtes Kapitel: Der Schmerz – Misere und Mysterium
Achtes Kapitel: Selbstmord, Drogen und Alkohol
Neuntes Kapitel: Opioide
Dritter Teil:Was die Wirtschaft damit zu tun hat
Zehntes Kapitel: Falsche Fährten – Armut, Einkommen und die Große Rezession
Elftes Kapitel: Die Schere am Arbeitsplatz
Zwölftes Kapitel: Die wachsende Kluft in den Familien
Vierter Teil:Warum der Kapitalismus so viele im Stich lässt
Dreizehntes Kapitel: Wie das amerikanische Gesundheitswesen das Leben von Menschen zerstört
Vierzehntes Kapitel: Kapitalismus, Immigranten, Roboter und China
Fünfzehntes Kapitel: Unternehmen, Verbraucher und Arbeitnehmer
Sechzehntes Kapitel: Was können wir jetzt tun?
Dank
Endnoten
VORWORT ZUR AMERIKANISCHEN TASCHENBUCHAUSGABE
Die gebundene Ausgabe von Tod aus Verzweiflung erschien am 17. März 2020 – vier Tage nachdem Präsident Trump den Covid-19-Ausbruch zum nationalen Notstand erklärt hatte, in derselben Woche, in der Staaten und Kommunen Ausgangssperren verhängten, um ihre Bürger vor der Ausbreitung des Coronavirus zu schützen. Bei den Recherchen für und der Arbeit an Tod aus Verzweiflung ahnten wir nicht, dass ein tödliches Virus den Planeten heimsuchen würde, und noch viel weniger, dass die USA bei den Todesopfern weltweit an der Spitze liegen würden. Dabei geriet das Leben von US-Amerikanern ohne Hochschulabschluss schon lange vor Covid-19 aus den Fugen. Jahr für Jahr sterben dort mehr Menschen durch eigene Hand, eine Drogenüberdosis oder alkoholbedingte Leberkrankheiten. Um diese andere Epidemie geht es in diesem Buch – eine Epidemie, die seit Anfang der 1990er-Jahre Menschenleben fordert und bis 2018 jedes Jahr 158.000 Amerikaner das Leben kostete. Während wir im September 2020 an diesem Vorwort arbeiten, werden Covid offiziell 200.000 Tote zugeschrieben. Diese Zahl ist jedoch mit großer Sicherheit zu niedrig angesetzt und dürfte bis zum Jahresende noch steigen.
Die beiden Epidemien sind zwar alles andere als identisch, doch das Muster der Todesfälle weist durchaus große Gemeinsamkeiten auf. Für weniger gebildete Amerikaner stellt der Tod durch Drogen, Selbstmord und Alkohol das größte Risiko dar. Von der Zunahme der dadurch verursachten Todesfälle seit Mitte der 1990er-Jahre sind fast ausschließlich Personen ohne vierjähriges Collegestudium betroffen. Bis wir mehr über das Bildungsniveau der Menschen erfahren, die dem Virus erliegen, wird es noch einige Zeit dauern – vielleicht bis Ende 2021 –, doch eines wissen wir bereits sicher: Weniger gebildete Menschen tragen ein höheres Infektionsrisiko. Im Juni 2020 errechnete das Bureau of Labor Statistics, dass über ein Drittel der Bürger mit Highschoolabschluss, aber ohne Collegestudium, berufsbedingt „stark exponiert“ ist, von den Bürgern mit einem Bachelorabschluss dagegen nur ein Fünftel.1 Viele hoch qualifizierte Menschen arbeiten im Homeoffice, und ihre Arbeitsplätze sind in aller Regel sicher. Im Juni 2020 verfügten 75 Prozent derjenigen, die pandemiebedingt Telearbeit am Computer ausüben, über einen Bachelor- oder einen höheren Studienabschluss. Im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung ist ihr Anteil mehr als doppelt so hoch.2 Gleichzeitig benutzen die weniger gebildeten Amerikaner mit größerer Wahrscheinlichkeit öffentliche Verkehrsmittel und leben beengter.
Es steht bereits fest, dass die Pandemie den Verdienst und die Arbeitsplätze geringer qualifizierter Amerikaner deutlich stärker beeinträchtigt, wodurch die Schere zwischen Menschen mit und ohne Collegeabschluss noch weiter aufgeht. Viele Amerikaner aus bildungsfernen Schichten arbeiten im Einzelhandel, in der Gastronomie, als Reinigungskräfte, bei Sicherheitsdiensten und im Verkehrswesen, oftmals für kleine Betriebe, die geschlossen sind und vielleicht nicht wieder öffnen.3 Hightech-Unternehmen ist es besser ergangen als der übrigen Wirtschaft, und solche Firmen haben im Verhältnis zu ihrer Größe weniger Beschäftigte. Qualifizierte Fachkräfte hatten währenddessen kaum Verdiensteinbußen, und ihre Aktiendepots und Altersvorsorgeportfolios verbuchen Rekordstände. Die Kluft zwischen den Menschen, die ein vierjähriges Studium absolviert haben, und allen anderen – ein wiederkehrendes Thema dieses Buches – reißt durch die Pandemie noch weiter auf.
Es gibt aber auch maßgebliche Unterschiede zwischen den beiden angesprochenen Epidemien. Den Tod aus Verzweiflung sterben vor allem Jüngere und Erwachsene mittleren Alters, wobei das Risiko im Vergleich zu den früher im 20. Jahrhundert Geborenen Jahrgang für Jahrgang zunimmt. Unter den Covid-Toten waren dagegen unverhältnismäßig viele Ältere. Der Verzweiflungstod konzentriert sich eher auf Weiße ohne hispanische Wurzeln, wenngleich nach 2013 die Drogenmortalität in der schwarzen Bevölkerung anstieg, als im Straßenhandel Fentanyl Einzug hielt – ein Opioid mit weit stärkerer Wirkung als Heroin. An Covid starben überproportional viele Afroamerikaner. Covid ist eine weltweite Pandemie, die reiche und arme Länder betrifft, während der Tod aus Verzweiflung zwar kein ausschließlich amerikanisches Phänomen ist, doch in den USA und anderen reichen Ländern weitaus stärker zu Buche schlägt.
Es wird spekuliert, dass die Covid-Pandemie beziehungsweise die Lockdowns, die damit einhergingen, die Zahl der Todesfälle aus Verzweiflung noch erhöhen könnten. In Medienberichten ist von verstärkter Inanspruchnahme der Telefonseelsorge die Rede und örtlich auch von einer steigenden Zahl der Selbstmorde sowie zunehmenden psychischen Problemen bis hin zu Suizidgedanken.4 Angeblich ist es in der Pandemie schwieriger, den Weg in die reguläre Suchttherapie zu finden, und die meisten 12-Schritte-Programme finden gar nicht oder online statt. Auch darüber werden wir vorerst keinen vollständigen Aufschluss gewinnen. 2018 gab es 158.000 Verzweiflungstote, genauso viele wie 2017, dem letzten von diesem Buch abgedeckten Jahr. An einer Überdosis starben etwas weniger Menschen als 2017, doch Selbsttötung und alkoholbedingte Todesfälle hatten zugenommen. Vorläufige Daten für 2019 lassen vermuten, dass der Aufwärtstrend bei den Drogentoten weitergeht.5 Daten über die Opfer einer Überdosis, die in der Notaufnahme behandelt wurden, deuten darauf hin, dass sich dieser Trend vor der Epidemie ins Jahr 2020 hinein fortsetzte.6 Infolgedessen dürfte es 2020 mehr Drogentote geben als 2019, selbst wenn die Pandemie als solche keinen direkten Effekt darauf hat.
Ebenso wird vermutet, dass die wirtschaftliche Rezession, die durch die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung ausgelöst wurde, die Zahl der Selbstmorde in die Höhe treiben könnte, wie es schon bei früheren Rezessionen zu beobachten war. Das ist sicherlich möglich und soziale Isolation erhöht das Selbstmordrisiko ebenfalls. Doch Indizien aus dem jüngsten Konjunkturabschwung, der Großen Rezession nach der Finanzkrise von 2008, belegen keinen automatischen Zusammenhang. Wie wir im zehnten Kapitel dokumentieren, gab es schon vor der Rezession immer mehr Verzweiflungstote, und ihre Zahl stieg während der Rezession und nach dem Ende der Rezession immer weiter. Es gibt kein Anzeichen für eine Rezession bei den Mortalitätszahlen. Dennoch ist die aktuelle Rezession anders. Mit keinem Abschwung gingen bisher Abstandsregeln oder Infektionsängste einher, sodass die Vergangenheit möglicherweise keine verlässlichen Schlüsse auf die aktuelle Entwicklung zulässt.
Das US-amerikanische Gesundheitssystem hat an beiden Epidemien großen Anteil, allerdings auf unterschiedliche Art und Weise. Im Folgenden stellen wir die These auf, dass diese Struktur, weil sie so kostspielig ist und so stark durch Beschäftigung finanziert wird, auf den Arbeitsmarkt für gering qualifizierte Amerikaner im Grunde eine ähnliche Wirkung hat wie eine Abrissbirne. Pharmakonzerne und Vertriebsunternehmen erzielen astronomische Gewinne, indem sie Medikamente mit hoher Suchtwirkung produzieren und vertreiben, was quasi einer Legalisierung von Heroin gleichkommt. In der Covid-Pandemie hat der Umstand, dass die Krankenversicherung an den Arbeitgeber gebunden ist, eine ganz andere Katastrophe ausgelöst: Zig Millionen Menschen verloren mit dem Arbeitsplatz auch ihren Versicherungsschutz, ohne eine Garantie für eine anderweitige Absicherung. Und selbst diejenigen, die noch krankenversichert sind, riskieren ihren finanziellen Ruin, wenn sie an Covid oder etwas anderem erkranken.
In den ersten sechs Monaten der Covid-Epidemie gelang es Lobbyisten im Gesundheitswesen, die Preisbeschränkungen für einen potenziellen Impfstoff aufzuweichen.7 Beide Epidemien machen die Unzulänglichkeiten des Gesundheitssystems und das Misstrauen der Amerikaner gegenüber ihrem Staat deutlich. Viele Beschäftigte ohne höhere Qualifikationen gehen davon aus, dass das System zu ihren Ungunsten manipuliert ist, und haben die Hoffnung auf ein besseres Leben verloren. Deshalb suchen sie Trost in Drogen und Alkohol. In der Covid-Pandemie nahmen viele Amerikaner Erklärungen, wie wichtig es sei, eine Maske zu tragen und Abstand zu halten, eher skeptisch auf. Für sie waren das Verfügungen einer Regierung, der sie nicht trauen. Anfang August berichtete Gallup, mehr als ein Drittel aller Amerikaner wolle nach eigenen Angaben eine von der FDA zugelassene kostenlose Impfung ablehnen.8
Wir können nur hoffen, dass der Tod durch Covid allerspätestens in ein paar Jahren durch Therapien und Impfstoffe eingedämmt wird. Doch für all jene, die Gefahr laufen, ihr Leben durch Drogen, Alkohol oder Selbstmord zu verlieren, gibt es keinen Impfstoff. Die Entwicklung von Impfstoffen und Therapien ist schwierig genug, doch noch schwieriger ist es, Reformen so umzusetzen, dass der amerikanische Kapitalismus funktioniert – Reformen, durch die er alle weiterbringt, nicht nur eine qualifizierte Elite.
Anne Case
Angus Deaton
Princeton, August 2020
VORWORT
2013 erschien Der große Ausbruch. Darin erzählte einer von uns eine positive Geschichte über den menschlichen Fortschritt in den letzten 250 Jahren. Sie handelte von einem zuvor unvorstellbaren materiellen Wohlstand, einem Rückgang der Armut und der Benachteiligung und der Verlängerung menschlichen Lebens. Möglich wurden diese Fortschritte durch die Entwicklung und Anwendung nützlichen Wissens. Star der Show war der Kapitalismus, der Millionen aus bitterer Armut hob, getragen von den positiven Kräften der Globalisierung. Die Welt demokratisierte sich zunehmend, sodass immer mehr Menschen ihre Kommunen und Gesellschaften aktiv mitgestalten konnten.
Dieses Buch ist nicht ganz so optimistisch. Es dokumentiert Verzweiflung und Tod, kritisiert bestimmte Aspekte des Kapitalismus und hinterfragt, wie Globalisierung und technischer Wandel im heutigen Amerika funktionieren. Dennoch bleiben wir zuversichtlich. Wir glauben an den Kapitalismus und sind nach wie vor überzeugt, dass sich Globalisierung und technischer Wandel so steuern lassen, dass alle davon profitieren. Kapitalismus muss nicht so funktionieren, wie das heute in Amerika der Fall ist. Er muss auch nicht abgeschafft, sondern lediglich so umgesteuert werden, dass er dem öffentlichen Interesse dient. Der Wettbewerb auf dem freien Markt kann vieles, doch es gibt auch zahlreiche Bereiche, in denen er überfordert ist. Dazu gehört die Gesundheitsversorgung, deren exorbitante Kosten der Gesundheit und dem Wohlergehen Amerikas enorm schaden. Ist die Regierung nicht bereit, eine Krankenversicherungspflicht zu verordnen und ihren Einfluss zu nutzen, um die Kosten unter Kontrolle zu halten – wie in anderen reichen Ländern –, dann sind Tragödien unvermeidlich. Die Verzweiflungstoten sind in hohem Maße darauf zurückzuführen, dass Amerika sich so unfähig zeigt wie kaum ein anderes Land, diese Lektion zu lernen.
Es hat schon früher Zeiten gegeben, in denen der Kapitalismus die meisten Menschen im Stich ließ, etwa zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als die industrielle Revolution in Gang kam, und erneut nach der Weltwirtschaftskrise. Doch die Bestie wurde gezähmt, nicht erlegt – was zu den großartigen Errungenschaften führte, die in Der große Ausbruch beschrieben sind. Wenn wir die richtigen Maßnahmen ergreifen, können wir sicherstellen, dass die heutigen Entwicklungen nicht Vorboten einer neuerlichen großen Katastrophe sind, sondern lediglich ein kurzer Rückschlag auf dem Weg zu mehr Wohlstand und besserer Gesundheit. Das vorliegende Buch mag nicht so erbaulich sein wie Der große Ausbruch, aber wir hoffen dennoch, dass es uns wieder auf den Kurs zurückbringt, der uns auch in diesem Jahrhundert Fortschritte beschert, wie wir sie aus der Vergangenheit kennen. Die Zukunft des Kapitalismus sollte im Zeichen der Hoffnung stehen – nicht der Verzweiflung.
Wir haben das Buch so geschrieben, dass es gelesen werden kann, ohne zu den Endnoten zu blättern beziehungsweise – für die Hörbuchfassung – ohne Blick auf die Zahlen. Der Text ist in sich schlüssig, und die Zahlen werden so ausführlich abgehandelt, dass die Argumentation auch ohne sie nachvollziehbar ist. Endnoten verwenden wir aus zweierlei Gründen: In den allermeisten Fällen verweisen sie auf Zitate, die unsere Thesen mit Daten unterlegen oder dokumentieren. In wenigen Fällen dienen die Endnoten auch dazu, tiefer in fachliche Fragen einzusteigen, die wissenschaftlich interessierte Leserinnen und Leser vielleicht überprüfen möchten. Für die Geschichte, die wir erzählen wollen, sind sie aber nicht nötig.
Es ist uns nicht immer leichtgefallen, die Verzweiflung darzustellen – und dem einen oder anderen dürfte es zusetzen, darüber zu lesen. Doch es gibt Hilfe für Menschen, die an Depressionen oder Suchtkrankheiten leiden, wie wir sie schildern. Wenn Sie Selbstmordgedanken haben, rufen Sie die National Suicide Prevention Lifeline unter 1-800-273-8255 (TALK) an. Eine Liste mit weiteren Ressourcen finden Sie unter at SpeakingOfSuicide.com/resources. Wenn Sie selbst oder Familienangehörige oder Bekannte an Drogen- oder Alkoholsucht leiden, ist ein ratsamer erster Schritt, mit dem Hausarzt Ihres Vertrauens oder einem spirituellen Berater zu sprechen. Wir empfehlen auch die Anonymen Alkoholiker (aa.org) und Al-Anon (al-anon.org). Al-Anon kümmert sich um die Angehörigen von Betroffenen. Diese Organisationen veranstalten an den meisten Orten in den USA und weltweit Treffen, bieten viele Hilfen und eine funktionierende Gemeinschaft von Unterstützern, in der Betroffene willkommen sind und der sie sich bedenkenlos anvertrauen können. Ortsgruppen finden Sie auf den Webseiten.
Anne Case und Angus Deaton
Princeton, New Jersey, Oktober 2019
EINLEITUNG
TOD AM NACHMITTAG
Die Idee zu diesem Buch entstand im Sommer 2014 in einer Blockhütte in Montana. Jedes Jahr verbringen wir den August in dem Dörfchen Varney Bridge am Madison River, mit Blick auf die Berge des Madison Range. Wir hatten versprochen, den Zusammenhang zwischen persönlichem Glück und Selbstmord zu untersuchen, also die Frage, ob Menschen an Unglücksorten – den Bezirken, Städten oder Ländern, aus denen die Leute berichten, dass es ihnen wirklich schlecht geht – auch häufiger Hand an sich legen. In Madison County, Montana, war die Selbstmordrate in den vergangenen zehn Jahren viermal so hoch wie in Mercer County, New Jersey, wo wir den Rest des Jahres leben. Das hatte uns neugierig gemacht – umso mehr, als wir selbst eigentlich in Montana immer glücklich waren und uns auch andere Menschen dort glücklich vorkamen.
Daneben hatten wir festgestellt, dass die Selbstmordraten unter weißen Amerikanern mittleren Alters rasant anstiegen. Und noch etwas verwunderte uns: Amerikaner aus dieser Alters- und Bevölkerungsgruppe litten nicht nur darunter. Sie berichteten immer häufiger von Schmerzzuständen und insgesamt schlechterer gesundheitlicher Verfassung – noch nicht so oft wie ältere Amerikaner, denn schließlich wird die Gesundheit im Alter nicht besser, doch der Abstand verringerte sich. Bei Älteren besserte sich der Gesundheitszustand, während er sich in der mittleren Altersgruppe verschlechterte. Wir wussten, Schmerz konnte Menschen in den Selbstmord treiben – standen diese beiden Erkenntnisse also womöglich in Zusammenhang?
Das war der Anfang. Als wir darüber nachdachten, wie wir unsere Ergebnisse zusammenschreiben wollten, war uns wichtig, die Selbstmorde in einen Kontext zu stellen. Welche Rolle spielte Selbstmord im Vergleich zu anderen Todesarten – auch zu den häufigsten Todesursachen wie Krebs oder Herzleiden? Wir wandten uns an die zuständige Behörde des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums (die Centers for Disease Control), luden uns die einschlägigen Zahlen herunter und stellten Berechnungen an. Erstaunt erkannten wir: Nicht nur die Selbstmorde nahmen unter weißen Amerikanern mittleren Alters zu, sondern alle Todesfälle. Die Steigerung war zwar nicht groß, doch erwartungsgemäß sollten die Todesraten von Jahr zu Jahr fallen, sodass schon eine Abflachung ungewöhnlich war – von einem Zuwachs ganz zu schweigen.
Wir dachten zunächst, wir müssten uns vertippt haben. Schließlich war der kontinuierliche Rückgang der Sterberate eines der am besten belegten Merkmale des 20. Jahrhunderts. Die Sterblichkeit – aus welchen Gründen auch immer – sollte bei keiner größeren Gruppe zunehmen. Natürlich gibt es Ausnahmen wie die große Grippeepidemie gegen Ende des Ersten Weltkriegs oder die Mortalität unter jüngeren Männern durch HIV/Aids vor 30 Jahren. Doch der stete Abfall der Todesraten, vor allem im mittleren Lebensalter, war eine der größten (und zuverlässigsten) Errungenschaften des 20. Jahrhunderts, durch die die Lebenserwartung eines Neugeborenen nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch in anderen wohlhabenden Ländern weltweit stieg.
Was war da los? Durch die Zahl der Selbstmorde allein ließ sich die Trendwende bei den gesamten Todesfällen nicht erklären. Wir forschten nach möglichen weiteren Ursachen. Zu unserer Überraschung waren „Vergiftungsunfälle“ ein maßgeblicher Faktor. Wie war das möglich? Schluckten so viele Menschen versehentlich Abflussreiniger oder Unkrautvernichtungsmittel? Unbedarft, wie wir (damals) waren, wussten wir nicht, dass „Vergiftungsunfälle“ die Kategorie war, unter die Drogentote (Stichwort: Überdosis) fielen. Auch nicht, dass eine bereits gut dokumentierte Opioidepidemie, die rasch um sich griff, viele Todesopfer forderte. Darüber hinaus stieg die Zahl der Todesfälle durch alkoholbedingte Lebererkrankungen rasant. Für die am schnellsten anziehenden Todesraten gab es demnach drei Gründe: Selbstmorde, Drogenüberdosen und alkoholbedingte Leberkrankheiten. Und alle waren selbst verschuldet, ob schnell durch eine Schusswaffe, langsamer und weniger zuverlässig durch Drogenabhängigkeit oder schleichend durch Alkohol. Der zutreffendste Sammelbegriff für diese drei Todesursachen erschien uns „Tod aus Verzweiflung“. Welcher Art die Verzweiflung war – wirtschaftlicher, sozialer oder psychischer –, das wussten wir nicht und wollten darüber auch keine Mutmaßungen anstellen. Doch das Etikett blieb haften, und dieses Buch stellt die eingehende Untersuchung dieser Verzweiflung dar.
Gegenstand dieses Buches sind die Todesfälle und die Menschen, die zu Tode kommen. Wir dokumentieren, was wir damals festgestellt haben und seither feststellen. Andere Autoren haben den Toten in Presseberichten und etlichen empfehlenswerten Büchern Namen und Gesichter gegeben und ihre Geschichten erzählt, worauf wir zurückgreifen konnten. Unsere eigene Arbeit hatte sich bis dato in erster Linie darauf fokussiert, die Vorgänge zu dokumentieren. Nun gehen wir einen Schritt weiter und versuchen, sie auf die zugrunde liegenden wirtschaftlichen und sozialen Ursachen zurückzuführen.
Was sind das für Menschen, die da sterben? Stirbt jemand, wird ein Totenschein ausgestellt, in dem unter anderem ein Kästchen zum Bildungsstand des Verstorbenen anzukreuzen ist. Die nächste Überraschung: Die steigende Zahl der Verzweiflungstoten entfiel fast ausschließlich auf Menschen ohne Bachelorabschluss. Wer vier Jahre studiert hatte, war davon kaum betroffen. Gefährdet waren alle, die keinen Hochschulabschluss vorweisen konnten. Besonders unerwartet traf uns das bei den Selbstmorddaten. Über hundert Jahre lang war es in gebildeteren Schichten häufiger zu Selbsttötungen gekommen1. Für die derzeitige Epidemie des Verzweiflungstodes galt das nicht.
Das vierjährige Collegestudium spaltet Amerika zunehmend, und die außerordentlichen Vorteile eines Hochschulabschlusses ziehen sich wie ein roter Faden durch dieses Buch. Die wachsende Kluft zwischen Menschen mit und ohne Bachelorabschluss ist aber nicht nur bei den Todeszahlen festzustellen, sondern auch bei der Lebensqualität. Menschen ohne diesen akademischen Grad leiden öfter unter Schmerzen, gesundheitlichen Problemen und schwerwiegenden psychischen Störungen und sind häufiger erwerbsunfähig und kontaktarm. Aber auch beim Verdienst, bei der Stabilität des Familienlebens und in der Gesellschaft wird das Gefälle größer.2 Ein abgeschlossenes vierjähriges Studium ist der maßgebliche Marker für sozialen Status – fast so, als müssten Menschen ohne abgeschlossenes Studium ein kreisrundes scharlachrotes Abzeichen tragen, auf dem die Buchstaben BA diagonal durchgestrichen sind.
In den vergangenen 50 Jahren hat Amerika (ebenso wie Großbritannien und andere reiche Länder) eine Meritokratie aufgebaut, die wir zu Recht für eine große Errungenschaft halten. Sie hat jedoch auch eine dunkle Seite, die vor langer Zeit schon von Michael Young vorausgesagt wurde – dem britischen Ökonomen und Sozialwissenschaftler, der den Begriff 1958 erfand und vorhersah, dass die Meritokratie zu sozialem Unheil führen würde.3 Wer die Prüfung nicht besteht und deshalb nicht in die kosmopolitische Elite aufrückt, hat keinen Zugang zu einem Leben in den wachstumsdynamischen, aufblühenden Hightech-Städten, sondern bekommt einen Job zugewiesen, der durch Globalisierung und Roboter bedroht ist. Die Elite betrachtet bisweilen selbstgefällig, was sie erreicht hat, und glaubt, sie habe es nicht anders verdient. Für die Menschen ohne Abschluss – die ihre Chance hatten, aber verspielten – hat sie oft nur abfällige Blicke übrig. Menschen von niedrigerem Bildungsstand werden herabgewürdigt oder gar verachtet. Ihnen wird vermittelt, dass sie Verlierer sind. Kein Wunder also, wenn sie mitunter den Eindruck gewinnen, das System sei gegen sie.4 So üppig heute die Früchte des Erfolgs sind, so drakonisch sind die Strafen für alle, die die Tests der Meritokratie nicht bestehen. Vorausschauend bezeichnete Young die abgehängte Gruppe als „die Populisten“ und die Elite als „die Scheinheiligen“.
Wir berichten nicht nur vom Tod, sondern auch von Schmerz und Sucht, von einem Leben, das aus den Fugen gerät und seine Struktur und seinen Sinn verliert. Bei Amerikanern ohne Bachelorabschluss geht die Zahl der Eheschließungen zurück. Dafür nehmen Lebensgemeinschaften und der Anteil der unehelich geborenen Kinder kontinuierlich zu. Viele Männer mittleren Alters kennen ihre Kinder gar nicht. Sie haben sich von den Frauen getrennt, mit denen sie früher zusammenlebten, und die Kinder aus solchen Beziehungen leben inzwischen bei Männern, die nicht ihre Väter sind. Der Trost, den früher ein organisiertes religiöses Leben spendete, vor allem in Form der traditionellen Kirchen, fehlt heute im Leben vieler. Die Menschen sind nicht mehr so stark in die Arbeitswelt integriert, viele gar nicht mehr erwerbstätig, und immer weniger haben eine langfristige Bindung an einen Arbeitgeber, der diese Loyalität erwidert – eine Beziehung, wie sie einstmals vielen einen gewissen Status eintrug und zu den Grundlagen eines erfüllten Lebens zählte.
Früher waren mehr Arbeitnehmer gewerkschaftlich organisiert. Die Gewerkschaften setzten sich für höhere Löhne ein, für mehr Mitbestimmungsrechte am Arbeitsplatz und für bessere Arbeitsbedingungen. In vielen kleineren und größeren Städten war das Gewerkschaftshaus das Zentrum des sozialen Lebens. Die guten Löhne, die einst der Arbeiteraristokratie zugrunde lagen, gibt es heute kaum noch und an die Stelle der Arbeit in der Produktion sind Dienstleistungsjobs getreten – etwa im Gesundheitswesen, in der Gastronomie und im Catering, bei Hausmeister- und Reinigungsdiensten und in der Wartung und Instandhaltung.
Unsere Geschichte von Verzweiflungstoten, Schmerz, Sucht, Alkoholismus und Selbstmord, von schlechteren Jobs mit niedrigeren Löhnen, von weniger Eheschließungen und vom Rückzug aus der Religion betrifft in erster Linie weiße Amerikaner nicht hispanischer Abstammung ohne Studienabschluss. 2018 schätzte das Census Bureau die Zahl der Amerikaner im Alter von 25 bis 64 auf 171 Millionen. Davon waren 62 Prozent Weiße ohne hispanische Abstammung und von diesen hatten wiederum 62 Prozent keinen Hochschulabschluss. Die gering qualifizierten weißen Amerikaner, die der gefährdeten Gruppe angehören, stellen 38 Prozent der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter. Die wirtschaftlichen Kräfte, die die Beschäftigungssituation verschlechtern, sind für alle Amerikaner aus der Arbeiterklasse ähnlich, ungeachtet ihrer Hautfarbe oder Ethnie. Dennoch unterscheidet sich die Geschichte von Schwarzen und Weißen deutlich.
In den 1970er- und 1980er-Jahren erlebten Afroamerikaner, die in der Stadt arbeiteten, rückblickend zum Teil dasselbe, was 30 Jahre später weißen Angehörigen der Arbeiterklasse widerfahren sollte. Die erste Globalisierungswelle traf die schwarze Bevölkerung besonders hart und in den Städten wurden die Jobs für diese schon zuvor chronisch benachteiligte Gruppe rar. Besser ausgebildete und qualifizierte Schwarze verließen die Innenstädte und wichen in sicherere Gegenden oder in die Vorstädte aus. Die Eheschließungen waren rückläufig, da vormals heiratsfähige Männer keine Arbeit mehr fanden.5 Die Kriminalität nahm zu und ebenso die Todesfälle durch Gewaltverbrechen, durch Drogenüberdosen in der Crack-Kokain-Epidemie und durch HIV/Aids, von denen Schwarze überproportional betroffen waren. Der Status der Schwarzen als am wenigsten begünstigte Gruppe zementierte sich, denn sie waren die Ersten, die die Schattenseiten der Veränderungen in der Landes- und Weltwirtschaft zu spüren bekamen, in der geringer qualifizierte Arbeitskräfte immer häufiger auf der Strecke blieben.
Afroamerikaner haben es seit jeher schwerer als Weiße. Heute wie damals ist ihre Lebenserwartung niedriger. Sie haben schlechtere Aussichten, aufs College zu gehen oder eine Anstellung zu finden. Diejenigen, die Arbeit haben, verdienen im Durchschnitt weniger als Weiße. Schwarze sind weniger vermögend, und die Wahrscheinlichkeit, dass sie kein Eigenheim besitzen, ins Gefängnis kommen und in Armut leben, ist ungleich höher. In vielen, aber nicht allen dieser Bereiche haben sich die Lebensbedingungen für Schwarze verbessert: Seit 1970 verzeichnen sie einen Anstieg bei Bildungsniveau, Löhnen, Einkommen und Vermögen. Von 1970 bis 2000 ging die Sterblichkeit bei Schwarzen stärker zurück als bei Weißen, und sie sank auch in den ersten 15 Jahren des 21. Jahrhunderts, während sie in der weißen Arbeiterschicht zunahm.
Es gibt weniger offene Diskriminierung als 1970 und inzwischen gab es sogar einen schwarzen Präsidenten. Waren die Menschen früher mit großer Mehrheit gegen Mischehen, finden die meisten heute nichts mehr dabei. Manchen Weißen gefällt sicherlich nicht, dass sie auf ihre etablierten weißen Privilegien verzichten sollen, und zwar allein auf ihre Kosten, nicht auch auf Kosten der Schwarzen.6 Arme Weiße, heißt es seit Langem, litten unter einem rassistischen System, das sich in erster Linie gegen die Schwarzen richtete. Arme Weiße wurden von den Reichen vor ihren Karren gespannt, die ihnen erklärten, sie hätten vielleicht nicht viel, doch immerhin seien sie weiß. Wie es Martin Luther King Jr. auf den Punkt brachte: „Die Südstaatenaristokratie übernahm die Welt und gab dem armen weißen Mann Jim Crow.“ Hatte er kein Geld, um sich etwas zu essen zu kaufen, so „tat er sich an Jim, der Krähe, gütlich, einem psychologischen Vogel, der ihm erzählte, dass er – ganz gleich, wie schlecht es ihm ging – doch zumindest ein weißer Mann war und damit besser als ein Schwarzer.“7 Doch als Jim Crow – wie andere Formen der Diskriminierung – allmählich das Feld räumte, büßte die weiße Arbeiterklasse den wie auch immer gearteten Nutzen ein, den sie daraus gezogen hatte. Über die Hälfte der weißen Amerikaner aus der Arbeiterschicht ist der Überzeugung, dass die Diskriminierung von Weißen inzwischen ein ebenso großes Problem darstellt wie die Diskriminierung von Schwarzen und anderen Minderheiten. Von den weißen Amerikanern mit Collegeabschluss glauben das nur 30 Prozent.8 Von der Historikerin Carol Anderson stammt die These, dass einem, der „stets privilegiert war, Gleichheit wie Unterdrückung vorkommt.“9
Bei der Sterblichkeit liegen die Schwarzen immer noch vor den Weißen, doch in den vergangenen 30 Jahren schrumpfte der Abstand der Weißen, die keinen Bachelorabschluss hatten, sichtlich. Bei Schwarzen betrug die Sterblichkeit noch Anfang der 1990er-Jahre mehr als das Doppelte der von Weißen verzeichneten Werte, war jedoch rückläufig, während die Zahlen bei den Weißen stiegen, sodass der Unterschied auf nur mehr 20 Prozent abschmolz. Seit 2013 greift die Opioidepidemie auch auf schwarze Gemeinschaften über, doch bis dahin hatte der Verzweiflungstod ein weißes Gesicht.
In den folgenden Kapiteln dokumentieren wir den Rückgang der Lebenserwartung und -qualität der weißen Arbeiterschicht in den letzten fünfzig Jahren. Weiße ohne hispanische Wurzeln machen 62 Prozent der US-Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter aus. Erkenntnisse über ihre Sterblichkeit sind daher an und für sich bedeutsam. Wie es den Afroamerikanern in den 1970er- und 1980er-Jahren erging, ist bereits ausführlich erforscht und diskutiert.10 Wir haben der einschlägigen Literatur nichts hinzuzufügen außer vielleicht die Anmerkung, dass es gewisse Parallelen zur heutigen Situation der Weißen gibt. Hispanoamerikaner sind eine äußerst heterogene Gruppe, die nur durch ihre gemeinsame Sprache definiert wird. Die Mortalitätstrends bei Hispanoamerikanern verändern sich in Einklang mit den Änderungen bei der Zusammensetzung der Immigranten – beispielsweise aus Mexiko, Kuba oder El Salvador. Wir versuchen uns nicht an einem stimmigen Narrativ für diese Gruppe.
Wir beschreiben vielmehr die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kräfte, die der Arbeiterklasse das Leben nach und nach immer schwerer machen. Eine Argumentationskette fokussiert sich dabei auf den Niedergang der Werte beziehungsweise eine zunehmend funktionsgestörte Kultur in der weißen Arbeiterklasse selbst.11 Es besteht wenig Zweifel daran, dass der zunächst so befreiend anmutende Verfall gesellschaftlicher Normen (die es nicht guthießen, unverheiratet Kinder zu bekommen) auf lange Sicht einen hohen Preis forderte. Junge Männer, die dachten, sie könnten ein Leben ohne Verpflichtungen führen, standen im mittleren Alter allein und haltlos da. Ein ähnlicher Faktor ist womöglich die Abkehr von der Religion. Diese lässt sich aber ebenso als Scheitern der organisierten Religion verstehen, die nicht in der Lage war, sich an politischen und wirtschaftlichen Wandel anzupassen und in einer veränderten Welt auch weiterhin Sinngehalt und Trost zu vermitteln. Wenngleich diese Argumente über gesellschaftliche Normen zweifellos stichhaltig sind, dreht sich unsere Geschichte primär um die externen Kräfte, die an dem Fundament nagen, das das Leben der Arbeiterschicht charakterisierte, wie es vor 50 Jahren aussah. Die Fakten belegen überzeugend, dass es keineswegs die Arbeiter waren, die das Verhängnis auf sich zogen, indem sie das Interesse an der Arbeit verloren.
Inflationsbereinigt stagniert der Medianlohn amerikanischer Männer seit 50 Jahren. Das Medianeinkommen weißer Männer ohne vierjähriges Studium büßte von 1979 bis 2017 13 Prozent an Kaufkraft ein. Im selben Zeitraum nahm das nationale Pro-Kopf-Einkommen um 85 Prozent zu. Von 2013 bis 2017 gab es zwar eine begrüßenswerte Trendwende bei den Einkommen Geringqualifizierter, die sich jedoch im Vergleich zu dem langfristigen Rückgang ausgesprochen kümmerlich ausnimmt. Seit Ende der Großen Rezession sind von Januar 2010 bis Januar 2019 fast 16 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen worden, doch nicht einmal drei Millionen für Menschen ohne vierjähriges Studium. Lediglich 55.000 waren für Bewerber geeignet, die nur einen Highschoolabschluss vorweisen konnten.12
Der anhaltende Schwund der Löhne gehört zu den grundlegenden Kräften, die gegen geringer qualifizierte Amerikaner arbeiten. Doch der einfache Zusammenhang zwischen sinkendem materiellem Lebensstandard und Verzweiflung allein kann die vorliegende Entwicklung nicht erklären. Zunächst geht der Lohnrückgang auf schlechtere Arbeitsmarktchancen zurück. Viele Menschen fallen ganz aus der Erwerbsbevölkerung heraus, weil die schlechteren Jobs so unattraktiv sind, es kaum freie Stellen gibt oder die Betroffenen nicht mobil sind oder eine Kombination dieser Faktoren vorliegt. Die qualitative Verschlechterung des Stellenangebots und die Loslösung aus der Erwerbstätigkeit bringen aber nicht nur Einkommensverlust mit sich, sondern auch noch andere Missstände.
Viele der neuen, schlechter bezahlten Jobs vermitteln nicht mehr den Stolz, den mancher empfindet, weil er Teil eines erfolgreichen Unternehmens ist – wenn auch in einer untergeordneten Position. Reinigungskräfte, Pförtner, Fahrer und Beschäftigte im Kundendienst „gehörten dazu“, als sie noch direkt bei großen Unternehmen angestellt waren. Lagert das Unternehmen solche Leistungen aber an einen Dienstleister aus, der weniger bezahlt und schlechtere Aufstiegsmöglichkeiten bietet, entsteht kein solches Zugehörigkeitsgefühl mehr. Selbst wenn die Beschäftigten dieselben Arbeiten verrichten wie vor ihrer Auslagerung, gehören sie doch nicht mehr zu dem Unternehmen, dessen Name über der Tür steht. Wie es der Ökonom Nicholas Bloom so einprägsam formuliert: Sie werden nicht mehr zur Weihnachtsfeier eingeladen.13 Die Zeiten sind vorbei, als eine Hausmeisterin bei Eastman Kodak noch zum CEO eines anderen großen Unternehmens aufsteigen konnte.14 In manchen Fällen werden die Arbeitsbedingungen so stark durch Software überwacht, dass die Beschäftigten dadurch jedes persönlichen Einflusses und jeder Eigeninitiative beraubt werden – selbst im Vergleich zu den einst so verhassten Fließbändern.15 Auch wer einer gefährlichen, schmutzigen Tätigkeit nachging, etwa in einem Kohlebergwerk, oder auf einer niedrigen Hierarchiestufe für ein namhaftes Unternehmen arbeitete, konnte früher stolz auf seine Rolle sein.
Männer ohne Perspektive geben keine guten Heiratskandidaten ab. Die Zahl der Eheschließungen unter gering qualifizierten Weißen ging prompt zurück, und immer mehr Menschen mussten auf die Vorteile der Ehe verzichten – darauf, die eigenen Kinder aufwachsen zu sehen und ihre Enkelkinder zu kennen. Von den gering qualifizierten weißen Müttern hat derzeit eine Mehrheit zumindest ein uneheliches Kind. Schlechtere Aussichten erschweren es den Menschen, sich ein Leben aufzubauen, wie es die eigenen Eltern führten – mit Eigenheim und Ersparnissen, um die Kinder aufs College zu schicken. Der Mangel an gut bezahlter Arbeit bedroht das Gemeinwesen und was es den Menschen bietet – etwa in Form von Schulen, Parks und Bibliotheken.
Doch eine Arbeitsstelle ist mehr als eine Einnahmequelle. Sie bildet die Grundlage für die Rituale, Gepflogenheiten und Routinen eines Arbeiterklasselebens. Ohne Arbeit kann die Arbeiterklasse letztlich nicht überleben. Es ist der Verlust der Bedeutung, der Würde, des Stolzes und der Selbstachtung, den es mit sich bringt, wenn Ehe und Gemeinwesen wegfallen, der in die Verzweiflung führt – nicht nur und noch nicht einmal primär der Verlust des Geldes.
In unserer Darstellung findet sich wieder, wie Emile Durkheim, der Begründer der Soziologie, den Selbstmord beschrieb, wie er vorkommt, wenn es der Gesellschaft nicht gelingt, manchen ihrer Mitglieder einen Rahmen zu geben, in dem sie ein würdiges, sinnvolles Leben führen können.16
Für uns stehen dabei nicht die wirtschaftlichen Missstände im Fokus, wenngleich diese zweifellos vorhanden sind. Weiße ohne Collegeabschluss sind aber nicht die ärmste Bevölkerungsgruppe in den Vereinigten Staaten. Ihr Armutsrisiko ist weit geringer als bei Afroamerikanern. Wir sehen in den rückläufigen Löhnen vielmehr einen Faktor, der nach und nach sämtliche Aspekte des Lebens der Menschen unterhöhlt.
Warum lässt die Wirtschaft die Arbeiterklasse im Stich? Wenn wir Anregungen für Veränderungen suchen, dann müssen wir wissen, was passiert ist, wo wir ansetzen müssen und welche Maßnahmen wirkungsvoll dagegenhalten könnten.
Wieder könnten wir auf die Versäumnisse der Betroffenen schauen und behaupten, dass es in der modernen Wirtschaft nicht möglich ist, ohne einen Bachelorabschluss Erfolg zu haben, und dass sich die Menschen eben einfach um mehr Bildung bemühen müssen. Wir sind beileibe nicht gegen Bildung, und diese ist heute sicherlich noch wertvoller als früher. Wir wünschen uns eine Welt, in der jeder, der davon profitieren kann, aufs College zu gehen, und das gern möchte, dies auch tun kann. Wir weigern uns aber, grundsätzlich davon auszugehen, dass Menschen für die Wirtschaft keinen Nutzen haben, wenn sie nicht über einen Bachelorabschluss verfügen. Und ganz sicher sind wir nicht der Ansicht, dass solche Menschen in irgendeiner Weise respektlos oder als Bürger zweiter Klasse behandelt werden dürfen.
Globalisierung und technischer Wandel werden häufig als Hauptursachen für diese Entwicklung angeprangert, weil sie den Wert ungelernter Arbeitskräfte vermindern und sie durch ausländische Billiglöhner oder noch billigere Maschinen ersetzen. Doch andere reiche Länder in Europa und anderswo sind ebenfalls mit Globalisierung und technischem Wandel konfrontiert, ohne dass die Löhne dort langfristig stagnieren oder der Tod aus Verzweiflung grassiert. In Amerika geht noch etwas anderes vor, was für die Arbeiterklasse besonders schädlich ist. Große Teile dieses Buches sind der Antwort auf die Frage gewidmet, was genau das sein könnte.
Wir sehen im Gesundheitssystem eine spezifisch amerikanische Tragödie mit zersetzender Wirkung auf das Leben der US-Bürger. Außerdem behaupten wir, dass sich in Amerika mehr als anderswo marktwirtschaftliche und politische Macht von der Arbeit aufs Kapital verlagert hat. Die Globalisierung hat dieser Verschiebung Vorschub geleistet, denn dadurch wurden die Gewerkschaften geschwächt und die Arbeitgeber gestärkt.17 Die amerikanischen Institutionen haben dazu beigetragen, dass diese Entwicklung in Amerika weiter ging als in anderen Ländern. Die Macht der Unternehmen nahm im selben Maße zu, in dem sie den Gewerkschaften abhandenkam und in dem die Politik unternehmensfreundlicher agierte. Das ist zum Teil dem phänomenalen Wachstum von Hightech-Unternehmen wie Apple oder Google zuzuschreiben, die, gemessen an ihrer Größe, wenige Menschen beschäftigen und pro Beschäftigter/m hohe Gewinne ausweisen. Das ist gut für die Produktivität und für das Nationaleinkommen, doch die arbeitende Bevölkerung hat davon wenig – und das gilt ganz besonders für gering qualifizierte Arbeitskräfte. In weniger positivem Licht erscheint, dass die Konsolidierung in manchen amerikanischen Branchen – zwei von vielen Beispielen dafür sind Krankenhäuser und Fluggesellschaften – auf manchen Produktmärkten so viel mehr Marktmacht entstehen ließ, dass die Unternehmen die Preise über das Niveau anheben können, das ihnen auf einem Markt mit freiem Wettbewerb möglich wäre. Da die wirtschaftliche und politische Macht bei den Unternehmen zu-, bei den Arbeitnehmern aber abnimmt, können die Unternehmen auf Kosten der Normalbürger, der Verbraucher und vor allem der Arbeitnehmer profitieren. In ihrer schlimmsten Form hat diese Macht manchen Pharmaunternehmen die Möglichkeit eröffnet, geschützt durch staatliche Lizenzen Milliarden Dollar am Absatz suchterzeugender Opioide zu verdienen, die fälschlicherweise als sicher bezeichnet wurden, und damit von der Vernichtung von Leben zu profitieren. Allgemeiner ausgedrückt ist das amerikanische Gesundheitssystem ein Paradebeispiel für eine Institution, die unter dem Schutz der Politik Einkommen nach oben umverteilt – an Krankenhäuser, Ärzte, Hersteller von Medizintechnik und Pharmaunternehmen. Gleichzeitig rangiert es bei der Wirkungsrelevanz unter den Schlusslichtern aller reichen Länder.
Während wir an diesem Buch arbeiten (im August 2019), müssen sich Opioidhersteller vor Gericht verantworten. Ein Richter wies Johnson & Johnson an, über eine halbe Milliarde US-Dollar an den Bundesstaat Oklahoma zu zahlen. Eine Tochtergesellschaft von Johnson & Johnson baute in Tasmanien Schlafmohn an – den Rohstoff für fast alle in den USA produzierten Opioide. Erste Berichte über einen Vergleich mit dem größten Missetäter, dem Oxycontin-Hersteller Purdue, lassen vermuten, dass die Familie Sackler, der das Unternehmen gehört, den Kürzeren ziehen und mehrere Milliarden Dollar vom bisher erzielten Gewinn verlieren könnte. Dennoch werden Pharmazeutika weiter aggressiv an Ärzte und Patienten vermarktet, und auch die Regeln, nach denen die US-Arzneimittelbehörde FDA zuließ, was im Grunde einer Legalisierung von Heroin entspricht, sind nach wie vor in Kraft. Viele kritische Beobachter des Opioidskandals sehen wenig Unterschiede zwischen dem Verhalten der Händler mit legalisierten Drogen und der illegalen Heroin- und Kokaindealer, die gemeinhin so verachtet und verdammt werden.18
Doch die Probleme des Gesundheitswesens gehen weit über den Opioidskandal hinaus. Die USA geben horrende Summen für ein Gesundheitssystem aus, das innerhalb der westlichen Welt zu den schlechtesten zählt. Wir werden die These aufstellen, dass diese Branche ein Krebsgeschwür im Herzen der Wirtschaft darstellt, das bereits massiv gestreut hat: indem es Löhne drückt, gute Arbeitsplätze vernichtet und es den Bundesstaaten und der US-Regierung immer schwerer macht, zu bezahlen, was ihre Bürger brauchen. Das öffentliche Interesse und das Gemeinwohl werden dem privaten Profit ohnehin schon gut situierter Akteure untergeordnet. Nichts davon wäre möglich ohne die Duldung – und mitunter auch eifrige Beteiligung – der Politiker, die eigentlich im Sinne der Allgemeinheit handeln sollten.
Robin Hood hat angeblich die Reichen beraubt, um den Armen zu geben. In Amerika passiert das heute genau umgekehrt: Es wird von den Armen genommen und den Reichen gegeben – sozusagen eine Umverteilung à la Sheriff von Nottingham. Der Schutz der Politik wird missbraucht zur persönlichen Bereicherung, indem die Armen im Namen der Reichen bestohlen werden – ein Prozess, den Ökonomen und Politikwissenschaftler auch als „Rent-Seeking-Verhalten“ bezeichnen: die Beeinflussung von Entscheidungsprozessen, um aus ihren Ergebnissen Vorteile zu ziehen. Das ist im Grunde das Gegenteil des freien Marktkapitalismus und stößt im linken Lager – wegen der Auswirkungen auf die Verteilung – ebenso auf Ablehnung wie im rechten: dort, weil es die Freiheit und einen wirklich freien Markt unterminiert. Solches Verhalten ist so alt wie der Kapitalismus selbst. Das wusste schon Adam Smith im Jahr 1776. In seinem Werk Wohlstand der Nationen, das von vielen als Bibel des Kapitalismus betrachtet wird, schrieb Smith, dass Steuergesetze zwar beklagenswert streng sein konnten, aber dennoch „milde und menschlich“ im Vergleich zu den Gesetzen, die „unsere Kaufleute und Fabrikanten durch lautes Klagen bei der Legislative durchgesetzt haben, um die eigenen unsinnigen und ausbeuterischen Monopole zu stützen.“ Er fand, „so mag man auch von ihnen sagen, sie seien alle mit Blut geschrieben.“19Rent-Seeking-Verhalten ist eine Hauptursache für die Stagnation der Löhne in der amerikanischen Arbeiterklasse und hat viel mit dem Verzweiflungstod zu tun. Dazu äußern wir uns an anderer Stelle noch ausführlicher.
Die beiden gängigsten Erklärungen für den sinkenden Lebensstandard gering qualifizierter Amerikaner lauten, die Globalisierung habe dazu geführt, dass Fabriken geschlossen wurden und die Produktion nach Mexiko oder China abgewandert ist, und die Automatisierung habe Arbeitskräfte verdrängt. Das sind natürlich handfeste Faktoren, die eine wichtige Grundlage für unsere Erörterung bilden. Doch die Erfahrungen anderer reicher Länder zeigen, dass Globalisierung und Automatisierung zwar überall stattfanden, aber nicht notgedrungen die Löhne verringern, wie es in den USA geschehen ist, und schon gar keine tödliche Epidemie mit sich bringen. Das ist in hohem Maße dem amerikanischen Gesundheitssystem zuzuschreiben, aber auch der Politik, insbesondere dem Umstand, dass nicht kartellrechtlich gegen die Konzentration von Marktmacht angegangen wurde – auf den Arbeitsmärkten noch mehr als auf den Warenmärkten –, und dass dem Rent-Seeking-Verhalten der Pharmaindustrie und der Gesundheitsbranche im Allgemeinen, aber auch der Banken und vieler mittelständischer Unternehmer wie Ärzte, Hedgefonds-Manager, Eigentümer von Sportketten, Immobilienmakler und Autohändler kein Riegel vorgeschoben wurde. Sie alle verdienen an den „ausbeuterischen Monopolen“ und den Sondervereinbarungen, Steuererleichterungen und Vorschriften, die sie „bei der Legislative durchgesetzt“ haben. Ganz oben in der amerikanischen Einkommensverteilung, im obersten Prozent und dessen oberstem Zehntel, sind seltener Spitzenmanager von Unternehmen anzutreffen als vielmehr Inhaber eigener Unternehmen20, von denen zahlreiche durch Rent-Seeking-Verhalten geschützt werden.
Es ist viel von den unheilvollen Auswirkungen der Ungleichheit die Rede. In diesem Buch betrachten wir Ungleichheit mehr als Wirkung denn als Ursache. Wird den Reichen gestattet, sich durch unfaire Prozesse zu bereichern, die die Löhne drücken und die Preise in die Höhe treiben, dann nimmt logischerweise die Ungleichheit zu. Doch nicht jeder wird auf diese Weise reich. Manche Menschen erfinden neue Instrumente, Medikamente, Geräte oder Methoden, was vielen zugutekommt – nicht nur ihnen selbst. Sie profitieren davon, dass sie das Leben anderer verbessern und verlängern. Es spricht nichts dagegen, dass besonders erfinderische Menschen reich werden. Allerdings ist es ein Unterschied, ob man etwas bewirkt oder nur abkassiert. Nicht die Ungleichheit als solche ist ungerecht, sondern vielmehr der Prozess, der sie hervorruft.
Menschen, die ins Hintertreffen geraten, machen sich um ihren eigenen sinkenden Lebensstandard und um das bröckelnde Gemeinwesen Gedanken, nicht darum, wie reich ein Jeff Bezos (von Amazon) oder ein Tim Cook (von Apple) ist. Doch wenn sie den Eindruck haben, dass die Ungleichheit durch Betrug oder Gefälligkeiten entsteht, dann wird die Lage unerträglich. Die Finanzkrise hat viel Schaden angerichtet. Zuvor glaubten viele, die Banker wüssten schon, was sie tun, und würden dafür bezahlt, das öffentliche Interesse zu wahren. Danach, als so viele Menschen ihre Arbeit und ihr Heim verloren hatten, die Banker aber immer noch gut verdienten und nicht zur Rechenschaft gezogen wurden, glich der amerikanische Kapitalismus immer mehr einer Maschinerie zur Umverteilung nach oben statt einem Motor des allgemeinen Wohlstands.
Wir glauben nicht, dass sich das Rent-Seeking-Problem durch Steuern lösen lässt. Wer Dieben Einhalt gebieten will, muss ihnen das Handwerk legen – nicht die Steuern erhöhen.21 Wir müssen den Missbrauch und die übermäßige Verschreibung von Opioiden stoppen, nicht die Gewinne daraus besteuern. Wir müssen den Prozess korrigieren, nicht am Ergebnis herumdoktern. Wir müssen es Ärzten aus dem Ausland leichter machen, in den USA eine Approbation zu erlangen. Wir müssen Banker und Immobilienhändler davon abhalten, Vorschriften und Steuergesetze zu verfassen, die ihren Interessen dienen. Das Problem Geringqualifizierter sind ihre stagnierenden, rückläufigen Löhne – nicht die Ungleichheit an sich. Dabei ist die Ungleichheit zum großen Teil die Folge von Lohnkürzungen, die eine Minderheit noch reicher machen sollen. Etwas gegen unlautere Vorteilsnahme zu tun würde auch die Ungleichheit deutlich verringern. Häufen die Eigentümer von Pharmaunternehmen märchenhafte Reichtümer an, indem sie hohe Preise verlangen, ihre Patente verlängern, Zulassungen und vorteilhafte Vorschriften erwirken, die ihre Lobbyisten der Regierung abringen, dann tragen sie maßgeblich zur Ungleichheit bei – sowohl, indem sie die Realeinkommen derjenigen drücken, die für die Medikamente zahlen müssen, als auch, indem sie die höchsten Einkommen an der Spitze der Verteilung weiter in die Höhe treiben. Dasselbe gilt für die Banker, die das Konkursrecht in ihrem Sinne – und zum Nachteil der Kreditnehmer – umgeschrieben haben. Wie ein Beobachter anmerkte: „Nie zuvor in unserer Geschichte hat es eine so gut organisierte, orchestrierte und finanzierte Kampagne zur Verschiebung des Machtverhältnisses zwischen Gläubigern und Schuldnern gegeben.“22
Wie oft festgestellt, bringt selbst eine konfiskatorische Besteuerung der Reichen den Armen keine echte Erleichterung – weil es so viele Arme gibt und so wenig Reiche. Heutzutage müssen wir aber über den umgekehrten Prozess nachdenken: Presst man jedem Einzelnen aus einer großen Schar von Erwerbstätigen auch nur einen kleinen Betrag ab, kann das den Reichen, die an der Presse stehen, zu einem riesigen Vermögen verhelfen. Genau das passiert gerade, und dem sollten wir ein Ende bereiten.
Wie aber könnte man nicht nur der Elite, sondern auch den Werktätigen ein besseres Leben ermöglichen? Bei dem Versuch, diese Frage zu beantworten, verfällt man schnell in Pessimismus. Konzentrieren sich politische und finanzielle Macht immer mehr, fehlt dieser Dynamik offenbar das Eigenkorrektiv. Unter solchen Umständen wird verständlich, wie Donald Trump die Wahl gewinnen konnte, doch ist das ein Ausdruck der Frustration und des Zorns, der nichts besser macht, sondern alles noch schlimmer. Die weiße Arbeiterschicht glaubt nicht daran, dass ihr die Demokratie helfen kann. 2016 waren mehr als zwei Drittel der Angehörigen der weißen Arbeiterschicht in Amerika überzeugt, dass die Wahlen von den Reichen und von den großen Konzernen beeinflusst werden, und dachten daher, auf ihre Stimmen käme es ohnehin nicht an. Von Politikwissenschaftlern erstellte Analysen der Abstimmungsmuster im Kongress leisten dieser skeptischen Einstellung Vorschub: Demokratische wie republikanische Parlamentarier stimmen beständig im Sinne ihrer wohlhabenderen Wähler und interessieren sich kaum für die Interessen anderer.23
Richter Louis Brandeis führte Ende des 19. Jahrhunderts einen Feldzug gegen das Fehlverhalten großer Konzerne und wurde später als erstes jüdisches Mitglied von Woodrow Wilson in den Supreme Court berufen. Er war der Auffassung, dass extreme Ungleichheit nicht mit dem Fortbestand der Demokratie vereinbar sei. Das gilt für „gute“ ebenso wie für „schlechte“ Ungleichheit. Es spielt keine Rolle mehr, wie jemand reich wurde, wenn auch jene, die ihr Vermögen legitim erwarben, dieses einsetzen, um die Rechte und Interessen der weniger Begüterten zu untergraben. Wie wir es sehen, sollten wir am besten dem Rent-Seeking-Verhalten, dem Lobbyismus und dem Missbrauch von Marktmacht Einhalt gebieten, der hinter der extremen Ungleichheit steckt, um den unfairen Prozess aufzuhalten. Geht das nicht, so würden auch hohe Grenzsteuersätze oder – besser, doch in der Praxis weitaus komplizierter – eine Vermögensteuer den Einfluss des Geldes auf die Politik verringern. Optimistisch zu bleiben ist aber gar nicht so einfach: Hat sich Ungleichheit erst einmal eingebürgert, so die Ansicht eines Historikers, kann sie nur durch gewaltsame Erschütterungen überwunden werden – und zwar schon seit der Steinzeit.24 Diese Ansicht ist uns dann doch zu pessimistisch. Doch wie sich die Ungleichheit von ihrem derzeitigen Stand zurückführen lässt, ohne die Prozesse und Institutionen zu reformieren, die sie herbeigeführt haben, ist nicht so einfach zu beantworten.
Es gibt aber auch Gründe für Optimismus und selbst in unserer derzeit fehlerhaften Demokratie sind Maßnahmen denkbar, die eine Verbesserung bewirken können. Institutionen können sich verändern. In Bezug auf diese Fragen gibt es viel intellektuelle Aufregung und daraus entstehen zahlreiche gute neue Ideen, die wir an anderer Stelle in diesem Buch noch aufgreifen. An den Schluss dieser Einleitung stellen wir aber eine weitere, allerdings optimistischere historische Parallele.
In Großbritannien war die Ungleichheit zu Anfang des 19. Jahrhunderts noch weit ausgeprägter, als wir es heute erleben. Die Erbgrundbesitzer waren nicht nur reich, sondern kontrollierten durch ein stark eingeschränktes Wahlrecht auch das Parlament. Nach 1815 unterbanden die berüchtigten Maisgesetze den Weizenimport, bis der Preis im Land so hoch war, dass den Menschen eine Hungersnot drohte. Hohe Weizenpreise mochten zwar die einfachen Leute belasten, lagen aber ganz im Interesse der aristokratischen Grundbesitzer, die von den „Renten“ lebten, denen die Importbeschränkungen zugrunde lagen – ein klassisches und ganz wörtliches Beispiel für „Rent-Seeking“, und zwar in einer Form, die auch nicht davor zurückschreckte, Menschen zu töten. Gesetze eben, die „mit Blut geschrieben“ waren. Die industrielle Revolution hatte begonnen. Der Gärstoff der Innovation und des Erfindungsgeistes war vorhanden und das Nationaleinkommen wuchs. Dennoch – die arbeitende Bevölkerung hatte nichts davon. Die Sterblichkeitsraten stiegen, als die Menschen aus relativ gesundheitsförderlichen ländlichen Gegenden in übel riechende, unhygienische Städte zogen. Jede neue Rekrutengeneration beim Militär war kleiner als die vorige, was von immer schlimmerer Unterernährung in der Kindheit zeugte – durch zu wenig Nahrung ebenso wie durch mangelnde Hygiene, die einer gesunden Ernährung hohnsprach. Die Ausübung des Glaubens ging zurück, wenn auch nur, weil die Kirchen auf dem Land waren, nicht in den neuen Industriestädten. Die Löhne stagnierten, und das für die nächsten fünfzig Jahre. Die Gewinne kletterten und ihr Anteil am Nationaleinkommen erhöhte sich auf Kosten der Arbeit. Schwer vorstellbar, wie aus diesem Prozess etwas Positives hervorgehen sollte.
Doch am Ende des Jahrhunderts waren die Maisgesetze Geschichte und die Renten und Vermögen der Aristokraten mit dem globalen Weizenpreis zurückgegangen – vor allem nach 1870, als Weizen aus der amerikanischen Prärie den Markt überschwemmte. Eine Reihe von Reformgesetzen hatte das Wahlrecht erweitert – von einem von zehn Männern zu Beginn des Jahrhunderts auf über die Hälfte zur Jahrhundertwende. Frauen mussten darauf allerdings noch bis 1918 warten.25 1850 hatte ein Lohnanstieg eingesetzt und der über hundert Jahre währende Rückgang der Sterblichkeit hatte begonnen.26 Das alles geschah, ohne dass der Staat zusammengebrochen wäre, ohne Krieg und ohne Pandemie – durch allmähliche Veränderungen von Institutionen, die nach und nach den Weg für die Forderungen derjenigen freimachten, die abgehängt worden waren. Selbst wenn wir nicht genau wissen, warum, oder ob sich diese Logik auf unsere Zeit übertragen lässt: Die Fakten an sich rechtfertigen fraglos zumindest eine begrenzte Zuversicht.
ERSTER
TEIL
DIE VERGANGENHEITALS VORSPIEL
1
DIE RUHE VOR DEM STURM
Seit 1990 steigt die Lebenserwartung in unserem Land alle sechs Jahre um ein Jahr. Ein heute geborenes Kind blickt auf durchschnittlich etwa 78 Lebensjahre – fast 30 Jahre mehr, als ein Baby erwarten durfte, das im Jahr 1900 zur Welt kam. Todesfälle durch Herzkrankheiten haben sich seit meiner Geburt um über 70 Prozent verringert. Durch die Behandlung und Prävention von HIV/Aids ist für uns heute die erste Aids-freie Generation seit dem Auftauchen dieses Virus vor über 30 Jahren vorstellbar. Die Sterberate bei Krebserkrankungen geht seit 15 Jahren jedes Jahr um ein Prozent zurück.
Francis Collins, Leiter der National Institutes of Health, Anhörung vor dem Senat, 28. April 2014
Im 20. Jahrhundert hat sich die Gesundheitssituation beispiellos verbessert. Im Jahr 2000 galt als erwarteter Normalzustand, dass die Menschen immer gesünder wurden. Kinder lebten länger als ihre Eltern und diese wiederum länger als deren Eltern. Jahrzehnt um Jahrzehnt verringerte sich das Sterberisiko. Zugrunde lagen den gesundheitlichen Verbesserungen ein höherer Lebensstandard, medizinische und therapeutische Fortschritte sowie Verhaltensänderungen, die sich darauf gründeten, dass die Menschen mehr darüber wussten, wie sich bestimmte Verhaltensweisen – insbesondere das Rauchen – auf ihre Gesundheit auswirkten. In anderen reichen Ländern vollzogen sich aus ähnlichen Gründen ähnliche Entwicklungen. In armen Ländern, vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, waren die Verbesserungen noch augenfälliger. Im Jahr 2000 sah es ganz so aus, als würde sich diese Entwicklung fortsetzen – mutmaßlich bis in alle Ewigkeit.
Auch der wirtschaftliche Fortschritt war bemerkenswert. Im Jahr 2000 war fast jeder Mensch auf der Welt reicher, als es seine Großeltern oder seine Urgroß- oder Ururgroßeltern gewesen waren, als 1901 Königin Victoria starb und Louis Armstrong geboren wurde. Dabei war bereits der Zeitraum von 1800 bis 1900 ein Jahrhundert des Fortschritts gewesen. In den reichen Ländern Westeuropas und Nordamerikas erreichten die Einkommenssteigerungen in der Ära, die in Frankreich als „Les trente glorieuses“ bezeichnet wird – die 30 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg –, eine nie da gewesene Höhe. In den Vereinigten Staaten war das Pro-Kopf-Nationaleinkommen in diesen Jahren nicht nur schneller angewachsen denn je, sondern verteilte sich auch breit auf Reiche, Arme und die Mittelschicht.
Ganz ähnlich verhielt es sich mit der Bildung. Im Jahr 1900 machte erst ein Viertel der Menschen einen Highschoolabschluss. Mitte des Jahrhunderts waren es schon über drei Viertel. Der Anteil der Collegeabsolventen erhöhte sich von jedem Zwanzigsten auf jeden Fünften. Mit einem höheren Bildungsstand ging zwar in aller Regel auch ein besserer Verdienst einher, doch der Nachkriegsarbeitsmarkt bot Mitte des 20. Jahrhunderts auch solchen Bewerbern gute Aussichten, die nur einen Highschoolabschluss vorweisen konnten. Wer eine Stelle in der Produktion fand, etwa in einem Stahlwerk oder einer Autofabrik, der konnte davon gut leben – insbesondere, wenn er die Karriereleiter erklomm. Junge Männer folgten ihren Vätern in gewerkschaftlich organisierte Arbeitsverhältnisse, die Arbeitnehmer wie Arbeitgeber oft lebenslang in die Pflicht nahmen. Damals verdiente ein Mann genug, um zu heiraten, eine Familie zu gründen, sich ein Haus zu kaufen und sich auf ein Leben zu freuen, das in vieler Hinsicht besser war als das Leben, das seine Eltern in seinem Alter führten. Eltern konnten ins Auge fassen, ihre Kinder aufs College zu schicken, um ihnen ein noch besseres Leben zu ermöglichen. Das war die Zeit der sogenannten Arbeiteraristokratie.
Nun wollen wir keinesfalls behaupten, das 20. Jahrhundert sei ein Paradies gewesen, das im 21. Jahrhundert verloren ging. Nichts läge der Wahrheit ferner.
Im 20. Jahrhundert fanden auch viele der schlimmsten Katastrophen in der Geschichte statt, die Zig oder gar Hunderte Millionen Menschen das Leben kosteten. Gemessen an den nackten Zahlen der Getöteten waren die beiden Weltkriege und die verbrecherischen Regimes von Hitler, Stalin und Mao die schlimmsten Ereignisse, doch es gab auch tödliche Epidemien, darunter die Grippe am Ende des Ersten Weltkriegs und HIV/Aids am Ende des Jahrhunderts. Millionen Kinder auf der Welt starben noch an verbreiteten Kinderkrankheiten, als man längst wusste, wie sich dies verhindern ließ. Kriege, Massenmorde, Epidemien und vermeidbares Kindersterben verringerten die Lebenserwartung mitunter drastisch. Es gab aber auch wirtschaftliche Katastrophen und es ging längst nicht allen Menschen überall gut. Die Weltwirtschaftskrise ließ Millionen verarmen und verelenden. Jim, die Krähe, war quicklebendig und institutionalisierte die Benachteiligung der schwarzen Amerikaner im Bildungssystem, in der Wirtschaft und in der Gesellschaft.
Wir sagen auch nicht, dass es beständigen kontinuierlichen Fortschritt gegeben hätte – lediglich, dass über einen langen Zeitraum, etwa von 1900 bis 2000, für die Menschen die Sterbewahrscheinlichkeit geringer und die Aussicht auf Wohlstand größer geworden war. Manche Bereiche zeigten stetigeren Fortschritt als andere und manche Länder schnitten im Vergleich besser ab. Doch angesichts der anhaltend positiven Entwicklungen von Gesundheit und Lebensstandard im 20. Jahrhundert konnten die Menschen um die Jahrhundertwende mit gutem Grund davon ausgehen, dass sich diese fortsetzen und ihren Kindern im Leben dieselben Segnungen bescheren würden, die ihnen selbst zuteilwurden. Der größte Teil der Weltbevölkerung lebte Ende des 20. Jahrhunderts länger denn je in der Geschichte – und das in größerem Wohlstand. Doch damit nicht genug – die Steigerung war seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs so stetig und nachhaltig gewesen, dass offensichtlich schien: Künftigen Generationen würde es noch besser gehen.
Um nicht nur diese früheren Veränderungen zu verstehen, sondern auch die weniger erfreulichen, die wir in diesem Buch beschreiben, müssen wir zunächst klären, wie Fortschritt gemessen wird.
DER LAUFENDE STAND IM SPIEL UM LEBEN UND TOD
Wir werden immer wieder über Sterblichkeit und Lebenserwartung sprechen, die in gewisser Hinsicht Gegensätze darstellen: Die Sterblichkeit oder Mortalität misst das Sterben, die Lebenserwartung die Lebensdauer. Unter der Sterblichkeitsrate ist das Sterberisiko zu verstehen, unter der Lebenserwartung die Zahl der Lebensjahre, mit der ein Neugeborenes rechnen kann. Eine hohe Sterblichkeitsrate bedeutet eine niedrige Lebenserwartung und umgekehrt. Die Mortalitätsraten fallen für verschiedene Altersgruppen unterschiedlich aus – sie sind bei Babys und Kleinkindern hoch und bei größeren Kindern, Heranwachsenden und jungen Erwachsenen niedrig. Im mittleren Alter wird der Tod zur realen Bedrohung. Ab 30 steigt das Sterberisiko mit jedem Jahr an. In den USA lag die Sterbewahrscheinlichkeit für Menschen zwischen 30 und 31 im Jahr 2017 bei 1,3 pro 1.000. Für 40-Jährige betrug sie 2,0 pro 1.000, für 50-Jährige 4,1 pro 1.000 und für 60-Jährige 9,2 pro 1.000. In den mittleren Jahren verdoppelt sich die Wahrscheinlichkeit, zu sterben, alle zehn Jahre. In anderen reichen Ländern sind diese Risiken etwas geringer, doch wenn keine Epidemien oder Kriege eintreten, ähneln sich die Muster für alle Regionen und Zeiträume.
Für ein Neugeborenes stellen wir uns das Leben als Hürdenlauf vor, wobei jeder Geburtstag eine Hürde darstellt. Die Mortalitätsraten geben die Wahrscheinlichkeit wieder, an der jeweiligen Hürde zu scheitern. Sie sind anfangs hoch, bis der neue Erdenbürger in seinen Rhythmus findet, dann eine Zeitlang niedrig, wenn der inzwischen versierte Läufer locker eine Hürde nach der anderen nimmt, und dann steigen sie im mittleren und hohen Lebensalter allmählich immer weiter an, wenn der Hürdenläufer ermüdet. In diesem Buch sprechen wir immer wieder von der Lebenserwartung, die angibt, wie viele Hürden ein durchschnittliches Neugeborenes voraussichtlich nehmen wird, und von den Sterblichkeitsraten, also der Wahrscheinlichkeit, die jeweilige Hürde nicht zu überwinden. Wir brauchen beide Konzepte, weil sich die Entwicklungen, die wir schildern wollen, auf verschiedene Hürden unterschiedlich auswirken. Es kann nämlich sein, dass Risiken im mittleren Altersabschnitt zunehmen, aber unter noch Älteren rückläufig sind. In der Lebenserwartung schlägt sich das unter Umständen gar nicht nieder, wenn sich solche Veränderungen gegenseitig aufheben.
Sind die ersten Hürden besonders hoch, kommen viele Läufer gar nicht weit. In den USA trugen Kinder zu Anfang des 20. Jahrhunderts ein hohes Sterberisiko. Nicht alle Kinder wurden ausreichend oder gesund ernährt, Kinderkrankheiten wie Masern endeten oft tödlich, es wurde längst nicht flächendeckend geimpft, und an vielen Orten in den USA gab es unter anderem weder Trinkwasser von einwandfreier Qualität noch eine saubere Trennung zwischen der Abwasserentsorgung und der Trinkwasserversorgung. Es ist nicht nur unappetitlich, sondern extrem ungesund, aus einem Fluss zu trinken, den ein anderer, der stromaufwärts lebt, als Toilette benutzt. Einwandfreies Trinkwasser und eine effiziente Abwasserentsorgung sind kostspielig, und es dauerte, bis die Gesundheitsbehörden überall entsprechende Vorkehrungen getroffen hatten – auch noch, nachdem die wissenschaftlichen Grundlagen, die Keimtheorie als Ursache von Krankheiten, bereits bekannt und akzeptiert waren.
Abgesehen von der ersten Lebenszeit steigt die Wahrscheinlichkeit, zu sterben, mit zunehmendem Alter. Am gefährlichsten ist das Leben für Säuglinge und Senioren. In reichen Ländern lebt es sich als Säugling sicher. Nur sechs von 1.000 amerikanischen Babys erleben ihren ersten Geburtstag nicht. In anderen Ländern sind die Zahlen noch besser. In Schweden oder Singapur beispielsweise sterben nur zwei von 1.000 Kindern im ersten Lebensjahr. In manchen armen Ländern sind die Gefahren deutlich größer, doch selbst dort werden rasante Fortschritte gemacht. In keinem einzigen Land der Welt ist die Säuglingssterblichkeit heute höher als vor 50 Jahren.
Im Lauf des 20. Jahrhunderts erhöhte sich die gesamte Lebenserwartung bei der Geburt in den Vereinigten Staaten von 49 auf 77 Jahre. Ende des Jahrhunderts, von 1970 bis 2000, stieg sie von 70,8 auf 76,8. Das sind zwei zusätzliche Lebensjahre für jedes Kalenderjahrzehnt. 1933 begann die umfassende Datenaufzeichnung in den USA. Seither verläuft der Trend beinahe kontinuierlich aufwärts und war höchstens über ein oder zwei Jahre rückläufig. Die Daten für Zeiträume vor 1933 sind unvollständig, weil nicht in allen Bundesstaaten Aufzeichnungen geführt wurden, doch offenbar gab es von 1915 bis 1918 am Ende des Ersten Weltkriegs und während der Grippeepidemie einen Rückgang über drei Jahre.
Hätte sich der Anstieg im selben Tempo fortgesetzt, müsste die Lebenserwartung im Jahr 2100 bei über 90 liegen – und für größere Bevölkerungsgruppen sogar bei 100. Ähnliches lässt sich für die Länder Westeuropas und für Japan, Australien, Neuseeland und Kanada feststellen.
DAS NEUE GESICHT DER MORTALITÄT
1900 waren die drei Haupttodesursachen Infektionskrankheiten: Lungenentzündung, Tuberkulose und Magen-Darm-Infektionen. Mitte des Jahrhunderts hatten Infektionskrankheiten als Todesursache an Bedeutung verloren. Öffentliche Gesundheits- und Impfprogramme waren weitgehend abgeschlossen und die Antibiotika waren erfunden und standen vor dem breiten Einsatz. Die Hürden für die ersten Lebensjahre waren niedriger geworden und die Sterblichkeit verlagerte sich in den mittleren und späten Lebensabschnitt. Man könnte sagen, der Tod selbst alterte und wanderte aus den Bäuchen der Kinder in die Lungen und Arterien der Menschen mittleren und höheren Alters. Ist das erst passiert, wird es deutlich schwerer, die Lebenserwartung zu steigern. Das Absenken der ersten Hürden beeinflusst stark, wie weit ein Läufer kommen kann, doch sobald es fast jeder bis ins mittlere und hohe Alter schafft, erhöht sich die Lebenserwartung längst nicht so deutlich, wenn älteres Leben gerettet wird.
Ende des 20. Jahrhunderts standen bei den Todesursachen Herzerkrankungen und Krebsleiden an der Spitze. Herzkrankheiten und Lungenkrebs kommen nicht mehr so häufig vor, wenn die Menschen nicht mehr rauchen, und der erheblich verringerte Anteil der Raucher an der Bevölkerung hatte maßgeblichen Einfluss auf die rückläufige Mortalität. Auch die Prävention von Herzkrankheiten trug dazu bei. Blutdrucksenker sind billige, leicht zu verabreichende Medikamente, die die Zahl der Herzinfarkte und Schlaganfälle verringern. Dass weniger Menschen an Herzerkrankungen starben, war eine der großen Erfolgsgeschichten des letzten Viertels des 20. Jahrhunderts. Es gab aber auch Erfolge im Kampf gegen bestimmte Krebsarten wie Brustkrebs – durch Medikamente und Früherkennung.
Neue Medikamente spielen bei der Verringerung der Todesraten möglicherweise keine so große Rolle wie das Verhalten der Menschen, können aber dennoch oft Leben retten. Wenn wir an anderer Stelle in diesem Buch über Exzesse in der Pharmaindustrie schreiben, ist dabei stets zu bedenken, dass Medikamente vielen Menschen das Leben retten. Ohne Antibiotika, ohne Insulin für Diabetiker, ohne Aspirin oder Ibuprofen, ohne Anästhetika, Blutdrucksenker, antiretrovirale Arzneimittel oder die Pille wäre die Welt ein viel schlimmerer Ort. Das Hauptproblem für die Politik besteht darin, einen Weg zu finden, uns die Vorteile eines längeren, besseren Lebens zu sichern, ohne dafür unannehmbare gesellschaftliche Folgen in Kauf zu nehmen – auch, aber längst nicht nur finanzieller Art.





























