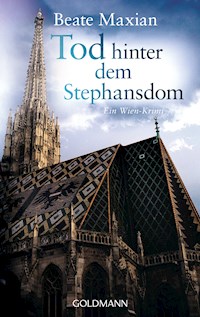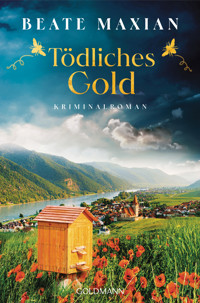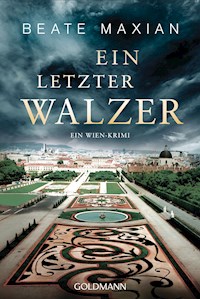9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Sarah-Pauli-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ganz Wien ist anlässlich des Jahreswechsels in Feierlaune. Auch Journalistin Sarah Pauli – sie hat tatsächlich Karten für das weltberühmte Neujahrskonzert der Philharmoniker ergattert. Doch die feierliche Hochstimmung schlägt in tiefes Entsetzen um: Als die Besucher nach der Veranstaltung den Konzertsaal verlassen, eröffnet ein Heckenschütze das Feuer und tötet ein Ehepaar. Sarah lässt die schreckliche Tat keine Ruhe. Sie recherchiert und entdeckt einen Zusammenhang mit einem Mord, der sich wenige Tage zuvor in der Wiener Hofburg ereignet hat. Doch der Todesschütze nimmt schon sein nächstes Opfer ins Visier ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Buch
Gute Vorsätze, rote Unterwäsche und allerlei Glücksbringer – in ihrer Kolumne über Aberglauben beim Wiener Boten widmet sich die Journalistin Sarah Pauli gegen Ende des Jahres beliebten Neujahrsbräuchen. Und eine der bekanntesten Traditionen in Wien ist das weltberühmte Neujahrskonzert der Philharmoniker, für das auch Sarah Karten ergattert hat. Doch die feierliche Hochstimmung schlägt in tiefes Entsetzen um: Als die Besucher nach der Veranstaltung den Konzertsaal verlassen, eröffnet ein Heckenschütze von einem der umliegenden Gebäude aus das Feuer und tötet mit gezielten Schüssen ein Ehepaar. Obwohl die Polizei weitreichende Ermittlungen anstellt, bleiben die Hintergründe des Doppelmordes im Dunkeln. Die schreckliche Tat lässt Sarah keine Ruhe. Sie beginnt zu recherchieren und stößt bald auf einen Zusammenhang mit einem anderen Verbrechen: Wenige Tage zuvor wurde im Sisi Museum der Wiener Hofburg eine Frau ermordet. Und auch in diesem Fall ist nichts, wie es scheint …
Weitere Informationen zu Beate Maxian sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
BEATEMAXIAN
Tod in der Hofburg
Ein Wien-Krimi
1. Auflage
Originalausgabe September 2015
Copyright © 2015 by Beate Maxian
Copyright © dieser Ausgabe 2015
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: © FinePic®, München
Redaktion: Karin Ballauff
KS · Herstellung: Str.
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-15932-0
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
I laß mir mein Aberglaub’nDurch ka Aufklärung raub’n,’s is jetzt schön überhaupt,Wenn man an etwas no glaubt.
Johann Nepomuk Nestroy
PROLOG
Sie konnte kaum glauben, dass sie ihr Vorhaben tatsächlich in die Tat umsetzte. Etwas zu planen oder eine Forderung auszusprechen war eine Sache, das Ding durchzuziehen eine andere.
Doch die Verbitterung saß tief. Bluten sollte dieser Scheißkerl. Richtig bluten. So wie sie geblutet hatte. Dieses verdammte Arschloch sollte vor ihr am Boden liegen und um Vergebung winseln. Und dieses symbolische Bluten erreichte sie über seine Achillesferse: Geld.
Im ersten Moment wollte sie abhaken, was passiert war, und einfach dort weitermachen, wo sie vor ihrem ersten Zusammentreffen aufgehört hatte. Doch er hatte keine Ruhe gegeben. Eine Zweieuromünze, die sie auf der Straße gefunden hatte, hatte sie schließlich auf die Idee gebracht. Er sollte bezahlen. Schmerzensgeld, eine Art Wiedergutmachung.
»Das ist Erpressung«, hatte er am Telefon gezischt, als sie ihre Forderung stellte. Sollte er es doch nennen, wie er wollte. Von ihr aus auch Erpressung, ihr war das egal. Hauptsache, er rückte die Kohle raus. Das allein zählte.
Heute würde sie ihm jede Menge Bares abnehmen.
Ob das ihren Seelenfrieden wiederherstellen konnte, würde sich erst hinterher erweisen.
In Gedanken versunken ging Annemarie Bartl die Kärntnerstraße hinauf und bog in den Graben ein. Am Kohlmarkt angekommen warf sie sehnsüchtige Blicke auf die Angebote der exklusiven Boutiquen. Armani. Gucci. Prada. Chanel. Die Schaufenster waren mit dicken Jacken, Mützen und Schals ausgestattet, fast alle noch mit Sale-Etiketten versehen. Sehr bald würden schon wieder Frühlings- und Sommerkleider, kurze Hosen, Strandmoden und Sandalen die Puppen bekleiden. Dann würde sie es sich auch endlich einmal leisten können, in den Luxustempeln ein Stück zu erstehen. Und zwar unabhängig vom Abverkauf. Diese Vorstellung zauberte ihr ein – wenngleich grimmiges – Lächeln ins Gesicht. Sie bahnte sich hoch erhobenen Hauptes weiter ihren Weg durch die Menschentrauben. Die Innenstadt war um diese Zeit, kurz nach Weihnachten, voller Touristen, die Silvester in der Walzerstadt feiern wollten. Sie hörte verschiedenste Sprachen, manche, die sie verstand, andere, die sie nicht einmal mit viel Fantasie zuordnen konnte. Einige klangen melodiös, andere monoton, wieder andere fast wie ein Krächzen.
Die Touristen fielen in die Mode- und Schuhgeschäfte, Restaurants und Kaffeehäuser ein und belagerten die Sehenswürdigkeiten der Stadt. Einer der Besuchermagneten war zweifellos die Hofburg. Über 600 Jahre hinweg hatte dieser Prachtbau der Habsburgerdynastie als Residenz gedient. Noch heute erahnte man die einstige Macht dieses Herrschergeschlechts. Auch innerhalb der Gemäuer war der ehemalige Kaiserwohnsitz feudal und prunkvoll – durch Reichtum und Überfluss geprägt.
Ein würdiger Ort für die Übergabe.
Annemarie Bartl hatte das Sisi Museum als Treffpunkt ausgewählt. Denn was war unauffälliger als zwei Frauen, die sich für die persönlichen Gegenstände und das Leben der Kaiserin Sisi interessierten? Einmal im Leben Prinzessin, Königin oder Kaiserin sein … Der Traum vieler Mädchen. Auch Annemarie Bartl hatte ihn geträumt. Als Kind hatte sie heimlich die Abendkleider und Stöckelschuhe ihrer Mutter angezogen und sich vor dem Spiegel bewundert. Freilich, solch aristokratische Kleider, wie Kaiserin Sisi sie getragen hatte und wie sie hier ausgestellt waren, etwa das ungarische Krönungskleid, hatte ihre Mutter nicht besessen. Doch Annemarie Bartl fühlte sich in diesem Augenblick wieder ein wenig so wie damals vor dem Spiegel: majestätisch.
Wenngleich die echte Kaiserin Elisabeth zeitlebens unglücklich gewesen sein sollte. Deshalb glänzte sie am Wiener Hof, sooft sie konnte, durch Abwesenheit. Schließlich verfiel sie einem ungesunden Schönheitswahn, floh in Magersucht und exzessive sportliche Betätigung. Eine Frau auf der Flucht vor sich selbst.
Dennoch war Annemarie Bartl davon überzeugt, den perfekten Ort ausgewählt zu haben. Dass ihr Plan funktionierte, schien außer Zweifel. Zwei Frauen. Zwei identische Handtaschen. In einer der Taschen 400 000 Euro. In einer halben Stunde würde sie um genau diesen Betrag reicher sein!
Auf dem Michaelerplatz betrachteten Touristen die römischen Ausgrabungen. Annemarie Bartl steuerte zielstrebig auf das geöffnete Michaelertor zu. Vor dem Eingang zur Spanischen Hofreitschule bildete sich eine längere Warteschlange, die Kasse fürs Sisi Museum im inneren Burghof dagegen war nahezu verwaist. Den Eintrittspreis von 11,50 Euro sah sie als notwendige und durchaus günstige Investition für ihr gesamtes Arrangement.
Während sie über den roten Teppich die breite Treppe zu den Räumlichkeiten hinaufging, überlegte sie, dass sie eigentlich noch mehr hätte verlangen sollen. Egal. Wenn ihr das Geld ausging, konnte sie immer noch eine Nachforderung stellen. Der Scheißkerl sollte sich sowieso nie mehr sicher vor ihr fühlen.
Am Drehkreuz presste sie ihre Eintrittskarte mit dem Code auf eine schmale Glasplatte und konnte gleich darauf das Museum betreten. Die Museumsaufseherin beobachtete sie aus ihrem Verschlag aus undefinierbarem Material kombiniert mit Glas. Kurz danach stand Annemarie Bartl in einem Raum namens »Der Tod« vor Sisis Totenmaske, die sich hinter Panzerglas befand und weiß wie Marmor war.
»… gibt es Geschichten über sagenumwobene Gestalten, die sich, ob wahr oder unwahr, über Jahrtausende halten und an die man gerne glauben möchte«, drang in dem Moment die Stimme einer Fremdenführerin an ihr Ohr, die eine Gruppe von Schülern und Schülerinnen vorbeiführte. »Die Weiße Frau in der Hofburg zum Beispiel ist so eine Gestalt. Je nachdem, ob sie beim Erscheinen weiße oder schwarze Handschuhe trägt, kündigt das eine Geburt oder den Tod an. Die Weiße Frau wurde zuletzt offiziell 1898 gesehen, kurz vor der Ermordung der Kaiserin Elisabeth. Damals trug sie schwarze Handschuhe. Dass sie seitdem nicht mehr gesehen wurde, bedeutet jedoch nicht, dass sie nicht mehr in der Hofburg umhergeht.«
Annemarie Bartl lächelte. Eine nette Geschichte, um die Jugendlichen während der Führung bei Laune zu halten.
Langsam ging sie weiter.
Als sie vor dem Modell der Wiener Hofburg und des Kaiserforums stand, betrat ihre neue Bekannte den Raum. Sehr groß und sehr gerade, wie ein schon in die Jahre gekommenes Model. Sie trug eine blonde Perücke. Von ihren Fingern zog sie schwarze Lederhandschuhe. Was für eine Dramaturgie!, dachte Annemarie Bartl und dachte schmunzelnd an die Geschichte der Weißen Frau. Trotz des überheblichen Blicks, mit dem die Geldbotin Annemarie Bartl bedachte, wirkte sie nervös, nahezu hektisch. Annemarie setzte ein Lächeln auf und winkte der anderen zu, wie man einer guten Freundin zuwinkt. Als sie vor ihr stand, begrüßte sie sie – vorgeblich herzlich – mit zwei Wangenküssen, wie es hierzulande eben üblich war.
»Wie schön, dich zu sehen«, flötete Annemarie Bartl.
»Was soll diese blöde Inszenierung?« Die Frage stand ihr zu. Immerhin zahlte sie seine Zeche, und Annemarie Bartl kassierte.
Selbstverständlich hätte die Übergabe auch woanders stattfinden können. Aber so war es nun einmal, wenn man etwas zu verbergen hatte: Es profitierten diejenigen, die von dem Geheimnis wussten und damit den Preis für ihr Schweigen und den Ort für die Übergabe des Geldes bestimmten.
»Hast du die Totenmaske der Kaiserin beim Eingang gesehen?«, erkundigte Annemarie Bartl sich, so als wären sie wirklich hergekommen, um die Exponate zu bewundern. »Warum haben sie die wohl gleich zu Beginn des Rundgangs ausgestellt?«
»Keine Ahnung. Bin ich die Kuratorin?«, entgegnete die andere unwirsch.
»Vielleicht, um Sisis Todessehnsucht zu dokumentieren?« Annemarie Bartl ignorierte die schlechte Laune der Überbringerin. Außerdem beschäftigte diese Frage sie tatsächlich. Sie zog die andere sanft weiter, vorbei an der lebensgroßen Statue der Sisi und am Bildschirm, der Filmauszüge mit Romy Schneider und Karlheinz Böhm in den Hauptrollen zeigte. Im Raum, der Sisis Kindheit repräsentieren sollte, blieben sie schließlich stehen.
»Wir müssen so tun, als ob uns das hier interessiert«, raunte Annemarie Bartl, während sie auf eine hinter Glas ausgestellte Zither zeigte.
»Blödsinn! Den Leuten hier ist es wurscht, ob uns das Klumpert interessiert oder nicht«, brummte die andere ungehalten.
Annemarie Bartl starrte sie überrascht an. Eine solche Ausdrucksweise hatte sie ihr gar nicht zugetraut. Sie sprach ansonsten in gehobenem Wienerisch.
»Schlechte Laune?« Die Frage klang provozierend.
»Lass uns die Sache zu Ende bringen. Ich hab nicht viel Zeit«, zischte die Geldkurierin.
Annemarie Bartl warf einen Blick an die Decke, um nach Kameras Ausschau zu halten. Sie konnte keine entdecken, was allerdings nichts zu bedeuten hatte. Sie ging weiter. Die andere folgte ihr. Annemarie hatte den optimalen Ort für den Handtaschenaustausch bereits ausgewählt, nämlich den Raum, wo das schwarze Kleid der Kaiserin ausgestellt wurde, an den Wänden Spiegel hingen und Blitze sowie Wörter auf die schwarze Wandfläche projiziert wurden: Sturm. Seele des Schwans.
Sonst war es in diesem Raum stockdunkel. Deshalb konnte sie von dem Schild auch nicht ablesen, wie dieser Teil des Museums betitelt wurde. Sie hoffte inständig, dass hier keine Kameras aufzeichneten.
»Wie viel?«, fragte Annemarie Bartl.
»So viel, wie du verlangt hast.«
Annemarie Bartls Herz klopfte aufgeregt. Offenbar waren sie allein.
»Jetzt«, gab sie das Kommando.
Rasch und unbemerkt tauschten sie die Handtaschen aus. Annemarie zog an dem Reißverschluss.
»Bist du verrückt?« Die andere legte die Hand auf Annemarie Bartls Unterarm. »Du willst die Tasche doch nicht etwa hier öffnen und das ganze Geld rausholen?« Sie machte eine diskrete Kopfbewegung. Eine Frau betrat den Raum, blickte in ihre Richtung, lächelte und wandte sich dann dem Kleid in der Mitte zu.
Die beiden Frauen gingen hinüber zur Teilkonstruktion des Hofsalonwagens.
»Ich will nur nachschauen, ob alles passt, solange du dabei bist«, flüsterte Annemarie und setzte erneut ein künstliches Lächeln auf.
»Geh nach Hause, Annemarie! Da bist du alleine und kannst in Ruhe zählen, ohne dass dir die Touristen über die Schulter schauen.«
Annemarie zögerte einen Moment.
»Hast eigentlich recht«, meinte sie dann.
»Glaub mir, es ist drinnen, was du verlangt hast. Wir wären schön blöd zu versuchen, dich übers Ohr zu hauen. Du weißt zu viel, und ich weiß, dass du keine Sekunde zögern wirst, zur Polizei zu gehen, wenn auch nur ein Euro fehlt«, erklärte die andere. »Das hast du ja oft genug betont.«
Sie griff nach Annemarie Bartls Handgelenk, hielt es fest und sah sie direkt an. »Und damit sind wir quitt. Keine weiteren Forderungen. Klar?«
»Klar.« Ihre Antwort war gelogen, und das wussten sie beide.
»Gut«, sagte die andere. »Ich gehe jetzt.«
Damit drehte sie sich auf dem Absatz um und verschwand.
Annemarie Bartl blieb zurück, fixierte die Tasche in ihrer Hand und erwog, die Hofburg ebenfalls zu verlassen. Daheim in ihrer Wohnung konnte sie tatsächlich wesentlich entspannter nachzählen. Doch ihre Neugier siegte über die Vorsicht. Nur ein Blick. Ein winzig kleiner Blick. Beim Betreten des Museums hatte sie gesehen, dass sich neben dem Eingang eine Toilette befand. Sie ging denselben Weg zurück, auf dem sie gekommen war, huschte durch die weiße Tür beim Museumseingang in die Toilettenräume und nahm die erste freie Kabine. Sie sperrte eilig hinter sich zu und stellte die Tasche auf dem Klodeckel ab. Dann atmete sie tief ein, und während sie die Tasche öffnete, lächelte sie siegessicher. Für den Bruchteil einer Sekunde.
Eine gewaltige Explosion erschütterte das gesamte Stockwerk. Glas zersplitterte, die Toilettentür wurde aus den Angeln gerissen, die Klomuschel zersprang, Plastikteile flogen durch die Luft, Wasser lief über Fliesen, und die Spiegel zerbarsten in tausend Teile. Im Museum krachten Bilder von den Wänden. Die Sisi-Statue kippte vor und fiel dann der Länge nach auf den Boden. Die Filmsequenzen wurden jäh unterbrochen und die Screens aus der Wand geschleudert. Die Menschen in den verschiedenen Räumen schrien vor Entsetzen, und ein ohrenbetäubendes Knallen breitete sich gleich einer Druckwelle in dem ganzen Museum aus. Einige von den Besuchern verloren das Gleichgewicht und stürzten. Ein Kind brüllte wie am Spieß. Manche Gesichter waren blutüberströmt. Im Raum »Der Tod« kauerten sich ein Mann und eine Frau in eine Ecke. Die Aufseherin, die Augenblicke zuvor noch den Eingangsbereich bewacht hatte, lag bewusstlos am Boden. In ihrer Brust steckten Glassplitter. Eine Alarmanlage war ausgelöst worden und dröhnte schrill. Im Umkreis von mehreren Metern bot sich ein Bild der Verwüstung. Nur die Totenmaske der Kaiserin und das schwarze Cape, die hinter Panzerglas ausgestellt wurden, blieben im Raum des Todes unversehrt.
Touristen, die noch keine Eintrittskarte gekauft hatten, starrten nun ungläubig dorthin, wo sich Sekunden vorher noch der Eingang zum WC befunden hatte und jetzt nur noch Trümmer herumlagen. Die Tür war aus ihren Angeln gerissen und vollkommen zerborsten. Eine Mischung aus Holz-, Mauerwerk- und Glassplittern übersäte den gesamten Flügel der Hofburg. Es stank nach Rauch, und Flammen loderten auf.
»Eine Bombe!«, brüllte eine Frau, die soeben die imperialen Stufen hinaufgelaufen war. Ihre Knie wollten ihr nicht mehr folgen, sie sackte zu Boden und blieb auf dem roten Teppich sitzen.
Aus der kleinen Menschengruppe vor der Kasse des Museums rief eine männliche Stimme: »Lassen Sie mich durch! Ich bin Arzt!«, und ein Mann bahnte sich den Weg durch die Gruppe.
Eine Frau zerrte ihn am Ellbogen zurück. »Was ist, wenn noch eine Bombe hochgeht?« Sie wandte sich abrupt ab und erbrach sich auf den Boden.
Bombe. Das Wort fuhr nun ebenfalls wie eine Druckwelle durch die Hofburg und fraß sich in Windeseile in die Ohren und Köpfe der aufgebrachten Menschen. Nun brach im gesamten Gebäude endgültig die Panik aus, bis in die Silberkammer und den Museumsshop im Erdgeschoß. Die Mitarbeiter hatten alle Hände voll zu tun, die Leute so geordnet wie möglich hinauszugeleiten. Sirenen kreischten. Menschen schrien. Die Menschentrauben vor den Ausgängen wurden immer dichter. Aus allen Richtungen strömten sie jetzt herbei, auch zu dem Unglücksort. Eine Stimme forderte die Umstehenden durch ein Megafon in mehreren Sprachen auf, das Gebäude und den Innenhof umgehend zu verlassen. Einige rannten zum nächsten Ausgang. Einige blieben einfach stehen, unfähig, sich zu bewegen. Viele weinten. Manche bluteten aus Schürfwunden.
Minuten später stürmten die ersten Einsatzkräfte das Museumsareal und bahnten sich einen Weg durch die geschockte Menge. Verletzte wurden versorgt, andere zurückgedrängt.
»Sie müssen raus! Bitte gehen Sie raus!«
Die Aufforderung kam wiederholt und im Stakkato. Absperrbänder wurden gezogen. Man befragte erste Augenzeugen.
Schließlich tauchte das Spezialeinsatzkommando der Polizei auf. Schwarz. Dunkel. Bedrohlich.
Ein Mann vom Bombenkommando wurde in den Schutzanzug gezwängt. Selbstsicheren Schrittes näherte er sich der Stelle, wo sich die Toilette befunden hatte. Ein Blick genügte, und ihm war klar, dass jede Hilfe zu spät kam. Ihr zerfetzter Körper lag auf dem Boden. Man konnte nichts mehr für sie tun.
1 SILVESTER
Der Tag, der für Judith und Josef Kreuzwieser den Tod brachte, stand unmittelbar bevor. In den Gärten rundum feierten und lachten die Menschen. Ein lauter Knall zerriss das fröhliche Stimmengewirr.
Sicher einer dieser verfluchten Schweizerkracher! Judith Kreuzwieser sah ihren Mann voller Empörung an, als sei der schuld an dem Krach. Sie war fest davon überzeugt, dass die Nachbarn diese grässlichen Böller nur schossen, um sie zu ärgern.
Zu Silvester steht das Geisterreich offen. Die Seelen der Verstorbenen und die Spukgestalten haben Ausgang. Dämonen veranstalten Umzüge oder ziehen in wilder Jagd durch die Lande. Das Feuerwerk um Mitternacht soll die bösen Geister vertreiben.
Das stand heute im Wiener Boten. Die Kolumne über Aberglauben hatte Josef Kreuzwieser noch vor allen anderen Artikeln gelesen. Normalerweise gab es diese Seite nur in der Wochenendbeilage der Tageszeitung. Doch heute war Silvester, eine sensible, geisterreiche Zeit, weshalb die Kolumne sich heute ausnahmsweise im Mittelteil der Zeitung fand. Er fand die Artikel dieser Sarah Pauli recht unterhaltsam. Allerdings bezweifelte er stark, dass die Kolumnistin recht behielt und es den vielen Raketen in dieser Nacht tatsächlich gelang, alles Böse aus Wien zu verjagen. Es gab einfach zu viele Dämonen in der Stadt. Er sah zu seiner Frau hinüber.
Judith lächelte nicht. Mit vorwurfsvoller Miene stand sie, steif und mit einem Glas Sekt in der Hand, neben ihm. Ohne Worte gelang es ihr, ihm zu vermitteln, dass sie nur ihm zuliebe auf dem Balkon ihres Hauses stand. Von hier aus hatte man einen schönen Blick auf das Feuerwerk, das in diesen Momenten auf die Stadt niederfunkelte. Er sah es gern, doch Judith konnte dem Schauspiel nichts abgewinnen. So war sie. Humorlos. Freudlos. War sie immer schon so gewesen? Oder war sie erst mit den Jahren so geworden?
Wieder gab es einen lauten Knall, gefolgt von einer Explosion. Diesmal kam der Krach aus dem Nachbargarten der gegenüberliegenden Straßenseite. Dort wohnten Erwin und Gerlinde Schwaiger.
»Die schießen wie die Depperten. Dass dir das gefällt, Josef!«
Judith Kreuzwieser ließ ihren Blick über die Rasenflächen der unmittelbaren Nachbarhäuser schweifen. Zwei Grundstücke grenzten direkt an ihres an. Von ihrem Balkon aus konnten sie alles gut beobachten. Im Garten hingegen versperrten hohe Hecken ihnen die Sicht.
»Ich finde, es reicht, dass die Stadt Tausende Euros in die Luft jagt. Es ist völlig unnötig, dass jeder Privathaushalt sein eigenes Feuerwerk veranstaltet.« Es klang ungehalten, und ihre Augen funkelten zornig.
»Lass sie doch«, entgegnete Josef Kreuzwieser leise. »Ist doch nicht unser Geld, das da in die Luft geschossen wird.« Sie hatten nie Raketen gekauft, auch nicht, als die Kinder noch klein waren. »Wir brauchen das nicht«, war Judiths Meinung gewesen. Den Kindern und ihm hätte es gefallen.
Rote, weiße und goldene Blitze zuckten über den Himmel und bildeten einen Lichterregen, der wenige Sekunden später mit dem Himmelsmeer verschmolz. Ein kurzes Leben. Kürzer als das einer Eintagsfliege, nur dazu bestimmt, die Menschen für Momente glauben zu lassen, dass sich im neuen Jahr alles zum Guten ändern würde. Eine Illusion.
In Wirklichkeit blieb stets alles beim Alten, davon war Kreuzwieser überzeugt. Die Trägheit und die Gewohnheiten würden immer siegen. Das war jedenfalls seine Erfahrung. Immerhin rauchte er noch immer täglich mehr als 20 Zigaretten, obwohl er sich seit Jahren zu Silvester vornahm, mit dem Rauchen aufzuhören. Silvester sei Abschied und Neubeginn zugleich, hieß es. Für ihn jedoch bedeutete Silvester Stillstand. So wie auch alle anderen Tage und Nächte in seinem Leben stillstanden. Sein Leben drehte sich nicht weiter.
Eine Rakete schoss von dem Grundstück gegenüber in den Himmel und verwandelte sich in einen grün glitzernden Reigen aus Sternen.
»Die Schwaigers sollten lieber zusehen, dass ihr Haus endlich neu gestrichen wird. Das vergilbte Weiß ist doch eine Zumutung für das ganze Grätzl«, setzte Judith Kreuzwieser ihr Geschimpfe fort und zeigte mit ausgestrecktem Arm in Richtung des Bungalows, wo das Ehepaar Schwaiger stand und die nächste Rakete startete. Schwaigers hatten offensichtlich Gäste.
»Klar, die Jaksch«, sagte Judith verächtlich. »Die passen zu den Schwaigers, die wollen ja auch immer etwas Besseres sein. Eine so verlogene Bagage ist das, dass einem graust. Neidisch aufeinander sein, aber Silvester miteinander feiern!«
Ihr Mann erwiderte nichts. Er hätte selbst gerne Gäste zu Silvester gehabt. Außerdem hatte er aufgehört, das Verhalten oder die Versäumnisse der Nachbarn seiner Frau gegenüber zu verteidigen. Welches Argument er auch brachte, Judith fühlte sich schon durch die bloße Anwesenheit der anderen gestört.
Wieder sauste eine Rakete zischend in die Dunkelheit hinauf und erhellte kurz darauf das Firmament für einen glanzvollen Augenblick.
Der nächste ohrenbetäubende Knall eines Schweizerkrachers ließ Josef Kreuzwieser zusammenzucken. Seine Frau fuhr herum. Der Nachbar links von ihnen zündete zur Freude seiner Kinder ausgerechnet diese extrem lauten Knallkörper und warf sie auf den Rasen seines Gartens. Der Duft von Schwarzpulver hing in der Luft.
»Dafür haben s’ Geld, die Winters! Aber das Auto auf Kredit kaufen und die Leasingraten nicht zahlen!«
Aus Versehen war nämlich unlängst das Mahnschreiben der Leasingfirma in ihrem Postkasten gelandet. Judith hatte es geöffnet, ebenfalls aus Versehen, wie sie behauptete, und es dann widerwillig der Nachbarin gebracht, nachdem Josef sie mehrmals darum gebeten hatte. Denn wäre es nach ihr gegangen, wäre das Schreiben im Altpapier gelandet. »Was geht mich das an, wenn der Postler sich irrt?«, hatte sie gemeint.
»Sind diese Schweizerkracher denn nicht verboten?«, fragte sie scharf.
»Restbestände dürfen noch bis 2017 verwendet werden«, antwortete er müde. »Den Kindern macht’s Spaß. Schau sie dir doch nur an, was die für eine Freud haben!«
»Ich finde, diese Dinger sind eine Zumutung, und ich bin sicher, dass das keine Restbestände sind. Die hat er hundertprozentig erst kürzlich oder vielleicht sogar erst heute gekauft. Illegal.« Sie betonte das letzte Wort. »Würde mich nicht wundern, wenn der feine Herr Winter noch mit ganz anderen Geschossen herumschießen würde.« Ihr missbilligender Blick fiel wieder auf den Vater der Kinder, der soeben den nächsten Kracher zündete. »Wehe ihm, wenn auch nur einer davon in unserem Garten landet!« Sie schnaubte. »Von der ganzen Knallerei bekommt man ja Kopfschmerzen. Verbieten sollte man das! Diese Schießerei zu Silvester geht mir sowieso schwer auf die Nerven. Das weißt du, Josef. Also erklär mir bitte, warum ich hier heraußen stehen soll!«
»Es ist Silvester, Judith!«
»Und? Da dürfen sich alle aufführen wie eine Horde wild gewordener Affen?« Sie sah ihn missmutig an. »Hätte ich mir gleich denken können, dass dir meine Meinung wieder einmal völlig egal ist.«
Josef Kreuzwieser nahm einen großen Schluck Sekt. So gewann er Zeit, um den aufkeimenden Ärger hinunterzuschlucken.
Kein Frieden also zur Jahreswende. Dabei hatten sie doch endlich Karten fürs Neujahrskonzert bekommen! Ein Grund, sich zu freuen und wenigstens einmal im Jahr die Nachbarn einfach nur Nachbarn sein zu lassen. Doch seine Frau hatte offenbar verlernt, sich zu freuen, immer und überall hatte sie etwas zu nörgeln. Sie schaffte es, mit jedem in ihrem Wohnviertel einen Streit vom Zaun zu brechen – ohne nachvollziehbaren Grund. Inzwischen ging jeder hier ihr nach Möglichkeit aus dem Weg.
»Hast du gesehen, wie diese Frau Winter heute daherkommt? Ich mein, die feiern Silvester zuhause mit den Kindern, und sie läuft in einem hautengen roten Kleid und Stöckelschuhen herum. Schaut doch aus wie ein billiges Flittchen.« Sie schüttelte den Kopf.
Josef Kreuzwieser gefiel die Aufmachung der jungen Nachbarin. Er stellte sich sogar vor, was sie wohl darunter trug. Doch das behielt er für sich.
Zu Silvester rote Unterwäsche zu tragen bringt Glück, Erfolg und Liebe im neuen Jahr. Vorausgesetzt, man bekommt sie geschenkt und hat sie noch nicht getragen.
Diesen Tipp hatte er in der Kolumne über Aberglauben von dieser Sarah Pauli bereits Anfang Dezember gelesen. Aus einer plötzlichen Laune heraus, die sonst gar nicht zu seinem eher konservativen Wesen passte, hatte er seiner Frau vorgeschlagen, das doch einmal auszuprobieren und sich für Silvester gegenseitig rote Unterwäsche zu schenken. Vielleicht in der Hoffnung, wieder einmal mit ihr über etwas lachen zu können. Mit ihr zu schlafen, davon träumte er schon lange nicht mehr, das letzte Mal lag mindestens fünf Jahre zurück. Als er ihr den Vorschlag unterbreitet hatte, war Judith in ihrem grauen Hausanzug damit beschäftigt gewesen, Weihnachtsdekorationen auf dem Fensterbrett im Wohnzimmer anzuordnen.
Das Haus schmücken, Zierrat aufstellen, der dann meistens im Weg herumlag, Tischdecken auflegen, auf denen man keine Gläser abstellen durfte, sondern Untersetzer verwenden musste. Putzen. Dekorieren. Entstauben … Das war ihre Welt.
Judith hatte ihn nur abschätzig angesehen und dann den Kopf geschüttelt. »Rote Unterwäsche! So etwas trägt doch unsereins nicht! Ich würde mich ja fühlen wie eine …« Sie hatte sich unterbrochen, aber er hatte längst begriffen, was sie meinte. »Wir sind traditionsbewusste, bodenständige Menschen und werden auf unsere alten Tage nicht noch mit so einem Unfug anfangen.«
Sie hatte tatsächlich »auf unsere alten Tage« gesagt, obwohl sie beide erst Mitte 50 waren. Doch um der Wahrheit die Ehre zu geben: Judith war schon viel früher alt.
»Seit wann glaubst du überhaupt an so einen Schmarrn?«, hatte sie dann misstrauisch wissen wollen und sich ihre Hände an dem grauen Hausanzug abgewischt.
»Ich glaub ja gar nicht dran«, hatte er sich verteidigt und überlegt, ob er sie in roter Unterwäsche attraktiv finden würde. Und sein nächster Gedanke war, ob er sie überhaupt noch attraktiv finden würde.
»Ich finde nur, es ist eine lustige Idee, und außerdem soll es Glück bringen.« Er hatte ihr den Artikel aus dem Wiener Boten vorgelesen.
»Eine lustige Idee! So ein Blödsinn! Außerdem sind wir nicht abergläubisch.«
Judith sprach immer in der ersten Person Plural, wenn sie etwas entschieden hatte, das er widerspruchslos zur Kenntnis nehmen sollte. Wenn sie zum Beispiel sagte: »Wir sprechen mit diesen Leuten nicht mehr«, so befahl sie ihm damit, ja kein Wort mehr mit den Nachbarn zu wechseln. Oder sie sagte: »Wir schneiden heute den Zaun«, was im Klartext hieß, dass er die Hecke schneiden sollte und sie seine Arbeit kontrollieren würde.
Er überlegte, wann er aufgehört hatte, sich gegen ihre Dominanz zu wehren. Hatte er sich eigentlich jemals zur Wehr gesetzt? Eigentlich nicht. Anfangs fand er es schön, dass Judith sich um alles kümmerte, danach war’s bequem, und irgendwann hatte er sich daran gewöhnt. Zwei Mal hatte er ernsthaft eine Scheidung in Erwägung gezogen und mit einem Rechtsanwalt darüber gesprochen. Eine viel zu teure Angelegenheit, denn ein großer Teil seines Einkommens wäre in ihre Tasche geflossen, und das wollte er nicht. Er hatte nach einem besser bezahlten Job Ausschau gehalten, doch das war danebengegangen. Außerdem, gestand er sich ein, wollte er den Rest seiner Tage nicht allein verbringen. Ihre Kinder besuchten sie selten. Paul lebte in Hamburg, Herta in Salzburg.
»Und wenn du jetzt auch noch damit anfängst, diesen Kolumnenunsinn für bare Münze zu nehmen, dann kündigen wir das Abo. Wir brauchen den Wiener Boten sowieso nicht. Also komm mir nicht mit irgendwelchen Flausen im Kopf daher.«
Sie befahl. Er parierte.
»Aber du klopfst doch auch manchmal auf Holz«, hatte er mit einem Anflug von Trotz erwidert. »Ist das etwa nicht abergläubisch?«
Er wusste selber nicht genau, warum er so darauf beharrte, denn im Grunde war es ihm egal, welche Unterwäsche sie zu Silvester trug. An ihrem Sexleben würde das sowieso nichts ändern.
Judith hatte ihre Diskussion beendet, indem sie das Thema wechselte: »Diese verfluchte Katze von den Winters hat gestern schon wieder unter unsere Sträucher geschissen. Ich hab’s genau gesehen.«
Also ob man dafür Beweise brauchte!
»Wenn ich sie noch einmal erwische …« Sie hatte ihre Drohung im Raum stehen gelassen.
Judiths Lamento über die Katzen und Hunde der Nachbarschaft kannte er zur Genüge. Es war immer dieselbe Leier. Sie hasste Tiere, hasste Menschen, hasste ihn und hasste ihr gemeinsames Leben.
Eines Tages würde er sie doch noch zum Teufel jagen!
Zwei Tage nach diesem Gespräch sah sich Josef Kreuzwieser aus purer Neugier in der Unterwäscheabteilung eines Kaufhauses auf der Kärntnerstraße um. Als eine junge Verkäuferin fragte, ob sie ihm helfen könne, lief er rot an und behauptete, sich auf dem Weg in die Herrenabteilung verlaufen zu haben. Ihm war klar, dass sie seine Lüge durchschaute, dennoch zeigte sie ihm kommentarlos den Weg.
Somit trug auch er am heutigen Silvesterabend kein Rot unter seiner grauen Anzughose.
»Ein gutes neues Jahr, Josef«, riss seine Frau ihn aus den Gedanken.
Er stieß mit ihr an und küsste sie auf die Wange, die sie ihm entgegenhielt. »Ein gutes neues Jahr, Judith.«
Wieder kam ein ohrenbetäubender Knall, gefolgt von einem Heuler.
»Wenn sich hier nicht bald was ändert, wird es wohl kaum ein gutes neues Jahr werden.« Sie seufzte und presste die Lippen aufeinander. »Ich gehe ins Bett, denn ich will morgen ausgeschlafen sein. Immerhin ist das Neujahrskonzert nicht irgendein Konzert. Ist wahrscheinlich das einzige Mal in meinem Leben.«
Sogar den Konzertbesuch machte sie ihm also zum Vorwurf, oder besser gesagt warf sie ihm vor, dass sie nicht zu den Kreisen gehörten, die jedes Jahr das Konzert besuchen konnten.
Judith Kreuzwieser drückte ihrem Mann das Glas Sekt in die Hand. Sie hatte nur einmal daran genippt. Dann warf sie einen letzten Blick in den Nachbargarten und schüttelte empört den Kopf.
»Banausen!«, schnaubte sie.
Dann wandte sie sich ab und ging durch die offene Balkontür zurück ins Haus.
Das Feuerwerk um Mitternacht vertreibt die bösen Geister, schoss es Josef Kreuzwieser durch den Kopf.
Wohl kaum. Er zündete sich eine Zigarette an und rauchte sie genüsslich. Ja, er hätte ihr die rote Unterwäsche kaufen sollen, und sei es nur, um den Dämon in seinem Haus mit dem Büstenhalter zu erwürgen.
Mittwoch, 1. Jänner
2 DIE CELLISTIN
In der Öffentlichkeit zu spielen glich einem Experiment. Eine Herausforderung. Ein Tanz auf dem Vulkan. Ein echtes Risiko, weil einen Fremde ansprechen konnten. Sie wurde nicht gerne angesprochen, und noch weniger gerne gab sie Antworten. Sie war introvertiert. Ihre Gedanken kreisten nicht um Mode, Politik oder das Weltgeschehen, sondern drehten sich um die Musik. Zugleich brachte ihr Vorhaben sie jedoch mit Sicherheit weiter in ihrer persönlichen Entwicklung.
Michaela Adam schob mit dem Fuß den Silvesterunrat zur Seite, der sich an der Seitenwand des brut im Künstlerhaus gesammelt hatte. Dann setzte sie sich auf den mitgebrachten Hocker. Die Mauer im Rücken, den Haupteingang des Musikvereins im Blickfeld direkt gegenüber. Auf der rechten Seite war der Karlsplatz, links von ihr das Hotel Imperial. Zwischen dem Hintereingang des Hotels und dem Künstlereingang in den Musikverein standen die großen Übertragungswagen für die Liveübertragung des Neujahrskonzerts in die halbe Welt. Der Platz selbst war frei von Dingen, die einem den Weg versperren konnten. Das war gut. Der Neujahrsmorgen präsentierte sich frei von Schnee und für diese Jahreszeit mit acht Grad über null relativ mild. Dennoch spürte sie den kalten Wind, der über ihr Gesicht strich und ihre Wangen rot färbte. Sie zog ihren dicken Wollschal enger um Hals und Schultern. Ihr Blick wanderte über die Fassade des Musikvereins. Durch jedes noch so winzige Detail an diesem Haus floss Musik. Das Gebäude war im historischen Stil nach dem Vorbild der griechischen Antike erbaut worden. Die Skulpturen am Giebelfeld zeigten Orpheus in der Unterwelt, der dort seine Ehefrau Eurydike aus den Fängen des Hades befreien wollte, allein durch seinen Gesang und das Spiel der Lyra. Sie mochte den Sänger und Dichter der griechischen Mythologie. Einer Überlieferung zufolge war er der Sohn des Apollo. Von ihm bekam er die Lyra geschenkt. Damit und mit seiner Stimme betörte Orpheus Götter, Menschen, Tiere, und sogar Steine und Felsen weinten, wenn sie ihn singen hörten.
Der Musikverein besaß mit dem großen goldenen Saal einen der schönsten und akustisch besten Musiksäle der Welt. Sie selbst hatte einmal im Brahms-Saal gespielt. Doch das war lange her.
Sie wandte sich ein wenig nach rechts und konnte durch die Baumgruppe deutlich die Kuppel der Karlskirche erkennen. Nur vereinzelt fuhren Autos auf der breiten Straße zwischen Musikverein und Karlsplatz. Auf einer Parkbank saßen zwei Frauen, die ab und zu in ihre Richtung sahen. Ob die beiden über sie sprachen?
Michaela Adams Blick wanderte weiter umher, sie nahm jede Kleinigkeit auf. Ihre Beobachtungsgabe war ein Segen und zugleich ein Fluch. Es gab nichts, das sie übersah. Es gab nichts, das sie ausblenden konnte. Alles, was sie umgab, sog sie mit allen Sinnen in sich auf.
Aus verschiedenen Richtungen eilten nun immer mehr Menschen herbei. Einige kamen vom Karlsplatz, andere von der Bösendorferstraße. Alle trugen sie elegante Kleidung unter ihren Wintermänteln, war sich Michaela Adam sicher. Denn alle hatten sie ein Ziel vor Augen: das Neujahrskonzert im Wiener Musikverein. Ob sie wegen der Musik oder nur aus Prestigegründen kamen, konnte sie zum Teil an ihren Gesichtern ablesen. Die Freude aufs Konzert lächelte fröhlich. Das Renommee war hier, weil es sich das leisten konnte. Seine überhebliche Miene sprach Bände.
Auf der Bühne in dem großen, goldenen Saal spielten die Wiener Philharmoniker für das Publikum und zugleich für die halbe Welt, jedes Jahr unter der Leitung eines anderen bekannten Dirigenten. Diesmal stand Daniel Barenboim auf dem Podium.
Aber der Dirigent interessierte Michaela Adam nicht. Der Dirigent interessierte sie nie. Sie kam ausschließlich der Musik zuliebe. Auch wenn sie hier draußen bleiben musste, weil sie niemals eine Karte für das Neujahrskonzert ergattern würde. Auf dem Programm stand traditionell die Musik der Strauss-Dynastie – Johann Vater & Sohn, Josef, Richard und Eduard Strauss. Ihre Musik war in diesem Land bekanntlich ein besonderes Gut, der Walzer ein wichtiges Stück Österreich und der Donauwalzer von Johann Strauss’ Sohn so etwas wie die heimliche Landeshymne.
Michaela Adam träumte von der Ehrwürdigkeit des Walzers, fantasierte von einem Leben voller Melodien, wünschte sich eine Existenz ohne Angst und ohne Tag und Nacht in ihren Gedanken. Sie beugte sich vor und nahm das Cello aus dem Koffer, der ihr zu Füßen lag. Den Deckel ließ sie offen stehen. Sanft, als berührte sie einen geliebten Menschen, nahm sie das Instrument in die Hand und setzte den Bogen an. Minutenlang saß sie einfach nur da. Das Cello thronte zwischen ihren Beinen. Dann, unmerklich, begann sie, über die Saiten zu streichen. Die ersten Töne erklangen.
Sie setzte ab und stimmte die Saiten nach, hob den Kopf und sah den Mann an der Ecke Bösendorferstraße Musikverein. Er trug einen dunklen kurzen Mantel und eine dunkle Sonnenbrille, die seine Augen verbarg. Um den Hals hatte er einen dicken Schal gewickelt. Er schlug den Mantelkragen hoch. Irgendwie fügte er sich nicht in das Bild ein. Er verhielt sich anders als die anderen Menschen am Platz. Er stand starr da und beobachtete die Umgebung. Seine Finger klopften ungeduldig gegen die Manteltasche. Es sah aus, als würde er sehr angestrengt über etwas nachdenken. Er ging ein paar Meter weiter und blieb vor den Fahrradständern wieder stehen.
Etwas schien ihm nicht zu behagen, seine Anspannung war für Michaela Adam spürbar. Er musterte sie und fuhr sich mit der Hand durch die braunen Locken. Dann richtete sein Blick sich auf die ständig neu Ankommenden, die auf den Eingang zueilten. Zwar hielten seine Finger jetzt still, dafür bewegte sich sein Oberkörper ruhelos hin und her. Es schien, als suchte er jemand Bestimmtes. Der Mann erinnerte sie an ein Raubtier, das sein Opfer aus der Menge auswählte. Er musterte nahezu jede einzelne Person, das konnte sie erkennen, obwohl er die dunkle Sonnenbrille aufhatte. Durchdringend. Bedrohlich.
In dem Moment schrillte ein Warnsignal durch ihre Gedanken. Angst jagte wie eine heiße Welle durch ihren Körper, und ein stechender Schmerz schoss ihr in den Kopf. Der Mann weckte unangenehme Erinnerungen in ihr. Dabei hätte sie schwören können, ihn noch nie in ihrem Leben gesehen zu haben. Sie kannte weder seine Identität noch seinen Beweggrund, zu dieser Zeit an diesem Ort zu sein. Doch ob sie wollte oder nicht, sie hatte den Kern seines Wesens erkannt, seinen Zorn, seine Gewaltbereitschaft. Die Leute vom Club Legato waren also noch immer auf der Suche. Eine dämonische Gruppe mit vielen Gesichtern und ebenso vielen falschen Namen. Ein Netzwerk, bestehend aus unterschiedlichen Menschen, das unter dem Deckmantel der künstlerischen Vollendung schnell zuschlug und wieder in der Normalität untertauchte. Sie waren der Grund dafür, dass sie ihren Beruf nicht mehr ausüben konnte so wie früher. Ihr Traum war zerplatzt. Doch nicht sofort. Erst nachdem Boris, ihr Bindeglied zum Club Legato, mehrmals bei ihr aufgetaucht war. Den Rest der Gruppe hatte sie nie kennengelernt.
Der Mann hatte inzwischen offenbar gefunden, wonach er suchte. Michaela Adam folgte seinem Blick. Doch es waren viel zu viele Menschen beim Eingang. Sie konnte nicht erkennen, wohin er seine Aufmerksamkeit richtete. Als sie wieder in seine Richtung sah, war er verschwunden. Wie vom Erdboden verschluckt. Sie schüttelte den Kopf, atmete mehrmals tief durch und war sich plötzlich nicht mehr sicher: Konnte sie sich auf ihr Gefühl verlassen? Hin- und hergerissen zwischen Unglauben und Gewissheit schloss sie die Augen. Doch das Unbehagen hallte nach. Ihre Hände zitterten.
Beruhige dich.
Das gelang ihr am besten mit Musik. Sie begann zu spielen. Sie wusste, dass viele jetzt überrascht zu ihr hinsehen würden.
Du musst spielen. Spiel einfach!
Die geschlossenen Lider schützten sie vor den Blicken der Vorbeieilenden. Sie hörte, wenn jemand eine Münze in den offenen Cellokasten warf, bedankte sich jedoch nicht, da sie nicht zu diesem Zweck spielte. Am liebsten war es ihr, wenn sie ignoriert wurde. Sie spielte nur für sich selbst, für ihren Seelenfrieden, für Klarheit in ihrem Kopf. Das Bild des Mannes verblasste allmählich. Das war gut so. Sie spielte weiter. Das Bild verschwand zur Gänze. Von Ton zu Ton ging sie mehr in der Musik auf. Musik war ihr Ein und Alles, ihr Leben, ihre Liebe.
3 GLÜCKSTELLER
Sarah, beeil dich!«
Sarah Pauli stand unter der Dusche und konnte David kaum hören. Sie hielt ihr Gesicht mit geschlossenen Augen unter das heiße Wasser und ließ die vergangenen Stunden mit David Revue passieren. Wenn sie sich konzentrierte, spürte sie noch immer seine Hände auf ihrem Körper. David wusste, was er tun musste, um sie abheben zu lassen. Jedes Mal, wenn er sie anlächelte und sich dabei Fältchen um seine dunklen Augen bildeten, blieb für Sarah die Zeit stehen.
Sie drehte wohlig seufzend den Hahn zu.
»Ich komme gleich!«, brüllte sie zurück und stieg aus der Duschkabine. Sie war keineswegs müde, sondern nur ein wenig träge. Silvester hatten sie gemütlich in Sarahs Wohnung verbracht. Nicht nur, weil ihnen vor dem Wirbel in den Lokalen und Straßen Wiens zu Jahresende grauste, sondern auch, weil Sarah ihre Katze Marie nicht alleine lassen wollte. Die Knallerei um Mitternacht erschreckte die schwarze Halbangora jedes Mal zutiefst. Chris und Gabi hatten mit ihnen zusammen gefeiert. Das Panorama, in dem ihr Bruder arbeitete, um sein Medizinstudium zu finanzieren, hatte Silvester geschlossen. Gabi und Chris waren seit einigen Monaten ein Paar. Ihr rastloser Bruder hatte in Sarahs Freundin und Davids Sekretärin endlich die Liebe und einen Ruhepol gefunden. Die Zeiten, in denen Chris jede Nacht eine andere Frau mit nach Hause brachte, schienen offensichtlich vorbei zu sein. Gabi war fünf Jahre älter als Chris. Sie hatte blonde, halblange Locken, blitzblaue Augen und ein ansteckendes Lachen und erinnerte Sarah ein wenig an die Schauspielerin Meg Ryan im Film »e-m@il für Dich«. Fröhlich. Natürlich. Einnehmend.