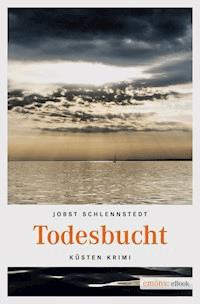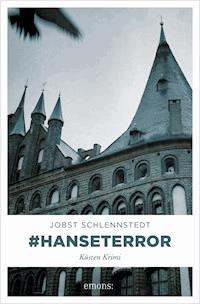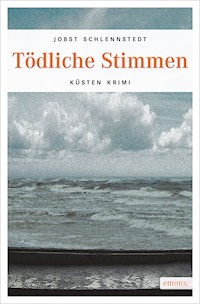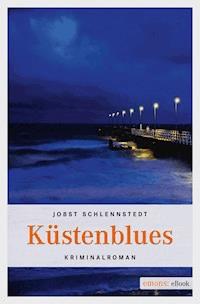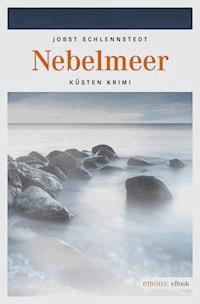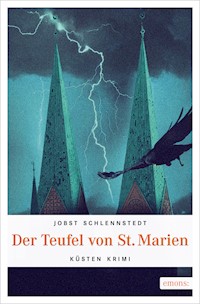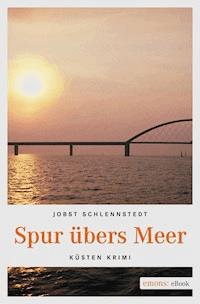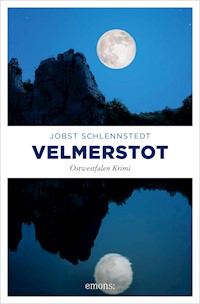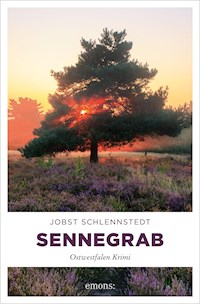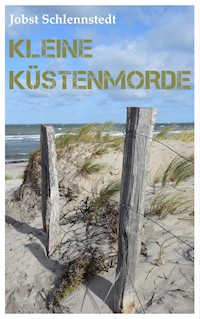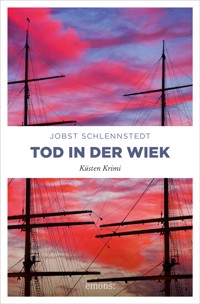
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kommissar Andresen
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Ein temporeicher, authentisch norddeutscher Krimi. Am Ufer des südlichen Priwalls treibt eine Leiche im seichten Wasser. Schnell wird klar: Der Besitzer einer Fischrestaurantkette wurde ermordet. Das Lübecker Ermittlerteam um Kommissar Morten Sandt, der noch mit dem Trauma kämpft, einen Menschen erschossen zu haben, stößt auf eine zerstrittene Familie und etliche Verdächtige. Als der ehemalige Ermittler Birger Andresen, der sich eigentlich zur Ruhe gesetzt hat, einen mysteriösen Anruf erhält, besteht kein Zweifel mehr daran, dass weitere Menschenleben in Gefahr sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 405
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jobst Schlennstedt, 1976 in Herford geboren und dort aufgewachsen, studierte Geografie an der Universität Bayreuth. Seit Anfang 2004 lebt er in Lübeck. Hauptberuflich arbeitet er als Senior Consultant für ein großes dänisches Unternehmen und berät die Hafen- und Logistikwirtschaft. 2006 erschien sein erster Kriminalroman. »Tod in der Wiek« ist sein vierundzwanzigster Roman im Emons Verlag und der dreizehnte Fall des Teams der Lübecker Mordkommission mit dem Ermittler Morten Sandt und Kultkommissar Birger Andresen.
www.jobst-schlennstedt.de
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2024 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: mauritius images/Thomas Ebelt
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Hilla Czinczoll
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-197-3
Küsten Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß §44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Wenn ihr eure Augen nicht gebraucht, um zu sehen, werdet ihr sie brauchen, um zu weinen.
Überleben
Manchmal denke ich, dass mein Leben genau richtig verlaufen ist. Dass ich nichts vermisse und froh darüber sein kann, meinen Weg eingeschlagen zu haben. Ich führe nach außen ein normales Leben. Ich könnte sogar stolz darauf sein, was ich erreicht habe.
Diese Momente sind allerdings selten. Sehr selten sogar.
Um bei der Wahrheit zu bleiben, es sind auch nur recht kurze Augenblicke, in denen ich so denke. Denn eigentlich hasse ich mein Leben abgrundtief. Jede einzelne Sekunde, an jedem verdammten Tag.
Nur wenn ich all das, was geschehen ist, nicht mehr ertragen kann und mit Tabletten oder zu viel Arbeit zu verdrängen versuche, ändert sich mein Gemütszustand. Dann verblasst die Vergangenheit für wenige Stunden, und ich rede mir ein, dass mein Schicksal vielleicht doch nicht so schlecht war. Ich belüge mich dabei selbst. In der Hoffnung, dann auch im nüchternen Zustand akzeptieren zu können, was passiert ist.
Umso frustrierender ist es jedoch, immer wieder einzusehen, dass es nicht funktioniert. Bei klarem Verstand sind die Bilder sofort wieder da. Dann kommt die Wut zurück. Die Wut auf mein Leben. Und auf diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass ich es hasse.
Von diesen Personen gibt es mehr, als ein einzelner Mensch verkraften kann. Aber die meisten sind mir einfach nicht wichtig genug, als dass sich mein Hass dauerhaft bei ihnen verfangen könnte. Ich habe gelernt, diesen Menschen gegenüber gleichgültig zu bleiben. Jede neue Erniedrigung ertrage ich mit einem aufgesetzten Lächeln. Worte verhallen, bevor sie in meinen Gehörgang treten. Abfällige Gesten hinter meinem Rücken stecke ich gedanklich in eine Schublade ganz weit hinten in meinem Kopf.
So kann ich meine Wut besser kanalisieren. Auf die Schuldigen. Auf diejenigen, die mir am meisten zugesetzt haben. Die mich systematisch zerstört haben. Die mich ausgegrenzt und, solange meine Erinnerung zurückreicht, wie aussätzig behandelt haben.
Ich muss fokussiert bleiben. So wie ich es in den beiden letzten Jahren gewesen bin. Endlich ist es mir gelungen, Klarheit zu erlangen. Mir Ziele zu setzen und die dunkle Seite nicht die Oberhand über mich gewinnen zu lassen.
Was geschehen ist, werde ich nicht mehr los. Es gehört zu mir, und das akzeptiere ich mittlerweile. Trotz aller Höhen und Tiefen, die ich auch heute noch durchlaufe, habe ich eine innere Mitte gefunden. Getrieben von meinem Ziel, das mir die Kraft gibt, jeden einzelnen Tag zu überstehen. Denn der Hass auf mein Leben wird unterschwellig immer bleiben.
Ich muss aus dem Schatten heraustreten, in dem ich seit viel zu langer Zeit lebe. In dem mich kaum jemand wahrnimmt. Ich bin da – und gleichzeitig auch wieder nicht. Ein Leben in einem leeren, gut isolierten Raum, aus dem meine Hilfeschreie nicht nach außen dringen.
Die wenigsten wissen, wer ich tatsächlich bin. Wo ich lebe. Niemand ahnt, was ich denke. Was ich plane. Denn wüssten sie es, könnte ich es niemals umsetzen. Ich muss im Verborgenen bleiben. Das ist vielleicht das Wichtigste, was ich dazugelernt habe. Nicht laut zu sein, nicht aufzufallen.
Mir ist vollkommen klar, was zu tun ist. Und das beunruhigt mich manchmal und sorgt für schlaflose Nächte. Denn unter anderen Umständen würde ich das, was ich tun werde, niemals in Betracht ziehen. Ich bin kein Mensch, der anderen Böses will. Der sie zerstören will, wie sie mich zerstört haben. Jeder auf seine eigene Art und Weise. Niemals würde ich jemanden so bestrafen, wie ich es nun zu tun plane. Niemals Menschen zur Rechenschaft ziehen, indem ich sie aus dem Leben reiße.
Aber mein Hass auf mich selbst kann nur verschwinden, wenn ich die Wurzeln meines Übels vernichte. Und zwar so, dass sie niemals mehr nachwachsen können. Niemals mehr Schaden anrichten können. Einfach aus dieser Welt verschwinden.
Ohne ihren Brief hätte ich niemals die Wahrheit erfahren. Ich muss es natürlich auch für sie tun. Ohne ihre Worte würde ich hier jetzt nicht im Mondschein an der Trave sitzen und mich vom leichten Wellenschlag des Wassers gegen den Rumpf der »Passat« beruhigen lassen. Wahrscheinlicher wäre, dass ich wie in den Jahren zuvor unter meine Bettdecke verschwinden würde, geplagt von Depressionen und Ängsten. Diese Zeiten sind vorbei. Und sie hat mir den Weg gewiesen. Auch unser Verhältnis war kaputt, aber der Brief hat alles geändert. Mir war sofort klar, dass ich sie rächen werde. Nichts anderes bin ich ihr schuldig.
Im Gegensatz zu ihr werde ich überleben. Und meine Wut wird nachlassen. Irgendwann werde ich aus dem Schatten treten und ein anderer Mensch sein. Der keine Tabletten mehr braucht, um sich für einen kurzen Moment aus den Fängen der bösen Erinnerungen zu befreien. Einfach nur ein Mensch sein, der leben und lieben kann. Und selbst geliebt wird. So wie ich bin. Mit allen Ecken und Kanten. Aber ohne meine Vergangenheit. Denn niemand wird jemals erfahren, wer ich bin und was ich getan habe.
Getötet. Und nicht nur einmal.
Blinder Passagier
Jan Ahrens lächelte innerlich. Hätte es jemanden gegeben, der ihn wirklich gut kannte, hätte diese Person seine Zufriedenheit wohl direkt wahrgenommen.
Aber es gab niemanden, der ihn besser kannte. Zum Glück. Die größte Angst in seinem Leben bestand darin, zu viel von sich preiszugeben. Zu durchschaubar zu sein. Solange er zurückdenken konnte, hatte er alles dafür getan, seine Gedanken und Gefühle ausschließlich für sich zu behalten. Für andere Menschen war er ein Buch mit sieben Siegeln.
Dreiundvierzig Jahre lang hatte er niemanden an seinem Seelenleben teilhaben lassen. In den ersten Jahren sicherlich noch nicht bewusst, aber er erinnerte sich an Augenblicke, als er bestimmt nicht älter als acht oder neun gewesen war, in denen sich etwas in ihm dagegengestemmt hatte, mit seinen Freunden darüber zu sprechen, wie er sich fühlte und weshalb er manchmal so still und unnahbar war und an anderen Tagen fröhlich und laut. Dass Letzteres schon damals nur eine Fassade war, hatte er nicht verraten.
Genauso wenig sprach er über seine introvertierte Art. Nicht, weil er den Grund nicht kannte – schon damals war ihm ziemlich klar gewesen, was die Ursache für sein Verhalten war. Aber er wollte von Anfang an unter allen Umständen vermeiden, dass von diesen Dingen etwas nach außen drang. Dass irgendjemand davon erfuhr, was ihn zu dem Menschen gemacht hatte, der er selbst als Kind schon gewesen war. Und dass sie schlimmstenfalls sogar dahinterkamen, dass er im Grunde schwach war.
Nach und nach hatte er sich angepasst. Sich gewissermaßen ein zweites Ich zugelegt. Einen neuen Charakter, der das komplette Gegenteil von seinem alten war. Eine Schale, die immer dicker geworden war und sich bis heute fast komplett um ihn gehüllt hatte. Niemand konnte und sollte wissen, dass der Kern darunter ein ganz anderer war. Schüchtern, verletzlich und traumatisiert. Die Umstände, unter denen er aufgewachsen war, hätten wahrscheinlich die wenigsten einfach so wegestecken können. Viele hätten kein halbwegs normales Leben führen können, war er sich sicher. Aber er war stark gewesen. Nicht nur stark genug, um mit dem Erlebten umzugehen. Er hatte sich nach außen in einen anderen, selbstbewussten Menschen verwandelt, den jeder respektierte und vielleicht sogar mochte.
Jan Ahrens lächelte bei dem Gedanken daran erneut. Natürlich nur innerlich.
Die Momente, in denen er sich fragte, wie er diesen Weg so radikal gehen konnte, ohne umzufallen, waren im Laufe der Jahre immer seltener geworden. Das Ganze hatte sich irgendwann verselbstständigt. Manchmal kam es ihm sogar so vor, als existiere sein altes Ich gar nicht mehr. Aber das war nichts weiter als sein innigster Wunsch. Selbstverständlich war er tief im Innern noch immer die Person, die damals als Kind oftmals apathisch gewirkt hatte, weil die Gedanken ständig um das kreisten, was um ihn herum tagtäglich geschah. Niemals würde er diese Dinge ganz abschütteln können. Vollkommen egal, wie sein äußeres Ich sich verhielt.
Jan ließ seinen Blick schweifen. Es gab nicht viele Orte, an denen er sich wohl und unbeobachtet fühlte. Dieser gehörte aber definitiv dazu. Wenn er hier in der Pötenitzer Wiek mit dem Boot ankerte, war es, als würde die Welt um ihn herum stillstehen. Travemünde, im Hintergrund das Maritim, das weit über die Bucht hinausragte, und die Priwallpromenade waren nur einige hundert Meter entfernt, aber dieser Ort hier kam ihm wie ein kleines Paradies vor. Nur ein paar wenige Segelboote, umso mehr Schwäne und Enten, die in Ufernähe zwischen dem Schiff schwammen, und eine Ruhe, die er nicht mehr missen wollte.
Die letzten Tage waren besonders herausfordernd gewesen, rief er sich vor Augen. Mit seinem Bruder so lange auf engstem Raum zusammen zu sein, hatte er sich derart anstrengend nicht ausgemalt, und gleichzeitig war es eine Erfahrung, die sie viel früher hätten teilen müssen. Es war spät dazu gekommen, aber nicht zu spät, um sich auszusprechen und ihr Verhältnis zu kitten.
Auf ihrer kurzen Reise hatte er die meiste Zeit gezweifelt, dass sein Plan funktionieren würde. Als blinder Passagier in ein neues Leben aufzubrechen, während sein Bruder dafür sorgte, dass sein Verschwinden wie ein tragischer Unfall auf der Ostsee aussähe. Und trotzdem hatte er die Hoffnung, Henning davon zu überzeugen, niemals aufgegeben und jeden Tag aufs Neue an ihn appelliert. Es war der einzige Weg, wenn die Sache einen positiven Ausgang für ihn nehmen sollte.
Als sie auf Fehmarn festgemacht hatten, war die Stimmung zwischen ihnen am absoluten Nullpunkt gewesen. Henning war ausgerastet, als Jan ihm die Details seines Plans erzählt hatte. Er hatte ihm schwere Vorwürfe gemacht, sich auf diese Weise aus dem Staub machen zu wollen. Entweder er solle es in Ordnung bringen oder, wenn es dafür längst zu spät sei, mit den Konsequenzen leben.
Einen halben Tag lang hatten sie kein Wort miteinander gewechselt. Erst in Dänemark hatte sich die Situation wieder entspannt. Schließlich hatte Jan einen letzten Anlauf genommen und zu einem Mittel gegriffen, das er eigentlich nicht anwenden wollte. Er musste Henning in die ganze Sache mit reinziehen und hatte damit gedroht, dass im schlechtesten Fall auch dessen Leben nicht mehr sicher sei.
Ein riskanter Zug. Henning hätte erst recht wütend auf ihn sein können. Schließlich waren es seine krummen Geschäfte und finanziellen Probleme, die er lösen musste, und nicht die seines Bruders. Henning hätte den gemeinsamen Segeltörn abbrechen und von Bord gehen können, um zurück nach Kopenhagen zu fahren, wo er mittlerweile seit einem Jahrzehnt lebte.
Aber das Gegenteil war der Fall gewesen. Henning hatte tatsächlich eingewilligt. Oder zumindest hatte er nicht widersprochen. Es war wieder still zwischen ihnen geworden, und es war seinem Bruder deutlich anzusehen, dass ihn die Situation innerlich auffraß. Aber er hatte genickt. Obwohl er Jan wahrscheinlich lieber eine Ohrfeige verpasst hätte, um ihn aufzurütteln.
Auch auf der Rückfahrt nach Travemünde hatten sie nur das Nötigste miteinander gesprochen. Über Windstärken und Koordinaten. Ein paar unverfängliche Anweisungen. Kein Wort über den Plan, den er geschmiedet hatte.
Es war sein Wunsch gewesen, hier in der Wiek zu ankern, bevor Henning morgen in den frühen Morgenstunden noch einmal raus auf die Ostsee fahren würde, um das Ganze durchzuziehen, was er sich ausgedacht hatte.
Danach würde dann auf ihn selbst ein anderes Leben warten, das nichts mehr mit dem bisherigen zu tun hatte. Er würde sein äußeres Ich wieder ablegen und seinem inneren endlich die Chance geben, der Mensch zu sein, der er tatsächlich war. Oder zumindest wieder der, der er als unschuldiges Kind einmal gewesen war.
Oft hatte Jan darüber nachgedacht, wie es sein würde, nie wieder hierherzukommen. Nie wieder jemanden von den Leuten, mit denen er sich täglich umgab, sehen zu können. Er hatte sich gefragt, ob er dieses Leben hier nicht doch stärker vermissen würde, als er sich eingestehen wollte. Aber jede Überlegung endete mit demselben Ergebnis. Er hatte das Leben hier satt. Die Zeit war gekommen, um mit sich selbst und Lübeck zu brechen.
Es dämmerte mittlerweile stark. Spätestens in zehn Minuten würde die Sonne endgültig über Travemünde untergehen. Dann würde er unter Deck gehen, wo sich Henning noch immer ausruhte, den guten Whisky rausholen und mit seinem Bruder auf den letzten Abend anstoßen. Er würde ihm ein letztes Mal alles erklären und ihn auf die Geschichte einschwören, die er ihm in den vergangenen Tagen eingetrichtert hatte.
Vielleicht würden sie sentimental werden, wenn die letzten Stunden anbrachen, aber auf keinen Fall würde er schwach werden, so viel stand fest. Selbst Henning kannte ihn nur als die Person, die er selbst ihm all die Jahre vorgespielt hatte. Niemand wusste von seiner Maskerade, und dabei sollte es bleiben. Auch sein Bruder sollte ihn so in Erinnerung behalten. Nicht als den traurigen, in sich gekehrten Menschen, der er war. Und er hoffte, dass Henning längst vergessen hatte, wie still er schon als Kind gewesen war, weil die Welt um ihn herum ihn überforderte.
Er hatte Henning damals nie gefragt, wie er mit dem Erlebten zurechtgekommen war. Vielleicht hätte er das als großer Bruder tun müssen – etwas, das er sich vorwerfen lassen musste. Ganz zu schweigen von Caroline, deren Leiden er sich gar nicht vorzustellen vermochte. Er hatte ihr nicht geholfen. Niemand war für sie da gewesen. Statt zusammenzuhalten, hatten sie alle geschwiegen.
Sein Bruder und er waren damals wegen Lappalien so sehr in Streit geraten, dass Henning in letzter Konsequenz sogar nach Dänemark ausgewandert war und alle Zelte in Lübeck abgebrochen hatte. Konsequent hatte sein Bruder seinem vorherigen Leben den Rücken gekehrt und das getan, was er selbst nun vorhatte. Ihren Streit hatten sie bis heute nicht aufgearbeitet. Auch in den letzten Tagen auf dem Boot hatten sie dieses Thema nicht angesprochen. Wenn sie etwas gemein hatten, dann die Fähigkeit, über wichtige Dinge einfach den Mantel des Schweigens zu legen.
Der Signalton eines Fährschiffs hallte plötzlich dumpf über die Wiek und den Skandinavienkai auf der anderen Seite der Trave. Jan hatte eine leise Ahnung, dass es die Fähre war, auf die er sich morgen schleichen würde.
Henning wusste, was zu tun war. Nicht nur morgen früh, sondern auch in den kommenden Tagen und Wochen, wenn er mantraartig die Geschichte wiederholen musste, die Jan ihm eingebläut hatte. Nicht nur gegenüber der Polizei durfte er sich dabei nicht widersprechen, sondern bei niemandem, der ihn danach fragte.
Erneut erklang das Schiffshorn. Gefolgt von einem leisen Geräusch im Wasser. Wahrscheinlich ein paar aufgeschreckte Enten, die davonflogen. Es war bereits so dunkel, dass er kaum mehr Details um sich herum erkennen konnte.
Es war an der Zeit, unter Deck zu gehen. Zeit, um auf den Abschied anzustoßen. Und auf das neue Leben. Anschließend musste er noch einmal zurück in seine Wohnung. Das meiste hatte er bereits präpariert, aber das Geld, das für die nächsten Monate reichen sollte, musste er noch holen.
Jan lächelte noch immer still in sich hinein. Aber im nächsten Augenblick zuckte er zusammen. Denn auf einmal spürte er, dass das Boot wackelte. Nur ganz leicht, aber doch wahrnehmbar.
Hatten die Enten und Schwäne etwa eine kleine Welle verursacht?
Er beugte sich ein Stück über die Reling, um nachzusehen, ob er mit seiner Vermutung richtiglag, erkannte aber sofort, dass das Wasser unter ihm spiegelglatt war. Doch im selben Moment spitzte er die Ohren, weil er plötzlich ein leises Knarzen des Rumpfs vernahm. Gefolgt von einem Geräusch, als bewege sich hinter ihm jemand auf dem Bootsdeck.
Jan fuhr herum. In der Erwartung, seinem Bruder in die Augen zu sehen, lächelte er diesmal nicht nur innerlich. Jedoch nur für den Bruchteil einer Sekunde. Dann verfinsterte sich sein Gesicht, ehe es einen Wimpernschlag später von einer Pistolenkugel zerfetzt wurde.
Finger am Abzug
Morten Sandt lachte. Er konnte sich nicht erinnern, wann er zuletzt so gut gelaunt gewesen war. Das Video, das ihm Lea auf dem Handy zeigte, war nüchtern betrachtet nicht sonderlich lustig, aber nach ein paar Bier konnte auch er sich darüber amüsieren, dass Leas Baby eine Schüssel mit Karottenbrei über den gesamten Küchentisch verteilte und anschließend vergnüglich darüber kicherte.
Es war ein schöner Abend bei seiner ehemals besten Freundin, mit der er seit dem Winter in unregelmäßigen Abständen wieder Kontakt hatte. Sie hatten viel über ihre Tochter Malia geredet und auch über so manches andere. Für ein paar Stunden hatte er den Kopf frei bekommen und nicht an die Sache vom vergangenen November gedacht. Die Bilder verfolgten ihn Tag und Nacht wie sein eigener Schatten, hatten ihn längst an den Rand des Wahnsinns getrieben. Die Gespräche mit der Polizeipsychologin waren genauso wenig hilfreich gewesen wie das gute Zureden seiner Kollegen und Kolleginnen. Wobei es im Grunde nur Birger Andresen war, der hartnäckiger versucht hatte, ihm zu helfen.
Alles ohne Erfolg.
Die Kugel, die er Jens Bachmann in den Kopf gejagt hatte, war gewissermaßen omnipräsent. Der Moment, als er den fünffachen Mörder mit einem gezielten Schuss direkt in die Stirn getötet hatte. Viele hatten ihm gesagt, er habe vorbildlich reagiert, weil er schließlich verhindert hatte, dass auch noch die Familienministerin Schleswig-Holsteins Opfer dieses Wahnsinnigen wurde.
Sie alle meinten es bestimmt gut mit ihm. Und doch verstanden sie gar nichts. Wenn die Ministerin von Bachmann getötet worden wäre, hätte sein Leben einen ganz normalen Verlauf genommen. Vielleicht wären sie als Mordkommission stark in die Kritik geraten, weil sie den Tod der Ministerin nicht hatten verhindern können. Aber seine Psyche, sein tiefstes Inneres, wäre an diesem Tag nicht kaputtgegangen.
Er hatte einen Menschen umgebracht. Und vollkommen egal, welcher grausamen Verbrechen sich dieser Mann zuvor schuldig gemacht hatte, er, Morten, hatte über etwas gerichtet, das ihm nicht zustand. Über ein Leben. Niemand, der so etwas nicht selbst erfahren hatte, würde verstehen, was es bedeutete, jemanden ins Jenseits befördert zu haben. Scharfrichter gewesen zu sein, diese finale Entscheidung getroffen zu haben, abzudrücken und ein Menschenleben auszulöschen.
Vielleicht war das, was er jetzt durchmachte, die gerechte Strafe dafür, ging es ihm immer wieder durch den Kopf. Wenn er einfach so weitergemacht hätte wie zuvor, wie würde sich das anfühlen, so zu tun, als wäre es das Normalste auf der Welt, jemanden zu töten? Würde er dann etwa nicht die Last der Verantwortung spüren? Es fiel ihm schwer, sich das vorzustellen. Auch weil er damals nicht vor einer schwierigen Entscheidung gestanden hatte. Denn wenn er ehrlich zu sich war, war es in dem Moment, als sein Finger am Abzug gezuckt hatte, tatsächlich die einzige Option gewesen. Das war die Wahrheit. Er hatte ganz bewusst abgedrückt.
Doch egal was er sich selbst einredete oder die anderen sagten, selbstverständlich hätte es andere Möglichkeiten gegeben. Den Mann ohne Waffengewalt zu überwältigen oder wenigstens auf eine andere Stelle des Körpers zu zielen und ihn so außer Gefecht zu setzen. Vielleicht wären auch Verhandlungen mit ihm möglich gewesen, immerhin hatte Morten im Laufe der Ermittlungen fast so etwas wie ein Vertrauensverhältnis zu Bachmann aufgebaut, als er noch nicht ahnte, dass er der Täter war.
Dass er den finalen Schuss abgefeuert hatte, war im Grunde unverzeihlich und hätte niemals passieren dürfen. Es war der verzweifelte Wunsch gewesen, die ganze Sache endlich zu beenden, nachdem sein Nervenkostüm während der kräftezehrenden Ermittlungen immer dünner geworden war. In diesem Moment hatte er alles, was er in seiner Ausbildung gelernt hatte, missachtet und sich einzig von seinen Emotionen leiten lassen.
Etwas anderes, sehr Persönliches, war durch dieses Ereignis vollkommen in den Hintergrund gerückt. Obwohl es ihm unbewusst sicher immer noch zu schaffen machte, war der Schmerz, den seine Kollegin Elif ihm zugefügt hatte, nur noch eine Randnotiz in seinem Leben.
Eigentlich hatte er damals im Herbst das Gefühl gehabt, nichts stünde mehr zwischen ihnen beiden. Der Moment, in dem sie sich geküsst hatten, war überwältigend gewesen und hätte doch der Beginn von viel mehr sein sollen. Aber das Gegenteil war der Fall. Vielmehr der Anfang vom Ende. Denn danach war alles zwischen ihnen kaputtgegangen. Mit einer Textnachricht hatte sie das zarte Pflänzchen zwischen ihnen brutal zertrampelt. Mit der Ausrede, sie befinde sich seit einigen Wochen in einer Beziehung, war sie auf Distanz zu ihm gegangen.
Bis heute zweifelte Morten jedoch daran, dass das der wahre Grund war. Aber weder hatte er noch einmal bei ihr nachgehakt, noch waren von ihr weitere Erklärungen gekommen. Sie waren sich im Präsidium weitestgehend aus dem Weg gegangen und hatten in den letzten Monaten kaum noch ein Wort miteinander gewechselt.
Wenn da nur nicht diese Alpträume wären, die die beiden einschneidenden Erlebnisse auf so grauenhafte Weise miteinander verbanden. Wenn er mal wieder schweißgebadet aufwachte, weil er gerade abgedrückt hatte und die Kugel Elifs Stirn durchbohrte.
Auf einmal hörte Morten eine Tür ins Schloss fallen.
»Das ist David«, sagte Lea und lächelte beruhigend, als sie merkte, dass er sich erschrocken hatte.
»Dann ist es Zeit für mich zu gehen.« Lea hatte ihm erzählt, dass ihr Mann ein Restaurant in Travemünde leitete. Offenbar hatte er jetzt Feierabend. »Danke für den netten Abend. War schön, dich mal wieder zu sehen und ausführlich zu quatschen.«
»Ja, das fand ich auch. Sollten wir öfter machen. Schade, dass wir heute nicht mehr über deinen Job reden konnten. Ich würde gerne mehr darüber erfahren, wie die Arbeit bei der Kripo so ist. Das muss spannend sein, wenn man den Mördern und Schwerverbrechern das Handwerk legt.«
»Ja, das ist wirklich …« Er brach ab, als er aus dem Augenwinkel erkannte, dass ein groß gewachsener, durchtrainierter Mann in seinem Alter das Wohnzimmer betrat.
»Du musst Morten sein«, sagte David aufgeschlossen. »Lea hat mir einiges über dich erzählt.«
»Tatsächlich?«
»Nur Gutes natürlich«, warf sie schnell ein.
»Ich war mir nicht sicher, ob ich vielleicht ein bisschen eifersüchtig sein muss. Aber wie ich sehe, waren meine Sorgen unbegründet.«
»Wie bitte?«
»Kleiner Scherz.« David schmunzelte und streckte ihm die Hand entgegen. Morten ergriff sie und versuchte, dem festen Händedruck standzuhalten.
»Du arbeitest also bei der Mordkommission?«, fragte David, nachdem er sich ein Bier aus dem Kühlschrank geholt und die Flasche mit einem Feuerzeug aufgemacht hatte.
»Genau«, antwortete Morten knapp und zog sich seine dünne Jacke über.
»Hattest du etwas mit diesen Mordfällen letzten Herbst zu tun?«
»Damit hatten wir alle zu tun, wenn wir die gleiche Sache meinen«, wich Morten aus.
»Muss heftig gewesen sein.«
»Mehr als heftig.«
»Warst du dabei, als der Täter erschossen wurde?«, bohrte David weiter nach.
»Kann man so sagen.«
»War das notwendig?«
»Wie meinst du das?« Morten fuhr sich etwas verunsichert durch seine blonden Haare, die mittlerweile fast Kinnlänge erreicht hatten.
»Nun«, antwortete David und nahm einen Schluck aus der Flasche, ehe er fortfuhr. »Sollte die Polizei denn nicht alles versuchen, um so etwas zu verhindern? Egal was dieser Mann getan hat, das Leben eines Menschen muss –«
»Wenn man keine Ahnung hat, sollte man besser den Mund halten«, fuhr Morten scharf dazwischen. »Das Leben der Familienministerin stand auf dem Spiel.«
»Und das hätte nicht gerettet werden können, wenn der Schuss nicht tödlich gewesen wäre?«
Morten fixierte Leas Mann jetzt. Was wollte dieser Typ eigentlich von ihm? Sie kannten sich seit zwei Minuten, aber er erdreistete sich allen Ernstes, die Arbeit der Polizei in einem der dramatischsten Einsätze der letzten Jahre zu beurteilen.
»Was soll denn das, David?«, mischte sich jetzt auch Lea wieder ein. »Morten und seine Leute werden mit Sicherheit alles dafür getan haben, dass niemand –«
»Woher willst du das denn wissen?«, unterbrach David sie, vehementer als zuvor. »Oder hast du etwa vergessen, was damals mit Lukas passiert ist?«
»Aber das kannst du doch nicht mit der Arbeit von Morten in diesem Mordfall vergleichen«, hielt sie dagegen.
»Wenn es darauf ankommt, sind diese Bullen doch alle gleich«, schimpfte David. »Und am Ende stecken sie alle unter einer Decke, und es dringt natürlich niemals an die Öffentlichkeit, was wirklich passiert ist.«
»Ich war es, der den Täter erschossen hat«, sagte Morten plötzlich mit ruhiger Stimme. »Andernfalls wäre die Ministerin jetzt tot.«
Lea und David verharrten augenblicklich und sahen ihn entgeistert an.
»Wenn du mir also unterstellen willst, dass ich den Mann fahrlässig getötet habe, dann liegst du komplett falsch«, fuhr Morten fort. »Ich habe im vollen Bewusstsein abgedrückt. Mit dem Ziel, ihn mit einem einzigen Treffer zu töten, um das Leben der Ministerin zu retten.«
Seine Worte verhallten. Was blieb, war eine Stille im Raum, die Morten unter normalen Umständen selbst als unerträglich empfunden hätte. Doch in diesem Moment war sie genau das, was er wollte.
»Krank«, murmelte David leise. »Das ist krank. Du bist krank.«
»David, bitte!«, zischte Lea leise.
Morten nickte schweigend und verzog dabei seinen Mund zu einem schrägen Lächeln. Für einen kurzen Augenblick überlegte er, etwas zu erwidern, dann wandte er sich jedoch ab und verließ wortlos die Wohnung.
Vor dem Haus zog er seine Jacke fest zu. Die Luft war abends noch immer kühl, obwohl der Frühsommer längst in den Startlöchern stand. Raschen Schrittes ging er den Reiherstieg vor bis zur Falkenstraße und bog dann nach links. Als er sich über die Hüxtertorbrücke der Altstadt näherte, blieb er stehen und warf einen Blick in die ruhig daliegende Kanaltrave. Der Mondschein erhellte den Abend und glänzte auf dem Wasser unter ihm.
Morten atmete tief durch, ehe er im nächsten Moment unvermittelt zusammenschrak. Die Bilder aus dem Haus der Familienministerin in Kiel stiegen urplötzlich auf. Mit voller Wucht, sodass er keine Chance hatte, sich dagegenzustemmen.
Da war die Waffe in seiner rechten Hand. Der Finger am Abzug. Das Ziel vor Augen.
Morten sah jetzt über den Lauf hinweg und stellte seinen Blick klar. Niemand war zu sehen. Kein Jens Bachmann. Und auch nicht Elif. Er schüttelte sich.
In der Hoffnung, dass die Bilder dieses Mal so schnell wieder verschwanden, wie sie gekommen waren, wollte er seinen Weg nach Hause gerade fortsetzen, als es plötzlich vor seinem inneren Auge blitzte. Im nächsten Moment drückte er ab. Den Flug der Pistolenkugel konnte er gewissermaßen wie in Zeitlupe verfolgen. Genau wie den Augenblick, als sie eine Stirn durchbohrte.
Morten erkannte sie sofort. Und das, obwohl sie ihm erst vor ein paar Minuten zum ersten Mal begegnet war. Zweifelsohne war es die Stirn von David.
Ihm huschte ein Lächeln über die Lippen, als aus Nase und Mund von Leas Mann Blut hervortrat und er schließlich ins Bodenlose fiel.
In dem Moment kamen ihm Davids Worte wieder in den Sinn. Vielleicht hatte er ja tatsächlich recht. Morten war krank.
Allmählich glaubte er es selbst.
Fünfunddreißig Jahre Ehe
Sie hatten sich schon gestritten, als Ulrike ihren etwas sperrigen, aber nagelneuen und rein elektrischen VW in einer schmalen Lücke direkt an der Mecklenburger Landstraße abstellte, obwohl Robert vehement darauf gedrängt hatte, einen breiteren Parkplatz zu suchen. Ob sie denn unbedingt wolle, dass der Wagen gleich ein paar Kratzer abbekäme, hatte er sich echauffiert. Sie solle sich bloß mal die anderen Autos ansehen, dann sei doch wohl klar, dass den Besitzern ein gepflegtes Fahrzeug nichts wert sei. Es sei wohl keine gute Idee, sie den Wagen noch einmal fahren zu lassen, wenn sie nicht darauf achte, wo die Gefahren lauerten.
Ulrike hatte seine Tirade über sich ergehen lassen und dabei zugesehen, wie er ums Auto herumgegangen war, sich hinters Steuer gesetzt hatte und ein paar hundert Meter weiter auf einen Parkplatz gefahren war, der – wie sie beim Vorbeifahren gesehen hatte – voll und ebenfalls eng war. Dennoch verzichtete sie darauf, etwas dazu zu sagen. In solchen Situationen war Robert ohnehin nicht mehr zu bremsen. Sollte er sich ruhig so kleinkariert und spießig benehmen, glücklich machte es ihn bestimmt nicht.
Schweigend waren sie losgegangen und nach einer Weile nach links abgebogen. Nachdem sie ein Wohnviertel hinter sich gelassen hatten, betraten sie schließlich auf Höhe des Alten Seeflughafens den Wald.
Sie kannten den Priwall wie ihre eigene Westentasche. Früher, als sie noch in Travemünde gelebt hatten, waren sie mehrmals die Woche hier auf dem Priwall spazieren gegangen. Mal am Strand oder entlang der alten Promenade mit den Backsteinbauten, die vor einigen Jahren abgerissen worden und einer Flaniermeile, Hotels und Ferienhäusern gewichen waren. Manchmal waren sie aber auch ganz im Süden der Halbinsel entlang der Trave gegenüber dem Skandinavienkai gewandert. Dort, wo die großen Fähren Richtung Norden ablegten.
Damals waren sie allerdings nur selten noch weitergelaufen. Jetzt aber ging es entlang der Pötenitzer Wiek über den Wanderweg und dann auf den Holzsteg hinein ins Naturschutzgebiet. Das Wummern der Schiffsmotoren auf der anderen Traveseite noch immer in den Ohren, war hier die Welt eine ganz andere. Ein kleines Paradies, fernab des touristischen Trubels, mit Flachwasserzonen und einer haffartigen Bucht in der Trave. Der Weg führte vorbei an dichtem Schilfrohr, knochig gewachsenen Kopfweiden und Sanddorn. Ein Ort, an dem man verweilen und den Moment nicht mehr loslassen wollte. Wenn man nicht gerade mit einem pedantischen und besserwisserischen Ehemann unterwegs war.
Ulrike ging schon seit einer ganzen Weile bestimmt zwanzig Meter hinter Robert her. Sie tat so, als suche sie nach seltenen Pflanzen wie der Wiesen-Kuhschelle oder beobachte Enten, Graugänse und Schwäne. Auch bei den Schafen, die hier in den Sommermonaten grasten, blieb sie kurz stehen. Hauptsache, sie musste nicht neben ihm hergehen.
Es war nicht immer so frostig zwischen ihnen gewesen. Als sie beide noch gearbeitet hatten, waren die gemeinsamen Ausflüge und Spaziergänge harmonisch verlaufen. Sie hatten einander erzählt, was sie am Tag erlebten, oder sich darüber beklagt, wie anstrengend die Kollegen doch waren. Und manchmal hatten sie auch einfach nur geschwiegen und es genossen, gemeinsam am Meer zu schlendern.
Lange Zeit war zwischen ihnen alles in Ordnung gewesen. Das hatte sich erst vor etwa fünf Jahren geändert, als sie beide in Frührente gegangen waren und sich ein kleines Reihenhaus in Schlutup gekauft hatten. Plötzlich waren sie den ganzen Tag zusammen. Aber sie hatten sich nichts zu erzählen, weil sie nichts mehr erlebten. Und so hatten sie angefangen, sich gegenseitig immer stärker zu beharken. Robert meckerte an allem herum, was sie tat. Was sie anzog. Was sie kochte. Oder eben, wie sie Auto fuhr.
Und sie? Sie hatte ihm die kalte Schulter gezeigt. War ihm mehr und mehr aus dem Weg gegangen und hatte sich ein paar Hobbys gesucht, von denen sie nie geglaubt hätte, dass sie ihr mal Freude bereiten würden. An zwei Abenden in der Woche belegte sie einen Yogakurs für Frauen über sechzig. Und neuerdings ging sie samstagnachmittags zu einem Kurs, in dem man lernte, Pralinen herzustellen.
So hatte sie Menschen kennengelernt, bei denen sie sich vorstellen konnte, sie auch privat zu treffen und sich mit ihnen anzufreunden. Noch zögerte sie, Robert davon zu erzählen. Würde es ihn stören, wenn sie abends wegging? Oder würde er vielleicht dabei sein wollen? Und vor allem, wollte sie Letzteres überhaupt?
Die Sache war verzwickt. Fünfunddreißig Jahre Ehe auf der einen Seite. Und ein Gefühl des Auseinanderlebens und der Gleichgültigkeit gegenüber ihrem Mann auf der anderen. Wenn es so weiterginge wie in den letzten Wochen oder an diesem Morgen, würde sie es jedenfalls nicht mehr lange mit ihm aushalten.
Konnte es etwa sein, dass er den Verstand verlor, fuhr es ihr plötzlich durch den Kopf. Seit wann hatte sich sein Verhalten so massiv verändert? So richtig hatten seine Stimmungsschwankungen, wenn er von einem auf den anderen Augenblick die Contenance verlor und ihr ohne Unterlass Vorwürfe machte, doch erst in den letzten Monaten eingesetzt, oder nicht?
Genau wie in diesem Moment. Plötzlich gestikulierte er wild und sah wie aufgeschreckt aus. In Erwartung einer neuerlichen Tirade wollte sich Ulrike gerade abwenden und am liebsten ohne ihn den Rückweg antreten, als sie innehielt und stutzte. Irgendetwas stimmte mit Robert nicht. Trotz der Entfernung zu ihm erkannte sie, dass er nicht gut aussah. Im nächsten Moment ging er in die Knie und beugte sich nach vorn.
Ein Gefühl von Angst machte sich in Ulrike breit. War ihm plötzlich schlecht geworden, oder war es etwas Schlimmeres? Robert hatte doch schon immer Angst vor einem Herzinfarkt gehabt.
Sie musste ihm jetzt helfen, beschwor sie sich. Ihrem Mann, von dem sie gerade eben noch gedacht hatte, dass eine Trennung vielleicht die beste Lösung für sie wäre. Für den flüchtigen Gedanken, einfach abzuhauen und ihn zurückzulassen, hätte sie sich vielleicht schämen müssen, aber dieses Gefühl wollte sich einfach nicht einstellen.
Sie atmete tief durch und versuchte, die Geräusche, die Robert von sich gab, auszublenden. Ohne Erfolg. Es hörte sich wie ein leises Stöhnen oder Röcheln an, und im nächsten Moment klang es beinahe furchteinflößend. Als würde er sich vom Teufel höchstpersönlich befreien wollen.
Sie musste sich kümmern, ihm helfen. Aber etwas hielt sie zurück, und das war nicht nur die Befürchtung, ihm gehe es nicht gut. Gab es vielleicht einen ganz anderen Grund für Roberts Verhalten? Hatte er irgendetwas entdeckt?
Ulrike rang mit sich. Sie schloss kurz die Augen, bevor sie sich einen Ruck gab und sich in Bewegung setzte. Sie rannte die wenigen Meter bis zu ihrem Mann und blieb direkt hinter ihm stehen. Eine seltsame Mischung aus Erleichterung und Enttäuschung, für die sie sich ebenfalls schämen sollte, stellte sich bei ihr ein.
Robert hatte keinen Herzinfarkt erlitten. Er musste sich zwar fast erbrechen, aber es ging ihm nicht so schlecht, wie sie befürchtet hatte. Ganz anders als dem menschlichen Körper vor ihnen, der langsam, aber beständig zwischen Schilf und Ufer im seichten Wasser hin und her schwappte.
Dass es Robert schlecht geworden war, konnte sie nur allzu gut verstehen. Denn der Anblick dieser aufgeschwemmten, wahrscheinlich männlichen Leiche war wohl das Schlimmste, was auch sie je gesehen hatte.
Haubentaucher
Morten war froh, dass Ida-Marie sofort gesagt hatte, er könne bei ihr mitfahren, während Elif Ole einsammeln wollte, um so schnell wie möglich auf den Priwall zu kommen.
Eigentlich fühlte er sich alles andere als einsatzbereit. Er hatte nicht mehr als vier Stunden geschlafen, und die auch noch unruhig und geplagt von verstörenden Träumen.
Unter normalen Umständen hätte er sich heute Morgen wahrscheinlich krankgemeldet. Wie so häufig in den vergangenen sechs Monaten, wenn die Nächte eine einzige Qual gewesen waren. Der Triggermoment des gestrigen Abends hatte alles noch einmal verschlimmert. Die Bilder, und noch viel mehr die Gedankenspiele, die dahintersteckten, beunruhigten ihn zunehmend.
»Wie fühlst du dich?«, unterbrach Ida-Marie Berg, die Leiterin der Mordkommission, seine Überlegungen.
»Was meinst du?«
»Denkst du etwa, man würde nicht merken, dass es dir nicht gut geht?«
»Eigentlich versuche ich mein Bestes, es mir nicht ansehen zu lassen.«
»Das gelingt dir aber nicht.«
»Ist mir egal«, entgegnete Morten. »Irgendwann wird es schon besser werden. Zeit heilt alle Wunden, davon bin ich überzeugt.« Er spürte selbst, dass seine Worte alles andere als überzeugend klangen, aber ehe er noch etwas ergänzen konnte, fuhr Ida-Marie in Höhe Wesloe plötzlich rechts ran und stellte den Motor ab. Dann wandte sie sich ihm zu.
»Ich habe kein Rezept, wie du die Sache gut hinter dir lassen kannst«, sagte sie mit ernster Stimme, »aber ich weiß, dass es nicht besser wird, wenn du dich dafür entscheidest, zu schweigen und es mit dir selbst auszumachen. Du kannst jederzeit zu mir kommen, wenn du reden willst, aber noch wichtiger ist, dass du dir professionelle Hilfe suchst. Und damit meine ich nicht nur unsere Polizeipsychologin.«
»Ja, vielleicht hast du recht«, reagierte Morten ausweichend.
»Streiche ›vielleicht‹«, entgegnete Ida-Marie streng. »Ich werde dich genauestens beobachten. Du brauchst nicht zu denken, ich würde zulassen, dass du daran kaputtgehst.«
Sie wartete nicht auf eine Antwort von ihm, sondern startete den Motor wieder und fuhr schwungvoll an.
In den folgenden fünfundzwanzig Minuten wechselten die beiden kein Wort mehr miteinander. Erst als sie auf die Mecklenburger Landstraße auf der zu Travemünde gehörenden Halbinsel Priwall einbogen, räusperte sich Ida-Marie und setzte erneut an.
»Birger und ich hatten vor einigen Jahren mal einen Fall, der für mich um ein Haar ganz übel ausgegangen wäre. Vielleicht erinnerst du dich an die Geschichte mit dem ›Horrorhaus auf dem Priwall‹, wie es die Zeitungen titulierten? War ein ziemlich großes Ding in den Medien.«
»Klar«, antwortete Morten. Er hatte damals noch mitten in seiner Ausbildung gesteckt, aber dieser Fall hatte niemanden bei der Polizei oder auch in der Bevölkerung kaltgelassen. Und er hatte Birger Andresens Image als scharfsinnigster und bester Kriminalkommissar Schleswig-Holsteins noch weiter verfestigt.
»Ich habe damals zwar niemanden getötet, aber die Ermittlungen waren verdammt heftig für mich. Ich hatte anschließend auch eine schwierige Zeit, und nicht nur, weil ich mich bei dem finalen Einsatz schwerer verletzt hatte und im Krankenhaus lag.«
»Jeder hat seine eigenen Probleme«, sagte Morten und machte durch seinen Tonfall keinen Hehl daraus, dass er eigentlich keine Lust auf dieses Gespräch hatte. Er wollte keine klugen Ratschläge und sich nicht sagen lassen, wie er mit der Sache umzugehen hatte.
Niemand im Team hatte bislang einen Menschen durch einen gezielten Kopfschuss getötet, also verstanden sie auch nicht, wie er sich fühlte. Und selbst wenn Ida-Marie recht damit hatte, dass er sich besser öffnen und über das Geschehene reden sollte, hatte er gerade nach gestern Abend erst einmal genug davon, dass sich überhaupt jemand in sein Leben einmischte. Jeder meinte zu wissen, was am besten für ihn wäre. Oder noch schlimmer, dass er damals im Herbst fahrlässig gehandelt hatte. Niemand steckte in seiner Haut. Und niemand hatte eine Ahnung davon, welche Bilder und Gedanken ihn plagten.
Sie parkten am Wendehammer im Pötenitzer Weg unweit des Alten Seeflughafens. Diverse Einsatzfahrzeuge waren hier kreuz und quer abgestellt. Morten erkannte auch den BMW von Harald Seelhoff, dem Leiter der Kriminaltechnik. Zwei Streifenpolizisten sprachen in ihre Funkgeräte und nickten ihnen zu, als sie sie erblickten.
Ida-Marie stellte sich und Morten kurz vor, woraufhin man ihnen erklärte, dass sie einen knappen Kilometer durch den Wald laufen und sich in Richtung des Holzstegs orientieren mussten, in dessen Nähe die Leiche zwischen Schilf und einem kurzen sandigen Uferabschnitt gefunden worden war. Weitere Beamte würden an Wegabzweigungen warten, um sie zum Tatort zu leiten.
Sie bedankten sich und betraten den Wald. Während sie um das ehemalige Flughafengelände herumgingen, das zwischen den beiden Weltkriegen als sogenannte Seeflugzeug-Erprobungsstelle genutzt worden war, wurde Morten bewusst, dass er sich hier, abseits der touristischen Pfade auf dem Priwall, gar nicht auskannte. Obwohl er schon oft gelesen hatte, dass diese Gegend besonders schön und naturbelassen wäre. Überhaupt gab es in Lübeck und Umgebung, teilweise in nächster Nähe zu den touristischen Hotspots, so viele Kleinode, dass er sich oft genug ärgerte, nicht häufiger den Hintern hochzubekommen, um sie zu erkunden. Dass er den Wanderweg entlang der Pötenitzer Wiek nun ausgerechnet im Rahmen einer Tatortbegehung kennenlernen würde, warf jedoch einen Schatten auf diesen Ort.
Als sie den Wald hinter sich gelassen hatten und den Bereich in Ufernähe erreichten, überkam Morten zum ersten Mal seit Monaten ein Gefühl absoluter Ruhe. Die dunklen Gedanken verschwanden von einem auf den anderen Moment, als sich vor ihnen die Wiek auftat. Die Bucht lag sanft und unberührt da. Gar nicht weit von Travemünde entfernt, schien es fast, als befände man sich in einer anderen Welt.
Einzig die Kollegen der Kriminaltechnik sowie zahlreiche Beamte der Ordnungspolizei störten dieses Bild. Sie hatten bereits den Weg und den gesamten Uferbereich mit rot-weißem Flatterband abgesperrt. Auch das Equipment der Kriminaltechnik war längst aufgebaut.
Morten nickte den Kollegen zu und ging wortlos vor bis ans Wasser, wo Seelhoff und sein langjähriger Mitarbeiter Siederdissen, beide in weiße Schutzoveralls gekleidet, in ein Gespräch vertieft standen. Zu ihren Füßen lag mit knapp einem Meter Abstand eine männliche Leiche auf einem schmalen Sandabschnitt.
Der Körper sah leicht aufgequollen aus, was ein klares Anzeichen dafür war, dass er eine ganze Zeit lang im Wasser getrieben und dann an Land geschwemmt worden war. Mortens Blick blieb allerdings an der Stirn des Opfers hängen. Ein Einschussloch befand sich über dem linken Auge. Eine weitere Kugel hatte das linke Jochbein regelrecht zerschmettert. Wer immer das getan hatte – das Trefferbild machte nicht den Eindruck, als wäre ein geübter Schütze am Werk gewesen. Kein Vergleich zu seinem perfekten Schuss exakt zwischen die Augenbrauen von Jens Bachmann.
»Moin.« Morten blieb eine halbe Körperlänge von den zwei Kriminaltechnikern entfernt stehen. Seit er Teil der Mordkommission war, wurde er das Gefühl nicht los, die beiden erfahrenen Kollegen hätten ein Problem mit ihm. Vielleicht war es aber auch einfach nur ein vertrautes Gesicht wie das von Birger Andresen, das ihnen fehlte.
»Kein schöner Anblick«, sagte Siederdissen in seinem typisch mürrischen Tonfall. »Wahrscheinlich lag die Leiche schon eine ganze Weile im flachen Wasser. Wir haben sie vorsichtig an Land geschafft. Da es gestern recht warm war, ist der Fäulnisprozess bereits in Gang gekommen. Die äußere Verwesung dürfte bald schon beginnen.«
»Könnt ihr denn einschätzen, wie lange genau sie im Wasser getrieben ist?«, fragte Morten.
»Es ist zu früh, sich darauf festzulegen«, warf Seelhoff ein. In seiner Stimme klang etwas Mahnendes mit, worauf Morten sofort die Augen verdrehte. Wollte er ihn wirklich belehren, dass sie keine voreiligen Schlüsse ziehen durften?
Seelhoff wandte sich von ihm ab, um in Denkerpose seinen Blick über die Pötenitzer Wiek schweifen zu lassen. »Ich würde schätzen, dass dieser Mann seit mindestens drei Tagen tot ist, aber das ist Aufgabe der Rechtsmedizin. Was die Spurenlage angeht, ist das hier im Sand alles andere als einfach. Dieser Bereich wird ohne Unterlass von leichten Wellen überspült. Unmöglich, hier zum Beispiel Fußabdrücke zu finden. Wenn es denn überhaupt welche gegeben hat.« Seelhoff hielt kurz inne und wies aufs Wasser. »Siehst du das Segelboot dort hinten?«
»Natürlich.«
»Das sollten wir uns mal näher ansehen.«
»Weil das Opfer dort erschossen wurde, ins Wasser gestürzt ist und dann hier angespült wurde?«
»Vom Himmel dürfte der Mann jedenfalls nicht gefallen sein«, kommentierte Siederdissen sarkastisch. »Und an Land haben wir bislang tatsächlich keinerlei Spuren außer denen der Leute, die den Mann entdeckt haben, gefunden.«
Morten verkniff sich einen Kommentar. Offenbar wollte der Kollege die Zusammenfassung der Ergebnisse nicht einem Jungspund wie ihm überlassen.
Er war froh, als Ida-Marie zu ihnen trat und sich nach dem aktuellen Stand erkundigte. Während Seelhoff ihr in aller Kürze berichtete, was er bezüglich des Segelboots und des ungefähren Todeszeitpunkts vermutete, zog Morten sich einige Meter zurück. Er wich dem Flatterband aus und ging den Wanderweg ein Stück entlang, bis sich zu seiner Linken hinter Sträuchern ein weiterer schmaler Zugang zum Wasser auftat. Er schob ein paar Äste beiseite und folgte dem Pfad.
Die Morgensonne glitzerte auf der Wasseroberfläche, ein paar Haubentaucher trieben scheinbar ziellos umher. Zweifellos ein traumhafter Ort. Wenn da nicht fünfzig Meter von Morten entfernt eine männliche Leiche mit zwei Kugeln im Kopf gelegen hätte. Und rund hundert Meter vor ihm in der Wiek ein Segelboot ankern würde, auf dem sich möglicherweise ein Verbrechen ereignet hatte.
Es mussten also schon einige Tage vergangen sein, seit dieser Mann erschossen worden war. Die Leiche war, wie es Siederdissen gesagt hatte, kein schöner Anblick, und dennoch hatte Morten nichts empfunden, als er sie inspiziert hatte. Kein flaues Gefühl oder Unbehagen, geschweige denn Ekel. Stattdessen vollkommene Gleichgültigkeit.
Trotzdem weckten der Fundort und die gesamte Szenerie die kriminalistischen Geister in ihm. Wer war der Tote? Was war auf diesem Boot vorgefallen? Und vor allem, was würde sie dort noch erwarten?
Gloria
»Das Boot heißt ›Gloria‹ und gehört Christian Ahrens. Es scheint den Namen seiner Mutter zu tragen«, verkündete Ida-Marie und ließ die Worte erst einmal wirken.
Morten sah in die Gesichter der anderen. Sie hatten sich vom Fundort zurückgezogen und dort, wo sie ihre Einsatzwagen abgestellt hatten, ein provisorisches Lagezentrum eingerichtet.
Nicht allen schien sofort klar zu sein, wer Christian Ahrens war. Auch Morten war sich nicht ganz sicher, hatte aber eine Ahnung. Ahrens war, wenn er sich richtig erinnerte, Wirtschaftssenator in Lübeck gewesen. Zu einer Zeit, als er selbst noch Teenager gewesen war, also mittlerweile vor knapp zwanzig Jahren. Er hatte das Bild von jemandem vor Augen, der schon damals ergraut gewesen war und für ihn wie ein Dinosaurier aus einer anderen Zeit gewirkt hatte. Dass er sich heute bisweilen genau solche Typen zurückwünschte, irritierte Morten manchmal selbst. Vielleicht lag es einfach daran, dass auch er allmählich älter wurde und schon bald zu den jungen Dinosauriern gehören würde.
»Trotz der Schussverletzungen im Gesicht können wir uns anhand von Fotos, die wir auf die Schnelle im Internet gefunden haben, wohl sicher sein, dass es sich um Jan Ahrens, den Sohn des ehemaligen Wirtschaftssenators, handelt«, fuhr Ida-Marie fort. »Der ein oder andere kennt ihn vielleicht.«
Jetzt stand auch Morten auf dem Schlauch. Musste er diesen Mann kennen?
»Jan Ahrens war ein erfolgreicher Unternehmer«, erklärte Ida-Marie. »Er war Gründer und Inhaber von Kutterfutter, der Fischrestaurant-Kette.«
Nun fiel der Groschen bei Morten, und wie er aus den Augenwinkeln erkannte, nicht nur bei ihm. Der Gastronomiebetrieb Kutterfutter hatte vor einigen Jahren ein erstes Restaurant an der Obertrave in Lübeck eröffnet und in kürzester Zeit mit einem modernen und gleichzeitig regionalen Konzept großen Erfolg gehabt. Im Laufe der Zeit waren diverse weitere Restaurants entlang der Küste hinzugekommen.
Obwohl in der Presse ziemlich oft über den Betrieb berichtet wurde, war ihm Jan Ahrens als Person kein Begriff. Auch das Gesicht hatte er nicht vor Augen. Selbst wenn, hätte er die Leiche nicht mit ihm in Verbindung bringen können.
»Jan Ahrens kommt eigentlich aus dem Marketing«, warf Mortens Kollege Ole Andresen jetzt ein, wobei er sich zuerst über seine Glatze und anschließend durch den dichten Kinnbart fuhr. »Er war kein Koch, hatte aber offenbar einen guten Riecher für passende Locations und ein modernes Konzept. Kutterfutter hat sich in kürzester Zeit zu einer sehr bekannten Marke entwickelt. Ich habe neulich erst einen Artikel über ihn gelesen. Eine Homestory in einer überregionalen Zeitung, verdammt dick aufgetragen und fast ein wenig unangenehm, wie er sich da profiliert hat. Aber der Fisch schmeckt wirklich gut.«
Den letzten Satz hatte Ole noch schnell hinterhergeschoben. Offenbar hatte er gemerkt, dass seine Worte in dieser Situation etwas pietätlos wirken könnten.
Mit Birger Andresens Sohn Ole hatte Morten bislang noch immer wenig zu tun gehabt. Das lag in erster Linie daran, dass Morten nach der Sache im November bis ins neue Jahr krankgeschrieben gewesen war. Anschließend hatte es in ihrem Kommissariat nur kleinere Ermittlungen gegeben, die den Einsatz eines größeren Teams nicht erforderlich machten. Hinzu kam Mortens Gefühl, dass Ole sich als Neuling bei der Kripo profilieren und so schnell wie möglich in die Fußstapfen seines Vaters treten wollte.
In den vergangenen Wochen hatte sich Morten trotz seiner persönlichen Probleme aber Gedanken darüber gemacht, wie sie in Zukunft ein normales Arbeitsverhältnis pflegen sollten. Er war zu dem Entschluss gekommen, ihre kleinen Rangeleien zu ignorieren. Wenn das Verhältnis zu Elif schon schwierig war, wollte er wenigstens mit Ole keine Probleme haben.
Zumal es ja auch noch dessen Vater Birger gab, der sich zwar inzwischen aus der alltäglichen Polizeiarbeit zurückgezogen hatte, aber mit dem jederzeit zu rechnen war, wenn ihn eine Ermittlung reizte oder sie ihn um Hilfe baten. Obwohl es mit Birger nicht immer unkompliziert gewesen war, mochte und respektierte Morten ihn. Und er hatte das Gefühl, dass es ihm mit Ole ähnlich ergehen könnte.
Im nächsten Augenblick sah er, dass die Techniker aus dem Waldstück zurückkamen. Offenbar hatten sie die Inspektion auf dem Segelboot bereits abgeschlossen. Er war gespannt auf die Ergebnisse, hätte er sich auf dem Boot doch am liebsten selbst umgesehen. Aufgrund der beengten Situation und der Gefahr, Spuren zu verwischen, hatten sie jedoch entschieden, nur wenige Techniker an Bord zu schicken.
An Seelhoffs Seite erkannte Morten Jannik Unger, einen Kollegen, der erst seit letztem Jahr bei der Kripo arbeitete. Sie hatten gemeinsam ihre Ausbildung an der Polizeischule in Eutin absolviert.
Zu seiner Überraschung gab Seelhoff Jannik ein Zeichen, dass er ihnen berichten sollte. Der glatzköpfige Chef der Kriminaltechnik selbst blieb dagegen etwas abseits stehen und fingerte sein Handy aus der Hosentasche unter seinem Overall hervor.
»Harald lässt sich entschuldigen«, begann Jannik selbstsicher. »Er muss dringend telefonieren, irgendetwas mit einem Handwerker. Ich hoffe, ihr kommt damit zurecht, dass ich euch erzähle, was wir auf dem Boot gefunden haben.«
»Selbstverständlich«, sagte Ida-Marie leicht genervt. »Aber spann uns doch bitte nicht länger auf die Folter.«
»Um es gleich vorwegzunehmen, der Mord fand zweifellos an Bord der ›Gloria‹ statt. Wir haben Blutspuren an Deck gefunden, die wahrscheinlich vom Todesopfer stammen. Die Tatsache, dass der Mord schon einige Tage zurückliegt, macht es leider nicht ganz so einfach für uns. Wir werden das Boot aber abschleppen, es uns in Ruhe vornehmen und jeden Quadratzentimeter unter die Lupe nehmen.«
»Gibt es denn irgendetwas, das einen Hinweis auf einen möglichen Täter liefert?«, hakte Ida-Marie nach.