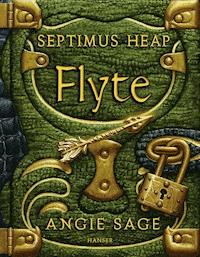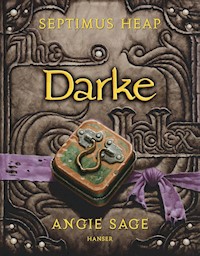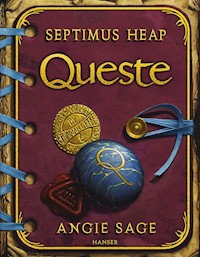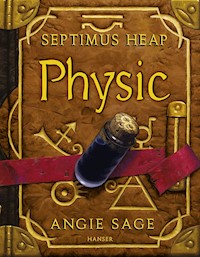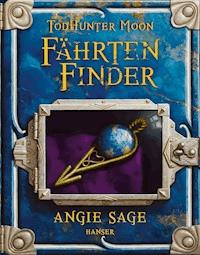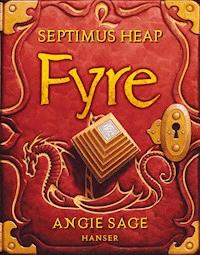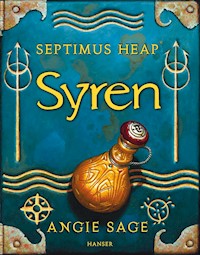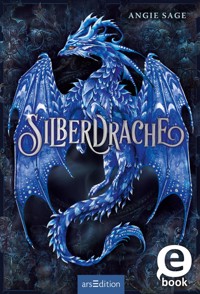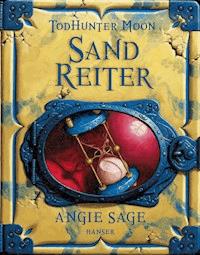Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: TodHunter Moon
- Sprache: Deutsch
Der böse Hexer Oraton-Marr scheint besiegt. Doch es droht neue Gefahr. Die eiskalte Rote Königin plant, die Burg an sich zu reißen und Königin Jennas Platz einzunehmen. Um die Macht der Burg abzusichern, macht sich Todi auf eine gefährliche Reise und riskiert dabei ihr Leben. Das dritte Fantasy-Abenteuer der jungen FährtenFinderin Todi und ihrer Freunde – voller Magie und Spannung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der böse Hexer Oraton-Marr scheint besiegt. Doch es droht neue Gefahr. Die eiskalte Rote Königin plant, die Burg an sich zu reißen und Königin Jennas Platz einzunehmen. Um die Macht der Burg abzusichern, macht sich Todi auf eine gefährliche Reise und riskiert dabei ihr Leben. Das dritte Fantasy-Abenteuer der jungen FährtenFinderin Todi und ihrer Freunde – voller Magie und Spannung.
Angie Sage
TODHUNTER MOON
STERNENJÄGER
Aus dem Englischen von Reiner Pfleiderer
Mit Illustrationen von Mark Zug
Carl Hanser Verlag
Für Milo Wishart
Marwicks Karte der Alten Wege
Inhalt
TEIL 1
Das Gemach der Königin
Die Vorladung
Verschwörung beim Tee
Fischgesicht
Eine Pille für eine Tüte Kraane
TEIL 2
Staub im Auge
Erste Vorkehrungen
Charm-Unterricht
Im Sandwich-Zauberland
Drei Uhr morgens
Spurensuche
TEIL 3
Das Orm-Baby
Eine letzte Chance
Drammer Makken
Schlappechsen
Im Drachenzwinger
TEIL 4
Ein Brief
Grula-Spiele
Im Schlangenschlupf
Der Schlaf der Orm
TEIL 5
Auf Wolverinen-Art
Begegnung im Wald
Auf der Flucht
Patschuli
Im Orm-Nest
TEIL 6
Schneegestöber
Am runden Tisch
Spaziergang auf der Mauer
TEIL 7
Ein getretener Wurm krümmt sich
Kegeln
Die Partytüte
Ausgerissen
Aus der Warte einer Ratte
Runter und rauf
Eine Kettenreaktion
Eine Ratte berichtet
Synchronschwimmen
TEIL 8
Ein Beinahezusammenstoß
Im Fernwald-Knoten
Furcht und Flucht
Auf Irrwegen
Atmen
Begrüßung
TEIL 9
Ein Vorschlag
Ein Falke wird gemietet
Ein Paar Augenblender
Falkenaugen
Jerras Weigerung
Geblendet
Schlangengezüngel
Ein Übermaß an Königinnen
TEIL 10
Wachablösung
Ausgeknockt
Nach Hause
Geheimnisse
Strich und Sichel
Der Metallfisch
Der Bund der Drei
Auf Fischfang
TEIL 11
Auf dem Unterwasserpfad
Im Bauch des Metallfisches
Eine technische Neuheit
Das Sieb
Die Kapsel
Der wandernde Mond
Driffa übernimmt
Der Schlussstein
Ein Teppich aus Grulas
TEIL 12
Bings Schnurbotschaft
Vergeltung
Mittsommerkreis
Zwei Welten werden eins
Ausklänge und Anfänge
Dank
TEIL 1
Das Gemach der Königin
Die letzten Echos des Mittagsläutens verklangen. In einem geheimen Gemach tief im Herzen des Roten Palastes standen drei staubbedeckte Frauen vor der Roten Königin. Das Gemach war sechseckig und nur spärlich beleuchtet von einem Schlitzfenster. Das Fenster war hoch oben in die einzige Wand eingelassen, die an den zentralen Garten grenzte. Trotz seiner prächtigen Ausstattung wirkte das Gemach wie ein Kerker.
Von ihrem goldenen Thron, der auf einem Podest stand, blickte die Königin auf die Frauen herab. »Und wo«, verlangte sie zu wissen, »woist der Zauberer, nach dem ich geschickt habe?«
Die Frauen gaben keine Antwort. Aber nicht, weil sie keine Antwort wussten, sondern weil der Wächter an der Tür sie gewarnt hatte: Wenn ihnen ihr Leben lieb sei, sollten sie immer fünf Sekunden warten, bevor sie antworteten. Die Rote Königin ärgere sich nämlich über Untertanen, die über ihre Antworten nicht gründlich nachdachten.
Die drei Frauen fühlten die stahlblauen Augen der Königin auf sich gerichtet. Zwei taten so, als betrachteten sie interessiert die roten und goldenen Fußbodenfliesen. Die dritte, die jüngste, blinzelte unter ihren gesenkten Wimpern hervor.
Die Rote Königin musterte die Frauen. Die Erste, eine ungepflegte Dicke, die in ihrem blauen Seidenkleid wie ein schlampig gepacktes Paket aussah, wurde die Lady genannt und war die Schwester des Zauberers, nach dem die Königin gefragt hatte. Zu ihrer Linken stand Mitza Draddenmora Draa, ihre Gehilfin: eine Frau so breit wie hoch, mit Raubvogelgesicht, straff nach hinten gekämmtem Haar und einem Mund so schmal wie eine Messerklinge. In Mitza erkannte die Rote Königin eine verwandte Seele.
Die dritte Frau war fast noch ein Mädchen. Die Königin betrachtete sie aus zusammengekniffenen Augen. Sie wusste nicht viel von ihr, nur dass sie Marissa hieß. Sie hatte einen unverschämten Blick und war für den Geschmack der Königin merkwürdig aufgemacht: Sie trug ein ledernes Stirnband im Haar, in das Perlen geflochten waren, einen staubigen grünen Umhang und schwere Stiefel. Sie war hübsch, aber schmuddelig und der Königin überhaupt nicht sympathisch. Diese Marissa hatte etwas von einer Hexe.
Marissa spürte, dass die Rote Königin sie prüfend ansah, fasste sich ein Herz und schielte nach oben. Ihre Blicke begegneten sich. Die Königin witterte etwas Finsteres und Verschlagenes hinter der gut einstudierten Unschuldsmiene Marissas. Gerade als sie überlegte, ob sie dieser Hexe nicht lieber gleich den Kopf abhacken sollte, bevor sie Schwierigkeiten machen konnte, war die Fünf-Sekunden-Pause verstrichen, und die Lady setzte stammelnd zu einer Antwort an.
»Ma… Majestät. Mein Bruder ist krank …« Ihre Stimme versagte unter dem starren Blick der stahlblauen Augen.
Die Königin erwiderte nichts. Sie fixierte einen Punkt knapp über den Köpfen der Frauen und überlegte, wie sie vorgehen sollte. Sie wusste, dass alle Vorteile bei ihr zu liegen schienen und dass die drei Frauen dachten, sie wären ihr hilflos ausgeliefert, aber das stimmte nicht. Die Frauen besaßen den Schlüssel zu etwas, das der Königin versprochen war. Sie wollte es – und sie wollte es jetzt. Mit einem Gefühl tiefer Sehnsucht dachte sie an die ferne Burg, die ihr der Zauberer versprochen hatte, an die schönen alten Häuser, die er ihr beschrieben hatte, und an ihre folgsamen Bewohner, die sich nach einer starken Herrscherin sehnten. Ganz zu schweigen von dem üppigen Umland, das ihr ebenfalls gehören sollte: den grünen Äckern und Wiesen, dem nahen Wald, dem breiten Fluss, der die Burg mit der wohlhabenden Stadt Port verband, wo er ins Meer mündete. Die Rote Königin begehrte diese Burg so sehr, dass es wehtat. Sie hatte genug von dem trockenen roten Staub und der Hitze in ihrer Stadt, von der Enge und den vielen Menschen, den Bettlern, die sich vor den Stadtmauern drängten. Ihre Untertanen waren griesgrämige Dummköpfe, die ihr nicht so gehorchten, wie sie sollten – es wäre wunderbar, noch einmal von vorn anzufangen. Die Königin senkte den Blick auf den Sonnenstrahl, der durch das Schlitzfenster fiel und einen weißen Streifen auf den roten Fußboden warf. Sie sehnte sich nach dem sanften Grün der Burg, ihrer Burg.
Doch das hätte die Rote Königin niemals offen zugegeben. Sie hatte noch nie etwas bekommen, nur weil sie sich danach sehnte, und sie erwartete nicht, dass sich daran etwas ändern würde. Sie musste besonnen zu Werke gehen, um zu bekommen, was sie wollte. Drohend erfüllte ihre tiefe Stimme den Raum: »Ich habe nicht nach dem Befinden des Zauberers gefragt. Ich habe nach seinem Verbleib gefragt. Also noch einmal: Wo ist der Zauberer?«
Die Schwester des Zauberers brachte mühsam hervor: »Ma… Majestät, m… mein Bruder befindet sich im Gastfried, dem königlichen Gästeturm. Dafür sind wir Ihnen sehr verbunden. Nur dank Ihrer unendlichen Güte und Gastfreundlichkeit ist …«
Die Königin schnitt ihr das Wort ab. »Was hat er dort verloren?«, bellte sie. »Ich habe ihn Schlag Mittag zu mir bestellt. Warum ist er nicht hier?«
Die Frau in Blau wagte kaum zu wiederholen, was sie bereits gesagt hatte, doch ihr fiel nichts anderes ein. Dünn und verängstigt drang ihre Stimme aus dem Bündel blauer Seide. »Weil … weil er krank ist, Majestät.«
»Niemand ist zu krank, um meiner Aufforderung Folge zu leisten. Niemand.«
Hilfesuchend schielte die Lady zu ihren Begleiterinnen, doch die wichen ihrem Blick aus. Das machte sie noch nervöser. »Majestät, ich flehe Sie an. Mein Bruder kann nicht aufstehen. Er hat schreckliches …« Abermals versagte ihr die Stimme.
»Schreckliches was?«
»Kopfweh.« Die Lady hatte das Wort kaum ausgesprochen, da wusste sie, dass sie einen Fehler begangen hatte. Es klang wie eine billige Ausrede. Wieder kehrte Stille ein, nur wollte sie diesmal kein Ende nehmen.
Die Lady hörte draußen im Garten die Brunnen plätschern und hatte das Gefühl, dass ihr Leben verrann wie das Wasser aus den Brunnen.
»Kopfweh«, wiederholte die Rote Königin schließlich, als wäre das Wort ein Stück Hundedreck, das sie an ihrem Schuh entdeckt hatte. »Der mächtige Zauberer Oraton-Marr hat … Kopfweh?«
»Ja, Majestät«, antwortete seine untröstliche Schwester. »Es ist wirklich schlimm. Wirklich ganz schlimm. Sie …«
»Ruhe!«, brüllte die Königin, ehe sie mit leiser, unheilvoller Stimme fortfuhr: »Ich habe ein Mittel gegen Kopfweh.« Ihre Hand strich über das Schwert, das in einer links am Thron baumelnden Scheide steckte. »Wenn Ihr Bruder meiner nächsten Vorladung nicht nachkommt, werde ich ihn von seinem Wehwehchen erlösen. Ich werde dafür sorgen, dass er keinen Kopf mehr hat, der ihm wehtun kann. Verstanden?«
»J… ja, Majestät«, stammelte die Lady.
»Nun fort mit euch.«
Die Tür hinter ihnen schwang auf, und die Frauen schlüpften rückwärts hinaus, erstaunt, dass ihnen eine Gnadenfrist gewährt wurde. Doch sie wussten, dass diese Frist nicht von langer Dauer sein würde.
Die Vorladung
Oraton-Marr lag bäuchlings auf seinem Bett wie schon seit vielen Wochen. Neben ihm saß seine Schwester, noch ganz zittrig von der Audienz bei der Königin. »Orrie«, flüsterte sie sorgenvoll, »geht es dir etwas besser?«
»Grrr«, war die ganze Antwort.
Die Schwester ließ nicht locker. »Orrie, es ist nämlich so, dass die Königin ungeduldig wird. Sie möchte ihre Burg. Du weißt schon, die, aus der diese Gören und der Drache stammen. Und die du ihr versprochen hast.« Sie verkniff sich zu sagen, die du ihr blödsinnigerweise versprochen hast, obwohl sie dir gar nicht gehört. Die Lady hatte gelernt, dass es besser war, ihren Bruder in seiner gegenwärtigen Verfassung nicht aufzuregen.
Als Antwort kam ein weiteres Stöhnen.
»Sie wird dich wieder zu sich bestellen, Orrie. Und wenn du dann nicht zu ihr gehst, wird etwas Furchtbares geschehen, fürchte ich. Ich glaube …« Die Lady hielt inne. Sie wagte kaum, es in Worte zu fassen, doch ihre Verzweiflung war groß. Irgendwie musste sie ihren Bruder dazu bringen, vom Krankenlager aufzustehen. »Ich glaube, sie wird dir den Kopf abschlagen.«
Oraton-Marr fand, dass ihm die Königin nur einen Gefallen tun würde, wenn sie ihm den Kopf abschlug. Der war im Moment ohnehin zu nichts zu gebrauchen. Er fühlte sich an, als würde jemand ein glühendes Eisen durch ihn hindurch treiben und ihn damit ans Bett nageln. Oraton-Marr konnte so wenig zur Königin gehen, wie er zum Mond fliegen konnte. »Gut«, sagte er.
Es war vier Uhr morgens, kurz vor der Dämmerung, wenn die Nacht am finstersten ist, als ein furchterregendes Klopfen an der Tür des Gastfrieds sämtliche Bewohner des Turms aus dem Schlaf schreckte. Die Lady setzte sich im Bett auf und lauschte mit ängstlich aufgerissenen Augen dem Pochen, das die Treppe heraufhallte. Sie kletterte aus dem Bett, schlüpfte in ihren Seidenmantel und schlich ins Erdgeschoss hinab. In der Vorhalle traf sie auf eine wild dreinblickende Mitza, die einen Hammer in der Hand hielt, und eine zerzauste Marissa, die ein langes Nachthemd trug, unter dem ein Paar derbe, fluchttaugliche Stiefel hervorlugten. Die drei Frauen starrten auf die schwere Eingangstür, die unter den wuchtigen Schlägen erzitterte.
»Was sollen wir tun?«, flüsterte die Lady.
Mitza verstärkte den Griff um den Hammer. »Wir müssen aufmachen, Mylady«, antwortete sie. »Und feststellen, was sie wollen.«
»Aber wir wissen doch, was sie wollen«, entgegnete die Lady. »Sie wollen Orrie.«
»Dann werden sie ihn auch bekommen«, gab Mitza in kühlem Ton zurück.
Plötzlich hörte das Klopfen auf, und von der anderen Seite der Tür ertönte der Ruf: »Im Namen der Königin, öffnen Sie!«
»Wir sollten aufmachen«, empfahl Marissa. »Sonst schlagen sie die Tür ein. Es ist besser, wenn wir uns entgegenkommend zeigen.«
Die Lady wusste, dass Marissa recht hatte, aber etwas mehr Widerstand hätte sie sich schon gewünscht. »Dann mach auf«, sagte sie beleidigt.
In ihrer mädchenhaftesten Stimme flötete Marissa: »Einen Augenblick noch! Für uns Frauen ist das etwas schwierig.« Unter lautem Stöhnen schob sie den langen Riegel zurück, dann zog sie die Tür auf, warf das Haar zurück, lehnte sich schwer gegen die Tür und keuchte wie nach einer heftigen Anstrengung.
Ihr Anblick verschlug den drei Gardisten die Sprache. Es dauerte eine Weile, ehe einer herausbrachte: »Verzeihung, Miss.«
Der Hauptmann der Garde fand die Fassung wieder. Er trat vor, wobei er es standhaft vermied, Marissa anzusehen, und schwenkte eine Schriftrolle mit rotem Siegel.
»Ich habe hier eine königliche Vorladung für den Zauberer Oraton-Marr.«
Die Lady streckte ihm ihre zitternden Pummelhände entgegen. »Ich bin seine Schwester. Ich werde sie ihm geben.«
Doch der Hauptmann gab die Schriftrolle nicht her. »Madam, ich habe den Befehl, sie dem Zauberer persönlich auszuhändigen. Bringen Sie mich zu ihm. Unverzüglich!«
Die Lady sah ein, dass es keinen Sinn hatte, mit dem Hauptmann zu streiten, und führte ihn die Treppe hinauf. Die beiden anderen Gardisten sahen ihnen nach, bis sie verschwunden waren, dann wandten sie sich Marissa zu.
»Was macht denn ein hübsches Mädchen wie du in einem solchen Haus?«, fragte der Jüngere.
Marissa kicherte. »Dasselbe wie du. Ich tue, was man mir sagt.«
»Bist du eine Art Dienstmädchen oder so was?«
»Mehr so was«, antwortete Marissa und öffnete beiläufig die obersten Knöpfe ihres Nachthemds. »Was guckst du denn so?«, fragte sie plötzlich.
»Äh … dein … äh … Schlüssel«, stotterte der junge Gardist. »Er sieht … äh … sehr hübsch aus«, schloss er lahm.
»Ach so, der Schlüssel«, erwiderte Marissa mit gelangweilter Stimme und hob den schmucklosen Eisenschlüssel hoch, den sie an einem grünen Band um den Hals trug. »Das ist der Schlüssel zur Burg. Den würde die Königin liebend gern in die Hände bekommen.«
Das war zu viel für den jungen Gardisten, der knallrot anlief. »Ha! Ich mit Sicherheit auch«, prustete er nervös heraus.
»Still!«, blaffte der ältere Gardist, den es ärgerte, dass Marissa nicht auch mit ihm schäkerte.
»Dann nehmt ihr den Zauberer also mit?«, fragte Marissa.
»Dazu dürfen wir nichts sagen, Miss«, brummte der Ältere.
»Wenn er jetzt nicht mitkommt, schauen wir später noch mal vorbei«, sagte der Jüngere. »Als Überraschung.«
»Gute Idee«, kicherte Marissa. »Wie schlau ihr seid. Und was ist die beste Zeit, um Zauberer zu überraschen?«
Der Ältere trat zwischen die beiden und stieß den Jüngeren grob zur Seite. »Hör auf damit, Nummer drei – sonst gibt es Ärger.«
Der junge Gardist gehorchte. Stille legte sich über die Vorhalle, und sie lauschten den Geräuschen oben. Bald näherten sich Schritte, und der Hauptmann kam wieder die Treppe herunter – ohne die Schriftrolle, aber mit der Lady im Schlepptau. »Bitte«, flehte sie verzweifelt, »bitte, Sie müssen doch gesehen haben, dass er unmöglich aufstehen, geschweige denn in den Palast gehen kann.«
»Ich überbringe nur die Vorladung«, knurrte der Hauptmann. »Es ist nicht meine Aufgabe zu beurteilen, was die Empfänger können und was nicht.« Damit marschierte er zur Tür, und die beiden Gardisten folgten ihm. Marissa hatte es so eingerichtet, dass sie verträumt an einer Säule lehnte, und als der junge Gardist an ihr vorbeikam, flüsterte er ihr zu: »Bis morgen früh um drei.« Er zwinkerte. »Das ist die beste Zeit, um Zauberer abzuholen.«
Marissa lächelte. »Ich kann es kaum erwarten.«
Dann waren die Gardisten der Königin fort, und kühle Nachtluft strömte durch die Tür herein, die sie weit offen gelassen hatten. Mit einem Schrei der Verzweiflung sank die Lady zu Boden.
Während Mitza neben ihr niederkniete und unbeholfen Trost spendete (in der einen Hand noch den Hammer, mit der anderen aus sicherem Abstand die Lady tätschelnd wie einen bissigen, kleinen Hund), schloss Marissa die Tür und schob den Riegel vor. Dann trat sie zu dem Häuflein Elend am Boden und sagte: »Ich habe einen Plan.«
Die Lady schaute mit verzweifelter Miene zu ihr auf. Wie konnte Marissa einen Plan haben? Sie war doch nur eine strohdumme Göre.
Marissa wusste genau, was die Lady in diesem Augenblick dachte. Es störte sie nicht. Sollte sie es ruhig denken. Sie würde noch früh genug merken, dass sie sich irrte.
Verschwörung beim Tee
Marissa führte die Lady und Mitza zu den Diwanen, die sich in der Vorhalle an den Wänden entlangreihten. Sie ließ sie Platz nehmen, holte weiche Decken, legte sie ihnen um – die Lady zitterte noch vor Schreck – und bat sie zu warten, solange sie Pfefferminztee hole. Dann schlich sie in der Hoffnung, dass die anderen ihre Stiefel nicht bemerkten, in die Gesindeküche.
Sie entzündete den kleinen Spirituskocher, setzte Wasser auf und dachte über ihr weiteres Vorgehen nach. Von einer Genesung des Zauberers würde sie mehr profitieren, als sie den beiden anderen gegenüber jemals zugeben würde. Bevor Oraton-Marr mit einem Kopfweh-Trank vergiftet worden war, hatte er fest daran geglaubt, bald den berühmten Zaubererturm in seine Gewalt zu bringen und der mächtigste Zauberer der Welt zu werden. Entsprechend großzügig war er mit seinen Versprechen gewesen. Nicht nur, dass er der Roten Königin die Burg versprochen hatte. Obendrein hatte er Marissa sein Wort gegeben, sie zur Hexenmutter der Wendronhexen zu machen, zur Chefin jenes Hexenzirkels, der im Wald direkt neben der Burg hauste. Und er hatte sich von ihr sogar die Zusage abringen lassen, dass der Zirkel zum ersten Mal überhaupt ein Domizil in der Burg bekommen würde. Sie hatte bereits eine hübsche Häuserreihe am Burggraben ins Auge gefasst.
Wie die Rote Königin wollte auch Marissa nicht von dem Traum lassen, mit dem Oraton-Marr sie geködert hatte. Für sie gab es immer noch viel zu gewinnen. Sie spielte gern mit hohem Einsatz, und bei diesem aufregenden Spiel winkte am Ende ein verlockender Preis. Aber sie musste behutsam zu Werke gehen.
Sie kehrte, ein Tablett mit gesüßtem Pfefferminztee und Safranwaffeln tragend, leisen Schrittes in die Vorhalle zurück. Bemüht, bescheiden zu wirken – was ihr nicht ganz gelang –, stellte sie das Tablett auf den niedrigen Tisch vor dem Diwan, sank auf die Knie und schenkte Tee ein. Sie wartete, bis sich die Lady und Mitza bequem in die Kissen zurückgelehnt hatten, dann begann sie, immer noch kniend, zu sprechen. Dabei verwendete sie für Oraton-Marr bewusst den Titel, auf den der Zauberer selbst immer bestanden hatte, bevor ihm der Kopfweh-Trank verabreicht wurde. »Wir müssen alles Notwendige tun, um Seine Hoheit zu retten.«
»Aber was können wir denn tun?«, rief die Lady. »Am Tor stehen Wachen.«
»Wir könnten ihn hinausschmuggeln«, schlug Mitza vor. »Ihn in einen Sack stecken. Die Wachen würden ihn für Rüben halten.«
Die Lady sah sie entgeistert an. »Orrie? Rüben? In einem Sack?«
Marissa verkniff sich ein Grinsen. Sie würde den Zauberer liebend gern in einen Sack stecken – und dann von der Spitze des Gastfrieds werfen –, aber sie musste an ihre Zukunft denken. »Es ist ganz einfach«, sagte sie. »Wir müssen Seine Hoheit so weit kurieren, dass er der Vorladung der Königin Folge leisten kann – und was noch wichtiger ist, dass er den Zaubererturm in seine Gewalt bringen kann.«
»Aber wie?«, heulte die Lady.
»Ich werde zu der Apothekerin gehen und das Gegenmittel holen …«
Doch die Lady hörte gar nicht zu. Der ganze aufgestaute Ärger und Groll über ihren Bruder brach sich nun Bahn. »Er ist ein hoffnungsloser Fall! Ich habe ihn davor gewarnt, auf die Orm zu setzen, solange sie noch gar nicht ausgebrütet ist, aber er wollte nicht hören. Und dann hat er dieser grässlichen Königin ein Versprechen gegeben, das er unmöglich halten kann. Und selbst wenn er wieder auf die Beine kommt, was soll er denn ohne die Orm mit dem Zaubererturm anfangen? Er wird niemals so mächtig, dass er einen solchen Ort beherrschen könnte. Im Leben nicht.«
Marissa bemerkte, dass Mitza die Lady schockiert ansah.
»Im Leben nicht«, wiederholte die Lady trotzig. »Ich kenne meinen Bruder. Er braucht alles an Lapislazuli, was er kriegen kann, um wenigstens ein halbwegs brauchbarer Zauberer zu werden. Gut, er kennt ein paar schwarzmagische Tricks und kann ein paar bösartige Kreaturen herbeizaubern, aber er hat nie eine richtige Ausbildung genossen.«
Marissa schenkte eifrig Tee nach und hörte mit großem Interesse zu. Die Lady machte ihrer Enttäuschung über ihren Bruder weiter Luft, bis sie schließlich, ermattet vom eigenen Geschimpfe, verstummte.
»Genau genommen«, sagte Marissa, »ist die Orm ja schon dort, wo Seine Hoheit sie haben will: in der Burg. Wie ich höre, will man sie unter dem Zaubererturm buddeln lassen, sodass reichlich Lapislazuli für ihn vorhanden wäre. Der Turm steht ohnehin schon auf einem Berg von dem Zeug. Bald wird es dort so viel Lapislazuli geben, dass jeder den Turm beherrschen könnte.« Marissa gab ein Kichern von sich. »Sogar meine Wenigkeit.«
»Was?«, platzte Mitza heraus. »Ein Spatzenhirn wie du? Wir wollen nicht übertreiben, Mädchen.«
Marissa hätte ihr am liebsten einen Tritt versetzt, sagte aber nur: »Miss Mitza, nehmen Sie doch noch etwas Tee.« Sie goss ihr ein und eilte dann die Treppe hinauf, um ihren Hexenmantel zu holen. Im Zimmer der Lady steckte sie noch ein Bündel Geldscheine und ein paar wertlose Schmuckstücke ein für den Fall, dass sie jemanden bestechen musste, dann rannte sie wieder nach unten und schnurstracks zur Tür.
»Marissa«, rief die Lady verdrossen. »Wo willst denn du hin?«
Marissa blieb in der offenen Tür stehen. »Zu der Apothekerin. Um das Gegenmittel gegen die Kopfschmerzen zu holen. Ich muss mich sputen, damit ich noch einen Kamelzug erwische.«
»Aber Marissa …«, rief die Lady, als die Tür schon zuging.
»Was ist denn noch?«, fragte Marissa.
»Du wirst kaum vor Mitternacht zurück sein. Was soll ich tun, wenn sie vorher Orrie holen kommen?« Die Stimme der Lady steigerte sich zu einem Heulen.
Am liebsten hätte Marissa geantwortet: »Wen kümmert es, was du tust, du doofe alte Schachtel?« Aber sie beherrschte sich. »Das werden sie nicht«, rief sie zurück und knallte die Tür zu.
Mitza watschelte zur Tür und schob den Riegel vor. »Sie wird es nicht bekommen. Dieses Aas von Apothekerin wird der dummen Hexe das Gegenmittel niemals geben. Ganz ausgeschlossen!« Mitza schüttelte grimmig den Kopf.
Die Lady seufzte. »Aber wenn es jemand dieser grässlichen Karamander Draa abschwatzen kann, dann Marissa. Sie wirkt zu allem entschlossen, findest du nicht? Mir ist sie fast schon unheimlich, um ehrlich zu sein.«
Mitza war überrascht, wie offenherzig die Lady mit ihr sprach, ließ es sich aber nicht anmerken. Überhaupt war ihr aufgefallen, dass die Lady sie zunehmend ins Vertrauen zog und viel umgänglicher war, seit Oraton-Marr das Bett hüten musste. Mitza begriff, dass sie sich von der Dienerin zur Gefährtin wandelte – und vielleicht sogar zur Freundin. Zwar wusste sie nicht genau, was eine Freundin eigentlich war, aber die Vorstellung gefiel ihr. Als Freundin würde sie mehr Einfluss bekommen. Und wahrscheinlich auch besseres Essen.
Mitza überlegte sich ihre Antwort genau. »Diese Hexe hat wirklich etwas, Mylady«, sagte sie. »Trotzdem glaube ich nicht, dass die Apothekerin ihr den Heiltrank geben wird. Sie wird nicht vergessen haben, dass Seine Hoheit ihre Kinder geraubt hat.«
»Aber er hat sie ja nicht behalten«, protestierte die Lady leicht gereizt. »Er hat sie ihr doch zurückgegeben.«
Mitza nickte. »Das stimmt. Obwohl es mir ein Rätsel ist, warum die Apothekerin sie zurückhaben wollte. Der Kleine ist ein nervtötender Schreihals. Und die Große eine freche Rotznase.« Mitza seufzte. »Aber Kinder sind ihren Eltern eben teuer, wie es so schön heißt. Und das kann hin und wieder ganz nützlich sein.« Sie lächelte und entblößte dabei ihre weißen Zähne, die, klein und scharf, ganz dicht beieinanderstanden. »In mancher Hinsicht sogar sehr nützlich. Haha.«
Die Lady sah Mitza verdutzt an. Manchmal war ihr die Frau nicht geheuer.
Mitza war jetzt in Fahrt. »Vielleicht hat Marissa die Absicht, einem der Kinder etwas anzutun und es als Druckmittel zu benutzen. Ich könnte mir vorstellen, dass das funktioniert.«
»Ich auch«, entgegnete die Lady mit leichtem Unbehagen. Dann hellte sich ihre Miene auf. »Na ja, solange sie mit dem Gegenmittel wiederkommt, werde ich sie nicht fragen, wie sie es gekriegt hat.«
Mitza schwieg. Das Gespräch über Kinder und ihre Eltern hatte sie an Alice TodHunter Moon und an die Burg erinnert, in der das Mädchen jetzt lebte. Falls sich in nächster Zeit die Gelegenheit bieten sollte, dorthin zu reisen, würde auch sie vorher eine Apothekerin aufsuchen müssen. Sie wollte auf keinen Fall unvorbereitet sein, wenn es zu einer Begegnung mit der jungen Alice kam. Eine solche Gelegenheit durfte sie nicht ungenutzt lassen. Mitza hasste verpasste Gelegenheiten.
Fischgesicht
Die Dämmerung brach an. Marissa eilte durch das Bettlertor, den einzigen unbewachten Zugang zur Roten Stadt, und reihte sich in die Schlange vor dem Kamelzug ein. Während sie wartete, sah sie sich um. Vor ihr erstreckte sich ein Lager, das aus Zelten jeder Form, Größe und Beschaffenheit bestand, angefangen bei zerlumpten Decken, die über ein paar Stöcke gespannt waren, bis hin zu großen, runden Behausungen aus reich bestickten Stoffbahnen, die recht schön waren. Die Bewohnerschaft war bunt gemischt und bestand aus Bettlern, Freigeistern, Kriminellen, Zauberern, Rebellen und Außenseitern – Menschen, die nicht unter dem strengen Regiment der Roten Königin leben wollten. Nicht von ungefähr wurde das Lager die »Stadt der Freien« genannt.
Während Marissa in der Schlange langsam vorrückte und den schnaubenden Kamelen immer näher kam, blickte sie auf das Meer von Zelten. Viele schimmerten im Schein von Kerzen, die in ihrem Innern brannten. Im grauen Dämmerlicht sahen sie viel einladender aus als der Kamelzug vor ihr. Marissa verfolgte das frühmorgendliche Treiben, beobachtete, wie Feuer entfacht wurden, lauschte dem Murmeln gedämpfter Gespräche und sog den Duft frisch gebrühten Kaffees ein. Dann blickte sie hinaus in die leere Wüste dahinter und hinauf zum Himmel, an dem die letzten Sterne funkelten. Marissa war an die Enge von Wald und Stadt gewöhnt. Die leere Weite der Wüste machte ihr Angst.
Um die Angst zu bezähmen, richtete sie ihre Aufmerksamkeit auf die Kamele vor ihr. Sie sah ihren dampfenden, warmen Atem in der Luft, hörte ihr Schnauben, spürte, wie der Boden unter dem Stampfen ihrer Füße erzitterte, und beobachtete ihren plumpen, schlingernden Gang, wenn sie mit Reitern lostrotteten. Von dem Anblick wurde ihr auch nicht wohler, im Gegenteil.
Also lenkte sie ihre Gedanken zurück auf die Ereignisse in den frühen Morgenstunden. Besonders in Erinnerung geblieben war ihr, was sie zu Mitza über den Zaubererturm gesagt hatte: Jeder könnte ihn beherrschen. Sogar meine Wenigkeit. Mitzas verletzende Antwort klang ihr noch in den Ohren. Sie hatte genug von Leuten, die sie respektlos behandelten. Wenn sie erst im Zaubererturm herrschte, würde sie es ihnen zeigen. Dann würde es niemand mehr wagen, sie herabzusetzen. Der Gedanke berauschte sie: Hexenmutter und Chefin im Zaubererturm! Warum sollte eine Hexe nicht im Zaubererturm herrschen? Mit all dem neuen Lapislazuli, den die Orm produzierte, konnte dort praktisch jeder herrschen, der ein wenig magisches Talent besaß. Man brauchte nur den Mumm, hineinzumarschieren und es zu tun. Und sie, dachte Marissa mit einem Lächeln, hatte mehr Mumm als jeder andere, den sie kannte.
Die Schlange rückte wieder ein Stück vor, und Marissas Hintermann trat auf ihren Mantel. Befeuert von der Begeisterung über ihre mögliche künftige Stellung fuhr Marissa herum und funkelte den Mann gebieterisch an, worauf der eingeschüchtert zurückwich und sich eilends entschuldigte. Mit einem zufriedenen Grinsen drehte sie sich wieder nach vorn. Daran könnte sie sich gewöhnen.
Plötzlich fand sie sich an der Spitze der Warteschlange wieder. Ihr Grinsen wich einem Ausdruck des Widerwillens, als sie »ihr« Kamel in Augenschein nahm. Es war ein großes, struppiges Tier, dem büschelweise Haare ausfielen und ein halbes Ohr fehlte. Seine gelben Augen musterten Marissa mit unverhohlener Bosheit. Außerdem roch es nicht gut.
»Wohin, kleines Fräulein?«, fragte der Kameltreiber.
Da plötzlich kam ihr eine Erkenntnis: Sie wollte gar nicht, dass Oraton-Marr wieder gesund wurde. Sie wollte nicht, dass er sie wieder herumkommandierte und verspottete. Und schon gar nicht wollte sie, dass er den Zaubererturm bekam – den wollte sie nämlich für sich haben.
Marissa beäugte den Kameltreiber: klein, runzelig und braun wie eine Nuss von der Wüstensonne. Sie sah sein einzähniges Lächeln und seinen verschlagenen, berechnenden Blick und antwortete ihm höchst vergnügt: »Nirgendwohin, Fischgesicht.« Dann machte sie auf dem Absatz kehrt und eilte davon.
Eine Pille für eine Tüte Kraane
Marissa folgte dem Weg ins Lager hinunter und wanderte langsam zwischen den Zelten umher. Sie sprach ein paar Leute an und fragte sie nach dem, was sie suchte, und zehn Minuten später fand sie sich vor einem schönen Zelt mit verblassten roten und blauen Streifen wieder. Auf einem Schemel stand eine kleine Handglocke. Marissa klingelte damit und wartete. Mehrere Minuten verstrichen, und sie wollte schon wieder gehen, da spähte eine kleine Frau mit durchdringenden blauen Augen misstrauisch aus dem Zelt.
»Ja?«, fragte sie.
»Sind Sie Apothekerin?«, erkundigte sich Marissa.
»Und wenn?«, gab die Frau unwirsch zurück.
Marissa zückte die Geldscheine, die eigentlich für Karamander Draa bestimmt gewesen waren, und streckte sie ihr auf der flachen Hand hin, so wie man einem Pferd einen Zuckerwürfel anbietet.
Die Frau betrachtete das Geld: Es war mehr, als sie in mehreren Monaten verdiente. »Komm herein, Schätzchen«, forderte sie Marissa auf. »Du hast Glück. Du hast die beste Apothekerin in der Stadt der Freien gefunden. Hier bekommst du alles, was dein Herz begehrt.« Sie bedachte Marissa mit einem verschmitzten Blick. »Und hier werden keine Fragen gestellt, meine Hübsche, überhaupt keine Fragen.«
Marissa gab ihr das Geld und trat in das halbdunkle Zelt, in dem es nach bitteren Pulvern und öligen Moschusessenzen roch.
Eine Stunde später huschte Marissa unbemerkt in den Gastfried zurück. Begleitet von einem Schnarchen, das mehrstimmig die Treppe herab drang, bereitete sie Oraton-Marrs Lieblingslimonade zu und stellte sie zusammen mit einer Schale Zuckermandeln – der einzigen Nahrung, die er noch zu sich nehmen konnte – auf ein Tablett. Neben die Schale legte sie die grüne Pille, die sie gegen das Bündel Geldscheine eingetauscht hatte. Barfuß und auf leisen Sohlen trug sie das Tablett die Steintreppe hinauf zu Oraton-Marrs Zimmer. Als sie die Tür aufstieß, bauschten sich die langen weißen Musseline-Vorhänge am Fenster sanft im kühlen Morgenwind.
Der Zauberer lag bäuchlings auf einem einfachen, niedrigen Bett, das mit einem Leintuch bezogen war. Seine grünen Augen, stumpf vor Schmerz, beobachteten, wie Marissa leichtfüßig den Raum durchquerte. Als sie mit dem Tablett neben ihm niederkniete, versuchte er ein Lächeln. Es wurde nur ein schwaches Lächeln, wie Marissa bemerkte. Sie war sich sicher, dass ihm nicht mehr viel Zeit blieb. »Guten Morgen, Hoheit«, flüsterte sie. »Ich habe Ihnen etwas gebracht, um die Kopfschmerzen zu lindern.«
Oraton-Marr stöhnte. »Nichts … wird sie lindern«, brachte er mühsam hervor. »Nur … nur die Apothekerin …«
»Ich war bei der Apothekerin«, erwiderte Marissa, wohl wissend, dass Oraton-Marr annahm, sie würden von ein und derselben Apothekerin sprechen.
Hoffnung glomm in seinen Augen auf. »Sie hat dir etwas gegeben?«, fragte er leise.
»Sie hat mir das hier gegeben.« Sie zeigte ihm die grüne Pille.
»Für mich?«, fragte er.
Oraton-Marrs Gesichtsausdruck erinnerte Marissa an einen bettelnden Hund. Sie fühlte sich davon abgestoßen, verbarg aber ihren Widerwillen. »Sie ist wirklich für Sie, Hoheit«, antwortete sie. »Und hier ist eine Limonade, damit Sie sie besser schlucken können.«
Mit einem qualvollen Röcheln hob der Zauberer den Kopf.
Marissa schloss die Finger um die Pille und hielt sie in der Faust. »Aber vorher«, fuhr sie leise fort, »vorher möchte ich etwas von Ihnen.«
Oraton-Marr ließ den Kopf wieder sinken und stieß einen Schmerzensschrei aus. »Du willst etwas dafür …«, murmelte er, als sein Kopf ins Kissen plumpste. »Aber natürlich …« Er sah Marissa in die Augen. »Nenne mir deinen Preis. Ich werde ihn bezahlen.«
»Ich brauche einen Leibwächter«, sagte Marissa. »Einen, der wirklich furchteinflößend ist.«
»Wie furchteinflößend?«, fragte Oraton-Marr.
Marissa beugte sich vor. Oraton-Marr bemerkte, dass ihr Atem süß nach seinen Zuckermandeln roch. »Extrem furchteinflößend«, flüsterte sie. Marissa hatte nämlich darüber nachgedacht, wie sie den Zaubererturm von seinen derzeitigen Bewohnern räumen konnte. »Außerdem sollte er besonders auf Zauberer Jagd machen. Ach ja, und natürlich auch auf Lehrlinge.«
Oraton-Marr riss verwundert die Augen auf. Aber ihm war zu elend, um Marissa weitere Fragen zu stellen. Alles, was er wollte, war die Pille. »Ich … hätte da etwas«, krächzte er.
»Ich wusste es«, frohlockte Marissa.
Oraton-Marr sagte nichts. Marissa hatte großes Glück, dass er das Gewünschte hatte. Er war ein fahrender Zauberer und reiste mit leichtem Gepäck, ohne viele magische Utensilien, die im Zauberergewerbe sonst üblich waren. Was er besaß, verwahrte er in einer Holztruhe, die er im Hinblick auf die Stellung, die er im Zaubererturm einzunehmen gehofft hatte, unlängst lila hatte lackieren lassen. Ihr Inhalt bestand aus verschiedenen gestohlenen Charms, Erzeugerformeln und Talismanen – von denen ihm in seiner gegenwärtigen Verfassung keiner von Nutzen war. »Kraane«, flüsterte er. »In der Truhe. Sie töten … jeden … der grüne Augen hat.«
Marissa durchwühlte die Truhe, in der alles voll Sand war. Sie hatte keine Ahnung, wonach sie suchte. Und so zog sie einen Gegenstand nach dem anderen heraus und zeigte ihn Oraton-Marr, bis sie einen weichen schwarzen Lederbeutel mit Zugband in die Höhe hielt. »Ja«, grunzte er.
Marissa wog den Beutel in der Hand. Er war sehr schwer für seine Größe. Sie zog das Band auf und spähte hinein. Der Beutel war voll glänzender roter Glasperlen. »Und wie funktionieren die?«, fragte sie.
»Gebrauchsanweisung … liegt bei«, hauchte Oraton-Marr. »Nimm sechs Perlen. Nur sechs. Sie ergeben einen Kraan.«
»Ich nehme den ganzen Beutel«, entschied Marissa, schüttelte ihn und lauschte dem gläsernen Klirren der Perlen, als wären sie ein Spielzeug.
Oraton-Marr stöhnte. Das Geräusch bohrte sich wie Nadeln in seine Trommelfelle. Wehmütig blickte er auf den schwarzen Lederbeutel. Die kleinen roten Perlen würden ihm fehlen. Eigentlich hatte er die Kraane bei der Eroberung des Zaubererturms zum Einsatz bringen wollen – nachdem er sich vorher eine Sonnenbrille besorgt hatte, versteht sich. Aber er würde jeden Preis bezahlen, den die Hexe verlangte, wenn sie ihm nur die grüne Pille gab, die ihn von den Kopfschmerzen erlöste.
Erst als er die Pille geschluckt hatte und langsam in einen tiefen Schlaf wegdämmerte, fiel ihm etwas auf: Marissa hatte gar nicht ausdrücklich gesagt, dass die Pille seine Kopfschmerzen heilen würde.
Mit dem schweren Kraane-Beutel in der Tasche, schlüpfte Marissa durch eine Pforte auf einen leeren Hof, in dem sich nichts weiter befand als ein Ablaufkanal mit kühlem, klarem Wasser und eine einzelne Palme in der Mitte. Sie trat in den schattigen Fleck unter dem Baum und verschwand.
TEIL 2
Staub im Auge
Es war kühl und noch früher Morgen in der Burg, als sich Septimus Heap mit seinem jungen Lehrmädchen Alice TodHunter Moon, von den meisten kurz Todi genannt, auf den Weg zu seinem ältesten Bruder Simon Heap machte.
Beim Gang durch die Zaubererallee, jene breite Straße, die vom Zaubererturm zum Palast führte, hielten sie sich in der Mitte, um dem frühmorgendlichen Treiben auszuweichen, das mit der Öffnung der vielen Läden und Betriebe auf beiden Seiten einherging. Die tief stehende Sonne blinzelte über die niedrigen Dächer und brachte die hohen silbernen Fackelpfähle so heftig zum Glitzern, dass der Schein der noch brennenden Flammen dagegen verblasste. Am anderen Ende der Zaubererallee bogen Septimus und sein Lehrling scharf rechts in die Schlangenhelling ab, eine viel schmälere, gewundene Gasse, die zum Burggraben hinabführte und auf beiden Seiten von Häusern gesäumt war. Die größeren und imposanteren Häuser standen auf der rechten Seite, doch es waren die kleineren auf der linken, die Septimus und Todi ansteuerten. Bald kam das Wasser des Burggrabens in Sicht, das am Ende der Helling träge dahinfloss, und Septimus bog in einen hübschen Vorgarten ab, schritt einen kurzen Weg entlang und klopfte an eine hellrote Haustür.
Eine junge Frau öffnete. Sie hatte Sorgenfalten im Gesicht, und ihr braunes Haar war hastig geflochten und zu einem Knoten gebunden, aber ohne die üblichen Bänder. Sie trug ein langes Kleid mit kunstvollen bunten Stickereien und dazu schwere braune Stiefel. »Hallo, Lucy«, grüßte Septimus. »Ich habe eben deine Nachricht erhalten.«
»Ach, Septimus, danke, dass du gekommen bist«, sagte Lucy Heap mit einem gequälten Lächeln.
»Ich habe Todi mitgebracht. Ich hoffe, du hast nichts dagegen.«
»Todi ist hier jederzeit willkommen«, erwiderte Lucy und blickte zu Todi, die ein Stück hinter Septimus stand. »Das weißt du doch, Todi, oder? Jederzeit, Tag und Nacht. Nach dem, was du für William getan hast, ist unser Haus auch dein Haus. Aber kommt doch rein, alle beide. Simon ist oben.«
Septimus und Todi folgten ihr durch den schmalen Flur zur Treppe. »In deiner Nachricht steht, dass Simon Staub im Auge hat?«, fragte Septimus.
»Ja, Staub«, antwortete Lucy.
Septimus fand, dass sie etwas viel Wirbel um eine solche Kleinigkeit machte. »Ich frage mich«, begann er vorsichtig, denn Lucy war sichtlich mit den Nerven am Ende, »ob Simon nicht vielleicht zu einem Arzt gehen sollte. Habt ihr Marcellus gebeten, es sich mal anzusehen?«
Lucy fuhr herum und sah die Besucher an. »Es ist nicht diese Art von Staub«, sagte sie verzweifelt, drehte sich wieder um und rannte die Treppe hinauf. Septimus und Todi eilten hinterher.
Lucy führte sie in das große Zimmer im vorderen Teil des Hauses. Simon lag auf dem gemachten Bett, über das eine Flickendecke gebreitet war, und hatte, von mehreren Kissen im Rücken gestützt, den Kopf in den Nacken gelegt und die Augen geschlossen. »Simon«, sagte Lucy leise, »du hast Besuch.«
Simon legte sich die Hand auf das rechte Auge und drückte dagegen, als wollte er es festhalten. Vorsichtig öffnete er das linke Auge. »Ach«, sagte er. »Sep. Todi. Entschuldigt, ich kann mich nicht aufsetzen. Ich habe Angst, es könnte … herausfallen.«
»Herausfallen?«, fragte Septimus. »Was meinst du … dein Auge?«
»Ja«, antwortete Simon leise. »Oder was noch davon übrig ist.«
Lucy legte Todi den Arm um die Schultern und blieb mit ihr zurück, während Septimus zu seinem Bruder ging. »Ist es dein Lapislazuli-Auge?«, fragte Septimus, obwohl er es genau wusste, doch er wollte sich Zeit verschaffen. Die Iris von Simons rechtem Auge, durch eine frühere Verletzung schon vorgeschädigt, hatte sich in Lapislazuli verwandelt, nachdem er mit Hilfe schwarzer Magie durch festes Lapislazuli-Gestein geschlüpft war, um seinen Sohn William zu retten. Dadurch hatte er die Sehkraft auf dem linken Auge verloren, doch er hatte nie Beschwerden gehabt – bis jetzt.
»Wann ist es passiert?«, fragte Septimus.
»Ich glaube, es hat schon vor einiger Zeit angefangen«, antwortete Simon. »Es hat sich kratzig angefühlt, als wäre ein Sandkorn oder so was drin.«
»Und auch die Farbe hat sich verändert«, warf Lucy ein. »Vorher hat das Auge geleuchtet, war strahlend blau mit einem kleinen goldenen Streifen darin, aber vor ein paar Wochen hatte ich das Gefühl, dass es matter wurde, und letzte Nacht hat es ganz grau ausgesehen. Und dann, heute Morgen …« Sie verstummte und schlug die Hand vor den Mund, um einen Schluchzer zu ersticken.
»Kann ich es mir mal ansehen?«, fragte Septimus seinen Bruder. »Nur damit ich weiß, wovon wir sprechen.«
»Ja«, antwortete Simon. »Aber ich warne dich. Es ist kein schöner Anblick.«
Vorsichtig nahm er die Hand vom Auge und öffnete es. Septimus beugte sich vor und sah mit Schrecken, dass ein feuchter Klumpen aus grauem Staub die Augenhöhle füllte. Er hatte sich bisher nie wirklich klargemacht, dass Simon auf einem Auge blind war, denn der Lapislazuli hatte einen besonderen Reiz gehabt und ihm gut gestanden. Doch der weiß-graue Staub sah tot und leer aus.
Septimus richtete sich wieder auf und überlegte angestrengt, was er Aufmunterndes sagen konnte. »Es sieht so aus, als wäre es noch aus einem Stück. Ich glaube nicht, dass es herausfällt.«
»So fühlt es sich aber nicht an«, erwiderte Simon.
Plötzlich brach es aus Lucy heraus. »Aber warum? Warum hat es sich so verändert? Hast du dafür eine Erklärung, Septimus?«
Septimus schüttelte den Kopf. »Vermutlich hat die Magie, die das lebende Auge in Lapislazuli verwandelt hat, an Kraft verloren.« Er schüttelte nochmals den Kopf. »Aber merkwürdig ist es schon. Der Lapislazuli hat so stabil ausgesehen.«
»Kannst du die Magie nicht irgendwie reaktivieren?«, fragte Lucy. »Und das Auge wieder in Lapislazuli verwandeln?«
Septimus war sich da alles andere als sicher, aber er wollte Lucy nicht noch mehr aufregen, und so antwortete er: »Ich werde mein Möglichstes tun, Lucy. Ich gehe sofort in die Bibliothek und stelle Nachforschungen an. Und ich werde auch Marcia fragen. Ich werde nichts unversucht lassen. Versprochen.«
»Danke, Bruderherz«, sagte Simon, drückte die Hand wieder aufs Auge und sank in die Kissen zurück.
Lucy führte die Besucher hinaus. »Ihr müsst mir versprechen, dass ihr niemandem davon erzählt. Ihr wisst ja, wie schnell Klatsch die Runde macht, und ich möchte nicht, dass William davon erfährt. Es würde ihm nur Angst machen.« Sie senkte die Stimme. »Simon glaubt, dass es sich ausbreitet. Denn nur die Iris war ja aus Lapislazuli, aber jetzt ist das ganze Auge Staub. Er fürchtet, dass als Nächstes sein Gehirn an der Reihe ist.«
»Nein!«, rief Septimus entsetzt. »Dazu wird es nicht kommen. Auf keinen Fall. Es ist nur das Auge, mehr nicht.«
Lucy schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht, Septimus. Ich fürchte, Simon könnte recht haben, und ich könnte es nicht ertragen, wenn …«
Ein dumpfer Knall aus der Mansarde ließ Lucy mitten im Satz innehalten. »Das ist William«, sagte sie. »Er hüpft wieder auf unserem Bett herum, obwohl ich es ihm verboten habe. Und … ach, du liebe Güte, ich muss mich sputen, sonst kommt er zu spät zur Schule.«
Todi und Septimus machten sich auf den Rückweg zum Zaubererturm. »Hat Simons Auge schlimm ausgesehen?«, fragte Todi.
»Ja«, antwortete Septimus. »Grässlich.«
»Glaubst du, du findest einen Zauber, mit dem du es in Lapislazuli zurückverwandeln kannst?«
Septimus schüttelte den Kopf. »Ich werde die Bibliothek auf den Kopf stellen. Aber was mit Simons Auge geschieht, ist die Folge irgendeiner uralten Erdmagie, und darüber ist nur sehr wenig geschrieben worden.«
Todi schwieg eine Weile. Erst als sie unter den Großen Bogen traten, der auf den Hof des Zaubererturms führte, fragte sie: »Und? Könnte es auf Simons Kopf übergreifen?«
Septimus seufzte. »Das werde ich vielleicht beantworten können, wenn ich die Ursache kenne. Aber zum jetzigen Zeitpunkt kann ich es nicht.«
»Dann müssen wir es herausfinden«, sagte Todi.
»Ja, das werden wir«, stimmte Septimus zu. Aber sehr zuversichtlich klang er nicht.
Erste Vorkehrungen
Einige Meilen entfernt, tief im Wald, trat Marissa gerade aus einer baufälligen kleinen Hütte, die aus Holzstangen errichtet und mit Zweigen gedeckt war. Im Wald keine Fremde, schritt sie zielstrebig durch eine Gasse aus riesengroßen Bäumen und folgte dann den dunklen, schmalen Waldpfaden. Sie war zwar allein, doch ihre Zukunftspläne leisteten ihr Gesellschaft, wirbelten in ihrem Kopf herum und wurden immer verwegener und aufregender. Marissa konnte es kaum erwarten, den ersten Schritt zur Verwirklichung dieser Pläne zu tun und einen Leibwächter-Kraan zu erzeugen. Doch zuvor hatte sie noch etwas zurechtzurücken.
Bevor sie von der Roten Stadt aus in den Wald aufgebrochen war, hatte sie eine kleine, ausgewählte Gruppe ihr treu ergebener Hexen beauftragt, das Orm-Baby aus der Burg zu entführen. Dies war Teil ihrer alten Abmachung mit Oraton-Marr gewesen. Ihre neuen Pläne sahen etwas ganz anderes vor. Jetzt kam es darauf an, dass das Orm-Baby im Zaubererturm blieb und dort möglichst bald anfing, Lapislazuli zu produzieren. Das Orm-Baby durfte auf keinen Fall entführt werden, und Marissa konnte nur hoffen, dass die Hexen es noch nicht getan hatten. Das Letzte, was sie wollte, war, dass die kleine, boshafte Kreatur in ihrem Zelt saß, wenn sie ins Sommerlager des Hexenzirkels kam.
Marissa eilte den Pfad entlang, der zum Sommerlager des Zirkels führte, und als sie um eine Kurve bog, sah sie zu ihrer Freude die beiden Junghexen Arial und Star entgegenkommen. Sie waren in ein Gespräch vertieft, verstummten jedoch bei ihrem Anblick und guckten, wie Marissa fand, etwas schuldbewusst. Doch Marissa brannte darauf, ihre Pläne voranzutreiben, und so schob sie ihren aufkeimenden Argwohn beiseite. »Hallo, Mädels!«, rief sie fröhlich.
»Hallo«, grüßte Ariel zurück.
»Wie geht’s?«, fragte Star.
»Gut«, antwortete Marissa. »Könnte nicht besser gehen. Und wie geht es Morwenna?« Morwenna Mould war die kränkelnde Hexenmutter des Zirkels.
»Nicht besonders«, antwortete Star. »Es ist wirklich ein Jammer. Ständig fällt sie hin. Außerdem wird sie ein wenig … na ja … wunderlich. Sie ist davon besessen, irgendeinen Schlüssel zu finden.«
»Wir haben alle möglichen Schüssel für sie gefunden«, fügte Ariel hinzu, »aber keiner war der richtige.«
Marissa wusste ganz genau, was für einen Schlüssel die Hexenmutter suchte: den Universalschlüssel für die Burg. Vor vielen Jahrhunderten hatte ihn ein schusseliger Außergewöhnlicher Zauberer verloren, und eine zufällig vorbeikommende Hexe hatte ihn gefunden und war bald darauf Hexenmutter des Zirkels geworden. Seit damals war der Schlüssel als geheimes Symbol des Amtes von einer Hexenmutter an die nächste weitergereicht worden. Marissa wussten genau, wo der Schlüssel war: Er hing an einem grünen Band um ihren Hals. »Ach, wie traurig«, sagte Marissa, wobei sie versuchte, teilnahmsvoll zu klingen, was ihr aber gründlich misslang.
»Ja«, erwiderte Star erbost.
Ariel wechselte eilends das Thema. Sie wollte es sich keinesfalls mit der Person verscherzen, die höchstwahrscheinlich die nächste Hexenmutter wurde. »Es ist schön, dich zu sehen, Marissa«, schmeichelte sie. »Wir haben dich in letzter Zeit kaum zu Gesicht bekommen.«
»Wir sind jetzt alle oben im Sommerlager«, warf Star ein, die Ariels Absicht erriet und nun versuchte, ebenfalls freundlich zu sein. »Dort ist es herrlich nach dem trostlosen Steinbruch.«
»Ja«, stimmte Marissa zu, »dieses düstere Loch kann ich auch nicht ausstehen.«
»Du siehst allerdings so aus, als wärst du in der Sonne gewesen«, sagte Star.
»Tatsächlich?« Marissa lachte. »Das muss an der frischen Seeluft unten in Port liegen. Ich hatte dort zu tun. Ihr wisst schon, bei wem.«
Ariel und Star schnappten nach Luft. »Doch nicht etwa beim Porter Hexenzirkel?«
Marissa legte den Finger auf die Lippen. »Pst! Ich sage nichts. Hört mal, Mädels. Ihr müsst etwas Wichtiges für mich erledigen. Einverstanden?«
»Einverstanden«, antwortete Star.
»Ihr wisst doch von dem Plan, das Orm-Baby zu entführen? Nun, er gilt nicht mehr.«
»Oh! Aber wieso denn?«, fragte Ariel.
»Das erkläre ich euch später«, entgegnete Marissa. »Noch hat es doch niemand entführt, oder?«
»Nicht, nachdem es Selina den kleinen Finger abgebissen hat«, erklärte Star säuerlich.
»Ach was?« Marissa war froh, dass sie sich mit dem Biest nicht mehr abgeben musste. »Also, sagt den anderen Bescheid. Die Entführung des Orm-Babys ist gestrichen. Klar?«
»Klar«, antwortete Ariel.
»Möglichst schnell.« Damit machte Marissa auf dem Absatz kehrt und eilte mit geschäftiger Miene davon.
Ariel und Star – die persönlichen Spione der Burgkönigin Jenna – sahen ihr nach, wie sie mit ausgreifenden Schritten im schattigen Wald verschwand.
»Ich hasse es, wie sie uns ›Mädels‹ nennt«, knurrte Ariel.
»Und uns wie Dienstboten behandelt«, fügte Star hinzu.
»Sollen wir das melden?«
»Ja, du weißt doch, was Königin Jenna gesagt hat: Meldet alles. Außerdem hätte ich Lust auf ein Mittagessen im Sandwich-Zauberland, du nicht?«
»Und ob«, antwortete Ariel. »Und auf ein Abendessen.«
Es war später Nachmittag, als Marissas Ziel endlich in Sicht kam: das alte Burgspital. Abseits der Burg am anderen Ufer des Burggrabens gelegen, siechte das Spital im Schatten am Waldrand vor sich hin und machte einen feuchten, modrigen Eindruck. Erst seit Kurzem fand es wieder etwas mehr Beachtung, denn es war zum Schauplatz wilder Partys geworden, die ältere Lehrlinge aus der Burg, Schreiber und jüngere Hexen dort feierten. Zur Verbesserung seines Aussehens hatte dies allerdings nicht beigetragen.
Marissa nahm den Universalschlüssel der Burg vom Hals und schloss damit die ramponierte Tür zum Spital auf, die quietschend aufschwang. Marissa trat in das muffige Halbdunkel, zog die Tür hinter sich zu und huschte durch einen gespenstischen Krankensaal mit leeren Betten und unbezogenen Matratzen. Ihr gruselte vor den Spinnwebengirlanden und düsteren Schatten im Saal. Am Schwesterntisch, wo sie einen Vorrat Kerzen versteckt hatte, blieb sie stehen. Mithilfe eines Feuersteins zündete sie eine Kerze an, doch plötzlich fuhr ein Windstoß durch ein zerbrochenes Fenster und blies sie wieder aus. Mit zitternden Händen ergriff sie die Kerzen und zündete alle an.
Sie setzte sich hin und betrachtete minutenlang die hell züngelnden Flammen. Dann holte sie tief Luft, um ihre Nerven zu beruhigen, öffnete den Kraan-Beutel und nahm die kleinen roten Perlen darin in Augenschein. Sie leuchteten im Kerzenlicht wie Hunderte wissender kleiner Augen, die sie anstarrten. Angst hüllte Marissa ein wie eine dunkle Wolke. Sie hatte das Gefühl, dass die Perlen sich gegen sie verbündeten, miteinander tuschelten, lachten, sich gegen sie verschworen … Sie warf den Kraan-Beutel in eine Schublade und knallte sie zu.
Eine tiefe Müdigkeit überkam sie. Sie legte sich auf das nächstbeste Bett, wickelte sich in eine Decke und schlief ein, ohne die vielen munter brennenden Kerzen zu löschen.
Charm-Unterricht
Als Todi am selben Nachmittag die Charm-Bibliothek im zehnten Stock des Zaubererturms betrat, saß dort Jo-Jo Heap und blätterte im Gesamtverzeichnis aller Charms. Das fand sie merkwürdig, denn Jo-Jo war ein seltener Besucher im Zaubererturm.
Jo-Jo schaute zu ihr auf. Das Mädchen, das er erblickte, war groß für ihr Alter und hatte leuchtend grüne Augen und dunkles Haar, das kurz geschnitten war bis auf eine lange, ordentlich geflochtene Elflocke. Sie trug eine Hose und eine kurze Jacke in vorschriftsmäßigem Lehrlingsgrün und dazu einen abgenutzten, aber eindrucksvollen, breiten Silbergürtel um die Hüfte. »Oh, hallo, Todi«, grüßte Jo-Jo.
»Hallo, Jo-Jo«, antwortete Todi. Von allen sechs Brüdern ihres Meisters Septimus Heap mochte sie Jo-Jo am wenigsten. Obwohl vier Jahre älter als Septimus, machte er auf sie keinen sehr erwachsenen Eindruck. Er trieb sich mit den unsympathischeren Lehrlingen aus dem Zaubererturm herum und war, wie Todi wusste, mit Newt Makken und dessen Bruder Drammer, einem weiteren Lehrling im ersten Jahr, befreundet. Drammer war auf Todi nicht gut zu sprechen. Er verübelte ihr, dass sie ihn um die Chance gebracht hatte, am prestigereichen Schlittenrennen für Lehrlinge teilzunehmen, und ließ keine Gelegenheit aus, sie dafür zu verhöhnen, dass sie das Rennen nicht zu Ende gebracht hatte.
Aber die Makken-Brüder waren nichts im Vergleich zu Jo-Jos Exfreundin: einer Hexe namens Marissa. Marissa hatte Todi und ihre beiden Freunde Ferdie und Oskar unlängst in höchste Lebensgefahr gebracht, und im Zaubererturm wurde gemunkelt, dass Jo-Jo wieder mit ihr zusammen sei. Todi wollte nicht im selben Raum mit jemandem sein, der etwas mit Marissa zu schaffen hatte. Hätte sie jetzt nicht eine Übungsstunde bei der Charm-Zauberin Rose gehabt, wäre sie auf der Stelle wieder gegangen und erst wiedergekommen, wenn Jo-Jo fort gewesen wäre.
Doch Rose kam bereits aus der inneren Charm-Kammer. Sie war erst seit Kurzem Gewöhnliche Zauberin und trug ihre blaue Amtsrobe noch mit Stolz. Aufgestickte Abzeichen an den Ärmeln, die zusätzlich mit einem Band in dunklerem Blau eingefasst waren, wiesen sie als Zauberin aus, die auf Charms spezialisiert war. Groß gewachsen, das lange braune Haar sorgsam zu einem Zopf geflochten, der bis zur Taille herabhing, strahlte Rose überall, wo sie auch hinkam, Ruhe aus. Ihre hellgrünen Augen leuchteten bei Todis Anblick. »Hallo, Todi. Auf diesen Moment freue ich mich schon den ganzen Morgen.«
Rose hielt die schön bemalte Tür zur Charm-Kammer auf, aus der ein eisiger Luftzug herauswehte. Todi trat in die kalte Kammer – aber nicht ohne vorher einen finsteren Seitenblick von Jo-Jo aufzufangen. Rose schloss die Tür hinter ihnen und schob geräuschlos den Riegel vor. »So, jetzt kann er nicht herein. Trägst du auch deine Charm-Armbänder, Todi?«
Todi hob die Hände und zeigte Rose die beiden breiten rosafarbenen Bänder. Sie wirkten der niedrigen Temperatur entgegen, die notwendig war, um die älteren Charms stabil zu halten.
»Schön, dass du daran gedacht hast«, sagte Rose. »Möchtest du einen Fruchtblubber?«
»Oh ja, bitte.«
Todi liebte die Charm-Kammer. Sie kam sich darin immer so vor, als wäre sie in eine riesige bunte Flickendecke gewickelt. Dabei handelte es sich in Wirklichkeit um einen zwölfeckigen Raum, in dem peinliche Ordnung herrschte und in dem von jedem bekannten Charm ein Exemplar aufbewahrt wurde. Dass er an eine Flickendecke erinnerte, lag an den vielen Hundert kleinen Schließfächern, die seine Wände bedeckten. Sie reichten vom Fußboden bis zur Decke und waren mit unterschiedlichen Mustern in unterschiedlichen Farben bemalt. Todi stockte vor Erregung immer der Atem, wenn sie an all die Zaubermittel dachte, die sie enthielten.
Todi folgte Rose, vorbei an dem zwölfeckigen Charm-Tisch, in dessen zahlreichen Holzeinlagen die Schlüssel für die Schließfächer aufbewahrt wurden, und dann durch eine Tür, die in die Fächerwand eingelassen und so bemalt war, als bestünde sie ebenfalls aus lauter Schließfächern. Bei Todis allererstem Besuch in der Charm-Kammer war Rose durch diese Tür gegangen, ohne dass Todi es bemerkte, und als sie aufschaute, war es, als hätte sich Rose in Luft aufgelöst.
Die Geheimtür führte in Roses privates Arbeitszimmer – einen kleinen Raum, dessen Fenster zum Wald hinausging. Die Einrichtung bestand aus einem Schreibtisch, zwei Stühlen, einem kleinen Spülbecken und einem magischen Schnippfeuer-Kocher, auf dem ein hübscher, kleiner Kupferkessel thronte.
»Setz dich, Todi«, sagte Rose, schnippte mit den Fingern und befahl dem Kocher: »Brenne!« Dann sah sie die Glasgefäße durch, die über der Spüle standen und die kleine Würfel in unterschiedlichen Farben enthielten. »Ich habe blaue Banane, rosa Traube, rote Ananas und … äh … etwas Grünes mit orangeroten Flecken.«
»Das Grüne mit orangeroten Flecken, bitte«, sagte Todi und sah dann zu, wie Rose den Fruchtblubber-Würfel aus dem Glas nahm, in eine Kanne warf und heißes Wasser darüber goss. Das Wasser sprudelte zu dunkelbraunem Schaum auf, und Rose goss es vorsichtig in zwei Gläser. Sie warteten, bis sich der Schaum gesetzt hatte, dann tranken sie den eiskalten Blubber.
»Merkwürdig«, sagte Rose. »Er schmeckt wie … äh …«
»Schoko-Orange«, half ihr Todi, »mit einem Hauch Pfefferminz.«