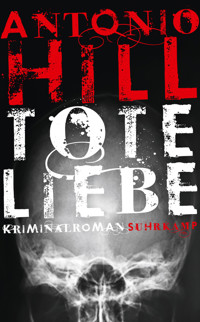
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Héctor-Salgado-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Der Abschluss der Barcelona-Trilogie rund um Inspektor Héctor Salgado Ein Paar, das sich zwischen vertrockneten Blüten in den Armen liegt – nackt und mit eingeschlagenen Schädeln. Daneben ein Rucksack voller Geld … Das ist es, was Inspektor Héctor Salgado zu Gesicht bekommt, als er in das verlassene Haus am Stadtrand von Barcelona gerufen wird. Die Opfer gelten seit sieben Jahren als vermisst, wie vom Erdboden verschluckt, seitdem ihre Ménage-à-trois mit einem Freund in die Brüche ging. Schlug der sie einfach tot? Aus Eifersucht, aus Wut? Salgado macht ihn in der geschlossenen Psychiatrie ausfindig – ein Wrack, vollgepumpt mit Medikamenten –, doch trotzdem ist nach dem Verhör eines ganz sicher: Nicht nur er hatte damals guten Grund auszurasten. Vater, Bandkollege, Jugendfreundin, sie alle wurden von den Opfern bitter enttäuscht …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 650
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Ein verlassenes Haus am Stadtrand von Barcelona, im Keller zwei Leichen in liebevoller Umarmung – Héctor Salgado und sein Team ermitteln. Die Opfer gelten seit sieben Jahren als vermisst, wie vom Erdboden verschluckt, seitdem ihre Ménage-à-trois mit einem Freund in die Brüche ging. Schlug der sie einfach tot? Aus Eifersucht, aus Wut? Salgado macht ihn in der geschlossenen Psychiatrie ausfindig – ein Wrack, vollgepumpt mit Medikamenten –, doch trotzdem ist nach dem Verhör eines ganz sicher: Nicht nur er hatte damals guten Grund auszurasten. Vater, Bandkollege, Jugendfreundin, sie alle wurden von den Opfern bitter enttäuscht …
Antonio Hill, geboren 1966 in Barcelona, hat Psychologie studiert und arbeitet als Übersetzer. Tote Liebe ist der Abschluss seiner Barcelona-Trilogie.
Thomas Brovot lebt als Übersetzer (u. a. Mario Vargas Llosa, Juan Goytisolo, Federico García Lorca) in Berlin.
ANTONIO HILL
TOTE LIEBE
KRIMINALROMAN
Aus dem Spanischen von Thomas Brovot
Suhrkamp
Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem TitelLos amantes de Hiroshima
bei Penguin Random House Grupo Editorial, Barcelona.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2015
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 4643
Deutsche Erstausgabe
© Suhrkamp Verlag Berlin 2015
© Antonio Hill, 2014
© Penguin Random House Grupo Editorial S.A.U, 2014
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Das Zitat auf S. 7 stammt aus Die Drehung der Schraube von Henry James. Es folgt der deutschen Ausgabe desManesse Verlags 2010 in der Übersetzung von Ingrid Rein.
Umschlagabbildung: mauritius images
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg
eISBN 978-3-518-74237-2
www.suhrkamp.de
Doch er war schon herumgefahren, hatte abermals zum Fenster geblickt und hinausgestarrt, aber draußen nur den friedvollen Tag gesehen. Unter dem schlagartigen Eindruck des Verlusts, auf den ich so stolz war, stieß er den Schrei eines Geschöpfs aus, das in einen Abgrund stürzt; sofort streckte ich die Arme nach ihm aus, und dass ich ihn zu packen bekam, hätte seinen Sturz abmildern können. Ja, ich fing ihn auf, hielt ihn fest – man kann sich vorstellen, mit welch heftiger Gemütsbewegung; nach einer Minute erst merkte ich, was ich tatsächlich in den Armen hielt. Wir waren allein mit dem friedvollen Tag, und sein kleines Herz hatte, der Macht des Bösen entrissen, aufgehört zu schlagen.
Henry James, Die Drehung der Schraube
PROLOG
Das erste Warnzeichen war ein Schatten im Spiegel. Ein kurzer, flüchtiger Fleck, gleich verbannt in die Tiefen des Verstands von einem Kribbeln, das ihr die Wirbelsäule hochkroch und sie zwang, die Augen zu schließen, während Daniel mit der Zunge über ihren Hals fuhr, eine ihrer empfindlichsten Stellen, das wusste er genau. Ein kleines Vorspiel nur, die feuchte Liebkosung verbunden mit dem Kitzel unrasierter Wangen, was seine Wirkung nie verfehlte – alle Zurückhaltung war wie weggeblasen, es überwältigte sie, versenkte sie in einen fast tranceartigen Zustand. Doch in einem Eckchen ihres Gehirns musste die Alarmglocke noch schrillen, denn als er innehielt, schaute sie wieder hin. Das Spiegelglas, alt und angelaufen, schenkte ihr nur das verschwommene Bild ihres Gesichts und von Daniels kräftigem, unruhigem Körper auf ihr. Sein Rücken glänzte vom Schweiß, der Hintern wie ein leuchtender, irgendwie komischer Klecks über den dunklen Schenkeln, die eigenen Hände angespannt, die Nägel in die Schultern des Freundes gegraben, als fürchtete sie, ihn zu verlieren.
Ein bekannter, erregender Anblick, und jede Spur von Angst verflog.
Der Spiegel war ihre Idee gewesen, Daniel konnte nichts damit anfangen. Aber beim Sex störte ihn kaum etwas, und wenn sie sich gern dabei sah, wenn es sie stimulierte, hatte er nichts dagegen. »Von mir aus kannst du welche an die Decke hängen«, hatte er gesagt, mit diesem hungrigen Lächeln, das sein ganzes Gesicht in Beschlag nahm, wenn sie von Sex sprachen, ein Gesicht, das sonst eher apathisch war. Also gingen sie einen kaufen, und zu ihrer Belustigung diskutierten sie in dem Möbelgeschäft vor einer schockierten Verkäuferin das Für und Wider der verschiedenen Modelle. Schließlich entschieden sie sich für einen recht altmodischen, mit weißem Rahmen und schwenkbarem Korpus, und platzierten ihn noch am selben Tag neben dem Bett. Sie zog sich aus und legte sich auf die Laken, während er ihren Anweisungen folgte und das Teil so lange drehte, bis sie zufrieden war. Oder besser gesagt, bis er es leid war, sie bloß anzusehen, und sich auf diesen wundervollen Körper warf, der sich ihm dort ohne jede Scham darbot. Das war schon vor Monaten gewesen, so viele Dinge waren seither passiert. Nicht nur schöne. Schreckliche auch. Kurios war, dass sie in diesem leerstehenden Haus, an diesem unwirtlichen Ort, der zu ihrem Refugium geworden war, einen weiteren Spiegel gefunden hatten, das Holz längst morsch und mit einer Beschichtung, die man mit nichts mehr sauber bekam. Aber für ihre Zwecke reichte es.
Cris versuchte sich zu entspannen und diese Unruhe abzustreifen, die irgendwo lauerte, bereit, jeden Moment hervorzubrechen. Das Gefühl war nicht neu, es begleitete sie oft in letzter Zeit. Ganz in der Nähe flog ein eiserner Vogel zu seinem Nest, und als das Dach des Hauses unter dem donnernden Schatten der Maschine erzitterte, schlang sie ihre Arme noch fester um Daniel, drängte ihn mit einem Stoß, endlich zum Abschluss zu kommen, ehe der Verstand sich gegen den Trieb durchsetzte und ihre Lust versiegte, aber er hörte nicht auf sie. Vielleicht missverstand er sie auch, denn er hielt inne. Sag jetzt nichts, flehte sie wortlos, Scheiße, mach jetzt nicht alles kaputt!
»Geht es dir gut?«, flüsterte er ihr ins Ohr.
Cris ließ die Arme über seinen Rücken gleiten und dann links und rechts fallen, schlaff, schon in der Leere, die ein verpatzter Orgasmus gewöhnlich hinterlässt. Sie schaute zum Fenster, um dem Bild zu entgehen, das sich im Spiegel abzeichnete, wollte nicht die Enttäuschung in ihrem Gesicht sehen, damit sie sich später nicht daran erinnerte. Es war nicht das erste Mal, dass ihr dieser Zustand der Leichtigkeit fehlte, diese frivole Besinnungslosigkeit, wie sie die richtige Mischung aus Alkohol und Kokain ihnen sonst schenkte.
So viel auch dagegensprach, so viele vernünftige Argumente sich anführen ließen: Sex ohne Drogen war nicht dasselbe.
Sie drückte ihr Gesicht an Daniels Brust und sog seinen Geruch ein. Dann hob sie den Kopf und schaute ihm in die Augen, die fast schwarz waren, was die dunklen, buschigen Brauen noch unterstrichen, und ein zärtliches Gefühl überkam sie, als sie sah, dass in seinem Gesicht noch Spuren der Schläge zu erkennen waren. Sie wollte ihm gerade die Spitze ihres Zeigefingers auf die Wange legen, den blauen Fleck, mit dem er wie ein abgehalfterter Boxer aussah, als sie etwas hörte, was sie nicht einordnen konnte. Bisher hatte sich zwar niemand diesem Haus genähert, das dort einsam in der Landschaft stand, aber ihnen war klar, dass jederzeit jemand hereinkommen konnte. Spielende Kinder, Jugendliche auf der Suche nach einem Ort zum Bumsen, Junkies, die sich einen Schuss setzen wollten, falsche Freunde. Cris hätte etwas gesagt, wenn er es nicht mit einem Kuss unterbunden hätte, um die Glut unter der Asche wieder zu entfachen. Er küsste sie wild, fordernd, und sie schmeckte den Daniel, den sie kannte, versuchte die Cristina zu sein, die sie immer gewesen war: frech, leidenschaftlich, stürmisch.
Und sie setzten alles daran, die Umgebung zu vergessen und was immer in letzter Zeit passiert war, führten noch einmal den Tanz auf, dessen Schritte sie kannten und tausendmal getanzt hatten, wollten nicht wissen, dass das Ergebnis, sosehr sie sich bemühten, schon etwas von Nachahmung hatte. Sie wollten sich lieben wie vorher, so als wäre nichts geschehen, aber sie schafften es nicht. Trotzdem reagierten ihre jungen Körper auf die Berührung, die Haut, und fünfzehn Minuten später hatte Cristina die tiefe Genugtuung, sich im Spiegel zu betrachten, Sekunden vor dem Orgasmus.
In dem Moment sah sie ihn. Ja, es gab keinen Zweifel, und bevor sie die Waffe in seiner Hand erblickte, dieses Ding, das kurz darauf gegen die Spiegelfläche schmetterte, spürte Cristina die Gefahr und ahnte, dass Daniel, völlig entspannt, nichts davon mitbekam. Sie versuchte ihn zu warnen, stöhnte auf eine Art, die mit Lust nichts zu tun hatte. Vergeblich. Die Eisenstange sauste mit voller Wucht auf seinen Kopf, gefolgt von einem dumpfen Krachen. Sie riss den Mund auf, wollte ihre Panik hinausschreien, doch der Schrei blieb stumm.
Cristina Silva nahm ein letztes Bild mit. In einer bitteren Vorahnung dessen, was ihr Ende sein würde, sah sie im gläsernen Spinnennetz des Spiegels ihr zersplittertes Gesicht. Und so, begraben unter einem leblosen Körper, der nur noch ein nutzloser Schild war, eine tote Last, die sie an jeder Bewegung hinderte, konnte sie gerade noch die Augen schließen, um diese Waffe nicht sehen zu müssen, die, nachdem sie Daniel den Schädel zertrümmert hatte, auch auf sie herabfuhr, ohne einen Funken Zweifel oder Mitleid.
Der Schmerz ist barmherzig. Beim ersten Schlag war sie bewusstlos und spürte nichts mehr.
DIE OPFER
1
Um das System zu überleben, muss man es überlisten. Für Héctor ist der Satz schon zu einem Mantra geworden. Er weiß nicht mal genau, woher er ihn hat, ob er ihn in einem Film gehört hat oder ob es ein Slogan ist, den jemand in diesen Zeiten der friedlichen Empörung losgelassen hat, aber der Spruch passt perfekt zu seiner Situation, und mangels eines besseren oder originelleren hat er ihn sich in den letzten Tagen zu eigen gemacht, denn er bringt es auf den Punkt; der einzige Satz, der ihm noch über die Lippen kommt, die These, die rechtfertigt, was er gleich tun wird.
Auf seinem unbequemen Stuhl, in diesem beleidigend leeren Raum hat sein Verstand nichts, womit er sich ablenken könnte, außer der Uhr an der Wand. Auf dem billigen Plastik, weiß wie die Wände, bewegen sich die Zeiger so langsam, dass es schon wehtut. Er weiß, das Warten ist Teil des Spiels. Er selbst ist auf der anderen Seite von Türen gewesen, die genauso aussahen wie die, die er jetzt am linken Ende des Raums vor sich hat, und ganz bewusst hat er die Vernehmung der Verdächtigen länger hinausgezögert als nötig. Das Warten irritiert, die Irritation schürt Nervosität, die Nervosität macht unvorsichtig, und dann bricht auf einmal die Wahrheit hervor.
Und genau das darf er sich heute nicht erlauben. Was er erzählen wird, könnte die Wahrheit sein. Und sie wird es sein, wenn man ihm nur glaubt. Davon hängt es ab: von seiner Standhaftigkeit, von seinem überzeugenden Auftritt, von der Selbstsicherheit, mit der er die Geschichte erzählt. Denn die Wahrheit ist kein absoluter Wert. Sie war es einmal, nicht lange her; jetzt nicht mehr. Er möchte sich einreden, dass die einzige wirkliche Wahrheit die ist, die man ihm glaubt, auf etwas anderes können Sünder ohnehin nicht bauen. Er muss lächeln und fragt sich, wieso ihm dieses Wort in den Sinn kommt, »Sünder«, wo er nie ein gläubiger Mensch war. Wenn er in seinem Leben je an etwas geglaubt hat, dann an das, was er gleich verraten wird. An die Notwendigkeit, den Dingen auf den Grund gehen, die Tatsachen auszugraben und ins kalte Licht des Tages zu zerren. Er wünscht sich, dass die Vernehmungsbeamten nicht so sind wie er, der Inspektor, der bei jeder sich bietenden Gelegenheit gesagt hat, da die Justiz nun mal unvollkommen sei, sei der einzige echte Trost, die Taten aufzudecken.
Nicht dass er seine Prinzipien aufgegeben hätte. Nur weiß er jetzt, dass eine solche Katharsis manchmal wenig Tröstliches mit sich bringt. Eine Verurteilung, einen Fluch. Und vor allem kann sie unterm Strich sehr viel ungerechter sein als eine nützliche Lüge.
Er räuspert sich, und sein Blick fällt erneut auf die Uhr, die in ihrem eigenen Rhythmus vorrückt, frei von Wünschen oder Zwängen. So sollte die Ermittlungsarbeit sein, denkt er: ein Automatismus, ausgeführt mit ruhiger Beständigkeit, in sich stimmig. Aseptisch und unbelastet von Gefühlen. Doch die Wirklichkeit könnte unterschiedlicher nicht sein. Sie rückt stoßweise vor, bewegt von plötzlichen Eingebungen, die zuweilen einen Rückschritt bedeuten oder in einer Sackgasse enden. Danach geht es langsam wieder voran, man versucht, eine Lehre daraus zu ziehen, doch dann packt einen wieder die Leidenschaft und reißt einen mit. Manchmal, und mit etwas Glück, schafft man es nach einem solchen Sprint ins Ziel, mit schmerzendem Körper und benebeltem Kopf.
Deshalb passieren solche Dinge. Deshalb stirbt jemand. Deshalb ist er jetzt dort, wo er ist.
Das System zu überlisten, denkt Héctor, ist die einzige Möglichkeit, es zu überleben. Er holt tief Luft und hält sie in der Lunge zurück, um den nötigen Mut zu schöpfen, um sich dem zu stellen, was ihn erwartet. Er hat noch nie gut lügen können, aber jetzt muss er es versuchen. Das Dumme ist, dass Rache für ihn nie ein Thema war. Alles wäre so viel einfacher, könnte er sich sagen, dass Ruths Mörder den Tod verdient hat. Aber so ist es nicht, das denkt er nicht, nie würde er für dieses »Auge um Auge« plädieren, es scheint ihm allzu vereinfachend, irrational, einem zivilisierten System nicht angemessen. Natürlich hat auch die Wut eine Rolle gespielt, aber sie gibt einem nicht das Recht auf Rache, nur auf Gerechtigkeit.
Dass der Mann tot ist, tut ihm nicht leid, nur bereut er, dass er es nicht vorausgesehen hat, dass er den Ereignissen nicht zuvorgekommen ist, dass er die Katastrophe nicht geahnt hat, bevor es so weit kam.
Deshalb, und auch aus ein paar anderen Gründen, ist seine Strafe klar. Er muss lügen und die Einsamkeit auf sich nehmen, die mit der Lüge stets einhergeht. Einfach auszupacken, diese befreiende Katharsis, ist ihm verwehrt. Nur eine Person wird ihn auf seiner Reise begleiten, wenngleich aus der Distanz. Ja, auch das ist klar, und es schmerzt ihn mehr als sein eigenes Schicksal. Er muss noch mal Luft holen bei dem Gedanken an Leire Castro, an ihren felsenfesten Entschluss und ihre Hartnäckigkeit, die ihn am Ende angesteckt hat, und er bemüht sich, jede Verbundenheit aus seinem Kopf zu vertreiben. Aber es ist unerlässlich, entscheidend auch, das alles zu tilgen, noch die kleinste Erinnerung daran, dass er für ein paar Tage nicht nur ihr Chef gewesen ist. Also muss er vergessen, muss aus seiner Stimme diesen zärtlichen Ton verbannen, der ungewollt hervorbricht und die Gefühle verrät. Sie haben nicht darüber gesprochen, es war nicht nötig. Aber er ist sich sicher, dass sie zu demselben Schluss gelangt ist. Vielleicht ist es ohnehin das Beste. Vielleicht war alles nur dem Frühling geschuldet, oder dem Fall, in dem sie gerade ermittelten und der geprägt war von Leuten, die sich den ungeschriebenen Gesetzen der Liebe entzogen, jenseits aller Vernunft. Aber darauf kommt es nicht mehr an. Die erste Strafe für die Lüge heißt: Leire zu vergessen.
Die Tür geht auf, und er zuckt zusammen. Die Zeiger der Uhr scheinen ebenfalls stillzustehen. Er erhebt sich, ganz langsam, täuscht die Ruhe vor, die es braucht, damit ihm das Publikum, das ihn auf der anderen Seite erwartet, seinen Auftritt abnimmt. Es wird nicht einfach sein. Aber darum geht es: das System zu überlisten.
Zu überleben.
Sowenig sie die Sommersonne verträgt, so sehr braucht sie sie heute. Sie hat einfach nicht in der Wohnung bleiben können, ihr fiel schon die Decke auf den Kopf, und da ihre Mutter für ein paar Tage bei ihr ist und auf Abel aufpassen kann, hat Leire sich entschlossen, hinauszugehen. Kaum auf der Straße, war ihr nicht mehr nach Spazieren zumute, und so hat sie sich einen freien Tisch in einem Straßencafé gesucht, wo sie nun seit einer Weile den Leuten zuschaut, ohne sie wirklich zu sehen. Das Einzige, was sie interessiert, das Einzige, woran Leire jetzt denken kann, ist Héctor und wie er die Fragen pariert. So wie sie gestern. Verfängliche Fragen, bohrend, nachbohrend. Die immer gleiche Frage, formuliert aus unterschiedlichen Blickwinkeln, bis einem jeder Zeitbegriff abhandenkommt und alles wie ein Déjà-vu erscheint. Fragen und Antworten verbinden sich zu einer eintönigen, fast freundlichen Sinfonie, mit plötzlichen Missklängen, auf die man zum Glück vorbereitet ist. Oder auch nicht. Wer weiß das schon.
Die Menschen ziehen über den Boulevard, die Sagrada Familia schiebt sich langsam vor die Sonne. Leire hat einen Kaffee bestellt, aber der ist noch nicht da, und für einen Moment ist sie versucht, sich davonzumachen. Aber nicht nur aus diesem Café, sondern aus der Stadt. Entgegen ihrer Gewohnheit verspürt sie einen heftigen Drang, ihre Familie um sich zu wissen, ihre Eltern, sich zu ihnen zu flüchten wie ein kleines Kind, das mitten in der Nacht aufgewacht ist, bestürmt vom schlimmsten aller Albträume. Wirklich absurd. Sie hat nie nachts Angst gehabt, hat sich immer über ihren Bruder lustig gemacht, der, obwohl zwei Jahre älter, nächtens zu den Eltern ins Bett schlüpfte. Sie nicht. Nie hat sie unters Bett geguckt, ob da vielleicht ein Monster ist, hat keine Angst vor dem Butzemann gehabt, sich im Dunkeln keine Gespenster ausgemalt. Doch so anders ist es heute gar nicht; beunruhigend ist allein die Wirklichkeit. Was sie getan haben. Was sie gestern erzählt hat. Was Héctor jetzt gerade wahrscheinlich vorträgt. Was sie beide immer wieder werden sagen müssen, gemeinsam und jeder einzeln, bis der Fall ein für alle Mal abgeschlossen ist. Trotzdem hat sie kein schlechtes Gewissen. Sie ist überzeugt, dass sie getan hat, was sie tun musste, und damit verschwindet aus ihrem Kopf auch jede Angst vor allem, was nicht real ist. Nicht greifbar. Nicht von dieser Welt.
»Ich habe es für dich getan, Ruth«, murmelt sie, und auch wenn sie nie an Geister oder übernatürliche Einflüsse geglaubt hat, ist sie sicher, dass diese Frau ihren Segen geben wird. Langsam macht sich die Hitze bemerkbar, und sie schließt die Augen zu einem Spalt. Atmet ein. Wenn sie bloß entspannen könnte, aber Yoga oder Meditation war in ihren Augen immer albernes Zeug für Neurotiker. Was gäbe sie darum, könnte sie sich jetzt einen Bach vorstellen, einen blauen Himmel oder eine Quelle, aber in ihrem Kopf sind nur Bilder aus dem Haus, wo man die Leichen gefunden hat. Es ist Wochen her, aber sie kann es nicht vergessen, und so begibt sie sich in Gedanken noch einmal dort hinein. Um sich an jedes Detail zu erinnern, jede Sekunde. Alles besser, als an das andere zu denken: den Schuss aus dem Nichts, wie eine Bombe; das Blut, diesen roten Fleck, der so klein war, dass er unmöglich das Leben eines Menschen enthalten konnte, ein Fleck, der den Boden fast schon ungehörig beschmutzte.
Noch immer kann sich ihre Fantasie nicht zu Sonnenaufgängen und plätschernden Bächlein durchringen, also hält sie sich an die anderen Toten. »Die Geliebten von Hiroshima« hat jemand sie in der Presse genannt, und so altbacken sie das Wort »Geliebte« findet, muss sie zugeben, dass es ein schönes ist, sie selbst hat es vor nicht langer Zeit benutzt, wenn auch ironisch. »Sind wir Geliebte?«, wollte sie wissen. Und Héctor hatte, auf den Lippen sein kleines Lächeln, mit den Schultern gezuckt, ohne gleich zu antworten.
Nein. Sie muss das Grübeln in den Griff bekommen. Muss sich wieder auf das tote Liebespaar konzentrieren, diese Geliebten jenseits aller Sehnsucht oder Gleichgültigkeit, die man an einem Morgen im Mai im Keller eines verlassenen Hauses fand, nebeneinander liegend, sich umarmend, als wären sie nach dem Liebesakt gestorben.
2
Sie hatte nicht mal gemerkt, dass der Wagen hielt. Sie erinnerte sich nur noch daran, dass sie sich in den Sitz zurückgelehnt hatte und dankbar war für die milde Morgensonne, die durchs Fenster hereinschien. Eine zaghafte Stimme riss sie aus ihrem kurzen, erholsamen Schlaf.
»Leire … Tut mir leid«, sagte Roger Fort. »Wir sind da.«
Leire blinzelte, und für einen Moment wusste sie nicht, wo sie war, noch, was sie dort zu suchen hatte, und sie ärgerte sich, über sich selbst wie über die ganze Welt. Ihr Kollege musste es bemerkt haben, denn ohne ein weiteres Wort stieg er aus, als wollte er ihr noch ein paar Sekunden schenken, damit sie allein in die Gegenwart zurückfand. Unter normalen Umständen, dachte sie, und ihre Laune war noch am Boden, hätte sie sich dafür geschämt, doch die angesammelte Müdigkeit, all die schlaflosen Nächte nahmen ihr jeden Rest von schlechtem Gewissen.
Sie betrachtete sich im Rückspiegel. Dunkle Ringe hatten sich unter ihren Augen breitgemacht; zuerst nur als dezenter Schatten, leicht zu überschminken, doch nach drei Monaten waren sie nicht mehr zu tilgen. Wenn das so weiterging, würden sie bald für immer zu ihrem Gesicht gehören, unauslöschliche Beweise für die Opfer der Mutterschaft. Beim Gedanken an Abel musste sie lächeln, und sie vermisste ihn so sehr, dass es sie fast verwunderte. Aber mit diesen Widersprüchen lebte sie seit vier Monaten: mit diesem körperlichen Bedürfnis, ihn zu sehen, zu berühren, zu spüren, und dann der nächtlichen Verzweiflung, wenn der Junge mal wieder weinte, als gäbe es kein Morgen. Oder als wollte er die Ankunft des Tages mit seinem Geplärr beschleunigen. Der Arzt sagte, es seien Koliken, bald würden sie vergehen. Leire hatte da ihre Zweifel.
Als sie ausstieg, traf sie das Licht wie ein Schlag auf die Augen, sie konnte kaum sehen, was sie vor sich hatte. Eine Wolke sprang ihr bei, und dieses verlassene Haus, verloren in der Umgebung des Flughafenterminals, erschien vor ihr, als hätte es jemand dort hingemalt. Sie musste an den Anruf denken, den sie gleich bei Dienstbeginn im Kommissariat erhalten hatte, und an die Worte ihres Kollegen: »Man hat zwei Leichen gefunden, in einem besetzten Haus bei El Prat.«
Noch immer halb versunken in ihrem kleinen Nickerchen, sah Leire nun, dass Fort mit einem der Gemeindepolizisten sprach, beide schauten zum Haus. An ihre Ohren drangen Wörter wie »Punker«, »räumen«, »gefunden«. Doch ehe sie zu ihnen ging, besah sie sich zunächst das Gebäude, nur wenige Meter entfernt. Sie konnte kaum glauben, dass jemand sich, auch wenn er am Rand der Gesellschaft lebte, in diese Ruine hineintraute. Was dort vor ihnen stand, dieser rechteckige Ziegelbau mit einem Dach darauf, als hätte es einen Luftangriff hinter sich, war in jeder Hinsicht unbewohnbar. Die Tür, an deren Brettern die Jahre wie die Vernachlässigung genagt hatten, schien in der Öffnung geschrumpft zu sein, und die Fenster zu beiden Seiten machten einen finsteren Eindruck, da irgendjemand, wahrscheinlich »diese Spinner«, sie mit zwei Flicken aus demselben schwarzen, schäbigen Stoff abgedeckt hatte, damit kein Licht hineindrang. Einer der beiden Flicken war noch gut befestigt und verhüllte das Fenster, der andere hatte sich gelöst und flatterte im Wind, wie die Flagge eines Piratenschiffs. Kurioserweise verliehen nur die Wagen der örtlichen Polizei und die Männer in Uniform, die vor der Tür standen, der Umgebung einen Anschein von Normalität.
Immerhin, dachte Leire, während sie zu ihrem Kollegen ging, gehört zu dem Kasten ein riesiges Grundstück. Eine von Unkraut und Sträuchern verschlungene Brache allerdings, die sich so weit erstreckte, dass sie mit der Landschaft im Hintergrund verschmolz.
»Das ist Leire Castro. Leire, der Kollege Torres. Er und seine Männer haben die Leichen gefunden.«
Leire gab dem Beamten die Hand, einem Mann in den Vierzigern, der sie mit einem nervösen Lächeln grüßte.
»Die von der Spurensicherung sind eben gekommen«, sagte er. »Sie sind schon drin.«
Und mit einem Blick zur Straße erklärte er:
»Wir warten auf den Untersuchungsrichter.«
Im selben Moment zog ein riesiger Schatten über sie, unter ihren Füßen vibrierte der Boden. Torres lächelte nun breit.
»Da kriegt man Angst, was? Der Flughafen ist ganz in der Nähe, und die verdammten Dinger fliegen tief.« Er machte eine Pause. »Sie wissen, was in dem Haus ist?«
»Zwei Leichen, oder?«, sagte Leire, und es klang unnötig schroff.
»Nicht nur, nein. Nicht nur zwei Tote. Ich will es Ihnen erklären.«
Leire hätte schwören können, dass der Polizist dabei erschauerte.
Sie seien, erzählte Torres, gegen neun Uhr morgens hergekommen, da Leute, die leere Häuser besetzten, so seine Theorie, bestenfalls geborene Herumtreiber seien, Asoziale und Faulenzer, die vor Mittag keinen Fuß in die Welt setzten. Zwar betrachte er sich mit seinen sechsundvierzig Jahren grundsätzlich als einen Menschen mit einer offenen Geisteshaltung, doch was das Privateigentum angehe, habe er einen festen Standpunkt: Man dürfe nicht erlauben, dass eine Horde von Dummköpfen, die in ihrem Leben noch nie einen Finger krumm gemacht hätten und die noch dazu eine Meute räudiger Hunde hinter sich herschleiften, dass diese Leute sich fremden Wohnraum unter den Nagel rissen. »Eine Saubande« nannte er sie, und das Wort umfasste sowohl die Menschen als auch diese ausgehungerten Tiere, die ihnen mit einer so blinden wie unbegreiflichen Ergebenheit folgten.
Eine Woche zuvor hatte ihn der erste Hinweis erreicht, dass ein paar seltsame Gestalten am Strand herumstreiften, und jemand hatte gesehen, wie sie in diese Richtung zogen. Torres versuchte herauszufinden, wem das Grundstück gehörte, und kam zu dem unbefriedigenden Schluss, dass tatsächlich kein Besitzer bekannt war. Die letzte nachweisliche Eigentümerin war eine gewisse Francisca Maldonada, seit zwanzig Jahren verstorben. Wenn man in Betracht zog, dass die Dame in vorgerücktem Alter gestorben war und dass die entsprechenden Steuern schon vor dem Ableben der Frau nicht mehr entrichtet wurden, gehörte das Haus de facto niemandem. Vermutlich war das Grundstück nur deshalb nicht von der Gemeinde enteignet und als Baugrund für neue Wohnungen verkauft worden, weil es, Jahre nach Errichtung des Hauses, im Bereich des Bebauungsplans für den neuen Terminal des Flughafens Barcelona-El Prat lag. Entgegen allen Prognosen waren das Gebäude und die angrenzenden Felder am Ende jedoch davongekommen, und sowohl die Behörden wie auch die Baugesellschaften schienen sie vergessen zu haben, da niemand etwas damit anfangen konnte – die Nähe des Airports und der ständige Flugverkehr machte sie für jedes Vorhaben unbrauchbar.
Torres jedenfalls war nicht bereit hinzunehmen, dass ein paar hirnlose Typen und ein paar Hunde sich einfach so in seiner Gemeinde niederließen, und er war sich sicher, dass ein entschlossener Besuch der Polizei sie zum Aufbruch bewegen würde. Wohin, war ihm egal, auch hatte er nicht die geringste Absicht, sie festzunehmen, solange sie keinen Widerstand leisteten oder man im Haus nichts offenkundig Strafbares fand, er hätte sie sonst mit Freuden eingelocht. Am praktischsten aber wäre es gewesen, im Haus aufzutauchen, sie tatkräftig, wenn auch ohne Gewalt hinauszubegleiten, dann die Tür und die Fenster zumauern zu lassen und die Sache ad acta zu legen. Der Polizist war ein treuer Anhänger der Maxime »Vorsicht ist besser als Nachsicht«, und früher oder später hätte eine Gruppe Hausbesetzer ihm garantiert Scherereien gemacht. So hatte er vierundzwanzig Stunden zuvor, nach mehreren Besprechungen und Auswertung der Informationen mit seinen Vorgesetzten, die Genehmigung erhalten, zu handeln.
Und genau das hatte er getan. Am Morgen des 11. Mai war Torres um 8 Uhr 30 mit ein paar seiner Männer zu dem Haus gefahren. Nachdem er seine Zigarette auf dem Boden ausgetreten hatte, wies er den Beamten Gómez an, nunmehr an die Tür zu klopfen. Ein nutzloses Unterfangen, da genau in dem Moment das Dröhnen eines startenden Flugzeugs jeden anderen Laut erstickte, und die Wirbelschleppe der Maschine brachte die Bretter noch heftiger zum Erbeben als jede Faust. Der schwarze Behelfsvorhang im Fenster begann wild zu schlagen, wie ein gelähmter Rabe, der es nicht in die Lüfte schafft, und ein anderer Polizist, einer der Jüngeren, zog erschrocken den Kopf ein und brüllte laut »Scheiße«, was für die Kollegen ebenfalls unhörbar blieb. Aber es war beeindruckend, diese metallenen Viecher so von Nahem zu sehen, und für ein paar Sekunden folgten die Blicke aller dem weißen Streifen, den der mechanische Vogel am Himmel hinterließ, fasziniert wie die Kinder, die einem Ballon nachsehen, wenn er ihnen aus der Hand gleitet.
Gómez schaute als Erster wieder zurück, und mit einem leichten Achselzucken räusperte er sich noch, als bäte er um Erlaubnis, bevor er ein weiteres Mal an die Tür klopfte. Diesmal waren seine Schläge allerdings zu hören, doch niemand antwortete.
»Sind Sie sicher, dass jemand drin ist?«, fragte er. »Merkwürdig, dass nicht mal die Hunde bellen.«
Torres dachte dasselbe, und in dem Moment hörte er hinter sich ein dumpfes Knurren. Er drehte sich um und stand vor einem Köter, dünn wie ein Windhund, der sie neugierig beobachtete. Vorsichtshalber griff er nach seinem Schlagstock, und jetzt bellte das Tier los, rührte sich aber nicht weiter, wartete ab.
»Verdammte Töle«, grummelte Torres. Und zu den anderen gewandt rief er: »Scheiß drauf, gehen wir einfach rein.«
Unter dem aufmerksamen Blick des Hundes stieß Gómez die Tür auf und trat, Taschenlampe in der Hand, ins Haus, die anderen hinterher. Als sie es dann später erzählten, förmlich für den Polizeibericht oder, in lockererem Ton, im vertrauten Kreis, sagte einer, kaum sei er im Haus gewesen, habe er schon geahnt, dass diese Räumung nicht so sein würde wie sonst. Doch verwundert hatte sie zunächst nur, wie ordentlich und sauber alles war. Ein Tisch, vier Stühle, ein altes Sofa und zwei Sessel, ein zerbrochener Spiegel. Dann leuchtete jemand auf die Wände, und ja, da wurde ihnen klar, dass die Leute, die sich dort eingerichtet hatten, keine gewöhnlichen Hausbesetzer waren.
»Gleich sehen Sie es selbst«, schloss Torres und stand schon an der Tür. »Wirklich seltsam, das Ganze. Niemand wäre auf die Idee gekommen, dass es in einem Haus in dieser Gegend einen Keller geben könnte, hier ist alles sumpfig. Na ja, Keller ist zu viel gesagt, eher ein Abstellraum.«
Der Hund, der ein paar Meter vor ihnen auf dem Boden lag, hob den Kopf, als er sie kommen hörte, machte aber keine Anstalten, auf sie zuzugehen. Der Form halber bellte er und legte sich wieder hin. Er hatte sich schon damit abgefunden, dass fremde Leute in sein Revier eindrangen.
»Er ist harmlos«, meinte Torres, als er sah, wie Roger Fort dem Tier einen scheuen Blick zuwarf. »Ich weiß nicht, wohin mit ihm.«
»Gehen wir nun rein?«, fragte Leire.
Sie selbst wie auch ihr Kollege hatten dem ausführlichen Bericht des Beamten höflich zugehört. Trotzdem hatte Leire das Gefühl, dass Torres sie gewissermaßen auf der Schwelle zurückhielt, als wollte er eine Erwartung schüren angesichts dessen, was sie im Haus vorfinden würden. Zumindest bei Leire Castro beförderte dies eine Ungeduld, die sie kaum noch im Griff hatte.
»Natürlich. Folgen Sie mir.«
Licht gab es kaum, nur was durch die Türöffnung drang, die Wände wurden von der Dunkelheit verschluckt. Torres gab ihnen jeweils eine Taschenlampe, damit sie die Räumlichkeit in Augenschein nahmen. Leire konnte einen überraschten Ausruf nicht unterdrücken, als sie sah, was Torres, der sich nun als eine Art Fremdenführer gab, mit seiner eigenen anleuchtete.
Die Bewohner des Hauses hatten den Raum mit Leinwänden behängt, riesige Flächen, die vom Boden bis zur Decke reichten. Fort und Leire brauchten eine Weile, ehe sie begriffen, dass es Teile einer Gemäldegruppe waren, links der Tür beginnend mit einem Bild des Hauses, von außen gesehen. Ohne Zweifel war der Künstler kein bloßer Hobbymaler, denn er hatte das Haus nicht nur so dargestellt, dass man es gleich wiedererkannte, es war ihm auch gelungen, eine Ahnung von seiner Einsamkeit und Verlassenheit zu vermitteln, betont noch durch ein paar Vögel mit starren Flügeln, die dem Ganzen einen makabren Hauch verliehen. Die schwarzen Tiere fanden sich auch auf einem anderen der Bilder: hingestreut auf dottergelbem Grund, die Flügel ausgebreitet, die Schnäbel aufgerissen, als ob sie schrien. Überhaupt war diese Farbe, dieses Gelb in unterschiedlichen Tönen, eine Konstante, auch wenn die Form wechselte. Mal waren es versprengte dicke Kleckse, als wäre die Sonne explodiert, mal hatte man den Eindruck, als fiele ein warmer, schmutziger Regen. Auf anderen Bildern wanderte es an den unteren Rand der Leinwand – verdorrte Sträucher, Hunde, die einer Spur folgten, ausgetrocknete Schlangen oder auch die Erde selbst, wie geflickt –, und auf einem der Gemälde, dem beeindruckendsten, vor dem die drei stehen blieben und auf das sie die Taschenlampen richteten, als wollten sie es mit ihrem Licht durchlöchern, überflutete das Gelb fast alles. Es schuf einen Teppich aus Blumen, die, im unteren Teil fein konturiert, nach oben hin immer mehr verschwammen, so als kauerte der Künstler zu Füßen eines imaginären Bettes und betrachtete von dort aus die darin Liegenden, im oberen Teil des Bildes. Zwei schwarze Totenschädel, verkohlt, zwei dürre Arme, zwei knöcherne Hände, ineinandergeschlungen auf dem floralen Grund.
Eine Berührung an den Beinen, und Roger Fort zuckte zusammen und ließ die Taschenlampe fallen. Es war der Hund, der zu ihm aufschaute und nicht von seiner Seite wich, nicht einmal, als er ihn kurz wegschubsen wollte, mehr vor Schreck, als um ihn zu treten. Jeder andere Straßenköter hätte die Zähne gebleckt oder wäre, durch Schaden klug, davongelaufen. Dieser Hund jedoch schaute ihn nur geduldig an, als wäre er derartige Reaktionen gewohnt und mäße ihnen keine größere Bedeutung bei.
Der Zwischenfall vermochte es, den Bann zu brechen und sie alle wieder in ihre Rolle als Polizisten zu schicken, nicht als Ad-hoc-Besucher eines geheimen Museums. Leire leuchtete nun den übrigen Raum aus. Wider Erwarten war er nicht allzu schmutzig. Sie sah Konservendosen in einem Regal, alle ungeöffnet; einen halbvollen Müllbeutel, einen alten Pullover, den jemand in die Ecke geworfen hatte, und Aschenbecher, die überquollen, wenn auch nicht gerade von normalen Kippen. Der Duft von Gras hing in dem verschlossenen Raum noch in der Luft.
»Und keine Spur von den Hausbesetzern?«, fragte Fort.
Torres schüttelte den Kopf.
»Sie haben sich aus dem Staub gemacht. Zeugen haben sie am Wochenende gesehen, sie können also nicht weit sein. Andererseits haben wir keine genaue Beschreibung. Sie wissen schon, die üblichen Visagen.«
Leire trat erst an den Tisch und ging dann in die Küche, wenn man diesen winzigen Raum so nennen wollte. Die Wände hatten mit der Zeit ihre Kacheln verloren und sahen aus wie ein unvollständiges Stickeralbum, überall weiße Löcher, die mit dem spärlich verbliebenen Himmelblau kontrastierten.
»Hausbesetzer, die das Geschirr spülen, bevor sie gehen?«, rief sie spöttisch. »Wie die Welt sich ändert.«
Das stimmte. In der Keramikspüle, mittendrin ein großer Sprung, standen mehrere Teller und ein abgeplatzter Topf, alles vollkommen sauber und trocken. Der Hund kam zu ihr und schnupperte an einem Unterschrank. Leire ahnte, dass darin sein Futter war.
»Hast du Hunger?«, flüsterte sie.
Sie öffnete den Schrank, und tatsächlich fand sich ein Beutel Trockenfutter. Sie suchte nach einer Schale oder irgendeinem anderen Gefäß, sah aber nichts. Bei der Aussicht, etwas zu fressen zu bekommen, bellte der Hund freudig auf, und mit der Schnauze bewegte er die Küchentür. Dahinter stand er: ein gelber Plastiknapf. Leire schüttete das Futter hinein und ging wieder nach nebenan.
»Und die Leichen?«, fragte in dem Moment Roger Fort.
»Unten. Im Keller. Als ich die Bilder sah, hatte ich den Eindruck, dass das Haus womöglich noch mehr verbarg.« Torres räusperte sich. »Einige Motive hatte der Maler aus der Wirklichkeit: das Haus, die Hunde. Die Flugzeuge. Das Einzige, was er sich offenbar ausgedacht hatte, waren die Toten. Also habe ich das Gebäude durchsucht. Und da habe ich sie gefunden. Folgen Sie mir bitte, auch wenn wir nicht alle hineinpassen.«
Leire bemerkte noch einen Gegenstand, den sie vorher nicht gesehen hatte. Neben der als Bett dienenden Pritsche stand ein Spiegel. Im Licht der Taschenlampe sah sie ihr Gesicht in dem zerbrochenen Glas und musste erschauern vor diesem kubistischen Bild. Ihr kamen die Spiegelkabinette in den Vergnügungsparks in den Sinn, die die Körper verzerren. So etwas hatte sie noch nie gemocht. Der Hund, der wieder so still zu ihr gekommen war, als gehörte er zur Katzenwelt, bellte erneut. Auch er mochte seinen zersplitterten Anblick nicht.
Leire schüttelte den Kopf und folgte den Kollegen. Am Ende des Raums ging eine Treppe ins Obergeschoss hinauf, dahinter verborgen eine Falltür, die in den Keller führte. Unten waren Geräusche zu hören. Die Leute von der Spurensicherung taten ihre Arbeit.
Sie stieg langsam hinab, den beiden Männern hinterher, und auch wenn sie schon eine Vorstellung hatte von dem, was sie erwartete, verzog sich ihr Gesicht zu einer angewiderten Miene, als der Lichtkegel auf dieses soeben geschändete Grab fiel. Das Bild an der Wand hatte eine klare Sprache gesprochen, dennoch war sie überrascht, als sie das Plastikding sah, eine Art Wachstuch, bedruckt mit gelben Blumen und um die beiden Leichen gelegt: verweste Körper, kaum noch Haut und Knochen, wie verschmolzen in einer ewigen Umarmung.
Sie hatte sich schon an den ständigen Flugbetrieb gewöhnt und war dankbar für die Sonne, die um diese Zeit unbekümmert vom Himmel schien. Der Untersuchungsrichter war mittlerweile eingetroffen und hatte angeordnet, die Leichen zu bergen. Eine komplizierte Angelegenheit angesichts ihres Zustands und der steilen Treppe. Leire sah wieder zur Haustür. Sie hatte nicht die geringste Lust, noch einmal hineinzugehen, aber sie musste es, als Roger Fort im Rahmen stand und nach ihr rief, mit einem so zufriedenen Lächeln, dass es ihr unangemessen vorkam, völlig fehl am Platz. Sie arbeiteten noch nicht lange zusammen, erst seit sie nach dem Mutterschutz ihren Dienst wieder angetreten hatte, und so freundlich er auch war, zweifellos ein wohlerzogener Typ, konnte sie noch nicht sagen, ob sie ihn mochte.
»Ich glaube, wir haben Glück gehabt«, meinte er, als sie bei ihm war. »Unter ihnen lag so eine Art Rucksack. Nein«, korrigierte er sich: »ein Rucksack. Vielleicht findet sich darin etwas, womit wir sie identifizieren können.«
Der Gerichtsmediziner hatte sich nicht zu einer Schätzung hinreißen lassen, wie lange sie schon tot waren, doch niemand bezweifelte, dass ihre Körper dort schon seit Jahren lagen. Leire wusste, dass das Plastik, mit dem man sie zugedeckt hatte, die Bestimmung eines exakten Datums erschwerte. Dagegen war schon bei der ersten Inaugenscheinnahme klar geworden, dass die beiden Personen – ein Mann und eine Frau – nicht auf natürliche Weise gestorben waren. Beim Mann deutete ein Riss an der Schädelbasis darauf hin, dass jemand ihm einen heftigen Schlag versetzt hatte. Ihr hatte man den Kopf grausam entzweigeschlagen.
Mit übergezogenen Handschuhen öffnete Fort den Rucksack und prüfte den Inhalt. Leire wartete, und dabei konzentrierte sie sich auf die Gemälde, die nacheinander abgenommen wurden. Sie merkte sich die Reihenfolge, in der sie hingen. Zwar ließ es sich anhand der Fotos später rekonstruieren, aber ihr Gefühl sagte ihr, dass die Anordnung der Bilder wichtig war und dass jemand damit vor allem etwas erzählen wollte.
»Sehr schön«, rief Fort, doch als er die Personalausweise hervorzog, die in den beiden Portemonnaies steckten, trübte sich seine Miene. »Sie waren noch jung.«
Leire musterte die Ausweise. Die Gesichter der Opfer schauten sie mit einem forcierten Lächeln und großen Augen an.
»Daniel Saavedra Domènech. Cristina Silva Aranda.« Dann las sie die Geburtsdaten. »Scheiße, sie waren wirklich noch jung.«
»Jemand wird ihr Verschwinden gemeldet haben. Sie sehen nicht aus wie …«
Leire verstand, was Fort sagen wollte. Jemand musste diese jungen Leute mit spanischer Nationalität und einem Lächeln im Gesicht vermisst haben. In wenigen Stunden würden zwei Familien bestätigt sehen, was sie schon ahnten. Oder hinnehmen, dass ihre Hoffnungen gestorben waren.
Torres kam zu ihnen.
»Haben Sie etwas gefunden, was bei der Identifizierung weiterhilft?«
Leire zeigte ihm die Ausweise. Der Mann nickte.
»Das wird Ihnen die Sache erleichtern. Wir suchen weiter nach den Hausbesetzern«, sagte er, und die beiden Kriminalbeamten hatten den Eindruck, dass es ihm schwerfiel, sich von dem Fall zu trennen. »Wir bleiben in Kontakt.«
»Klar«, sagte Leire, auch wenn sie es eher bezweifelte. »Bestimmt finden wir noch Spuren im Haus. Ob gewollt oder nicht, Spuren werden sie hinterlassen haben. Wenn einer vorbestraft ist, haben wir ihn bald.«
Der Polizist pflichtete bei. Dann lächelte er, ein wenig resigniert, und verabschiedete sich.
»Den Rest sehen wir uns auf dem Kommissariat an«, sagte Leire, die endlich gehen wollte.
Als sie draußen waren und schon beim Wagen standen, hielt ein Bellen sie zurück. Der Hund sah ihnen von der Schwelle aus nach, und in seinen Augen lag die Trostlosigkeit eines Tiers, das schon tausendmal verlassen wurde und sich seines Unglücks bewusst ist. Leire seufzte und machte kehrt, aber dann hörte sie überrascht, wie ihr Kollege laut pfiff und die Hecktür öffnete.
Der Hund zögerte erst. Dann lief er, mit der unschuldigen Hoffnung der Vierbeiner, auf sein neues Schicksal zu. Als Leire zu Fort sah, errötete der.
»Ich wollte immer schon einen haben«, sagte er, wie um sich zu rechtfertigen.
Sie lächelte. Vielleicht mochte sie den Jungen langsam doch.
3
Wenn er an etwas merkte, dass er die Grenze der vierzig überschritten hatte, dann nicht an seiner Kondition, denn die konnte sich sehen lassen, auch nicht an seiner geistigen Beweglichkeit, da konnte er nicht klagen, noch nicht. Héctor Salgado wusste, dass das Alter sich bei ihm auf eine etwas rätselhaftere Weise äußerte, es injizierte ihm eine feine Dosis Trägheit, sobald gewisse Aktivitäten in Angriff zu nehmen waren, Aktivitäten, die er sich vorgenommen hatte, meist in den frühen Morgenstunden, wenn er den Tag plante.
Gegen diese plötzliche Lethargie hatte der Inspektor jedoch gelernt anzukämpfen. So auch an jenem Mittwoch im Mai, als er von der Arbeit nach Hause kam und sein Körper ihm nahelegte, zur Dachterrasse hinaufzugehen, ein Bier aufzumachen und mit all der Ruhe, die ihm das Alleinsein vergönnte, drei oder vier Zigaretten zu rauchen; und ein rebellischer Drang, wie er ihn sonst nur der Jugend zugestand, dergleichen Anregung zum Schweigen brachte und ihm sagte, er solle sich umziehen und joggen gehen.
Es war fast halb neun, und Héctor trabte erst einmal langsam los, um die Muskulatur aufzuwärmen, ohne einen Blick zu den Leuten, die es sich, Glas in der Hand, in den Straßencafés bequem machten. Er hatte es mit Kopfhörern probiert und beim Laufen Musik gehört, doch Tatsache war, dass er den natürlichen Straßenlärm mehr genoss, den Rhythmus seiner eigenen Schritte und wie sie von Minute zu Minute schneller wurden. Beim Joggen entzog er sich auf unglaubliche Weise allem, was ihn umgab, konzentriert allein darauf, zu spüren, wie bei jedem Schritt die Spannung von seinem Körper abfiel und er in eine Geschwindigkeit hineinlief, von der nicht wenige in seinem Alter träumten. Ein vielleicht dummer Stolz, aber völlig unschädlich. Als er zum Passeig Marítim kam und erleichtert die Brise wahrnahm, die dieses gebändigte Meer vor der Stadt herüberschickte, musste er beinahe lächeln, so froh war er, dort zu sein und den Körper zu trainieren, statt sich zu Hause auf die Couch zu hauen. Seine Bauchmuskeln, dieser so schüchterne Teil der männlichen Anatomie, würde es ihm danken. Und Lola auch.
Bei dem Gedanken an sie lief er noch schneller. Seit dem Abend, als es geschneit hatte, vier Monate war es her, hatte ihre Beziehung eine Art Neubeginn erfahren. Und als hätten sie sich gerade erst kennengelernt und zögerten noch, sich darauf einzulassen, hatten sie sich nur sporadisch getroffen, etwa alle drei Wochen. Der Abstand war kein Zufall, er entsprach den Reisen, die Lola nach Barcelona führten, auch wenn Héctor ahnte, dass die Journalistin jeden Vorwand zu einem Besuch der Gräflichen Stadt nutzte. Denn zugegeben hätte sie es nie: Lola schob den Job vor, und ihm kam es nicht zu, es ihr unter die Nase zu reiben. Nach und nach, anhand von Bemerkungen oder einem spontanen Satz, hatte Héctor den Gedanken zugelassen, dass ihre frühere Trennung, ein Beschluss seinerseits, um bei seiner Frau und seinem Sohn zu bleiben, für Lola ein sehr viel härterer Schlag gewesen war als vermutet. Nichts davon hatte sie erkennen lassen. Lola war keine Frau, die vor Männern weinte. Schlechten Nachrichten stellte sie sich selbstbewusst, vielleicht auch nur mit Würde. Und wie Madame de Merteuil, die kühle, intrigante französische Marquise, die für Héctor immer die Züge von Glenn Close tragen würde, hatte sie gelernt, sich unterm Tisch eine Messerklinge in die Hand zu drücken und zugleich zu lächeln. Doch anders als die Marquise hatte Lola so etwas nicht verdient. Hinter der Fassade einer harten, resoluten und gar ein wenig spröden Frau verbarg sich ein sehr viel zerbrechlicherer Mensch, was Héctor vorher nie gesehen hatte.
In ihrer früheren Beziehung, diesem Seitensprung, der für ihn vor allem ein sexueller Ausgleich war angesichts von Ruths üblicher Lustlosigkeit, war die echte Lola nicht zum Vorschein gekommen. Sie hatten sich gesehen, so oft es ging, hatten wortlos gebumst und miteinander geredet, ohne sich viel zu sagen, denn in einer solchen Situation glitten die Wörter allzu schnell in Gemeinplätze ab, was beide hassten. Weder wollte er seine Frau vor Lola kritisieren, noch war sie so heuchlerisch, als dass sie sich dem Mann, mit dem sie eben geschlafen hatte, als Eheberaterin angedient hätte. Weshalb ihm, als er die Sache beendete, auch nicht in den Sinn gekommen wäre, dass es sie sonderlich berührte. Wie alle verheirateten Männer, die eine Affäre mit einer ledigen Frau hatten, hielt er es für wahrscheinlich, dass es da noch andere Liebhaber gab, ein Eindruck, zu dem Lola das Ihre beitrug. Nur entsprach es, wie er heute wusste, kaum der Wahrheit.
Die Brise wurde zum Wind, und auf der Promenade waren bloß noch andere Jogger, hin zu einem Ziel, das es nur in ihrem Kopf gab. Um sich selbst zu übertreffen. Um der Zeit Sekunden abzuringen. Vielleicht wurden diese abendlichen Läufe aber auch, so wie es ihm manchmal passierte, zu einer Scheinflucht, einer vagen Möglichkeit, sich vom Alltag abzukoppeln, alles hinter sich zu lassen auf der Suche nach einem neuen Weg, einem anderen Ende.
Aber das war unmöglich, er wusste es genau, denn früher oder später spielten die Beine nicht mehr mit. Sie drehten um, kehrten zurück zum Ausgangspunkt, als zöge jemand an einem unsichtbaren Band und zeigte ihm die Grenzen auf. Mit über vierzig konnte man nicht das Gleiche tun wie mit neunzehn: sich einfach aufmachen und bedenkenlos in eine Zukunft fliehen, die einem, ausgemalt von der Hoffnung und der Unreife, besser erschien, attraktiver; konnte nicht in eine andere Stadt entwischen, jenseits des Ozeans, um einer nicht überglücklichen Kindheit den Rücken zu kehren und einem Vater, dem nur allzu oft die Hand ausrutschte. Was ihm mit über vierzig zu schaffen machte, war die Gegenwart, die ihn wie ein Anker fest an die Erde band, an eine Wohnung, ein Leben. Was zählt, sagte er sich, ist der Augenblick, sind die Möglichkeiten in der unmittelbaren Wirklichkeit; beim Laufen bis an die Grenzen zu gehen, federnden Schrittes nach Hause zu kommen, mit Guillermo zu Abend zu essen, Lola anzurufen. Um dann, wenn alle Verpflichtungen erfüllt waren, zu einem Treffen aufzubrechen, das er sich vorgenommen hatte.
Die Beine gehorchten seinem Befehl und beschleunigten, unbeirrt und beständig. Es war schon dunkel, als Héctor erschöpft, fast außer Atem den Rückweg einschlug. Neben ihm verschmolzen Meer und Himmel in einem einzigen, von schmutziger Gischt gesäumten Schwarz. Und während er in einem ruhigeren Tempo joggte, zogen die Ereignisse des Tages durch seinen Kopf, einen sehr viel wacheren und klareren als zu Beginn des Laufs.
Die Fotos, vor ihm auf dem Schreibtisch ausgebreitet, gaben dem Bericht seiner Teamkollegen die nötige Anschaulichkeit. Ein verlassenes Haus, besetzt von Unbekannten, die die Wände mit Bildern dekoriert hatten. Ein Keller als Grabstätte. Eine makabre bunte Wachsdecke als Leichentuch, als wäre das Grab ein Blumenbett. Das deutliche Gefühl, dass die Toten ein Liebespaar gewesen waren und dass jemand, wahrscheinlich ihr Mörder, gewollt hatte, dass sie zusammen lagen.
»Wissen wir mehr über die Toten?«, fragte Héctor.
»Bisher nicht«, antwortete Roger Fort. »Die Personalausweise sind unversehrt, und die Namen stimmen mit der Vermisstenanzeige von 2004 überein. Wir warten noch auf die entsprechende Akte.«
Héctor wusste, dass sie aus der Abteilung kam, die Inspektor Bellver leitete. Alle Vermisstenanzeigen gingen über seinen Tisch. Auch die von Ruth, dachte er.
»Drücken wir die Daumen, dass sie nicht lange brauchen«, brummte er.
Leire lächelte. Das Verhältnis zwischen ihrem Chef und Dídac Bellver war noch nie sehr geschmeidig gewesen.
»Und der Rucksack? Was war noch drin?«, fragte Héctor.
Der Inhalt des Rucksacks befand sich, sorgfältig registriert, in Druckverschlussbeuteln. Héctor sah sie sich einen nach dem anderen an. Eine Schachtel Präservative. Ein paar Garnituren Unterwäsche, für sie und für ihn. Ein Kulturbeutel mit zwei Zahnbürsten und ein Fläschchen Haargel. Nichts Besonderes also. Überraschend war der Rest.
»Was ist das?«
Héctor deutete auf ein paar Bögen Papier, zerknittert und fast unlesbar.
Leire trat an den Tisch. Sie hatte die Zusammenfassung ihrem Kollegen überlassen, irgendwie fühlte sie sich noch nicht ganz zurück in ihrem Job.
»Ich würde sagen, das sind Liedtexte, mit Gitarrenakkorden«, sagte Fort.
»Mensch, Musik können Sie auch?«
»Na ja, wer hat nicht mal in einer Band gespielt.«
Héctor stimmte höflich zu.
»Ja, vielleicht bringen sie uns weiter.« Er nahm einen großen, länglichen Umschlag, typisch für Bankauszüge. Es war der letzte Gegenstand aus dem Rucksack.
»Das ist das Merkwürdigste überhaupt, Herr Inspektor«, sagte Fort. »Wer sie getötet hat, wollte sie jedenfalls nicht ausrauben.«
Das stimmte. Denn kein Dieb, ob Profi oder Gelegenheitstäter, hätte über den Inhalt dieses dicken Umschlags hinweggesehen. Fünfhundert-Euro-Scheine, sauber gebündelt, und das in einer nicht zu verachtenden Menge.
»Wie viel ist es?«
»Zwanzig gleiche Scheine, Herr Inspektor. Zehntausend Euro, immerhin.«
Héctor dachte nach und versuchte sich vorzustellen, unter welchen Umständen jemand eine solche Menge Geld hätte ignorieren können. Ein Jemand, der auf diese beiden Personen eingeschlagen hatte, bis sie tot waren, um ihre Körper dann bei einer Art Begräbnisritual zu arrangieren. Jemand, der in der Lage war zu morden, aber nicht, einen Toten auszurauben. Zu töten und die Opfer danach auf eigene Weise zu ehren.
»Schön. Warten wir, bis der Bericht da ist und die Leute von der Rechtsmedizin ihre Arbeit gemacht haben …« Er unterbrach sich. »Obwohl, wenn es eine Vermisstenanzeige gibt, dürfte der Rucksack kaum zufällig dort gelandet sein. Der Familie teilen wir es am besten erst morgen mit, wenn wir mehr wissen. Sonst noch etwas Auffälliges in dem Haus?«, fragte Héctor. »Außer den Bildern, klar.«
»Ein Hund«, sagte Leire und lächelte, als sie sah, wie ihr Kollege errötete. Und als sie dann das Gesicht ihres Chefs sah, fügte sie in ernsterem Ton hinzu: »Sie versuchen noch, die Spuren der Hausbesetzer zu sichern. Vielleicht finden wir da noch etwas heraus.«
»Einverstanden. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Und Leire, versuchen Sie etwas über diese Bilder in Erfahrung zu bringen. Ich schaue sie mir dann in Ruhe an. Ich muss jetzt zu einer …«
Héctor hatte den Satz noch nicht beendet, als ein Anruf ihn informierte, dass Kommissar Savall ihn in seinem Büro erwarte.
Er hörte, wie die Wohnungstür seiner Vermieterin aufging, und blieb stehen. Seit Tagen war er ihr nicht begegnet. Die Frau trat ins Treppenhaus, und Héctor konnte kaum glauben, wie gut sie aussah. Ihr Alter war eins der bestgehüteten Geheimnisse der Welt, doch Carmen musste schon um die siebzig sein, und trotzdem war sie immer fein zurechtgemacht, selbst zu Hause. Als er einmal eine entsprechende Bemerkung machte, hatte sie mit einem Lächeln erklärt, das Alter sei schon Strafe genug, das müsse sie nicht durch Nachlässigkeit noch unterstreichen. Kittel und Pantoffel waren nichts für Carmen, die sich drinnen so kleidete wie draußen: bequem, aber korrekt, als erwarte sie stets Gäste.
»Was machst du nur für ein Gesicht!«, schimpfte sie halb im Scherz. »Diese Lauferei haut dich irgendwann noch um.«
»Der Körper will fit gehalten werden, sonst rostet er«, sagte er mit heiserer Stimme, was ihn selber überraschte.
»Na, in letzter Zeit trainierst du ihn ja ordentlich.« Carmen lächelte. »Das freut mich, ob du es glaubst oder nicht.«
Er wurde rot, so peinlich war es ihm, überspielt zum Glück von der Erschöpfung in seinem Gesicht. Guillermo war zum Ende des Schuljahres auf Klassenfahrt gewesen, und Lola hatte ein Wochenende bei ihm verbracht. Carmen, Vermieterin durch Zufall und neugierig aus Leidenschaft, war der Aufenthalt dieser Frau gewiss nicht entgangen, der ersten, die sein Zuhause betrat, seit Ruth gegangen war.
Héctor wollte sich verabschieden und in die Wohnung gehen, zwei Stockwerke über ihr, doch sie entließ ihn nicht.
»Warte, geh nicht gleich. Komm einen Moment rein.«
»Ich rieche scheußlich …«
Die Frau machte eine wegwerfende Handbewegung und schloss die Tür hinter ihnen.
»Komm in die Küche, ich habe etwas für dich.«
Sie musste ihm gar nicht sagen, was es war, der knusprige Duft von frisch gebackenen Empanadas drang zu ihm und weckte so viele Erinnerungen wie Appetit.
»Ich weiß nicht, ob sie mir gelungen sind«, sagte sie, worauf sie ein Dutzend aus dem Ofen zog und auf Alufolie legte, um sie einzuschlagen. »Du weißt ja, ich mixe die Rezepte gern.«
»Die sind bestimmt lecker. Guillermo wird begeistert sein, Sie kennen ihn.«
»Der Junge muss mehr essen. Gestern habe ich ihn gesehen, er ist größer geworden, aber dünn wie ein Besenstiel.«
Wohl wahr. Der Junge kam ganz nach seiner Mutter: zarte Knochen, lange Gliedmaßen, Zeichentalent. Das Einzige, was er von ihm hatte, hätte Héctor ihm am liebsten nicht vererbt: diese für einen Vierzehnjährigen unangemessene Ernsthaftigkeit, etwas Frühreifes auch, womit manchmal nur schwer umzugehen war. Nicht alles konnte man auf die Gene schieben, aber das letzte Jahr war für niemanden einfach gewesen, erst recht nicht für seinen Sohn.
Carmen packte die Empanadas zu einem Päckchen und gab im letzten Moment noch ein paar drauf. Dann steckte sie alles in eine Plastiktüte, gab sie ihm aber nicht. Sie stellte sie auf den Küchentisch und schaute Héctor an, ihre Miene war auf einmal traurig. Er ahnte, worum es ging. Kummer machte ihr nur einer.
»Ist etwas mit Carlos?«, fragte er.
Carlos, von seinen Freunden Charly genannt, war Carmens Sohn und für die Frau ein Kreuz, das sie nicht verdient hatte. Mit seinen gut dreißig Jahren hatte sich der liebe Junge schon allen erdenklichen Ärger eingehandelt, auch wenn er es bisher immer geschafft hatte, einigermaßen heil wieder rauszukommen. Seit er mit achtzehn Jahren, als er ein Cabrio klaute und zu Schrott fuhr, zum ersten Mal verhaftet wurde, war Charlys Biografie eine einzige Abfolge von kleineren Straftaten und Tummeleien in schlechter Gesellschaft. Hätte er für eine Bewerbung einen Lebenslauf einreichen müssen, hätte seine »Berufserfahrung« jeden Personalchef sprachlos gemacht. Zu seinem Glück oder auch Unglück hatte Charly sich gewiss noch nie dazu genötigt gesehen; eine normale Arbeit zu finden hatte er garantiert nie auch nur in Betracht gezogen. Wann immer Héctor an ihn dachte, kam ihm ein alter Tango in den Sinn, an dessen Titel er sich nicht erinnerte, der aber ungefähr so ging: »Geh nicht zum Hafen, sei doch nicht dumm! Da wird nur geschuftet, du rackerst wie blöde, ein echter Mann, der legt sich nicht krumm.«
Vor zehn Jahren, auf dem Höhepunkt seiner vielfältigen Abhängigkeiten und Laster, hatte er seiner Mutter einmal gedroht, und Héctor, der es hörte, war so heftig dazwischengegangen, dass der Junge, damals gerade mal zwanzig, von zu Hause abgehauen war und für seine Rückkehr zehn Jahre benötigte. Carmen warf es ihm nie offen vor, aber der Inspektor war sich sicher, dass sie ihn mehr als einmal für die Abwesenheit ihres Sohnes verantwortlich machte. Eine allzu lange Abwesenheit, die, unterbrochen nur von gelegentlichen Bettelbesuchen, vor kurzem zu Ende gegangen war.
Wie ein verirrtes Schaf hatte Charly im Januar schließlich heimgefunden und die Wohnung im zweiten Stock bezogen, zwischen Carmen und Héctor, eine Wohnung, die die Frau in der Hoffnung auf seine Rückkehr immer frei gehalten hatte. In diesen vier Monaten war Héctor ihm ein paarmal auf der Treppe begegnet, aber keiner der beiden fühlte sich bemüßigt, mehr als nur vage zu grüßen. Manche Erfahrung war nur schwer zu vergessen, und wer Héctor Salgado einmal wütend gesehen hatte, neigte dazu, sich mit furchtsamer Klarheit an dieses Bild zu erinnern.
Sie seufzte.
»Mal kommt er, mal nicht, Héctor.« Sie ließ sich auf den Stuhl sinken, und ihre Finger strichen über ein Küchentuch, das sorgfältig zusammengefaltet auf dem Tisch lag. »Egal, geh hoch, essen. Guillermo wartet schon. Wir sprechen ein andermal.«
»Nichts da, ich lasse Sie nicht so hier sitzen«, und seine Stimme klang eine Spur zornig, als er sagte: »Hat er wieder was ausgefressen?«
»Nein.«
Er sah sie ungläubig an.
»Nein, wirklich nicht, Héctor. Was das angeht, habe ich ihm nichts vorzuwerfen. Er ist jetzt ruhiger, und soweit ich weiß, nimmt er auch keine Drogen mehr.«
Tatsächlich hatte Héctor bei ihren seltenen Begegnungen ebenfalls diesen Eindruck gehabt. Charly war ein schlanker, jugendlich wirkender Typ, und aus der Ferne, besser gesagt, von hinten, hätte man ihn für einen Freund von Guillermo halten können. Nur sein Gesicht schaffte es nicht, die Jahre und den schlechten Lebenswandel zu verbergen: ein scheuer Blick aus dunklen Augen, die nicht eine Sekunde ruhig blieben; tiefe, wie eingebrannte Augenringe; spitze Wangenknochen, als wollten sie die blasse, dünne Haut durchbohren; ein kleiner Mund, den die Gewohnheit zu einer Miene zwischen Aufsässigkeit und Widerwillen verdammt zu haben schien. Ruth, erinnerte sich Héctor, hatte immer gesagt, der Junge sehe aus wie ein Frettchen, aber da musste sie ein anderes Tier gemeint haben, denn Frettchen fand er sympathisch. Charly nicht.
»Und?«
»Er ist weg«, sagte Carmen mit leicht zitternder Stimme. »Drei Tage habe ich nichts von ihm gehört, also bin ich heute Morgen zu ihm in die Wohnung hinein. Er hat seine Sachen mitgenommen.«
Héctor konnte nicht verbergen, wie sauer er war. Das hatte Carmen nicht verdient. War es denn so schwer, sich zu verabschieden, eine Erklärung zu geben, und sei sie gelogen, und die alte Dame in Ruhe zu lassen? Durch seinen Kopf ratterten mögliche Gründe für einen solch überstürzten Aufbruch, aber es waren so viele, dass er aufgab.
»Ich mache mir nichts vor, Héctor«, fuhr sie fort. »Ich weiß, wie er ist, auch wenn ich nie verstanden habe, warum, das kannst du mir glauben. Schon als kleiner Junge hatte er nur im Kopf, wie er etwas anstellen konnte. Aber diesmal war er ruhiger. Nie hätte ich gedacht, dass er wegwollte.«
»Er ging nicht oft vor die Tür, oder?«
Sie drückte die Hand aufs Küchentuch, wie um aufzustehen.
»Das ist dir auch aufgefallen, ja? Er ging fast nie raus. Ein paarmal habe ich abends gehört, wie er losging, aber er war so schnell wieder zurück, dass er höchstens eine Runde um den Block gedreht haben kann. Er wollte nicht weg von hier. Außerdem mochte er wohl nicht, dass die Leute ihn sahen. Viele Freunde hat er bestimmt nicht mehr im Viertel, aber den ein oder anderen wird es geben. Trotzdem hat keiner ihn je besucht, kein einziger. Zumindest, soweit ich weiß.«
Sie machte eine Pause, schlug langsam das Tuch auf, als wäre sie mit seinem Aussehen nicht zufrieden, und faltete es wieder, bis es genauso dalag wie zuvor. Ihre Augen blickten auf, mit diesem tiefen Blau, dem das Alter nichts hatte anhaben können, und dann sagte sie, die Worte sorgsam wägend:
»Ich habe Angst, Héctor. Und diesmal fürchte ich nicht, was er tun könnte, sondern was ihm vielleicht zustößt. Und noch etwas.«
»Was?«
»Charly hat eine Pistole. Ich weiß, ich hätte es dir sagen sollen. Aber ich schwöre, ich habe es erst neulich entdeckt.«
»Und warum sagen Sie es mir jetzt?«, wollte Héctor wissen, auch wenn er sich die Antwort denken konnte.
»Sie ist nicht mehr da. Er hat sie mitgenommen. Ich habe Angst, Héctor. Wirklich.«
Er schaute ihr in die Augen. Himmel, zu welchen Dummheiten Mütter imstande waren. Aber Carmen brauchte keine Vorwürfe, sondern Hilfe. Und er wusste, wie er sie beruhigen konnte, zumindest für den Moment.
»Ich werde versuchen, etwas herauszubekommen, versprochen. Wissen Sie, wo er sich früher rumgetrieben hat?«
»Von der Vergangenheit hat er nie gesprochen.« Sie zeigte ein bitteres Lächeln. »Und ehrlich gesagt, von der Zukunft auch nicht. Am Sonntag haben wir zusammen gegessen, hier, und da habe ich ihn gefragt, was er machen will, ob er Pläne hat.«
»Und was hat er gesagt?«
»Er sagte, die Zukunft sei wie eine Fata Morgana. Von ferne sehe sie schön aus, bis man näher herankommt und sieht, dass es dieselbe Scheiße ist wie die Gegenwart.«
Der letzte Satz kostete sie Überwindung. Carmen gehörte einer Generation an, in der Damen keine unanständigen Wörter in den Mund nahmen. Fast beschämt stand sie auf und gab ihm die Plastiktüte mit den Empanadas.
»Na los, geh hoch, sonst werden sie kalt. Ich will dir nicht noch mehr Arbeit machen, als du schon hast.«
»Für das hier können Sie mir so viel Arbeit machen, wie Sie wollen.« Er stand einen Moment da, ehe er ging, und bedauerte, nicht länger bleiben zu können, aber es war schon spät. »Carmen«, sagte er noch, »machen Sie sich keine Sorgen. Ich kümmere mich drum.«
»Ich habe immer gesagt, ein Polizist im Haus kann nicht schaden.« Sie lächelte. »Auch wenn er Argentinier ist …«
4
»Willst du wirklich nichts trinken?«
Leire Castro wusste schon, dass der Junge das Angebot ablehnen würde, dazu ein höfliches: »Ich wollte nur kurz mal bei euch vorbeischauen.« So kam es auch, und Leire lächelte, während sie ihn zum Kinderzimmer führte, wo Abel in seiner Wiege schlief, unter einem Sternenmobile, das Guillermo für ihn gebastelt und bemalt hatte und das der Kleine, zumindest bisher, nicht im Geringsten beachtete.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben:





























