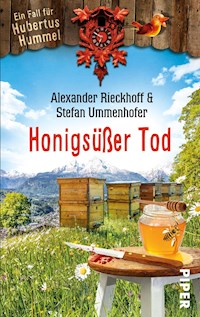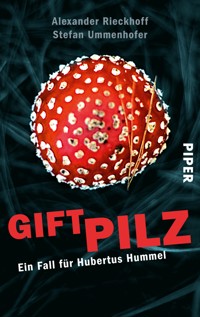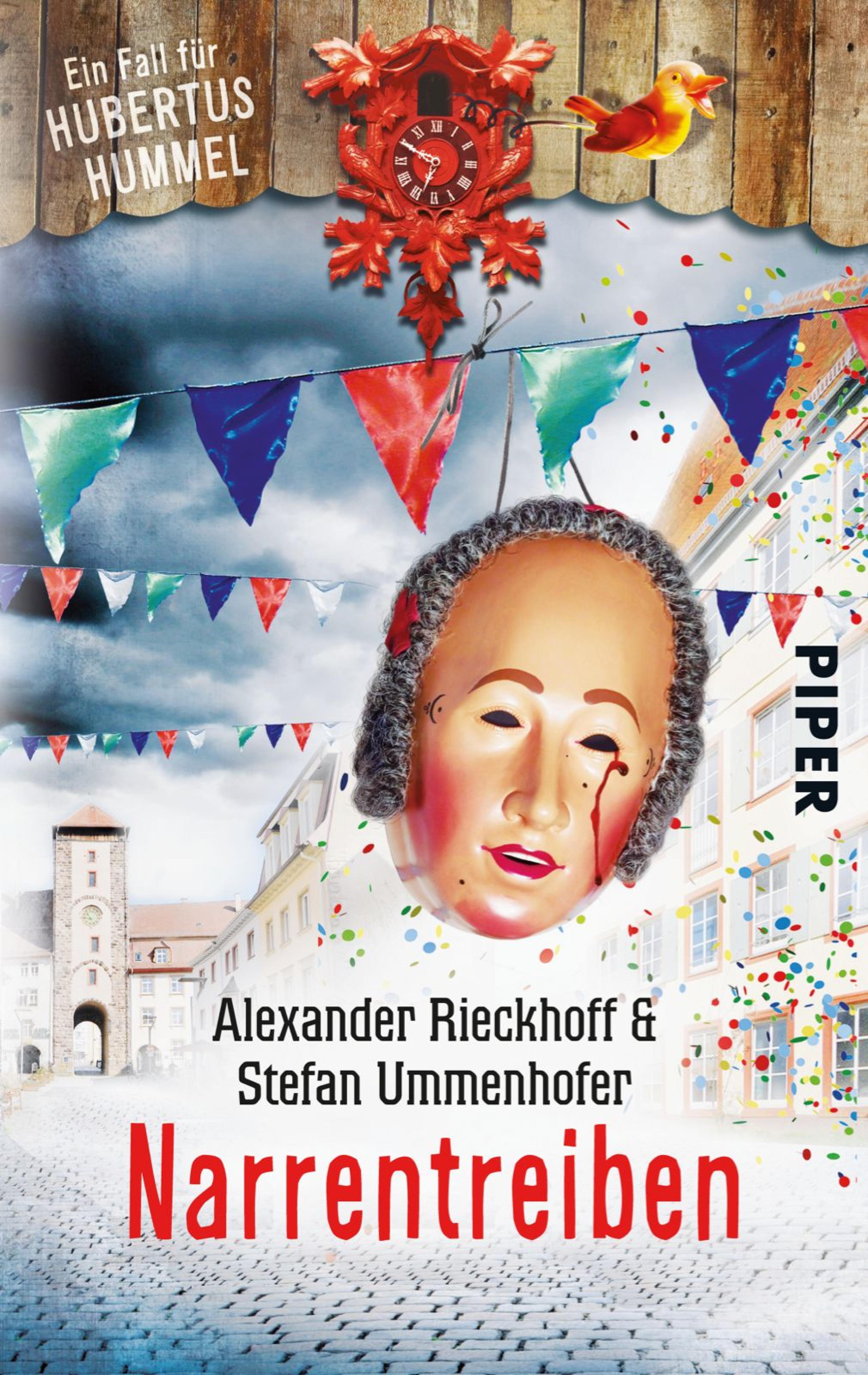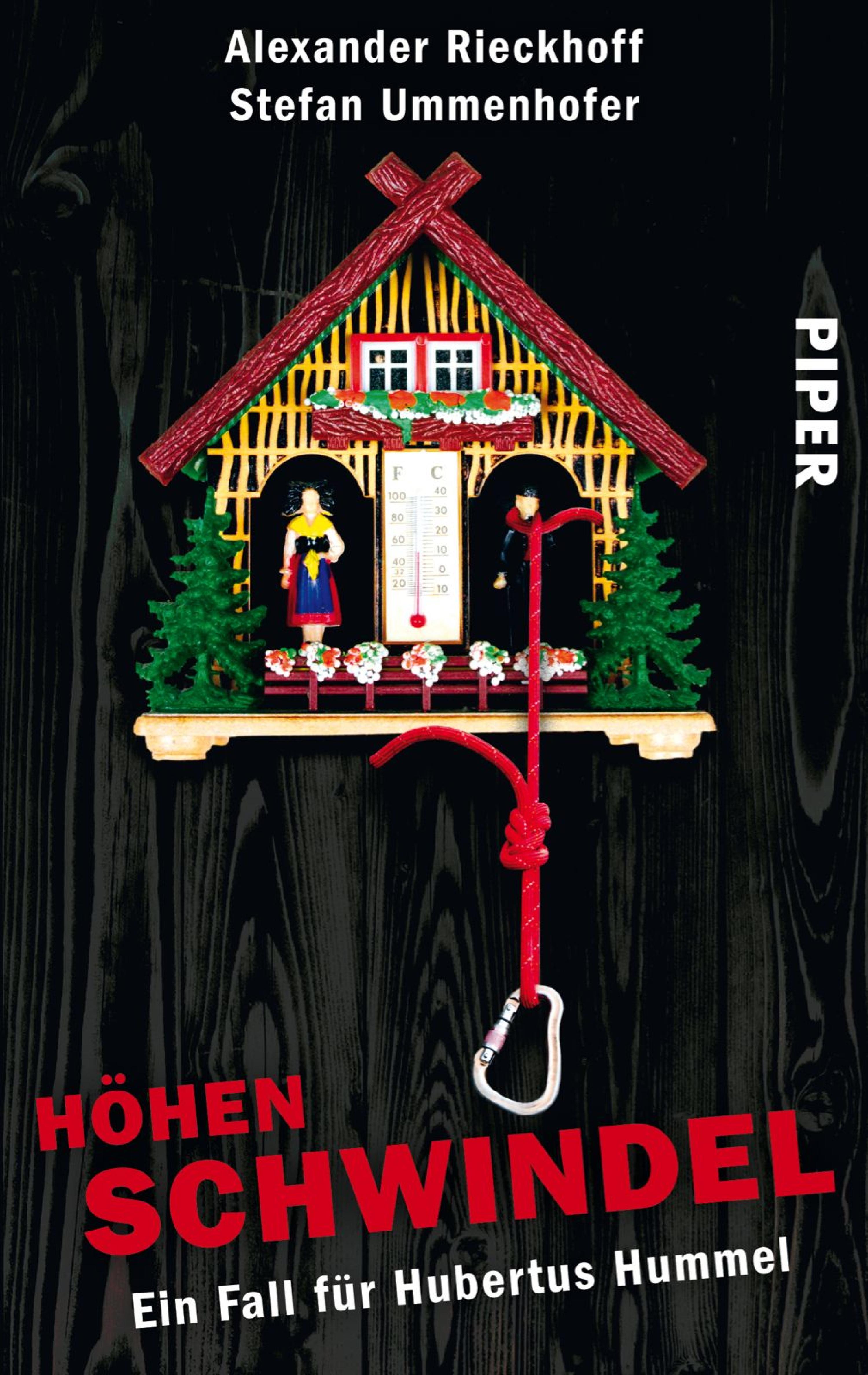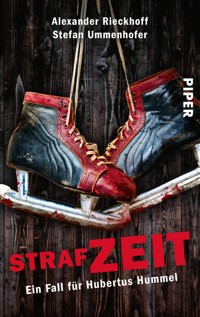9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Krimi
- Serie: Schwarzwald-Krimi
- Sprache: Deutsch
Vom Ku'damm zum Damwild - Marie Kaltenbachs Einstieg als Kommissarin in der Schwarzwälder Heimat beginnt eher mittelprächtig: Auf dem Weg zur Arbeit fährt sie erst mal ein Reh um, und mit ihrem neuen Kollegen Karl-Heinz Winterhalter liegt sie sich schon vor Dienstbeginn in den Haaren. Und dann gibt's direkt einen Mord! Ein Mann in Tracht liegt erdrosselt in einer Gruft - und ausgerechnet Winterhalters Sohn ist beim Geocaching über die Leiche gestolpert. Dass die beiden Hauptkommissare bei der Suche nach dem Mörder versehentlich in einer Ehetherapie landen, macht die Sache auch nicht gerade besser. Denn der Fall, den sie zu lösen haben, führt sie in dunkle Abgründe ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Ein Schwarzwald-Krimi
LÜBBE
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Stefanie Kruschandl, Hamburg
Umschlaggestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de
Unter Verwendung von Motiven von © shutterstock: waku | Christopher Elwell | Juhku | Serg64 | detchana wangkheeree | Tvorcha | Ksw Photographer | Umomos | Tsekhmister | inxti | valzan | klikkipetra
eBook-Erstellung: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-7785-9
www.luebbe.de
www.lesejury.de
Ein verlagsneues Buch kostet in Deutschland und Österreich jeweils netto ohne UST überall dasselbe.
Damit die kulturelle Vielfalt erhalten und für die Leser bezahlbar bleibt, gibt es die gesetzliche Buchpreisbindung. Ob im Internet, in der Großbuchhandlung, beim lokalen Buchhändler, im Dorf oder in der Großstadt – überall bekommen Sie Ihre verlagsneuen Bücher zum selben Preis.
Prolog
Wie ein kostbarer Schatz funkelten die Glasperlen und reflektierten die einfallenden Sonnenstrahlen als kleine Lichtpunkte auf die Wände der Fürstengruft. Es waren Hunderte von Perlen, die den Schäppel verzierten, den kronenartigen Kopfschmuck der Fürstenberger Tracht. Mit leeren Augen starrte der Träger der Krone die blaue Kuppel empor, die ringsum von Porträts der früheren Herrscher des Fürstenhauses gesäumt war. Es hatte den Anschein, als blickten die Fürsten stolz, ja geradezu abschätzig auf die Gestalt mit dem glitzernden Kopfschmuck herab, die genau unter der Mitte der Kuppel lag.
1. Schatzsuche
Mit einem quietschenden Geräusch öffnete sich die schwere Eisentür des Parks. Die Geocacher starrten gespannt auf ihr GPS-Gerät und nahmen dann Kurs auf die Grabkapelle der Fürsten zu Fürstenberg. Thomas Winterhalter ging voran und betrat als Erster die Anlage, die wie ein verwunschener Garten wirkte. Seine Begleiter betrachteten den dezent angebrachten Hinweis auf dem Emailleschild, das unmissverständlich klarmachte: »Höfliche Bitte, die Parktüre zu schließen!« Sie kamen der Bitte zwar höflich, aber keineswegs geräuschlos nach. Es quietsche erneut und ließ die Geocacher ein wenig erschauern.
Vor ihnen ragte – umgeben von einigen Bäumen – die Gruftkapelle empor, die mit ihrer Kuppel ein bisschen wie eine Miniatur des Petersdoms wirkte. Wie es sich für ein Fürstengrab gehörte, versprühte sie einen herrschaftlichen Glanz, auch wenn der Park mit den Jahren etwas verwildert war. Zur einen Seite hin entspann sich ein undurchdringbares Wirrwarr aus Sträuchern, Büschen und Bäumen, an deren Ende das alte Pfarrhaus durchschimmerte.
Die Geocacher schauten auf ihre Koordinaten: 47° 54' 45''N 8° 34' 14''O. Hier im Park musste der »Cache«, der Schatz, liegen.
Thomas, Johanna, Sandra und Martin gingen entlang der Parkmauer, die an einigen Stellen durchbrochen war und deren Steine sich im Laufe der Jahre steil abwärts in Richtung Donauufer verabschiedet hatten. Die vier Freunde betrachteten die Kreuze, die nicht nur auf die Bestattungen von früheren Fürsten, sondern auch auf deren treue Gönner, Diener und Stallmeister hinwiesen. Ein mächtiger Grabstein zeigte an, dass der Friedhof früher zu einem Kloster gehört hatte: »Hier ruht die gnädige Frau Äbtissin des Klosters Maria Hof Neudingen«.
Als Thomas Winterhalter und seine Schatzsucher plötzlich laute Schreie hörten, erschauderten sie. Doch dann wurde ihnen klar, dass es keine menschlichen Stimmen waren, sondern die Jungen eines Reihers, die auf den Wipfeln eines Parkbaumes saßen und ungeduldig auf Futter warteten.
Die Geocacher untersuchten den Bereich neben der Grabplatte des letzten Fürsten und seiner Gemahlin. Nichts, kein Schatz. Also nahmen sie das leerstehende, halb verfallene Pfarrhaus genauer in Augenschein. Doch sie fanden nichts. Womit im Grunde nur eine Möglichkeit blieb. Entschlossen steuerten sie auf die Gruft zu, die an diesem Tag ausnahmsweise geöffnet war, weil zu Ehren des letzten verstorbenen Fürsten ein Gottesdienst im Park abgehalten werden sollte. Auf dem Weg dahin kam ihnen in einiger Distanz ein früher Spaziergänger entgegen, der sie im Vorbeigehen jedoch nur schweigend musterte.
Thomas, dessen ohnehin immer rötliche Wangen vor Aufregung glühten, war auch der Erste, der die Kirche betrat, die an diesem besonderen Tag ebenso wie das Fürstengrab prächtig mit Blumenschmuck ausstaffiert worden war. Durch den Saal unter der Kuppel zogen zarte Dunstschwaden, die das einfallende Licht noch heller erscheinen ließen.
Aus der Mitte der Kirche strahlte den Geocachern zudem ein glitzernder, kugelartiger Schäppel entgegen. Sie dachten, sie hätten den Schatz gefunden, und liefen zu der glitzernden Kugel. Doch dann erkannten sie, dass eine auf einer Holzbank liegende Gestalt den Schatz auf dem Kopf trug.
»Da liegt eine Leiche!«, rief Thomas mit einer Mischung aus Schock und Begeisterung.
»Eine Leiche? Mach jetzt bitte keine üblen Scherze …«, flüsterte Johanna.
Als würde man heute nicht den Todestag des Fürsten begehen, sondern eine neuerliche Bestattung zelebrieren, lag die Gestalt unter der mächtigen Kuppel aufgebahrt da – mit gefalteten Händen und in Tracht gekleidet.
Genauer gesagt war es die Frauentracht aus dem ehemaligen Herrschaftsgebiet der Fürstenberger im Kinzigtal: mit einem Tschobe, einer schwarzen, kurzen Jacke, die an den Ärmeln mit Elfenbeinknöpfen ausstaffiert war. Darüber trug die aufgebahrte Gestalt ein fransiges Seidentuch, das mit Blumenmotiven reich bestickt war. Auch die Seidenschürze war mit Blumenmotiven verziert. Unter ihr schauten die mit weißen, dicken Strümpfen bekleideten Beine hervor.
»Die wollten es wohl besonders gruselig machen und haben hier extra eine Figur aufgebahrt. Vermutlich eine Puppe aus irgendeinem Trachtenmuseum. Großartige Idee«, flüsterte Sandra.
»Ja, die haben sich echt was einfallen lassen. Cool«, sagte Thomas und machte einige Selfies von sich und der aufgebahrten Gestalt, mal alleine, dann zusammen mit Sandra, Johanna und Martin.
»Krasse Idee.« Martin begann, die Gestalt in Frauentracht genauer zu betrachten.
»Ich stelle die Fotos gleich mal bei Facebook und Instagram ein«, sagte Thomas begeistert.
»Das ist doch hoffentlich auch wirklich eine Puppe?«, fragte Johanna etwas unsicher, als das Fotoshooting beendet war.
Thomas erwog, die Puppe anzufassen, zögerte aber. Seinen Begleitern ging es nicht anders, woraufhin sie ihre Stimmen weiter dämpften.
»Wirkt eher wie ein Mann als eine Frau«, sagte Sandra nach einer längeren Pause.
»Ist aber definitiv eine Frauentracht«, flüsterte Johanna.
Thomas zuckte mit den Schultern.
»Wahrscheinlich hatten sie nur eine Männerpuppe zur Hand und haben sie in die Tracht gesteckt.« Er deutete auf den Kopfschmuck der Figur. »Unser Schatz ist wahrscheinlich der Schäppel. Ist übrigens die Fürstenberger Tracht.«
Thomas’ ganze Familie war im Trachtenverein Linach aktiv.
Sein Vater, im Hauptberuf Kriminalhauptkommissar bei der Mordkommission Villingen-Schwenningen, hielt ihm immer wieder Vorträge über Schwarzwälder Trachten. Und diese hier war neben der weltbekannten Bollenhuttracht die prächtigste.
»Die Leiche wirkt tatsächlich ganz schön echt«, sagte Thomas dann und schaute auf das fahle Gesicht. »Sie ist wirklich gut gemacht.«
»Vielleicht ist es keine Puppe, sondern ein Schauspieler«, warf Sandra ein.
Sie standen nun etwa drei Meter entfernt.
»Und wahrscheinlich springt der gleich auf und erschreckt uns.«
Thomas riss sich zusammen, trat zum angeblichen Toten hin und strich ganz vorsichtig mit seiner Hand über die Wange.
Er bemerkte einen Geruch, den die reglose Gestalt zu verströmen schien. Ein vertrauter Geruch, trotzdem kam er nicht darauf, was es war. Knoblauch?
Doch er hatte nun ganz andere Sorgen.
»Fühlt sich tatsächlich echt an, weich«, sagte er dann. »Und etwas kalt.«
Thomas rüttelte an der Gestalt. Nichts.
Dann noch mal. Als sie sich erneut nicht bewegte, erschrak er.
»Das ist …«, setzte er dann stockend an und ging nun wie die anderen auf Abstand, »… das ist, glaube ich, ein echter Mensch. Also, eine echte Leiche.«
Johanna stieß einen Schrei aus, der gespenstisch durch die Gruft hallte.
Dann kam Bewegung in die kleine Gruppe: Sie rannten aus der Gruft und hielten erst an, als sie das quietschende Parktor erreicht hatten.
»Thomas, wir müssen die Polizei rufen. Telefonier am besten gleich mit deinem Vater«, schlug Martin keuchend vor.
Und Thomas nahm das Handy und wählte den Eintrag »Bapa«.
2. Blutspur
Marie drückte das Gaspedal auf der kurvigen Straße bis zum Anschlag durch. Es brauchte schon die gesamte PS-Zahl ihres metallicroten Fiat Panda, um diesen Berg zu erklimmen. »Eleganza« hieß das Modell, Baujahr 1992. Aber wenn man ehrlich war, schien die Eleganz des Wagens irgendwann um die Jahrtausendwende verflogen zu sein.
Mit einem Finger schob Marie ihre Brille zurück auf die Nase. Eigentlich konnte sie hervorragend sehen, aber die Fensterglasbrille verlieh ihr eine gewisse Seriosität, jedenfalls hoffte sie das. Ihr Gesicht – große braune Augen, leichte Stupsnase und ein Hauch von Sommersprossen – führte dazu, dass die Leute sie gerne für jünger hielten, als sie eigentlich war. Besser gesagt: für jünger und unerfahrener. Ein süßes, nettes Mädchen. Was zum einen nicht stimmte, und zum anderen in ihrem Job nicht gerade vorteilhaft war. Daher die Brille.
Heute, an ihrem ersten Arbeitstag, trug sie ein halbwegs konservatives Outfit. Schwarze Jeans und eine kurzärmlige Bluse mit Paisleymuster, die locker fiel und somit alles verhüllte, was verhüllt werden sollte. Ihre schulterlangen braunen Locken hatte sie offen gelassen, was sich jetzt allerdings als Fehler erwies. Denn der Fahrtwind wehte ihr immer wieder einzelne Strähnen ins Gesicht. Sie hatte die Fenster ganz heruntergekurbelt, um die frische Schwarzwaldluft einzuatmen.
Diese Luft war eine wahre Wohltat im Vergleich zu dem Großstadtmief, den sie während der letzten zehn Jahre eingeatmet hatte. Von der berühmt-berüchtigten »Berliner Luft« hatte sie schon länger die Nase voll gehabt. Immer wieder hatte sie sich dabei ertappt, wie sie sich in Berlin nach dem Schwarzwald zurücksehnte, wo sie vor fünfunddreißig Jahren geboren worden und anschließend aufgewachsen war. Als Jugendliche waren ihr der Schwarzwald eng und seine Bewohner engstirnig vorgekommen. Doch jetzt, auf ihrer Fahrt durch den Fichtenwald, verspürte sie Ruhe, Klarheit. Ja, es war die richtige Entscheidung gewesen zurückzukehren. Auch wenn diese Entscheidung nur … na ja, halbwegs freiwillig gewesen war.
Marie ließ das Pedal zurückschnellen, um es kurz darauf erneut bis zum Anschlag durchzudrücken. Sie wollte noch den einen oder anderen Stundenkilometer mehr aus ihrem Gefährt herausholen.
Die kleine Schwarzwald-Puppe mit Bollenhut, die am Rückspiegel hing und die ihr ihre Mutter zur Rückkehr geschenkt hatte, zappelte hin und her.
Gleich würde Marie die Bergkuppe erreichen. Danach konnte sie ihren Eleganza mit etwas mehr Tempo in Richtung Villingen-Schwenningen, ihrer alten Heimatstadt, rollen lassen. Sie schaute auf das Tachometer. Knapp über fünfzig zitterte der Zeiger herum.
Für die Großstadt und die dortigen Parkplatzprobleme war ihr kleiner Fiat Panda genau das richtige Gefährt, für die Berge und Täler des Schwarzwalds eher weniger. Sie sollte sich bald mal nach einem PS-stärkeren und vor allem neueren Gefährt umschauen, wenn sie besser vorankommen wollte.
Und das wollte sie auch heute schon, denn sie war nach einem Zwischenstopp und einer Übernachtung bei einer Freundin in Freiburg schon etwas spät dran. Dabei war es ihr erster Tag in der neuen Dienststelle bei der Kriminalpolizei VS, wie die Doppelstadt abgekürzt hieß.
Aber sosehr sie sich über ihre Verspätung ärgerte – ein wenig erleichtert war sie doch, dass sie den Dienstantritt noch etwas hinauszögern konnte. Sie fühlte sich plötzlich zurückversetzt in ihre Kindheit – war ein wenig das kleine, aufgeregte Mädchen, das eine neue Schule besuchte.
Und egal wie es auf der »neuen Schule« werden würde – klar war, dass sie in die »alte Schule« nicht mehr zurückkehren konnte.
Niemals!
Wieder begannen die Bilder in ihrem Kopf abzulaufen, und sie durchlebte noch einmal den schrecklichen Augenblick, der das Ende ihrer Berliner Lebensphase eingeläutet hatte: die wilde Verfolgungsfahrt durch die Straßen der Hauptstadt, das Heulen der Sirenen und das Blaulicht, das entlang der Häuserfluchten in Friedrichshain zuckte. Dieser verdammte Kopf der Dealerbande, hinter dem sie schon seit etlichen Wochen her waren, in seinem AMG. Das Quietschen der Reifen, als Marie ihr Dienstfahrzeug quer stellte und zusammen mit dem Kollegen Gartmann den Flüchtigen mit gezogener Waffe stoppte. Das Klicken der Handschellen, das Gesicht des Kripochefs, der sich vor Ort den Ermittlungserfolg anheften wollte, weil sicher gleich schon die ersten Medienvertreter auftauchen würden.
Und dann der Knall, der verfluchte Knall, den ihre Pistole verursachte. Marie kam es so vor, als würde sie den Flug des Projektils noch einmal in Zeitlupe mitverfolgen können. Wie es sich löste, die Luft durchschnitt und das Gesäß ihres Kripochefs ansteuerte, um dort mit voller Wucht einzuschlagen. Auch das anschließende Aufheulen ihres Chefs und das der Krankenwagensirene gingen ihr nicht mehr aus dem Kopf. Fast jede Nacht sah sie diesen Film. Immer und immer wieder.
Ausgerechnet ihr war das passiert. Ihr! Der Ermittlerin mit der höchsten Aufklärungsquote in der Dienststelle, der »Klassenbesten« sozusagen. Doch mit dem verdammten Schuss war das passé gewesen.
Den Vorfall hatte die Berliner Boulevardpresse genüsslich ausgeschlachtet. Die Schlagzeile hatte sich ebenfalls in ihrem Gedächtnis eingebrannt: »Volltreffer: Kommissarin ballert Kripochef in den Po!«
Das anschließende Disziplinarverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung hatte sie noch einigermaßen gelassen ertragen. Aber der zusätzliche Hohn und Spott einiger Kollegen in der Dienststelle war schwer zu ertragen gewesen. Besonders dieser neue Spitzname, den sie ihr verpasst hatten. War sie früher wegen ihrer Herkunft halbwegs liebevoll »Schwarzwaldmarie« genannt worden, nannte man sie jetzt »Schützin Arsch«.
Letzten Endes hatten die Neider gewonnen. Irgendwann hatte sie es nicht mehr ertragen. Sie musste weg. Ganz weit weg. So hatte sie mit ihrem Berliner Leben Schluss gemacht. Und auch mit ihrem Freund. Aber das war eine andere Geschichte …
Sie hoffte, dass die neuen Kollegen im Schwarzwald von dem Vorfall nichts mitbekommen hatten. Und wenn doch, dass sie die Sache diskret behandeln würden. Ihre neue Chefin hatte ihr das schon mal versprochen. Aber das Internet vergaß ja bekanntlich nichts, auch wenn ihr Nachname damals abgekürzt worden war.
Marie drückte aufs Gaspedal. Jetzt galt es, mit Schwung die Straße Richtung Herzogenweiler zu nehmen. Der Tachometer-Zeiger hatte schon die siebzig Stundenkilometer erreicht, als sie einen erneuten Flashback erlitt und wieder in ihren Albtraum zurückkatapultiert wurde. Sie durchlebte zum sicher fünfhundertsten Mal die Sequenz, wie das Projektil in das Gesäß ihres Chefs einschlug. Ein schauderhafter Anblick.
Und noch schauderhafter war, was daraufhin folgte. Denn plötzlich sah Marie rot. Tatsächlich rot. Blut!
Und hörte wieder einen fürchterlichen Knall.
Sie konnte kurzzeitig nicht sagen, ob das Blut und der Knall Bestandteil der realen Welt oder ihres Albtraums waren. Panisch drückte sie das Pedal bis zum Anschlag durch. Diesmal aber nicht das Gaspedal, sondern die Bremse. Die Schwarzwald-Puppe am Rückspiegel knallte gegen die Windschutzscheibe, ihre Augen fielen zu.
Krampfhaft presste auch Marie ihre Augenlider zusammen, wünschte sich, dass das alles nicht echt war und nur in ihrer Vorstellung ablief.
Doch als sie die Augen wieder öffnete, sah sie immer noch rot. Blut hatte sich auf der Windschutzscheibe verteilt. Diese war gesprungen und von tiefen Rillen durchzogen. Marie konnte nicht sehen, von was oder wem das Blut stammte.
Hatte sie einen Wanderer übersehen? Erneut durch eine Unkonzentriertheit einem Menschen Schaden zugefügt? Aber dieser Knall!
War das nicht ein Schuss gewesen? Ein Schuss, der jemanden getroffen hatte, woraufhin das angeschossene Opfer auf ihrer Windschutzscheibe gelandet war?
Aber nein, das ergab doch keinen Sinn. Andererseits: Was hatte in den letzten Monaten schon Sinn ergeben?
Und dann hörte sie endlich auf, rot zu sehen. Denn jetzt wurde ihr schwarz vor Augen.
Als Marie ihre Augen erneut aufschlug, wusste sie nicht, wie lange sie weggetreten gewesen war. Sie wusste nur eines: dass die blutverschmierte Windschutzscheibe kein Albtraum gewesen war. Sie hatte sie noch immer direkt vor Augen.
Nur eines hatte sich verändert: Ihre Fahrertür stand offen.
War sie aufgesprungen? Oder hatte sie selbst sie geöffnet?
Marie versuchte, aus dem Wagen zu steigen, was ihr einen stechenden Schmerz im Nacken bescherte. Sie hielt sich mit einer Hand den Hals, zog sich mit der anderen an der Autotür empor.
Zu ihrer Überraschung war sie nicht allein.
Ein Mann mit grauem Filzhut, grauer Strickjacke und grünen Kniebundhosen stand an der Front ihres Wagens. Trotz des ernsten Anlasses sah er sie mit verschmitztem Blick und geröteten Wangen an und fragte: »Geht’s Ihne guet? I hab grad schon mol nach Ihne g’schaut und ihre Vitalfunktione überprüft. Positiv!«
Ehe Marie antworten konnte, nahm der Albtraum eine ganz neue Dimension an. Der Mann zückte plötzliche eine Waffe. Marie schnappte nach Luft, wollte schon in Deckung gehen. Aber der Kniebundhosenträger richtete die Waffe nicht auf sie, sondern auf etwas, das vor ihrem Eleganza liegen musste. Was es war, konnte Marie nicht erkennen, da sie noch immer reichlich kraftlos an der Fahrerseite stand.
Ihr war aber klar, dass der Mann mit dem etwas rustikalen Aussehen gleich Ernst machen und abdrücken würde.
»Nein«, rief sie noch. »Nicht schießen!«
Nun war sie sich fast sicher, dass das Ganze doch Teil des Albtraums sein musste. Die Schallwellen des Knalls, die den dichten Fichtenwald fluteten, sprachen allerdings dagegen.
Sie schloss die Augen, zählte bis drei und öffnete sie wieder.
Der Mann mit Filzhut und Kniebundhosen war noch da. Der Blick: immer noch freundlich-verschmitzt.
Er sicherte seine Pistole und steckte sie in ein Holster, das sich unter seiner Strickjacke befand.
Dann sagte er trocken: »Des war jetzt mol än saubere Kopfschuss. Ging nit andersch.«
Nun hatte seine Miene etwas leicht Bitteres.
Marie gelang es einfach nicht, diese absurde Szene mit der Realität in Einklang zu bringen. Erst das Blut, dann der seltsame Mann, dann der Kopfschuss auf wen oder was auch immer. Eigentlich war sie sich sicher, dass sie nicht träumte, alleine schon ihre Kopf- und Nackenschmerzen sprachen dagegen. Während sie sich gegen die Autotür lehnte, wurde ihr klar, dass es noch eine weitere mögliche Erklärung gab. Eine, die sehr wahrscheinlich war, weil sie nämlich all das hier erklären würde: Sie war verrückt geworden. Das war mehr als ein Burn-out.
»Sie sind … verhaftet«, flüsterte sie noch, bevor sie wieder zusammensackte.
Als sie wieder zu sich kam, sah sie zwei Uniformen der baden-württembergischen Polizei. Immerhin.
»Geht’s Ihnen wieder gut?«, fragte ein untersetzter, gemütlicher Beamter.
Sie nickte.
Entgegen ihrer Erwartung war der Pistolenmann auch noch da – und zwar keineswegs in Handschellen.
Als eine ihrer Stärken hatte Marie – zumindest bis zu jenem verhängnisvollen Schuss in Friedrichshain – ihre Fähigkeit angesehen, auch unter Stress ziemlich logisch denken zu können.
Sie versuchte es noch einmal, hatte gedanklich eine neue, zumindest annähernd rationale Erklärung für das Geschehen. Mit ein paar unsicheren Schritten trat sie vor und nahm die Leiche in Augenschein.
Tatsächlich: ein Reh!
Das Tier lag aufgrund des Zusammenpralls mit ihrem Wagen und des anschließenden Kopfschusses zusammengekrümmt auf der Landstraße.
Marie wusste nun immerhin, dass sie in der Realität angekommen war. Und sie wusste noch etwas: Wenn sie sich nicht schon seit Jahren strikt gegen Fleischkonsum ausgesprochen hätte – jetzt wäre es so weit gewesen.
Der zweite Beamte, ein etwas jüngerer, drahtiger Kerl, fragte den Filzhutträger: »Musste das jetzt unbedingt sein?«
»Ha klar. Des Viech war praktisch schon dot. Da wär nix mehr zu mache g’wese. Mein Schuss war ä Erlösung für des Reh.« In seiner Miene zeigte sich Bedauern, doch beim nächsten Satz bekam sein Blick etwas Herausforderndes. »Des gibt jetzt en leckere Brate. Da wird sich mei Frau freue.«
Marie musste hysterisch auflachen.
Der gemütliche Streifenpolizist versuchte, sie zu beruhigen: »Das wird schon wieder. Ganz ruhig.«
»Braten! Er denkt jetzt an Braten!«, rief Marie, während sie sich vor Lachen schüttelte. Dann riss sie sich einen Moment zusammen und zischte: »Mörder!«
»Entschuldigung, aber Sie habe des Viech ja wohl umg’fahre. Nit ich. Wenn’s nach mir gange wär, dät des Rehle jetzt unbehelligt im Wald grase. Ich wiederhol’s noch mal: Mein Schuss war für des arme Tier ä Erlösung.«
Er verniedlichte das Reh ganz bewusst mit der Schwarzwaldtypischen »le«-Endung.
Maries hysterisches Lachen setzte erneut ein, und sie stieg in den Streifenwagen. Der gemütliche Streifenpolizist tätschelte ihr tröstend die Schulter.
Es war wohl doch alles etwas zu viel für sie.
Als der Beamte mit Marie langsam davonfuhr, erhaschte sie im Rückspiegel noch einen Blick auf das grauenvolle Spektakel, das sich hinter ihr abspielte: Der Filzhutträger zückte sein Jägermesser und begann an Ort und Stelle, das »Rehle« auszuweiden.
Der jüngere Streifenpolizist hatte angeekelt den Kopf in Richtung Wald abgewandt. Durch das geöffnete Autofenster hörte sie einige letzte Wortfetzen.
»… muss das sein«, stieß der Streifenpolizist hervor.
»Ha klar, jetzt isch des Rehle noch frisch. Umso besser schmeckt’s am End«, entgegnete der Filzhutträger ungerührt.
Zum Glück gab der Beamte, der Marie zur Dienststelle nach Villingen chauffiert, Gas. Gleich darauf war der Schauplatz des Gemetzels nicht mehr zu sehen.
3. Dienstantritt
Als Marie Kaltenbach den weißen, schmucklosen Siebzigerjahre-Bau betrat, hatte sie sich etwas beruhigt, war aber immer noch etwas mitgenommen. Ihr Start in der alten Heimat schien alles andere als rund zu laufen. Sie machte genau dort weiter, wo sie in Berlin aufgehört hatte. Dort hatte sie als »Schwarzwaldmarie« begonnen und als »Schützin Arsch« geendet. Hier wollte sie wieder als »Schwarzwaldmarie« beginnen, schien aber gleich zur »Pechmarie« zu werden.
Kaum hatte sie die Eingangstür hinter sich gelassen, um das Büro ihrer Chefin aufzusuchen, hatte sie ein Déjà-vu: Filzhut, Strickjacke, Kniebundhosen.
Der Träger dieses Ensembles, der mit seinen klobigen Wanderstiefeln den PVC-Flur entlangstapfte, schien nicht weniger überrascht, die junge, aufgeregte Frau vom Unfallort hier zu sehen.
»Aha. Wollet Sie mich jetzt wege Mordes anzeige?«
»Musste das vorhin wirklich sein?«, wiederholte Marie die Frage des Streifenpolizisten von vorhin fast wortgenau.
»Klar, Sie hättet des Reh wahrscheinlich noch wiederbelebt. Ich sag’s Ihne jetzt noch mol: Für des arme Vieh war des ä Erlösung.«
»Vieh!«, zischte Marie. »Schon der Begriff!«
»Das sagt man hier im Schwarzwald halt so«, erklärte der Stiefelträger jetzt in bemühtem Hochdeutsch. »Ich weiß ja nicht, wo Sie herkommen. Aber als Versöhnungsangebot: Sie können gern was von dem Braten abhaben … Schließlich haben Sie das arme Tier ja auch, wie soll ich sagen, erlegt.«
»Sie sind geschmacklos!«, wurde Marie nun noch angriffslustiger. »Nein, vielen Dank. Ich esse kein Fleisch!«
»Aha, eine Vegetarierin?«, fragte der Filzhut- und Strickjackenträger in verächtlich klingendem Ton. »Klar, man darf natürlich keine Tiere töten. Lieber lässt man sie im Straßengraben jämmerlich verrecken.«
»Nein, ich bin Veganerin, falls Ihnen das überhaupt etwas sagt. Das bedeutet, keine tierischen Produkte zu sich zu nehmen. Überhaupt keine! Die machen nämlich krank!«, konterte Marie. »Und das arme Tier hätte man ja wohl auch etwas humaner ins Jenseits befördern können als mit einem Kopfschuss. Man hätte zum Beispiel den Tierarzt rufen und ihn bitten können, es einzuschläfern.«
»Humaner? Ha, wenn ich das schon höre. Im Übrigen: Bis der Tierarzt eingetroffen wäre, gute Frau, wäre das Tier ohnehin längst jämmerlich verreckt.« Er seufzte. »Was für ein Tag: Erst komme ich durch die kranken Viecher auf meinem Bauernhof zwei Stunden zu spät, und jetzt noch eine durchgeknallte Veganerin …«
Bevor ihr Wortwechsel noch schärfer werden konnte, kam ein junger, hagerer Mann um die Ecke. Seine Körperhaltung war ungewöhnlich aufrecht, fast ein wenig steif. Auch seine Frisur wirkte sehr akkurat. Er trug ein Hemd, das so blütenweiß war, dass es fast blendete.
»Ah, ihr habt euch schon miteinander bekannt gemacht?«, sagte er. »Das ist gut.«
»Wie? Bekannt g’macht«?, fragte der Filzhutträger verdutzt. »Ich kenne die Dame nicht.«
»Sie sind doch die neue Kollegin aus Berlin, nicht wahr? Ich hab Ihr Bewerbungsfoto auf dem Schreibtisch der Chefin gesehen«, sagte der junge Mann zu Marie.
Die nickte zögerlich.
Marie und der Filzhutträger schauten sich verdutzt an. Es entstand ein peinliches Schweigen, das der junge Kollege schließlich durchbrach.
»Also: Ich bin Francois Kiefer. Entschuldigen Sie meinen Akzent – ich bin von der Gendarmerie der Region Elsass und im Rahmen eines Austauschs für ein Jahr hier«, sagte er.
»Das macht doch nichts«, scherzte Marie, worauf sie der Elsässer ein wenig irritiert ansah. Okay, er war wohl eher von der ernsten Sorte. Aber wofür entschuldigte er sich denn? Der Mann sprach doch perfektes Hochdeutsch.
»Herzlich willkommen bei uns, Frau Kaltenbach!«, sagte er wie zum Beweis und schüttelte ihre Hand. »Das ist KHK Marie Kaltenbach, die aus Berlin zu uns stößt. Das, liebe Frau Kaltenbach, ist Ihr neuer Kollege Karl-Heinz Winterhalter. Ein echtes Schwarzwälder Original.«
»Original!« Marie spuckte das Wort fast aus, ehe sie sich zusammenriss.
»Also gut: Hallo erst mal.«
Sie machte eine etwas ungelenke, halb winkende Handbewegung. Schon allein, um einen Händedruck mit dem Kniebundhosen-Träger nach diesem wüsten Schlagabtausch zu vermeiden. Doch vergebens.
»Dag«, sagte Winterhalter und streckte ihr demonstrativ die Hand entgegen.
Der kräftige Händedruck des Mannes war schmerzhaft, so, als wolle er sich für den »Mörder« revanchieren.
»Auf gute Zusammenarbeit.«
»Jaja, auf … äh, gute Zusammen…arbeit.«
Heute blieb ihr aber auch wirklich nichts erspart, dachte Marie. Erst das Reh und dann noch dieser Trachten-Kasper und passionierte Tiermörder als neuer Kollege.
Wieder entstand ein peinliches Schweigen, das Kiefer, der Marie aufmerksam zu mustern schien, erneut durchbrach.
»Der Kollege Winterhalter, müssen Sie wissen, ist nicht nur ein echter Schwarzwälder, sondern auch ein sehr guter und akribischer Ermittler. Besonders auf dem Gebiet der Kriminaltechnik. Und im Nebenberuf ist er Landwirt und betreibt noch immer seinen Bauernhof in der Nähe von Linach. Er schlachtet übrigens noch selbst und stellt ausgezeichnete Wurstwaren und Schinken her.«
»Aha? Schlachter also auch noch?«, torpedierte Marie Kiefers Versuch, die Atmosphäre etwas aufzulockern.
»Humaner Schlachter. Ganz human«, antwortete Winterhalter nicht weniger scharfzüngig.
Marie biss die Zähne zusammen und schwieg. »Du kannst übrigens ›du‹ zu mir sagen. Ich bin die Marie«, wandte sie sich dann demonstrativ freundlich dem jungen, elsässischen Kollegen zu.
»Ich … ich bin Francois«, sagte Kiefer und schien etwas verlegen in Richtung Winterhalter zu schauen, der nun die Arme über der Strickjacke verschränkt hatte.
Erneut herrschte Schweigen. Bis plötzlich eine Frau im energischen Tonfall erklärte: »Ah, da ist ja unsere neue Kollegin aus Berlin!«
Frau Bergmann, die Kripochefin, steuerte direkt auf Marie zu. Sie hatte nicht nur eine kräftige Stimme, sondern auch ein forsches Auftreten, das perfekt zu ihrem Aussehen passte: Die Frisur akkurat geformt, beiges Kostüm mit Blazer sowie schwarzen Stilettos. Sie war Ende fünfzig und wirkte ein wenig wie eine deutsche Ausgabe von Maggie Thatcher.
»Ach, Sie haben sich ja schon bekannt gemacht«, wiederholte die Chefin nun fast wortgenau Kiefers Aussage.
»Das kann man wohl so sagen«, sagte Marie und warf Winterhalter einen giftigen Blick zu. »Guten Tag, Frau Kriminaldirektorin Bergmann. Und vielen Dank für den freundlichen Empfang.«
»Ich freu mich, dass es hier wieder mehr Frauenpower gibt. Wir bräuchten noch viel mehr tüchtige, junge Ermittlerinnen wie Sie in unserer Dienststelle.«
»Was hat denn das Geschlecht mit der Güte der Ermittlungen zu tun?«, knurrte Winterhalter, der Diskussionen über Feminismus offenbar wenig schätzte.
»Frauen haben einen ganz anderen Blick auf die Dinge, Kollege Winterhalter. Sie denken auch mal quer, statt immer den gleichen alten Stiefel zu machen«, entgegnete die Bergmann und schob ihre Brille mit dem Zeigefinger das Nasenbein hoch. Dabei fixierte sie Winterhalters klobige Wanderstiefel so, als hätte sie an diesen etwas zu beanstanden.
Winterhalter verdrehte die Augen.
In diesem Moment muhte die Kuh. Es war der Klingelton des etwas in die Jahre gekommenen Handys von Winterhalter.
Die Bergmann quittierte das Muhen nun ihrerseits mit einem Augenrollen in Richtung Marie, die sich um einen neutralen Gesichtsausdruck bemühte.
Winterhalter ging einige Meter den Flur entlang, um ungestört telefonieren zu können.
»Thomas? Wa isch denn …?«
Nach etwa dreißig Sekunden stapfte der Schwarzwälder Kommissar in seinen Wanderstiefeln wieder in Richtung der Gruppe zurück, das Handy noch immer am Ohr: »Mir sind schon unterwegs. Und bloß nix a’lange. Finger weg von der Leich, hasch du mich verstande?«
Leiche?, dachte Marie.
»Hasch du schon? Ja, bisch du denn noch ganz bei Troscht?«, schallte es durch den Flur. Winterhalter hielt kurz inne und versuchte dann, mit gedämpfterer Stimme weiterzusprechen: »Dann lasst wenigschtens jetzt die Finger von dem Dote. Mir sind glei do. Und«, er machte eine bedeutungsvolle Sprechpause, »Ruhe bewahre.«
Als Winterhalter das Handy in seiner Strickjacke verstaut hatte, meldete er seiner Chefin im feinsten, nahezu akzentfreien Polizistendeutsch: »Leblose Person in der Neudinger Fürstengruft. Ungeklärte Todesursache. Wir sollten gleich los.«
»Und wieso erhalten Sie private Mitteilungen über diesen Leichenfund?«, fragte die Bergmann verwundert.
Winterhalter kratzte sich offenbar etwas verlegen die Stoppeln seines Dreitagebartes.
»Mein Sohn war mit ein paar Freunden beim Geokatsching. Und da haben sie eine Leiche in der Fürstengruft gefunden.«
»Du meinst wohl Geocaching«, korrigierte Kiefer. »Das ist eine Art moderne Schnitzeljagd mit GPS. Also mit Global Positioning System.«
»Jaja«, sagte Winterhalter.
»Ich weiß, was Geocaching bedeutet. Mir brauchen Sie das nicht zu erklären«, sagte die Bergmann und schien Winterhalter einen abschätzigen Blick zuzuwerfen.
»Es handelt sich um ein globales Satellitennavigationssystem zur Positionsbestimmung. Man hat sozusagen einen kleinen elektronischen Kompass bei sich, mit dem man …«, setzte Kiefer, der als Computer- und Technikfreak sehr beliebt im Kommissariat war, zu einer längeren Erklärung an.
»Mich interessiert jetzt ehrlich gesagt mehr, was mit dem ungeklärten Todesfall ist«, mischte sich Marie ein.
Einen Moment befürchtete sie, damit zu weit vorgeprescht zu sein, aber sie bekam gleich verbale Unterstützung von der Bergmann.
»Genau, Kollegin Kaltenbach. Wieso sind Sie eigentlich überhaupt noch hier, meine Herren?«
»Franz, los geht’s«, gab nun Winterhalter das Kommando zum Aufbruch.
»Franz?«, fragte Marie verdutzt.
»Kollege Winterhalter nennt mich so, weil der Name einfacher für ihn auszusprechen ist«, erläuterte der französische Austauschkommissar.
»Ist doch einfacher. Übrigens spreche ich mit dem Kollegen Hochdeutsch, damit er wirklich alles in der Dienststelle versteht«, schaltete sich Winterhalter ein.
»Also ich nenne dich Francois, wenn du einverstanden bist. Und ich komme natürlich mit«, sagte Marie bestimmt.
Die Unterstützung von Frau Bergmann hatte ihr Mut gemacht.
Winterhalter gab sich keine Mühe, sein Unbehagen über die drohende Begleitung der neuen Kollegin zu verbergen.
»Na, Frau Kaltenbach. Jetzt kommen Sie doch erst mal richtig an«, säuselte er. »Schauen Sie sich in unserem schönen Dienstgebäude um. Frau Bergmann gibt Ihnen sicher gern eine Führung. Und wir Männer kümmern uns um schon mal um die Leich«, fügte er in einem Tonfall an, als würde er seiner Tochter erklären, sie solle nun gefälligst zu Bett gehen.
»Papperlapapp«, fuhr die Bergmann ihm in die Parade. »Wir haben Frau Kaltenbach als Unterstützung aus Berlin bekommen. Und zwar ab heute! Also ab sofort! Habe ich mich klar genug ausgedrückt?!«
Marie konnte sich ein leicht triumphierendes Grinsen nicht verkneifen.
»Jawoll, Chefin!«, erwiderte Winterhalter nach einer kurzen Pause.
Es fehlte nur noch, dass er Frau Bergmann salutierte. Die Ironie im Tonfall des Kollegen wiederum war das Erste, was Marie an ihm gefiel. Dieser Charakterzug war ihr nämlich auch nicht ganz fremd …
4. Disput im Overall
»Finger weg und nix anlange, hab ich g’sagt«, schimpfte Winterhalter wie ein Rohrspatz.
»Aber Bapa«, entgegnete sein Sohn Thomas im jammernden Tonfall eines kleinen Jungen, der gerade für etwas ausgeschimpft wurde. »Mir habe doch gar nit g’wusst, dass des ä richtige Leich ischt. Mir dachte, des wär ä Pupp oder so. Irgendwas, das ä andere Geocaching-Gruppe so hindrapiert hat.«
»Ä Pupp«, rief Winterhalter entsetzt, wurde dann aber leiser. »Des isch jo peinlich. Du bisch de Sohn von einem de erfahrenschte Kriminalbeamte. Und du hältscht ä Leiche für ä Puppe und langsch sie au noch an. Des solltescht du wohl besser wisse.«
»Ich hab sie doch nit ang’langt, ich hab sie doch nur ang’stupst.«
»Ang’stupst isch wie ang’langt«, sagte Winterhalter trocken. »Des macht’s jo nit besser.«
Er hatte sich schon seinen weißen Kriminaltechniker-Overall angezogen, bückte sich und schlüpfte nun unter dem Flatterband hindurch, das die Kriminaltechnik am Eingangsbereich der Fürstengruft gespannt hatte. Marie und Kiefer folgten ihm in gleicher Kluft.
Draußen versuchten schon die ersten Schaulustigen, einen Blick auf die Leiche zu erhaschen. Die Kunde schien sich schnell herumgesprochen zu haben.
Einige Streifenpolizisten versperrten aber den Weg und den Blick ins Innere der Kuppelkirche.
Die für diesen Tag geplante Feier im Park würde wohl abgesagt werden müssen.
»Todeszeitpunkt?«, fragte Winterhalter Marie wieder in bemühtem Hochdeutsch, nachdem sie die Leiche in der Fürstenberger Tracht in Augenschein genommen hatten.
Es schien eine Art Prüfung zu werden.
»Scannen kann ich die Leiche leider noch nicht. Ich fürchte, wir werden sie wohl näher untersuchen müssen. Um den exakten Todeszeitpunkt zu ermitteln, schlage ich vor, dass wir umgehend eine Körpertemperaturmessung vornehmen. Ein Grad verliert der Körper eines Toten pro Stunde. Damit werden wir den Todeszeitpunkt in etwa zurückverfolgen können«, antwortete Marie spitz.
»Die Todesursache werden wir wohl auch erst kennen, wenn wir die Leiche genauer untersucht haben. Aber das brauche ich Ihnen als erfahrenem Ermittler ja wohl nicht erzählen.«
»Nein«, entgegnete Winterhalter. »Wir Schwarzwälder sehen nämlich nur so blöd aus!«
»Ich bin auch Schwarzwälderin, falls ich mir diese Bemerkung erlauben darf. Ich bin in Villingen-Schwenningen zur Schule gegangen. Genauer gesagt in Villingen. Und der badische Teil der Doppelstadt liegt ja wohl noch im Schwarzwald. Oder haben Sie da andere Informationen?«
Winterhalter ging nicht darauf ein, blickte sie nur verächtlich an.
Seine schlechte Laune ließ er nun an seinem Sprössling aus, der ein paar Meter weiter hinter dem Flatterband kauerte.
»Wo komme eigentlich die ganze Gaffer her, die mir drauße g’sehe habe? Ich hab doch g’sagt: Zu keinem ein Wort!«
Thomas blickte etwas schuldbewusst drein: »Also, g’sagt habe mir zu niemand was. Aber ganz am Anfang, da … habe mir halt was auf Facebook gepostet.«
»Facebook!« Winterhalter spuckte das Wort regelrecht aus. »Nix läuft mehr ohne den Scheißdreck! Allmählich hass ich des Internet. Hättet ihr heut mol was G’scheites gmacht, anstatt mit diesem Pokemon hier in die Gruft …«
»Geocaching, Bapa …«
Winterhalter wandte sich von seinem Sohn ab und Marie zu: »Ich wollt nicht auf die Minute wissen, wann diese Person ums Leben kam. Das Jahrhundert würd mir in etwa reichen. Liegt die Leiche also schon länger – oder wurde sie hier erst vor Kurzem drapiert?«
»Einundzwanzigstes Jahrhundert, würde ich sagen.«
»Prima«, heuchelte Winterhalter Lob. »Dank Ihnen kommen wir langsam voran.«
Während Kiefer in seinem Overall ziellos in der Gruft umherlief, weil ihm das Geplänkel seiner beiden Kollegen offensichtlich unangenehm war, ging Winterhalter erneut ein paar Meter in Richtung Absperrung.
»Also noch mol von vorn, Thomas: Um wie viel Uhr seid ihr hier rein gekomme?«
»So gege zehn morgens.« Winterhalters Sprössling warf einen Blick auf seine drei Begleiter, die immer noch schockgefroren wirkten. »Mir habe heute ausnahmsweise blau g’macht und sind nit zur FH gegange. Weil die Gruft jo nur heut geöffnet ischt. Deshalb sind mir auch recht früh aufg’standen.«
Ehe Winterhalter seinen Sohn weiter befragen konnte, ging Marie dazwischen.
»Kollege Winterhalter«, sagte sie mit größtmöglicher Bestimmtheit, »lassen Sie mich mit Ihrem Sohn sprechen. Sie scheinen mir befangen …«
Ehe Winterhalter antworten konnte, meldete sich Kiefer zu Wort: »Die Person ist stranguliert worden.«
Er hatte begonnen, die Leiche zu untersuchen, ihren Spitzenkragen angehoben und darunter Striemen entdeckt, auf die er nun wortlos zeigte.
»Die könnten dem Opfer mit einem Seil oder Draht beigebracht worden sein. Der Täter muss ziemlich brutal vorgegangen sein.«
In seltener Eintracht beugten sich nun die drei Ermittler über die Leiche, die ebenso ungerührt wie starr zur Kuppel hinaufblickte.
Winterhalter war der Erste, der wieder zwei Meter nach hinten trat.
»Stranguliert mit Draht oder einem Seil? Deutet auf ein professionelles Vorgehen hin.«
Dann schaute er wieder auf die Leiche. »Das ist doch unzweifelhaft ein Mann. Warum trägt der dann aber eine Frauentracht? Wir sind doch hier nicht in Berlin.«
Der Seitenhieb galt natürlich Marie.
»Oder bei eurer Fasnet«, warf Kiefer ein.
»Bei der Fasnet würd wohl kaum ein Mann die Tracht einer Frau anziehen«, widersprach Winterhalter.
»Transsexualität gibt es eben inzwischen überall. Selbst auf dem Dorf«, kommentierte Marie.
Ehe die beiden Kampfhähne wieder aneinandergeraten konnten, mischte sich Thomas ein: »Vielleicht hät mer ihm die Frauentracht auch erscht nach seinem Tod a’zoge – und ihn dann hier reing’legt.«
»Des könnt sei – und isch auf jeden Fall än bessere Beitrag als alles, was von seller Dame dort kommt.« Winterhalter kratzte sich nachdenklich am Kinn und sagte dann zum elsässischen Kollegen Kiefer wieder betont hochdeutsch: »Die Hände einpacken!«
»Bitte?« Marie schüttelte den Kopf.
»Ich weiß ja nicht, liebe Kollegin, wie Sie in Berlin bei so einem Fall verfahren, aber wir hier im Schwarzwald sind akribische Schaffer, wie man so schön sagt. Wir sichern jetzt jeden kleinsten Fitzel, der einen Hinweis auf den oder die Täter geben könnte. Als Erstes packt Kollege Kiefer die Hände des Opfers in Pergamintüten ein, damit wir später die Fingernägel auf Spuren untersuchen können, die wiederum auf de Täter Hinweise geben. Ist ja selbstverständlich, dass …«
»Schon klar. Sie brauchen mir das Einmaleins einer Ermittlung nicht zu erklären. Auch wir in Berlin haben schon mal von Kriminaltechnik gehört«, unterbrach Marie und wunderte sich selbst über das »wir in Berlin«.
Sie war offensichtlich noch nicht wieder im Schwarzwald angekommen.
Nachdem sie einmal tief Luft geholt hatte, fixierte sie Winterhalter: »Was soll ich also Ihrer geschätzten Meinung nach tun?«
Der Kommissar lächelte verschmitzt, was seine mit feinen Blutäderchen durchzogenen Wangen hervortreten ließ.
»Tja, wir fangen mit der Drecksarbeit an, würde ich mal sagen.«
Er zog aus einem der Kriminaltechnikkoffer ein Fieberthermometer hervor, hielt es Marie direkt vors Gesicht. »Fieber messen, bitte. Der Kollege Kiefer hilft Ihnen, die Leiche umzudrehen.«
Wenn Winterhalter sich erhoffte, sie damit zu schocken, hatte er sich getäuscht.
»Na klar doch, sehr gerne«, sagte Marie in einem freundlichen Singsang.
»Und was gedenken Sie in der Zwischenzeit zu tun?«
»Ich schau mal, ob ich Spuren für daktyloskopische Untersuchungen sichern kann. Vielleicht hat der Täter ja Fingerabdrücke hinterlassen.«
Winterhalter begann, die Umgebung der Leiche zu untersuchen. Nach einer Weile sah er auf. »Riecht hier ganz schön nach Knoblauch, ist Ihnen das auch aufgefallen?« Bevor Marie und Kiefer etwas antworten konnten, fuhr er auch schon mit seinem Monolog fort: »Hat der Mann kurz vor seinem Tod eine stark gewürzte Mahlzeit gegessen? Auch das könnte natürlich ein wichtiger Hinweis sein … Kiefer!« Als der Kollege ruckhaft den Kopf hob, befahl Winterhalter: »Sorgen Sie dafür, dass bei der Obduktion der Mageninhalt des Opfers besonders sorgfältig untersucht wird.«
Kiefer nickte. Nachdem er die Hände fertig verpackt hatte und die erste Temperaturmessung bei der Leiche vorgenommen worden war, begann er, die Leiche mit Folie abzukleben.
Obwohl Kiefer erst einige Monate bei der deutschen Kripo war, waren die beiden Kommissare schon ein eingespieltes Team, wie Marie bemerkte. Während Kiefer die Folie auftrug, nummerierte Winterhalter die einzelnen Folien. Am Ende des Vormittags sah der Mann in Frauentracht aus, als habe man ihn für eine Paketversendung fertig gemacht.
Marie nahm sich derweil grimmig vor, den Fall zu lösen.
Notfalls im Alleingang.
5. Entspannung
Das Ticken beruhigte.
Kriminalhauptkommissar Karl-Heinz Winterhalter saß in seinem rustikalen Sessel in der guten Stube, die schuhlosen Füße weit von sich gestreckt, eine graubraune Strickjacke an.
Die Kuckucksuhr in der Nähe des Herrgottswinkels tat das, was sie schon immer getan hatte – und Winterhalter war dankbar dafür.
Was für ein Tag! Erst der Unfall mit Gnadenschuss, anschließend der erdrosselte Mann in Frauenkleidern. Und zu allem Überfluss war nun auch noch Thomas in den Mordfall verwickelt. Das weitaus Schlimmste aber: die neue Kollegin.
Winterhalter hielt sich für einen gutmütigen, kollegialen Beamten, einen »Teamworker«, genau wie es Frau Bergmann immer forderte.
Und er war weiß Gott schon mehrfach auf die Probe gestellt worden, zuletzt jahrelang mit seinem phobischen Kollegen Thomsen, bei dem die norddeutsche Herkunft noch eines der geringeren Probleme gewesen war. Thomsen hatte Winterhalter mit seinen Zwängen schier zur Weißglut getrieben, doch selbst mit diesem psychisch labilen Kollegen hatten sie einige Mordfälle gelöst.
Während die Uhr weiter tickte, breitete sich in Winterhalter das Erstaunen darüber aus, dass er den ungeliebten Thomsen nun fast schon vermisste. Aber irgendwann war es nicht mehr gegangen. Der Kollege hatte aufgrund seiner immer schlimmer werdenden Phobien stationäre psychiatrische Hilfe in Anspruch nehmen müssen.
Er würde ihn mal besuchen, nahm sich Winterhalter vor. Irgendwie hatte er ein schlechtes Gewissen, dass er das nicht schon längst getan hatte. Primär allerdings – und so ehrlich war er, während er im Sessel fläzte –, war diese plötzliche Sehnsucht nach Thomsen der Tatsache geschuldet, dass er nun eine neue Kollegin hatte, mit der er noch weniger zurechtkam als mit dem norddeutschen Kommissar in der Hochphase seiner Zwänge.
Winterhalter war niemand, der zu Verschwörungstheorien neigte, aber inzwischen fragte er sich doch, ob die Bergmann ihm absichtlich eine solche Person zur Seite gestellt hatte, um ihn zu »bossen«. Schließlich gefielen der Chefin etliche seiner Eigenarten nicht. Zum Beispiel, dass er mit seinen Stiefeln voller Stalldreck das Kommissariat verschmutzte. Oder seinen Handel mit Selbstgeschlachtetem von seinem Bauernhof im Polizeipräsidium. Oder seinen Dialekt. Und vielleicht auch die Tatsache, dass er einfach nur ein Mann war.
Nun also musste er sich mit einer Großstadtpflanze herumschlagen, die sich für etwas Besseres hielt. Die aber – und das hatte er schon am Nachmittag über den Flurfunk erfahren – nur hierher versetzt worden war, weil sie in der Hauptstadt einem leitenden Beamten bei einem Einsatz in den Allerwertesten geschossen hatte.
Winterhalter schmunzelte. Er neigte nun wahrlich nicht zur üblen Nachrede, aber es war schon gut, dass man gleich am Anfang etwas gegen die Kollegin in der Hand hatte.
Nur so für den Notfall.
»Transsexualität gibt’s inzwische auch auf dem Dorf«, äffte er den Satz der Kaltenbach in der Gruft nach.
Winterhalter hielt sich im Allgemeinen für einen toleranten Menschen, der jeden nach seiner Façon selig werden ließ. Allerdings war er ganz froh, dass hier in seinem Dorf, in Linach, noch alles auf althergebrachte Weise funktionierte.
Transsexuelle und Veganer sollten in Städten wie Berlin glücklich werden – und auch überkandidelte Kommissarinnen, die nicht in diese Region passten. Da mochte die Kaltenbach zehnmal hier geboren worden sein – das änderte nichts daran, dass sie in der Hauptstadt verdorben worden war, eine Zusammenarbeit mit ihr schwer möglich. Allein schon deshalb, weil sie vorlaut war und keinen Respekt vor erfahreneren Kollegen hatte.
Er starrte auf den dunkelbraunen Holzdielenboden und schüttelte den Kopf.
Da lobte er sich die Beziehung mit seiner Hilde. Sie beide konnten sich auch mal anschweigen, es musste nicht alles ausdiskutiert werden, jeder wusste, wo sein Platz war. Auf dem Bauernhof und auch im Leben. Und immerhin hatte er seiner Gattin den schönsten Liebesbeweis überhaupt erbracht: Er hatte eine seiner Kühe nach ihr benannt.
Sicher war Hilde auch jetzt wieder im Stall, um sich um ihre noch immer kränkelnde Namensvetterin zu kümmern.
»Karl-Heinz«, ertönte es da drei Meter hinter ihm vom Stuhl am Esstisch.
Huch! Er hatte sie gar nicht kommen gehört. Oder saß sie schon die ganze Zeit da?
Er knurrte etwas Undefinierbares.
»Karl-Heinz?«
»Jo?«
Die Uhr tickte weiter, aber mit der Ruhe war es vorbei.
»Mir schwätzet gar nimmer mite’nand.«
Hatte sie seine Gedanken gelesen? Es war doch positiv, dass man nach vierundzwanzig Jahren Ehe nicht mehr so viel reden musste. Oder?
Winterhalter überlegte und brummte dann: »Mir schwätze doch jetzt.«
»Ha, aber schwätze isch nit gleich schwätze«, wandte Hilde ein.
»Über was willsch denn schwätze?«
Er schnaufte hörbar. Das war das, was er nach einem solchen Tag genau nicht wollte. Eine Frau, die ihn nervte.
Er blickte wieder zur Uhr: halb acht.
Thomas war aus dem Haus, vermutlich wieder beim Geocatching oder wie das hieß.
Ein dringend notwendiger Entspannungsabend. Ein bisschen mit seiner Frau reden, dann noch mal in den Stall – und früh ins Bett, denn auf einem Bauernhof begann der Tag früh – bereits vor fünf. Also zu einer Zeit, in der die neue Kollegin wahrscheinlich erst ins Bett ging, ehe sie zum Frühstück gegen zwölf einen glutenfreien Kicherkürbis zubereitete …
»Also, wie war dein Dag?«, machte Winterhalter nun doch den Anfang – in der Hoffnung, dass das Ende auch bald erreicht sein würde.
»Ich war bei de Franziska«, sagte Hilde – und Winterhalter erstarrte in seinem Sessel. Franziska war eine Nachbarin, die ununterbrochen von »persönlicher Weiterentwicklung« faselte. Eine Frau, die sich aufführte, als sei sie weitaus gebildeter und kosmopolitischer als die ganzen anderen Dorffrauen.
»Die Franziska und ihr Mann hän au monatelang nie richtig mehr mit’nander g’schwätzt …«
»Und jetzt?«
Winterhalter war alarmiert. Hatte sich Franziska von ihrem Mann getrennt? Falls ja, konnte er diesem – dem Seiler Helmut – nur gratulieren, aber warum erwähnte Hilde das jetzt? Sie wollte sich doch wohl nicht von ihm …?
Unsinn, er fantasierte. Zur Sicherheit drehte er sich aber rasch um und wartete angespannt auf Hildes Antwort.
Sie war nicht ganz so schlimm, wie er befürchtet hatte. Allerdings auch nicht viel besser.
»Die habet ä Ehetherapie g’macht – und jetzt isch da wieder Harmonie.«
»Die Franziska isch doch eh nit ganz dicht«, platzte es aus Winterhalter heraus, ehe ihm klar wurde, dass das unter diesen Umständen genau die falsche Antwort war.
Er räusperte sich und sagte so ruhig wie möglich: »Aber mir brauchet so was jo nit, oder?«
Hildes Gesichtsausdruck machte ihm Sorgen.
»Es wär wichtig, Karl-Heinz …«
»Jetzt mol ernschthaft, Hilde«, brauste der Kommissar auf und legte los.
In den nächsten Minuten fluchte, schimpfte, spottete er: über Weicheier, Großstadtmarotten, Emanzen und Geldgeier, die mit ihrem hirnlosem Geschwafel Leute einlullten, womit er den von Franziska empfohlenen Paartherapeuten meinte.
Trotz seiner energischen Gegenwehr schwante ihm Schlimmes. So eingespielt und wunderbar geregelt die Dinge im Hause Winterhalter auch waren: Wenn Hildes Gesicht diesen speziellen Ausdruck annahm, würde sie sich nicht von ihrem Kurs abbringen lassen.
Aus Prinzip tobte Winterhalter noch eine Weile weiter, dann ging er in den Stall. Er verfluchte Franziska – und mit ihr seine neue Kollegin Marie Kaltenbach, die auf irgendeine geheimnisvolle Weise mitverantwortlich an den heutigen Schicksalsschlägen zu sein schien. Jedenfalls würde sie sich garantiert ein Grinsen verkneifen müssen, falls sie davon erfuhr.
Deshalb nahm sich Winterhalter Folgendes vor: Er würde dafür sorgen, dass weder die Kaltenbach noch sonst jemand von diesem Wahnsinn etwas mitbekam. Gleich morgen würde er diesen Eheberatungs-Quatsch absagen. Er brauchte nur noch einen guten Grund, Hilde dies zu vermitteln. Er würde noch einen Moment bei den Kühen bleiben. Wenn er ihnen beim Fressen zusah, kamen ihm immer die besten Gedanken.
6. Teamwork
Die Fahrt an ihrem zweiten Arbeitstag schien besser zu verlaufen als die gestrige. Diesmal gab es keine Tiere auf der Fahrbahn. Und mit ihren Gedanken hing Marie auch schon nicht mehr in Berlin, sondern bei der rätselhaften Leiche aus der Gruft.
Sie war gut zwei Stunden früher dran als tags zuvor, denn sie plante, vor ihrem neuen Kollegen – oder sollte sie eher sagen: Kontrahenten? – Winterhalter im Büro zu sein, der offenbar stets zu den Ersten gehörte.
Diesmal hatte sie das Fenster des Wagens weit geöffnet und sog die Schwarzwaldluft ein. Bei besagtem Wagen handelte es sich um einen alten Mercedes E 500 – ein ziemlich klobiges und kaum spritzigeres Modell als ihr Fiat Eleganza. Eine Leihgabe ihres Vaters, denn der Eleganza befand sich nach dem schrecklichen Wildunfall in der Werkstatt. Marie hoffte, dass es kein Totalschaden war, denn an dem Fahrzeug hingen doch einige Erinnerungen.
Psychisch war sie – wie eigentlich immer in den letzten Wochen, ja Monaten – nicht in Bestform. Das würde aber hoffentlich wieder werden, sobald sie sich erst mal eingelebt hatte. Das neue, schicke Loft an der Villinger Stadtmauer mit Dachterrasse und Blick auf die Alstadtsilhouette wurde gerade renoviert und sollte bald bezugsfertig sein.
Nach ihrer Berlin-Episode würde sie sich von ihren vorwiegend männlichen Kollegen hier nicht ins Bockshorn jagen lassen. Marie beschleunigte den Wagen, als wolle sie diesen Entschluss via Gaspedal energisch durchsetzen. Und mit jedem zurückgelegten Meter hatte sie den Eindruck, sich noch weiter von Berlin zu entfernen. Weg von Peter, weg vom Schuss in den Hintern. Volle Konzentration auf Villingen-Schwenningen.
Mit Winterhalter hatte sie leider einen dieser Typen vor der Nase sitzen, derentwegen sie damals, vor fast zwanzig Jahren, weggegangen war: ein Ewiggestriger – was seine Sprache, die Kleidung und vor allem seine Einstellung betraf.
Der junge Francois Kiefer, der als Gastbeamter aus dem Elsass zu den Schwarzwälder Kollegen gestoßen war, schien ihr da trotz seiner ungewöhnlich akkuraten Körperhaltung schon zugänglicher, aber auch weicher als die Kollegen aus Berlin, wo bekanntermaßen ein kriminalistisch rauerer Wind herrschte als im Schwarzwald.
Doch vielleicht würde sich das bald ändern: Marie eilte der Ruf voraus, dass sie Mordfälle förmlich anzog.
In Berlin war das noch nicht so außergewöhnlich gewesen, aber gleich am ersten Arbeitstag im Schwarzwald mit einem möglichen Mord konfrontiert zu werden, das war keine schlechte Leistung … Jedenfalls hatte ihr Winterhalter das am Vorabend noch zum Abschluss mitgegeben. Als könne ein toter Mann in Frauenkleidern nur der zweifelhafte Verdienst einer Hexe aus Berlin sein, deren sündhafter Großstadt-Einfluss das Klima im ach so friedlichen Schwarzwald negativ beeinträchtige.
Der Pförtner schien das glücklicherweise anders zu sehen, denn er begrüßte sie überaus freundlich: »Morgä!«
Es war trotz des Werktags still auf den Fluren der Kripo. Vermutlich war aber auch hier die Ursache, dass sie das hektische und laute Berliner Leben zum Maßstab nahm.