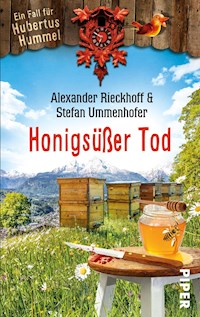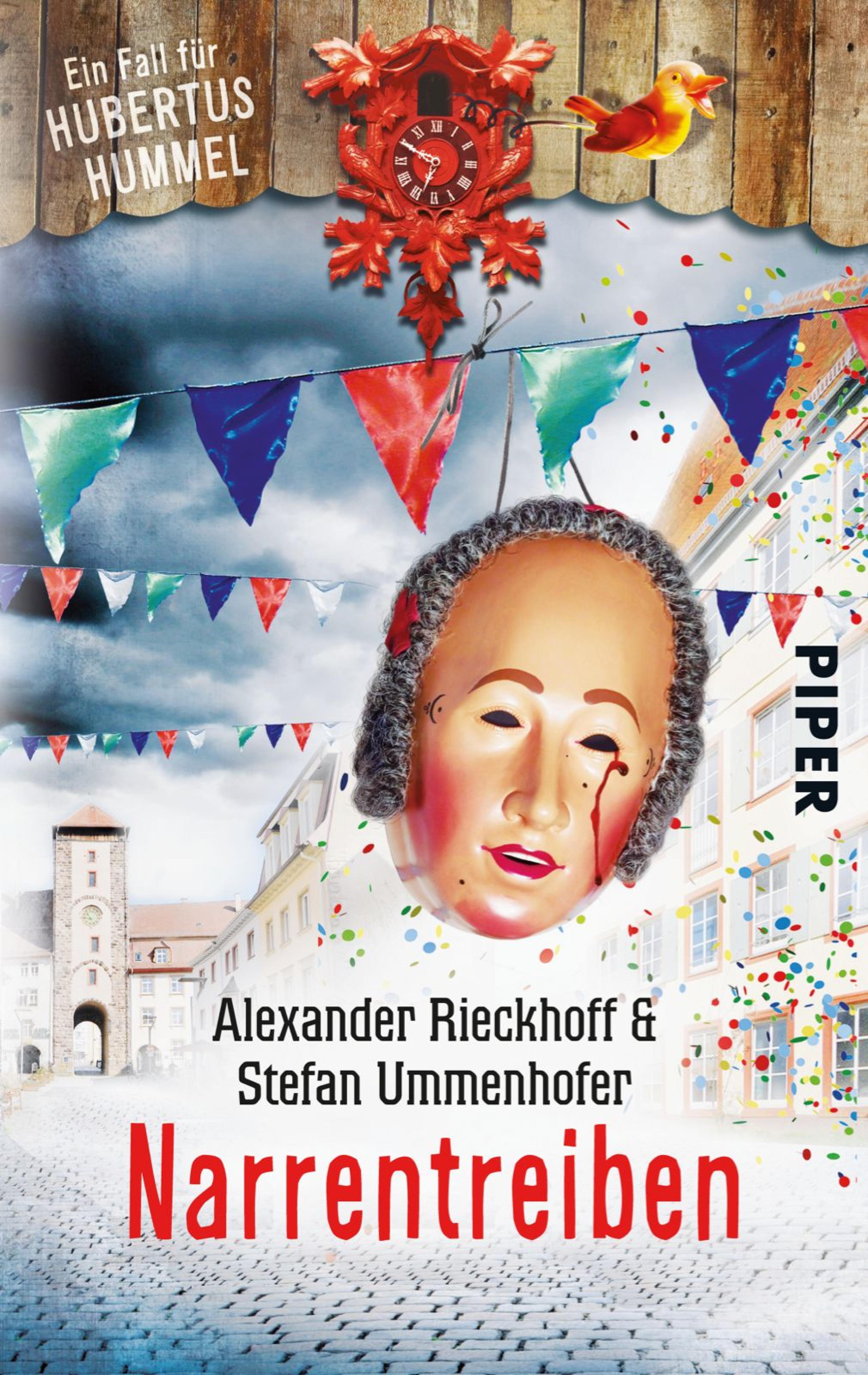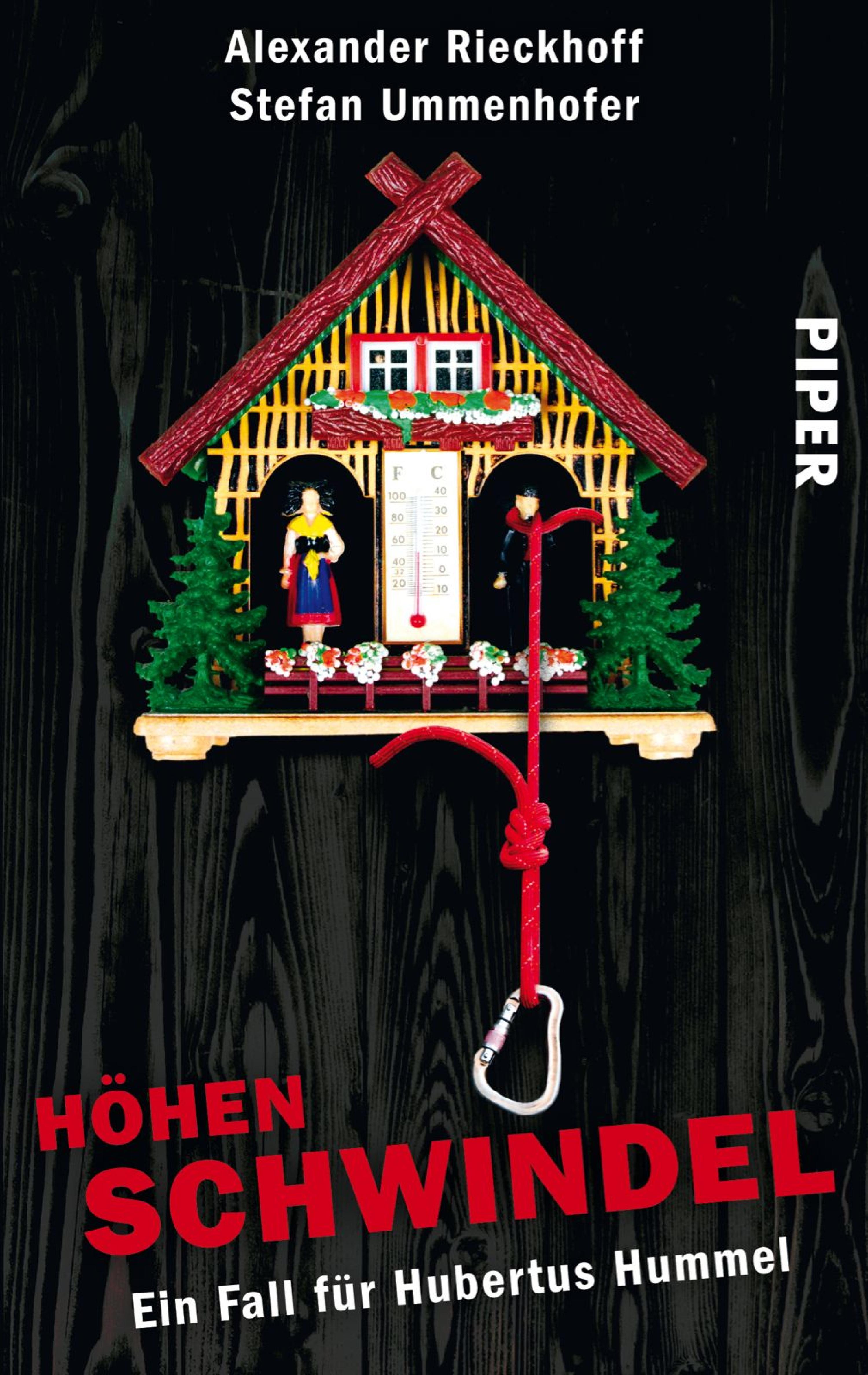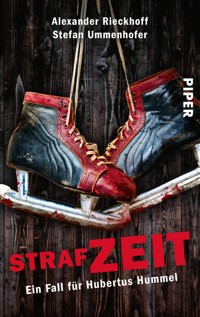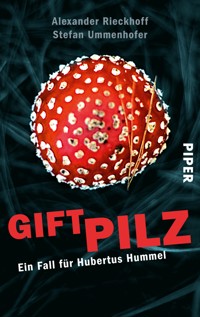
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Herzprobleme! Auch das noch! Ein Aufenthalt in einer Schwarzwälder Klinik soll Hubertus Hummel wieder auf die Beine bringen – die Besuche von Familie und Freundin tragen jedenfalls zu seinem Wohlbefinden bei. Doch als ein Mitpatient an einer Pilzvergiftung stirbt, ist es mit Ruhe und Erholung vorbei, denn der Studienrat vermutet dahinter keineswegs nur einen Unglücksfall. Gemeinsam mit dem Journalisten Klaus Riesle begibt er sich im Kurmilieu auf Verbrecherjagd, was nicht nur ihm bald an die Nieren geht…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
3. Auflage 2011
ISBN 978-3-492-95685-7
© Piper Verlag GmbH, München, 2010 Umschlaggestaltung: semper smile, München Umschlagmotiv: Dagmar Morath / buchcover.com Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
1. WIEDERBELEBUNG
Sosehr Hubertus sich auch bemühte, er konnte sich nicht bewegen. Da war nur dieses taube Gefühl in seinen Gliedmaßen, das Pelzige auf seiner Haut, die von einem kalten Schweißfilm überzogen war. Sein Schädel dröhnte, er musste auf den Hinterkopf gestürzt sein. Und dieser Schmerz in der Brust … Ein Überfall? In der beschaulichen Villinger Südstadt, an einem strahlenden Herbsttag?
Oberstudienrat Hubertus Hummel lag mit dem Rücken im Gras seines Gartens in der Vom-Stein-Straße und starrte in den tiefblauen Schwarzwaldhimmel. Lediglich der kräftige Ast einer Buche mit ihren rötlich-braunen Blättern ragte in sein Sichtfeld. Ein Stillleben, hätten nicht leichte Windstöße immer wieder dafür gesorgt, dass die Blätter auf und ab wippten und sanft raschelten.
Hubertus hatte keine Ahnung, wie lange er schon so lag. Es mochten wenige Minuten oder gar Sekunden gewesen sein, doch ihm kam es vor wie eine halbe Ewigkeit. Vage konnte er sich erinnern, dass er vor dem Sturz bei der Gartenarbeit gewesen war. Er hatte die Hecken geschnitten, Blätter zusammengerecht, den Rasenmäher aus der Garage auf die Wiese getragen. Zum Mähen selbst war er wohl nicht mehr gekommen.
Er registrierte, dass sein Kopf in einer Lache lag. Wasser? An diesem trockenen Tag? Nein. Die Wahrheit war offenbar so einfach wie unangenehm: Blut!
Je länger Hubertus in dieser starren Position lag, umso mehr steigerte sich seine Besorgnis. Mehrfach schon hatte er versucht, seine Lippen zu bewegen. Er konzentrierte sich auf das Wort »Hilfe«. Doch sosehr er sich auch anstrengte, kein einziger Buchstabe, nicht einmal irgendein Laut wollte über seine Lippen.
Wie schwer war er verletzt? Lebensgefährlich? Vielleicht war er ja sogar schon tot? Womöglich würde gleich ein Film vor seinen Augen ablaufen, wie es bei Nahtod-Erfahrungen offenbar der Fall war. Na dann: Film ab! Die unbeschwerte Kindheit in dem beschaulichen Schwarzwaldstädtchen, seine bewegten Jahre an der Uni in Freiburg, seine Liebe zu Elke, die Hochzeit. Die Geburt seiner Tochter Martina. Die Rückkehr nach Villingen. Die spannende Zeit mit seinem besten Freund, dem Lokaljournalisten Klaus Riesle, mit dem er immer wieder seine Nase in knifflige Kriminalfälle gesteckt hatte. Seine anstrengenden, aber auch erfüllenden Jahre als Lehrer am Romäus-Gymnasium. Sein fastnächtliches und heimatkundliches Engagement. Dann die Krisen mit Elke, die Geburt des Enkels Maximilian und zuletzt die schöne, aber offenbar viel zu kurze Zeit mit seiner neuen Freundin Carolin.
Der Film stoppte. Was würde er darum geben, jetzt, in diesem endlos wirkenden Moment, Carolin zu sehen? Oder Maximilian? Oder wenigstens Elke?
Doch stattdessen tauchte ein anderes Gesicht über ihm auf. Die markante gebogene Nase, die aus seiner momentanen Perspektive noch größer wirkte, war ihm wohlbekannt. Ebenso wie die zurückgestrichenen halblangen braunen Haare und diese Gutmenschen-Augen, die ihn entsetzt musterten. Der Anblick löste in ihm Erleichterung und Unruhe aus. Erleichterung, weil ihm endlich jemand zu Hilfe gekommen war, und Unruhe, weil Hubertus sich so ziemlich jeden anderen Menschen lieber als Ersthelfer gewünscht hätte als seinen nervtötenden Nachbarn und Lehrerkollegen Pergel-Bülow, der gerade immer wieder seinen Namen rief. Vielmehr dessen Koseform, die Hummel hasste und die er ihm streng untersagt hatte. Doch jetzt konnte er sich kaum dagegen wehren.
»Huby, Huby – mein Freund, was ist geschehen?«, rief Pergel-Bülow. Normalerweise fiel es ihm schwer, seine Stimme zu erheben, doch für seine Verhältnisse erzielte er eine beachtliche Lautstärke. Pergel-Bülow war eher der sanfte Typ. Was unter anderem daran lag, dass er sich gemeinsam mit seiner Frau Regine und Hummels künftiger Exgattin Elke schon seit etlichen Jahren in der esoterischen Szene der Stadt bewegte. Vor allem aber nervte Hummel, dass das Ehepaar seine penetrante Nächstenliebe bei jeder Gelegenheit zur Schau stellte – vor allem bei ihm.
Klaus-Dieter Pergel-Bülow hatte gerade seine nachmittägliche Meditation im Kreise seiner Gartenpflanzen begonnen, als er das Stöhnen vernommen hatte. So erklärte er es jedenfalls wortreich Hubertus. Zwischendurch flüsterte Pergel-Bülow immer wieder: »Alles wird gut … Alles wird gut …« Hummel überlegte für ein paar Millisekunden, ob Sterben nicht doch die bessere Alternative wäre. Doch natürlich gewann die Panik in ihm die Oberhand, und er ergab sich in die Rolle des Pergel-Bülow’schen Opfers.
Als ehemaliger Rettungsassistent bei den Maltesern hätte sich Hubertus auch nach all den Jahren einen Einsatz als Ersthelfer zugetraut. Doch wie war es um Pergel-Bülows Erste-Hilfe-Kenntnisse bestellt? Hummel wusste, dass dieser unzählige Seminare in ayurvedischer Ernährung, Rückführungen in frühere Leben und Partnerschafts-Wochenenden, um die weibliche Seite in sich zu entdecken, belegt hatte. Doch mit keiner dieser Weiterbildungen war in der akuten Notsituation viel anzufangen …
Immerhin: Der Nachbar brachte Hummel unter weiteren Mutmachfloskeln in eine stabile Seitenlage und wies seine mittlerweile herangetrippelte Frau an, den Rettungsdienst zu benachrichtigen. Na endlich!
Doch dann ging es ans Eingemachte. Hummels üppige Figur, die er selbst als »stattlich« bezeichnete, bereitete Pergel-Bülow ganz offenbar gewisse Schwierigkeiten. Er tastete nach dem Puls: am linken Arm, dann am rechten Arm, sogar an den Beinen und der Halsschlagader suchte er. Doch die Suche war wohl vergeblich. Mit einem Blick auf Hummels schmerzenden Brustkorb schien der Nachbar feststellen zu wollen, ob sich da überhaupt noch etwas hob. Das offenbar negative Resultat seiner Analyse bewegte Pergel-Bülow dazu, möglichst rasch zu handeln.
Zu Hummels Entsetzen öffnete sich über seinem Gesicht Pergels Mund. Wie ein Saugnapf umhüllten die leicht wulstigen Lippen Hubertus’ Nase. Der war nun so hellwach und klar bei Sinnen, dass er einen letzten Entschluss fasste: So würdelos durfte er nicht sterben. Er nahm also all seine Kraft zusammen und versuchte, einen Schrei loszulassen. Das, was aus Hubertus’ Mund kam, als der Ersthelfer den ersten Atemstoß in die Nase abgegeben hatte, war immerhin ein Röcheln.
Nun müsste doch selbst ein Pergel-Bülow kapieren, dass Hummel noch lebte!
Offenbar nicht, denn der drückte seine Hand noch fester auf Hubertus’ Mund. Nein, der Nachbar war wirklich kein Großmeister der Ersten Hilfe.
Mit letzter Kraft presste Hummel ein Wimmern hervor.
Pergel-Bülow hörte es und sah erleichtert aus, ja, fast ein wenig stolz.
Dem Mann, dem die Rettungssanitäter mit Martinshorn und Blaulicht zur Hilfe eilten, schien es sehr schlecht zu gehen. »Bewusstlose Person im Garten«, hatte die Leitstelle gefunkt.
Als die Sanitäter aus dem Fahrzeug stiegen und sich über den Mann in der grünen Gartenschürze beugten, murmelte der bloß: »Keine Küsse von … Pergel-Bülow!« Dann lächelte er sanft, fast etwas entrückt, und schloss die Augen. Die Sanitäter konnten Pergel-Bülow gerade noch rechtzeitig davon abbringen, den Nachbarn erneut zu reanimieren. »Der Patient atmet doch!«, rief der Fahrer des Rettungswagens.
Zehn Minuten später hatten die Sanitäter Hummel nach Eintreffen des Notarztes und der Stillung der Blutung am Kopf eine Infusion angelegt und ihn auf einer Trage in den Krankenwagen geschoben. Pergel-Bülow glühte immer noch vor unbändigem Stolz, war er doch felsenfest davon überzeugt, Hubertus gerettet zu haben. »Das war doch gar nichts Besonderes«, sagte er, ohne dass die Sanitäter ihn danach gefragt oder ihm wenigstens einen Pokal mit der Aufschrift »Lebensretter« überreicht hätten. »Du schaffst es, Hubertus«, rief er dem Nachbarn euphorisch hinterher.
2. DREIBETTZIMMER
Hummel musste lange geschlafen haben. Als er aufwachte, schimmerte bereits ein goldener Sichelmond über den Wipfeln der Schwarzwaldtannen. Vom Fenster des Krankenzimmers aus wanderte sein Blick auf die Gesichter seiner lieben Verwandten. Martina wippte seinen Enkel Maximilian auf dem Arm. Hubertus’ Eltern saßen am Kopfende des Krankenbettes. Zur Linken befand sich seine Nochehefrau Elke, die ihn anlächelte. Zur Rechten seine Freundin Carolin, die sogar strahlte. So viel Eintracht! Stand es wirklich schon so schlecht um ihn? Aus den Augenwinkeln sah Hubertus schemenhaft zwei weitere Betten. Und einen weiteren Menschen neben Elke: Pergel-Bülow – den stolzen Retter. Nicht schon wieder! Hubertus floh zurück ins Land der Träume.
Der erste Sinn, der sich bei Hummel zurückmeldete, war der Geruchssinn. Sollte er tatsächlich im Jenseits aufgewacht sein, dann war Gott ein Anatolier. Denn das, was in seine Nase stieg, war zweifellos der Geruch von türkischem Essen. Ob es Börek, Kebap oder Pide war, konnte er nicht genau sagen, zumal die Lider seiner Augen wie mit einer Heißklebepistole miteinander verbunden schienen. Dafür rührte sich sein Magen, der gewaltig zu rumoren begann.
Als sich dann auch das Gehör zurückmeldete, wusste er augenblicklich, dass er nicht im anatolischen Himmel war. Denn das Kauderwelsch, das immer deutlicher seine Gehörgänge flutete, war ein Mischmasch aus türkischem Akzent und Schwarzwälder Dialekt.
»Papa, musch du esse! Mama hät Börek g’macht. Musch du wieder zu Kräfte komme’«, sagte jemand.
Hummel blinzelte zögerlich und schlug die Augen auf. Keine Spur mehr von seiner Familie, dafür hatte sich eine andere in beachtlicher Größe um das Bett seines Zimmernachbarn geschart. Hubertus konnte nicht ausmachen, wer zur Kinder-, Enkel- oder Geschwisterfraktion gehörte. Es waren so viele, dass vermutlich auch noch Cousins und Cousinen gekommen waren. Und alle redeten gewaltig durcheinander und bemühten sich nach Kräften, dem Familienoberhaupt nach seinem Herzinfarkt beizustehen.
Als der schmächtige Mann entdeckte, dass sein Zimmernachbar aufgewacht war, hoffte er, einen dankbaren Abnehmer für das viele Essen gefunden zu haben.
»Meine Frau macht beschte Börek von de ganze Schwarzwalde – weisch?«
Zum ersten Mal seit dem Vorfall im Garten kam ein leises Lächeln über Hummels Lippen. Zum einen darüber, dass er offensichtlich noch am Leben war, zum anderen über das türkische Schwarzwälderisch oder schwarzwälderische Türkisch.
»Ha, jetzt lasset Sie den Mann doch erscht emol in Ruh wach werde«, kam es schroff von der anderen Seite des Betts. »Sie sehet doch, dass er noch ganz benomme isch. Do isch des deftige ausländische Esse erscht mol nit ’s Richtige. Vielleicht e Zwiebäckle für de A’fang?« Der Mann zeigte auf eine halbleere orangefarbene Packung mit dem strahlenden blonden Jungen auf seinem Nachttisch. »Soll i nach de Schweschter klingle?«
Mit Mühe und unter stechenden Kopfschmerzen wandte Hubertus sein Gesicht nach rechts. Dort saß ein Mann um die siebzig, körperlich in etwa das Gegenteil des Bettnachbarn zur Linken. Recht korpulent, Stirnglatze mit Haarkranz. Gerötete Wangen, die entweder auf einen Naturburschen oder auf Bluthochdruck schließen ließen.
»Ihne isch’s geschtern aber gar nit guet gange’«, meinte er mit weit aufgerissenen Augen und tiefen Stirnfalten, so als wollte er die Dramatik seiner Erzählung mit einem grimmigen Minenspiel unterstreichen. »Sie sin wohl em Tod grad no mol so vom Schipple g’schprunge.«
Hubertus bemühte sich, eine Frage zu stellen. Doch ehe er den ersten Ton überhaupt herausbrachte, hatte der Bettnachbar schon das Thema gewechselt. Es ging zwar immer noch um medizinische Belange, aber nicht mehr um Hummel.
»Bei mir isch’s jo so ähnlich g’wese. Mei Frau hät mich halbtot uf em Speicher g’funde. I kann Ihne sage …«
Also doch Bluthochdruck, dachte sich Hubertus.
»Die Weißkittel hän mir de Stecker zoge. Wobei des au Pfuscher sin – wie überall!«
Hubertus dröhnte der Schädel. Er war kurz vor einer erneuten Ohnmacht. Zum einen war es warm und stickig in dem kleinen Zimmer, was vermutlich auch an den schätzungsweise fünfzehn Besuchern lag. Auch die anfangs verlockenden Gewürze von Kreuzkümmel und Knoblauch sorgten mittlerweile für leichte Übelkeit. Zum anderen fühlte er sich von den Wortschwällen überrollt.
»Fascht en Herzinfarkt! Sofort hän sie mich vu Schönwald do her ins Krankenhaus brocht …«
Hubertus fielen die Augenlider halb zu, was den schwatzenden Bettnachbarn aber nicht vom Weiterreden abhielt. Im Gegenteil: Er wurde noch lauter.
»En Katheter hän sie mir g’macht. Do hän sie mir so lange Röhrle in d’ Leischte neig’schobbe bis zum Herz hin. Ratsch, ratsch, ratsch, hät’s g’macht. I kann Ihne sage, de blanke Horror. Zumal, wenn mer’s so schlecht macht wie seller Versager von Arzt …«
Die Erzählungen des kernigen, aber offenbar auch etwas hypochondrisch veranlagten Schwarzwälders regten Hubertus derart auf, dass das Messgerät neben seinem Bett einen Ruhepuls von fünfundneunzig anzeigte. Er fühlte, wie es in seiner Brust vibrierte und sein Herz immer wieder Sprünge machte.
Ganz ruhig, dachte sich Hubertus. Er war also in der kardiologischen Abteilung, vermutlich im Zentralklinikum Villingen-Schwenningen. Opfer eines Verbrechens war er offenbar nicht geworden.
Hatte er womöglich einen Herzinfarkt erlitten? Wie sollte es dann weitergehen? Und wieso lag er eigentlich in einem Dreibettzimmer? Hatte er als Privatpatient nicht Anspruch auf ein Einzelzimmer?
»Bypass oder nit, des isch hier die Frage«, dröhnte der Bettnachbar. »Bei mir habet sie zum Glück nur d’ Herzkranzgefäße g’weitet. Und wisset Sie …«
Panisch überlegte Hubertus, wie er sich aus dieser Situation befreien konnte.
»Falls die Ihne übrigens e Kur verschreibet: Passet Sie bloß uf. Ohnehin kann mer selle Weißkittel nit traue …«
Das war wohl das Stichwort. In diesem Moment öffnete sich die Tür, und ein halbes Dutzend weiß gekleideter Personen betrat das Patientenzimmer.
»Hier geht’s ja zu wie auf einem Basar. Darf ich die Herrschaften mal kurz nach draußen bitten? Wir machen jetzt Visite«, sagte ein untersetzter Mann mit akkuratem Seitenscheitel und umgehängtem Stethoskop. Von Statur und Erscheinung her ein Napoleon-Typ, klein und forsch. Seine rechte Hand hatte er allerdings nicht im Schlitz des Kittels, sondern lässig in der Seitentasche verstaut.
Hatte man als Privatpatient nicht auch den Anspruch, als Erster dran zu sein? Offenbar nicht, denn die Herren wandten sich dem nervigen Bettnachbarn zu. Sie tauschten sich in einer von Fachbegriffen gespickten Sprache aus, da war von »pektanginösen Beschwerden« die Rede und von einer »Claudicatio intermittens«, was, wie Hummel wusste, der lateinische Name für die sogenannte Schaufensterkrankheit war. Offenbar hatten entweder die Diagnose oder das Arztgeschwader den Bettnachbarn eingeschüchtert. Jedenfalls war endlich das eingetreten, was Hubertus die ganze Zeit gehofft hatte: Er hielt den Mund!
Als der Chefarzt sich ihm zuwandte, kam sich Hummel vor wie ein Angeklagter, der auf sein Urteil wartete. Bitte nicht die Todesstrafe …
Dann beugte der Napoleon-Verschnitt den Kopf nach vorne, sodass er über die Gläser der Lesebrille hinweg Hubertus mustern konnte.
»Es tut uns sehr leid, Herr …?«
»Hummel«, half der Stationsarzt aus.
Hubertus spürte einen dicken Kloß im Hals.
»Herr Hummel, ich bin Professor Brückner. Ich bedaure es sehr, dass Sie als Privatpatient mit einem Dreibettzimmer vorliebnehmen müssen. Aber wir sind momentan hoffnungslos überfüllt. Der gute Ruf der Klinik, Sie verstehen …« Der Chefarzt tätschelte ihm die Hand.
Hummel atmete erst mal erleichtert auf. Doch kein Todesurteil? Freispruch gar?
»Wir werden Sie noch ein paar Tage bei uns behalten. Sie werden natürlich so bald wie möglich in ein Einzelzimmer verlegt. Wenn es geht, noch heute.«
Einige Tage hierbehalten? Verlegen? Hatten die Größeres mit ihm vor?
»Was hab ich denn nun?«, erkundigte er sich.
Wieder hatte der Stationsarzt seinen Einsatz. Keine Urteilsverkündung, sondern eher eine Grabrede. Und zwar eine, die weniger für ihn als für die anderen Ärzte bestimmt war. Es wurde nicht mit ihm, sondern über ihn gesprochen.
»Der siebenundvierzigjährige Patient wurde gestern notfallmäßig eingeliefert. Er hatte im Garten eine Synkope erlitten. Als Ursache gehen wir von einer instabilen Angina pectoris aus. Als Folge der Synkope erlitt er eine Commotio cerebri. Beim Eintreffen des Notarztes waren bereits insuffiziente Reanimationsbemühungen durchgeführt worden. Im Notarztwagen kam es zu einer selbstlimitierenden supraventrikulären Tachykardie, welche auf Metoprolol prompt in einen Sinusrhythmus konvertierte. Es ist von einem metabolischen Syndrom mit den kardiovaskulären Risikofaktoren einer Hypercholesterinämie, eines latenten arteriellen Hypertonus und einer Adipositas Grad II auszugehen. Im Labor fiel eine erhöhte Gamma-GT von 107 auf. Für heute Mittag ist eine Koronarangiografie geplant.«
»Jesses nei!«, entfuhr es Hummel. »Könnten Sie mir das bitte in meiner Sprache erklären?«
Angina pectoris, das hatte er verstanden. Immerhin. Daher die Schmerzen in der Brust. Und Commotio cerebri war eine Gehirnerschütterung! Dem Latinum sei Dank.
»Ah, Sie sind Lehrer?«, bemerkte Professor Brückner, der offenbar nicht auf Zwischenfragen eingestellt war. »Habe ich mir gedacht.«
»Der Troponinwert ist zwar laut Labor negativ«, fuhr der Stationsarzt unbeirrt mit seinem Vortrag fort. »Aber das EKG deutet darauf hin, dass eine gestörte Durchblutung der Herzkranzgefäße vorliegt.«
»Also, heute Nachmittag werden wir eine Angiografie bei Ihnen vornehmen. Der Stationsarzt wird Sie dann über alles Weitere aufklären«, sagte Professor Brückner und tätschelte ihm nochmals flüchtig den Arm. »Keine Sorge, Ihnen steht ja eine Chefarztbehandlung zu. Da kann nichts passieren. In der Zwischenzeit werden wir noch die Patientenfürsprecherin vorbeischicken. Die wird Sie über alle Annehmlichkeiten unseres Hauses aufklären: Bademantel, Minibar, Kuchenservice.«
3. KATHETER
Immer wieder starrte Hummel auf das gewaltige Röntgengerät, das wie ein Damoklesschwert drohend über ihm hing. Und dann diese schrecklichen Geräusche: das Ratschen, wenn der OP-Pfleger die sterilen Handschuhe abstreifte und neue aufzog. Und das ständige Piepsen des EKG-Geräts. Immerhin konnte er so wenigstens selbst kontrollieren, ob er noch am Leben war.
»Achtung, jetzt kribbelt’s«, warnte der Pfleger und rieb ihn großflächig mit Desinfektionsmittel ein.
Ein zweiter Pfleger kam hinzu. Gemeinsam bedeckten sie den vollständig entkleideten Hummel von Brust bis Oberschenkel mit dem sterilen OP-Tuch.
»Alles klar?«, fragte der eine.
Hummel blinzelte verkniffen und deutete ein Nicken an. Zum Glück waren die beiden keine ehemaligen Schüler von ihm …
Die Pritsche war hart. Er fühlte sich wie kurz vor der Schlachtung. Gleich würde es Schinkenspeck geben. Es fehlte nur noch die Betäubungspistole.
Hubertus musste mit ansehen, wie einer der Pfleger das sterile OP-Werkzeug auf den Rolltisch legte. In Plastik verpackte Drähte, mit denen der Arzt gleich in seinen Körper eindringen wollte. Wäre es doch schon vorbei!
Doch der Chefarzt ließ auf sich warten. Stattdessen führten die Pfleger Männergespräche, während sie weitere Vorbereitungen für den Eingriff trafen.
»Hab gestern die kleine blonde Schwesternschülerin von der Geburtsstation angebaggert. Du weißt schon. Die mit den Sommersprossen und dem Piercing.«
»Eine echte Granate. Und, wie ist’s gelaufen?«
»Spitzenmäßig, sage ich dir.«
Hubertus schaute ungeduldig auf die Uhr über dem großen Monitor. Sie hätte gut in einen alten Hauptbahnhof gepasst. Nur Zeiger für Stunden und Minuten, nicht für die Sekunden. Dadurch hatte man das Gefühl, dass die Zeit noch langsamer verrann. Und der Minutenzeiger wollte einfach nicht umspringen.
Gut eine halbe Stunde lag Hubertus auf der Pritsche und wartete auf den Arzt. Und mit jeder weiteren Minute, die der lahme Zeiger umsprang, wurde er unruhiger. Er unterdrückte den Drang, vom OP-Tisch zu springen und durch die Flure in Richtung Ausgang zu rennen.
Kurz bevor die OP-Pfleger fast alle Schwesternschülerinnen und ihr »Anbaggerpotenzial« durchdekliniert hatten, tauchte endlich Professor Brückner mit einem Kollegen auf.
»Das ist Oberarzt Doktor Bünzli. Herr …?«
Diesmal genügte ein Blick auf den Monitor, auf dem bereits der Schriftzug »Untersuchung H. Hummel« inklusive Datum und Uhrzeit aufleuchtete.
»Genau, Herr Hummel: Wir machen diese Untersuchung im Dreamteam. Sie dreamen, wir teamen.«
Der Chefarzt grinste Bünzli an, der etwas nervös zu sein schien.
Was heißt eigentlich Witzbold auf Englisch?, fragte sich Hummel.
»Grüezi wohl«, begrüßte ihn der Oberarzt in mittelstarkem Schweizer Akzent. Seine Augenlider zuckten leicht, dennoch setzte er noch einen drauf. »Wir hätten da zwei Träume für Sie im Angebot: Schweizer Bergwiese mit Kuh. Oder Palmenstrand mit Kokosnüssen. Welchen hätten Sie denn gern?«
Hummel schwieg pikiert.
»Als Alternativtraum hätten wir noch den Partner nach Wahl …«
Partner nach Wahl … Jesses nei, war er plötzlich müde. Mit den Gedanken bei Carolin und Elke schlief er ein.
Das »Teamen« bedeutete, dass der Chefarzt sich wieder wichtigeren Dingen in seinem Büro widmete, während Bünzli die eigentliche Chefarztbehandlung durchführte.
Das Problem war nur, dass der Schweizer mit seinen dicken Metzgerfingern über so wenig handwerkliches Geschick verfügte wie eine Kantinenköchin nach einer kurzen Einführung in Sachen Katheter.
Fachlich war er durchaus gebildet und für die Arbeit im Labor wie geschaffen. Für medizinische Eingriffe am menschlichen Objekt hatte er allerdings zwei linke Hände. Jede Herzkatheteruntersuchung trieb seinen eigenen Puls weit nach oben.
Da war es wohl besser, den Patienten im Glauben zu lassen, der Professor – und nicht er – würde den Eingriff durchführen. Dieser Mann vor ihm zählte ohnehin zu der Kategorie Patient, denen man lieber weniger als zu viel sagte. Bünzli hatte noch einen Blick auf die Akte geworfen. Lehrer, Ende vierzig. Lehrer, oje. Wussten immer alles besser – und klappte mal eine Kleinigkeit nicht, so stand sofort der Anwalt parat. Wobei in seinem Fall die nicht ganz unberechtigte Befürchtung bestand, dass mehr als eine Kleinigkeit schiefgehen könnte.
Also los! Bünzli tastete mit seinen wulstigen Fingern an Hummels Leiste herum.
»Ja, wo isch denn das Äderli?«, murmelte er.
Er versuchte den Zugang zu legen. Einmal, zweimal.
Die Pfleger warfen sich amüsierte Blicke zu. »Hagottzack, isch des en Schinkchre«, entfuhr es ihm nach dem dritten vergeblichen Versuch.
Dass der Schinken in dem Moment aufwachte, jagte dem Oberarzt einen ziemlichen Schrecken ein.
»Schin…ken…?«, stammelte Hubertus.
»Überprüfen Sie sofort den Zugang für das Schlafmittel«, befahl Bünzli barsch.
Bevor Hummel überlegen konnte, wo eigentlich der Chefarzt abgeblieben war, schlief er wieder ein.
Beim vierten Versuch spürte Bünzli endlich keinen Widerstand mehr. Der Katheter war drin.
»So, jetzt lueget mer mol inni«, sagte Bünzli und ließ sich von einer Schwester die Stirn abwischen. Die Zugangsschleuse war gelegt.
Nun bloß den richtigen Weg nehmen, sagte er sich, während er den Katheter weiter in den Körper einführte. Als er nach ein paar ungelenken Manövern endlich mit der Katheterspitze im Herzen angekommen war, beobachtete Bünzli besorgt die Sprünge, die das Patientenherz auf dem EKG anzeigte. Vor allem, als er an den Herzwänden entlangfuhr, nahmen die Rhythmusstörungen zu.
»Jetzt das Kontrastmittel verabreichen«, forderte er einen der OP-Pfleger auf, der mit einer Art Spritzenpistole das Mittel über einen Schlauch in den Körper beförderte.
Für Bünzlis Verhältnisse lief der Rest der Untersuchung reibungslos. Jetzt noch ein ordentlicher Druckverband an der Leiste, aber das würden ja zum Glück die Pfleger erledigen.
Als Hubertus Hummel erneut aufwachte, stand gerade rechtzeitig wieder der Chefarzt in grüner OP-Kleidung vor ihm.
»Es ist alles gut verlaufen. Haben Sie gut gedreamt? Wir haben jedenfalls hervorragend geteamt. Gleich holt Sie der Stationspfleger ab und bringt Sie auf Ihr Zimmer.«
Hubertus hatte tatsächlich etwas geträumt. Allerdings weder von Kuhglocken noch von Kokospalmen. Er war beim Einkauf in seiner Stammmetzgerei gewesen. Dort hatte hatte ihm der Metzger Schwarzwälder Kirschwasser eingeflößt und zwischen abgehangenem Schinken und Salami eine Herzkatheteruntersuchung an ihm durchgeführt. Es war schrecklich gewesen!
»Ich schaue heute Abend noch mal bei Ihnen rein. Dann besprechen wir auch den Befund«, erklärte Brückner, bevor er das Zimmer verließ.
Hummel war eigentlich immer der Überzeugung gewesen, eine Schwarzwälder Rossnatur zu haben und mindestens so alt wie sein Großvater zu werden – sechsundneunzig Jahre. Und zwar bei genauso guter Gesundheit und bei normalem Lebenswandel. Normal hatte für seinen Großvater geheißen, immer einen gesunden Appetit auf Deftiges zu haben, schon mal gerne einen über den Durst zu trinken und »Stumpen« zu rauchen. Das mussten die guten Gene sein, hatte Hummel beschlossen und sich sogar vorgenommen, die Hundert vollzumachen.
»Herr … hm«, begann der Chefarzt am Abend die Befundbesprechung. »Ich will nicht lange um den heißen Brei herumreden. Sehr positiv ist, dass wir bei Ihnen keine Herzkranzgefäße weiten mussten. Das bedeutet auch, dass Sie nicht akut herzinfarktgefährdet sind.«
Hummel schnaufte tief durch.
»Schön, dann kann ich ja heute Abend nach Hause.« Er fühlte sich schlagartig viel besser.
»Nun mal langsam, Herr …«
»Hummel. Ist aber auch egal.«
»Sie sollten das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Immerhin haben wir beim Herzkatheter festgestellt, dass Sie einige Engstellen in den Herzkranzgefäßen aufweisen. Das wundert mich nicht bei Ihrem Beruf. Lehrer sind heutzutage unglaublichem Stress ausgesetzt. Ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten: Aber Sie machen auf mich den Eindruck, enorm unter Strom zu stehen.«
»Der Eindruck täuscht«, erwiderte Hummel trotzig. »Einige Engstellen in den Herzkranzgefäßen? Könnten Sie das bitte konkret erläutern?«
»Momentan ist die Durchblutung gewährleistet. Wir sollten aber schauen, dass sich die Herzkranzgefäße nicht weiter verengen. Wir wollen Sie doch nicht noch mal auf dem Kathetertisch haben. Aber dafür sollten Sie darüber nachdenken, ob Sie Ihr Leben nicht etwas umstellen. Mehr Sport, fettarme Ernährung, vor allem weniger Alkohol. Sie haben eine höhere Gamma-GT als unsere komplette Ärzteschaft am Zentralklinikum zusammen.«
Es hatte den Anschein, als musterte der Professor demonstrativ Hummels Bauch, der sich unter der weißen Decke mehr als sonst zu wölben schien.
»Herr … Wir schicken Sie zu einer Anschlussheilbehandlung in eine psychosomatische Klinik. Sie werden sehen: Das wird Ihnen guttun.«
4. NORDIC WALKING
»Und beim Schwung nach hinten die Hand öffnen!«
Hubertus kämpfte verzweifelt mit seinen Nordic-Walking-Stöcken, um den Anordnungen der Sportlehrerin Folge zu leisten.
»Kein Problem, Hubertus – das wird schon noch.«
Hummel nickte mit zusammengebissenen Zähnen und schaute sich dann ängstlich um, ob ihn beim Marsch durch den Ort jemand erkannte. Nicht einmal zwanzig Kilometer war Königsfeld von Villingen entfernt – die Gefahr daher latent. Und dass einer seiner Schüler ihn dabei beobachtete, wie er im Gänsemarsch mit anderen Rehawalkern durch das Örtchen tölpelte – das musste nun wirklich nicht sein.
Ohnehin gab es genügend Gerüchte, nachdem er krankgeschrieben worden und deshalb nicht mehr im Romäus-Gymnasium aufgetaucht war. Seine Freundin Carolin, die an derselben Schule unterrichtete, hatte ihm alles haarklein erzählt. Die einen Schüler hatten etwas von einem Selbstmordversuch zu berichten gewusst, wegen dem »der Hummel« längere Zeit nicht mehr kommen würde. »Der muss jetzt erst mal in die Klapse.«
Andere, unter ihnen sogar Kollegen, hatten kolportiert, Hubertus werde an eine andere Schule versetzt, weil die unbotmäßige außereheliche Beziehung mit Carolin nun bis zum Schulamt gedrungen sei. Hier war Pergel-Bülow wieder einmal in die Bresche gesprungen und hatte die Sache klargestellt. Im Lehrer- ebenso wie im Klassenzimmer. Zum Thema Zivilcourage hatte er im Gemeinschaftskundeunterricht – in aller Bescheidenheit – die Rettung des Nachbarn und Kollegen in epischer Breite behandelt, freilich ohne sich selbst übermäßig ins Rampenlicht zu stellen – das war zumindest seine Auffassung.
Lustlos schlurfte Hubertus in der halbwegs unauffälligen Mitte der Truppe durch die Straßen in Richtung Königsfelder Kurpark – neugierig und mitunter auch leicht spöttisch begafft von einigen Passanten. Dabei war Königsfeld einer der wichtigsten Kurorte im Schwarzwald, weshalb solche Szenen eigentlich nichts Besonderes waren.
»Stöcke nicht zu weit vorne aufsetzen«, mahnte ihn die durchtrainierte Blondine, die die Gruppe beaufsichtigte. Allmählich verließ Hubertus jeglicher Mut. Der Reißverschluss seines bestimmt fünfzehn Jahre alten Trainingsanzugs spannte noch mehr als zu Beginn der anderthalbstündigen Tortur, die mit einer theoretischen Einweisung begonnen hatte.
Das mit dem Trainingsanzug würde sich in nächster Zeit allerdings wohl ändern, denn die Schufte hatten ihn auf eintausendvierhundert Kalorien am Tag gesetzt.
»Hän ihr d’ Schi underwegs verlore?«, spottete ein älterer Mann. Hubertus kramte nach einer schlagfertigen Antwort, in der das Alter des Spötters Hauptbestandteil gewesen wäre, ließ sich aber vom beschwichtigenden Blick der Sportlehrerin davon abbringen.
»Sich hier zum Idioten zu machen und ausgelacht zu werden ist aber auch nicht im Sinn einer psychosomatischen Reha, oder?«, beschwerte sich der hagere Mann, der hinter Hubertus lief.
»Das ist alles eine Frage des Selbstbewusstseins«, antwortete Birgit, die Walkinglehrerin. »So toll, wie ihr das schon macht, habt ihr auch allerlei Grund dazu. Sehr gut, Hubertus. Prima, Dietrich.«
»Hoffentlich haben wir’s dann bald«, knurrte Dietrich, dessen hervorstechendstes Merkmal neben seiner Gesichtsblässe und seinem Reizhusten eine Narbe am Kinn war. Dabei hatte er nur eine ganz kleine Runde mitgedreht – fünf Minuten maximal. Eine Aktion des guten Willens sozusagen.
»Bringt ja doch nichts«, meinte Narben-Dietrich, wie Hubertus ihn getauft hatte. Kurzatmig kroch der Mittfünfziger am Ende des Feldes hinterher und wirkte noch weniger ambitioniert als Hubertus. Der schloss ihn deshalb gleich ins Herz.
»Optimismus! Optimismus!«, krähte die immerfröhliche Anführerin. »Bei mir ging’s am Anfang deutlich schlechter als bei euch jetzt. Und jetzt hat eure Birgit eine Nordic-Walking-Schule.«
Fast alle duzten sich. Die Physiotherapeuten und Sportlehrerinnen, die Massagefraktion und die Patienten. Ärzte wurden hingegen gesiezt. Hubertus mochte es nicht, mit Wildfremden per Du zu sein. In der Villinger Narrozunft mochte das noch eher angehen als hier, wo die einzige Gemeinsamkeit ein ähnliches Leiden war.
Hubertus hatte eine »Anschlussheilbehandlung« von zunächst drei Wochen bewilligt bekommen. Die Kur war zu seinem Leidwesen stationär, das abendliche Heimfahren aus »medizinisch-psychosomatisch-diätetischen Gründen« verboten. Überhaupt solle er sich vorstellen, er sei Hunderte Kilometer von zu Hause weg, um ganz abschalten zu können, hatten sie ihm gesagt.
Bereits am ersten Abend war Hummel kurz davor gewesen, zu desertieren, um wenigstens die Nacht in seinem eigenen Bett zu verbringen – oder in dem von Carolin. Allerdings wäre das der strengen Dame an der Pforte wohl aufgefallen, weshalb er zum Entschluss gelangt war, nicht gleich anfangs durch übergroße Bockigkeit aufzufallen.
Die hatte er schon bei der Eingangsuntersuchung gezeigt. Der neuralgische Punkt war das Wiegen gewesen. Der Moment der Wahrheit – nach mehr als fünf Jahren.
»Ist das wirklich nötig?«, hatte er gefragt. »Ich weiß, dass ich ein paar Kilo zu viel habe. Aber in der Hauptsache geht’s doch um mein Herz.«
Jegliche Renitenz war jedoch vergebens gewesen. Hinterher hatte Hummel sogar bereut, so zickig gewesen zu sein, denn im Vergleich zu den anderen Bediensteten hatte sich der knorrige Arzt durch einen trockenen Humor ausgezeichnet.
»Und jetzt bitte noch mal ohne Anhänger vorfahren«, hatte er bemerkt, nachdem sich Hubertus endlich schnaufend auf das Ding gestellt hatte.
Hummel hatte ihn nur erstaunt angeglotzt.
»Nur ein Spaß«, winkte der Arzt ab. »Aber ihr BMI ist bei fast 35.«
»BMI? Herr Doktor, reden Sie doch einfach Klartext mit mir.«
Das ließ der sich nicht zweimal sagen: »Sie sind zu fett.«
Hummel schluckte trocken. Vermutlich ließ sich nicht jeder Patient in einer psychosomatischen Reha so etwas sagen, ohne anschließend Selbstmordgedanken zu hegen. Immerhin hatte er sein Hauptvorurteil über Bord werfen müssen: Seine Mitpatienten waren keineswegs alles hoffnungslose Fälle, deretwegen man die Brücken im Klinikumfeld absichern musste, damit sie sich nicht hinunterstürzten. Die meisten machten eigentlich einen recht auskömmlichen Eindruck.
Er schluckte noch einmal und meinte dann beleidigt: »Also, wie viel wiege ich?« Gemeinerweise konnte nämlich nur der Arzt die Digitalzahl auf der Waage ablesen.
Wenn ich über hundert wiege, bin ich wirklich ein Psychosozialfall, dachte sich Hummel. Um nach einem weiteren Gedanken geistig zu ergänzen: Verflixt. Es sind über hundert. So viel waren es doch schon beim letzten ärztlichen Wiegen.
Seitdem hatte er allein schon deshalb nicht abgenommen, weil er von einer Ehekrise in die nächste geschlittert war. Und bei Krisen, so lautete die alte Hummel’sche Regel, wurde gegessen – ohne Rücksicht auf Verluste. Beziehungsweise Zugewinne bei den Kilos.
Vielleicht hatte er durch den Stress in letzter Zeit aber doch etwas abgenommen. Und durch die vermehrte Gartenarbeit. Und die Hausarbeit, die an ihm hängen blieb, seit seine Frau Elke ausgezogen war. Sie wohnte mittlerweile in einer Art WG zusammen mit anderen ehemaligen Mitgliedern der Sekte »Kinder der Sonne«, der Elke kurzzeitig angehört hatte. Hummels neue Freundin Carolin lebte nach wie vor in ihrer kleinen Wohnung in St. Georgen. Für einen Einzug bei Hubertus war es noch zu früh – und außerdem hätte Martina, Hummels Tochter, für diesen Fall wohl umgehend eine Bombe unter dem ehemaligen Ehebett deponiert. Sie konnte Carolin nicht ausstehen.
Der Arzt, der sich als Dr. Auberle vorgestellt hatte (»wobei Sie den Dr. vergessen können«), murmelte: »Sie sind drüber …«
Schicksalsergeben nickte Hummel. »Und konkret? Hundertzwei? Hundertdrei?«
Der Arzt stieß ein trockenes, kehliges Lachen aus. Vermutlich war er Raucher. »Humor ist schon mal eine gute Eigenschaft, um bald wieder ganz auf dem Damm zu sein.«
Oh, oh. Hummel wurde leicht panisch. Über hundertdrei? Deutlich über hundertdrei?
»Hundertzwanzig Komma zwei«, gab Auberle die schreckliche Wahrheit preis.
»Jesses nei!«
Hummel war so niedergeschlagen, dass er während der nächsten zwei Stunden nur noch apathisch nickte. Beim Rat des Arztes, sein Leben von Grund auf zu ändern, bei der Weiterleitung an die Diätassistentin und zu all dem, was sie mit ihm vorhatten. Er wehrte sich auch nicht mehr – nicht gegen das therapeutisch begleitete Essen mit der Ernährungsberaterin, nicht gegen das umfassende Sportprogramm, nicht gegen die Entspannungstherapie, die von Atemgymnastik über Qi Gong bis hin zur progressiven Muskelentspannung nach Jacobson reichte, und auch nicht gegen die psychologischen Einzel- und Gruppensitzungen.
Einer der größten Vorteile war das Einzelzimmer, befand Hummel. In den knapp drei Wochen bis zum Einrücken in die Königsfelder Rehaklinik war seine größte Sorge gewesen, dass man ihn in ein Doppelzimmer mit jemandem zusammenpferchen würde, der Dauerschnarcher, Schmutzfink, Selbstmörder, Hypochonder oder gar Psychopath war.
»Vielleicht gibt’s da ja sogar Drei- oder Vierbettzimmer«, hatte ihn seine Tochter Martina beunruhigt – sie war die Einzige gewesen, die ihn nicht mit Samthandschuhen angefasst hatte.
»Wir müssen Gespräche führen«, hatte ihn hingegen Elke beschworen. Sich den Schatten der Vergangenheit stellen. Verdrängtes emporbefördern. Ihre Ehe analysieren. Gemeinsam meditieren. Nur so könne er wirklich ganzheitlich gesunden – an Leib und Seele.
Vielleicht hatte die Aussicht darauf den letzten Ausschlag gegeben, dass Hummel wirklich nicht noch in letzter Sekunde gekniffen hatte, sondern tatsächlich an jenem schönen Frühherbstmorgen zur Königsfelder Klinik gefahren war.
Sein Zimmer war, na ja, zweckmäßig eingerichtet: Bett, Dusche, WC, Tischchen, Stuhl. Sogar einen Fernseher gab es. Doch dann die grauenvolle Entdeckung: Das Gerät war nicht freigeschaltet, die Scheibe blieb matt. Aus therapeutischen Gründen. Seine Versuche, das zu ändern, waren von keinerlei Erfolg gekrönt gewesen. »Ich bin Lehrer. Ich muss wissen, was draußen in der Welt passiert«, war sein Argument gewesen. Leider hatte es nichts genützt.
Abendessen gab es zwischen siebzehn Uhr dreißig und neunzehn Uhr: fettarmer Käse, Schwarzbrot, Graubrot, Tee, Mineralwasser. »Das gleiche Essen wie in Alcatraz«, hatte Hummel zu seinem Tischnachbarn gesagt.
Der ältere Mann im grauen Trainingsanzug, der sich ihm schlecht gelaunt als Gerd Zuckschwerdt vorgestellt hatte, schaute desinteressiert, hob verständnislos die Schultern und widmete sich weiter seinem Graubrot. Offenbar war auch er auf Diät.
»Das Gefängnis auf dieser Insel in dem Clint-Eastwood-Film?«, mischte sich Dietrich ein, der Mann mit der Narbe. Hummel nickte. Wenigstens einer, der einigermaßen auf seiner Wellenlänge war.
Der Mann mit der Narbe war der Einzige, von dem er sich ganz gerne duzen ließ. Und der Einzige, dem man zuhören konnte, wenn er sich über seinen Krankheitsverlauf ausließ. Die Auslassungen waren nämlich meist kurz und bündig – allein schon wegen der Atemnot, die ihn regelmäßig überkam. Hummel hatte erfahren, dass Dietrich an einem unheilbaren Lungenemphysem litt. »Noch sechs Monate, meint der Doc.« Dann gab Dietrich wieder seinen trockenen Husten von sich und zeigte mit seiner rechten Hand eine Kopf-ab-Bewegung.
Beim Gedanken daran blieb Hummel das ohnehin schon karge Essen fast im Hals stecken. Schon bewundernswert, wie dieser Mann sich in sein Schicksal ergab. Im Vergleich dazu ging es ihm ja noch prächtig. Er hatte gewissermaßen einen Warnschuss bekommen, um sein Leben zu ändern – auch wenn dies nicht so einfach sein würde. Hoffentlich hatten sich die Ärzte bei Dietrich geirrt: Wenn es gar keine Chance gab, hätte man ihn doch sicher schon zum Sterben nach Hause entlassen.
Der Vierertisch – außer Dietrich, Hummel und Zuckschwerdt gehörte noch ein fideler Sachse um die sechzig dazu – schwieg vor sich hin.
»Gebb’n Se mir och ’ne Möhre?«, fragte der Sachse schließlich.
»Gelbe Rübe! Gelbe Rübe heißt das hier«, belehrte ihn Hubertus Hummel, worauf eine Diskussion am Tisch entbrannte, bei der die anderen beiden sich als »Karotten«-Befürworter erwiesen.
Hummel schüttelte den Kopf. Schlimm genug, dass er das Zeug dauernd in sich hineinstopfen musste, da es eines der wenigen Nahrungsmittel war, das ihm in beliebiger Menge erlaubt war.
»Mahlzeit!«, ertönte es plötzlich, und Hubertus erhielt einen Schlag auf die Schulter, dass sich seine Herzkranzgefäße meldeten.
Klaus Riesle! Sein Freund, Lokaljournalist und Mann ohne Manieren.
»Ich dachte mir, ich schaue mal vorbei, ehe du vor Langeweile eingehst«, tönte der drahtige Redakteur, der wie immer Jeanshose und -jacke trug. »War gar nicht leicht, dich in dem Laden hier aufzustöbern.«
»Entschuldigung, aber wir haben gerade Essenszeit«, bemerkte eine Schwester, die den unangemeldeten Besuch verscheuchen wollte.
»Nee, danke – für mich nichts«, parierte der Journalist mit Blick auf Hummels Portion. »Und das nennt ihr hier Essen? Das ist ja erschütternd!«
»Sie müssen jetzt wirklich gehen«, meinte die Schwester und wurde allmählich unwirsch. »Das ist eine Rehaklinik – und Besuch sollte vorher angemeldet werden.«
»Alcatraz …«, wiederholte Dietrich bestätigend, nickte Hummel zu, hustete und schlurfte nach draußen.
»Oder Altenheim«, meinte Riesle.
»Und? Schon einen Kurschatten gefunden?«, frotzelte er einige Minuten später im Aufenthaltsraum.
»Noch nicht mal die Benutzung des Fernsehers haben sie mir erlaubt«, schimpfte Hummel.
»Oje, du Ärmster! Ich komme aber sobald wie möglich wieder bei dir vorbei, versprochen. Nächstes Mal bringe ich Elke mit. Die hat nämlich vorher bei mir angerufen und wollte dich auch mal besuchen.«
Hummel fielen mit Grausen die »guten Gespräche« ein, die Elke so am Herzen lagen, auf die er selbst aber am liebsten verzichtet hätte.
»Caro war auch schon da. Habt ihr eigentlich Kontakt?«, erkundigte er sich und versuchte, das Thema zu wechseln.
Bereits am frühen Nachmittag war Carolin nämlich als erster Überraschungsbesuch dieses Tages in der Klinik vorbeigekommen. Hubertus hatte sie zu einem Spaziergang überredet. Schön war es gewesen, fast schon romantisch.
Ende der Leseprobe