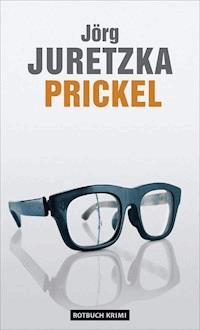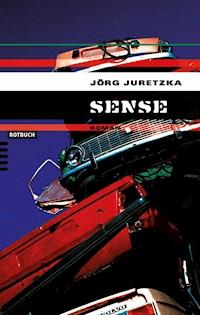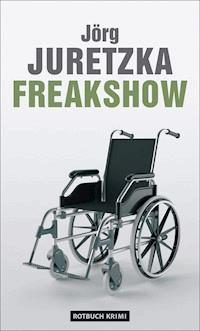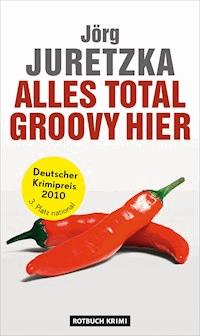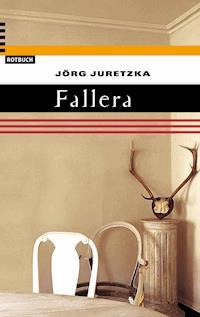Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BEBUG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Kristof-Kryszinski-Roman
- Sprache: Deutsch
Es war wirklich keine gute Idee gewesen, die Mafia von Marseille zu beklauen, muss Ex-Privatdetektiv und Ex-Kneipier Kristof Kryszinski einsehen. Seit dem Coup hält er sich, getarnt als lettischer Werftarbeiter, im portugiesischen Surferstädtchen Jerusalé versteckt. Doch mit dem Nahen des Winters und der Riesenwellen spürt er, dass seine Fassade bröckelt, seine Zeit abläuft. Schon bald muss er eine Entscheidung treffen: flüchten oder sich seinen Verfolgern stellen. Flieht er, wird er zum Gehetzten, bleibt er, bringt er sich und alle um ihn herum in Lebensgefahr. Die beste Lösung scheint da, er wäre tot … Elf Fälle hat Kristof Kryszinski seit 1998 er- und überlebt, und auch Fall 12 hält wieder alles bereit, wofür seine Leser Jörg Juretzka lieben: eine abgefahrene Story, zwielichtige Charaktere sowie perfekt getimte und messerscharfe Dialoge. TrailerPark setzt noch einen drauf und geht - wie könnte es anders sein - voll und ohne Rückfahrschein auf die Zwölf!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jörg Juretzka
TrailerPark
Kriminalroman
Rotbuch Verlag
Von Jörg Juretzka liegen bei Rotbuch außerdem vor:
Prickel (2011)
Taxibar (2014)
eISBN 978-3-86789-603-0
1. Auflage
© 2015 by BEBUG mbH / Rotbuch Verlag, Berlin
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Umschlagabbildung: © Gudellaphoto/Fotolia
Rotbuch Verlag
Alexanderstraße 1
10178 Berlin
Tel. 01805/30 99 99
(0,14 Euro/Min., Mobil max. 0,42 Euro/Min.)
www.rotbuch.de
Für Cora und Verena
Speziellen Dank an Chris Spedding für »Heisenberg«
Sämtliche Figuren dieses Romans sind frei erfunden.
Tot. Ich war tot.
Na, so gut wie. Noch wummerte mein Herz gegen den Brustkorb, noch schwitzten meine Poren, noch gruben sich meine Fingernägel in die Handflächen, noch hielt ich mich irgendwie senkrecht. Noch waren es nur meine Gedanken, die wie Querschläger kreuz und quer durch mein Schädelrund heulten. Noch.
Ich stand wie gelähmt, umgeben von Finsternis, eingekreist von einer schwer bewaffneten Einheit krimineller CRS-Beamter, belauert von einer fünfköpfigen Drogengang, verraten von der Frau, mit der ich mich nur Stunden zuvor in lustvoller Umklammerung über die Laken gewälzt hatte.
Meine Ermordung war beschlossene Sache, Zeitpunkt: sofort. Nur stellte man gerade zur allgemeinen Irritation fest, nicht bis zum Letzten geklärt zu haben, wer genau mich denn nun abkehlen sollte.
Inmitten einer an Abstrusität unüberbietbaren ›Nach Ihnen‹ / ›Nein danke, nach Ihnen‹-Situation stand ich da, erstarrt in kaltem Entsetzen, und wartete darauf, dass sie anfingen, Streichhölzer zu ziehen.
*
Der alte Clark-Stapler ächzte, als ich die Ladung Krummholz vorsichtig auf den Böcken ablegte. Vorsichtig, weil die Böcke, wie der Stapler, schon bessere Tage gesehen hatten. Alles hier in der Werft war abgegriffen, leck, krumm, rostig, rissig, schadhaft, angeschlagen. Man kann sagen, ich fühlte mich ganz zu Hause.
Vorarbeiter Rafael hatte mir einen Stapel nummerierter Schablonen hingelegt. Ich nahm die oberste und glich sie unter Drehen und Wenden mit den Krümmungen der starken Äste und jungen Baumstämme ab, manche davon angekokelt und rußüberzogen, Reste der Waldbrände der letzten Jahre. Nach Monaten am Schneidbrenner, Monaten des Abwrackens einer alten Fähre sägte ich jetzt schon die zweite Woche in Folge Spanten für den Neubau, ein Fischerboot mit Holzrumpf, das Eusebio in Auftrag genommen hatte. Passten Schablone und Krummholz übereinander, schrieb ich die jeweilige Nummer mit Kreide aufs Kopfende. Anschließend zog ich das erste Holz auf die ›Ping-Pong-Tisch‹ genannte stählerne Arbeitsfläche und legte es auf die Seite. Sie haben hier in der Werft ihre eigene Methode, um auch ohne Sägewerk ein Rundholz rechtwinklig zu bekommen: Mit einem auf einen Holzklotz gelegten Bleistift fuhr ich über den Tisch und zog dabei der Länge nach eine Linie an der äußeren Krümmung entlang und wiederholte das dann auf der inneren Seite. Folgte ich den beiden Linien nun mit der flach gehaltenen Kettensäge, hatte ich schon mal eine Seite der zukünftigen Spante plan. Doch es ging nicht recht vorwärts. Kette stumpf. Yesus. Keine Ahnung, wie er das macht, aber der baumlange Eritreer braucht die Stihl nur anzusehen, und die Kette ist hinüber. Milde genervt griff ich zur Rundfeile, hockte mich hin, nahm das Kettenschwert zwischen die Knie und begann, die Zähne durchzufeilen, erst die Linken, dann die Rechten. Zündung an, Startleine gezerrt, Gas, Gas, Gas und … aah.
Um drei heulte die Sirene. Feierabend. Ich packte das Werkzeug zusammen, brachte es in den Schuppen, bürstete mir die Sägespäne ab, wusch mich flüchtig an der Wassertonne und reihte mich ein in die Schlange mit den anderen Illegalen. Samstag, Zahltag.
*
Obwohl es mich innerlich geradezu in Streifen schnitt, war es mir irgendwann als der einzige Ausweg erschienen, das Drogenpaket zurück an den Fundort nach Frankreich zu bringen, ehe noch mehr Leute – mich eingeschlossen – deswegen draufgingen. Gleichzeitig war ich nicht so naiv gewesen anzunehmen, dass man mich nach der Übergabe mit einem warmen Händedruck und einem freundlichen Schulterklopfen ziehen lassen würde. Nicht nach dem, was schon passiert war, nicht mit dem, was ich mittlerweile wusste. Also habe ich mir Rückendeckung in Form der schönen Zollinspektorin Ingrid Dessentrangle und ihrer Behörde verschafft.
Oder gedacht, ich hätte. Ja, Scheiße.
Ohne mich zu rühren – äußerlich blickte ich, ganz das Opfer, dumpf ins Nichts – suchte ich fieberhaft nach einer, einer einzigen, noch so winzigen Möglichkeit des Entkommens. Flucht beherrschte mein Denken. Heillose, kopflose, ziellose Flucht, nur weg und mich irgendwo verkriechen, wie ein Karnickel in seinem Bau. Ich hätte angefangen, den Asphalt unter meinen Sohlen mit bloßen Händen aufzureißen, wenn das nur die geringste Aussicht auf Erfolg versprochen hätte.
Ein nächtlicher Parkplatz in den Dünen der Atlantikküste, drumherum ein rasch aufgestelltes Geviert transportabler Sichtschutzzäune, darin ein Bus und ein Lkw der CRS mit einem gruseligen Sortiment von Äxten und Schaufeln an den Bracken, Ingrid Dessentrangles privater Citroen, der heruntergekommene Mitsubishi Evo der Drogentypen, mein rostbeuliger 77er Toyota mit offener Fahrertür, Schlüssel im Zündschloss, doch zwischen mir und meinem Auto die ringförmig angeordnete, zwölf Mann starke Einheit in Kampfanzügen und voller Bewaffnung, Finger an den Abzügen, alle Mündungen auf meine Beine, alle Blicke auf meinen Hals gerichtet. Hinter dem Zaun in westlicher Richtung ein Fußweg durch die Dünen zum Strand, in östlicher eine Fahrbahn durch die Dünen zur nahen Landstraße, und in jeder anderen Richtung ausschließlich Dünen, Dünen, Dünen.
Einer aus der Drogengang, ein kaum dem Teenie-Alter entwachsener Typ in Laufschuhen, Trainingshose und ärmellosem T-Shirt, mit seinen rotblonden Stoppeln der einzige Nicht-Schwarzhaarige seiner Bande, stand etwa anderthalb Meter rechts von mir. Uns gegenüber, nicht viel weiter als einen langen Schritt entfernt, reckte sich der Kommandant der CRS-Truppe in breitbeiniger Pose, Drogenpaket in einer Ikea-Tasche und Drogengeld in zwei Kühlboxen zu seinen Füßen. Er und der Rotblonde verhandelten. Es ging nicht um die Kaufsumme, die war vorher vereinbart und gerade eben ausgehändigt worden, sondern um – mich. Der Gangster sprach laut und in einem gewöhnungsbedürftigen Dialekt, der die Modulationsmöglichkeiten des weichen französischen ›n‹-Nasals verweigerte und durch ein geradezu abgehacktes ›ng‹ ersetzte. Südfrankreich, erinnerte ich mich, während meine Gedanken sich mehr und mehr auf die Gestalt des Kommandanten konzentrierten, Midi, entsann ich mich eines Urlaubs vor langer Zeit, vermutlich Marseille.
Flucht. Ich hatte nichts, womit ich drohen, worum ich feilschen, was ich zum Tausch anbieten könnte dafür, am Leben gelassen zu werden. Ich besaß keinerlei Verhandlungsposition. Flucht war meine letzte verbliebene Hoffnung. Flucht durch den Kreis der Polizisten und in mein Auto und dann ab durch die Mitte, und all das, ohne schon im Ansatz gepackt, niedergeknüppelt oder über den Haufen geschossen zu werden … Hm. Sprint durch den Kreis der Polizisten, und dann schwungvoll über den instabilen Zaun aus groben Drahtmaschen und glatter Kunststoffbahn gehechtet … Zweimal ›Hm‹, vor allem was das ›schwungvoll‹ anging. Ich hatte mehrere wirklich robuste Attacken auf meine Person hinter mir, und noch war längst nicht alles wieder abgeschwollen.
Blieb der Kommandant und die Pistole in dem Holster an seinem Gürtel, knapp oberhalb der rechten Arschbacke, gehalten von einem Lederriemen, den ein simpler, durch einen Schlitz gedrückter Knopf sicherte. Ich musste mich zwingen, nicht darauf zu starren wie ein Reiher auf seine nächste Mahlzeit.
Ein Satz nach vorn, den Riemen losrupfen, die Waffe packen, aus dem Holster zerren, hochreißen und augenblicklich um mich schießen. Packen, hochreißen und so viele wie möglich umnieten, mitnehmen ins Verderben … Hm. Selbst in meinem Zustand am Rande panischer Umnachtung entging mir nicht der eine oder andere Schwachpunkt in meinem Plan, angefangen bei der Tatsache, dass der Ausgang für mich unverändert letal ausfallen dürfte, bis hin zu meiner nahezu völligen, fast schon anrührenden Unkenntnis, was Schusswaffen und ihre Handhabung angeht. Nie gelernt, das. Nie gewollt, wenn ich ehrlich bin. Wahrscheinlich wäre ich schon zu einem Klumpen blutigen Fleischs zusammengesackt, bevor ich auch nur herausgefunden hätte, wie man das Biest entsichert.
Die Waffe packen, aus dem Holster zerren und sie ohne zu zögern dem Kommandanten an den Hals setzen, und scheiß drauf, ob sie nun entsichert war oder nicht. Ihn lautstark bedrohen, gewaltsam mit zum Auto schleifen und in den Kofferraum zwingen. Und dann mit Vollgas abhauen. Das war sie, das war meine letzte Chance.
Der Rotblonde machte jetzt einen Vorschlag. Alle ringsum scharrten mittlerweile mit den Hufen, wollten weg, doch nicht, solange ich noch in der Lage war, eine Aussage zu machen, mit dem Finger zu deuten, das CRS-Kommando, die schöne Zollinspektorin und die jugendliche Drogengang in die Kacke zu reiten. Oder, anders ausgedrückt: zu atmen.
»Ssänke mille, eh ang le liquid eh l’angterr dang leh dühn«, bot er an. Zumindest klang es so. ›Fünf Mille und wir machen ihn platt und verscharren ihn in den Dünen‹, sinngemäß übersetzt.
Der Kommandant zog ein abwägendes Gesicht.
Bei drei, entschied ich.
Eins …
*
Ich zählte nach. Eusebio entlohnt seine Leute immer in kleinen Scheinen, weil das, wie er hofft, nach mehr aussieht, und dabei vertut er sich bekanntermaßen ganz gern und – seltsam – immer zu seinen Gunsten.
»Stimmt«, sagte ich und steckte das Geld ein.
Eusebio blätterte in seiner Kladde und wog den Kopf hin und her, ein allsamstägliches Ritual. Er war alt, eingefallen, der ganzjährig sonnenbraune Schädel umflust von weißen Haartupfen. Seine viel zu große Lesebrille ließ es so wirken, als habe er seit ihrer Anschaffung dreißig Kilo Gewicht, zwanzig Zentimeter Höhe und mindestens zehn Prozent seines Kopfumfangs eingebüßt.
»Wie kommst du voran?«, fragte er und hob Brille, Blick und Brauen. Mit mir sprach er englisch, mit anderen französisch, mit wieder anderen portugiesisch, und das völlig ungeachtet der Tatsache, in welcher Sprache sein Gegenüber antwortete.
»Fantastisch«, behauptete ich. Ich meine, was erwartete er? Dass ich, »Na ja, irgendwie total schleppend«, antwortete? Ich war Wochenlöhner. Ich kam entweder fantastisch voran, oder ich kam nicht wieder.
Er sah mich an und nickte dann gnädig. »Montag, sieben Uhr.« Und er blickte abwartend.
Ich sagte nur: »Gut.« Mag sein, er erhoffte irgendein Zeichen von Dankbarkeit, doch mal ganz im Ernst, dafür zahlte der alte Halunke einfach zu beschissen. Außerdem hatte ich den Job zumindest finanziell nicht unbedingt nötig, nicht so händeringend wie die meisten anderen. Warum ich trotzdem Woche für Woche weitermachte, hatte damit zu tun, dass ich einen nachvollziehbaren, einen sichtbaren Broterwerb brauchte, eine Arbeit, eine Rolle, um meine Fassade aufrechtzuerhalten. Ich war angelernter Werftarbeiter aus dem Baltikum, wohin ich aus privaten Gründen nicht zurückwollte. Wenn mir hier irgendetwas das Genick brechen konnte, dann wäre das, als Deutscher erkannt und mit einem Haufen Bargeld in Verbindung gebracht zu werden. Da könnte ich mir auch gleich ›Kryszinski‹ quer über die Schultern pinseln und eine Zielscheibe darunter. Nein, ich musste immer ein bisschen knapp bei Kasse wirken und arbeiten, arbeiten, arbeiten. Angenehmer Nebeneffekt war, dass mir so weniger Zeit zum Grübeln blieb, während ich mich auf das Unvermeidliche vorbereitete.
*
Niemand hatte ihn kommen hören. Der Kampfhubschrauber stieg so plötzlich über den Dünenkamm, dass es wie ein Hopsen wirkte und man so halb und halb erwartete, ihn genauso rasch wieder außer Sicht sacken zu sehen. Doch er blieb, ein mattschwarzes Monstrum, hässlich wie ein tödlich giftiges Insekt. Stand auf der Stelle, trotz des Meerwinds, was ihn faktisch dazu zwang, rückwärts zu fliegen. Stand, knapp über den Dünen, alle Scheinwerfer an, und dazu, rot, scharf, deutlich sichtbar in der feuchten Luft, der Feuerleitlaser einer Bordkanone, in ruhiger Schwenkbewegung, suchend, drohend.
Zwei …
Jeder Mensch kann vor Schreck verkrampfen, doch besonders heftig fällt diese Reaktion für gewöhnlich aus, wenn sie an Schuldbewusstsein geknüpft ist.
Wohl dem, der das nicht kennt.
Alle starrten in das grelle Licht, Klamotten knatternd im Abwind der Rotorblätter, vollkommen verblüfft, regelrecht vor den Kopf geschlagen, nur ich nicht.
Drei!
Ich warf mich nach vorn, packte die Tragegriffe, wirbelte herum, stürmte los, durch den Ring meiner Bewacher zum Toyota, wuchtete meine Last aus vollem Lauf durch die offenstehende Fahrertür, hechtete hinters Lenkrad, drehte den Schlüssel, trat das Gas, und – zögerte. Wohin?!, gellte mir in den Ohren. Nach links war die logische Antwort, zur Zufahrt, zur einzigen Lücke im Zaun, und von da aus weiter, immer weiter in die Nacht. Bloß dass in genau dem Augenblick, als ich die Kupplung schnackeln ließ, in eben dieser Lücke ein mit ›Police‹ beschrifteter Schützenpanzer zum Stehen kam, in seinem Rücken ein Meer von Blaulicht.
*
Die Schmarotzer warteten draußen vor der Werft. Eine kleine Gruppe asozialer Portugiesen und sonstigen europäischen Treibguts, meist hängengebliebene Alternativ-Touristen, lauter aggressive Schnorrer, die sich das Abgreifen der arbeitenden ›Sem Papéis‹ zu einer liebgewonnenen Gewohnheit gemacht hatten. Ich trat vors Tor und sah, wie sie Yesus in die Mangel nahmen. Ihr Chef war ein – ich weiß nicht – Holländer, Belgier? Jedenfalls sprach er mit einem kratzigen flämischen Akzent. Er war ungefähr in meinem Alter, aber fleischiger, und hatte etwas ungemein Schmieriges an sich. Diese gelben Augen, dieses großkotzige Gehabe, dieses Tattoo im Genick, diese schwere Kette ums Handgelenk, golden mit Ansätzen von Grünspan in den Gliedern. Früher sicher mal ganz gutaussehend, war er mittlerweile dabei, an den Rändern auszufransen wie eine abgelatschte Badematte. Ich gab ihm noch zwei, drei Jahre, bis er als ein aufgedunsenes, zahnloses Wrack durch die Straßen eiern würde. Doch so lange konnte ich nicht warten.
Er lehnte am Zaun der Werft, während das restliche Pack meinen Kollegen bedrängte.
Unter den ›Papierlosen‹ gibt es keine wirkliche Solidarität, sondern eher eine generelle ›Besser du als ich‹-Haltung. Keiner will in etwas hineingezogen werden, das die Behörden auf den Plan rufen könnte, doch ich mochte Yesus gut leiden, und stoppte deshalb, anstatt einen Bogen um die Szene zu machen. Von allen Afrikanern, die ich je getroffen habe, sieht Yesus einer dieser dünnen Ebenholz-Figuren vom Trödelmarkt am ähnlichsten. Er blickte unglücklich drein, wie ein Basketballer, der sich unversehens mit dem Ei unterm Arm inmitten eines Football-Matches wiederfindet.
»Gib ihnen nichts«, sagte ich in einem um Leichtigkeit bemühten Tonfall, »sie versaufen‘s ja doch bloß.« Alle waren hier freundlich – dies war kein Raubüberfall, nein, dies war nur eine gutmütige Kungelei unter Freunden – ›Komm, Sem Papéis, leih uns ein bisschen was von deinem Lohn, wir wollen doch alle nicht, dass man dich gefesselt und geknebelt in den nächsten Flieger zurück ins Elend schiebt, oder?‹
Yesus warf mir nur einen kurzen, scheuen Blick zu und forkte dann einen Schein heraus.
»Bisschen wenig«, fand der Typ, der ihn annahm, ein Vierschrot, dem graue Wolle aus sämtlichen Öffnungen seines Unterhemds quoll.
»Schluss jetzt«, entschied ich, legte Yesus einen Arm um die Schultern und wollte weiter, als sich der Chef der Truppe vom Zaun löste.
»Du hast noch nicht gezahlt, Lette«, stellte er in kehligem Englisch fest und packte mich am linken Ärmel meines langen, robusten Grobkarierten. »Ja, genau genommen, hast du noch nie gezahlt.«
Und er hielt mich, während sich der Kreis der Schnorrer um uns schloss.
Meine Schuld. Seit Monaten war ich ihnen ausgewichen, seit Monaten hatte es sich angebahnt, und nun war es soweit. Mein Herz schlug bis zum Hals, doch einmal nachgeben heißt für immer nachgeben. Und das ließ sich mit irgendetwas in meinem Inneren nicht vereinbaren. Du kannst sinken, wie in meinem Fall sogar tief sinken, doch wenn du nicht an einem bestimmten Punkt einen Strich ziehst, gehst du unter. Der Punkt war erreicht.
Ich sah von der Hand an meinem Ärmel hoch, sah den Typen direkt an – nicht in die Augen, immer ein bisschen tiefer, um zumindest peripher die Bewegungen seiner Arme, seiner Beine, seiner Hände und Füße im Blick zu behalten – und sagte klar, ruhig und präzise: »Lass los. Sofort. Oder ich breche dir den Arm.«
Seine Augen weiteten sich in gemimtem Erstaunen, dann fiel sein Blick auf das mit Blei gefüllte Stück Stahlrohr, das ich aus meiner Zollstocktasche gezaubert hatte.
Er sagte etwas auf Portugiesisch, das seine Kumpels grinsen ließ und aus dem ich nur ›Polícia aliens‹ heraushörte, dann ließ er meinen Ärmel los. Ich nickte ihm zu und ging, Yesus an meiner Seite.
»Nepomuk, was tust du da?«, raunte er eindringlich, kaum dass wir außer Hörweite waren. »Sie werden dich bei der Fremdenpolizei anzeigen.«
Ich wog das einen Moment lang ab, mein Blut noch heiß und meine Finger vielleicht ein ganz klein bisschen zittrig. Es war so knapp gewesen und Blut wäre geflossen. Immer hässlich, das.
»Noch nicht«, entschied ich dann. »Sie geben sich jetzt gerade noch einen letzten Versuch.« Und bis dahin, bis zum nächsten Zahltag, musste ich mir etwas einfallen lassen.
*
Die Vergaser schnorchelten entschlossen, die Hinterreifen quietschten auf, ich beschleunigte direkt auf die Sichtschutzwand zu, rammte sie um und nahm sie unter die Räder, nutzte sie als Rampe die Düne hinauf. Wie durch ein Wunder reichte der Schwung bis hoch zum Kamm, doch dann leider nur halbwegs drüberweg. Für einen Moment, gerade lange genug, um mit der Phalanx liegender und mit Strandhafer an den Helmen perfekt getarnter Polizisten Rezepte für Choucroute à l‘Alsacienne auszutauschen, lag der Toyota knirschend auf dem Bauch, Räder baumelnd, hilflos rotierend, während die Polizisten die Läufe ihrer Sturmgewehre in meine Richtung drehten und mich ins Visier nahmen. Ich duckte mich, schloss die Augen, erwartete das Peitschen von Schüssen zu hören, das Splittern von Glas und mein letztes, röchelndes Atmen, dann zog das Gewicht des Motors die Nase des Wagens nach unten, und es ging wieder vorwärts. Kein einziger Schuss war gefallen.
Dann sah ich die Straßensperre. Und die Beamten sahen mich. Verblüffung auf beiden Seiten. Ich hatte irgendwie nicht damit gerechnet, dass sie zusätzlich zu dem Kampfhubschrauber, dem Schützenpanzer und dem durch die Dünen robbenden Großaufgebot noch Straßensperren für nötig halten würden. Und sie waren sich völlig sicher gewesen, eben damit für alle Fälle vorgesorgt zu haben, und jetzt kam ich hier inmitten einer Sandlawine den Hang heruntergerodelt, Vorderräder voll eingeschlagen und trotzdem mehr oder weniger direkt auf sie zu. Ich zog kurz, ganz kurz die Handbremse, das Heck begann wie erhofft auszuschwenken und hörte dann, anders als erwartet, nicht wieder auf. Wir drohten, breitseits bis in den Straßengraben zu rutschen, wo sie mich dann nur noch aus dem Auto zu pflücken brauchten, also lenkte ich bis zum Anschlag gegen, trat das Gas in kurzen Stößen und zwang den Wagen mehr als dass ich ihn steuerte in eine schräge Linie zur Straße hinab. Ich zielte auf die Rückseite der Blockade, bekam unter Rütteln der Hinterachse und Fontänen von Sand gerade genug Fahrt drauf, um den Graben in flachem Winkel zu queren, fühlte Asphalt unter die Räder wachsen und presste das Pedal auf den Boden wie schon lange nicht mehr. Noch immer kamen keine Kugeln durch Glas oder Blech geknallt. Dritter Gang, und ich geriet jetzt sehr schnell außer Reichweite, sollten sie mir doch noch ein paar hinterherjagen.
Verraten, verkauft, verdammt, drauf und dran, mit dem Klappspaten erschlagen und in der nächsten Düne verscharrt zu werden. Ha! Dem war ich entkommen. Eigentlich, der Vernunft gehorchend, hätte ich mich stellen können. Doch ich war es gewesen, der die fünfundzwanzig Kilo angeliefert hatte, und das bedeutete mit Sicherheit erst mal Überstellung in U-Haft. In französische U-Haft. Mitsamt meinem Wissen über eine in den Drogenschmuggel verwickelte französische Eliteeinheit und ihre Geschäftsbeziehungen zur Marseiller Mafia. Es gibt, alles in allem, rosigere und, tja, wie soll ich sagen, längerfristige Zukunftsaussichten. Hinzu kam der kleine und doch so ernüchternde Nachgedanke, dass man mir auch unter Verweis auf ausgestandene Mühen, Härten und Gefahren wohl kaum gestatten würde, den fetten sechsstelligen Betrag in den beiden Kühlboxen für mich zu behalten. Also blieb ich voll am Gas, während sie hinter mir hektisch auf Motorräder und in Autos sprangen. Scheinwerfer leuchteten in meinen Spiegeln auf, doch immer noch kein Mündungsfeuer. All das Geballer ist doch eher was fürs Fernsehen. Die Situation war einfach zu undurchsichtig. Wer war ich? Ein Verdächtiger, oder ein zufälliger Augenzeuge? War ich allein oder hatte ich andere Personen mit im Auto? All das musste erst einmal geklärt und dann ein Befehl zum Schießen erteilt werden. Bis dahin jagte ich davon in die Nacht. Verfolgt von der französischen Staatsmacht und den sicherlich nicht unbedingt besten Wünschen der auf dem Parkplatz Zurückgebliebenen. Dabei konnten sie noch nicht mal meckern. Das Heroin zumindest hatte ich ihnen dagelassen.
*
»Wo ist der Haken?«, fragte ich. Äußerlich machte der Jetski einen neuwertigen Eindruck, der sich allerdings nicht im Preis widerspiegelte. Bisschen sehr günstig.
»Er springt im Moment nicht an«, antwortete Walter, Inhaber von West Coast Marina, dem größten Bootshandels- und Lagerbetrieb der ganzen Gegend. Walter ist gebürtiger Gelsenkirchener mit einer Vorliebe für überweite Hemden mit halbem Arm und Bügelfalten. Die Saison für ihn war eigentlich vorbei, Walter schon längst auf dem Sprung in sein südspanisches Winterdomizil, doch nicht ohne vorher noch zu versuchen, mir ein paar schnelle Scheine aus dem Kreuz zu leiern.
»Im Moment«, echote ich, und er nickte ein paarmal öfter als nötig.
»Vermutlich nur die Kerzen.«
»Aber sicher. Zehn Minuten Schrauben und das Ding rennt wieder. Walter, wofür hältst du mich?«
Er wurde ein wenig lebhaft. »Jetzt sieh doch mal, Nepomuk: Ein RXP, keine zweihundert Betriebsstunden auf der Uhr, fuffzehnhundert Kubik, Kompressor, zweihundertfuffzehn PS, noch ohne die verdammte Speed-Abriegelung, und es ist ein echter Sea-Doo, keine nachgebaute Scheiße aus China.«
»Ich suche eigentlich einen von Yamaha«, log ich.
»Mit Hänger!«
»Walter, ein Jetski, der nicht anspringt, ist nichts anderes als eine überteuerte Boje.«
Er rang mit sich, oh wie er mit sich rang. Es war geradezu rührend anzuschauen. Abraham, drauf und dran seinen eigenen Sohn abzuschlachten, er kann nicht beeindruckender mit sich gerungen haben. Schließlich ließ er mir fünfhundert nach, und ich schlug ein. War reell betrachtet wahrscheinlich immer noch zu teuer, aber ich wusste, wie und wo ich günstig an Teile für das Ding kam. Und ich brauchte ein zweites Standbein. Eusebio war launisch, und sein Arbeitsaufkommen schwankend wie die Gezeiten.
»Aber du musst ihn heute noch bezahlen und abholen. Ich sperre zu und fliege morgen früh nach Marbella.«
»Gib mir ’ne Stunde.«
*
Niemand mehr im Rückspiegel. Keine Scheinwerfer, kein Blaulicht, nichts, nur beruhigende Schwärze. Ich wollte gerade aufatmen, gerade versuchen, meinen Puls ein paar Beats runterzuregulieren, da überholte mich – Fünfter drin nach dem nächsten reifenkreischenden Abbiegemanöver auf eine weitere mehr oder weniger schnurgerade, wenn auch schmale und holprige Landstraße – ein Hubschrauber. Im Gegensatz zu dem mattschwarzen Monstrum am Strand war dieser hier in glänzendem Dunkelblau lackiert und weiß mit ›Police‹ beschriftet. Ich sah kurz seine Flanke, als er mich einmal umkreiste, bevor er seinen Suchscheinwerfer auf meine Heckscheibe ausrichtete und anschließend den Schatten des Toyotas fast schon spielerisch vor mir über den Asphalt tanzen ließ. Ich blieb auf dem Gas, auch wenn das bedeutete, dass ich bei jedem entgegenkommenden Fahrzeug das Lenkrad packen musste, bis meine Fingerknöchel weiß durch die Haut schimmerten. Nicht unbedingt für französische Landstraßen gemacht, die japanischen Fahrwerke aus den Siebzigern.
Gleichzeitig redete ich mir gut zu. Polizeihubschrauber haben keine Bordkanonen, und dass sich da oben einer aus der Tür lehnte, um auf mich zu feuern, war irgendwie nicht ernsthaft zu erwar…
›KTACKKK!‹ stach etwas durch das Dach und schlug in den Beifahrersitz, dass der Staub nur so aufstieg. Mein Puls schnellte hoch, bis ich ihn hören konnte, ein rasendes, dumpfes Stakkato, wie eine Basstrommel mit Keith Moons Fuß auf dem Pedal.
Den Schießbefehl, wurde mir mit einiger Hitze bewusst, hatte man inzwischen offensichtlich erteilt. Der rote Toyota mit dem Verdächtigen am Steuer war mit allen Mitteln am Entkommen zu hindern. Mit allen Mitteln.
Baumkronen! Ich musste mich so schnell wie möglich unter Bäume flüchten, wollte ich weitere Zielübungen von oben verhindern. Doch selbst wenn mir das gelang, gab die Hubschrauberbesatzung natürlich meine wechselnden Positionen an die Kollegen am Boden weiter. Zumindest, solange sie konnten, solange sie mich im Blick behielten. Das war die Problemstellung, und sie war heftig, in diesem riesigen, ehemaligen Sumpfgebiet, dieser dünnbesiedelten, total platten Gegend. Keine Brücken, keine Tunnel, keine Unterführungen, keine Parkhäuser und somit nichts, rein gar nichts, um sich und sein Auto einer Überwachung aus der Luft zu entziehen. Also nur und bestenfalls Baumkronen, da, wo der Pinienwald alt genug war und dicht genug wuchs. Ich bremste brachial, riss den Wagen in einen Forstweg und schaltete sofort die Scheinwerfer aus. Im ersten Moment sah ich nichts, nur durch Lücken im Geäst stechende Lichtfinger, meinte aber, irgendwo über mir jemanden hämisch auflachen zu hören.
Der Sattel quietschte leise vor sich hin, das Vorderrad eierte mit nahezu handbreitem Seitenausschlag, die Kette übersprang immer mal wieder klackend einen Zahn. Seit Tagen schon wollte ich sie ölen und vergaß es dann wieder. Meine kleine grüne Gazelle litt, wie es aussah, unter einem leichten Wartungsstau. Quietschend, eiernd, klackend strampelten wir in gemächlichem Tempo Jerusalés Hauptstraße hinunter, die am Strand entlangführende Avenida da Constituição, auch liebevoll ›Avenida Dada‹ genannt. Auf Höhe der Mulholland Bar stoppte das Rad von ganz allein und lehnte sich mit einem Pedal auf den Bordstein. Ein paar Schritte nur, und ich hockte an Danielos Tresen. Danielo heißt eigentlich Daniel, ist Ire mit schwarzen Haaren und dieser herausfordernden irischen Männlichkeit, die mich früher immer gereizt hat, der ich mittlerweile aber wesentlich entspannter begegne. Jeder, wie er will, jeder, wie er kann.
Eine sorgfältig in eine Papierserviette gewickelte Flasche Cristal in der Hand, sah ich mich mit der Zufriedenheit um, wie sie sich gern am Ende einer langen Woche harter Maloche einstellt.
Zu Füßen des Hotel Mar an eine Straßenecke geschmiegt, ist die Mulholland Bar die Kneipe mit dem gemischtesten Publikum in Jerusalé. Also noch nicht völlig von ausschließlich Surfern mit Kapuzensweatern und Schlabbershorts oder Bootstypen mit Weltumsegler-Gehabe übernommen, und Danielo sei Dank auch nicht von Horden semi-deliriöser Briten oder Ostgoten.
Du kannst hier in Arbeitsklamotten oder Abendanzug dein Bier trinken, niemand stört sich dran, und so muss es sein.
Die Fenster der Bar, im Sommer meist weit geöffnet, waren zu, der Himmel draußen über der Bucht mehr grau als blau, der Wind böig. Obwohl die Temperaturen weiterhin ungewöhnlich hoch waren, trübte das Wetter ein, kündigte sich der Winter an. Mir war’s, ehrlich gesagt, ganz recht. Als gebürtiger Ruhrpöttler, gewohnt an rund dreihundert Tage grauesten Graus da oben pro Jahr, hätte ich mir niemals träumen lassen, dass es auch so etwas wie zu viel schönes Wetter geben könnte. Doch der Sommer hier hatte mir die Haut gegerbt, bis ich mich zu fühlen begann wie ein Stück Dörrfleisch. Also sah ich sinkenden Temperaturen und steigenden Niederschlägen mit einiger Gelassenheit entgegen. Brennholz hatte ich auch schon gehackt, und mit dem Winter und seinen Stürmen begann in Jerusalé obendrein die ›zweite Saison‹, an der ich ein wenig mitzuverdienen gedachte. Das brachte meine Gedanken zurück zu dem Jetski, den ich noch abholen musste.
Ich legte etwas Kleingeld auf die Theke und wollte mich verabschieden, doch ein Blick nach draußen ließ mich zögern.
»Danielo«, sagte ich, »kennst du den Typen da drüben? Den mit der Tinte im Genick, der mit den beiden Nutten auf der Parkbank spricht?«
»Kennen ist zu viel gesagt.« Danielo strich mein Geld ein, warf eine der Münzen in die Trinkgeldschale. »Warte mal, wie heißt der noch? Chris? Ja, Chris. Warum?«
»Was weißt du über ihn?«
»Hausverbot, bei mir. Ständig dicht. Meth, Alk, Klebstoff, was weiß ich. Angeblich Zuhälter der alleruntersten Schiene, schnorrt, klaut, dealt ein bisschen. Ich hoffe nur, du hast nicht vor, bei ihm etwas zu kaufen. Nepomuk, wenn du Drogen willst, frag mich.«
Ich sah ihn an. Er blickte schläfrig zurück. Danielo blickt immer schläfrig drein, doch das ist nur Show. Als – und ich kann das beurteilen – geborener Barkeeper, hatte er erst eine Karriere als Surfer gegen den besser bezahlten Job eines Models getauscht, bis ihm eines Tages die Lust am Posieren vergangen war und er kurzentschlossen die Mulholland Bar übernommen hat. Und sie steht ihm gut, wenn man das so sagen kann. Mit seinem Schopf dunkler Locken und dem ewigen Schlafzimmerblick, mit seiner ruhigen, nachdenklichen Art besitzt er einen Magnetismus, der weit über das Erotische hinausgeht. Selbst wer nicht mit ihm ins Bett will, möchte zumindest unbedingt mit ihm befreundet sein. Nachdem unser sexuelles Desinteresse aneinander schon mit der ersten Begrüßung geklärt war, hatten Danielo und ich uns ziemlich rasch auf die zweite Option verständigt.
»Kannst du mir sonst noch etwas über den Typen erzählen? Egal was?«
»Nur unter uns, aber warum interessiert dich der Penner?«
»Er versucht, mir und den Jungs von der Werft Schwierigkeiten zu machen. Das will ich, tja, unterbinden.«
»Ich weiß nur, dass er Jorge, deinem Vermieter, ab und zu dabei hilft, Schulden einzutreiben und säumige Zahler an die Luft zu setzen. Dafür lässt der ihn umsonst in einer seiner Mietbaracken hausen, drüben in der Favela.«
»Urgs.«
Danielo nickte und glitt davon, andere Gäste versorgen.
›Favela‹ nennt sich ein typisches Sozialbau-Viertel, nicht weit von Jerusalé im Schatten einer Autobahnbrücke vor zig Jahren in der scheinbar universell unausweichlichen Scheußlichkeit hastig hochgezogen und dann wie selbstverständlich vom ersten Tag an der Verwahrlosung überlassen. Kurz nach meiner Ankunft hatte ich mich da mal vorsichtig nach einer Wohnung umgesehen und war schaudernd geflüchtet. Das Furchtbare an solchen Vierteln ist ihre Saugkraft, die an Treibsand erinnert. Bist du einmal dort gelandet, kannst du dich abmühen, wie du willst, sie lassen dich nicht wieder los, sondern ziehen dich weiter und weiter hinein und nuckeln dir nebenbei so ganz allmählich das Mark aus den Knochen. Als Favela-Bewohner giltst du automatisch als ambitionslos und arbeitsscheu, und selbst wenn du es trotzdem schaffst, einen Job zu finden, ist die Bezahlung dann unweigerlich so bemessen, dass du dir einen Umzug in eine bessere Gegend komplett aus dem Kopf schlagen kannst. Saugkraft, ich sag’s doch.
Danielo kam wieder an mein Ende des Tresens gedriftet.
»Du hast nicht zufällig seine genaue Adresse?«, fragte ich.
Er schüttelte den Kopf. »Und ich würde an deiner Stelle nichts überstürzen. So ein Typ wie Chris zieht sowieso weiter, sobald er sich irgendwo genug Feinde gemacht hat. Manchmal ist Warten das Klügste.«
Chris, dachte ich, trat raus auf die Straße und schwang ein Bein über meine Gazelle. Okay, Chris, ich will klug sein und warte. Ich geb dir bis morgen.
*
Unterführungen haben sie nicht im französischen Aquitaine, Parkhäuser schon gar nicht, auch keine verwirrend angelegten Industriegebiete voller Rohrleitungen, Hallen und Kräne. Kurz, keine Deckung. Doch was sie hier haben – vor allem in sternklaren Nächten, wenn der sandige Boden sehr rasch auskühlt, während sich die Meeresluft warm und feucht darüberwälzt – sind Nebelbänke. Aber holla.
Der Forstweg war in die nächste Landstraße gemündet, und ich hatte die Scheinwerfer wieder an und den Fünften erneut drin und den Hubschrauber nach wie vor im Nacken. Sein Lichtkegel klebte auf meinen Dach und leuchtete in allen Scheiben, als sich mit einem Mal die graue Wand vor mir aufbaute. Im nächsten Augenblick war ich drin. Und ging sofort vom Gas. Sicht rundum: knapp über Armlänge, dann wabernde graue Watte. Scheinwerfer aus. Gang raus. Handbremse gezogen, um ein Aufleuchten der Bremslichter zu vermeiden. Motor aus. Scheibe runter. Kopf raus.
Anstatt mit vollem Tempo weitergeflogen zu sein, stand der verfluchte Hubschrauber direkt über mir, über dem Nebel, unsichtbar, aber unüberhörbar.
Eine Infrarotkamera, vermutete ich, im Zentrum der Linse mein rotgelb leuchtender Sechzehnhunderter. Einen kurzen Moment vollkommen entnervter Ratlosigkeit lang presste ich meine Stirn gegen den Lenkradkranz, dann startete ich den Motor und klopfte den Ersten rein. Weiter. Einfach in Bewegung bleiben. Denn Stillstand, so heißt es doch immer, ist der Tod.
*
Mit dem Fahrrad auf der Schulter erklomm ich die Stufen zur Plattform. Die Eingeborenen nennen den Schrägaufzug ›Titia‹, also ›Tantchen‹. Er ist ein Relikt aus der Zeit vor dem Bau des Wellenbrechers, als die Bucht noch unbewohnt war, nur ein Strand, auf dem die Fischer ihre Boote hochzogen und sich Sommerfrischler in der Sonne aalten. Dann hat man den Hafen angelegt und die Bucht nach und nach mit maritimer und touristischer Infrastruktur bebaut. Das Tantchen führt hinauf auf den steilen, zum Meer hin schroffen Hügel im Norden, auf dem noch das alte Fischerdorf steht, mittlerweile umgeben von einem Golfplatz und dem ›TrailerPark‹, einem für Reisemobile reservierten Campingplatz mit einer unauffällig großzügig über das Areal verteilten Ansammlung alter Wohnwagen, sehr beliebt bei den örtlichen Sem Papéis. Zum einen ignorieren die TrailerPark-Besitzer die behördliche Meldepflicht, zum anderen heißt die einzige bezahlbare Alternative ›Favela‹. So ein Leben im Wohnwagen mag seine Nachteile haben, aber zumindest muss man da nicht jede zweite Nacht mitanhören, wie in der unmittelbaren Nachbarschaft jemand abgestochen oder vergewaltigt wird.
Es gibt auch eine Straße hoch auf den Hügel, doch sie schlägt in Serpentinen einen weiten Bogen durchs Inland. Und dann existiert noch ein Klippenpfad vom Strand hoch, der aber einen alpinistischen Schwierigkeitsgrad hat, dessen Beschreibung mit ›Nur für erfahrene und entsprechend ausgerüstete …‹ beginnt. Blieb das Tantchen mit all seinem angejahrten Charme, den Scherengittertüren, Holzbänken und einem der Obskurität überlassenen Wartungszustand.
Auf der Plattform traf ich Yesus wieder, zwei Einkaufstüten zu seinen Füßen. Die eine, einzige, auf Stelzen stehende Kabine des Tantchens war noch unterwegs, wir mussten warten.
»Fährst du morgen nach Figueras?«, fragte er. Yesus heißt mit vollem Namen eigentlich Monteyesus, was für einen im Arbeitsalltag häufig gebrauchten Vornamen nun wirklich ein paar Silben zu lang ist. Für die Kollegen aus französischsprachigen Ländern ist er deshalb ›Monpti‹, kurz für ›Mon Petit‹, also ›Mein Kleiner‹, für die anderen, die den Witz nicht recht kapieren, Yesus.
»Am Nachmittag«, antwortete ich. »Willst du mit?«
Er nickte. Wegen der vielen Immigranten in schlechtbezahlten aber stundenintensiven Jobs hier in der Gegend hat das Büro von Western Union in Figueras auch sonntags geöffnet. Zusammen mit einer ganzen Anzahl kleinerer Läden für den täglichen Bedarf, auch wenn man bei den meisten erst mal an der Tür klopfen muss. »Ich zahle auch das Benzin.« Yesus muss jeden Sonntag nach Figueras, um einen Teil seines Lohns an seine Familie in Eritrea zu überweisen.
»Diesel«, korrigierte ich ihn. »Und du brauchst mir kein Geld zu geben. Ich muss sowieso in die Stadt.« Den Diesel bezog ich von der Werft. Allein aus der abgewrackten Fähre hatten wir noch fünfhundert Liter rausgepumpt.
»Aber …«
»Doch du könntest mir gleich ein bisschen zur Hand gehen«, schlug ich vor. Yesus will nichts umsonst, genau wie ich.
»Gut«, fand er. »Und anschließend isst du bei mir.«
Der Aufzug kam die Schräge heruntergerumpelt und zu einem polternden Stillstand.
»Ich fürchte, ich bin heute Abend schon verabredet.«
»Mit wem?«
Wir stiegen ein, ich lehnte das Fahrrad gegen eine der Sitzbänke und Yesus drückte den Startknopf. Nach einer etwa halbminütigen Bedenkzeit, gerade lang genug, um milde Zweifel an seiner Funktionstüchtigkeit aufkommen zu lassen, setzte sich der Aufzug mit dem gewohnten Ruck in Bewegung.
»Mit rund zwanzig Bieren«, gestand ich.
Yesus schüttelte missbilligend den Kopf, sagte aber nichts weiter.
Ein weiterer Ruck, und wir waren da.