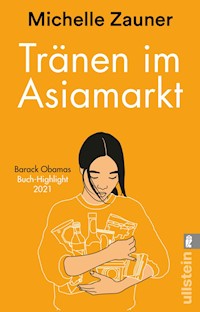
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Als Michelle mit Mitte zwanzig erfährt, dass ihre Mutter an Krebs erkrankt ist, steht die Welt für sie still. Sie lässt ihr bisheriges Leben in Philadelphia zurück und kehrt heim nach Oregon, in ihr abgelegenes Elternhaus, um ganz für ihre Mutter da zu sein. Doch schon ein halbes Jahr später stirbt die Mutter. Michelle begegnet ihrer Trauer, ihrer Wut, ihrer Angst mit einer Selbsttherapie: der koreanischen Küche. Sie kocht all die asiatischen Gerichte, die sie früher mit ihrer Mutter aß und erinnert sich dabei an die gemeinsame Zeit: an das Aufwachsen unter den Augen einer strengen und fordernden Mutter; an die quirligen Sommer in Seoul; an das Gefühl, weder in den USA noch in Korea ganz dazuzugehören. Und an die Körper und Seele wärmenden Gerichte, über denen sie und ihre Mutter immer wieder zusammengefunden haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Tränen im Asia-Markt
Die Autorin
MICHELLE ZAUNER wuchs als einziges Kind einer koreanischen Mutter und eines amerikanischen Vaters im Bundesstaat Oregon auf. Als Indie-Musikerin brachte sie unter dem Namen Japanese Breakfast 2016 ihr Debütalbum heraus. An den viralen Erfolg ihres New Yorker-Artikels, in dem sie den Tod ihrer Mutter verarbeitet, schließt Zauner nun mit ihrem ersten Buch, Tränen im Asia-Markt, an.
Das Buch
»Ihre Erziehungsmethode ›Tough Love‹ zu nennen, wäre eine Untertreibung. Ihre Liebe war nicht streng, sie war geradezu brutal. Eine zähe Liebe, die nie auch nur einem Anflug von Schwäche nachgab. … Das Einzige, das man ihr vorwerfen konnte, war, dass sie sich zu sehr sorgte. Das wird mir erst jetzt, im Rückblick, klar. Niemand auf der ganzen Welt würde mich je so sehr lieben wie meine Mutter, und sie würde nicht zulassen, dass ich das jemals vergaß.«Aus der Trauer über den Tod ihrer Mutter heraus hat Indie-Rockstar Michelle Zauner eine Coming-of-Age Geschichte geschrieben, die wunderbar besonders und zugleich universell berührend ist. Ihr Buch ist eine Liebeserklärung an die Person, die sie geformt und gefordert, gereizt und geliebt hat wie keine zweite – und zeigt, dass der Einfluss und die Liebe der eigenen Mutter weit über deren Tod hinausreichen.
Michelle Zauner
Tränen im Asia-Markt
Eine Geschichte von Trauer, Liebe und koreanischem Essen
Aus dem Amerikanischen von Corinna Rodewald
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Die Arbeit der Übersetzerin am vorliegenden Text wurde im Rahmen des Programms »NEUSTART KULTUR« aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel Crying in H Mart: A Memoir bei Alfred A. Knopf, New York
© 2021 by Michelle Zauner© der deutschsprachigen AusgabeUllstein Buchverlage GmbH, Berlin 2021Umschlaggestaltung: zero-media.net, München Umschlagillustration: © Mel Four, Picador Art Department Autorinnenfoto: © Barbora MrazkovaE-Book-Konvertierung powered by pepyrusAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-8437-2617-7
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
1 Tränen im Asia-Markt
2 Heb deine Tränen auf
3 Doppelte Lidfalte
4 New-York-mäßig
5 Wo ist der Wein?
6 Dunkle Materie
7 Medizin
8 Unni
9 Wo gehen wir hin?
10 Leben und Sterben
11 Von welch ungestümer Großartigkeit strotzt du nur so
12 Law and Order
13 Eine schwere Hand
14 Wundervoll
15 »My Heart Will Go On«
16 Jatjuk
17 Kleine Axt
18 Maangchi und ich
19 Kimchi-Kühlschrank
20 »Coffee Hanjan«
Dank
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
1 Tränen im Asia-Markt
Widmung
1 Tränen im Asia-Markt
Seitdem meine Mutter gestorben ist, weine ich im Asia-Markt. Genauer gesagt im H Mart.
Der H Mart ist eine koreanisch-amerikanische Supermarktkette, die sich auf asiatische Lebensmittel spezialisiert hat. Das H steht für »Han Ah Reum«, eine koreanische Wendung, die sich in etwa mit »ein Arm voll Lebensmittel« übersetzen lässt. Im H Mart scharen sich allein in die USA gekommene junge Leute, um genau die Marke Instantnudeln aufzutreiben, die sie an zu Hause erinnert. Hier kaufen koreanische Familien Reiskuchen für Tteokguk ein, die Suppe, die an Neujahr serviert wird. Nur hier gibt es ein riesiges Fass voller geschälter Knoblauchzehen, denn nur hier weiß man, welche Unmengen an Knoblauch für das Essen aus der Heimat tatsächlich benötigt werden. H Mart bedeutet, aus dem einen Gang im normalen Supermarkt auszubrechen, der mit »Internationale Feinkost« beschriftet ist. Hier stellen sie keine Bohnen von Goya neben die Sriracha-Sauce. Stattdessen kann man mich bei den Kühlschränken voll Banchan-Beilagen finden, weinend, weil ich mich an die Eier in Sojasauce und die kalte Rettichsuppe meiner Mutter erinnere. Oder man sieht mich bei den Tiefkühltruhen mit einer Packung Dumplingteig in der Hand und in Gedanken bei all den Stunden, die Mom und ich am Küchentisch damit verbracht haben, Gehacktes vom Schwein und Schnittlauch in den dünnen Teig einzuwickeln. Oder wie ich bei den Trockenwaren schluchze und mich frage, ob ich überhaupt noch als Koreanerin durchgehe, wenn ich niemanden mehr anrufen kann, um zu fragen, welche Marke Seetang wir immer gekauft haben.
Als Tochter eines weißen Amerikaners und einer Koreanerin verließ ich mich auf meine Mutter, was den Zugang zu unserem koreanischen Erbe betraf. Obwohl sie mir nie das Kochen beigebracht hat (Koreanerinnen haben einen Hang dazu, Abmessungen abzulehnen und lediglich kryptische Anweisungen zu geben wie »gib so viel Sesamöl dazu, bis es schmeckt wie bei Mom«), hat sie mir doch ein sehr koreanisches Essverhalten beigebracht. Dazu gehört es, gutes Essen zu verehren, und der Hang dazu, gefühlsabhängig zu essen. Wir waren bei allem eigen: Kimchi musste genau richtig sauer sein, Samgyeopsal vollendet knusprig; Eintöpfe mussten kochend heiß sein, sonst waren sie praktisch ungenießbar. Das Konzept, Gerichte für die Woche vorzukochen, war ein Affront gegen unseren Lebensstil. Wir gingen unserem Verlangen täglich nach. Wenn wir drei Wochen lang Kimchi-Eintopf wollten, dann aßen wir drei Wochen lang Kimchi-Eintopf, bis uns ein neues Verlangen überkam.
Wir ließen uns von Jahreszeiten und Feiertagen leiten. Wenn der Frühling kam und es wärmer wurde, stellten wir draußen unseren Campingkocher auf und brieten frische Schweinebauchstreifen auf der Terrasse. An meinem Geburtstag aßen wir Miyeokguk – eine kräftige, nährstoffreiche Seetangsuppe, die Frauen nach der Entbindung empfohlen wird und die man in Korea zu Ehren der Mutter traditionell an Geburtstagen isst.
Durch Essen drückte meine Mutter ihre Liebe aus. Egal, wie kritisch oder grausam sie mir mit ihrem ständigen Drängen und ihren erbitterten Erwartungen erschien – ich spürte stets, wie mir ihre Zuneigung aus den Lunchpaketen, die sie packte, und aus den Mahlzeiten, die sie genau nach meinen Vorlieben zubereitete, entgegenstieg. Ich spreche nur ein paar Brocken Koreanisch, aber im H Mart kommt es mir vor, als könnte ich es fließend. Ich streichle die Produkte und sage laut ihre Namen – Chamoe-Melonen, Danmuji. In meinem Einkaufswagen landen Snacks, auf deren glänzender Verpackung vertraute Zeichentrickfiguren auftauchen. Ich denke an damals, als Mom mir zeigte, wie man die kleine Plastikkarte, die in einer Tüte Jolly Pong steckt, zu einem Löffel faltet, mit dem ich mir dann den Karamell-Puffreis in den Mund schaufeln konnte, und wie der Reis dabei unweigerlich auf meinem T-Shirt landete und sich im ganzen Auto verteilte. Ich denke daran, wie Mom mir von den Süßigkeiten erzählte, die sie als Kind gegessen hatte, und wie ich versuchte, mir meine Mutter in meinem Alter vorzustellen. Ich wollte alles mögen, was sie mochte, wollte sie voll und ganz verkörpern.
Meine Trauer kommt in Wellen und wird in der Regel von etwas Willkürlichem ausgelöst. Ich kann davon erzählen, wie ich zusah, als meiner Mutter in der Badewanne die Haare ausfielen, ohne eine Miene zu verziehen, oder von den fünf Wochen berichten, die ich in Krankenhäusern übernachtet habe, aber wenn irgendein Kind im H Mart mit den Händen voll Ppeongtwigi-Tüten an mir vorbeirennt, breche ich zusammen. Die kleinen Frisbees aus Puffreis waren meine Kindheit, die glücklichere Zeit, als Mom noch da war und wir nach der Schule die styroporähnlichen Scheibchen knabberten, sie auseinanderbrachen, als würden wir Erdnüsse knacken, und sie dann auf der Zunge zergehen ließen wie Zucker.
Ich weine, wenn ich im Food-Court eine koreanische Großmutter sehe, die Nudelsuppe mit Meeresfrüchten isst und ihre Garnelenköpfe und Muschelschalen auf dem Metalldeckel neben der Reisschale ihrer Tochter ablegt. Das graue Haar kraus, die Wangenknochen hervorstehend wie zwei Pfirsiche, tätowierte Augenbrauen, deren Farbe rostet. Dann frage ich mich, wie meine Mutter mit siebzig ausgesehen hätte, ob auch sie schließlich die gleiche Dauerwelle getragen hätte wie alle anderen koreanischen Großmütter, als wäre es ein evolutionäres Merkmal. Ich stelle mir vor, wie wir, die Arme untergehakt, auf der Rolltreppe zum Food-Court stehen, ihre schmale Gestalt an meine gelehnt. Beide ganz in Schwarz gekleidet, »New-York-mäßig«, würde sie sagen, denn ihr Bild von New York entsprach noch immer der Ära, in der Frühstück bei Tiffany spielt. Sie würde die Chanel-Handtasche aus gestepptem Leder tragen, die sie sich ihr Leben lang gewünscht hatte, und nicht eine von den Imitaten, die sie irgendwo auf der Straße in Itaewon erstanden hatte. Ihre Hände und ihr Gesicht wären ein wenig klebrig von einer Antifaltencreme aus den Dauerwerbesendungen auf QVC. An den Füßen würde sie irgendwelche merkwürdigen hohen Sneakers mit Keilabsatz tragen, mit denen ich mich nicht anfreunden könnte. »Michelle, in Korea tragen alle Promis die.« Sie würde Fusseln von meinem Mantel zupfen und auf mir herumhacken – wie krumm ich stünde, dass ich neue Schuhe bräuchte, dass ich wirklich damit anfangen sollte, das Arganöl-Pflegeprodukt zu benutzen, das sie mir gekauft hatte –, aber wir wären zusammen.
Wenn ich ehrlich bin, ist da eine Menge Wut. Ich bin wütend auf diese alte koreanische Frau, die ich nicht einmal kenne, weil sie lebt, aber meine Mutter nicht, als hätte das Weiterleben dieser Fremden irgendetwas mit meinem Verlust zu tun. Weil jemand, der so alt ist wie meine Mutter, selbst noch eine Mutter haben kann. Warum sitzt sie hier und schlürft ihre scharfen Jjampong-Nudeln, aber meine Mutter nicht? Anderen Menschen muss es da gehen wie mir. Das Leben ist ungerecht, und gelegentlich hilft es, wenn ich auf irrationale Weise jemandem die Schuld dafür gebe.
Manchmal fühlt sich meine Trauer an, als hätte man mich in einem Zimmer ohne Türen allein gelassen. Jedes Mal, wenn ich mich daran erinnere, dass meine Mutter tot ist, kommt es mir vor, als würde ich gegen eine Wand prallen, die nicht nachgibt. Es gibt kein Entkommen, nur eine harte Oberfläche, gegen die ich immer wieder stoße und die mich an die unabänderliche Tatsache erinnert, dass ich meine Mutter niemals wiedersehen werde.
H Marts befinden sich üblicherweise am Stadtrand und bilden das Herzstück von Einkaufsstraßen mit asiatischen Schaufensterfronten und Restaurants, die immer besser sind als im Stadtzentrum. Die koreanischen Restaurants hier beladen die Tische so reichlich mit Banchan-Beilagen, dass man nicht anders kann, als eine endlose Runde horizontales Jenga mit zwölf Schälchen voller gebratener Anchovis, gefüllter Gurken und allem, was es sonst an Eingelegtem gibt, zu spielen. Nicht wie in dem traurigen Laden mit asiatischer Fusionsküche bei der Arbeit um die Ecke, wo sie Paprika ins Bibimbap tun und dich empört angucken, wenn du fragst, ob du noch ein paar welke Sojasprossen bekommen könntest. Hier gibt’s das richtige Zeug.
Du wirst merken, dass du auf dem richtigen Weg bist, denn Zeichen werden dich auf deiner Pilgerreise leiten. Die Schriftzüge an den Vordächern werden sich allmählich in Symbole verwandeln, die du vielleicht lesen kannst, vielleicht auch nicht. Ab hier werden meine Koreanischkenntnisse, die auf dem Niveau einer Grundschülerin stehen geblieben sind, auf die Probe gestellt – wie schnell kann ich die Vokale im Vorbeifahren aussprechen? Über sechs Jahre lang bin ich jeden Freitag zum Koreanischunterricht zur Hangul Hakkyo gegangen, und mehr habe ich nicht vorzuweisen. Ich kann die Schilder lesen, die auf Kirchen aufmerksam machen, auf einen Optiker, eine Bank. Noch ein paar Straßen weiter, und wir befinden uns mittendrin. Auf einmal sind wir in einem anderen Land. Alle hier sehen asiatisch aus, unterschiedliche Dialekte schwirren hin und her wie unsichtbare Telefonkabel, die einzigen englischen Begriffe sind »hot pot« und Namen von Spirituosenmarken, und selbst die sind vergraben unter einer Ansammlung von Hieroglyphen und Graphemen, neben denen ein Anime-Tiger oder ein Hot Dog ein Tänzchen aufführt.
In einem H Mart gibt es außer der Lebensmittelabteilung auch einen Food-Court, einen Laden für Haushaltsgeräte und eine Apotheke. Normalerweise gibt es zudem einen Make-up-Tresen, an dem man koreanische Kosmetik und Hautpflegeprodukte mit Schneckenschleim oder Kaviarextrakt darin kaufen kann, oder eine Gesichtsmaske, die sich vage mit »Plazenta« brüstet. (Wessen Plazenta? Wer weiß das schon?) In der Regel gibt es auch eine pseudofranzösische Bäckerei mit wässrigem Kaffee, Bubble Tea und einer Auslage glänzenden Gebäcks, das immer viel besser aussieht, als es schmeckt.
Der H Mart, zu dem ich zurzeit gehe, liegt in Elkins Park, einer Stadt nordöstlich von Philadelphia. Meine Routine besteht darin, am Wochenende zum Mittagessen hinzufahren, meine Einkäufe für die Woche zu erledigen und mich von der frischen Fülle für das Abendessen inspirieren zu lassen. Der H Mart in Elkins Park hat zwei Etagen: Im Erdgeschoss befinden sich die Lebensmittel, im ersten Stock der Food-Court. Dort gibt es eine Auswahl an Ständen, die unterschiedliche asiatische Küchen anbieten. Bei einem bekommt man Sushi, ein anderer beschränkt sich strikt auf chinesisches Essen. Am nächsten gibt es klassische koreanische Jjigae, blubbernde Eintöpfe, serviert in traditionellen Steinguttöpfen, genannt Ttukbaegi, die als Kesselchen dienen und sicherstellen, dass die Suppe auch noch gut zehn Minuten nach dem Servieren brodelt. Es gibt einen Stand für koreanisches Streetfood, an dem man koreanische Ramen bekommt (im Grunde Instantnudeln von Shin Ramyun, in die man ein Ei geschlagen hat), riesige gedämpfte Dumplings aus einem dicken, kuchenähnlichen Teig gefüllt mit Schweinefleisch und Glasnudeln, außerdem Tteokbokki, klebrige, fingerdicke, längliche Reiskuchen, die in einer Brühe mit Fischkuchen, Chili und Gochujang zubereitet werden, einer süß-scharfen Paste, die zu einer der drei Hauptgewürzpasten gehört, die in quasi jedem koreanischen Gericht verwendet werden. Als Letztes noch mein persönlicher Favorit: koreanisch-chinesische Fusionsküche, bei der es Tangsuyuk gibt – Schweinefleisch mit glänzend-orangener süß-saurer Sauce –, Meeresfrüchte-Nudelsuppe, gebratenen Reis und Jajangmyeon, Nudeln mit schwarzer Sojabohnenpaste.
Während man salziges, fettiges Jajangmyeon herunterschlingt, kann man hier im Food-Court hervorragend Leute gucken. Ich denke an meine Verwandten, die in Korea lebten, bevor die meisten von ihnen gestorben sind, und daran, dass wir immer als Erstes Koreanisch-Chinesisch aßen, wenn meine Mutter und ich nach einem Vierzehn-Stunden-Flug in Seoul landeten. Zwanzig Minuten nachdem meine Tante unsere Bestellung per Telefon aufgegeben hatte, spielte die Türklingel »Für Elise« in MIDI, und ein Mann mit Helm, gerade vom Motorrad abgestiegen, kam mit einer gigantischen Stahlkiste die Treppe hoch. Oben angekommen, schob er den Deckel auf und überreichte uns bis obenhin gefüllte Schüsseln mit Nudeln und paniertem und frittiertem Schweinefleisch, die schwere Sauce extra. Die Klarsichtfolie darum wölbte sich nach innen und triefte vor Kondenswasser. Wir zogen die Folie ab, träufelten schwarze, dickflüssige Herrlichkeit über die Nudeln und gossen die klebrige, orange schimmernde Sauce über das Fleisch. Dann setzten wir uns im Schneidersitz auf den kühlen Marmorboden, griffen übereinander hinweg und schmatzten. Meine Tanten, meine Mutter und meine Großmutter plapperten auf Koreanisch, während ich aß und zuhörte, ohne etwas zu verstehen, und immer wieder meine Mom anstieß, damit sie für mich übersetzte.
Ich frage mich, wie viele der Menschen im H Mart wohl ihre Familie vermissen. Wie viele von ihnen an ihre Verwandten denken, während sie mit ihrem Tablett von den unterschiedlichen Ständen an einen Tisch gehen. Ob sie essen, um sich verbunden zu fühlen, um durch das Essen diese Menschen zu zelebrieren? Wer von ihnen konnte dieses Jahr nicht hinfliegen oder die letzten zehn Jahre nicht? Wem geht es wie mir, wer von ihnen vermisst die Menschen, die sich für immer aus seinem Leben verabschiedet haben?
An einem Tisch sitzt eine Gruppe junger chinesischer Studierender, allein und ohne Familie an Hochschulen in Amerika. Sie haben sich zusammengetan, um mit dem Bus eine Dreiviertelstunde aus der Stadt rauszufahren und in einem Vorort in einem fremden Land Suppen-Dumplings zu essen. An einem anderen Tisch sitzen drei Generationen koreanischer Frauen und essen unterschiedliche Arten von Eintopf. Tochter, Mutter und Großmutter tauchen ihre Löffel in die Schüsseln der jeweils anderen, greifen quer über den Tisch, die Arme den anderen vor der Nase, schnappen sich mit ihren Stäbchen etwas von allen Banchan. Hier hat niemand einen persönlichen Bereich, das Konzept existiert gar nicht.
Ein junger weißer Mann und seine Familie kichern bei ihren Versuchen, die Speisekarte zu lesen. Der Sohn erklärt seinen Eltern, welche Gerichte sie bestellt haben. Vielleicht war er für seinen Wehrdienst in Seoul stationiert oder hat im Ausland Englisch unterrichtet. Vielleicht ist er der Einzige in seiner Familie, der je einen Reisepass brauchte. Vielleicht ist das hier der Moment, in dem seine Familie beschließt, dass es an der Zeit ist, auf Reisen zu gehen und all das selbst zu entdecken.
Ein Asiate eröffnet seiner Freundin eine umwerfende neue Welt aus Geschmäckern und Konsistenzen. Er zeigt ihr, wie man Naengmyeon isst, eine kalte Nudelsuppe, die besser schmeckt, wenn man vorher noch Essig und heißen Senf hinzugibt. Er erzählt ihr, wie seine Eltern nach Amerika gekommen sind, wie er seiner Mutter dabei zugesehen hat, wenn sie zu Hause dieses Gericht zubereitete. Statt Zucchini hinzuzufügen, nahm sie Rettich. Ein alter Mann humpelt an ihnen vorbei, um den Hühnchen-Ginseng-Reistopf zu bestellen, den er vermutlich jeden Tag hier isst. Es läutet, wenn jemand seine Bestellung abholen soll. Hinter den Tresen arbeiten Frauen mit Sonnenvisoren unermüdlich.
Es ist ein wunderbarer, heiliger Ort. Eine Cafeteria voll Menschen aus der ganzen Welt, die in ein fremdes Land verpflanzt worden sind, jede Person mit einer eigenen Geschichte. Woher kommen sie und wie weit sind sie gereist? Warum sind sie alle hier? Um das Galgant aufzuspüren, das sonst kein Supermarkt in Amerika führt, weil sie das indonesische Curry kochen wollen, das der Vater so liebt? Um die Reiskuchen zu besorgen, die man braucht, um Jesa zu feiern und damit den Todestag eines Angehörigen zu begehen? Um an einem verregneten Tag dem Verlangen nach Tteokbokki nachzugeben, das durch die Erinnerung an einen betrunkenen Abend mit einem Mitternachtsimbiss unter dem Zeltdach eines Pojangmacha in Myeong-dong aufkam?
Wir reden nicht darüber. Wir werfen uns nicht einmal wissende Blicke zu. Wir sitzen schweigend da und essen. Aber ich weiß, dass wir alle aus demselben Grund hier sind. Wir sind auf der Suche nach einem Stück Heimat oder einem Stück unserer selbst. Wir suchen nach einem Anklang davon in dem Essen, das wir bestellen, und in den Zutaten, die wir einkaufen. Dann gehen wir wieder unserer Wege. Wir bringen unsere Ausbeute in unsere Wohnheime und Vorortküchen, und wir bereiten das Gericht zu, das ohne unseren Ausflug nicht möglich gewesen wäre. Was wir brauchen, bekommt man nicht in einem Trader Joe’s. Im H Mart trifft man unter einem duftenden Dach auf seine Leute, hier kann man sich darauf verlassen, dass man findet, was es sonst nirgendwo gibt.
Im Food-Court des H Mart finde ich auch mich selbst wieder, als ich nach dem ersten Kapitel der Geschichte forsche, die ich über meine Mutter erzählen möchte. Ich sitze neben einer koreanischen Mutter und ihrem Sohn, die sich nichtsahnend den Tisch neben der alten Heulsuse hier ausgesucht haben. Der Sohn holt pflichtbewusst das Besteck vom Tresen und legt es auf Papierservietten für sie beide bereit. Er isst gebratenen Reis, seine Mutter Seolleongtang, Ochsenknochensuppe. Er ist sicher schon Anfang zwanzig, aber seine Mutter belehrt ihn immer noch, wie er zu essen hat, genau wie meine Mutter es immer tat. »Tunk die Zwiebel in die Paste.« »Nimm nicht zu viel Gochujang, sonst wird es zu salzig.« »Warum isst du die Mungbohnen nicht?« An manchen Tagen nervte mich die ständige Nörgelei. Kann ich nicht einmal in Ruhe essen? Aber meistens war mir bewusst, dass dies für eine Koreanerin die höchste Zuneigungsbekundung war, und diese Liebe hielt ich in Ehren. Eine Liebe, für die ich alles geben würde, könnte ich sie jetzt wiederhaben.
Die Mutter des Jungen gibt Rindfleischstückchen von ihrem Löffel auf seinen. Er ist still und sieht müde aus und spricht kaum mit ihr. Ich möchte ihm sagen, wie sehr mir meine Mutter fehlt. Dass er nett zu seiner Mutter sein soll, das Leben ist schließlich zerbrechlich, und sie könnte jeden Augenblick weg sein. Sag ihr, sie soll zum Arzt gehen und untersuchen lassen, ob in ihr nicht auch ein kleiner Tumor wächst.
Innerhalb von fünf Jahren habe ich sowohl meine Tante als auch meine Mutter an Krebs verloren. Wenn ich also zum H Mart fahre, dann bin ich nicht bloß auf der Jagd nach Tintenfisch und drei Bund Frühlingszwiebeln für einen Dollar; ich suche nach Erinnerungen. Ich sammele Beweise dafür, dass der koreanische Anteil meiner Identität nicht mit ihnen gestorben ist. Der H Mart ist die Brücke, die mich von den Erinnerungen wegführt, die mich verfolgen, Erinnerungen an Chemo-Schädel und skelettartige Körper und Listen mit Milligramm von Hydrocodon. Der H Mart erinnert mich daran, wer die beiden vorher waren, wunderschön und voller Leben. Als sie sich Honigcrackerringe von Chang Gu auf alle zehn Finger steckten und damit wackelten. Als sie mir beibrachten, wie man eine Kyoho-Traube aus ihrer Schale lutscht und die Kerne ausspuckt.
2 Heb deine Tränen auf
Meine Mutter starb am 18. Oktober 2014, ein Datum, das ich mir nie merken kann. Ich weiß nicht, weshalb, ob es daran liegt, dass ich mich nicht erinnern will oder ob das genaue Datum so unwichtig erscheint bei allem, was wir durchgestanden haben. Sie war sechsundfünfzig Jahre alt. Ich war fünfundzwanzig, ein Alter, von dem mir meine Mutter schon seit Jahren versichert hatte, es würde etwas Besonderes werden. Sie selbst war fünfundzwanzig, als sie meinen Vater kennenlernte. In diesem Jahr heiratete sie, in diesem Jahr verließ sie ihr Heimatland, ihre Mutter und ihre beiden Schwestern und begann ein entscheidendes neues Kapitel in ihrem Erwachsenenleben. In diesem Jahr gründete sie die Familie, die sie schließlich ausmachte. Für mich sollte mit fünfundzwanzig eigentlich alles seinen Platz finden. Dann wurde es das Jahr, in dem das Leben meiner Mutter zu Ende ging und meins auseinanderfiel.
Manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich mich nicht genau daran erinnern kann, an welchem Tag es geschah. Jeden Herbst muss ich durch die Fotos scrollen, die ich von ihrem Grabstein gemacht habe, um das eingravierte Datum zu überprüfen, das von den bunten Blumensträußen, die ich im Laufe der letzten fünf Jahre aufs Grab gelegt habe, halb verdeckt wird. Oder ich gehe so weit, dass ich die Todesanzeige googele, die nicht ich damals aufgesetzt habe, um bewusst ein Gefühl hervorzurufen, das mir nie so richtig wie das vorkommt, was ich fühlen sollte.
Mein Vater ist von Daten besessen. Eine Art innerer Kalender flattert unfehlbar, um jeden bevorstehenden Geburtstag, Todestag, Jahrestag und Feiertag anzukündigen. Eine Woche vor dem Todestag meiner Mutter verdunkelt sich seine Psyche intuitiv, und schon bald überschwemmt er mich mit Nachrichten auf Facebook, wie ungerecht alles sei und dass ich nie verstehen werde, was es bedeutet, seine beste Freundin zu verlieren. Dann nimmt er seine Motorradtouren auf Phuket wieder auf, wohin er ein Jahr nach ihrem Tod gezogen ist, und füllt die Leere mit warmen Stränden und Meeresfrüchten von Straßenständen und jungen Frauen, für die Problem ein Fremdwort ist.
Ich hingegen könnte nie vergessen, was meine Mutter gerne aß. Für sie gab es »das Übliche« in großer Vielfalt. Nach einem Tag Shopping ein Patty Melt – Burger auf Roggentoast – und dazu dicke Pommes zum Teilen im Terrace Café. Ein ungesüßter Eistee mit einer halben Packung Süßstoff von Splenda, von dem sie felsenfest behauptete, sie würde ihn nie für etwas anderes verwenden. Minestrone bestellte sie im Olive Garden immer »dampfig heiß«, nicht »dampfend heiß«, und mit extra Brühe. Zu besonderen Anlässen ein halbes Dutzend Austern in der Halbschale mit Champagner-Mignonette und »dampfig heißer« französischer Zwiebelsuppe von Jake’s in Portland. Sie war wahrscheinlich der einzige Mensch auf Erden, der ernsthaft »dampfig heiße« Pommes im McDrive bestellte. Jjampong, scharfe Meeresfrüchte-Nudelsuppe mit extra Gemüse von Café Seoul, das sie immer Seoul Café nannte, in der Wortstellung ihrer Muttersprache. Im Winter liebte sie geröstete Maronen, obwohl sie fürchterliche Blähungen davon bekam. Zu leichtem Bier aß sie gern gesalzene Erdnüsse. Beinahe jeden Tag trank sie zwei Gläser Chardonnay, aber wenn sie ein drittes trank, wurde ihr schlecht. Auf ihrer Pizza aß sie scharf eingelegte Peperoni. In mexikanischen Restaurants bestellte sie zu jedem Gericht fein geschnittene Jalapeños dazu. Saucen bestellte sie immer extra. Koriander, Avocado und Paprika konnte sie nicht ausstehen. Gegen Sellerie war sie allergisch. Sie aß fast nie Süßigkeiten, mit der Ausnahme der gelegentlichen Packung Erdbeereis von Häagen-Dazs, einer Tüte Geleebohnen mit Mandarinengeschmack, ein oder zwei Schokotrüffeln von See’s um Weihnachten herum und einem Stück Blaubeer-Cheesecake an ihrem Geburtstag. Kaum jemals frühstückte sie oder naschte zwischendurch. Sie war salzig veranlagt.
An all das erinnere ich mich so deutlich, weil meine Mutter so ihre Liebe zeigte, nicht durch Schwindeleien und ständige verbale Bestätigung, sondern indem sie unauffällig beobachtete und sich merkte, was einem Freude bereitete, und einem dadurch das Gefühl gab, getröstet und umsorgt zu werden, ohne dass man sich dessen bewusst war. Sie wusste, ob du deinen Eintopf am liebsten mit extra viel Brühe magst, ob du empfindlich auf Gewürze reagierst, ob du Tomaten hasst, ob du keine Meeresfrüchte isst, ob du einen großen Appetit hast. Sie erinnerte sich daran, welche Banchan-Beilage du zuerst leer gegessen hast, sodass es bei deinem nächsten Besuch doppelt so viel davon gab, neben all den anderen Lieblingsgerichten, die dich ausmachen.
Im Jahre 1983 las mein Vater eine Anzeige im Philadelphia Inquirer, in der lediglich »Gelegenheit im Ausland« stand, und flog daraufhin kurzerhand nach Südkorea. Die Gelegenheit stellte sich als ein Trainingsprogramm in Seoul heraus, bei dem Gebrauchtwagen an das US-Militär verkauft wurden. Die Firma buchte ein Zimmer für ihn im Naija Hotel, ein Wahrzeichen des Yongsan-Viertels, wo meine Mutter damals an der Rezeption arbeitete. Angeblich war sie die erste Koreanerin, die er je getroffen hatte.
Drei Monate lang gingen sie aus, und als das Trainingsprogramm beendet war, machte mein Vater meiner Mutter einen Heiratsantrag. Die beiden tingelten durch drei Länder und lebten im japanischen Misawa, in Heidelberg und dann wieder in Seoul, wo ich geboren wurde. Ein Jahr später bot Ron, der ältere Bruder meines Vaters, ihm einen Job in seinem Frachtmakler-Unternehmen an. Die Stelle bedeutete Stabilität und ein Ende der halbjährlichen interkontinentalen Entwurzelung meiner Familie, und so immigrierten wir in die USA, als ich gerade mal ein Jahr alt war.
Wir zogen nach Eugene, Oregon, eine kleine Universitätsstadt im Pazifischen Nordwesten. Die Stadt liegt in Ursprungsnähe des Willamette, ein Fluss, der von den Calapooya Mountains vor den Toren der Stadt bis zu seiner Mündung in den Columbia River 240 Kilometer nordwärts fließt. Er bahnt sich seinen Weg zwischen den Bergen der Kaskadenkette im Osten und der Oregon Coast Range im Westen und prägt ein fruchtbares Tal. Vor Zehntausenden von Jahren hatte sich eine Reihe von Schmelzwasserfluten vom Lake Missoula aus südwestwärts über das östliche Washington ergossen und dabei reichen Boden sowie vulkanisches Gestein mitgebracht. Noch heute eignen sich die Erdschichten des Schwemmlands für eine enorme Bandbreite an landwirtschaftlicher Nutzung.
Die Stadt selbst ist mit Grün überzogen, schmiegt sich ans Flussufer und erstreckt sich bis in die zerklüfteten Hügel und Kiefernwälder des zentralen Oregon hinauf. Das Klima ist mild, und fast das ganze Jahr über ist es feucht und grau, aber die Sommer sind unverdorben und üppig. Es regnet permanent, und doch tragen die Leute hier nie einen Regenschirm bei sich.
Die Einwohnerinnen und Einwohner von Eugene sind stolz auf die Fülle der Region, und schon lange, bevor es wieder in Mode kam, lag es ihnen am Herzen, lokale, saisonale und biologisch angebaute Produkte zu verwenden. Angler machen in den Süßwassergewässern reichlich Beute, wo sie im Frühjahr wilden Königslachs und im Sommer Regenbogenforellen fischen, und in den Mündungsgebieten findet man das ganze Jahr über kalifornische Taschenkrebse zuhauf. Jeden Samstag versammeln sich die hiesigen Landwirte in der Innenstadt, um Biogemüse, Honig, gesammelte Pilze und wilde Beeren zu verkaufen. Das Bild prägen Hippies, die den Whole Foods Market zugunsten von lokalen Kooperativen boykottieren, Birkenstocks tragen, Tücher für die Haare weben und auf Märkten verkaufen und ihre eigene Nussbutter herstellen. Es sind Männer mit Namen wie Herb und River und Frauen, die Forest oder Aurora heißen.
Als ich zehn war, zogen wir elf Kilometer aus der Stadt hinaus, vorbei an den Weihnachtsbaumplantagen und den Wanderwegen des Spencer Butte Parks, in ein Haus im Wald. Es stand auf fast zwei Hektar Land, auf dem Scharen von wilden Truthühnern umherstreiften und im Gras nach Insekten pickten und wo mein Vater seinen Aufsitzmäher nackt fahren konnte, wenn er wollte, denn das Grundstück war geschützt von Tausenden von Gelb-Kiefern, keine Nachbarn weit und breit. Nach hinten raus gab es eine Lichtung, auf der meine Mutter Rhododendren anpflanzte und den Rasen gepflegt hielt. Dahinter lagen sanfte Hügel mit hartem Gras und rotem Lehm. Es gab einen ausgehobenen Teich voll erdigem Wasser und weichem Schlamm, und Salamander und Frösche, die man jagen, einfangen und wieder freilassen konnte. Brombeersträucher wucherten, und im Frühsommer, wenn man Feuer machen durfte, rückte mein Vater ihnen mit einer riesigen Heckenschere zu Leibe und erschuf zwischen den Gehölzen neue Wege auf der Strecke für sein Geländemotorrad. Einmal im Monat ließ er mich den Anzünder unten an die Haufen schütten, die sich angesammelt hatten, und dann bewunderten wir das Freudenfeuer, wenn es in zwei Meter hohen Flammen aufging.
Ich fand unser neues Zuhause großartig, aber mit der Zeit hatte ich es auch satt. Es gab keine Kinder in der näheren Umgebung, mit denen ich spielen konnte, keinen Laden und auch keinen Park, den man mit dem Fahrrad hätte erreichen können. Ich saß fest und war einsam, ein Einzelkind, das mit niemandem reden und sich an niemanden wenden konnte außer an seine Mutter.
Allein mit ihr im Wald, überwältigten mich die Zeit und Aufmerksamkeit, die sie mir widmete und die, wie ich begriff, sowohl ein glückliches Privileg sein konnten als auch mich zu erdrücken drohten. Meine Mutter war Hausfrau. Seit meiner Geburt drehte sich ihr Leben darum, einen Haushalt zu führen, und obwohl sie fürsorglich war und mich beschützen wollte, tat sie alles andere, als mich zu verhätscheln. Sie war nicht die »Mommy-Mom«, wie ich es nannte und um die ich die meisten meiner Freundinnen und Freunde beneidete. Eine Mommy-Mom ist eine Mutter, die sich für alles interessiert, was ihr Kind zu sagen hat, selbst wenn es ihr eigentlich scheißegal ist, die dich sofort zum Arzt schleppt, wenn du über das kleinste Wehwehchen klagst, die sagt, »die sind doch bloß neidisch«, wenn sich jemand über dich lustig macht, oder »ich finde dich immer wunderschön«, selbst wenn du nicht wunderschön aussiehst, oder »wie hübsch!«, wenn du ihr irgendeinen Schrott zu Weihnachten schenkst.
Wenn ich mir wehtat, fing meine Mutter jedes Mal an zu schreien. Nicht aus Sorge um mich, sondern aus Ärger. Ich verstand das nicht. Wenn meine Freundinnen sich wehtaten, nahmen ihre Mütter sie in den Arm und versicherten ihnen, dass alles wieder gut werden würde, oder sie fuhren direkt zum Arzt. Weiße fuhren ständig zum Arzt. Doch wenn ich mir wehtat, wurde meine Mutter fuchsteufelswild, gerade so, als hätte ich böswillig etwas kaputt gemacht, das ihr gehörte.
Einmal kletterte ich auf den Baum bei uns im Vorgarten und rutschte mit dem Fuß an der Einkerbung ab, an der ich mich hochgedrückt hatte. Ich versuchte, mich irgendwie festzuklammern, und rutschte ein ganzes Stück mit dem nackten Bauch an der rauen Rinde herunter, bevor ich fast zwei Meter nach unten stürzte und auf meinem Fuß aufkam. Weinend, mit umgeknicktem Knöchel und zerrissenem T-Shirt, der Bauch aufgeschürft und blutig an beiden Seiten, wurde ich nicht von meiner Mutter in den Arm genommen und zum Arzt gebracht. Stattdessen stürzte sie sich auf mich wie ein Schwarm Krähen.
»WIE OFT HAT MOMMY GESAGT, DU SOLLST NICHT AUF DEN BAUM KLETTERN?!«
»Umma, ich glaube, ich habe mir den Knöchel verstaucht!«, heulte ich. »Ich glaube, ich muss ins Krankenhaus!«
Über meinen zusammengekrümmten Körper gebeugt, kreischte sie immer weiter, während ich mich im Laub wand. Ich hätte schwören können, dass sie auch noch ein paar Tritte dazugab.
»Mom, ich blute! Bitte schrei mich nicht an!«
»DIE NARBE WIRST DU IMMER HABEN! AY-CHAM WHEN-IL-EEYA?!«
»Es tut mir leid, okay? Es tut mir leid!«
Immer wieder entschuldigte ich mich und schluchzte dabei dramatisch. Dicke fette Tränen und beharrliches abgehacktes Geheul. Auf den Ellenbogen schob ich mich Richtung Haus, griff in das trockene Laub und die kalte Erde und zog steif mein verletztes Bein hinter mir her.
»Aigo! Dwae ssuh! Das reicht!«
Ihre Erziehungsmethode als »tough love« zu bezeichnen, wäre eine Untertreibung. Ihre Liebe war nicht streng, sie war geradezu brutal. Eine zähe Liebe, die nie auch nur einem Anflug von Schwäche nachgab. Eine Liebe, die schon zehn Schritte vorher erkannte, was das Beste für dich war, und die nicht interessierte, ob es unterdessen höllisch schmerzte. Wenn ich mir wehtat, spürte sie es so tief in ihrem Inneren, als hätte sie sich selbst verletzt. Das Einzige, das man ihr vorwerfen konnte, war, dass sie sich zu sehr sorgte. Das wird mir erst jetzt, im Rückblick, klar. Niemand auf der ganzen Welt würde mich je so sehr lieben wie meine Mutter, und sie würde nicht zulassen, dass ich das jemals vergaß.
»Hör auf zu weinen! Heb deine Tränen für Mommys Tod auf.«
Das war bei uns zu Hause eine übliche Wendung. Anstelle der englischen Redewendungen, die meine Mutter nie gelernt hatte, prägte sie ihre eigenen. »Mommy ist die Einzige, die dir je die Wahrheit sagt, denn Mommy ist die Einzige, die dich wirklich liebt.« Eine meiner frühesten Erinnerungen ist die an meine Mutter, wie sie mich anweist, immer »zehn Prozent von dir aufzusparen«. Damit meinte sie, man solle nie alles von sich geben, ganz egal, wie sehr man jemanden zu lieben meint, oder wie sehr man glaubt, dass jemand einen liebt. Spar zehn Prozent auf, immer, dann hast du etwas, auf das du zurückgreifen kannst. »Sogar vor Daddy spare ich mir etwas auf«, sagte sie dann noch.
Meine Mutter war ständig darum bemüht, mich zur perfekten Version meiner selbst zu formen. Als Neugeborenes kniff sie mir in die Nase, weil sie befürchtete, sie sei zu platt. In der Grundschule sorgte sie sich darum, dass ich zu klein war, und so wies sie mich jeden Morgen an, mich am Kopfteil meines Betts festzuhalten, während sie an meinen Füßen zog, um meine Beine länger werden zu lassen. Runzelte ich die Stirn oder lächelte ich zu breit, strich sie mir die Stirn glatt und wies mich an, ich solle »keine Falten mehr machen«. Lief ich krumm, landete ihre Hand mit dem Befehl »Ukgae peego!« zwischen meinen Schulterblättern. »Schultern gerade!«
Sie war besessen vom Aussehen und verbrachte Stunden vor den Dauerwerbesendungen auf QVC. Telefonisch bestellte sie reinigende Spülungen, Spezialzahnpasta und ganze Gefäße voll Peeling mit Kaviaröl, Haarserum, Feuchtigkeitscreme, Gesichtswasser und Antifaltencreme. Mit dem Eifer einer Verschwörungstheoretikerin glaubte sie an Produkte von QVC. Stellte man infrage, ob ein Produkt auch seriös war, brauste sie auf und verteidigte es. Meine Mom war voll und ganz davon überzeugt, dass Supersmile-Zahnpasta die Zähne fünf Nuancen heller machte und dass das dreiteilige Hautpflegeset von Dr. Denese’s Beautiful Complexion das Gesicht um zehn Jahre verjüngte. Ihr Waschtisch im Bad war eine Insel voller Glastiegel und getönter Behälter, mit deren Inhalt sie ihr Gesicht betupfte, massierte, glatt strich. Mit peinlicher Genauigkeit folgte sie einer zehnstufigen Hautpflegeroutine, zu der auch ein Stab mit Mikrostrom gehörte, der die Falten exekutierte. Jeden Abend hörte ich vom Flur aus, wie sie mit den Handflächen auf ihre Wangen klatschte, und dann das Summen pulsierender Elektrizität, die angeblich die Poren verfeinerte, und nachdem meine Mutter gesurrt und gezappt hatte, trug sie eine Schicht Creme nach der anderen auf.
Im Schrank unter meinem Waschbecken stapelten sich unterdessen Boxen mit Gesichtswasser von Proactiv, und die Borsten einer Gesichtsreinigungsbürste von Clarisonic blieben trocken und vorwiegend unbenutzt. Ich war zu ungeduldig, um mich an irgendeine Routine zu halten, die meine Mutter mir aufzudrücken versuchte, ein Grund für Streit, der während meiner Pubertät eskalieren sollte.
Ihre Akribie machte mich rasend, und ihre Perfektion blieb mir ein Rätsel. Sie konnte ein Kleidungsstück schon zehn Jahre besitzen, und es sah immer noch so aus, als hätte sie es nie getragen. Nie hatte sie auch nur den kleinsten Fussel auf dem Mantel oder ein Knötchen auf dem Pulli oder auch nur einen Kratzer auf einem Lacklederschuh, wohingegen ich andauernd gerügt wurde, weil ich etwas kaputt machte oder verlor, und zwar selbst die Dinge, die mir am meisten am Herzen lagen.
Genauso pedantisch führte sie ihren makellosen Haushalt. Sie saugte täglich, und einmal die Woche musste ich mit dem Staubtuch über die Fußleisten wischen, während sie das Parkett mit Öl begoss und mit einem Lappen polierte. Mit meinem Vater und mir zusammenzuleben, musste sich in etwa so angefühlt haben, als hätte sie mit zwei Kleinkindern zusammengewohnt, die wild entschlossen waren, ihre perfekte Welt zu zerstören. Wenn sie mal wieder wegen der kleinsten Unordnung explodierte, schauten mein Vater und ich nach, worum es ging, und hatten keine Ahnung, was schmutzig oder am falschen Platz war. Verschüttete einer von uns etwas auf dem Teppich, reagierte meine Mutter, als hätten wir ihn in Brand gesteckt. Augenblicklich heulte sie gequält auf, eilte in die Küche, um die Teppichreinigungssprays von QVC unter der Spüle hervorzuholen, und schob uns beiseite aus Angst, wir könnten den Fleck noch vergrößern. Mein Vater und ich standen dann nur verlegen daneben und sahen dümmlich dabei zu, wie sie unsere Missgeschicke besprühte und betupfte.





























