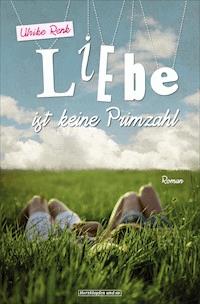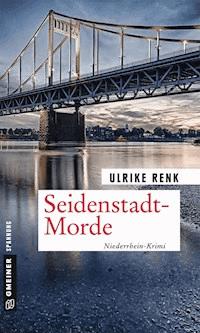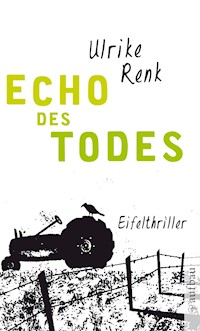9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die große Seidenstadt-Saga
- Sprache: Deutsch
„Die Menschen hinter meinen Figuren existierten wirklich. Sie sollen nie vergessen werden.“ Ulrike Renk.
August, 1940. Amerika soll für Ruth Meyer und ihre Familie das Land der Freiheit werden. Endlich haben sie es geschafft, aus Europa zu fliehen. Doch wird man sie als deutsche Juden in der Fremde willkommen heißen? Die Zeichen stehen zunächst nicht zum Besten. Kaum am Hafen angekommen fällt Ruths Vater auf Betrüger herein. In Chicago, der vorerst letzten Station ihrer Odyssee, versucht Ruth sich einzurichten und Arbeit zu finden. Immer sind ihre Gedanken bei ihren Verwandten, die in Deutschland zurückbleiben mussten. Bald aber hat sie noch andere Sorgen. Ein junger Mann wirbt um sie – leider ist er Soldat und muss in die Hölle des Krieges, der sie gerade entkommen ist ...
Eine dramatische Familiengeschichte, die von Deutschland über England in die USA führt. Von der Autorin der Bestseller „Die Zeit der Kraniche“ und „Tage des Lichts“.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 688
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über das Buch
»Die Menschen hinter meinen Figuren existierten wirklich. Sie sollen nie vergessen werden.« Ulrike Renk.
August, 1940. Amerika soll für Ruth Meyer und ihre Familie das Land der Freiheit werden. Endlich haben sie es geschafft, aus Europa zu fliehen. Doch wird man sie als deutsche Juden in der Fremde willkommen heißen? Die Zeichen stehen zunächst nicht zum Besten. Kaum am Hafen angekommen fällt Ruths Vater auf Betrüger herein. In Chicago, der vorerst letzten Station ihrer Odyssee, versucht Ruth sich einzurichten und Arbeit zu finden. Immer sind ihre Gedanken bei ihren Verwandten, die in Deutschland zurückbleiben mussten. Bald aber hat sie noch andere Sorgen. Ein junger Mann wirbt um sie – leider ist er Soldat und muss in die Hölle des Krieges, der sie gerade entkommen ist.
Eine dramatische Familiengeschichte, die von Deutschland über England in die USA führt. Von der Autorin der Bestseller »Die Zeit der Kraniche« und »Tage des Lichts«
Über Ulrike Renk
Ulrike Renk, Jahrgang 1967, studierte Literatur und Medienwissenschaften und lebt mit ihrer Familie in Krefeld. Familiengeschichten haben sie schon immer fasziniert, und so verwebt sie in ihren erfolgreichen Romanen Realität mit Fiktion.
Im Aufbau Taschenbuch liegen ihre Australien-Saga, die Ostpreußen-Saga, die ersten drei Bände der Seidenstadt-Saga und zahlreiche historische Romane vor.
Mehr Informationen zur Autorin unter www.ulrikerenk.de.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Ulrike Renk
Träume aus Samt
Das Schicksal einer Familie
Roman
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Personenverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Epilog
Nachwort
Danksagungen
Impressum
Für Claus
Zuhörer – Vorkoster – Mitesser – Aufbauer – Tröster – Liebhaber – Witzemacher – Masseur – Gassigeher – Hundebesitzer – Küchenbauer – Chauffeur – Vater – und bester Ehemann von allen
Personenverzeichnis
Familie Meyer
Martha Meyer
Karl Meyer
Ruth
Ilse
Verwandtschaft in Deutschland
Wilhelmine (Omi) und Valentin Meyer (Opi) → Karls Eltern
Emilie Meyer (Großmutter) → Marthas Mutter
Hedwig Simons → Karls Schwester
Hans Simons
Verwandtschaft in Amerika
Irene
Töchter Doris und Regine
Fred (angeheiratet, Amerikaner)
Freunde der Familie in Amerika
Sofie und Walter Gompetz
Sarah und Heinrich Hirsch
Rachel → Tochter
Aaron → Cousin
Klara → Tante
Margret und Fritz Goldberg
Anna → Tochter
Else und Otto Hirsch
Inge → Tochter
Else und Albert Glimmich
Kurt → Sohn
Anne → Tochter
Freunde Ruths
Marcella, Franzisca, Julie → Kolleginnen bei »Fancy Frocks«
Andrew Silberstein → Freund Rachels
Eddie Elcott
Kapitel 1
New York, August 1940
»Dort?«, fragte Ilse aufgeregt. Sie kniff die Augen zusammen, schob ihre Brille fast bis vor die Augen und starrte nach rechts. »Ist sie dort?«
»Nein, Ilse«, sagte Ruth belustigt. »Schau nach links. Da ist sie – allerdings kann man sie bisher nur erahnen.« Sie wies ihrer Schwester die Richtung.
»Ich sehe nichts«, brummte Karl verdrossen. »Gar nichts.«
»Ich fürchte, in Chicago müsst ihr beide zum Augenarzt und werdet eine neue Brille brauchen«, meinte Martha nachdenklich. »Ich hoffe, wir können uns das leisten«, fügte sie fast tonlos hinzu.
»Mach dir keine Gedanken«, sagte Karl Meyer und legte seiner Frau den Arm um die Schulter. »Alles wird gut werden.«
Obwohl Ruth – im Gegensatz zu ihrer Schwester Ilse – die Augenkrankheit ihres Vaters nicht geerbt hatte, kniff auch sie die Augen zusammen. Heute Morgen schon war der Ruf »Land in Sicht« ertönt; alle waren an Deck geeilt und hatten in die Ferne gestarrt. Doch Ruth hatte nur eine Art Schatten am Horizont erkannt – das hätten auch niedrighängende Wolken sein können. Enttäuscht war sie zum Frühstück zurückgekehrt. Der Atlantik war ruhig, und fast alle Mitreisenden hatten sich von der Seekrankheit erholt, deshalb war der Speisesaal voller als in den letzten Tagen.
»Noch zwei Mahlzeiten an Bord«, hatte Mutti gesagt und aus dem Fenster geschaut – wo aber außer Wasser nichts zu sehen war. »Heute Abend sind wir endlich in Amerika.«
Ja, hatte Ruth gedacht – aber was dann? Vor mehr als einer Woche waren sie in Liverpool auf das Schiff gegangen. Die Überfahrt nach New York sollte nur sechs Tage dauern, doch die Scythia war von der normalen Linienroute abgewichen, nachdem sie den Konvoi, der sie begleiten sollte, verloren hatten. Die Gefahr, von deutschen U-Booten angegriffen zu werden, war groß, und der Kapitän hatte sich dazu entschlossen, im Zickzack zu fahren. Auch Funkverbindungen waren schwierig, die Deutschen versuchten jeden Funkspruch abzufangen, hatte Johnny, einer der kanadischen Soldaten, die mit auf dem Schiff waren, Ruth erklärt.
Dies war eigentlich ihre Fahrt in die Zukunft. Eine Fahrt, die sich die Familie Meyer so lange ersehnt, auf die sie hin gefiebert hatte. Es sollte die Reise in die Freiheit werden, weg von den Nazis und ihren lebensbedrohlichen Repressionen. Es sollte, so hatte es sich Ruth früher ausgemalt, eine glückliche, fröhliche Reise werden, aber das war es nicht. Die Angst saß ihnen immer noch im Nacken, und all die Meldungen über zivile Schiffe, die angegriffen wurden, machten es nicht leichter.
Nichts ist mehr unbeschwert, dachte Ruth, seit der Pogromnacht. Damals hat sich alles verändert, alles war schrecklich geworden, noch schrecklicher, als es zuvor schon gewesen war. Seit dieser Nacht hatte Ruth die Angst als ständigen Begleiter bei sich. Das hatte sich auch nicht geändert, als sie in England die Stelle als Haushaltshilfe auf der Farm der Sandersons antreten konnte, als sie endlich Nazideutschland verlassen hatte. Das war erst vor etwas mehr als einem Jahr gewesen, dennoch erschien es Ruth eine Ewigkeit entfernt zu sein. Auf dem Hof hatte sie hart arbeiten müssen. Olivia Sanderson, die Frau des Hofbesitzers, war streng und unnahbar gewesen. Damit hatte Ruth sich bald abgefunden – sie brauchte die Stelle, um in England bleiben und ihre Familie zu sich holen zu können. Doch die Angst um ihr Leben war zur Angst um das Leben ihrer Familie geworden. Lange hatte sie darum fürchten müssen. Würden sie es rechtzeitig schaffen auszureisen? Erst im letzten Moment war es tatsächlich wahr geworden, und sie hatte ihre Lieben wieder in die Arme schließen können. Doch dann war der Krieg ausgebrochen, und plötzlich bedrohte die Invasion Nazideutschlands England. Und sie, die Geflüchteten, wurden zu möglichen Feinden innerhalb des Landes.
Es war selten eine offene Feindseligkeit, die sie verspürten, es war eher ein unterschwelliges Grollen gegen sie. Sie waren Juden – verfolgt in Deutschland. Aber sie waren auch Deutsche – die Feinde Englands.
Mit der Ausreise nach Amerika, so hatte Ruth gehofft, würden alle diese Lasten von ihr abfallen. In Amerika würden sie neu anfangen, befreit von allen Vorurteilen, von allen Anfeindungen. Sie kämen als freie Menschen in ein freies Land.
Doch schon auf der Überfahrt war ihr klar geworden, dass dies eine Illusion war. Sie würden immer und immer ihre Vergangenheit mit sich tragen. Die Angst und die Last. Sie würden immer Juden für andere bleiben. »Juden« – als ob sie das zu anderen Menschen machte. Aber manche dachten eben so, andere zum Glück nicht. Vielleicht würde es mehr Menschen geben, denen ihre Herkunft und ihr Glauben egal wäre – dort, in Amerika.
Ruth schaute wieder aus dem Fenster, doch auch jetzt waren nur Wellen und der entfernte Horizont, der mit dem Atlantik verschmolz, zu sehen. Sie trank den letzten Schluck Kaffee, Bohnenkaffee – diesen Luxus hatte sie auf dem Schiff sehr genossen –, und stand auf.
Martha sah sie an. »Hast du alles gepackt? Nachher wird es vielleicht schnell gehen müssen.«
»Wieso?«, fragte Ruth irritiert.
»Setz dich wieder«, sagte Vati. Sein Tonfall ließ keinen Widerspruch zu. Dann beugte er sich zu ihr. »Ich habe jemanden getroffen«, wisperte er. »Er ist Amerikaner und hat Verbindungen.«
»Verbindungen?« Ruth schüttelte fragend den Kopf. »Was für Verbindungen?«
»Sei still und hör zu.« Ihr Vater sah sie an. »Alle wollen so schnell wie möglich vom Schiff. Alle wollen so schnell es geht an Land und weiter. Wir auch. Verstehst du?«
Ruth nickte. »Es wird Gedränge geben«, sagte sie beklommen.
»Nein«, sagte Martha lächelnd. »Nicht für uns. Vati hat vorgesorgt.«
»Wie das?«, fragte Ruth verblüfft.
»Ich habe Karten gekauft, Einreisekarten – damit wir unter den Ersten sind, die das Schiff verlassen dürfen. Unser Gepäck wird auch gesondert ausgeladen – vor allen andern.«
»Vor der ersten Klasse?«, fragte Ruth ungläubig.
Karl schüttelte den Kopf. »Natürlich nicht. Die erste Klasse geht immer vor. Aber direkt danach kommen wir. Wir müssen uns nur gleich in einen speziellen Raum begeben – mit unserem Handgepäck. Und unser anderes Gepäck muss schon abgegeben sein.«
»Du musst also jetzt packen«, bestätigte Martha die Worte ihres Mannes.
»Und dann kommen wir schneller von Bord?«, fragte Ruth noch einmal nach.
»Ja.«
»Was ist dann? Was machen wir an Land?«
»Wir müssen eine Droschke nehmen und zum Bahnhof fahren«, sagte ihr Vater. »Ich habe schon hier an Bord Bahnfahrkarten kaufen können, die uns schnell nach Chicago bringen werden.« Er lächelte. »Übermorgen werden wir hoffentlich da sein.«
»Sofie hat eine Wohnung für uns angemietet«, sagte Martha und strahlte glücklich »Eine Wohnung in Chicago. Dort wird unser neues Leben beginnen.«
»Sofie?« Ruth sah ihre Mutter fragend an.
»Sofie Gompetz, Schätzchen. Du wirst sie doch nicht vergessen haben?«
Natürlich hatte Ruth das Ehepaar Gompetz nicht vergessen. Die Freunde ihrer Eltern hatten bereits Ende 1938 aus Deutschland ausreisen können. Sie hatten sich schon früh um Visa für Amerika bemüht. Immer noch gab es die Quote von ca. 22000 Einwanderern, die Amerika ins Land ließ; dies aber auch nur, wenn sie ein Affidavit – eine Bürgschaft von jemandem im Land – hatten. Wenn gewährleistet war, dass es genug Geld gab, damit sie nicht auf Staatskosten leben würden.
Obwohl die Meyers einige Verwandte in Amerika hatten, war keiner von ihnen bereit gewesen, das Affidavit für sie zu leisten. Erst nach vielen Briefen und auch einigem Geld, das geflossen war, hatte sich die entfernte Cousine von Martha dazu bereit erklärt. Sie hatte aber jede weitere Verantwortung abgelehnt und wollte auch keinen Kontakt.
So hatten die Freunde, Sofie und Walter Gompetz, den Möbelcontainer der Meyers angenommen und untergebracht und ihnen auch ein kleines Apartment in Chicago angemietet, wo sie selbst untergekommen waren.
Nach der Quote, die Amerika ausgegeben hatte, hätten die Meyers erst Ende 1941 nach Amerika einreisen dürfen, aber nach Kriegsbeginn waren die Grenzen Deutschlands geschlossen worden und kaum ein Jude durfte nun noch ausreisen. Deshalb rückten alle anderen nach, die inzwischen im Ausland saßen – so wie die Meyers. Sie nahmen die Plätze von anderen Leuten ein. Was mit diesen Menschen wurde, mochten sie sich kaum ausmalen; trotzdem ließen sie die Gedanken an diese Menschen nicht los.
»Ja, natürlich«, sagte Ruth leise. »Sofie. Ich freue mich, sie wiederzusehen.«
»Dann geh jetzt packen, Kind«, sagte Karl. »Gleich gehen wir nochmal an Deck, vielleicht können wir jetzt die Freiheitsstatue sehen.«
»Ich will unbedingt dabei sein, wenn wir an ihr vorbeifahren«, sagte Martha. »Es muss erhebend sein – dieses Gefühl, endlich anzukommen.«
Ja, dachte Ruth, das will ich auch. Schnell ging sie in die Kabine. Schon gestern hatte sie das meiste gepackt, jetzt gab es nur noch Reste zu verstauen und ihren Kulturbeutel zu füllen. Sie putzte sich die Zähne, kämmte sich die Haare und besah sich gründlich im Spiegel.
Ich bin gerade neunzehn. Ich habe meine Heimat verlassen, wahrscheinlich für immer. Einige Monate habe ich in England gearbeitet, und jetzt werden wir gleich Amerika betreten, das Land, auf das ich so gehofft habe. Sie fühlte in sich hinein, erwartete das Gefühl der großen Erleichterung und Freude, aber es wollte sich nicht einstellen.
Gleich, sagte sich Ruth, gleich, wenn wir die Freiheitsstatue sehen, dann … dann wird die Freude groß sein.
Auch Ilse war in die Kabine gekommen und hatte die restlichen Sachen gepackt. »Es ist alles so aufregend«, sagte sie. »Was meinst du, werden wir andere Menschen sein, wenn wir in Amerika sind? Werden wir uns anders fühlen?«
»Wir werden sicherlich noch wir selbst sein«, sagte Ruth nachdenklich. »Ich hoffe allerdings sehr, dass wir uns anders fühlen werden – sicherer.«
»Oh, das tue ich jetzt schon«, meinte ihre Schwester fröhlich und ging nach oben an Deck.
Ruth sah sich noch einmal in der Kabine um. Zehn Tage lang hatten sie hier gewohnt. Es war eine luxuriöse Unterkunft, fast schon wie ihr Haus in Krefeld, und ganz bestimmt würden sie in nächster Zukunft so nicht mehr leben. Dennoch hatte Ruth das seltsame Gefühl nie ganz abstreifen können, das sie beschlichen hatte, als sie an die vielen tausend Meter Wasser unter dem Schiff dachte und an die drohenden U-Boote, die in der Dunkelheit des Atlantiks auf Opfer warteten. Diese Furcht zumindest würde sie an Land nicht mehr haben müssen.
Langsam ging Ruth die Treppe nach oben an Deck. Es war schon gut gefüllt, alle wollten die Freiheitsstatue sehen, die nun auch deutlich zu erkennen war. Erst war sie noch ein Schemen in der Ferne gewesen, aber jetzt sah man die kleine Insel und die Figur mit dem hochgestreckten Arm.
»Dort vorne«, rief jemand aufgeregt, »ist Ellis Island. Rechts von uns. Und dort links, da ist die Freiheitsstatue.«
Ellis Island, dort befand sich die Immigrantenaufnahme der Vereinigten Staaten. Dort wurden alle Einwanderer geprüft und untersucht, wusste Ruth. Auch Ilse hatte davon gehört.
»Legen wir dort an?«, fragte sie fast atemlos.
»Nein«, sagte der Mann und tätschelte ihre Schulter. »Wir nicht. Wir sind auf der Scythia, auf einem Linienschiff der Cunard Linie. Wir sind normale Reisende.« Er sah sich um und lächelte. »Nicht wahr?«
»Aber … aber … wir sind doch Emigranten«, sagte Ilse unsicher. »Wir wollen doch Amerikaner werden und sind keine Urlauber.«
Der Mann strafte Ilse mit einem strengen Blick. »Shhhh«, zischte er und schüttelte den Kopf. »Du solltest lernen, deine Zunge im Zaum und deine Gedanken bei dir zu behalten, kleines Mädchen. Das wird es für dich sehr viel einfacher machen.« Er lachte ein unangenehmes Lachen und wandte sich ab.
Ilse drehte sich zu Ruth. »Wie hat er das gemeint?«, fragte sie und schluckte. »Was habe ich falsch gemacht?«
»Du hast nichts falsch gemacht«, versuchte Ruth ihre kleine Schwester zu beruhigen. »Wir sind auf einem Linienschiff und müssen nicht durch die Einwanderungskontrollen auf Ellis Island. Wir müssen nicht dahin, weil wir alle unsere Unterlagen schon abgegeben haben und sie geprüft worden sind. Wir haben Affidavits für unsere Einreise.«
»Affi… ich höre das immer wieder, was ist das?«, wollte Ilse wissen.
»Das ist eine Bürgschaft für uns.« Ruth versuchte zu lächeln. »Tante Ingrid hat sie für uns gemacht.«
»Tante … wer?«
»Tante Ingrid. Sie ist entfernt mit Mutti verwandt und lebt schon eine Weile in Amerika«, versuchte Ruth leichthin zu sagen.
»Die kenne ich gar nicht.« Ilse kaute auf ihrer Lippe. »Warum kenne ich den Namen nicht?«
»Weil … weil … das ist alles schwierig, Ilse«, sagte Ruth und seufzte. »Schau!«, rief sie dann, »schau dort vorne, da ist die Freiheitsstatue.«
»Wo?«
»Komm, wir versuchen auf das Oberdeck zu kommen.« Ruth nahm Ilse an die Hand und schob sich durch die Menge bis zur Treppe, die zum Oberdeck führte. Dort waren jetzt nur die Passagiere der ersten Klasse erlaubt.
Auf der Treppe zum Oberdeck hielt sie eine Frau zurück. Sie trug einen Mantel aus Fuchspelz und ein Monokel, durch das sie die Mädchen scharf musterte.
»Was macht ihr hier? Und wer seid ihr? Ich habe euch bisher noch nicht gesehen«, fauchte sie.
»Wir … wir wollen die Freiheitsstatue sehen«, sagte Ruth.
»Grundgütiger, Elisabeth, das sind Kinder aus der zweiten Klasse. Lass sie hoch«, sagte ein Mann vom Oberdeck. Er kam ihnen ein paar Stufen entgegen. »Kommt, Kinder, kommt. Es ist erhebend. Jedes Mal wieder.«
»Sie waren schon mal in New York?«, fragte Ilse ungläubig.
»Natürlich. Ich bin alle paar Jahre hier. So eine aufregende Stadt. Das will man doch nicht verpassen«, sagte der Mann lächelnd und führte sie zur Reling. »Aus deinen Worten entnehme ich, dass ihr das erste Mal in den Staaten seid?«
»Wir sind gekommen, um zu bleiben«, sagte Ruth und biss sich auf die Lippen.
»Oh«, sagte der Mann und musterte sie. »Ihr seid Juden?«
»Sieht man das?«, fragte Ilse und versuchte, die plötzlich auftretenden Tränen wegzublinzeln. »Sieht man es wirklich?«
Der Mann schob sie von sich weg, schaute sie genau an. »Nun«, sagte er dann, »ich folge den Rassegesetzen der Nazis nicht. Sie haben so krude Einteilungen, die einfach lächerlich sind. Ihr beide aber habt herrliches Haar. Dunkle Locken. Wunderschön. So dunkle lockige, aber nicht krause Haare haben nur wenige Menschen auf der Welt, es macht euch einzig. Und dann eure Augen – so leuchtend und klar. Großartig. Ich sehe kein fliehendes Kinn, keine abartige Stirn – ich sehe schöne Gesichter. Es gibt blonde und blauäugige Idioten, die weitaus hässlicher sind, als ihr es seid.«
»Aber sehen wir für Sie aus wie Juden?«, fragte Ilse noch einmal und schluckte.
Der Mann überlegte. Dann legte er seine Hand auf ihren Kopf und streichelte sie sanft. »Nein. Ich habe aber kein Bild für ›den Juden‹. Was ihr nicht seid, ganz gewiss nicht seid – sind sture Arier, blond, blauäugig und blödsinnig. Ihr seid aufgeweckte Mädchen, egal, welcher Religion ihr angehört.« Er räusperte sich.
»Danke«, sagte Ruth leise. »Danke dafür, das wird meiner Schwester helfen.«
Er sah sie an, nickte kaum merkbar. »Und nun schauen wir nach rechts. Dort ist sie, die Statue of Liberty, die Freiheitsstatue. Seht ihr sie? Könnt ihr sie sehen?« Er nahm Ilse auf den Arm und trat an die Reling. »Jetzt fahren wir an ihr vorbei in den Hafen. Wir fahren in die Freiheit.«
Ruth stand hinter ihm, konnte die Statue aber deutlich sehen. Sie sah den hochgestreckten Arm, das Kleid, das in vielen Falten zu Boden fiel, den Kranz um ihren Kopf. Die Sonne schien und beleuchtete die Statue.
Jetzt, dachte Ruth, jetzt muss es kommen. Das Gefühl der Freiheit, der Erleichterung, des Friedens, des Glücks.
Aber sie fühlte nur eine große Leere. Da war nichts – da war keine Erleichterung und kein Glück. Sie fühlte sich leer und ausgelaugt. Sie hatte das Ziel erreicht und gewonnen, aber Glück über den Sieg fühlte sie nicht.
»Ilse? Ruth? Wo seid ihr?« Martha lief über das Deck, rief immer wieder die Namen ihrer Töchter.
»Hier sind wir!«, rief Ilse zurück. »Hier oben!« Sie winkte ihrer Mutter fröhlich zu.
»Was macht ihr denn da?«, fragte Martha verblüfft. »Kommt sofort herunter, dieser Teil des Decks ist für die erste Klasse reserviert.«
»Komm«, sagte Ruth zu Ilse, »lass uns zu Mutti gehen.« Sie nahm die Hand ihrer Schwester.
»Aber hier haben wir einen so schönen Ausblick. Hast du die Häuser gesehen? Diese hohen, hohen Häuser? Gleich fahren wir daran vorbei. Und ich will sehen, wie das Schiff anlegt.«
»Wir haben genug gesehen, Ilse«, sagte Ruth freundlich, aber bestimmend. »Schau, wie aufgeregt Mutti ist. Lass uns zu ihr gehen. Auch von dort können wir das Anlegen sicherlich beobachten.«
Ilse verzog den Mund, aber sie folgte ihrer Schwester.
»Es dauert nicht mehr lange«, sagte Martha aufgeregt. »Gleich legen wir an. Vati hat jemanden getroffen, der Beziehungen hat. Er hat uns eine Möglichkeit vermittelt, unter den Ersten zu sein, die das Schiff verlassen können.« Sie sah ihre Töchter an. »Also holt euer Handgepäck.«
»Und dann?«, fragte Ilse.
»Dann gehen wir in einen Raum, hat uns der Mann erklärt. Dort warten wir, bis das Schiff angelegt hat, und dann dürfen wir bald an Land und müssen nicht so lange warten.«
»In einen Raum?« Ilse schüttelte den Kopf. »Ich will aber an Deck bleiben und sehen, wie wir anlegen.«
»Und dann eine der Letzten sein, die an Land gehen?«, fragte Ruth sie. »Sei keine Gans.«
»Aber … aber …«, wandte Ilse ein, doch Martha schnitt ihr das Wort ab.
»Keine Widerrede! Holt eure Sachen! Vati veranlasst gerade, dass unser Gepäck auch schnellstmöglich von Bord gebracht wird.«
Sie holten ihr Handgepäck, dann führte der Mann die Familie Meyer und einige andere in einen Raum auf dem Unterdeck. Sie alle hatten ihn dafür bezahlt, als Erste von Bord gehen zu können, und freuten sich nun darauf, bald schon das sichere Land betreten zu können. Der Raum hatte keine Fenster und nur zwei Glühlampen. Es gab einige Bänke, aber nicht genügend für alle. Unsicher schauten sie sich um. Der Mann nickte ihnen zu und trat zurück in den Gang, schloss die Tür. Sie hörten, dass ein Riegel vorgeschoben wurde.
»Was soll das?«, fragte jemand verunsichert. »Hat er uns etwa eingeschlossen?«
Ruth ging zur Tür, drückte den Griff hinunter – doch die Tür ließ sich nicht öffnen. Erschrocken drehte sie sich um.
»Das ist sicherlich nur eine Vorsichtsmaßnahme«, sagte jemand beruhigend. »Damit niemand, der nicht bezahlt hat, hier hereinkommt. Sobald das Schiff angelegt hat, wird uns geöffnet werden.«
»Ja«, sagten nun einige erleichtert und atmeten auf. »So wird das sein«, versicherten sie sich gegenseitig.
Es gab ein Fenster, aber das war sehr weit oben und klein, außerdem ging es zum Hafen und nicht zum Pier hinaus. Einige stellten einen Tisch unter das Fenster und kletterten darauf, um hinauszuschauen. Doch viel zu sehen war nicht. Die Motorengeräusche änderten sich, man hörte dumpfe Schläge.
»Jetzt hat das Schiff angelegt«, sagte jemand, und tatsächlich wurden die Turbinen nun ausgestellt. Immer noch konnte man dumpfe, aber sehr viel leisere Maschinengeräusche hören. Auch das Trappeln von Füßen war zu vernehmen.
Ruth fand die Geräusche, die sie nicht wirklich orten konnte, unheimlich. Ilse drückte sich an ihre Schwester, auch sie fürchtete sich.
»Wir sind in Amerika«, versuchte Ruth sie zu beruhigen. »Wir sind endlich in Amerika.«
Ich sollte jetzt erleichtert sein. Glücklich. Ich sollte unendlich glücklich sein, euphorisch. Aber ich bin es nicht, stellte sie fest. In mir ist eine große Leere, wie ein Vakuum. Ich fühle gar nichts, noch nicht einmal Traurigkeit.
»Wir sind in Amerika«, wiederholte Ilse. Ihre Stimme klang glücklich und erleichtert. »Jetzt wird alles anders. Unser ganzes Leben wird sich verändern.«
Ja, dachte Ruth, unser ganzes Leben wird sich wieder einmal verändern. Aber ob es besser wird? Sie hatte einige Zweifel.
Ihre Eltern saßen nebeneinander, hielten sich an den Händen. Martha wirkte befreit, sie lächelte – Karls Gesicht hingegen blieb angespannt. Immer wieder schaute er auf seine Uhr. Schließlich stand er auf.
»Jetzt müsste er doch endlich die Tür öffnen«, brummte er unzufrieden. »Wir sind doch schon angelandet.«
»Ach, so etwas kann dauern«, sagte ein Mann. »Das ist ja ein großes Schiff und keine Jolle.«
»Dennoch«, sagte ein anderer, »wir sind da, das Schiff steht, und wir sollen die Ersten sein, die von Bord gehen. Dafür haben wir bezahlt. Dann können sie uns auch jetzt die Tür öffnen.«
»Die erste Klasse ist noch vor uns dran«, meinte eine Frau und rümpfte die Nase. »Die Reichen und Schönen haben immer und überall Vorrang.«
»Aber nicht in Amerika«, sagte eine andere Frau. »Hier sind alle gleich. Und hier ist es auch egal, ob man Jude ist oder nicht.«
Martha sah sie an und lächelte. »Ja, so wird es sein«, sagte sie fast fröhlich. »Genau so. Deshalb sind wir hierhergekommen.« Sie schluckte, strich sich über die Haare. »Hier wird vermutlich alles anders werden.«
Die Frau stand auf, setzte sich neben Martha. »Hoffentlich. In Deutschland war es schlimm genug, schlimmer kann es hier ja nicht sein.« Sie reichte Martha die Hand. »Eleonore Grüneberg. Dort drüben ist mein Mann Friedrich und dort mein Sohn Hans.«
»Grüneberg?« Martha runzelte die Stirn. »Sind Sie aus Düsseldorf? Dort kenne ich Grünebergs.«
»Wir sind aus Brandenburg, haben zuletzt in Berlin gelebt. Von Verwandtschaft im Rheinischen weiß ich nichts.«
»Ach, aber das hätte ja sein können«, sagte Martha. »Ich bin Martha Meyer. Mein Mann Karl, meine Töchter Ruth und Ilse. Wir kommen aus Krefeld am Niederrhein.«
»Wir sind aus Wuppertal – ursprünglich«, sagte eine andere Frau und gesellte sich zu Martha. »Haben aber im letzten Jahr bei Verwandten in England gewohnt.«
»Ich bin aus Köln. Mein Mann ist schon in New York«, sagte eine weitere Frau.
Wie seltsam, dachte Ruth, wir sitzen hier seit mindestens drei Stunden in dem kleinen Raum, und jetzt, wo wir gleich gehen dürfen, bricht das Eis. Einige Leute kannten sich schon von den Mahlzeiten, andere hatten sich an Deck getroffen und stellten jetzt erst fest, dass sie ja vorher Kontakt gehabt hatten.
Hier zu sitzen und auf das gute Ende zu warten scheint uns blind gemacht zu haben, resümierte Ruth. Wir hatten uns nur selbst im Blick – uns und das Schiff. Wir wollen alle raus, wollen weg, dabei sitzen wir in demselben Boot und scheinen wieder einmal gefangen zu sein. Sie lauschte; immer mehr Schritte waren zu hören – irgendwo über ihnen. Neue Geräusche kamen auf, aber auch die waren für Ruth nicht genau zu orten. Ihre Mutter und die anderen Frauen unterhielten sich nun angeregt, und auch die Männer tauten langsam auf, fingen Gespräche an. Ruth war nicht auf Geplänkel und seichte Konversation aus. Sie wollte weg von dem Schiff, wollte an Land, selbst wenn ihr der Gedanke an das neue Leben Bauchschmerzen bereitete. Es würde nicht einfach werden – wie auch? Als sie nach England gekommen war, hatte sie einen festen Job – und somit Unterkunft, Verpflegung und eine kleine Entlohnung für ihre Arbeit. In Amerika hatte sie das nicht – keiner von ihrer Familie. Ruth wusste, dass es einige Rücklagen gab, aber die schrumpften täglich und würden nicht ewig halten. Hier in diesem Raum – sie sah sich noch einmal um – waren gut vierzig Menschen, etwa zehn Familien. Das war ein Bruchteil der Familien, die auf diesem Schiff waren – ein Bruchteil all der Einwanderer, die nach Amerika kamen. Gab es für alle Arbeit? Gab es neue Existenzmöglichkeiten? All das würde sich noch zeigen müssen.
»Wo wollen Sie hin?«, fragte ein dickleibiger Mann Karl. »Nach Chicago?«
»Ja, dort haben wir Freunde und Verwandte. Sie haben schon eine Wohnung für uns angemietet.«
»Und wie wollen Sie da hinkommen?«, fragte der Dicke und zündete sich eine Zigarre an.
»Mit dem Zug natürlich. Wieso fragen Sie?«
»Lieber Herr Meyer, waren Sie schon mal in den Staaten?«, fragte der Dicke. Er beugte sich zu Karl und klopfte ihm auf die Schultern. Ruth beobachtete das Geschehen und fühlte sich unwohl dabei. Der Mann wirkte freundlich, aber die Freundlichkeit erreichte nicht seine Augen. Ruth setzte sich neben ihren Vater, um das Gespräch weiter zu verfolgen.
»Nein, war ich noch nicht«, gestand Karl. »Aber wir haben Freunde und Verwandte hier.«
»Wenn wir gleich vom Schiff kommen, werden wir in die Aufnahmestation gelangen. Dort wird jeder von uns untersucht. Genau untersucht.«
Auch andere hatten dem Gespräch gelauscht. »Untersucht? Wieso? Wir sind doch nicht an Ellis Island angekommen, sondern am Terminal der Reederei«, sagte ein Mann.
Der Dicke stand auf. »Gestatten, mein Name ist Goldblum, Harry Goldblum. Meine Brüder wohnen in New York und haben dort einen Edelsteinhandel. Sie leben schon seit Jahren in New York, und sie haben mir geschrieben, dass alle Einwanderer trotzdem geprüft werden. Jetzt, wo so viele kommen. Wenn jemand von Ihnen hier eine Reise mit Rückfahrt nach Europa gebucht hat, sieht das natürlich anders aus – diese Personen müssen nur ein, zwei Fragen beantworten. Der Rest wird untersucht und geprüft – wie auf Ellis Island, nur dass wir hier an einer anderen Stelle des Hafens sind.«
Ein Raunen ging durch den Raum.
»Aber man hatte uns doch versprochen, dass wir unkompliziert von Bord und an Land gehen können«, sagte Karl.
»Ja, genau«, stimmten andere ein.
»Ich glaube nicht, dass die Bedingungen in den letzten Wochen geändert wurden. Damit müssen wir uns einfach abfinden«, sagte Goldblum. Er sah in die Runde. »Selbst wenn wir jetzt schnell von Bord kommen, wird es eine Weile dauern, bis wir tatsächlich in der Stadt sind.«
»Aber … aber wir wollen noch weiter … wir wollen nach Chicago. So schnell es geht«, sagte Karl.
Goldblum nickte. »Das wird nicht so einfach werden, oder haben Sie Verwandtschaft in New York?«
»Eine entfernte Cousine«, antwortete Karl nachdenklich. »Ich hatte ihr vor unserer Abreise gekabelt, aber natürlich noch keine Antwort bekommen, wie auch? Allerdings habe ich eine Telefonnummer und wollte anrufen, sobald wir an Land sind.«
Goldblum nickte. »Das ist ein guter Plan. Und Ihre Cousine hat schon Bahnfahrkarten für Sie?«
»Nein, natürlich nicht«, sagte Karl. »Wir wollten eigentlich direkt zum Bahnhof.«
Nun seufzte Goldblum. »Das wird aber schwierig«, sagte er leise. »Wissen Sie«, er räusperte sich, »es fährt nicht jeden Tag ein Zug nach Chicago, und an Tagen wie heute, wenn ein großes Schiff angekommen ist, sind die Fahrkarten schnell weg. Tatsächlich fährt heute kein Zug mehr dorthin.«
»Woher wollen Sie das wissen?«, fragte ein anderer Mann.
»Das haben mir meine Brüder geschrieben«, sagte Goldblum. »Sie haben in den letzten Monaten so manches Elend und etliche Probleme jüdischer Einwanderer mitbekommen.« Er senkte den Kopf und seufzte wieder.
»Aber morgen fährt ein Zug nach Chicago?«, fragte Karl.
»Ja, das schon. Morgen fährt ein Zug.«
»Und nach Boston? Wann fährt ein Zug nach Boston?«, wollte jemand wissen.
»Wir wollen nach Tennessee, da haben wir Verwandtschaft«, fiel nun ein anderer ein. »Fahren denn Züge nach Tennessee?«
»Mein Bruder Joseph hat gute Verbindungen zur Bahn«, sagte Goldblum nun. »Sobald wir an Land sind, werde ich ihn anrufen. Soll er versuchen, Zugfahrkarten für Sie zu bekommen?«
Die Männer nickten, sie standen auf und gingen zu ihm. Schnell hatte Goldblum ein Notizheft gezückt und schrieb sich die Zielorte und die Anzahl der gewünschten Fahrkarten auf. »Preise kann ich Ihnen jetzt noch nicht nennen«, sagte er bedauernd.
»Das ist doch nicht wichtig. Die Karten müssten wir ja so oder so kaufen«, sagte jemand. »Aber nun können wir Zeit sparen, und Ihr Bruder weiß sicher besser über das Zugsystem hier Bescheid als wir.«
»Ja! Ja!«, stimmten ihm die anderen zu.
Es dauerte eine Weile, bis Goldblum alle Aufträge notiert hatte. Zufrieden steckte er das Notizbuch zurück in seine Tasche.
»Ich finde ihn merkwürdig«, flüsterte Ruth ihrer Mutter zu.
Martha nickte. »Ich auch, aber Vati scheint ihm zu vertrauen, und Vati wird schon wissen, was er tut.«
»Wenn wir erst morgen nach Chicago fahren können, was machen wir dann heute?«, fragte Ilse. »Wo werden wir schlafen?«
»Vati wird seine Cousine zweiten Grades anrufen. Sie wohnt in New York. Sicherlich wird sie uns für eine Nacht aufnehmen«, sagte Martha, aber Ruth hörte den Zweifel in ihrer Stimme.
»Was für eine Cousine ist das?«, wollte Ruth wissen.
»Irene. Erinnert ihr euch nicht an Tante Irene? Du zumindest, Ruth, könntest dich noch an sie erinnern. Sie hat zwei Töchter, die etwa so alt sind wie ihr. Sie sind vor sechs oder sieben Jahren nach Amerika gegangen.«
Ruth dachte nach. »Ich glaube, ich weiß noch, wer das ist. Die eine Tochter heißt Doris, nicht wahr?«
»Ja, das stimmt. Und die andere heißt Regine. Ihr habt euch früher gut verstanden, auch wenn wir uns nicht oft getroffen haben.«
»Warum bleiben wir dann nicht in New York, sondern gehen nach Chicago«, fragte Ilse. »Das ist doch Verwandtschaft …«
Martha verzog das Gesicht zu einem schrägen Lächeln. »Irene fand sich außerstande, uns zu helfen – auch nicht mit den Papieren und den anderen Sachen. Sie möchte … keine Verantwortung übernehmen, glaube ich.«
»Aber das muss sie doch nicht«, sagte Ilse empört, »das tut doch Vati.«
»Irene ist sehr eigen«, sagte Karl, der sich nun wieder zu seiner Familie setzte. »Das war sie schon immer. Das macht aber auch nichts, wir haben ja Freunde, die uns geholfen haben. Und diese Freunde wohnen in Chicago. Deshalb ziehen wir auch dort hin.« Er faltete einen Zettel sorgfältig zusammen und schob ihn in seine Brieftasche. »Immerhin werden wir wohl heute noch Zugfahrkarten haben. Es soll ein besonders schneller Zug sein und sehr komfortabel, deshalb sind die Fahrkarten auch etwas teurer.«
»Hauptsache, wir kommen bald hier heraus«, sagte Ruth voller Sorge. »Ich höre die ganze Zeit Schritte über uns, und ich meine auch Stimmen von draußen gehört zu haben. Viele Schritte und viele Stimmen. So viele Menschen waren doch gar nicht in der ersten Klasse.«
Auch die anderen wurden nun wieder unruhig. Inzwischen waren fast drei Stunden vergangen, seit das Schiff angelegt hatte.
Jemand stand auf und rüttelte an der Tür. »Hallo?«, rief er. »Hallo? Ist dort jemand?« Aber niemand antwortete.
»Sie haben uns hier eingesperrt«, sagte Ilse leise. Tränen stiegen in ihre Augen. »Was, wenn sie uns nicht mehr herauslassen?«
Martha wurde bleich und legte ihre Hand auf ihr Herz. Ihr Atem wurde schneller.
»Sie werden uns schon herauslassen«, sagte Ruth ruhiger, als sie sich fühlte. Es war beklemmend, eingesperrt zu sein; düstere Bilder wollten sich aufbauen. Ruth versuchte alles, um sie zurückzudrängen.
»Ist hier eine Toilette?«, fragte eine Frau zaghaft.
»Nein, ich habe vorhin schon gesucht. Dort hinten ist nur ein kleiner Abstellraum«, antwortete eine andere. »Dort sind Putzmittel … und ein Eimer.« Sie räusperte sich verlegen.
»Oh. Nun, in der Not …«
Nach und nach suchten etliche die Kammer auf, und der scharfe Geruch von Urin vermischte sich mit dem sauren des Schweißes, der den Raum mehr und mehr erfüllte.
Ich halte das nicht mehr lange aus, dachte Ruth. Was, wenn sie uns hier drin lassen und wieder zurück nach England bringen? War etwa alles umsonst gewesen?
Die Unruhe wurde lauter. Mehrere Männer versuchten, die Tür zu öffnen, sie pochten dagegen, riefen laut, suchten nach Werkzeug – doch es war nichts Brauchbares zu finden. Die Rufe wurden immer lauter, sie schlugen mit den Fäusten gegen die Tür, traten dagegen, und endlich hörten sie jemanden kommen.
»Was machen Sie denn hier drin?«, fragte ein Steward überrascht.
»Jemand hat uns hier eingeschlossen.«
»Dann sehen Sie zu, dass Sie von Bord kommen, es sind schon fast alle an Land«, sagte er und rümpfte die Nase. »Was stinkt denn hier so furchtbar?«
Sie antworteten ihm nicht, sondern drängten sich an ihm vorbei in den Gang.
»Der Kerl hat uns betrogen«, sagte Karl. »Er hat uns das Geld abgenommen und uns dann eingesperrt.«
»Nun gräm dich nicht«, versuchte Martha ihn zu trösten. »Schau, wie viele auf ihn hereingefallen sind.«
»Da sind wir Hitler, diesem Verbrecher, entkommen, er hat uns alles genommen, und nun gibt es auch hier Schmocks, die uns bestehlen und betrügen.« Karl war fassungslos. »Es sollte doch alles besser werden.«
»Es wird sicher besser, Vati«, sagte Ruth. »Aber wir werden uns dennoch in Acht nehmen müssen. Böse Menschen gibt es überall auf der Welt.«
»Ob das ein Nazi war?«, fragte sich Karl. »Ob das ein Nazi war, der es gezielt auf uns abgesehen hat?«
»Diese Gedanken bringen doch nichts.« Martha fasste seinen Arm.
Sie stiegen die Treppe hoch und kamen an Deck. Nur kurz blieb Ruth stehen und sah auf die Stadt, die all ihre Vorstellungen übertraf. Natürlich hatte sie Bilder von New York gesehen, aber die Hochhäuser, die Skyscrapers, nun tatsächlich vor sich zu haben, ließen sie den Atem anhalten – jedoch nur kurz, dann sog sie die Luft ein, die von Rauch und Öl geschwängert, aber trotzdem doch so viel besser war als die unter Deck.
Skyscrapers, dachte sie – Wolkenkratzer – das Wort passt. Es sah tatsächlich so aus, als würden die Häuser den Himmel berühren.
Ihr Blick schweifte über den Hafen, der voller Betriebsamkeit war. In der Ferne konnte sie die Straßen voller Automobile sehen. Es war laut und hektisch. Und es machte ihr Angst.
New York ist noch viel größer als London, und ich dachte, London wäre riesig und voll – aber so etwas habe ich mir nicht vorstellen können. Ob Chicago auch so ist? Wie soll ich mich jemals in so einer Stadt zurechtfinden? Ach, wie schön doch unser beschauliches Krefeld war. Die Wehmut schwappte wie eine Welle über sie, aber Ruth wusste, für solche Gefühle war nun keine Zeit.
Sie gingen die Gangway hinunter und auf den Pier.
Karl machte einen großen Schritt, dann blieb er stehen. »Nun betreten wir das erste Mal amerikanischen Boden. Das ist unser gelobtes Land, das Land der Freiheit und der Hoffnung. Mögen sich unsere Wünsche und Gebete erfüllen.«
»Amen«, sagte Martha, und Ruth und Ilse schlossen sich dem an. »Amen.«
Es gab nur einen Weg, den sie gehen konnten – zu einem großen Gebäude aus grauem Sandstein. Dort mussten sie sich in einen großen Saal begeben. Hier drängelten sich die Leute dicht an dicht. Ruth stellte sich auf die Zehenspitzen und versuchte, über die Köpfe der Menschen hinwegzuschauen. Sie erspähte eine Art Tresen, vor dem die Menschen in drei Schlangen anstanden. Dahinter waren Vorhänge.
Es war laut in dem Saal, und die Luft war schlecht. Stühle oder Bänke gab es nicht, und so manch einer hatte sich auf den Boden gesetzt. Auch Martha schaute sich suchend um, dann wandte sie sich an eine Frau, die auf ihrem Koffer saß.
»Gibt es hier irgendwo Toiletten?«, fragte sie.
Die Frau nickte und zeigte zur linken Wand. Dort waren zwei weitere lange Schlangen.
»Und gibt es hier irgendwo etwas zu trinken?«, wollte Martha wissen. Die Frau schüttelte den Kopf.
»Das kann doch nicht sein«, sagte Martha zu Karl. »Es muss doch etwas Versorgung geben. Wenigstens Wasser.«
»Wahrscheinlich gibt es das draußen«, meinte Karl. »Es wird hier schon nicht so lange dauern.« Sein Gesichtsausdruck hingegen sprach andere Worte, fand Ruth.
»Wir warten hier schon seit drei Stunden«, sagte ein Mann neben ihnen. »Es wird sicher noch ewig dauern.«
»Gibt es hier wenigstens einen Fernsprecher?«, wollte Karl wissen.
»Dort vorne.«
Vor dem Fernsprecher standen nur wenige Leute. »Ich werde versuchen, Irene anzurufen«, sagte Karl. »Wartet hier.«
»Als ob wir irgendwo hingehen könnten«, maulte Ilse. »Ich habe Durst. Und Hunger.«
»Hast du nicht gefrühstückt?«, fragte Martha.
»Nur ein wenig, ich war zu aufgeregt«, antwortete Ilse. »Und wer konnte schon ahnen, dass Vati sich in eine Falle hat locken lassen und wir stundenlang eingesperrt waren, und jetzt werden wir weitere Stunden hier warten müssen, bis wir endlich in die Stadt können.« Sie schob die Unterlippe vor.
»Erst einmal müssen Sie durch die Kontrollen«, sagte der Mann neben ihnen. »Ich habe gehört, dass ein Arzt einen untersucht und man nur in das Land gelassen wird, wenn man gesund ist.«
Entsetzt sah Ilse erst ihn, dann ihre Mutter an. »Mutti, stimmt das?«
Martha seufzte. »Ich weiß es nicht.«
»Wahrscheinlich stimmt es«, sagte Ruth leise und beschwichtigend. »Aber wir sind ja gesund und haben nichts zu befürchten.«
»Was ist mit meinen Augen?«, fragte Ilse voller Angst. »Ich kann doch nicht gut sehen.«
»Ich wette, jede Menge Amerikaner können auch nicht gut sehen. Das werden sie sicher nicht meinen, Ilse. Es geht bestimmt eher um Krankheiten wie Krätze oder Tuberkulose. Schlimme und ansteckende Krankheiten.«
»Meinst du, dass sie die Kranken wirklich wieder zurückschicken? Obwohl Krieg ist?«, fragte ihre Schwester fast lautlos.
Ruth überlegte. »Ich weiß es nicht«, sagte sie dann. Ich glaube jedoch, dass sie es tatsächlich tun, dachte sie. Menschen können grausam sein, wenn sie sich vermeintlich schützen wollen. Und auch Krankheiten sind Bedrohungen. Die Amerikaner waren da nicht anders als andere Völker, das hatte ja ihr Verhalten in den letzten Jahren gezeigt. Obwohl die Juden mehr und mehr verfolgt wurden, hatten sie ihre Quote nicht erhöht und nicht mehr Schutzsuchende aufgenommen.
Jetzt aber sind wir hier, sagte sich Ruth. Und wir haben die Chance, uns ein neues Leben aufzubauen, fern von den Nazis.
Doch zuerst mussten sie durch die Kontrollen, und das dauerte. Es dauerte auch, bis Karl zurückkam.
»Hast du Irene erreicht?«, fragte Martha. Karl nickte, er sah jedoch nicht zufrieden aus.
»Wir sollen uns melden, wenn wir hier fertig sind. Sie versucht, eine Unterkunft für uns zu bekommen. Erfreut klang sie nicht.«
»Und das nach allem, was Omi und Opi für sie getan haben«, meinte Martha und rümpfte die Nase.
»Irene hat es auch nicht einfach gehabt, das hat sie hart gemacht.«
»Warum hatte sie es nicht einfach?«, wollte Ruth wissen.
»Ihre Mutter, die Schwester von Omi, ist früh gestorben, deshalb war sie als Kind oft bei uns. Sie hat sehr getrauert und die Liebe, die ihr Omi schenken wollte, nicht angenommen. Und dann hat sie Helmut kennengelernt und ihn geheiratet. Sie hat ihn schon vor Jahren überredet, nach Amerika auszuwandern. Er wollte nicht, hat ihr aber nachgegeben. Sie bekamen die Papiere – damals war das alles noch einfacher –, aber eine Woche vor ihrer Abreise ist Helmut gestorben. Er hatte ein schwaches Herz«, erklärte Karl.
»Irene war sehr verbittert«, erinnerte sich Martha. »Sie meinte immer, er wäre gestorben, um nicht auswandern zu müssen.«
Karl nickte. »Sie ist mit den beiden Mädchen trotzdem gefahren und hat hier ihr Leben aufgebaut. Omi hat ihr immer geschrieben, aber Antworten kamen nur selten und in den letzten Jahren gar nicht mehr. Das hat unsere Omi sehr traurig gemacht.«
»Immerhin besorgt sie uns eine Unterkunft«, meinte Ruth und beschloss, sich auch auf den Boden zu setzen. Die Schlangen vor dem Tresen schienen gar nicht kürzer zu werden.
Kapitel 2
Die Zeit schien nicht zu vergehen. Sie saßen auf dem kalten Steinboden und warteten. Nur sehr langsam ging es voran. Am frühen Nachmittag hatte irgendwer Erbarmen und brachte Wasser, so dass sie wenigstens etwas trinken konnten. Zu essen gab es jedoch nicht. Die kleinen Kinder und auch manch alte Leute jammerten und weinten. So hatte sich bestimmt niemand die Einreise in das ersehnte Land vorgestellt.
Es dämmerte schon, als sie schließlich an die Reihe kamen – sie waren unter den Letzten, aber sie waren ja auch erst spät von Bord gekommen.
Tatsächlich mussten sie alle ihre Papiere vorlegen, wurden nach Schulabschluss und Berufen befragt, wohin sie gehen würden, und auch ihre finanziellen Belange wurden geprüft. Dann wurden sie einzeln hinter den Vorhang gewinkt.
»Ausziehen«, sagte eine Frau in einer Uniform. Ihr Gesicht war grau, und sie wirkte müde.
Sicherlich ist sie auch schon den ganzen Tag auf den Beinen, dachte Ruth und empfand etwas Mitleid mit ihr.
Schnell zog sie sich bis auf die Unterwäsche aus. Es war kalt hier in dem Gebäude, und auch Ruth war erschöpft. Zitternd legte sie die Arme um ihren Oberkörper.
»Nein«, sagte die Frau. »Arme ausstrecken und langsam umdrehen.«
Ruth folgte der Weisung. Dann wurde sie abgehört, ihr wurde in die Ohren geschaut und auch auf die Kopfhaut. Die Frau sprach kaum ein Wort, und wenn, waren es harsche Befehlstöne.
Sie macht nur ihre Arbeit, sagte sich Ruth, als sie sich endlich wieder anziehen durfte.
Die Frau wies auf eine Tür. »Dort hinein!«
»Ist dort meine Familie?«, wollte Ruth wissen, doch die Frau antwortete ihr nicht. »Der Nächste«, rief sie.
Schnell nahm Ruth ihr Handgepäck und ging durch die Tür. Dahinter war ein weiterer Wartesaal – aber er war kleiner und hatte große Fenster, die zur Straße zeigten.
»Ruth, endlich«, sagte Martha erleichtert und schloss ihre Tochter in die Arme. Auch Vati und Ilse waren schon da.
»Und?«, fragte Ruth bange. »Dürfen wir einreisen?«
»Offensichtlich sind wir das nun«, sagte Karl und lächelte müde. »Sobald wir auf die Straße treten, sind wir in Amerika und können so schnell nicht mehr abgeschoben werden.«
»Werden denn Leute wirklich zurückgeschickt?«
Martha wies auf einen Bereich, der durch ein Gitter von der Halle abgetrennt war. Dort saß eine kleine, jämmerliche Schar von Menschen.
»Ich glaube, diese hat man ausgenommen.«
»Müssen sie zurück?«, fragte Ruth erschrocken.
»Das kommt darauf an«, sagte eine tiefe Stimme hinter ihr. Abrupt drehte sie sich um und sah Herrn Goldblum. »Ich habe auf Sie gewartet«, erklärte er und lächelte breit. »Das hat ja lange gedauert.« Er hielt einen Umschlag in der Hand. »Hier sind Ihre Fahrkarten nach Chicago. Mein Bruder hat sie wie versprochen besorgt.«
Erleichtert nickte Karl und zückte seine Brieftasche. Nachdem sie das Geschäft abgeschlossen hatten und ihr Vater die Fahrkarten eingesteckt hatte, wandte sich Ruth an Goldblum.
»Worauf kommt es an?«
Verwirrt musterte er sie.
»Sie haben gesagt, es kommt darauf an, ob die Menschen zurückgeschickt werden oder nicht. Aber worauf kommt es denn an?«
»Ach so. Nun, darauf, weshalb sie nicht einreisen dürfen – es gibt verschiedene Gründe. Manche fälschen ihre Papiere oder stehlen Schiffskarten – die werden selten hineingelassen oder nur, wenn sie hier Bürgen haben. Andere sind krank, dann müssen sie eventuell in Quarantäne. Aber das muss dich ja nicht beschäftigen, denn ihr habt es ja schließlich geschafft, nicht wahr?« Er drehte sich zu Martha und Karl um. »Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Neuanfang hier in den Staaten und viel Glück.« Dann verschwand er so plötzlich in der Menge, wie er aufgetaucht war.
»Ich habe nicht damit gerechnet, dass er wirklich kommt und uns die Karten bringt. Ich dachte, er wäre auch ein Betrüger«, sagte Karl und wischte sich über die Stirn. »Und nun gehe ich Irene anrufen. Es wird Zeit, dass wir hier herauskommen.«
Ja, dachte Ruth, es ist es wirklich Zeit. Karl ging zum Fernsprecher und ließ sich mit seiner Cousine verbinden. Er war zu weit weg, so dass sie nicht hören konnten, was er sagte. Doch seine Körperhaltung und wie er mit der freien Hand fuchtelte, sprach Bände, fand Ruth. Das Gespräch lief nicht so, wie er es sich erhofft hatte. Auch Martha erkannte das und seufzte leise vor sich hin. Schließlich kehrte er zurück, das Gesicht voller Sorgenfalten.
»Kommt«, sagte er nur. Zum Glück hatten sie ihr Gepäck, das von Bord gebracht worden war, schon erhalten. Sie nahmen die Koffer und ihr Handgepäck und gingen zum Ausgang.
»Jetzt«, sagte Ruth und lächelte ihrem Vater zu, als sie nach draußen traten. »Jetzt erst ist es der Schritt in das neue Land.« Fest trat sie auf den Boden.
Über Karls Gesicht huschte ein Lächeln. »Du hast recht. Wir sind hier, wir haben Zugfahrkarten, und in Chicago haben wir eine Wohnung. Ein paar kleine Hürden müssen wir noch nehmen, dann aber können wir endlich ankommen und unser neues Leben beginnen.«
»Wo ist denn Tante Irene?«, fragte Ilse. »Ich habe Hunger und Durst. Und ich bin müde.«
»Sieh mal«, sagte Ruth und zeigte zu einem kleinen Stand auf Rädern, der am Straßenrand stand. »Ich glaube, dort bekommt man etwas zu essen.«
Karl nickte. »Komm, Ruth, wir schauen, ob wir etwas zu essen auftreiben können. Martha, du bleibst mit Ilse bei unserem Gepäck.«
»Holt uns Tante Irene ab?«, fragte Ruth, während sie zu dem Stand gingen. Es roch lecker, aber so ganz konnte sie den Geruch nicht einordnen.
»Wir nehmen uns gleich ein Taxi und fahren zu Irene«, sagte Karl grimmig. »Auch wenn sie gar nicht begeistert davon ist.«
»Sie will nicht, dass wir kommen?«
»Sie hat wieder geheiratet. Einen Amerikaner. Sie möchte mit ihrem alten Leben ganz abschließen, und nun kommen wir.«
»Was machen wir jetzt?«, fragte Ruth erschrocken.
»Nach einigem Hin und Her nimmt sie uns trotzdem auf. Nur für diese eine Nacht. Und ohne weitere Verpflichtungen, sollten wir hier Probleme haben.« Karl schnaufte. »Ich bin froh, dass meine Mutter damals nicht so gedacht hat wie Irene jetzt, sondern sie immer mit offenen Armen empfangen hat.«
Sie waren bei dem kleinen Stand angekommen. »Hot Dog« stand auf dem Schild, las Ruth verwundert. »Ich glaube nicht«, sagte sie leise, »dass das etwas für uns ist.«
»Wieso?«
»Da steht, hier gibt es heißen Hund. Wusstest du, dass Amerikaner Hundefleisch essen?«
»Nein, nein!«, rief der Mann hinter dem Stand und lachte laut. Er sprach Deutsch. »Es ist kein Hundefleisch. Es sind Wiener Würstchen in einem Brötchen. Schau, so sieht das aus.« Er hielt einen Hot Dog hoch. »Ich nehme an, dass ihr gerade erst angekommen seid? Herzlich willkommen in Amerika, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten.«
»Sie sind aus Deutschland«, sagte Ruth erleichtert.
»Seit wann sind Sie hier?«, wollte Karl wissen. »Und was hat das mit dem Hund auf sich?«
»Ich bin schon seit acht Jahren in New York«, antwortete der Mann. »Kann mir gar nicht mehr vorstellen, woanders zu leben.«
»Sind … sind Sie Jude?«, fragte Ruth leise.
Er schüttelte den Kopf. »Ich bin Kommunist«, sagte er leise. »Und ich habe hier für mich eine sicherere Zukunft gesehen als in Deutschland.« Er sah Karl an. »Die Würstchen sind wirklich lecker. Wollen Sie welche?« Er blickte über Karls Schulter. Ruth drehte sich um, hinter ihnen warteten inzwischen schon andere Passanten.
Karl war unschlüssig, wie Ruth bemerkte. »Ja«, sagte sie deshalb schnell. »Vier Würstchen.« Sie sah ihren Vater an, er nickte.
Schnell holte der Mann mit einer Zange die Würstchen aus einem dampfenden Behälter und legte sie in die aufgeschnittenen Brötchen. »Welche Zutaten? Ich habe Sauerkraut, rote Bohnen, geröstete Zwiebeln oder gepickeltes Gemüse?« Fragend sah er Ruth an.
»Wie isst man die denn hier?« Ruth war verwirrt.
»Wie man es am liebsten mag. Ich empfehle Sauerkraut und Röstzwiebeln.«
Ruth schaute auf das Brötchen, das nicht so aussah wie die Brötchen, die sie aus Deutschland kannte. Doch ihr Magen knurrte, und der Duft der gekochten Würste verlockte sie. »Das ist aber keine große Portion«, murmelte sie unentschlossen.
»Wir nehmen acht Würste«, entschied Karl. »Viermal mit Sauerkraut, viermal mit Bohnen und alle mit Röstzwiebeln.«
»Ketchup oder Senf?«
»Senf«, sagte Karl.
Sicher und geschickt bestückte der Mann alle acht Brötchen mit den gewünschten Zutaten. Ruth überlegte fieberhaft, wie sie die acht Brötchen denn transportieren sollten, da sie gesehen hatte, dass er den vorherigen Kunden das Brötchen mit einer Papierserviette in die Hand gedrückt hatte. Doch nun legte der Verkäufer die Hot Dogs in einen Pappkarton und reichte ihn Ruth. Karl nahm sein Portemonnaie hervor und bezahlte. In England schon hatte er Dollar eingetauscht, und nun war er froh darüber, Bargeld zu haben. Gerade als ihm der Mann das Wechselgeld reichen wollte, fiel Karl noch etwas ein. »Haben Sie auch Getränke?«
»Natürlich. Coke? Oder Limonade?«
»Coca-Cola«, seufzte Ruth verzückt.
»Vier Flaschen, bitte«, sagte Karl und lächelte seiner Tochter zu.
Und so aßen sie ihre erste und sehr amerikanische Mahlzeit auf dem Bürgersteig vor dem Terminal der Cunnard-Line in New York.
»Es schmeckt … ungewohnt«, sagte Ilse. Sie wischte sich den Mund ab und nahm den zweiten Hot Dog. »Aber lecker.«
»Ja, es ist ungewohnt. Wahrscheinlich werden wir uns an so manch andere Sachen noch gewöhnen müssen«, seufzte Martha, aber auch sie aß mit großem Appetit. »Vielleicht hättest du lieber Wasser zum Trinken mitbringen sollen, die Coca-Cola ist natürlich lecker, allerdings auch sehr süß.«
Ruth schmunzelte. Irgendwas hat Mutti ja immer, dachte sie und nahm noch einen großen Schluck Cola. Sie liebte das Getränk, hatte es aber schon lange nicht mehr getrunken. Die jüdischen Geschäfte in Krefeld hatten es nicht im Angebot, und in England hatte sie keine Gelegenheit gehabt, es zu kaufen.
»Was machen wir jetzt?«, fragte Martha, nachdem sie aufgegessen hatten. »Kommt uns Irene abholen?«
»Wir nehmen ein Taxi und fahren zu ihr.« Karl sah sich um. Auf der anderen Straßenseite standen Taxis. Schnell hatte er ein freies Fahrzeug gefunden. Sie stiegen ein, und Karl nannte dem Mann hinter dem Steuer die Adresse. Doch der Fahrer sah ihn nur verständnislos an. Obwohl Martha und Karl sich in Slough bemüht hatten, Englisch zu lernen, war die Kommunikation noch sehr holprig. Martha nahm ihrem Mann den Zettel aus der Hand und reichte ihn dem Fahrer.
»Ah, Queens«, sagte er und fuhr los.
»Wo sind wir denn hier?«, fragte Ruth.
»Brooklyn«, antwortete er knapp und zündete sich eine Zigarette an.
Sie fuhren an Lagerhallen und Industriegebäuden vorbei und kamen in die Straßenschluchten. Ruth und Ilse sahen aus den Fenstern, sprachlos und überwältigt von den hohen Gebäuden, den vielen Menschen und dem Verkehr.
»Ist es immer so voll?«, wollte Ruth wissen.
»Heute geht’s noch.«
»Wofür sind die Leitern an den Häusern?«, fragte Ilse erstaunt.
»Das sind Feuerleitern.« Der Fahrer drehte sich um, grinste. »Seid wohl gerade erst angekommen, was? Woher?«
»England«, sagte Ruth. »Davor Deutschland.«
»Dann seid ihr nicht zu Besuch, sondern für immer hier?«
Ruth nickte schüchtern.
»Willkommen in Amerika.« Er lachte, ein raues Lachen. »Aber Queens ist kein schlechter Stadtteil, um dort zu leben.«
»Wir fahren morgen weiter nach Chicago«, erklärte Ruth. »In Chicago werden wir leben.«
»Viel Glück.«
Mehr sagte er nicht, und obwohl Ruth über den Satz nachdenken musste, wollte sie nicht nachfragen, wie er das meinte.
Die Fahrt dauerte lange. Sie fuhren durch verschiedene Stadtteile – vom Hafen weg durch Straßen, die mit hohen Mietshäusern aus rotem Backstein gesäumt wurden, aber auch durch Straßen, in denen Einfamilienhäuser standen – das wirkte fast schon kleinstädtisch. Doch dann kamen sie wieder in ein Viertel mit dichterer Bebauung. Vor einem der Backsteingebäude blieb das Taxi stehen.
»Da wären wir«, sagte er und nannte Karl den Fahrpreis.
»Du liebe Güte«, sagte Martha. »Wie können sich das die Amerikaner leisten?«
»Die New Yorker fahren für solche Strecken mit der Bahn«, sagte der Taxifahrer und grinste. Er half ihnen noch, das Gepäck auszuladen, bevor er davonfuhr.
Karl hatte schon geklingelt, und eine Frau öffnete die Haustür. Ruth hielt den Atem an.
»Hallo, Irene«, sagte Karl und umarmte sie. Erst zögerte sie, doch dann erwiderte sie die Umarmung. Sie begrüßte Martha schon herzlicher und sah dann zu den Mädchen.
»Du musst Ruth sein? Du bist … so erwachsen. Und du bist sicher Ilse?«
Ihr Deutsch hatte schon einen leichten amerikanischen Akzent, stellte Ruth fest.
»Du bist … Filmschauspielerin?«, sagte Ilse zögernd und bewundernd. »Du bist berühmt?«
»Was? Grundgütiger, nein«, sagte Irene lachend. »Wie kommst du denn auf so eine absurde Idee?«
»Weil du … so aussiehst«, seufzte Ilse. »So wunderschön … deine Haare … und deine elegante Kleidung …«
Wieder lachte Irene. »Ach, das ist ganz normale Kleidung. Nun kommt erst einmal herein. Wir wohnen im ersten Stock.« Sie wandte sich zu Karl und Martha. »Fred, mein Mann, ist noch nicht da. Ich hoffe, er … nun ja, wir haben nicht mit eurem Besuch gerechnet. Du hast doch geschrieben, dass ihr nach Chicago zieht.«
»Es ist nur für diese eine Nacht«, sagte Martha. »Wirklich. Morgen fahren wir mit dem Zug weiter. Karl hat schon die Fahrkarten.«
»Na ja, Fred wird es schon verstehen«, murmelte Irene, doch es klang zweifelnd.
Sie gingen in den ersten Stock, und Irene schloss die Tür zur Wohnung auf.
»Doris ist noch unterwegs, aber das ist Regine«, erklärte Irene.
Das Mädchen war etwas jünger als Ruth – aber sie sah viel erwachsener aus.
Die Haare, oh, dachte Ruth, was für eine wundervolle Frisur. Und sie ist geschminkt. Ilse hat recht – sie sehen aus wie Filmstars. Verschämt biss sie sich auf die Lippe, sie kam sich vor wie eine Bauernmagd aus der Provinz.
»Hello«, sagte Regine und reichte ihnen die Hand. »Wie geht es euch?« Sie hatte einen sehr starken Akzent, und man merkte, dass sie schon lange nicht mehr deutsch gesprochen hatte.
»Legt ab«, sagte Irene, »und kommt herein. Möchtet ihr etwas trinken?«
Rechts vom Flur ging eine Tür ab in die Küche. Neugierig schaute Ruth hinein und staunte. Es war eine sehr moderne Küche, mit weißen Möbeln, einem Eisschrank und einem Herd, wie Ruth noch nie einen gesehen hatte. Überhaupt war sie überrascht von der Helligkeit und Großzügigkeit der Wohnung. Im Wohnzimmer waren moderne Möbel, es gab einen Gaskamin, an den Fenstern hingen weiße Vorhänge. Natürlich gab es elektrisches Licht – das hatten sie auch in Slough gehabt, aber die Lampen hier waren sehr schlicht und modern. Und im Vergleich zu dem Bauernhof der Sandersons in Frinton-on-Sea erschien es ihr, als wäre sie mit einer Zeitmaschine in die Zukunft gereist. Auch Karl und Martha sahen sich gespannt um.
»Das ist aber schön hier, Irene«, sagte Martha bewundernd. »Dir muss es wirklich gutgehen, dass du dir eine so schöne Wohnung leisten kannst.«
»Wir wohnen noch nicht lange hier. Ihr hättet mal unser altes Zuhause sehen sollen, das war vielleicht schäbig«, sagte Regine. Irene warf ihr einen scharfen Blick zu, worauf das Mädchen den Kopf senkte.
»Uns geht es ganz gut. Dafür sorgt Fred, mein Mann«, erklärte Irene. »Auf der anderen Seite ist das Bad. Dort könnt ihr euch frisch machen. Und dann wollt ihr sicherlich einen Drink? Ich habe eine Kleinigkeit zu essen vorbereitet – allerdings keine große Mahlzeit, ich habe ja nicht mit euch gerechnet.« Sie lächelte, aber es war kein echtes Lächeln.
Ruth fühlte sich unwohl, sie sah ihrer Mutter an, dass es ihr ebenso ging.
Es ist nur für heute, nur für eine Nacht, sagte der Blick, den Martha ihrer Tochter zuwarf. Das schaffen wir. Ruth nickte kaum merklich und hob das Kinn an.
»Kann ich dir irgendwie helfen, Tante Irene?«, fragte sie. Karl machte sich frisch, und Martha hatte sich erschöpft auf das Sofa gesetzt.
Irene sah sich unschlüssig um. »Vielleicht kannst du mir in der Küche helfen. Regine – du und Ilse könnt im Mädchenzimmer schon mal die Betten für euch vorbereiten.« Sie sah Martha an. »Ein Gästezimmer haben wir – du und Karl, ihr werdet auf der Couch schlafen müssen.«
»Das ist wunderbar. Danke.« Martha lächelte. »Uns ist alles recht.«
»Möchtest du einen Kaffee?«, fragte Irene, die immer zwischen Freundlichkeit und Ablehnung zu schwanken schien, »oder lieber etwas Stärkeres? Sherry? Brandy?«
»Ein großes Glas Wasser wäre wunderbar. Und danach gerne einen Sherry.«
Ruth folge Irene in die Küche. Noch einmal bewunderte sie die sauberen weißen Schränke und den grauen Linoleumboden. Dieser Raum war sicher so viel einfacher sauberzuhalten als die riesige Küche im Farmhaus der Sandersons.
»Kannst du Brote schmieren?«, fragte Irene ein wenig zweifelnd.
»Selbstverständlich.«
»Gut.« Irene schien erleichtert. Sie holte Brot und Margarine hervor, Käse und Wurst nahm sie aus dem Eisschrank. »Dort in der Schublade ist Besteck.« Dann legte sie noch eingelegte Gurken und frische Tomaten auf den Küchentisch und sah Ruth wieder skeptisch an. »Wenn du die Brote schmierst, reicht das schon. Alles andere mache ich gleich.« Mit drei Gläsern verschwand sie, und bald schon hörte Ruth, wie Irene mit Martha anstieß.
»Auf eure Zukunft hier in Amerika!«
Behände schnitt Ruth das Brot, schmierte Margarine darauf und belegte die Schnittchen, die sie in mundgerechte Häppchen geschnitten hatte. Die Gurken und Tomaten zerteilte sie in dünne Scheiben und verzierte damit die Brote. Auf der Fensterbank stand ein Bund Petersilie, davon rupfte Ruth ein paar Blätter ab und streute sie auf die Brote. Sie war gerade fertig, als Irene in die Küche zurückkehrte.
»Grundgütiger«, sagte Irene erstaunt. »Hast du das ganz alleine gemacht?« Sie wartete nicht auf eine Antwort, sondern nahm die Platte. »Ich wollte noch Eier kochen – kannst du das auch?«
Ruth nickte. »Ja, aber ich weiß nicht, wie der Herd funktioniert.«
»Warte.« Irene brachte die Platte schnell ins Wohnzimmer. »Hier sind ein paar Häppchen … es ist nicht viel …«
»Das sieht wunderbar aus, herzlichen Dank«, sagte Martha.
Irene zeigte Ruth, wie man den Herd anschaltet, dann verließ sie die Küche wieder.
Ruth fand die Eier im Vorratsschrank. Eier zu kochen war keine Kunst, im letzten Jahr hatte sie das unzählige Male gemacht. Aber es verletzte sie, dass ihre Tante sie so schnell in die Rolle der Bediensteten gesteckt hatte.
Liegt es an mir, fragte sich Ruth. Strahle ich das jetzt aus? Vielleicht wirke ich unterwürfig. Oder, dachte sie, möglicherweise bin ich auch einfach nur hilfsbereit. Wir haben Tante Irene und ihre Familie ja quasi überfallen, da breche ich mir keinen Zacken aus der Krone, wenn ich etwas mithelfe.
Sie hörte Ilse und Regine im Zimmer der Mädchen lachen und reden und beneidete die beiden plötzlich. Ilse und Regine sind fast gleich alt – sie sind Jugendliche. Ich bin älter, gehöre nicht mehr richtig zu ihnen, aber zu den Erwachsenen gehöre ich auch noch nicht wirklich, dachte sie traurig.
Auf einmal wurde die Wohnungstür aufgeschlossen und fiel kurz darauf krachend ins Schloss.
»Ich bin zu Hause, Mommy«, rief eine weibliche Stimme in breitem Amerikanisch. Jemand kam um die Ecke in die Küche gestürmt und blieb erschrocken stehen und starrte Ruth an. »Huch!«
Irene kam aus dem Wohnzimmer geeilt. »Dolly, das ist Ruth, deine … hmmm, Großcousine oder Cousine zweiten Grades aus Deutschland. Ruth, das ist Doris.«
»Dolly, nenn mich bloß nicht Doris«, sagte das Mädchen, das ungefähr in Ruths Alter war. Aber auch sie sah so ganz anders aus – sie trug sehr modische Kleidung, ein flottes kleines Hütchen, das schräg auf dem Kopf saß, ein geblümtes Kleid mit einem schmalen Ledergürtel in der Taille und Schuhe mit Absätzen. Ihre Lippen glänzten rot, und auch die Wangen hatten einen rötlichen Schimmer, dazu kamen die getuschten Wimpern und der Lidschatten. Ruth kam aus dem Staunen nicht mehr heraus.
»Ihr seid die Cousinen aus Deutschland? Onkel Karl und Tante Martha?«, fragte Dolly und lächelte.
Ruth konnte nur nicken.