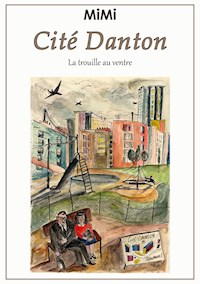15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
MIMI ist schön, begabt und erfolgreich – und aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht wegzudenken. Mit ihrer lebenslustigen Art ist sie nicht nur ein beliebter Gast in den Talkshows, sondern auch für viele ein Vorbild. Doch was lange nur wenige wussten: Die sympathische Entertainerin betäubte ihren Schmerz und ihre Schuldgefühle fast 30 Jahre mit Alkohol und verlor regelmäßig die Kontrolle über ihr Leben. Sie wahrte nach außen den Schein – und wurde dabei immer kränker. Heute ist sie trockene Alkoholikerin und erzählt in ihrem Buch schonungslos offen von ihrem Leben mit der Volksdroge – und ihren Dämonen, die sie mit ihm zu bekämpfen glaubte. "Trinkerbelle" ist die berührende und wahre Geschichte einer Frau, die nach jahrelangen Kämpfen endlich nüchtern werden durfte und seit Maria Himmelfahrt 2018 nicht mehr trinken muss. "Ich habe fast dreißig Jahre zu den klassischen funktionalen Trinkerinnen gehört, wobei der Ausdruck funktional in diesem Zusammenhang immer auch ein bisschen seltsam klingt. Denn so richtig funktioniert hat eigentlich recht wenig in meinem Leben. Ich war vollgetankt und bin trotzdem immer auf Reserve gefahren. Mein Leben war durch die Sucht ein Konstrukt aus Lügen und Vertuschungen, aus körperlichen und seelischen Schmerzen, von denen ich niemandem erzählen konnte – weil ich dann hätte zugeben müssen, woher sie kommen. Ich wollte leben, aber ich wollte so nicht mehr weiterleben." MIMI - MIMI ist als Mimi Fiedler bekannt aus Film und Fernsehen ("Die Nachtschwestern") und ein beliebter Gast in Talkshows - Ein berührender Einblick in ihre schwerste Zeit. - Ein Buch, das Mut macht, sich immer wieder den eigenen Dämonen zu stellen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mimi
Trinkerbelle
Mein Leben im Rausch
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
MIMI ist schön, begabt und erfolgreich – und aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht wegzudenken. Mit ihrer lebenslustigen Art ist sie nicht nur ein beliebter Gast in Talkshows, sondern auch für viele ein Vorbild. Doch was lange nur wenige wussten: Die sympathische Entertainerin betäubte ihren Schmerz und ihre Schuldgefühle fast 30 Jahre mit Alkohol und verlor regelmäßig die Kontrolle über ihr Leben. Sie wahrte nach außen den Schein – und wurde dabei immer kränker. Heute ist sie trockene Alkoholikerin und erzählt in ihrem Buch schonungslos offen von ihrem Leben mit der Volksdroge – und ihren Dämonen, die sie mit dem Alkohol zu bekämpfen glaubte. Trinkerbelle ist die berührende und wahre Geschichte einer Frau, die nach jahrelangen Kämpfen endlich nüchtern werden durfte und seit Maria Himmelfahrt 2018 nicht mehr trinken muss.
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Vorwort von Nathalie Stüben
Prolog
SCHULD
Dritte Klasse, Liverpool
Wolkenkratzer
Gebete
Der Schrei
Der Heimaturlaub I
Jovanka Broz
Der Heimaturlaub II
Auf hoffentlich Wiedersehen
Fritule
Der Sohn des Piloten
Voice. And over.
Die Kassette
Vater, Mutter, Kind I
Zwillinge
Der klügste kleine Mensch der Welt
Big City Lights
Wenn die Seele weint
Die Zeit heilt alle Wunden
Ghost Kingdom
Drahtseile und Zerreißproben
Identität
Passive Not Aggressive
Von Trauben und Pflaumen
SCHAM
Acting Strange
Komplizierte Umstände
Schmerz im Mutterherz
Rock Bottom
Operation am offenen Herzen
Johann oder Niels
Winterwonderland
Volle Breitseite
Zerplatzte Seifenblase
Beflecktes Badewasser
Die Verwandlung
Dreieinhalb Flaschen Wahrheit
Flashback
Vater, Mutter, Kind II
Unter die Räder gekommen
Franky Not in Hollywood
Dean
Bonding
Der Kreidekreis
Xanax oder Valium?
Berauschendes Fest
Mord
Is’ was mi’m Papa?
Sucht mich nicht
Der Tod ist groß, wir sind die Seinen
Terror im Kölner Treff
Lügen haben meine Beine
Angela
Cheating on a Cheat Day
Tripping
Lost and Found
Eloï, Eloï, lema sabachthani
What if God Was One of Us?
VERGEBUNG
Abschiede und Neuanfänge
Epilog
Kontaktadressen für Hilfsangebote
Anlaufstellen Alkoholismus
Anlaufstellen nach sexuellem Missbrauch
Für Ava und Ana.
Für meine Eltern und für meine Schwester.
Für Otto.
Für alle Abgestürzten.
Vom Himmel und im Leben.
Für die, die überlebt haben.
Und für die, die es nicht geschafft haben.
Vor allem für die.
»The greater a child’s terror, and the earlier it is experienced,
the harder it becomes to develop a strong and healthy sense of self.«
Nathaniel Branden
»Ask not why the addiction, but why the pain.«
Gabor Maté
Vorwort von Nathalie Stüben
»Mein Krafttier ist eine Ameise. Deins auch?«
Nein, meins nicht. Ich musste nur lachen, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Nun saß ich vor meinem Rechner, führte mein Podcastinterview mit Mimi, sprach überhaupt zum allerersten Mal mit ihr und wollte mit etwas Lustigem einsteigen. Und es war doch lustig, dass ihr Krafttier eine Ameise ist. Denn hey, Krafttiere, da denkt man doch eher an Löwen oder Geparden oder Adler.
Aber Mimi lachte nicht. Sie erklärte:
»Ich habe mal eine schamanische Reise gemacht. Der Schamane hat mich in eine Trance geführt und dann habe ich überall Ameisen gesehen. Da meinte er, ja, das ist dann dein Krafttier. Da war ich total enttäuscht. Eine Ameise? Kann es nicht irgendwas ein bisschen ›Posheres‹ sein? Aber er sagte, die Ameise sei eigentlich das kräftigste Tier im Schamanismus, weil sie sehr, sehr, sehr viel mehr tragen kann als das eigene Körpergewicht. Und das passt dann doch wieder zu meiner Geschichte, weil ich sehr viel mehr ausgehalten habe oder aushalten konnte, als ich dachte.«
Diese Aussage ist typisch für sie. Erst bringt sie dich zum Lachen. Dann packt dich die Tiefe ihrer Komik. Dann bringt sie dich zum Nachdenken. Dann verliebst du dich in sie.
Mimi ist eine der beeindruckendsten Frauen, die ich kenne. Eine der großzügigsten, liebenswürdigsten, klügsten und wärmsten. Sie ist eine Überlebende. Und ich danke allen Göttern, Universen und Krafttieren dafür, dass sie lebt. Dass sie die Stärke besaß, aufzuhören mit Aushalten. Und anzufangen mit Gestalten.
Dieses Buch ist das Manifest eines Lebens, das sich nicht länger von außen bestimmen lässt. Ich bin so froh, dass es erscheint. Möge die Kraft dieser Frau und ihrer Worte alle Lesenden mitreißen, weg von Wahrheiten und Urteilen anderer, hin zu Unabhängigkeit und Selbstbestimmung.
Rosenheim, den 1.11.2022
Nathalie Stüben
Prolog
Als ich die Worte meiner Freundin Nathalie Stüben zum ersten Mal gelesen habe, musste ich weinen. Es steckt so viel Liebe und so viel Wertschätzung in ihnen, dass ich Mühe hatte, sie anzunehmen. Obwohl ich schon so viel gelernt und so viel verstanden habe, taucht manchmal immer noch dieses eine abwertende Gefühl in mir auf und verunsichert mich.
Dieses Gefühl, das sagt: Das stimmt alles nicht und du hast das auch gar nicht verdient!
Aber anders als früher gebe ich unangenehmen Gefühlen so lange ihren Raum, wie sie ihn brauchen. Ich drücke sie nicht mehr weg. Ich betäube sie nicht mehr. Denn genau das haben Nathalie und ich beide lange gemacht. Ich ein ganzes Stück länger als sie. Weil ich früher angefangen und später aufgehört habe, es zu tun. Es tun zu müssen.
Gefühle lassen sich leichter ausschalten, wenn man betrunken ist, also haben wir getrunken. Erst manchmal zu viel. Und dann immer zu viel. Bei mir waren es nach meinem ersten Schluck nur wenige Monate von »manchmal zu viel« bis »immer zu viel«. Ich habe mit vierzehn angefangen und fast dreißig Jahre lang getrunken. Ganz gleich, wie sehr und wie oft ich versucht habe, den Alkoholkonsum einzugrenzen, mein Trinkverhalten hat sich nie wirklich verändert. Von Beginn an habe ich maßlos getrunken und war zu keinem Zeitpunkt fähig, meinen Konsum zu kontrollieren. Verändert haben sich nur die Trinkabstände, die mit den Jahren kleiner geworden sind. Dafür wurde die Menge an Alkohol größer.
Ich habe zu den klassischen funktionalen Trinkerinnen gehört, wobei der Ausdruck funktional in diesem Zusammenhang immer auch ein bisschen seltsam klingt. Denn so richtig funktioniert hat eigentlich recht wenig in meinem Leben. Ich war vollgetankt und bin trotzdem immer auf Reserve gefahren.
Erst als ich 2010 verstanden habe, dass ich alkoholkrank bin, und sagen konnte: »Ich bin Mimi und ich bin Alkoholikerin«, hat sich meine Fahrtrichtung verändert. Warum ich trotzdem noch acht Jahre gebraucht habe und erst 2018 aufhören konnte zu trinken und warum ich seither nicht mehr trinken muss, das kann ich nicht genau sagen. Es gibt keine logische Erklärung dafür, denn so genau weiß immer noch niemand, warum die einen es schaffen und die anderen nicht. Vielleicht hatte ich einfach Glück, dass ich immer wieder die Kraft fand, aufzustehen, um immer wieder zu versuchen, nüchtern zu werden.
Es gibt einen Spruch, den ich in den Räumen einer Selbsthilfegruppe, die mir geholfen hat, gesund zu werden, gelernt habe: »Don’t quit before the miracle happens.«
Auch wenn ich oft völlig erschöpft und die Hoffnung auf dieses miracle nicht selten in weite Ferne gerückt war, habe ich nie aufgehört, an das Wunder des Nüchternwerdens zu glauben. Und in einer Gesellschaft, in der es normaler ist, zu trinken, als nicht zu trinken, fiel mir das sehr, sehr schwer. Vielleicht habe ich auch deswegen so lange gebraucht. Aber irgendwann war es tatsächlich da, und bis heute ist es nicht von meiner Seite gewichen.
Ich möchte dir an dieser Stelle aber sagen, dass Trinkerbelle kein Ratgeber ist. Ich sage das, weil ich keine falschen Hoffnungen schüren möchte. Obwohl ich nüchtern werden durfte, weiß ich trotzdem nicht, wie es für dich geht. Also habe ich mich erst gar nicht daran versucht. Der Weg zur Nüchternheit ist ein sehr persönlicher und ich glaube, es ist deswegen auch besonders wichtig, ihn auf seine ganz eigene Weise zu gehen.
Deswegen erzähle ich dir hier lediglich meine Geschichte. Und sie beginnt weit vor meiner Geburt, mit dem Leben meiner Ahnen.
Die Betäubung von seelischen Schmerzen ist auch in meiner Familie ein epigenetischer roter Faden, der sich von Generation zu Generation weitergesponnen hat. Die Schmerzen meiner Ahnen waren nicht alle gleich, aber alle waren sie tief. Woher mein eigener Schmerz kommt, daran konnte ich mich viele Jahre nicht erinnern.
Ich wusste nur, dass er da ist und dass er immer mehr Raum in mir einnimmt. Irgendwann war er so übermächtig und so groß, dass ich ihn einfach nicht mehr aushalten konnte. Sehr schnell habe ich gelernt, dass ich im Rausch meine Gefühle nicht mehr aushalten muss. Und genauso schnell, wie ich das gelernt habe, war ich süchtig nach Rausch.
Ich erzähle meine Geschichte aber nicht um meiner selbst willen, ich erzähle sie, um Alkoholismus eine Stimme zu geben. Denn die meisten alkoholkranken Menschen, denen ich begegnet bin, hatten keine. Sie waren Verwundete, deren Hilferufe so leise waren, dass sie nicht gehört wurden. Und weil sie nicht wussten, wie sie anders mit ihrem Schmerz umgehen sollten, haben sie ihn betäubt.
Ich habe beschlossen, in diesem Buch den Scheinwerfer ausschließlich auf diejenigen Ausschnitte meines Lebens zu richten, die direkt oder indirekt mit Alkohol zu tun hatten. Natürlich war alles nicht immer schwer und auch nicht immer tragisch, aber in jeder meiner Lebensphasen spielte Alkohol eine der Hauptrollen.
Die andere Hauptrolle spielte sexueller Missbrauch, den ich als Kind erleben musste. Viele Jahre wusste ich nicht mal, dass das so ist, weil ich mich nicht daran erinnern konnte. Aber ich erinnere mich heute und möchte dir diesen Teil meiner Geschichte nicht verschweigen. Überhaupt möchte ich ihn nie wieder verschweigen müssen.
Ich erzähle dir davon im Bewusstsein, dass ich dafür keine Beweise vorlegen kann und dass die, die dafür verantwortlich sind, ihre Verantwortung nie angenommen haben. Sie haben sogar das Gegenteil behauptet, nämlich, dass es nicht geschehen ist.
Aber es ist geschehen. Und es ist zu meinem point of no return geworden.
Danach hat sich die Tür zur Wiege der Unschuld für mich für immer verschlossen. Mein Weg war vorgezeichnet, denn als ich auf meine Täter traf, war ich bereits traumatisiert, und diesen Wunden wurden durch sie weitere, sehr viel tiefere Wunden hinzugefügt.
Lange habe ich darüber nachgedacht, ob ich das Recht dazu habe, ohne einen einzigen Beweis ein Manifest zu verfassen, das unverrückbar und für jeden nachlesbar ist. Aber so, wie sich zwei erwachsene Menschen erlaubt haben, einem Kind für die nächsten fünfunddreißig Jahre die Chance auf eine selbstbestimmte und gesunde Zukunft zu nehmen, erlaube ich mir, das, was sie getan haben, zu erzählen. Es gibt nur ein einziges Fragment, das in mein Bewusstsein gerückt ist, und ich beschreibe dieses Fragment so detailliert und so deutlich, wie es in meiner Wahrnehmung geschehen ist.
Ich bitte dich, genau zu überprüfen, ob du dich auf diese Beschreibung einlassen kannst. Ich habe alles zu Papier gebracht, was ich zu sagen hatte. Über Schuld und Scham und über Vergebung. Ich habe mich dabei behauptet und gelernt, meine Behauptung auszuhalten und anzuerkennen, dass das, was ich fühle, wahr ist. Und das war der wichtigste Schritt, den ich gegangen bin. Denn es war der erste. Ich habe mir die Freiheit genommen, noch viele weitere Schritte zu gehen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, mich dabei zu begleiten. Das bedeutet mir unendlich viel.
Deine Mimi
PS:
Am Ende dieses Buches findest du verschiedene Möglichkeiten, die ich für dich gesammelt habe, wenn du dir auf deinem Weg in die Nüchternheit Unterstützung wünschst. Es sind auch Adressen für diejenigen dabei, die süchtige Menschen in ihrem Umfeld haben und darüber sprechen möchten. Hinweise auf Hilfe, falls du sexuellen Missbrauch erleben musstest, findest du ebenfalls dort.
Du bist nicht allein. Ich fühle und sehe dich.
SCHULD
Dritte Klasse, Liverpool
Das Königreich Dalmatien liegt an der schönen Adria und ist ein österreichisches Kronland. Im Laufe der Jahrhunderte erwerben die Habsburger die schönste Perle der Adria, zusammen mit noch vielen weiteren Kronländern in Mitteleuropa: Dalmatien ist zwar besonders schön, aber auch besonders arm.
Mein Urgroßvater Ivan wird 1881 in die Monarchie seines Landes hineingeboren, dem Herrgott hinterm Rücken und im kältesten Februar des Jahrhunderts. Es ist so bitterkalt, dass seine Mutter in alle Decken eingewickelt werden muss, die im Dorf auffindbar sind. Ihr Bauch ist so steinhart und kalt, dass die Befürchtung groß ist, das Baby würde noch im Mutterleib erfrieren.
Meinem Urgroßvater ist die Temperatur alles andere als geheuer, er ziert sich und lässt sich viel Zeit, bevor er sein Köpfchen in die Februarkälte schiebt. Sein sieben Jahre älterer Bruder Mijo hockt mit eiszapfigen Füßen und eingerollt wie eine Katze hinter dem alten Sessel in der Küche, wo die Szene stattfindet, und bezeugt die Geburt eines Kindes, das keinen einzigen Mucks von sich gibt. Mein Urgroßvater Ivan ist derart entsetzt über die Lage, in die er hineingeboren wird, dass ihm die kleine Stimme im Hals stecken bleibt.
Ivan bleibt auch später ein Mensch, der nie schreit. Dafür schreit sich der Nachzügler Mate, der fünf Jahre später in einem nicht minder eisigen Winter geboren wird, die Seele aus dem Leib.
Die beiden älteren Bauernsöhne wachsen zu geschickten Steinmetzen heran: Sie haben goldene Hände und bauen reichen Bauern weit über ihre dalmatinischen Dorfgrenzen hinaus die schönsten Häuser. Der jüngste Bruder, Mate, ist ein geschickter Jäger, und so teilen sich die drei Brüder die Aufgaben auf dem Hof. Zur Jahrhundertwende, Mate ist vierzehn, Ivan neunzehn und Mijo sechsundzwanzig, hören sie zum ersten Mal von den großen Schiffen, die eine bessere Zukunft im fernen Amerika versprechen, und davon, dass schon einige mutige Dalmatiner dort ein Leben für sich und ihre Familien aufbauen konnten. Die drei Brüder beschließen mit Handschlag: »Sobald wir Frauen und Kinder haben, nehmen wir auch so ein Schiff nach Amerika. Packen Vater und Mutter ein und bauen uns dort ein großes Haus, in dem wir alle leben. In einem besseren Leben.«
Ivan, der sparsamste der Brüder, verwaltet dreizehn Jahre lang die Kronen, die sie sich verdienen. Und auch wenn die Kronen nicht reichen, um Land in der Heimat zu kaufen, reichen sie allemal für drei Schiffstickets nach Amerika. Mate, der jüngste der Brüder, belesen und klug, hat zwar eine Ehefrau, aber noch kein Kind vorzuweisen und beschließt, die beiden älteren Brüder ziehen zu lassen, um später, hoffentlich schnellstmöglich selbst zum Vater geworden, mit Frauen, Kindern und den Eltern nachzukommen. Die anderen beiden versprechen, so schnell wie möglich genug Dollars und die Einreisepapiere zu senden.
Mijos Ehefrau, seine zwei Söhne und meine Urgroßmutter, Ivans Ehefrau, mit meiner Großmutter Mara, die zum Zeitpunkt der Abreise ihres Vaters Ivan vier Jahre alt ist, bleiben mit den Eltern, dem jüngsten Bruder Mate und seiner Ehefrau im Königreich Dalmatien zurück. Dreizehn beschwerliche Jahre und dreizehn harte Winter nachdem die Brüder den Beschluss gefasst haben, ins gelobte Land auszuwandern, verlassen Ivan und Mijo ihr kleines dalmatisches Dorf Svib und machen sich auf die mühselige Reise nach Liverpool. Dort kaufen sie sich zwei Tickets für die RMS Laconia, auf der 350 Plätze der ersten, 350 Plätze der zweiten und 1500 Plätze der dritten Klasse belegt sind. Neun Tage verbringen die beiden in der dritten Klasse auf dem Schiff Richtung New York, um von dort aus nach Chicago weiterzureisen – die Stadt, in der schon viele Dalmatiner vor ihnen sesshaft geworden sind und eine große katholisch-dalmatinische Gemeinde aufgebaut haben. Dort warten warme Betten und eine goldene Zukunft auf die beiden Steinmetze mit den goldenen Händen, denn es gibt unbegrenzt Arbeit im Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
Es wird nicht lange dauern, bis sie genug verdient haben, um den Rest der Familie mitsamt den Eltern nach Chicago zu holen. Niemand ahnt, dass die Zukunft des kleinen Dorfes auf den Monat genau ein Jahr später ins Ungewisse rutschen wird, als im August 1914 das Deutsche Reich dem russischen Zarenreich den Krieg erklärt.
Ein Attentat, bei dem der Thronfolger Österreich-Ungarns, Erzherzog Franz Ferdinand, und seine Ehefrau Sophie Chotek bei ihrem Besuch in Sarajevo ermordet werden, löst die Julikrise aus. Und die wiederum den Ersten Weltkrieg.
Während sich die Armeen rüsten, landet auch der jüngste Bruder Mate einen Treffer und zeugt 1914 seinen langersehnten Sohn, der 1915 in die brandneue Kriegswelt hineingeboren wird. Doch Mate siedelt nicht mit der übrigen Familie nach Amerika über, und zwar nicht nur, weil der Krieg das Tor nach Übersee verriegelt, sondern auch, weil er für die Monarchie kämpfen will.
1917 nimmt er nicht wie vereinbart die RMS Laconia nach Amerika, sondern als Soldat der Krone ein Kriegsschiff nach Italien.
Wäre Mate, wie vereinbart, nicht nach Italien, sondern mit der Laconia nach New York gereist, wäre er Zeuge ihrer letzten erfolgreichen Atlantiküberquerung geworden. Denn im selben Jahr wird das Schiff vor der irischen Küste von einem deutschen U-Boot versenkt. Unter den zwölf Todesopfern befinden sich zwei US-amerikanische Staatsbürgerinnen. Der frischgekürte amerikanische Präsident Woodrow Wilson kann unter keinen Umständen weitere von den Deutschen verursachte amerikanische Opfer dulden. Er erklärt im April 1917 dem Kaiserreich den Krieg.
Der Eintritt der USA markiert die Wende im Ersten Weltkrieg und macht es den beiden älteren Brüdern, die auf nichts anderes hinarbeiten als darauf, ihre Familien in die USA zu holen, unmöglich, dies zu tun.
Und so geschieht es, dass der Krieg die drei Brüder aus dem kleinen Dorf hinter Gottes Rücken für immer von ihren Familien trennt. Sie sehen weder ihre Eltern noch ihre Ehefrauen und ihre Kinder jemals wieder.
Wolkenkratzer
Meine Großmutter Mara wächst behütet auf und liebt ihr Dorf über alles. Besonders die Tiere liebt sie. Sie hat sogar ein eigenes Kalb, vor ihren Augen wird es von der dicken Kuh geboren und ist ganz verschmiert und klein. Irgendwann wird Mara ganz allein mit ihren eigenen Händen viele kleine, verschmierte Kälber in die Welt ziehen.
Sie weiß, dass sie einen Vater hat. Sie weiß auch, wie er ausschaut, weil ihre Mutter ein Bild von ihm unter der guten Damastbettwäsche im Schrank liegen hat. Dort liegt es, sagt ihre Mutter, damit die Sonne die Erinnerungen an ihn nicht wegnimmt. Er ist in Amerika, und sie und ihre Mutter sollen auch nach Amerika kommen. Und die anderen auch. Onkel Mate, ihre Tanten und Cousins und auch Oma und Opa. Aber keiner will.
Maras Mutter sagt, solange Krieg herrscht, wird sich niemand von der Stelle rühren. Sie seien ja nicht verrückt.
Für Mara ist der Krieg weit weg. So weit weg wie Amerika. Wenn sie das Bild ihres Vaters anschaut, wird keine Erinnerung in ihr wach. Aber wenn ihre Mutter mit ihr zum Heuspeicher hochklettert und sie das frische Heu riecht, dann erinnert sich Mara doch an ihren Vater. Daran, wie er sie huckepack die steilen Stufen nach oben trug und sie ins Heu warf. Sie erinnert sich daran, wie die Halme in seinem schwarzen Schnurrbart festhingen. Und an sein Lachen. Und daran, dass er nie schrie. Daran kann sie sich erinnern und ist erleichtert, dass sie sich erinnert.
Sie glaubt schon, dass sie ihn lieb hat, sie fühlt es nur nicht mehr. Die Liebe zu ihren Tieren und den Babykatzen, die Liebe zu ihrer Familie, die fühlt sie so tief, dass manchmal ihr Herz davon wehtut. Und weil das so ist, fühlt sie sich manchmal schuldig. Weil die Liebe zu ihrem Vater mit ihm nach Amerika verschwunden ist. Und so weiß sie bereits mit acht Jahren schon ganz genau, wie sich Schuld anfühlt.
Maras Onkel Mate erzählt beim Abendbrot, dass ihr Vater zusammen mit ihrem anderen Onkel Mijo in Amerika Häuser baut. Sehr hohe Häuser! Er zeigt nach oben in den Himmel und sagt, die Bauwerke nennt man Wolkenkratzer, so hoch sind sie. Sie fragt erstaunt, ob die Wolken nicht kaputtgehen, wenn sie von so einem hohen Haus gekratzt werden. Ihr Onkel Mate lacht, und Mara fragt weiter: »Wenn wir in Amerika sind, können wir über diese hohen Häuser zu den Wolken hochklettern und die Engel besuchen? Mama sagt, in den Wolken wohnen die Engel!«
Mate lacht wieder und antwortet: »Ach herrje, Kind, hat sie das gesagt, ja? Die wohnen nicht in den Wolken, niemand weiß so recht, wo, aber dort sicher nicht!«
»Nicht?«, fragt Mara.
Er erläutert: »Wolken, das sind viele kleine Wassertröpfchen, und du könntest zwar hochklettern, aber nicht auf ihnen sitzen. Wolken sind wie ein dichter Nebel am Himmel, du würdest durch sie durchrutschen. Und dann wäre es aus mit dir. Zappenduster wäre es dann.«
Sie staunt und fragt sich, woher er das alles weiß.
Mate kaut weiter auf seinem Brot, reißt ein Stück Schinken ab und redet mit vollem Mund weiter: »Weißt du denn überhaupt, wie Wolken entstehen?«
Mara schüttelt den Kopf.
»Wolken entstehen, wenn durch die heißen Sonnenstrahlen Wasser auf der Erde verdunstet. Wie wenn Mama Wasser kocht und das Wasser dann als Dampf aufsteigt. Oben im Himmel kühlt der Dampf wieder ab und die kleinen Wassertröpfchen rücken dann ganz eng zusammen und du kannst sie so zusammengerückt als Wolken am Himmel sehen. Und wenn die Tropfen in den Wolken zu groß und zu schwer werden, rieseln sie als Regentropfen auf uns runter.«
Ihr Onkel ist ziemlich klug. Er bringt ihr bei, wie man ihren Namen schreibt, und erzählt ihr alles, was es über den Himmel und die Erde zu erzählen gibt. Und weil sie für ihn das fühlt, was sie für ihren Vater in Amerika empfinden sollte, fühlt sie sich noch schuldiger.
Obwohl Mama sagt, solange Krieg herrscht, wird sich keiner vom Fleck rühren, verlässt Onkel Mate ungerührt das Dorf. Es sei für die Krone und für das Vaterland.
Maras Vater ist in Amerika, und Mara denkt deswegen, Onkel Mate zieht für Amerika in den Krieg. Er drückt alle zum Abschied und zeigt sich kämpferisch und siegessicher. Sie werden sich niemandem ergeben, sagt er. »Wir sind Dalmatiner, Mara, vergiss das nicht. Dalmatiner kennen keine Angst. Wir sind stärker als der Rest der ganzen Welt. Und wenn ich wiederkomme, dann bringe ich dir das Lesen bei. Du wirst das klügste junge Mädchen im Dorf, klüger als alle Jungen zusammen.«
Mates Sohn ist zwei Jahre alt, Mara hält ihn auf dem Arm und winkt zusammen mit den anderen der Pferdekutsche hinterher, die ihren Onkel und die anderen Männer aus dem Dorf zum Hafen von Makarska und von dort aus in den Krieg bringt.
Ein paar Monate später wird ihre Mutter unter Tränen erzählen, dass es kein Lebenszeichen mehr von Onkel Mate gibt und dass sie denken, er sei gefallen.
Ihre Tante tauscht ihre bunten, mit Rosen bestickten Röcke gegen schwarze Kleider und verdeckt ihre Haare mit einem noch schwärzeren Tuch. Und alle weinen bitterlich.
Mara weint nicht. Sie kann nicht. Sie ist wütend auf Onkel Mate. Sie fragt sich, wie er so kopflos sein konnte! Er hat doch gewusst, dass man sich in Amerika nicht auf die Wolken setzen darf, weil man dann fällt. Und dass es dann aus mit einem ist. Weil ja nur Engel fliegen können. Er hat es ihr doch selbst erzählt. Warum zum Teufel hat er es dann trotzdem getan?
Sie schwört sich, niemals auch nur einen Fuß in dieses schreckliche, kratzige Amerika zu setzen, das Wolken im Himmel hat, durch die man fällt. Niemals wird sie diesen Ort betreten, der ihr nicht nur ihren Vater Ivan und ihren Onkel Mijo, sondern jetzt auch noch Onkel Mate genommen hat. Niemals.
Gebete
Die Jahre gehen ins Land, der Erste Weltkrieg neigt sich 1918 dem Ende zu und niemand rechnet damit, dass das Königreich Dalmatien zu den Verlierern gehören wird. Onkel Mate ist nicht gefallen – jedenfalls weiß man das nicht genau –, er ist nur verschollen, kein Lebenszeichen weit und breit, und obwohl sein bester Freund, der mit ihm nach Italien verschifft wurde, offiziell für tot erklärt wird, bleibt Mate verschollen.
Seine Ehefrau weiß nicht, was schlimmer ist: verwitwet oder vielleicht verwitwet zu sein. Bis zu ihrem Tod wird sie es nie erfahren, sie bleibt in Schwarz gehüllt und ohne Mann.
Die anderen beiden Brüder sind immer noch in Amerika, und auch wenn Mate verschwunden bleibt, wollen sie wenigstens ihre Kinder und ihre Frauen nach Chicago holen. Aber immer noch will keiner das Dorf verlassen.
Mein Urgroßvater Ivan liest eines Morgens in der Chicago Tribune, dass eine Seuche in Europa ausgebrochen ist, die Spanische Grippe, und dass der spanische König Alfons XIII. bereits daran erkrankt ist. Die Spanier sind nicht am Krieg beteiligt, und weil die spanische Presse deswegen nicht zensiert wird, verbreitet sich die Nachricht von seiner Erkrankung schnell in Richtung Amerika. Dem Rest Europas wird die Seuche verschwiegen, es ist ein Staatsgeheimnis – schließlich herrscht immer noch Krieg. Demoralisierende Meldungen sind nicht erwünscht. Mein Urgroßvater wird auch immer demoralisierter und noch unruhiger als zuvor. Er möchte keine Sekunde mehr warten. Seine Familie soll so schnell wie möglich nach Chicago kommen.
Das Königreich Dalmatien gehört zu den haushohen Verlierern des Krieges, der über vierzig Millionen Opfer fordert, unter ihnen auch der kleine Bruder meines Urgroßvaters. Und als sich Dalmatien aus der österreichisch-ungarischen Monarchie löst, marschieren immer mehr italienische Truppen ein, die das Land von den Alliierten zugesprochen bekamen. Der Nationalrat der Slowenen, Kroaten und Serben beschließt die Vereinigung der Königreiche. Das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen entsteht. Die dalmatinischen Bauern mögen die neue Monarchie aber nicht und gründen eine Bauernpartei, der sich auch Männer aus dem Dorf anschließen.
Mara ist neun Jahre alt, und die einzige männliche Bezugsperson, die sie jetzt noch hat, ist ihr Großvater. Und der ist bis an die Zähne bewaffnet und sagt, er wird jeden umschießen, der ihm sein Land wegnehmen will.
Mein Urgroßvater Ivan telegrafiert unterdessen seiner Frau, sie solle sich und die Tochter nun vorbereiten, dieses Mal dulde er keine Widerrede. Meine Urgroßmutter lässt zurücktelegrafieren, sie könne ihren Vater unter keinen Umständen seinem Schicksal überlassen, und schiebt die Reise wieder auf: Ivan, was nicht geht, geht einfach nicht! Komm du zurück nach Hause, dann haben wir die Probleme vom Tisch!
Ivan aber sieht keine Zukunft in seinem Dorf hinter Gottes Rücken und hat sich längst ein gutes Leben in Chicago aufgebaut. Er ist ein angesehener Mann, beschäftigt ein paar Arbeiter, zahlt pünktlich die Wochenlöhne aus, trägt feine Anzüge und hat fest vor, ein reicher Mann zu werden. Für ihn gibt es kein Zurück. Für ihn gibt es nur Amerika. Der Ausbruch der Spanischen Grippe wiederum wischt die Probleme vom Tisch meiner Urgroßmutter und macht eine Immigration in die USA für die nächsten Jahre unmöglich. Dass eine Überfahrt viel zu gefährlich für seine Tochter und seine Ehefrau ist, das muss auch mein Urgroßvater einsehen und schluckt die bittere Pille, die ihm die größte Seuche des Jahrhunderts beschert. Meine Großmutter Mara wird pünktlich zum offiziellen Ende der Spanischen Grippe zwölf Jahre alt und von einem viel schlimmeren Fieber befallen. Heilung ausgeschlossen. Das Fieber heißt Liebe. Ihr Angebeteter ist mein Großvater Jozo, der schönste Junge im Dorf. Mara hat Schmetterlinge im Bauch und sieht nur noch Jozos graue Augen, seine Locken und sein verschmitztes Gesicht, das übersät ist mit Sommersprossen. Sie sieht weder die Schäden der Spanischen Grippe noch die Auswirkungen des Ersten Weltkrieges, sie sieht keinen Hunger, keine Not. Die verheerende Dürre in Dalmatien interessiert Mara auch nicht. Amerika hat sie sowieso längst vergessen. Alles, was meine Großmutter interessiert, ist mein Großvater. Maras Vater Ivan verliert langsam jegliche Geduld mit seinen beiden Frauen, die partout nicht nach Amerika kommen wollen. Das Geld, das er ihnen für die Reise schickt, geben sie dem bewaffneten Großvater.
Fünf weitere Jahre gehen ins Land. Fünf Jahre, in denen sich Ivans Frau und Tochter ihm und Amerika verweigern, bis ihm der Geduldsfaden endgültig reißt. Im Sommer 1925 schickt er wieder ein Telegramm. Und wieder wird es seine sture Ehefrau in die knarrende Küchenschublade stopfen und ein NEIN zurücktelegrafieren wollen. Aber diesmal tut sie es nicht, denn das Telegramm ist bitterernst. Ivan schreibt: Hole euch Weihnachten. Persönlich. Packt eure Sachen und haltet euch bereit!
Der Erste Weltkrieg ist seit sieben Jahren beendet, die Seuche treibt ihr Unwesen längst nicht mehr, und nun will er mit seiner Familie endlich das kommode Leben in Amerika genießen, das er sich mit mühsamer Arbeit aufgebaut hat.
Meine Großmutter Mara und mein Großvater Jozo sind unzertrennlich und verbringen seit Jahren jeden Nachmittag miteinander. Nach der Arbeit treffen sie sich heimlich auf dem Feld, unter den Pflaumenbäumen, die ihnen Schatten und Schutz vor den Augen der anderen bieten, während sie sich küssen. Mara will ihren Jozo niemals verlassen und betet jede Nacht zur Muttergottes, dass ihr Vater Ivan sie und ihre Mutter nicht abholen kommt.
Weder seine Ehefrau noch seine Tochter wollen weggehen. Sie können sich ein Leben ohne ihr Dorf nicht vorstellen, und Ivan ist schon so lange fort, dass sie sich auch ihn nicht mehr vorstellen können. Jozos Vater, mein Urgroßvater väterlicherseits, ist ebenfalls nach Amerika ausgewandert, und auch er kommt nach Dalmatien. Aber nicht, um seine Frau und die Kinder zu holen, sondern um zu bleiben. Er beugt sich der Sturheit seiner Frau, weil er des Bettelns müde geworden ist. Ivan hingegen ist nicht müde, er ist entschlossen und ziemlich sauer. Mara ist über seine Entschlossenheit so verzweifelt, dass sie die heilige Mutter schließlich um ein Wunder bittet. Egal, welches! Sie pilgert barfuß fünfzig Kilometer zur Muttergottes nach Sinj und barfuß fünfzig Kilometer zurück. Sie betet Hunderte Ave-Marias. Es muss etwas geschehen, es muss ein Wunder vom Himmel fallen, Gott darf nicht zulassen, dass sie ihren geliebten Jozo verlassen muss. Das Wunder fällt. Zwar nicht vom Himmel, aber aus der Straßenbahn. Ivan stürzt genau aus dieser, am Beginn seiner Reise, die ihn von Chicago über New York und Liverpool schließlich ins Dorf bringen soll. Nach dem Sturz wird mein Urgroßvater von einem Automobil überfahren. Er wurde zerquetscht wie eine Pflaume, wird man sich später im Dorf erzählen. Die Überseepapiere für seine Familie liegen in einer Blutlache auf der Straße und erreichen, so wie der Überbringer selbst, nie die Empfängerinnen.
Mara erfährt vom Tod ihres Vaters durch den dumpfen Aufprall ihrer ohnmächtigen Mutter. Beide Frauen tragen nach der Geschichte mit der Straßenbahn genau das gleiche tiefe Schwarz wie die Frau von Onkel Mate. Nur einmal wird meine Großmutter Mara etwas anderes als Schwarz tragen: zu ihrer Hochzeit mit meinem Großvater Jozo. Denn dass der gute Vater in Amerika zerquetscht wird wie eine Pflaume, das haben sie nicht gewollt!
Die Schuld frisst meine Großmutter von innen auf. Nur zu gut weiß sie, worum sie die Muttergottes gebeten hat. Und obwohl sie sich nichts sehnlicher gewünscht hat, als im Dorf zu bleiben, wird sie dort nie wirklich glücklich.
Der Schrei
Meine Mutter ist gerade einen Monat volljährig, als ich geboren werde. Der Bruder meines Vaters fährt sie ins Krankenhaus, wo sie mich nach einer langen Nacht am frühen Morgen des 11. Septembers 1975 entbindet. Weder ihre eigene Mutter noch mein Vater sind bei ihr. Beide arbeiten in Deutschland. Die Mutter meiner Mutter bringt ihre fünf Kinder allein durch, schuftet tagsüber in einer Stofffabrik in Wangen am Bodensee, putzt nachts die Bäckerei nebenan und schickt Geld in die Heimat. Den Vater meiner Mutter gibt es nicht mehr.
Meine Mutter und mein Vater kommen wie Mara und Jozo auch beide aus dem Dorf. Aber als mein Vater endlich Arbeit in Deutschland findet, packt er über Nacht seine Sachen und geht. Diese Gelegenheit gibt es kein zweites Mal, denn er ist für den Fuhrpark eines Bauunternehmers zuständig. Und bekommt ein sattes Gehalt. Aber im Fuhrpark eines deutschen Unternehmers ist kein Platz für eine minderjährige, hochschwangere Jugoslawin. Also lässt mein Vater meine Mutter im Dorf zurück, es geht einfach nicht anders.
Als sie kurz vor der Niederkunft ist, fragt er, ob er Urlaub bekommen kann. Aber es gibt Regeln in Deutschland, und mein Vater hat seinen Antrag nicht früh genug eingereicht. Und deswegen ist es jetzt einfach zu spät. Und so bringt meine Mutter ihr erstes Kind allein und ohne ermutigende Worte zur Welt. Zusammen mit vier anderen Frauen, nur von vergilbten Vorhängen voneinander getrennt, in einem großen Saal des alten Militärkrankenhauses in Split. Der Arzt fragt meine Mutter, ob sie genauso laut geschrien hat, als ich gezeugt wurde. Mutterseelenallein liegt sie in den Wehen, ohne eine haltende Hand, ohne meinen Vater, vom eigenen Vater verlassen. Derweil geht unbeeindruckt die dalmatinische Sonne strahlend über dem Meer auf und beleuchtet wie eine viel zu helle Taschenlampe das Bett meiner gebärenden Mutter.
Die Geburt seines ersten Kindes feiert mein Vater in seinem kleinen Gastarbeiterzimmer mit seinen Gastarbeiterkollegen. Es wird Bier und Schnaps getrunken bis in die frühen Morgenstunden, und zwar in solchem Übermaß, dass dieser 11. September für lange Zeit als der Inbegriff eines Besäufnisses gilt. Mein Vater ist froh, endlich ein Kind vorweisen zu können, denn man hat sich bereits gefragt, ob mit ihm etwas nicht stimme. Aber es stimmt alles. Ich bin endlich da und das muss begossen werden.
Einen Monat später sieht mein Vater mich zum ersten Mal. Er weint. Doch der Besuch ist kurz und die folgende Ankündigung hart: Meine Mutter soll mitkommen nach Deutschland. Ohne mich. Die Familie meines Vaters ist groß und kinderreich, es gibt viele Tanten, die Ammen für mich sein wollen. Meine Mutter weigert sich zunächst, aber es ist aussichtslos. Sie hat keine Fürsprecher, keine Mutter, keinen Vater, die sich schützend vor sie stellen. Sie ist ein sippenloses achtzehnjähriges Mädchen, das gerade ein Kind zur Welt gebracht hat, und beugt sich, obwohl sie ohne ihr Baby nicht gehen will. Es ist nur für ein paar Monate, beschwichtigt sie mein Vater. Und er meint es ernst. Auch er will so schnell wie möglich zurück nach Hause. Mit Taschen voller guter Deutscher Mark. Und der Aussicht auf eine bessere Zukunft.
Ich bleibe bei den Brüdern meines Vaters und ihren Ehefrauen und Kindern auf unserem Hof, und sie reichen mich wie einen kleinen Wanderpokal von Zimmer zu Zimmer. Ich werde inniglich geliebt, gehegt und gepflegt. Bis meine Tante Iva die Reise des verwaisten Wanderpokals beendet. Sie sagt, das Baby braucht eine Bezugsperson. Und diese Bezugsperson wird sie.
Der Heimaturlaub I
Meine Mutter bekommt schnell auch so eine gute Arbeit in Deutschland wie mein Vater. Als Tellerwäscherin, in einem jugoslawischen Restaurant am Ort. Ihre Stelle ist begehrt, der Chef zahlt gut und hilft, die Kasse meiner Eltern zu füllen, die bald wieder zurück in die Heimat wollen, damit mein Vater in unserem Dorf eine kleine Autowerkstatt eröffnen kann. Meine Mutter muss dann gar nicht mehr arbeiten. Denn mein Vater hat große Pläne. Er hat eine Begabung fürs Geldverdienen, meine Mutter eine Begabung für die Küche. Der Chef hält große Stücke auf sie, sie ist jung, fleißig und reinlich. Und sie ist vor allem eines: bildhübsch. Er sagt, wenn sie schnell Deutsch lerne, würde er sie als Kellnerin einsetzen. Die hübschen jugoslawischen Kellnerinnen gingen alle mit Taschen voller Geld heim, das wolle sie sich doch nicht entgehen lassen. Aber meine Mutter will nicht zu den Deutschen, sie will auch kein Deutsch lernen. Sie will so schnell wie möglich zurück nach Jugoslawien.
Sie will zurück zu ihrem Baby, zu mir.
Sie bleibt jeden Abend länger als die anderen und übernimmt Extraschichten. Und dabei magert sie so ab, dass die älteren Kolleginnen anfangen, sich ernsthaft um sie zu sorgen, und schimpfen: »Kind, du musst essen!«
Aber sie kann nichts essen, unmöglich. Sie bekommt einfach nichts herunter. Sie spürt keinen Hunger. Sie spürt nur diesen pochenden, tiefen Schmerz. Wie ein scharfes Messer steckt er in ihrer Magengrube und bohrt sich jeden Tag, den sie getrennt von ihrem Baby ist, tiefer in sie hinein.
An ihrem neunzehnten Geburtstag, sechsundvierzig Tage vor meinem ersten, bekommt sie von den anderen Tellerwäscherinnen eine Vasina Torta gebacken und einen roten Paschminaschal geschenkt. Mein Vater schenkt ihr einen goldenen Herzanhänger und sagt ihr, nicht mehr lange, dann gehen wir zurück! Meine Mutter will aber nicht länger warten, sie nimmt ihren Mut zusammen und fragt ihren Chef, ob sie zu meinem ersten Geburtstag für ein paar Tage Heimaturlaub nehmen darf. Er lehnt ab.
Er schiebt Personalmangel vor – in Wahrheit fürchtet er, seine fleißigste Mitarbeiterin zu verlieren. Denn er weiß: Lässt er sie gehen, kommt sie nicht mehr zurück.
Erst ist meine Mutter außer sich, dann verstummt sie. Sie spricht tagelang kein Wort, und mein Vater beschließt, nun seinen Chef nach Heimaturlaub zu fragen.
»Einer von uns beiden«, sagt er, »ist da, wenn die erste Kerze ausgepustet wird.«
Vier Tage könne er ihn entbehren, sagt ihm sein Chef, aber die Schicht am Wochenende müsse er trotzdem schieben. Doch mein erster Geburtstag fällt ausgerechnet auf einen Samstag und somit auf die Wochenendschicht meines Vaters.
Meine Mutter sagt: »Du musst trotzdem fliegen!«
Sie fahren mit dem Bus zum nächstgelegenen Reisebüro und kaufen von ihrem Ersparten ein Flugticket von Köln nach Split, mit einem Rückflug am 10. September 1976. Einen Tag vor meinem ersten Geburtstag.
Mein Vater versucht, meine Mutter zu beschwichtigen: »Es ist doch nicht so schlimm, sie ist noch so klein und weiß doch gar nicht, welcher Tag es ist. Donnerstag, Freitag oder Samstag, es ist doch egal. Ich puste trotzdem eine Kerze mit ihr aus!«
Meine Mutter stopft aus alten Stoffen eine Puppe, stickt ihr Augen und mit rotem Faden einen großen, lächelnden Mund und schläft jeden Abend bis zum Abflug in fester Umarmung mit ihr ein. Sie wickelt die Puppe in Geschenkpapier mit bunten Glitzerpunkten und steckt sie meinem Vater ins Handgepäck. Der Duft des Geburtstagsgeschenkes meiner neunzehnjährigen Mutter soll mich an sie erinnern. Daran, dass es sie gibt und ich sie nicht vergessen darf.