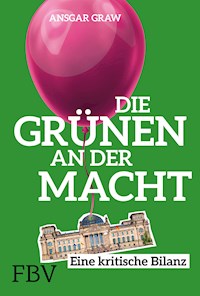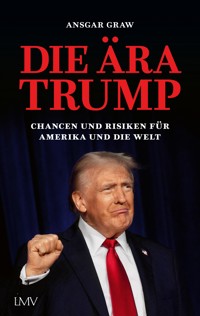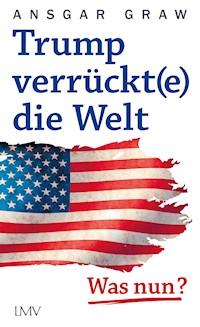
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Langen-Müller
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Am 3. November entscheiden die Wähler, ob sie das 2016 begonnene Experiment mit Donald Trump, dem wohl disruptivsten Staatsmann, der nach 1945 in einer liberalen Demokratie ins Zentrum der Macht gewählt wurde, fortsetzen oder sich für den Routinier Joe Biden entscheiden, der nicht wegen seiner Ideen gewählt würde, sondern weil er nicht Donald Trump ist. Washington Insider Ansgar Graw zeigt die Stärken und Schwächen beider Politiker in einer tief gespaltenen Nation, er analysiert ihre Wählermilieus und die Umfragen und er zeichnet die großen Themen des Wahljahrs und ihren Einfluss nach: Da ist die Black-Lives-Matter-Bewegung, die gegen Rassismus und Polizeigewalt protestiert, aber in ihren extremen Ausläufern nicht vor Gewalt, Brandschatzungen und Denkmalstürmereien zurückschreckt. Und da ist die Pandemie. Trump hat sie stets heruntergespielt, aber wenige Wochen vor der Wahl wurde bekannt, dass er sich der tödlichen Bedrohung durch Corona immer bewusst war. Nehmen ihm seine Wähler ab, dass er sie vor einer Panik bewahren wollte? Oder setzt sich Bidens Wort vom "Verrat des amerikanischen Volkes auf Leben und Tod" durch?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Titel
Ansgar Graw
Trump
verrückt(e)
die Welt
Was nun?
Impressum
Besuchen Sie uns im Internet unter
www.langen-mueller-verlag.de
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
VÖLLIG AKTUALISIERTE NEUAUFLAGE
zur Wahl am 3. November 2020 zwischen
Donald Trump und Joe Biden
© 2020 Langen Müller Verlag GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Thomas Steinhoff, Frankfurt am Main
Umschlaggestaltung: Wolfgang Heinzel
Umschlagmotiv: © barks, stock-adobe.com
Satz und E-Book Produktin: Satzwerk Huber, Germering
Gesetzt aus der Minion Pro 11/13,75 pt
ISBN 978-3-7844-8394-8
Inhalt
Einleitung
1 | Wahlkampf 2020: Joe Biden, der Kandidat ohne Eigenschaften
Biden, der Plagiator
Kamala Harris und die »warme Spucke«
Amerika und die Pandemie
Der Tod des George Floyd
2 | Wer ist Donald Trump?
Trump, der Unternehmer
Trump, der Politiker
Trump, der Fall für die Psychiater
Trump und die Frauen
Trump, der Radikale
Die Gretchenfrage: Wie hältst du’s mit der Religion?
Trump, der Law-and-Order-Präsident
Trump, der Führer, der nur manchmal führt
3 | Ein Trump und zwei Amerikas
Amerikas Identitätskrise
4 | Falsche Schweden: Großvater, Vater, Sohn
Der Großvater: Ein »Etablissement« in Alaska
Der Vater: Bauen für den Mittelstand
Der Enkel: Aus Millionen werden Milliarden
5 | Jäger im Weißen Haus: Wie Donald Trump zur Politik fand
»Running Mate« von George H.W. Bush?
Im Bündnis mit Ross Perot
Wo wurde Obama geboren?
Spenden für die Demokraten
Ein später Abtreibungsgegner
Frühe Kritik am Freihandel
6 | Wer wählt Trump, wer will Biden?
Wie war es 2016?
Weiße Pessimisten
Stadt-Land-Spaltung
Der Meinungsforscher, der nicht mehr an sich glaubte
7 | Das Universum des Präsidenten: Familie und Verbündete
Der Präsident und die Gesetzeslücken
Die Geschäfte der First Daughter
Smarter Schwiegersohn, emanzipierte First Lady
8 | Außenpolitik: »America First« und »Amercia Alone«
Der »Aufstieg der Anderen«
Wer braucht die Nato?
Der Spalter und die gespaltene EU
Ungeliebtes Deutschland
Beneidetes Russland
Blutbefleckter Naher Osten
»Niemand ist stärker Pro-Israel«
Kein Deal mit dem Iran
Kein Rückzug aus Syrien und Afghanistan
Handelskrieg mit China
Ein smarter Freund aus Nordkorea
Hat Trump eine außenpolitische Doktrin?
9 | Spuren nach Moskau: »Putin ist netter als ich«
Erfundene Begegnungen
Moskaus Hass auf Clinton
Russische Rubel
10 | Rückruf der Geschichte: Das Erbe des Andrew Jackson
Old Hickorys Mangel an Selbstkontrolle
Das gesprengte Parteiensystem
Kampf gegen die Banken
Hurensohn mit Elektrosäge
11 | Obama, Biden und Political Correctness als Trumps Wahlhelfer
Darf man vom »radikalen Islam« sprechen?
Geht auch Joe Biden in die PC-Falle?
Die Faszination der Mauer
12 | Amerikas Wirtschaft: War es Trumps Aufschwung?
Erfolgreiche Steuerreform
Als Bill Clinton in den Sumpf raste
13 | Der Commander-in-Tweets, die Medien und die alternativen Fakten
Die Regie einer Pressekonferenz
Wie links sind Amerikas Journalisten?
Der Präsident und der Philosoph
14 | Trumps Politik: Die Bilanz nach vier Jahren
Literaturverzeichnis
Namensregister
Einleitung
2020 wird nicht nur als das erste Coronajahr in die Geschichtsbücher eingehen, sondern auch die Frage beantworten, ob die amerikanischen Wähler am 3. November das Experiment mit dem wohl disruptivsten Politiker, der seit 1945 in einer liberalen Demokratie in ein zentrales Amt (nein, in das zentrale Amt!) gewählt wurde, fortsetzten oder beendeten.
2016 begann dieses Experiment, als Donald Trump am 8. November zum Präsidenten der USA gewählt wurde. Vier Jahre später stand er seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden gegenüber. Der ständige Provokateur gegen den routinierten Langweiler. Der Make-America-great-again-Politiker gegen den, der verspricht, das zerstrittene Land wieder zu einen.
Der Autor hat von 2009 bis 2017 als politischer Chefkorrespondent in Washington gearbeitet und dabei beide Politiker aus der Nähe erlebt. Biden als den Vizepräsidenten mit langer Erfahrung aus dem Senat an der Seite von Barack Obama und Trump seit 2016 als Wahlkämpfer und im ersten Halbjahr seiner Präsidentschaft. Er war bei Trumps Inauguration dabei, bei Pressekonferenzen im Weißen Haus und bei Hintergrundgesprächen mit Regierungsoffiziellen. Er hielt engen Kontakt zu Entscheidern in der Obama-Administration, darunter Mitarbeiter Bidens, und er traf frühzeitig Weggefährten, Biografen und Freunde der Familie Trump. Er reiste in die Hochburgen von Trump-Wählern und stieß dort auf eine große Perspektivlosigkeit. Im Sommer 2017 legte er eine erste Einschätzung des neuen Präsidenten unter dem Titel »Trump verrückt die Welt« vor. Die Einleitung begann so: »Donald John Trump hat das Zeug, als einer der mächtigsten Präsidenten in die Geschichte der USA einzugehen – wenn man Macht am Ausmaß der Veränderungen bemisst, für die der jeweilige Commander-in-Chief verantwortlich zeichnet.«
Diese Voraussage hat sich bestätigt. Die Veränderungen betreffen die internationale Arena, von der sich seit 100 Jahren kein Präsident so entschlossen zurückgezogen hat wie Trump – und es noch umfassender täte, würden ihm nicht manche Berater, darunter Schwiegersohn Jared Kushner, und die Profis in State Department und Pentagon gelegentlich in den Arm fallen. Amerika sei nicht mehr bereit, »Weltpolizist zu sein«, appellierte der zuvor auch international tätige Immobilienunternehmer an die Stimmung der nach blutigen und teuren Einsätzen in Afghanistan und im Irak kriegsmüden Bevölkerung. Trumps Isolationismus ging so weit, die Nato 2016 vorübergehend als »obsolet« zu bezeichnen. Damit hat er das nach dem Zweiten Weltkrieg etablierte Vertrauen im transatlantischen Verhältnis fundamental verändert.
Und hier die wichtige Nachricht für Europa und gerade Deutschland: Egal, ob Joe Biden 2020 oder erst 2024 ein Trump-Nachfolger gewählt wird, im transatlantischen Verhältnis wird es nicht wieder so werden wie es war. Der Ton würde wieder zivilisierter, das Vertragswerk stabiler werden, doch auch die Demokraten werden von den Verbündeten ein gerechteres Burden Sharing und höhere Verteidigungsbeiträge verlangen.
Denn trotz seiner Absage an den Multilateralismus hat Trump gleichwohl sicherheits- und außenpolitische Erfolge zu verzeichnen: von der militärischen Zerstörung des sogenannten »Islamischen Staats« (ISIS) über den Beginn offizieller Friedensgespräche zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban am 12. September 2020 in Katar bis zur Vermittlung eines Friedensabkommens zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Golfstaat Bahrain folgt dem Beispiel und normalisiert ebenfalls die Beziehungen zu Jerusalem. Diese außenpolitischen Erfolge darf sich Trump trotz seiner vielfach kritisierten Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels und seines unerbittlichen Kurses gegen die Taliban zuschreiben. 2019 steuerten amerikanische Flugzeuge 7423 Bomben oder Raketen gegen Ziele in Afghanistan, während es zum Höhepunkt der Offensive unter Obama 2009 laut US-Air Force lediglich 4147 Bomben und Raketen waren.
Innenpolitisch sind die Trump zuzubilligenden Veränderungen nicht weniger gewichtig. Faktische Zwei-Parteien-Systeme haben immer die Tendenz zu einem tiefen ideologischen Graben zwischen links und rechts. Aber unter Trump gab es bürgerkriegsähnliche Szenen, als Chaoten unter dem Deckmantel der überwiegend friedlichen Black-Lives-Matter-Demonstrationen brandschatzend durch amerikanische Stadtviertel zogen. Dabei hatte der formale Anlass der Unruhen, nämlich die tödliche Polizeigewalt gegen den Afroamerikaner George Floyd, wenig mit dem Präsidenten zu tun. Als 2014 während Obamas Präsidentschaft in Ferguson in Missouri der schwarze Teenager Michael Brown von einem weißen Cop erschossen wurde, erlebte der Autor nicht nur die anschließenden Demonstrationen und Ausschreitungen mit, sondern wurde selbst grundlos verhaftet und in Handschellen gelegt und damit (wie später ein Gericht geklärt hat) ein Opfer von Polizeiwillkür.
Vor Trump gab es strenge Kriterien für eine ernstzunehmende Präsidentschaftskandidatur, etwa fundierte politische Erfahrungen aus einem Mandat im Kongress oder als Gouverneur. Biden mit seinen 38 Jahren im Senat und acht Jahren als Vizepräsident ist nach diesen bisherigen Maßstäben der ideale Kandidat. Nichts davon brachte Trump mit. Dieser Präsident, der regelmäßig lügt, als Unternehmer mit der Organisierten Kriminalität zusammengearbeitet hat und sich schon damals brüstete, er könne für 200000 Dollar einen Senator kaufen, hat alle Standards gerissen. Dass er gewählt wurde, belegt, dass jeder zweite Amerikaner mit dem System unzufrieden ist. Die Menschen im Binnenland, im Flyover America, sahen sich mit ihren Problemen in Washington nicht mehr repräsentiert.
Aber Trump verachtet die weiße Unter- und Mittelschicht, seine wichtigste Basis. Das zeigen seine Äußerungen über gefallene amerikanische Soldaten, die er als »Verlierer und Trottel« bezeichnete. Wurde er so unter Berufung auf Quellen aus seiner Umgebung zunächst vom zweifellos Trump-kritischen Magazin The Atlantic zitiert, bestätigte später auch Jennifer Griffin, sicherheitspolitische Korrespondentin von FoxNews, dem Leib- und Magensender des Präsidenten.
Der zweite harte Schlag für den Wahlkampf des Präsidenten im September: Der legendäre Watergate-Enthüller Bob Woodward bewies mit Gesprächsaufzeichnungen, dass Trump schon im Februar über die tödlichen Gefahren durch das Corona-Virus Bescheid wusste. Er spielte die Pandemie dennoch herunter und verhöhnte noch im September 2020 Joe Biden als »Fall für den Psychiater«, weil der öffentlich Schutzmasken trug. Er habe nur eine Panik vermeiden wollen, verteidigte sich Trump. Warum rief er dann nicht wenigstens wiederholt zur Beachtung der Sicherheitsvorschriften auf? Trump log nicht nur über Corona, er log auch über seine Lüge über Corona.
Zurück zu den Kriterien für das Präsidentenamt, die Trump niedergerissen hat: Als der Rapper Kanye West im Sommer 2020 seine Kandidatur ankündigte, fand dies medial weit mehr Beachtung als es einer solchen PR-Aktion gebührt. Aber Wests organisatorisch wenig ambitioniertes Engagement passte zu einer Stimmung, die schon einmal vor knapp 200 Jahren zu beobachten war. Als der politisch völlig unerfahrene, jähzornige, gegen die Eliten pöbelnde Andrew Jackson 1829 Präsident wurde, rief eine Frau aus: »Also, wenn der Präsident werden kann, dann kann das jeder andere auch.« Wer den Aufstieg von Trump begreifen will, muss die Faszination verstehen, die Jackson auslöste, als er die Amerikaner auf dem Land gegen die in den Städten mobilisierte – nahezu mit den gleichen Parolen, die Trump verwendete. In dem entsprechenden Kapitel zeigt der Autor, das Trump nicht vom Himmel gefallen ist (oder gar aus der Hölle gespuckt wurde), sondern mit einem traditionellen Grundgefühl einer großen Bevölkerungsgruppe harmoniert.
Trump hat wegen seiner narzisstischen Persönlichkeit, seiner Lügen und seiner sprunghaften Politik Kritik verdient. Allerdings geraten die Vorwürfe gegen ihn mitunter zum bloßen Affekt. Joe Biden warf dem Präsidenten Rassismus vor, weil er Corona, das sich von Wuhan aus verbreitete, als »chinesisches Virus« bezeichnet hatte. Viele im Westen applaudierten dem Demokraten. Doch von Afrikanischer Schweinepest oder Spanischer Grippe sprechen wir wegen ihrer ursprünglichen Herkunftsgebiete mit größter Selbstverständlichkeit. Politische Korrektheit als Waffe gegen Trump hat schon im Wahlkampf 2016 versagt.
Trump setzt vor allem auf weiße Wähler. Allerdings fand sein unternehmerfreundlicher Kurs (ohne Rücksicht auf die Staatsverschuldung) auch Zustimmung unter Schwarzen und Hispanics, deren Chancen sich auf dem Arbeitsmarkt verbesserten. Biden setzt auf Wähler mit höherer Bildung, auf Arbeiter und auf Minderheiten, insbesondere Afroamerikaner. Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris soll ihm dabei helfen. Doch in entscheidenden Swingstates wie Florida oder Michigan holte Trump im September auf. Darum ist dieses Buch keines über den Wahlkampf 2020, sondern eines, das die Zerrissenheit des Landes aus dem Verständnis des Landes erklärt. In einer Zeit, in der zu viele Autoren ihre Aufgabe darin sehen, als Bannerträger zumeist des einen und seltener des anderen Kandidaten persönliche Überzeugungen statt gründlicher Information zu vermitteln, soll dieses Buch über den Wahltag hinaus Relevanz behalten.
1 | Wahlkampf 2020: Joe Biden, der Kandidat ohne Eigenschaften
Etwas mehr Mindestlohn. Investitionen in grüne Energien. Eine Strafrechtsreform. Unterstützung von Gemeinden mit hohem Minderheitenanteil. Die Rückkehr zum Pariser Klimaabkommen. Nein zum generellen Einreiseverbot aus diversen muslimischen Ländern. Ja zu Obamacare. Jein zu einem weiterhin harten Kurs gegenüber China. Joe Bidens Wahlkampfthemen sind so vorhersehbar und wenig aufregend wie seine Reden. Der Kandidat der Demokraten ist kein Entertainer, kein Volkstribun, kein Mensch mit Visionen. Der frühere Rechtsanwalt, der 17 Tage nach der Wahl 78 Jahre alt wird, wirkt nicht wie der Garant für ein zukunftsfestes Amerika, sondern wie der nette Großvater von nebenan.
Und das taugte im Wahlkampf 2020 vielleicht zur schärfsten Waffe von Biden. Donald Trump, der Präsident, ist nur vier Jahre jünger, aber er ist der aggressive Zuspitzer. »Tough Trump« wurde er genannt, als er 2011 wieder einmal ein Buch auf den Markt brachte, »Time to get Tough«. Er spottet gern über »sleepy Joe«, den verschlafenen Joe. Was aber, wenn die Menschen in den USA nach vier Jahren Egotrip des Milliardärs im Oval Office sich jetzt den visionsfreien Opa-Typen wünschen? Lieber einen entspannenden Beruhigungstee trinken statt ständig Adrenalin serviert zu bekommen? Einen Kandidaten ohne Eigenschaften bevorzugen gegenüber einem so eigenwilligen Narzissten?
Biden, geboren im Nordosten des Bundesstaates Pennsylvania, wuchs auf in Delaware, das er von 1973 bis 2009 im Senat vertrat. Als er im Wahlkampf 2008 Running Mate von Barack Obama und dann acht Jahre dessen Vizepräsident war, wirkte Biden noch drahtiger, agiler, vor allem ambitionierter. Gegenüber Journalisten ließ er deutlich durchblicken, dass er mit seiner langen Senatserfahrung und seiner Fähigkeit, über die Parteilinien hinweg Kompromisse auszuhandeln, doch eigentlich der viel geeignetere Kandidat sei als dieser Jungspund, geboren auf Hawaii, der gerade erst seit 2005 als Junior Senator für Illinois die Bundespolitik zu entdecken begann.
Der Groll kam nicht von ungefähr. In jener Präsidentschaftswahl hatte Biden eigentlich seinen Namen auf dem Ticket der Demokraten fürs Weiße Haus sehen wollen. Dann aber äußerte er sich 2007 im Aufgalopp zum Bewerbungsrennen über den ebenfalls in den Startlöchern sitzenden Obama. »Ich meine, wir haben den ersten Mainstream-Afroamerikaner, der sich artikulieren kann, intelligent und sauber und ein gutaussehender Kerl ist«, sagte Biden dem New York Observer in einem Gespräch über das Bewerberfeld seiner Partei. »Ich meine, das ist wie für einen Roman, Mann.« Der Politiker, dem bis heute der Ruf nacheilt, er lasse keinen Fettnapf aus, entschuldigte sich. Seine Worte, vor allem das Lob dafür, dass der Afroamerikaner »sauber« sei, seien aus dem Kontext gerissen worden. Doch mit der Nominierung wurde es nichts mehr, stattdessen kam Obama zum Zug.
Erstmals hatte sich der irischstämmige Katholik 1988 um die Kandidatur bemüht. In einer Wahlkampfrede wollte der junge Senator auf Ungerechtigkeiten im Bildungssystem hinweisen: »Als ich hierher kam, überlegte ich mir, warum wohl Joe Biden der erste in seiner Familie ist, der jemals eine Universität besucht hat.« Dann zeigte er auf seine im Publikum sitzende Frau und fuhr fort: »Warum ist meine Frau, die hier im Publikum sitzt, die erste in ihrer Familie, die ein College besucht hat?«
Biden, der Plagiator
Schön? Schön geklaut! Biden hatte abgekupfert bei Neil Kinnock, dem Führer der britischen Labour Party, der einige Monate zuvor eine Rede sehr ähnlich aufgezogen hatte: »Warum bin ich der erste Kinnock seit 1000 Generationen, der auf die Universität gehen konnte?« Ein Fingerzeig auf die Gattin im Auditorium: »Warum ist Glenys die erste Frau in ihrer Familie seit 1000 Generationen, die eine Universität besuchen konnte?«
Als man Bidens frühere Reden nun genauer unter die Lupe nahm, fanden sich weitere Plagiate, unter anderem aus Reden von John F. Kennedy und dessen Bruder Robert. Zudem hatte er seine akademischen Leistungen deutlich aufgehübscht und tatsachenwidrig behauptet, er sei in der Bürgerrechtsbewegung mitmarschiert. Kurz darauf zog Biden seine Bewerbung zurück.
Die Lügen und Übertreibungen von Trump werden zu Recht kritisiert. Biden hat sich allerdings auch wiederholt die Realität zurechtgebogen. 2012 kokettierte er in einer Rede im Bundesstaat Ohio zunächst mit seinem Alter (er habe via Internet sein Gedächtnis gegenchecken müssen) und prahlte dann, 1963 habe er mit dem Football-Team der University of Delaware gegen die Bobcats der Ohio University 29 zu 12 gewonnen. Die Irish Times hat das überprüft – und festgestellt, dass der Jurastudent nie auf der Ebene seiner Universität Football gespielt habe.
Vielleicht hat Biden schlicht Glück, dass der Mann, gegen den er im November 2020 gewinnen will, so regelmäßig lügt, dass seine eigenen Angebereien als vernachlässigenswert angesehen werden. Oder liegt es daran, dass die Medien einen Demokraten (und vielleicht auch jeden anderen Republikaner) mit mehr Nachsicht behandeln als Trump?
2020 schließlich nominierten die Demokraten Biden ohne jeden Enthusiasmus. In den parteiinternen Primaries musste er sich (wie Hillary Clinton vier Jahre zuvor) einigermaßen mühsam gegen Senator Bernie Sanders durchsetzen. Sanders ist kein Parteifreund, sondern ein Unabhängiger und selbst erklärter »demokratischer Sozialist«, der aber im Senat mit den Demokraten abstimmt. Auch Kamala Harris hatte sich beworben. Am Ende fiel die Entscheidung für Biden, weil er von vielen zu durchschnittlichen oder zu unbekannten oder zu unerfahrenen Bewerbern immer noch die zuverlässigste Bank zu sein schien.
Als Obamas Vizepräsident war Biden trotz seiner anfänglichen Sticheleien, dass er ja eigentlich viel besser geeignet sei, loyal. Vielleicht loyaler zum Präsidenten als der zu ihm. Kaum war das Team im Amt, sagte der oft verschwafelte Biden auf eine Journalistenfrage: »Selbst wenn wir alles richtig machen … besteht immer noch eine 30-prozentige Chance, dass wir etwas falsch machen.« Was der Vize damit ausdrücken wollte, ist bis heute nicht gänzlich geklärt. Ein Reporter fragte kurz darauf den Präsidenten, ob Biden denn zumindest nicht den Plan zur Bankenrettung nach der Finanzkrise oder das Konjunkturprogramm der neuen Administration gemeint habe. »Wissen Sie, ich erinnere mich nicht genau, worauf Joe sich bezog«, sorgte Obama daraufhin für Lacher. »Was ja nicht überraschend ist.«
Als sich seine zweite Legislaturperiode dem Ende zuneigte, unterstützte Obama nicht seinen Vize Biden, der ebenfalls gern sein Nachfolger geworden wäre, sondern seine einstige parteiinterne Gegenkandidatin Hillary Clinton.
Woran das lag? Biden ist ein erfahrener Politprofi, der über viele Jahre dem Senatsausschuss für auswärtige Angelegenheiten zunächst als Mitglied, dann als Vorsitzender angehört hatte. Außerdem hatte er im Justizausschuss gesessen. Aber trotz dieser hohen Kompetenz hat Obama seinen Stellvertreter möglicherweise nie so ernst genommen wie seine Außenministerin. Obama und Clinton waren beide Aktenfresser, sie kamen bestens präpariert mit sämtlichen schon durchgearbeiteten Unterlagen in Sitzungen. Biden, so wurde erzählt, habe sich mitunter schlecht vorbereitet dazu gesetzt, eine Zeit lang zugehört und plötzlich einen unpassenden Einwurf gemacht, der vom Thema völlig wegführte. Manche Anwesenden verdrehten die Augen, andere nutzten die Pause, um ihre Notizen durchzugehen (Smartphones sind bei den Besprechungen mit dem Präsidenten verboten). Der Vizepräsident wirkte dann wie der wunderliche Onkel, der bei den Familienfeiern mit am Tisch sitzt und immer wieder alte, etwas abseitige, selten verständliche Geschichten erzählt
Biden stotterte als Kind. Darum war er in seinem ersten Highschool-Jahr als einziger Schüler von der Verpflichtung ausgenommen, vor 250 Mitschülern eine Präsentation vorzutragen. Er wurde als »Joe Impedimenta« verspottet, »der sprachbehinderte Joe«. In seiner 2008 erschienenen Autobiografie schreibt Biden, er könne sich an die damalige Scham noch erinnern als sei es gestern gewesen. Und obwohl er mitunter den Eindruck gehabt habe, »die Welt geht unter«, würde er heute »die dunklen Tage des Stotterns« nicht nachträglich aus seiner Vita entfernen wollen. Denn diese Behinderung habe ihn, wie ein Geschenk Gottes, stark gemacht. Er habe sich dann auf Sport konzentriert, »und das wurde mein Ticket zur Akzeptanz«, schreibt Biden. »Selbst wenn ich stotterte, war ich der Junge, der sagte: Gib mir den Ball!«, auch wenn er als Achtjähriger der Kleinste auf dem Platz war. »Und sie gaben ihn mir.«
Die schlimmeren Schicksalsschläge standen da noch aus. Wenige Wochen nach seiner ersten Wahl 1972 in den Senat starben seine erste Frau Neilia und die einjährige Tochter Naomi bei einem schweren Autounfall. Die beiden Söhne Beau und Hunter, drei und zwei Jahre alt, waren ebenfalls an Bord und wurden verletzt. Der Vater war nicht mitgefahren. Er überlegte, sein Mandat nicht anzunehmen, um ganz für die beiden Jungs sorgen zu können. Parteifreunde überzeugten ihn, die politische Karriere fortzusetzen. Drei Jahre später lernte er seine heutige Frau Jill kennen, die beiden heirateten 1977.
Sohn Beau folgte ihm in die Politik und wurde 2006 und 2010 zweimal zum Generalstaatsanwalt von Delaware gewählt. In dieser Zeit freundete er sich mit Kamala Harris an, damals Amtskollegin in Kalifornien. Beau Biden wollte 2016 für das Gouverneursamt kandidieren. Doch im Jahr zuvor starb er an einem Hirntumor. Dass sich Obama in jener Zeit für Hillary Clinton als seine Nachfolgerin stark machte, wird auch damit erklärt, dass man den Vater, der zum zweiten Mal ein Kind verloren hatte, in seiner Trauer nicht belasten wollte.
Der jüngste Sohn, Hunter Biden, ist ebenfalls Jurist und Mitbegründer einer Investmentfirma. Sie war sowohl in China als auch in der Ukraine aktiv. Es gab nie Indizien dafür, dass der Vater seine Hände dabei im Spiel hatte, dennoch sorgte man sich in der Obama-Administration, es könne der Eindruck eines Interessenkonflikts entstehen. Donald Trump attackierte Joe Biden wiederholt mit dem Vorwurf, Hunter sei auf Vermittlung des damaligen Vizepräsidenten in den beiden Ländern reich geworden. Im September 2019 stieg Hunter Biden aus seiner Investmentfirma aus, um jeden weiteren Anschein von Korruption zu vermeiden.
Kamala Harris und die »warme Spucke«
Und dann ist da Kamala Harris. In vielen Wahlkämpfen hätte man ihren Job als Running Mate Joe Bidens für so nachgeordnet gehalten wie den eines parlamentarischen Staatssekretärs in einem deutschen Bundesministerium. Vize-Präsidenten in den USA haben einen tollen Titel – und eine nach der Wahl ziemlich nebensächliche Funktion. Schultern klopfen, Ausstellungen eröffnen, Spender umgarnen, den Präsidenten immer dann vertreten, wenn er Besseres zu tun hat – John Nance Garner, von 1933 bis 1941 der Vize von Franklin D. Roosevelt, sagte, die Position sei »keinen Eimer warme Pisse« wert. Aus Gründen der damals noch gepflegten Sittlichkeit entschärften das die Journalisten zu »warme Spucke«. Und John Adams, der erste Vice President in der Geschichte der USA, nannte es »das unbedeutendste Amt, das seit der Erfindung des Menschen geschaffen wurde«.
Da wusste der vormalige Lateinlehrer und Rechtsanwalt Adams noch nicht, dass er seinem damaligen Chef George Washington nachfolgen und von 1797 bis 1801 der zweite Präsident der Vereinigten Staaten werden würde. Von den 44 Personen, die bislang amerikanische Präsidenten wurden, bekleideten immerhin 14 zuvor den Stellvertreterposten, darunter Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, Harry S. Truman, Richard Nixon und George H.W. Bush. Jetzt will es ihnen Joe Biden nachtun.
Das macht einen Vize-Präsidenten eben doch wichtig: Er ist das »Ersatzrad« (Garner) und kann später selbst in die erste Reihe treten, entweder durch die Kandidatur bei einer regulären Wahl – oder automatisch via Verfassung durch den Tod des gewählten Präsidenten. Zuletzt widerfuhr das 1963 Lyndon B. Johnson nach der Ermordung von John F. Kennedy.
Andere Präsidenten starben im Amt eines natürlichen Todes, sodass sie von ihrem Stellvertreter beerbt wurden. Calvin Coolidge wurde zur Nummer 1, nachdem Präsident Warren G. Harding 1823 einem Herzinfarkt erlag. Harding war erst 57 Jahre alt.
Umso mehr erwarteten die Amerikaner vom aktuellen Bewerber der Demokraten, Joe Biden, der im Fall seines Wahlsieges als bislang ältester Präsident ins Oval Office einziehen sollte, dass er bei der Auswahl des Running Mate in eine andere Alterskohorte greifen würde. Das sprach gegen die Partei-Linke Elizabeth Warren, die immerhin 71 Jahre zählt. Etwas mehr Altersunterschied wünschen sich die Wähler schon.
Und noch ein anderes Kriterium sollte diese Personalie erfüllen. »Für wen auch immer ich mich entscheide, vorzugsweise wird es jemand sein, der eine Farbe und / oder ein anderes Geschlecht hat, aber ich treffe diese Festlegung erst, wenn ich weiß, dass ich vollständig darauf vertrauen kann, dass die Person, mit der ich es zu tun haben werde, authentisch ist und ich mich darauf verlassen kann, dass wir gleich ticken«, hatte der damals noch nicht bestätigte Kandidat Ende Juni im Gespräch mit einer Gruppe afroamerikanischer Journalisten gesagt. Das lenkte nun endgültig den Blick auf Kamala Harris, im Oktober 1964 im kalifornischen Oakland geboren als Tochter eines jamaikanischen Vaters und einer indisch-tamilischen Mutter. Ein Selbstläufer wurde Bidens Entscheidung trotzdem nicht. Im Juni 2019 im parteiinternen Vorwahlkampf hatte die Senatorin aus Kalifornien und vormalige Staatsanwältin Biden heftig attackiert. Er habe im Verlauf seiner politischen Karriere zu große Nähe gezeigt zu den (verstorbenen) Kongressabgeordneten James Eastland (Mississippi) und Herman Talmadge (Georgia), die der Politik der Segregation lange nahestanden. Harris erklärte intern ungerührt, sie sehe keinen Grund, ihre damalige Kritik zurückzunehmen. Das hat Biden geärgert. Darum traf er seine Entscheidung nicht, wie zuvor angekündigt, »Anfang August«, sondern anderthalb Wochen verspätet.
Harris gilt als ausgesprochen ambitioniert. Möglicherweise fürchtete Biden, dass sie vom ersten Tag im Amt an ihrer Inszenierung als bessere Alternative arbeiten würde. Geschlecht, Hautfarbe, Kompetenz, es passt alles, um die Juristin zur nächsten Präsidentschaftskandidatin der Demokraten zu machen. Hinweis am Rande: Barack Obama lobte 2013 bei einer Veranstaltung die damalige Generalstaatsanwältin Harris als nicht nur besonders klug, sondern auch als die Bestaussehende. Danach gab es einen Shitstorm gegen den Präsidenten, der Harris »auf Äußerlichkeiten« reduziert habe, Obama kroch tatsächlich zu Kreuze, und der Immobilienunternehmer Donald Trump, damals schon in Lauerstellung für eine Politkarriere, spottete zur Freude vieler Amerikaner mächtig über diesen politisch-korrekten Kniefall. Manches spricht dafür, dass Harris damals ungewollt ein wenig Lotsendienst leistete für Trumps Weg ins Oval Office.
Amerika und die Pandemie
Zu Beginn des Jahres 2020 war sich Trump seiner Wiederwahl offenkundig recht sicher. Hatte er 2016 selbst nie ernsthaft geglaubt, im Weißen Haus zu landen, sondern sich nur zum Ziel gesetzt, der »»bekannteste Mensch der Welt« zu werden, war die Situation nach drei Jahren im Amt eine andere. Die Arbeitslosenzahlen waren auf dem niedrigsten Punkt seit vielen Jahren, der Dow Jones auf einem Allzeithoch und die Demokraten hatten keinen stärkeren Kandidaten zur Hand als den nach Trumps harschem Urteil fast schon senilen Joe Biden. Und dann kam Corona.
Hat Trump frühzeitig über die tödliche Gefahr des Virus Bescheid gewusst und sie gegenüber der Öffentlichkeit klein geredet? Sein Nationaler Sicherheitsberater Robert C. O’Brien habe ihm bereits am 28. Januar unter Berufung auf die Geheimdienste erklärt, Corona sei »die größte Bedrohung der nationalen Sicherheit während Ihrer Präsidentschaft«, enthüllte der Investigativ-Journalist Bob Woodward im September in seinem Buch »Rage« (Wut). Zehn Tage später, am 7. Februar, habe Trump Woodward angerufen. Die Situation sei weitaus ernster als das, was er öffentlich sage. »Sie atmen einfach Luft ein, und so wird es übertragen. Das ist was sehr Schwieriges. Das ist was sehr Heikles. Das ist auch tödlicher als selbst eine starke Grippe.« Doch, so sagte er Woodward am 19. März in einem weiteren Gespräch, er wolle und wollte es »immer herunterspielen, weil ich keine Panik auslösen wollte«.
Bekannt war schon zuvor, dass die US-Regierung am 3. Januar 2020 förmlich von der chinesischen Regierung über den Ausbruch der Atemwegserkrankung informiert worden. Die eigenen Geheimdienste bestätigten, die Situation sei sehr ernst. Erste Covid-19-Erkrankte in den USA wurden ab dem 6. Januar 2020 gemeldet. Trump dementierte öffentlich die neue Gefahr. »Wir haben es total unter Kontrolle«, versicherte er am 22. Januar während des Weltwirtschaftsforums in Davos auf die Frage eines CNBC-Journalisten. Bei dieser Linie blieb er über Monate: »Viele (Experten) erwarten, es verschwindet im April mit der Hitze.« (10. Februar) Und: »Das Risiko für das amerikanische Volk bleibt sehr gering.« (26. Februar) Oder: »Die Fake-News-Medien mit ihren Partnern, den Demokraten, (…) tun alles, um die Coronavirus-Situation aufzubauschen, weit über das hinaus, was die Fakten rechtfertigen.« (9. März)
Immerhin hatte Trump zwischenzeitlich erste Maßnahmen verfügt: Ab 31. Januar gab es Einreisebeschränkungen für Nicht-Amerikaner, die aus China kamen. Flugzeuge aus dem Reich der Mitte durften nicht mehr in den USA landen. Deutsche Flughäfen standen chinesischen Airlines da noch offen.
Nach Veröffentlichung von Tonbandaufnahmen für Woodwards Buch räumte Trump am 9. September ein, dass er die Situation verharmlost habe, um eine Panik zu vermeiden. Er sei der »Cheerleader« der USA, die er liebe, und »ich möchte die Leute nicht verängstigen«. Handelte es sich also um eine barmherzige Lüge im Dienste einer guten Sache? Was nicht dazu passt: Wenn sich Trump keinerlei Illusionen hingab, warum lehnte er, das Vorbild für viele Amerikaner, trotz täglich neuer Infizierten- und Todeszahlen über Monate das Tragen einer Gesichtsmaske ab? Erstmals ließ er sich damit am 12. Juli sehen. Er hätte wohl das Gegenteil einer Panik ausgelöst, wenn er erklärt hätte: »Liebe Landsleute, wir haben alles unter Kontrolle. Aber damit das so bleibt, bitte ich euch im Geiste von America first, in der Öffentlichkeit euch und andere mit einer Maske zu schützen!« Doch nichts davon. Als ein Fox-News-Journalist am 26. März ein Bild von Joe Biden mit dunklem Mund-Nasen-Schutz plus Sonnenbrille und der Bemerkung twitterte, dieses Bild könne möglicherweise erklären, »warum Trump es nicht mag, öffentlich eine Maske zu tragen«, retweetete Trump den Gag. Noch am 4. September spottete der Präsident bei einem Auftritt in Pennsylvania über den Gegenkandidaten: »Haben Sie je einen Mann gesehen, der Masken so sehr mag?« Wäre er Psychiater, »würde ich sagen, dieser Kerl hat ein paar große Probleme«.
Zudem lud Trump Anhänger zu Wahlkampfveranstaltungen ein, bei denen weder Masken getragen noch Abstand eingehalten wurden. Dabei hatte sich Trump am 17. März, in Übereinstimmung mit seinen zunächst unveröffentlichten Gesprächen mit Woodward, vor Journalisten gebrüstet: »Dies ist eine Pandemie. Ich fühlte, dass es eine Pandemie ist, lange bevor es Pandemie genannt wurde.« Vier Tage später verbreitete er via Twitter die Hoffnung, das zur Malaria-Bekämpfung entwickelte Arzneimittel Hydroxychloroquin könne helfen.
Wie passen frühzeitiges Wissen und gleichzeitiger Spott über Corona-Masken-Träger zusammen? Die Antwort: Trump hat eine extrem kurze Aufmerksamkeitsspanne. Er war mutmaßlich kurz vor seinen Gesprächen mit Woodward von Geheimdienstlern über die Gefährlichkeit von Covid-19 informiert worden und wusste, das Buch der Journalistenlegende würde sein Bild in der Zeitgeschichte teilweise definieren. Darum protzte er mit Insiderwissen. Am nächsten Tag saß er mit seinen Wahlkämpfern zusammen, die ständig (in Bestätigung seiner öffentlichen Aussagen) Argumente dafür sammelten, dass alles nicht so schlimm sei. Wenn dann ein Experte mutmaßte, sobald es wärmer werde, verschwinde der Virus möglicherweise, verbreitete Trump diese Hoffnung wie ein Faktum weiter. Trump neigt dazu, stets die Position seines letzten Gesprächspartners zu übernehmen, solange dessen Argumentation knapp und nachvollziehbar ist.
Die Zahl der Corona-Toten in den USA ist gewaltig. Allerdings ist die Opferzahl pro eine Million Einwohner in etlichen Ländern höher. Am 13. September 2020 waren in Proportion zur Bevölkerung die meisten Menschen in Peru gestorben, es folgten unter anderem Belgien, Spanien, Großbritannien und Italien. Die USA standen in dieser traurigen Liste auf Platz 10, auch wenn dort in absoluten Zahlen mehr Menschen Covid-19 zum Opfer gefallen waren als in jedem anderen Land. Spätestens seit den Woodward-Enthüllungen muss man dem Präsidenten vorwerfen, dass er wohl viele Menschen hätte retten können mit einem besonnenen Aufruf, nicht in Panik zu verfallen, aber Corona gleichwohl ernst zu nehmen.
Im zweiten Quartal brach das Bruttoinlandsprodukt in den USA um 32,9 Prozent ein. Aber schon im August rutschte die zuvor auf 14 Prozent gekletterte Arbeitslosenquote wieder auf einen einstelligen Wert unter zehn Prozent. Im September sprach Trump zudem davon, ein Impfmittel gegen Corona könne zum Jahresende »oder sogar früher« gefunden werden. Wer aber glaubt ihm jetzt noch?
Der Tod des George Floyd
Die Wunden der Sklaverei in Amerika sind bis heute nicht verheilt. Fast 160 Jahre nach ihrer offiziellen Abschaffung durch Abraham Lincolns Emanzipationsproklamation vom 22. September 1862 und nahezu 60 Jahre nach dem von Martin Luther King angeführten »Marsch auf Washington« im August 1963 leben Weiße und Schwarze eher Neben- als Miteinander. Vielfach wohnen sie in nicht juristisch, aber faktisch getrennten Stadtvierteln. Der Bildungsgrad der Schwarzen und dementsprechend ihr Verdienst ist niedriger. Die Schulen der Schwarzen, finanziert aus dem lokalen Steueraufkommen, sind wegen der geringeren Einkünfte schlechter ausgestattet. Die Kriminalität der Schwarzen ist höher. Während sie nur etwa 13 Prozent der Bevölkerung ausmachen, begehen sie im Jahr 2016 nach der FBI-Statistik 52,6 Prozent der Tötungsdelikte. Weiße (ohne Hispanics) stellen 63,4 Prozent der Bevölkerung und verüben 44,7 Prozent der Tötungsdelikte. In Gefängnissen des Bundes und der Einzelstaaten saßen Ende 2017 laut des Justizministeriums 475900 Schwarze und 436500 Weiße.
Diese Zahlen mögen erklären, dass in einem Land mit dem Recht auf Schusswaffenbesitz Polizisten in Begegnungen mit Schwarzen (noch) misstrauischer sind als mit Weißen. Wer je in eine Fahrzeugkontrolle in den USA geraten ist, weiß, dass es sich dringend empfiehlt, im Auto bis zu einer anderslautenden Aufforderung sitzen zu bleiben, die Hände auf dem Lenkrad zu belassen und auf der Suche nach den Papieren erst nach Rücksprache mit dem Officer in die Jackentasche oder gar ins Handschuhfach zu greifen.
Der 46-jährige Afroamerikaner George Floyd hielt sich laut Videoaufzeichnungen an diese Vorgaben, als er am 25. Mai 2020 in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota in seinem Auto sitzend von Polizisten mit vorgehaltener Waffe überprüft wurde. Ein Verkäufer in einem nahen Geschäft hatte die Beamten verständigt, weil er den Verdacht hatte, der angetrunken wirkende Floyd habe bei ihm mit einem gefälschten 20-Dollar-Schein Zigaretten gekauft. Floyd musste schließlich aussteigen, und ihm wurden, nach anfänglichem Widerstand, Handschellen angelegt. Als die Polizisten den gefesselten Floyd in ihr Einsatzfahrzeug setzen wollte, wehrte der sich. Er fiel zu Boden, mehrere weiße Cops drückten ihn nieder. Einer von ihnen, inzwischen wegen Mordes angeklagt, presste sein Knie auf Floyds Genick. Sieben Minuten und 46 Sekunden lang ließen die Polizisten nicht von dem gefesselten Mann ab, der mindestens 20 Mal stöhnte, er könne nicht atmen: »Sie bringen mich um, Mann!« Kurz darauf war George Floyd tot.
In den anschließenden Tagen, Wochen und Monaten kam es zu Protestkundgebungen der Black-Lives-Matter-Bewegung gegen Polizeigewalt in über 2000 amerikanischen Städten und Gemeinden sowie in vielen Ländern der Welt – zumal es weitere Fälle der Tötung von Schwarzen durch weiße Polizisten gab, bei denen die Verhältnismäßigkeit der Gewaltanwendung sehr zweifelhaft erschien. Zu 93 Prozent blieben die Demonstrationen friedlich. Linksextreme Chaoten nutzten die Proteste aber auch zu massiven Plünderungen, Brandschatzungen und Angriffen vor allem auf Polizeistationen. Dutzende Denkmäler wurden zerstört. Ziel der Attacken waren keineswegs nur Standbilder von Südstaaten-Generälen aus dem Bürgerkrieg. In einem veritablen Kulturkampf wurden bis Ende August 2020 mindestens 35 Statuen von Christoph Columbus und einzelne Standbilder von Präsidenten wie George Washington, Thomas Jefferson oder Theodore Roosevelt zerstört. Die Vorwürfe: Columbus habe die Kolonisierung initiiert, und die Präsidenten seien Sklavenbesitzer gewesen. Selbst ein Denkmal für den Sklaven-befreier Abraham Lincoln wurde Zielscheibe der Wut der (keineswegs durchgängig schwarzen) Protestler, weil es neben dem Präsidenten einen dankbaren Schwarzen in »unterwürfiger Position« zeigte. Zerstört wurde zudem ein Denkmal für Francis Scott Key, den Autor der Nationalhymne »The Star-Spangled Banner«.
Der Präsident befehligte Bundespolizisten nach Portland in Oregon, einem Zentrum gewalttätiger Proteste, und orderte Einheiten der Nationalgarde in die Hauptstadt Washington. Der Gouverneur von Wisconsin, Tony Evers, ein Demokrat, rief Soldaten der Nationalgarde zudem nach Kenosha, wo es nach Schüssen eines Polizisten in den Rücken des Afroamerikaners Jacob Blake ebenfalls zu tagelangen Ausschreitungen linksextremer Randalierer kam. Seinem Gegenkandidaten Biden warf Trump vor, der wolle wie die BLM-Bewegung das Budget für Polizeibehörden zusammenstreichen. Biden hat so etwas nie gefordert. Aber je länger die Unruhen in den USA anhalten, die sich nicht nur gegen Rassismus und Polizeigewalt, sondern auch gegen den Mann im Weißen Haus richten, desto stärker dürfte Trump davon profitieren.
2 | Wer ist Donald Trump
Nach vier Jahren im Weißen Haus bleibt Trump manchen ein Faszinosum und anderen ein Skandalon. Er ist der unbeliebteste Präsident seit Erfindung der Meinungsforschung und er hat reale Chancen, in diesem Jahr 2020 gegen Joe Biden wiedergewählt zu werden – obwohl die Umfragen ihn bis in den Herbst hinein deutlich hinter seinem demokratischen Herausforderer sahen. Der Quereinsteiger in die Politik, der Amerikas Spaltung vertiefte, die Institutionen der ältesten Demokratie infrage stellte und das Ordnungsgefüge der Welt verrückte, hat allein schon durch seinen Wahlsieg 2016 die Geschichte verändert.
Die Beliebtheit eines Präsidenten lässt sich an seinen Akzeptanzwerten (Approval Rating) messen. Trump kam dabei laut Gallup zwischen Januar 2017 und August 2020 auf durchschnittlich 40 Prozent. Sämtliche Vorgänger erreichten im Schnitt ihrer gesamten Präsidentschaft bessere Werte. Barack Obama (47,9 Prozent), George W. Bush (49,4 Prozent), Bill Clinton (55,1 Prozent), George H.W. Bush (60,9 Prozent), Ronald Reagan