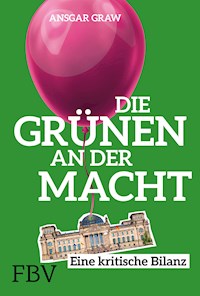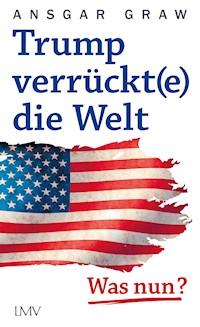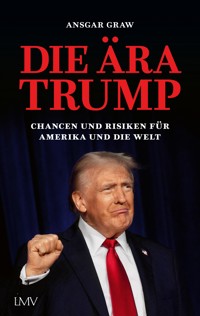
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Langen-Müller
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
America First! Und zweitens? »Groß und glorreich« will Donald Trump Amerika machen. Er will Steuern kürzen, Zölle erheben, Illegale deportieren, Grönland und Panama kontrollieren. Er ist Kapitalist und Protektionist, er ist Isolationist und Imperialist, er gilt als Frauenverächter und fördert Frauen. Kein anderer Machtpolitiker ist so widersprüchlich wie Trump. Wie tickt der mächtigste Mann der Welt? Was will er wirklich? Auf wen stützt er sich dabei? Dieses Buch, mit essayistischer Kraft erzählt, gibt die Antworten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Einleitung – Die Regie einer Pressekonferenz 9
1. Und was, wenn Trump recht hat? 20
Ein Jungtürke bei den Republikanern 27
Kanada, Grönland – und der Panama-Kanal 28
2. Eine Ära – die Prägung des Besonderen 35
Die Fehler von Joe Biden 39
Das Erbe von Barack Obama 40
»America First« – seit 1916 42
Trump und andere Status-quo-Brecher in der Welt 44
Lange waren die Europäer Egoisten – jetzt werden es die USA 47
3. Ein Mann mit Konturen im Zeitalter der Konturenlosigkeit 49
72 oder 2 Geschlechter? 50
Als Obama Harris lobte und sich dann dafür entschuldigen musste 53
»Illegal« oder nur »undokumentiert«? 57
4. The Show must go on 61
Am Anfang war die Provokation 63
Der Wahlkampf 2024 66
Wie Trumps Reden funktionieren 67
Obsession mit der Größe seiner Zuschauerschaft 70
Erfundene Begegnungen mit Putin 71
Bullshit-Talk 74
Immer weitere Superlative 77
5. Frauenfeind, Faschist, amoralisch: Wie radikal ist Donald Trump? 80
Stichwort Frauenfeindlichkeit 90
Erfolgreiche Klage gegen ABC 95
Ist Trump xenophob? Ein Radiointerview lässt aufmerken 101
Diskriminierung von Afroamerikanern? 103
Trump und LGBTQ+ 104
Trump und die Muslime 106
Trump und das Christentum 108
Trump und die Ethik: Politik und Business sind eins 111
6. Wer wählte Trump? Und warum? 115
Niederlagen auf den Schlachtfeldern 117
Prioritäten für Wahlentscheidungen haben sich verschoben 119
Man hält Trump nicht für ehrlich – und wählt ihn trotzdem 119
7. Die Trumps in Amerika – Familie oder Dynastie? 127
Hoffnungsträger Barron und Kai: Kinder und Enkel des Präsidenten 128
Präsidenten und ihre Kinder: Von Theodor Roosevelt bis zu Barack Obama 133
Golfspielen mit Enkelin Kai 136
Trump und die Frauen 138
Falsche Schweden: Großvater, Vater, Sohn 143
Der Großvater: Ein »Etablissement« in Alaska 144
Der Vater: Bauen für den Mittelstand 149
Der Enkel: Aus Millionen werden Milliarden 155
8. Musk, J. D. Vance, Milei und andere Disruptoren – Trumps Universum 167
First Buddy Musk und seine Deutschland-Mission 170
Wie J. D. Vance 2028 gewinnen soll 178
Javier Milei: Hardrocker im Kammermusik-Orchester 184
Licht und Schatten in Trumps Kabinett 187
9. It’s the migration, stupid 190
Alle Illegalen ausweisen? Trumps Angst vor den Kameras 192
Im Juni 2015 versprach Trump den Amerikanern eine Mauer 196
10. Trumps Außenpolitik – America First. Und zweitens? 200
Trumps Grönland-Forderungen sind sehr ernst gemeint 202
America First, aber kein Isolationismus 207
Warum Merkel Obama nicht ernst nahm 209
Auch Carter und Clinton gegen Multilateralismus 211
Handel ist Macht: Trumps Blick nach Asien 213
Sanktionen und Wege zu ihrer Umgehung 216
Krieg um Taiwan? 220
Israel und der Nahe Osten 222
Ukraine als Nagelprobe: Wie stark ist Trump? 224
Kein Deal mit dem Iran 227
11. Trumps Wirtschaftspolitik: Kapitalismus hinterm Zollzaun 230
Frühe Wortmeldung gegen Handelsdefizite 232
Lobbyismus oder: Wer verdiente an den Aluminiumzöllen wirklich? 234
Amerika hat nicht zu viel, sondern zu wenig Kapitalismus 237
Wenn sich arbeiten nicht lohnt 239
12. Der erste Trump hieß Andrew Jackson 244
Old Hickorys Mangel an Selbstkontrolle 248
Trump und Jackson wollten das Wahlmänner-System abschaffen 253
Berater riet Trump, die Clintons zu verhaften 254
Amerikas kleine Parteien und unabhängige Kandidaten 256
»Zerlumpte Kerle im Weißen Haus« 258
»Gutmütig, aber oberflächlich« 260
Vizepräsident J. D. Vance und der »Hurensohn« mit Elektrosäge 261
13. Was Deutschland und die Welt von Trump zu erwarten haben 265
Trump und der Klimaschutz 266
Trump und die NATO 269
Trump und die Deutschen 270
Trump, Policy undPolitics 271
MAGA-Movement ersetzt die Republikaner 274
Trump, Russland und die Ukraine 276
Trump und die EU 277
Bibliographie 279
Personenregister 283
Mit Dank an viele Ratgeber und allen voran an meine Frau Anja und unsere Tochter Benediktina – auch für ihre Bereitschaft, mich in den letzten vier Wochen des Jahres 2024 wie einen Eremiten zu akzeptieren, der Tage und Nächte hauptsächlich in der höhligen Umgebung seines Bücherregal-umfriedeten Home Office verbrachte.
Einleitung – Die Regie einer Pressekonferenz
2025, das Jahr seiner zweiten Inauguration, fühlt sich gänzlich anders an, wesentlich routinierter als der Start von Donald Trumps Präsidentschaft 2017. Bei seinem ersten Amtsantritt schien Trump, der abstinente Gentleman in Anzug und Krawatte mit dem Benehmen eines Schlägertyps im Hinterhof, wie ein Irrtum des Systems, den man gleich einer biblischen Plage aushalten müsse – es sind ja nur vier Jahre. Bei seiner Wiederwahl fehlte die Panik, alles erschien überraschend routiniert, Business as usual, wie bei jedem bevorstehenden Präsidentenwechsel. Okay, abgesehen von Trumps Drohungen! Gegen Grönland und damit Dänemark! Gegen Panama und Kanada und Europa und gegen China sowieso. »Schaut mal, ich bin zurück! Und wenn mein Buddy Elon Musk mit ein paar Tweets in die Schlagzeilen kommt, schaffe ich das mit der größten Armee der Welt im Rücken noch viel besser.« Hatte jemand gedacht, Trump sei zum Elder Statesman geworden? Der Schlägertyp aus dem Hinterhof vollzieht sein Comeback. Trotzdem: Die Demokraten und viele Unabhängige waren tief unglücklich über Trumps Rückkehr ins Weiße Haus. Doch Endzeitstimmung verspürte der Autor vor Ort diesmal nicht.
In der Zeit der ersten Trump-Wahl lebte der Autor als Korrespondent der Welt in Washington D. C., einer 90-Prozent-Bastion für Hillary Clinton und die Demokraten, und in den Tagen nach Trumps überraschendem Triumph im November 2016 bis über die Amtseinführung im Januar hinaus lagen bleiernes Entsetzen und hinhaltende Ungläubigkeit über der amerikanischen Hauptstadt. Den 5. November 2024, Trumps Wiederwahl, verfolgte ich von meinem Arbeitsplatz in Singapur (wo es eigentlich schon der 6. November war), aber Ende des Monats reiste ich erneut nach Washington und führte viele Gespräche. Ich hatte nahezu jedes Jahr nach meiner Korrespondententätigkeit, die von 2009 bis 2017 währte, die USA besucht, keineswegs nur die Hauptstadt, und Kontakt gehalten zu vielen Kollegen, Beobachtern und Freunden. Und nicht alle, aber manche von ihnen teilten nach der Wiederwahl den Eindruck, dass in der Rückschau acht Jahre zuvor eine Ära begonnen zu haben schien und die Wahlen 2016 und 2024 für eine neue Realität standen, während sich die tüdelige Geschichte 2020 lediglich geirrt habe, als zwischendurch noch einmal Joe Biden an die Macht gekommen war.
Als Trump im Juli 2016 von der Republican National Convention in Cleveland (Ohio) offiziell zum Kandidaten für die vier Monate später stattfindende Präsidentschaftswahl ausgerufen wurde, war er noch der selbst in der eigenen Partei vielfach ungeliebte und als insgesamt chancenlos angesehene Außenseiter. PayPal-Gründer Peter Thiel, eine Silicon-Valley-Größe, hielt dort als der erste offen homosexuelle Redner bei einem Republikaner-Parteitag eine Hommage auf Trump und bekam viel Beifall, sah sich aber nach Rückkehr ins Silicon Valley heftigen Anfeindungen ausgesetzt. Auf Trump, den 47. Präsidenten, setzen hingegen etliche Tech-Gurus, er wird in Mar-a-Lago besucht von Meta-CEO Mark Zuckerberg, der ein Riesengeschenk mitbrachte: Facebook schafft die Fact-Checkers ab, »sie waren zu sehr politisch voreingenommen« und hätten »mehr Vertrauen zerstört als aufgebaut«. Das freut Trump, der es mit Fakten nie genau genommen hat. Und ein Besuch von Bill Gates ist ebenfalls im Gespräch, Wallstreet-Entscheider äußern sich überfreundlich und Sponsoren haben sich überboten für seine Inauguration, die aufwändiger wurde als jede zuvor.
2016 hatten hauptsächlich Amerikas in die Jahre gekommenen weißen Männer Trump gewählt. Damals klügelten die demokratischen Strategen, die Zeit beende endgültig die Vormacht der Republikaner, Amerika würde nun sehr rasch diverser, multiethnischer, weiblicher, woker und künftig anders wählen. Doch just entscheidende Teilmengen derartiger Minderheiten ermöglichten Trumps Rückkehr ins Weiße Haus, unter den Latino-Männern wählte ihn gar eine Mehrheit, und plötzlich wirkte Trump wie die logische Antwort auf die Unfähigkeit nicht nur der gänzlich uninspirierenden Democrats, sondern auf ein in Teilen dysfunktionales System. Bei Latinos, Schwarzen, Muslimen und Asiaten fand er mehr Zuspruch, auch Frauen und junge Wähler sehen in ihm einen Hoffnungsträger – interessant, da doch seine Gegenkandidatin eine Frau war, die knapp seine Tochter hätte sein können.
Im tiefblauen, also demokratischen Kalifornien verkürzte er Bidens Vorsprung von 29 Prozentpunkten auf nur noch 20 Punkte, die Harris vor ihm landete. In der anderen großen blauen Bastion, New York, siegte die Vizepräsidentin mit einem Vorsprung von knapp 12 Prozentpunkten – Biden lag 2020 doppelt so weit vor Trump. Amerikaner, die enttäuscht waren von der schlechten Politik Bidens, angefangen bei der Grenze, nicht zu vergessen den schmählichen Rückzug aus Afghanistan, schließlich das Megathema Inflation, die immer weniger vom Lohn übrig lässt, oder die Angst haben um das freie Wort in woken Zeiten, schlugen sich auf die Seite von Trump. Ob er ihre Probleme lösen kann, ist keineswegs ausgemacht. Make America Great Again beginnt aber immerhin mit der schonungslosen Analyse, dass Amerika, die unverzichtbare Führungsmacht des freien Westens, zuletzt nicht mehr groß schien.
Donald Trump, 45. und 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, bleibt disruptiv, radikal, verstörend. Ein verurteilter Gesetzesbrecher, der seine Niederlage 2020 bis heute nicht einräumt. Aber Trump, der Systemstörer, passt jetzt in eine weltpolitische Landschaft, die den Status quo in vielen Bereichen abgeschüttelt hat, ohne schon überzeugende Vorstellungen vom Künftigen, vom Status quo post zu haben. Er passt nun auch nach Washington D. C., wo zwar die 90-Prozent-plus-x erneut für die Demokraten und diesmal Kamala Harris stimmten, aber die konventionelle Politik an ihre Grenzen gestoßen ist. Jetzt bleibt zu hoffen, dass die Abrissarbeiten an dem Gewohnten und Eingeübten nicht zu brutal verlaufen.
Der Autor ist und war stets ein entschiedener Trump-Kritiker; ich verabscheue die Prahlsucht, den Narzissmus, die Rücksichtslosigkeit und die Demokratieverachtung des Präsidenten, die besonders deutlich am 6. Januar 2021 zutage trat. Ich bin kein Amerikaner, aber fühle mich aus einer liberal-konservativen Warte am ehesten den Ronald-Reagan-Republikanern verbunden. Doch ich habe mich immer um ein faires Bild bemüht, von Anfang an auch den Kontakt zu Trump-Anhängern und Vertrauten gesucht und mich gegen Überheblichkeit und den moralischen Zeigefinger zu immunisieren versucht. Dabei mag mir der Hinweis der Journalistin Salena Zito aus ihrer The Atlantic-Kolumne im September 2016 geholfen haben, nicht in die in Medienkreisen verbreitete Orthodoxie bei der Ablehnung von Trump zu verfallen: »Die Presse nimmt ihn wörtlich, aber nicht ernst; seine Anhänger nehmen ihn ernst, aber nicht wörtlich.«
Ausländische Korrespondenten erleben amerikanische Präsidenten zumeist aus der Halbdistanz. Manchmal begleiten wir den jeweils mächtigsten Mann der Welt mit einem riesigen Pressetross zu Terminen oder sind bei einer Pressekonferenz anwesend, doch Interviews bleiben in der Regel den Kollegen der großen amerikanischen Medien vorbehalten. Es gibt Ausnahmen, aber ich habe kein Interview im Weißen Haus zustande gebracht, weder in den acht Jahren des Barack Obama noch im ersten Jahr von Trump, die ich in den USA verbrachte. Allerdings hatte ich ein unmittelbares Erlebnis mit Trump im März 2017, beim ersten Besuch von Angela Merkel im Weißen Haus, und ich erzähle es hier erneut, weil es mir klarmachte, dass dieser Präsident, zweifellos kein Intellektueller, mit einer souveränen Schlagfertigkeit ausgestattet und street-smart ist, wie die Amerikaner sagen. Diese Fähigkeiten schaffen Charisma und erklären in Teilen seine Popularität. Aber das Erlebnis entlarvt auch, wie Trump widerlegte Fake News, die er verbreitet hat, im Handumdrehen durch neue Tatsachenverdrehungen tarnt.
Damals gaben der Präsident und die Kanzlerin die übliche Pressekonferenz im East Room des Weißen Hauses. Zwei amerikanische Reporter durften dort je eine Frage stellen und ebenso zwei deutsche, nämlich eine mitreisende Journalistin aus dem Tross der Kanzlerin und, wie mir die formidablen Kollegen in D. C. freundlicherweise zugestanden hatten, von den Korrespondenten vor Ort ich. An jenem Tag herrschte Aufregung unter den Presseleuten, allerdings kaum wegen Merkel: Vielmehr war die Nachricht des Tages ein Dementi Londoner Regierungsvertreter zur Andeutung von Trumps Sprecher Sean Spicer vom Vortag, britische Spione hätten Trump im Wahlkampf auf Veranlassung Obamas abgehört. Als »lächerlich« wies ein namentlich nicht genannter Vertreter der britischen Regierung dies just am Morgen des Merkel-Besuchs zurück.
Zwei Journalisten von CNN und New York Times berieten sich, wer den Präsidenten auf diesen Vorgang ansprechen würde. Das schnappte eine in der Nähe stehende Mitarbeiterin von Spicer auf. Der Trump-Sprecher wählte kurzerhand zwei andere US-Journalisten aus, die harmlose Fragen zu anderen Themen planten. Der CNN-Journalist Joe Johns wollte diese Regie nicht akzeptieren und bat mich, an seiner Stelle das Thema anzusprechen. Anders als Spicer verlangte der Vertreter des Bundespresseamtes niemals Auskunft darüber, was wir denn zu fragen gedächten, sondern wollte nur wissen, wer die Fragen stellen würde, damit die Kanzlerin uns namentlich aufrufen konnte. Ich würde am Schluss, also als vierter an die Reihe kommen.
Nach den Statements von Präsident und Kanzlerin rief Trump zunächst Mark Halperin von MSNBC auf. Danach ärgerte Kristina Dunz (damals dpa, heute RND) den Präsidenten mit der Frage, warum er »Angst vor Diversität« habe, von Fake News spreche und Dinge behaupte, die nicht belegt werden könnten, »wie die Äußerung, Obama habe Sie abhören lassen«. Trump reagierte sarkastisch: »Nette, freundliche Reporterin.« Er warf Dunz in seiner Antwort ebenfalls Fake News vor, ohne auf die Abhördebatte einzugehen.
Es folgte eine Frage von Kevin Cirilli von Bloomberg TV, dann kam als letzter ich an die Reihe, befragte die Kanzlerin zum unterschiedlichen Verständnis der Europäischen Union in Berlin und Washington und wandte mich an Trump: Rücke er nach dem Dementi aus London von der Meinung ab, dass der britische Geheimdienst ihn abgehört habe – oder gebe es »weitere Verdächtige«? Und weil Trump über Twitter die entsprechende Beschuldigung gegen Obama erhoben hatte, formulierte ich, gegen die strengen Spielregeln des Weißen Hauses, gleich noch »meine zweite Frage: Bedauern Sie gelegentlich den einen oder anderen Ihrer Tweets?«
»Sehr selten«, antwortete Trump, der zu jenem Zeitpunkt nahezu 30 Millionen Twitter-Follower hatte (bis Anfang Januar 2025 stieg die Zahl auf 97,1 Millionen). Ich fasste nach: »Sehr selten? Sie würden sich also nie wünschen …?« Der Präsident fiel mir ins Wort: »Sehr selten. Ich würde vermutlich jetzt nicht hier sein – also sehr selten.« Denn er könne »die Medien umgehen, wenn die Medien nicht die Wahrheit erzählen, darum mag ich das«.
Und dann sagte Trump, mit einem Grinsen in Richtung der neben ihm stehenden Merkel: »Was das Abhören angeht, ich glaube in Bezug auf die vorige Regierung haben wir immerhin etwas gemeinsam, vielleicht.« Das gab Gelächter im Saal. Die Kanzlerin warf ihm einen irritierten Blick zu, lächelte aber nicht. Merkel war unter George W. Bush und Obama vom US-Geheimdienst NSA abgehört worden.
Der Präsident wandte sich nochmals mir zu: »Und um Ihre Frage abzuschließen, wir haben nichts behauptet. Alles, was wir getan haben, wir haben einen sehr begabten juristischen Kopf zitiert, der dafür verantwortlich ist und das im Fernsehen gesagt hat. Ich habe mir dazu keine Meinung gebildet. Das war das Statement eines sehr begabten Anwaltes auf Fox. Ich habe mich dazu nicht geäußert. Und darum sollten Sie nicht mit mir reden, sondern Sie sollten mit Fox reden, okay?«
Das war nicht nötig. Anderthalb Stunden nach der auf allen News-Kanälen live übertragenen Pressekonferenz distanzierte sich Fox-News-Moderator Shepard Smith aus dem Studio von dem »begabten Kopf«, auf den sich Trump berufen hatte: »Fox News kann die Darstellung von Richter (Andrew) Napolitano nicht bestätigen. Fox News hat keine Kenntnis von Belegen irgendwelcher Art dafür, dass der derzeitige Präsident der Vereinigten Staaten zu irgendeinem Zeitpunkt in irgendeiner Weise überwacht wurde. Punkt.« Der Sender nahm Napolitano, einen ehemaligen Verfassungsrichter in New Jersey, für einige Tage vom Schirm. Am 29. März 2017 trat der Jurist dort allerdings erneut auf – und wiederholte seine Theorie, Obama sei aus der üblichen »Befehlskette ausgestiegen« und habe den britischen Geheimdienst GCHQ (Government Communications Headquarters) zur Überwachung von Trump instrumentalisiert.
Doch mehrere Untersuchungen im Kongress ergaben später keine Hinweise, dass Trumps Telefone oder sein Büro angezapft worden waren – ob nun von amerikanischen oder britischen Agenten. Das FBI hatte lediglich wegen des (falschen) Verdachts, der Kandidat werde von Moskau gesteuert, einen mit Mikrofonen »verwanzten« Zuträger auf Trumps Wahlkampf-Mitarbeiter Carter Page und George Padadopoulos angesetzt, um Beweise für eine direkte Kooperation mit russischen Behörden zu sammeln. Erkenntnisse aus diesen Operationen landeten jedoch nie im Weißen Haus.
Übrigens bekamen Kristina Dunz und ich vor allem von Amerikanern direkt nach der Pressekonferenz viel Lob. »Die deutsche Presse hat uns beschämt«, twitterte Tara Palmeri (Politico). Jeremy Diamond (CNN) assistierte: »Gut, dass unsere deutschen Kollegen den Präsidenten wegen der Abhörvorwürfe fragten, nachdem zwei Reporter, die Trump aufrief, das nicht taten.« Ähnlich äußerten sich CNN-Ikone Wolf Blitzer, Abby D. Philip (Washington Post) und Ryan Lizza (New Yorker). Allerdings widersprach ich, als mir direkt nach der Pressekonferenz Mikrofone unter die Nase gehalten wurden, dem freundlichen Lob. Deutsche Journalisten sind mutiger als ihre amerikanischen Kollegen? Nein. Ich war nur für amerikanische Kollegen eingesprungen, denen das Weiße Hauses das Wort verboten hatte. Damit habe ich keinen Mut gezeigt, ich habe eine normale journalistische Frage in Washington D. C. gestellt – und nicht etwa in Pjöngjang.
Seit Januar 2025 trägt der Präsident ein unübersehbares Kainsmal: Trump habe »mit beispiellosem kriminellem Aufwand« versucht, seine Niederlage im November 2020 rückgängig zu machen, formulierte Sonderermittler Jack Smith in seinem Abschlussbericht zum Sturm auf das Kapitol. Er habe »falsche Behauptungen über Wahlbetrug« verbreitet, »diese Lügen als Waffen eingesetzt« und konsequent »zur Gewalt gegen seine vermeintlichen Gegner aufgerufen«, was am 6. Januar 2021 zum Sturm auf das Kapitol führte. Smith schrieb, sein Büro sei zu dem Schluss gekommen, dass »die zulässigen Beweise ausreichten, um eine Verurteilung vor Gericht zu erreichen« – und damit eine mehrjährige Haftstrafe. Gleichwohl beantragte Smith die Einstellung des Verfahrens – wegen seiner Wiederwahl genieße der Präsident Immunität. Hätte Kamala Harris gewonnen, wäre nach dieser Einschätzung Trump im Gefängnis gelandet. Zehn Tage vor seiner zweiten Inauguration wurde der Bericht veröffentlicht, obwohl Trumps Anwälte dies mit allen Mitteln zu verhindern gesucht hatten.
Ein Wort zu diesem Buch: Ein kleiner Teil des Inhalts wurde, zumeist in aktualisierter und ergänzter Form, übernommen aus den beiden früheren, im gleichen Verlagshaus erschienenen Büchern des Autors, »Trump verrückt die Welt. Wie der US-Präsident sein Land und die Geopolitik verändert« (2017) und »Trump verrückt(e) die Welt. Was nun?« (2020). Zu den Ausnahmen gehören die Familiengeschichte der Trumps, die lediglich aktualisiert wurde, und das Kapitel über Andrew Jackson, der ein früher Vorläufer von Trump war mit frappierender Ähnlichkeit bis hin zum äußeren Erscheinungsbild. Das meiste aber wurde völlig neu geschrieben.
Jedes Kapitel hat den Anspruch, auch für sich alleine gelesen werden zu können, und setzt nicht zwingend das Vorwissen aus den anderen Abschnitten voraus. Wer also wissen will, wie Trump zur Außenpolitik oder zur Migration steht, kann direkt zu den entsprechenden Kapiteln springen und muss nicht fürchten, sie erst nach Lektüre der vorangegangenen Seiten zu verstehen. Darum wird aber auch diese oder jene Information mehrfach vermittelt, weil beispielsweise Trumps Ankündigung seiner Kandidatur 2015 eine Rolle spielt für seine Migrationspolitik, aber auch für seine Wahlerfolge oder für seinen Showman-Charakter.
Das vorgenannte erste Buch zum Thema eröffnete der Autor mit dieser Passage: »Donald John Trump hat das Zeug, als einer der mächtigsten Präsidenten in die Geschichte der USA einzugehen – wenn man Macht am Ausmaß der Veränderungen bemisst, für die der jeweilige Commander-in-Chief verantwortlich zeichnet.«
Diese Prophezeiung einer neuen Ära hat sich bestätigt. Donald Trump ist einer der mächtigsten Präsidenten in der Geschichte der USA, vielleicht gar der stärkste von allen. Jetzt gilt es, sich in dieser neuen Welt zu orientieren.
1. Und was, wenn Trump recht hat?
Stellen wir an den Anfang eines Trump-kritischen Buches von einem Autor, der den wiedergewählten Präsidenten der USA ablehnt wegen seiner Selbstgerechtigkeit und seiner Polemik und seiner Demokratieverachtung, wie sie am 6. Januar 2021 überdeutlich wurde, eine gemeine Frage: Was ist, wenn Trump recht hat?
Nicht mit seiner Idee, dass nur Wahlen fair sind, die ihn als Sieger ausweisen. Oder dass der Präsident mit ein paar Muskelspielereien Grönland unter US-Hoheit bekäme (obwohl ganz und gar nicht ausgeschlossen ist, dass er den Status dieser Insel tatsächlich verändern wird). Oder dass sich mit Zollschranken nach China und Europa und Kanada und Mexiko Amerikas ökonomische Probleme lösen ließen. Oder dass es den USA besser ginge, wenn sämtliche illegalen Einwanderer, mindestens elf Millionen, deportiert würden. Oder bei seinem Umgang mit Frauen – immerhin wurde er in einem zivilrechtlichen Verfahren verurteilt wegen sexuellen Missbrauchs und seine Berufung dagegen kurz vor Jahresende 2024 von einem Bundesgericht abgewiesen. Aber dass er vielleicht recht hat mit dem Gespür dafür, dass die bisherigen Rezepte, die in freien Gesellschaften diskutiert werden, keine adäquate Antwort sind auf die aktuellen Herausforderungen? Dass die Transformation auf allen Feldern, von der Öffnung der Grenzen über eine Strangulierung der Volkswirtschaften im Zeichen einer klimaneutralen Zukunft, von den Bürgern nicht mitgemacht wird? Die Mehrheit der Amerikaner schickte deshalb im Januar 2025 zum zweiten Mal einen Präsidenten ins Weiße Haus, der sich dem woken Konsens linksliberaler Meinungsmacher verweigert. Die Argentinier wählten bereits 2023 mit Javier Milei einen Mann, der ihnen sämtliche Härten marktliberaler Radikalität in Aussicht stellte, aber letztlich auch eine Befreiung von einem Übermaß an Staat. In Europa, von Ungarn über Italien bis Skandinavien, den Niederlanden, Österreich und Frankreich, die neuen Rechts- und Linksaußen-Parteien in Deutschland nicht zu vergessen, werden neue Lösungen gesucht. Gefunden hat sie noch keiner, Donald Trump eingeschlossen, und der Brexit der Briten möge Europa nicht zum Vorbild werden. In jedem Fall braucht es Konzepte angesichts der Macht autoritärer Regime, die vor allem in China und in Russland zunehmend expansiv agieren, eines noch wirtschaftlich-diplomatisch, das andere bereits mit Panzern und Raketen. Nordkorea, Belarus und Iran gehören in dieses Lager, und die Türkei, obgleich NATO-Mitglied, will sich dem BRICS-Bündnis anschließen, das nicht von allen, aber doch einigen ihrer Mitglieder als Kampfallianz gegen die von den USA geführte freie Welt gesehen wird.
Die britische Journalistin Jane Merrick kam schon im November 2016 im Kurznachrichtendienst Twitter, heute X, zu der Frage: »Ist es ein Zufall, dass Trumps Unterschrift wie die Messwerte eines Seismografen nach einem Erdbeben aussieht?«
Acht Jahre später schrieb Eric Gujer, Chefredakteur der Neuen Zürcher Zeitung, Trump sei »der empfindlichste Seismograf unserer Epoche«. In der Tat hat der Instinktmensch im Weißen Haus zwar kaum Prinzipien, Überzeugungen oder intellektuelle Grundierung. Aber er hat ein feines Gespür für Stimmungen in der Bevölkerung und tektonische Machtverschiebungen in der Welt. Er warnte bereits in der Obama-Zeit vor China, als der damalige Präsident noch mit dem Gedanken einer partnerschaftlichen G2-Führung des Globus liebäugelte. Er registrierte die Deindustrialisierung der USA angesichts billigerer Arbeitskräfte im Ausland und spürte den wachsenden Unmut über die gleichzeitige millionenfache illegale Zuwanderung. Wenn Sozialleistungsprogramme von den Menschen nicht mehr als sicher angesehen werden und die Amerikaner den Eindruck haben, ihnen gehe es schlechter als der Elterngeneration, kann es nicht bei business as usual bleiben. Wer im überwucherten Gestrüpp mit der Gartenschere nicht mehr weiterkommt, muss die Kettensäge ausprobieren. So wie es andere Disruptoren der Gegenwart probieren, Javier Milei in Argentinien allen voran.
Darum wird es Zeit, ehrlich mit Donald Trump umzugehen und gerechte Urteile zu fällen. Gerecht zu sein zu einem, der allenfalls selbstgerecht ist. Aber es geht nicht darum, die Fälle seines politischen oder charakterlichen Versagens schönzumalen, sondern schlicht um den Verzicht auf den Gestus der Hypermoral. Trump ist gewählt worden, erneut, dafür gibt es Gründe und das gilt es in einer Demokratie zu respektieren, bevor man die Demokratiefähigkeit des Gewählten unter die Lupe nimmt.
Bislang dominierten auf der einen Seite Polemik, Simplifizierung und Arroganz gegenüber dem im Januar 2025 erneut vereidigten Präsidenten und seinen Wählern – und auf der anderen Seite seine naive und unpolitische Verklärung. Zweifellos ist vieles an Kritik dringend nötig. Genauso wichtig ist aber die Kritik an seinen Kritikern, und das sind viele von uns Journalisten, die wir seine Bedeutung für Amerika und damit die Welt weder 2015 und 2016 noch 2024 richtig einzuordnen wussten.
Trump ist der am stärksten unterschätzte Machtpolitiker des 21. und mutmaßlich auch des 20. Jahrhunderts. Und andererseits wird er überschätzt, im Positiven wie im Negativen. Er ist ganz und gar nicht die messianische Lichtgestalt, die seine glühendsten Verehrer in ihm sehen. Aber er ist auch nicht der Satan, den seine Gegner aus ihm machen. Viele seiner Äußerungen zeigen ein beträchtliches Ausmaß an Demokratieverachtung und sind eines Präsidenten unwürdig, aber andere Zitate, die seine Gefährlichkeit beweisen sollen, sind aus dem Zusammenhang gerissen. Stichwort: »Blutbad« – wir kommen an anderer Stelle darauf zurück.
Vor allem eines ist Trump: anders. Er hat die Entschlossenheit, mit dem Normalen an nahezu jeder Front zu brechen. Das ist nicht durchweg erfreulich, aber Amerikaner, die seit Jahren mit ihrer Regierung unzufrieden sind, schöpfen daraus erkennbar Hoffnung, ob es nüchternen Beobachtern passt oder nicht. Man mag Trump, den selbstsüchtigen Narzissten mit dem autoritären Anspruch, entschieden ablehnen, aber man muss dann trotzdem die Frage zulassen, was an seiner Politik in der ersten Amtszeit katastrophal schlecht oder gar böse gewesen sei. Es gibt weite Felder, auf denen er zwischen 2017 und 2021 versagt hat, und zwar schon vor seinem indiskutablen Verhalten am 6. Januar 2021 im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol, und dieses Versagen wird in dem Buch analysiert.
Auf anderen Feldern hatte er hingegen bemerkenswerte Erfolge, und wenn man sich auf die Ergebnisse seiner Politik beschränkt, nicht auf charakterliche Eigenschaften und Stil, schneidet er ab wie andere Präsidenten und Politiker, mit guten Noten hier und schlechten Noten dort. Die Politik des größten Showstars der Weltpolitik war oft sprunghaft und eben nicht so hervorragend, dass man ihn 2020 wiedergewählt hätte. Aber seine Politik war auch nicht so miserabel, dass man ihm 2024 nicht eine erneute Chance einräumen wollte – nachdem Joe Biden in den Augen einer Mehrheit der Amerikaner nicht geliefert hat und damit vergessen machte, welches Chaos mit Trumps erster Amtszeit oft einherging.
Unter dem Strich gibt es sehr viele Amerikaner, die weder einen Gottgesandten in Trump sehen noch an ihm Schwefelgeruch wahrzunehmen glauben. Das sind die Commonsense-Amerikaner, die ihren »gesunden Menschenverstand« bei der Wahl haben entscheiden lassen, und von ihnen stimmten mehr für als gegen Trump, sie gaben den Ausschlag. Commonsense reklamiert Trump auch für sich, und diese Haltung hat die Wahl entschieden, die mit einem klaren Sieg, aber keineswegs einem »Erdrutsch« zugunsten des Republikaners endete. Amerika ist kein Trump-Land geworden, im Gegenteil, es ist tief gespalten zwischen dem Trump-Lager und dem Anti-Trump-Lager. Reflexhaft wird Trump gern für die Spaltung verantwortlich gemacht, doch er ist Ergebnis der extremen Lagerbildung in den USA, nicht deren Ursache. Das gilt für seinen ersten Wahlsieg 2016 ebenso wie für 2024.
Warum aber gewann Trump dann erneut eine Präsidentschaftswahl? Die Stichworte »Wirtschaft« und »Migration« stecken in der Antwort, aber sie lässt sich nicht darauf reduzieren. Unstrittig ist, dass die Mär, nur männliche Weiße bevorzugt ohne höhere Bildung, hätten ihn gewählt, schlicht falsch ist. Er bekam beachtlichen Zuspruch auch von Minderheiten, von Latinos (in der Gruppe der hispanischen Männer lag er sogar um 10 Punkte vor Harris, nachdem ihn Biden 2020 noch um 23 und Clinton 2016 gar um 31 Prozentpunkte deklassiert hatten) und Schwarzen, von den Muslimen in Michigan und von Asiaten, allesamt traditionelle Bastionen der Demokraten.
Noch ein Punkt ist wichtig: Trump machte den Wählern inhaltliche Angebote. Er wolle die Inflation unter anderem durch massive Zölle und Steuerkürzungen vor allem im oberen Einkommensbereich bekämpfen. Er wolle die illegale Migration, die vielen Amerikanern als ursächlich gilt für mehr Kriminalität und mehr Drogenhandel, nicht nur reduzieren, sondern durch massive Abschiebungen revidieren. Er steht gegen die Botschaften eines »linken Kulturkampfes« wie Cancel Culture, kritische Rassentheorie und Gender-Ideologie. Kurzum: Er will die Parameter verändern. Das zündete. Die Demokraten hingegen hatten keinerlei Programmatik zur Erneuerung anzubieten, und als Kamala Harris von Joe Biden die Spitzenkandidatur übernahm, konnte sie nur darauf verweisen, dass sie deutlich jünger ist – doch das war ohne Substanz und reichte nicht nach vier Jahren auf dem Beifahrersitz, in denen es der Wirtschaft ausweislich der Aktienkurse gut gegangen war, aber die Menschen nach den Einkäufen und dem Tanken immer weniger in der Tasche hatten.
Trumps Wahlkampf war klüger als der von Biden und danach Harris. Seine Strategen ließen die großen, sogenannten Mainstream-Medien oft beiseite und gingen in Podcasts wie den von Joe Rogan, der insbesondere ein junges Publikum erreichte. Zudem wurden aggressive Kampagnen über Internet-Influencer gefahren, die sich beispielsweise auf E-Gamer oder die Crypto-Szene fokussierten. Internet-Memes waren wichtiger als Fernsehwerbung. Und wenn sich Harris in der heißen Phase des Wahlkampfs von Starfotografin Annie Leibovitz für das Cover der elitären Vogue ablichten ließ, tauchte Trump nahezu zeitgleich mit Schürze und Burger in der Hand hinter der Theke eines McDonald’s auf, wo er Kunden bediente und sich von ihnen fotografieren ließ. Als dann kurz darauf der nicht mehr durchgehend formulierungsmächtige Präsident Biden Anhänger von Trump in die Nähe von »Abfall« rückte, enterte Trump mit der berufstypischen orangen Warnweste die Fahrerkabine eines Müllwagens, dessen Seitenfront mit seinem MAGA-Kampagnenlogo verziert war. Der Kandidat der Grand Old Party auf Raubzug in den Milieus der einstigen demokratischen Arbeiterpartei, die sich inzwischen in den elaborierten Elfenbeinturm zurückgezogen hat. Das Konzept von Trumps Strategen funktionierte und wird für kommende Wahlkämpfe lehrreich sein. Denn es erweiterte den Kreis der Adressaten weit über konventionelle Republikaner-Wähler hinaus.
Ein Jungtürke bei den Republikanern
2016 galten die Republikaner bei Intellektuellen ebenso wie im Silicon Valley als Peinlichkeit und Trump als Ärgernis. Wer sich mit der Partei oder ihrem Kandidaten einließ, bekam die Konsequenzen zu spüren, wie etwa der Milliardär Peter Thiel, der durch seine Spenden für Trump und eine Rede bei dessen Nominierungsparteitag gegen das gesellschaftlich Erlaubte verstieß und mit Liebesentzug bestraft wurde. 2024 gab es die Berührungsängste gegenüber der Partei nicht mehr und Trump wird zunehmend akzeptiert als Bestandteil einer neuen Normalität. Ende November 2024 besuchte Meta-Chef Mark Zuckerberg den President-elect in Mar-a-Lago, nachdem Trump wegen seiner Rolle beim Kapitol-Sturm seiner Anhänger im Januar 2021 noch von Facebook und Instagram verbannt worden war, und er wiederum Zuckerberg Gefängnis angedroht hatte, für den Fall einer Einmischung in die Präsidentschaftswahlen. Und weitere drei Wochen später trat eine langjährige Galionsfigur der jungen Linksintellektuellen, Cenk Uygur von der Radioshow The Young Turks, beim AmericaFest 2024, einer Veranstaltung der konservativen Gruppierung Turning Point USA, in Phoenix (Arizona) auf und versicherte den vornehmlich jungen Republikanern dort, die MAGA-Bewegung sei »offener« als die Linke. Trump war ein weiterer Redner auf dieser Veranstaltung. Und er kokettierte vor Silvester mit Hinweisen, dass sich Bill Gates mit ihm treffen wolle.
Kanada, Grönland – und der Panama-Kanal
Es gibt einen Überdruss am bisherigen Mainstream, eine Neuformierung der Lager und davon profitieren Amerikas Konservative. Charlie Kirk, der 31-jährige Initiator von Turning Point, versicherte im Oktober 2024, an den Universitäten seien die Studenten so rechts wie seit 50 Jahren nicht mehr. Schwappt das über ins Extreme, in die Kumpanei mit Radikalen? Das wird zu beobachten sein, zumal Trump laut seinem Ex-Sicherheitsberater und heutigen Kritiker John Bolton über sich selbst sagt: »Ich bin ein Schwätzer, ich rede gern« – so jemand gibt auch dem politischen Rand leicht Nahrung. Ihm, dem Showman, geht es zuerst um das mediale Scheinwerferlicht und danach um reale Machtpolitik, wenn er auf seinem Netzwerk Truth Social postet und später auf Pressekonferenzen wiederholt, die USA könnten Kanada, Grönland und den Panamakanal ins Visier nehmen und alle drei Regionen unter ihre Kontrolle bringen. Aber seine Jünger in den Reihen von weißen Rassisten oder faschistischen Organisationen wie den gewaltbereiten Proud Boys mögen nicht alle ironisch-provokanten Untertöne zuverlässig decodieren und daraus ein Make America Greater ablesen.
Und auch Trump tut einzelnen Themen keinen Gefallen durch derartige Zusammenmischungen: Es gibt legitime amerikanische Neutralitätsinteressen am Panama-Kanal, die vertraglich abgesichert sind und an anderer Stelle erläutert werden. Ein Präsident muss darauf achten, dass diese Verpflichtungen eingehalten und auch von China nicht untergraben werden. Aber diese Frage mit angeblich »lächerlich hohen« Transportgebühren zu vermengen, ist nicht staatsmännisch, sondern klingt nach Krämerseele.
Gleichwohl ist Donald Trump ein überlebensgroßer Triumphator, der insbesondere 2016 nach allen damals noch geltenden Gesetzen einer ins Betuliche ausgewichenen Demokratie nicht hätte gewinnen können. Wäre es nach den Medien gegangen, hätte er verlieren müssen; wäre es nach dem republikanischen Parteiestablishment gegangen, hätte er gar nicht erst nominiert werden dürfen; wäre es nach den Dos and Don’ts, dem Erlaubten und Unerlaubten der amerikanischen Politik gegangen, hätte er, der Rüpel, ohne vorherige Ämter in der Politik oder beim Militär keine Chance gehabt. Darum glaubte er damals bis zuletzt selbst nicht daran, dass er ins Weiße Haus einziehen könne, wie er einmal bekannte. Und es hieß, seine Frau Melania habe nach dem Sieg im November 2016 Tränen des Entsetzens vergossen ob der Vorstellung, aus dem dreistöckigen Penthouse-Eigentum im luxuriösen Trump Tower an New Yorks gediegener Fifth Avenue in die angejahrte Enge der Privat-Gemächer im wenig heimeligen Weißen Haus umziehen zu müssen.
2024 hat Trump hingegen an seine Rückkehr ins Weiße Haus geglaubt, und er hat es geschafft. Im Wahlkampf überstand er zwei Attentate. Beim ersten, am 14. Juli, war er kühn genug, sich aus dem menschlichen Schutzschirm der sonnenbebrillten Secret Service-Agenten, die ihn nach den Schüssen auf den Boden geworfen hatten, augenblicklich wieder hochzukämpfen, mit Blutspritzern von seinem getroffenen Ohr auf Gesicht und Hemd. Als er sich da hochreckte, wie eine Statue des Heroismus, ähnlich dem Iwo-Jima-Denkmal (Marine Corps War Memorial) in Arlington vor den Toren der Hauptstadt, und die geballte Faust gen Himmel reckte, schrieb der Autor dieses Buches, ganz und gar kein Fan dieses Mannes, aber um einen objektiven Blick bemüht, auf Twitter: »Jetzt ist #Trump nicht mehr zu besiegen.«
Trump wird vorgeworfen, Hass zu säen auf Frauen (das ist abwegig), Ausländer (das ist Unsinn), Homosexuelle (das ist absurd) und illegale Migranten (das ist wahr) – wir kommen an anderer Stelle darauf zurück. Joe Biden verstieg sich im Wahlkampf zu dem Vorwurf des Antisemitismus, was arg albern ist angesichts einer Tochter, Ivanka, die zum Judentum konvertierte, und einem jüdischen Schwiegersohn, Jared Kushner, mit dem der Präsident in der ersten Amtszeit in der Israel-Politik eng zusammenarbeitete.
Richtig ist gleichwohl: Trump ist kein moralisches Leuchtfeuer für die Welt. Seine Wähler, die zumeist, aber keineswegs nur, männlichen Geschlechts sind, überzeugt seine Energie, aber nicht sein Charakter. Sie wollten ihn als Präsident und würden doch ihre Töchter daheim einschließen, hätten die einen ruchlosen und vulgären Boyfriend wie ihn. Seine Wähler fordern Law and Order und setzen dazu ausgerechnet auf einen verurteilten Straftäter.
Trump ist wie jemand, der sich aus Gründen der Selbstvermarktung auf einen wilden Egotrip begeben hat und nicht mehr die Ausfahrt zur Normalität findet. Er ist ein Faktenverdreher, ein Großmaul, ein Demokratieverächter. Er ignoriert sämtliche ethische Standards, etwa wenn er, der aussichtsreiche Kandidat für das Weiße Haus, sich Ende September 2024 in Mar-a-Lago von To Lam, dem damaligen Präsidenten des von Trumps Einfuhrzöllen bedrohten Vietnam, besuchen ließ und mit ihm einen 1,5 Millionen Dollar Deal über ein Golf- und Hotelprojekt in der nördlichen Hung Yen-Provinz des südostasiatischen Staates unterzeichnete. Und in seiner ersten Amtszeit unterhielt der Milliardär Trump ein Luxushotel in Washington D. C. in Steinwurfweite vom Weißen Haus; ausländischen Delegationen geriet es nicht zum Nachteil, wenn sie dort abstiegen oder teure Events veranstalteten. Die Trump Organization, die während der Präsidentschaft von 2017 bis 2021 zumindest auf dem Papier von Trumps Kindern Don Jr., Eric und Ivanka treuhänderisch geleitet wurde, hatte das Old Post Office, in dem sich die Edelherberge befand, von einer Regierungsbehörde geleast, deren Chefin der Präsident ernannt hatte. Trump vermietete also an Trump.
Sich aus einer Position der Stärke über alle ethischen Gepflogenheiten hinwegzusetzen, ist rücksichtslos. Trump selbst nennt es mit dem Titel seines (von Ghostwriter Tony Schwartz geschriebenen) Bestsellers The Art of the Deal. Doch die Kunst des Geschäftemachens wird fragwürdig, wenn der Geschäftspartner, den Trump zu übervorteilen sucht, letztlich der amerikanische Steuerzahler ist.
Um uns allerdings auch bei diesem Thema zu erden: Joe Biden verabschiedete sich ebenfalls nicht als Posterboy der Ethik aus dem Weißen Haus, nachdem er über den Thanksgiving-Truthahn Anfang Dezember entschied, seinen verurteilten Sohn Hunter, dem im Dezember 2024 eine Gefängnisstrafe wegen verspäteter Steuerzahlungen und einem illegalen Waffenkauf im Zusammenhang mit Drogenabhängigkeit verkündet worden wäre, entgegen allen vorherigen Versprechen noch rasch zu begnadigen.
Trump, das ist einer gegen alle, wie im alten Western, und Trump obsiegte, ein Happy Ending, allerdings als ein so provozierender Protagonist, wie er in Hollywood-Streifen nicht vorkommt. Er hat zerstörerische Energie, und viele befürchten, er sei ein Diktator in Lauerstellung, der die Demokratie abschaffen wird.
Ja, das täte er mutmaßlich gern. Trump würde auch mit Freude gegen unbotmäßige Journalisten, die er als »Feinde des Volkes« bezeichnet, vorgehen. Mehr als 100-mal hat er dazu aufgerufen, politische Gegner juristisch zu verfolgen und zu inhaftieren, angefangen bei seiner parteiinternen Kritikerin Liz Cheney. Aber der Autor, der von 2009 bis 2017 in Washington als politischer Chefkorrespondent der Tageszeitung Die Welt und der Welt am Sonntag lebte, mithin während der gesamten Barack-Obama-Jahre, während des Wahlkampfes Hillary Clinton vs. Donald Trump und während des ersten halben Jahres der ersten Trump-Präsidentschaft, vertraut in die Institutionen der USA. Der Supreme Court lässt sich nicht gängeln, auch nicht, seit ihm mit Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh und Amy Coney Barrett drei von Trump in der ersten Amtszeit nominierte Richter angehören. Zehn Tage vor der Inauguration wiesen sie einen Eilantrag des President-elect ab, der die Strafmaßverkündung durch ein New Yorker Geschworenengericht wegen der illegalen Verschleierung von Schweigegeldern im Prozess um die Pornodarstellerin Stormy Daniels verhindern wollte. Es kam dementsprechend zur Verkündung: Trump sei schuldig in 34 Anklagepunkten, aber wird nicht bestraft. Der Präsident will trotzdem in Berufung gehen.
Der Kongress hat nicht durchgängig Mut gegenüber Trump gezeigt, aber auch er ließe sich nicht für einen Putsch von oben instrumentalisieren. Manchen von Trumps Kandidaten für Ministerämter und andere Spitzenjobs in der Administration zeigten republikanische Senatoren schon vor der offiziellen Nominierung die rote Karte, von einigen personellen Plänen musste Trump bereits im November abrücken. Im Dezember 2024 holte er sich, noch als President-elect, eine blutige Nase bei dem Versuch, ein (von seinem First Buddy Elon Musk initiiertes) Gesetz zur Regierungsfinanzierung durchzupeitschen, das ihn für zwei Jahre von jeder Schuldenobergrenze befreit hätte – 38 republikanische Abgeordnete lehnten es ab, weil es ihnen ernst ist, die Schuldenmacherei zu bändigen, und sie demonstrierten damit, dass Trump trotz seiner Mehrheiten nicht »durchregieren« kann. Und allein die starke Stellung der einzelnen Bundesstaaten macht die Errichtung einer Diktatur in den USA unmöglich. Kalifornien und New York, beides tiefblaue Hochburgen der Demokraten, würden dem Präsidenten etwas husten, würde er sich mehr anmaßen, als ihm die Verfassung zugesteht.
Nicht zu vergessen, schließlich, die Zivilgesellschaft. Die Amerikaner haben mit klarer, aber nicht überwältigender Mehrheit zum zweiten Mal für Trump gestimmt. Doch allenfalls eine Minderheit der Bürger wäre bereit, ihre Freiheit aufzugeben.