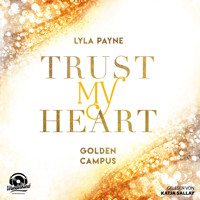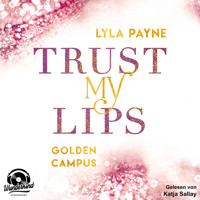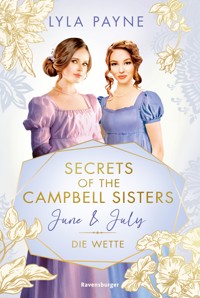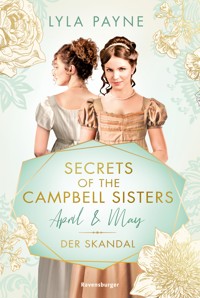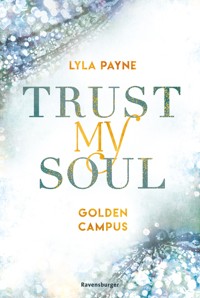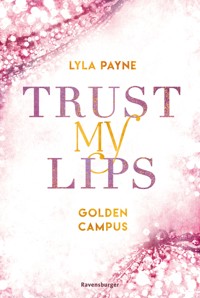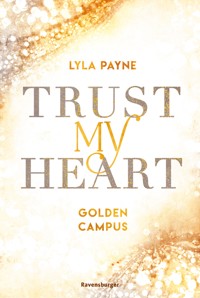
Trust My Heart - Golden-Campus-Trilogie, Band 1 (Prickelnde New-Adult-Romance auf der glamourösen Golden Isles Academy. Für alle Fans von KISS ME ONCE.) E-Book
Lyla Payne
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ravensburger Verlag GmbH
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Golden-Campus-Trilogie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
No Love without Trust. Auf der Golden Isles Academy kennt jeder die Zwillinge Felix und Noah James – die reichen Erben, die seit dem tödlichen Unfall ihrer Eltern noch unnahbarer geworden sind. May ist die Einzige, die kein Interesse an den beiden hat. Doch als Felix ihr einen Job als Nanny seiner kleinen Schwester anbietet, muss May annehmen. Bald lernt sie eine andere Seite an Felix kennen: die des fürsorglichen Bruders, der um das Sorgerecht für seine Schwester kämpft. Und die eines Jungen, der ihr Herz berührt. *** Eine Szene aus TRUST MY HEART *** "Bitte. Ich würde mich wirklich freuen, wenn du bleibst." Es war sein "Bitte", das mich umstimmte. Die Worte "na gut" waren meinen Lippen entschlüpft, bevor ich es verhindern konnte.Felix strahlte mich regelrecht an, und das Lächeln, das sich jetzt auf seinem Gesicht ausbreitete, machte ihn noch attraktiver, als er es ohnehin schon war. Dieser Anblick, dieses Lächeln ließ alles um mich herum zu Schwarz- und Weißtönen verblassen, und mir stockte der Atem, während mein Herz auf einmal wie verrückt klopfte.Meine Wangen wurden heiß, und all meine Vernunft konnte meinen Körper nicht davon abhalten, auf ihn zu reagieren. Aber ich durfte auf keinen Fall vergessen, dass Felix James, auch wenn er verdammt gut aussah, nichts für mich war. Unter den kastanienbraunen Haaren, die ihm in die Stirn fielen, prangte unübersehbar ein großes Warnschild, das ich auch bemerkt hätte, wenn mich nicht alle, einschließlich meiner eigenen Großmutter, darauf hingewiesen hätten. Ein Warnschild, auf dem ganz groß stand: Trouble. Band 1 der Golden-Campus-Trilogie Herzzerreißend romantisch. Unvergesslich knisternd
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 544
Ähnliche
Deutsche ErstausgabeAls Ravensburger E-Book erschienen 2021Die Print-Ausgabe erscheint in der Ravensburger Verlag GmbH, Postfach 2460, D-88194 Ravensburg© 2021 Ravensburger Verlag GmbHText © 2021 Lyla PayneUmschlaggestaltung: unter Verwendung von Motiven von © Shutterstock (janniwet, emi13, Lukasz Szwaj und MrVander)Übersetzung: Sabine TandetzkeLektorat: Tamara Reisinger, www.tamara-reisinger.deAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-473-47149-2www.ravensburger.de
Für alle, die auf der Suche nach der wahren Liebe sind – meistens findet sie dich, wenn du es am allerwenigsten erwartest.
DER SOMMER DANACH
Die Sommersonne schien warm auf meine Schultern und der Sand unter meinen nackten Beinen fühlte sich nach diesem heißen, fast schon zu perfekten Nachmittag wohlig warm an. Aber es war der vom vielen Lesen schon ganz zerknitterte Zettel in meiner Hand, der mir erneut ein breites Lächeln entlockte.
Als ich vor neun Monaten nach Golden Isles gekommen war, hätte ich mir all das nicht mal im Traum vorstellen können.
So vieles hatte sich seitdem verändert. Nicht alles davon war positiv, aber letztendlich hatte sich alles zum Guten gewandt.
Bei dem Gedanken musste ich grinsen. Meine beste Freundin Jo würde vermutlich die Augen verdrehen, wenn ich behauptete, alles wäre so gekommen, wie es vorherbestimmt war. Aber das wäre natürlich totaler Quatsch.
Die Dinge hatten sich nicht zum Guten gewandt, weil das Schicksal es so gewollte hatte; das glaubte ich auch nicht.
Sie hatten sich zum Guten gewandt, weil ich dafür gesorgt hatte. Ich. Und niemand anders.
Und diese Erkenntnis war vielleicht das Beste, was mir hier auf dieser Insel passiert war.
Der Zettel mit der Nachricht war schon ganz weich und verknittert, auch wenn ich mir noch so viel Mühe gegeben hatte, ihn auf meinem Bein glatt zu streichen. Wahrscheinlich lag es daran, dass ich ihn schon so oft gelesen hatte.
Die Worte ließen mein Herz immer noch höher schlagen. Ich konnte es kaum glauben, dass ich hier tatsächlich die Liebe gefunden hatte.
Und jeden Morgen, wenn ich beim Aufwachen an ihn dachte, war ich überrascht, wie sehr ich ihn liebte.
Unser erstes richtiges Date an diesem Strand liegt jetzt vier Monate zurück. Wir sollten es nachholen. Heute um 16 Uhr. Du weißt, wo du mich findest - und keine Sorge, ich habe eine saubere Decke mitgebracht.
Und ein Vorhängeschloss. ;)
Xxx
O ja, ich wusste, wo ich ihn finden würde, und nach einem Blick auf die Uhr konnte mich nichts mehr halten. Meine Füße führten mich automatisch dorthin.
Denn auch nach all diesen Monaten fühlte ich mich nirgendwo wohler als in seinen Armen.
Nicht mal am Strand.
MAY
In meinem Leben gab es so viele Dinge, die ich ignorieren musste – das Knurren meines Magens, die Sprachnachricht auf meinem Handy und das Telefongespräch, das mir unwiderruflich bevorstand, sobald ich sie abgehört hatte –, dass ich gar nicht wusste, wo ich anfangen sollte.
Das Haus fühlte sich viel zu groß an, auch wenn ich darin, als Grammy noch lebte, manchmal das Gefühl hatte, keine Luft zu bekommen. Sie war keine große Frau gewesen, aber ihre Persönlichkeit nahm eine Menge Raum ein – Raum, den ich sonst immer für mich gehabt hatte, weil meine Mutter mir mehr davon ließ, als ich jemals gewollt hatte. Außerdem hatte sie erwartet, dass ich mich ihrem Leben anpasste und nicht umgekehrt.
Doch jetzt, ohne die Frau, die mir die Tür geöffnet hatte, als ich auf ihrer Veranda aufgetaucht war, anstatt sie mir vor der Nase zuzuschlagen, kam mir das Haus riesig und kalt vor.
Rastlos lief ich in die Küche, wo ich versuchte, mich abzulenken, indem ich erst die Kühlschranktür auf- und zumachte und das Ganze gleich darauf mit sämtlichen Schranktüren wiederholte. Einige Dosen mit Bohnen und anderem Gemüse, ein paar Fertigsuppen. Ungelogen ein Jahresvorrat an Mayonnaise. Sonst nicht viel.
Aber das war nichts Neues.
Auch im Kühlschrank befanden sich nur ein halber Liter Milch, eine Dose Cola und zwei Äpfel, die ich nächste Woche als Mittagessen mit in die Schule nehmen wollte.
Ich griff nach meinem Handy, ignorierte weiterhin die Sprachnachricht und öffnete stattdessen meine Banking-App. Das würde mich auch nicht glücklicher machen als die Nachricht von dieser Bulldogge vom Jugendamt, die es ja ach so gut mit mir meinte, aber es würde mir zumindest die Illusion verschaffen, irgendetwas unter Kontrolle zu haben.
Mit einer Mischung aus Ungeduld und Furcht wartete ich darauf, dass die Seite lud. Als mein Kontostand auf dem Bildschirm erschien, stieß ich erleichtert die Luft aus – 1257 Dollar.
Noch vor einem Jahr hätte ich gedacht, ich hätte den Jackpot geknackt, aber nach den zwei Monaten, die ich jetzt alleine lebte, wusste ich ganz genau, wie schnell dieses Geld verschwinden würde.
Zwölfhundert Dollar und das Schulgeld für zwei Jahre an der Golden Isles Academy waren alles, was meine Großmutter mir hinterlassen hatte, als sie kurz nach Weihnachten an einem Schlaganfall gestorben war – dem ersten und einzigen gesundheitlichen Problem, das sie in achtzig Jahren jemals gehabt hatte. Und ihr Haus, was natürlich auch keine Kleinigkeit war.
Okay, das Haus war für Golden Isles vergleichsweise klein, aber Grammy hatte diesen zeitlosen Geschmack, der nie außer Mode kam, und das Geschenk, ein Dach über dem Kopf zu haben, war nicht zu unterschätzen – nicht, als sie mich hier hatte wohnen lassen, nachdem ich von zu Hause weggelaufen war, und erst recht nicht jetzt, nach ihrem unerwarteten Tod. Indem sie mir das Haus hinterlassen hatte, bot sie mir auf lange Sicht ein Heim – und das, obwohl wir viel zu wenig Zeit gehabt hatten, uns richtig kennenzulernen.
Trotzdem musste ich mich von irgendetwas ernähren, den Strom bezahlen, Benzin in meinen Tank füllen und warm duschen … Das Geld würde in ein paar Monaten aufgebraucht sein. Und das war noch großzügig geschätzt.
Ich brauchte also dringend einen Job.
Als ich mein Handy ausschalten wollte, fiel mein Blick erneut auf das Icon der Sprachnachricht. Eigentlich gab es keinen Grund, sie mir anzuhören. Ich konnte mir ziemlich genau vorstellen, was diese neugierige Frau vom Jugendamt von mir wollte –, aber es machte mich wahnsinnig, wenn eine nicht abgehörte Nachricht auf meinem Display angezeigt wurde.
Ich versuchte, sie weiterhin zu ignorieren. Es juckte mir in den Fingern, etwas zu programmieren, in einer Sprache zu schreiben, die überall auf der Welt verstanden wurde, und wo man mit einer bestimmten Abfolge von Befehlen das Chaos in Schach und ganze Universen im Gleichgewicht halten konnte. Aber diese kleine rote Zahl auf meinem Display würde dadurch auch nicht verschwinden. Ich verstand nicht, wie man es schaffte, sie einfach zu ignorieren und ins Unendliche steigen zu lassen. Solche Leute waren für mich Psychos.
Und da das Letzte, was ich im Moment gebrauchen konnte, war, dass mich jemand auch noch für gestört hielt, drückte ich auf »Abhören«, holte tief Luft, schloss die Augen und presste mir das Handy ans Ohr.
»Hallo, Miss May Russell, hier noch mal Caroline Dawson. Es ist nun bereits acht Wochen her, seit Ihre Großmutter verstorben ist, und ich brauche von Ihnen jetzt wirklich eine Entscheidung in Bezug auf Ihre vorzeitige Mündigkeit. Sollten Sie die nötigen Unterlagen nicht im Laufe des nächsten Monats einreichen, werden zwangsläufig staatliche Stellen eingeschaltet. Also melden Sie sich bitte auf meinen Anruf und informieren Sie mich über den Stand der Dinge. Bitte denken Sie auch daran, dass Sie nachweisen müssen, dass Sie finanziell für sich selbst sorgen können, und dass ich Empfehlungsschreiben von geeigneten Erwachsenen brauche. Jemand von Ihrer Schulleitung wäre ideal. Ich melde mich Montag noch mal. Einen schönen Tag noch, Liebes.«
Ihr »Liebes« ärgerte mich maßlos. Auch wenn ich nie woanders als in South Carolina gelebt hatte, konnte ich es nicht ausstehen, dass einige ältere Frauen alle jungen Leute behandelten, als wären sie ihre eigenen Kinder. Aber vielleicht reagierte ich auch nur instinktiv mit Misstrauen, wenn jemand versuchte, mich zu bemuttern. Vor allem, weil meine eigene Mutter ihren Job nicht besonders gut gemacht hatte.
Resigniert löschte ich die Nachricht. Mir blieb nichts anderes übrig, als Mrs. Dawson zurückzurufen – wenn nicht heute, dann Montag auf dem Weg zur Schule. Mir war klar, dass sie bis jetzt ziemlich nachsichtig mit mir gewesen war. Denn nachdem aus mir eine allein lebende Minderjährige geworden war, hätte ich entweder zu meiner Mutter zurückkehren, mich in die Obhut der staatlichen Jugendhilfe begeben oder direkt nach Grammys Tod einen Antrag auf vorzeitige Mündigkeit stellen müssen.
Es war wirklich dumm von mir, dass ich so viel Zeit hatte verstreichen lassen, ohne einen einzigen Punkt auf der Liste der Dinge in Angriff zu nehmen, die ich brauchte, um diesen Antrag zu stellen. Denn das war definitiv die einzige Option für mich.
»Okay, May«, sagte ich laut zu mir selbst. »Es wäre besser, wenn du ihr diesmal auch etwas liefern könntest.«
Einen Job zu finden, wäre da schon mal ein guter Anfang. Das hätte ich bereits in den Tagen nach Großmutters Beerdigung tun sollen, aber ich hatte mich einfach treiben lassen und so getan, als würde sie vielleicht doch zurückkommen – auch wenn ich wusste, dass das nicht geschehen würde.
Es würde keine gemeinsamen Sonntagsessen am gedeckten Tisch mehr geben; es würde auch niemanden mehr geben, der mich an ihren Bridge-Abenden aus dem Haus scheuchte, niemanden, der mich aufforderte, mir selbst etwas zu essen für die Schule zu machen, weil sie keine Lust hatte, noch einmal jemanden zu bemuttern. Mit diesem Teil ihres Lebens hatte sie abgeschlossen.
Grammy war gestorben, und mit ihr wahrscheinlich auch meine einzige Chance, in diesem Leben noch eine funktionierende Beziehung zu einem Familienmitglied aufzubauen. Denn meine Mutter schied da auf jeden Fall aus.
Und die beiden waren meine einzigen Verwandten. Zumindest soweit ich wusste.
Es war auch nicht so, als hätte ich vorher noch nie gejobbt. Ich hatte schon gearbeitet, bevor es überhaupt erlaubt war. Für mich war es nichts Neues, dass ich selbst dafür sorgen musste, etwas in den Magen zu bekommen.
Aber als ich aus der tiefsten Provinz nach Golden Isles gezogen war, hatte Grammy darauf bestanden, dass ich mich hier endlich mal meinem Alter entsprechend verhielt – und nicht wie eine Erwachsene. Ich sollte mich auf die Schule konzentrieren und – wenn ich Lust darauf hatte – Sport machen oder einem Club beitreten, aber sonst nichts.
Es machte mir Spaß, die neue Website der Academy zu programmieren, und ich tat nichts lieber, als sie zu pflegen und Verbesserungen einzuführen, um die mich niemand gebeten hatte, die Mrs. Reynolds, unsere Journalistiklehrerin, jedoch regelmäßig zu Begeisterungsstürmen hinrissen.
Aber jetzt war alles anders. Wieder mal.
Das musste ich mir nicht zum ersten Mal in Erinnerung rufen. Und wenn ich für einen Job das Website-Projekt aufgeben musste, dann würde ich das tun. Ich würde dann eben weiter mein Onlinespiel programmieren, an dem ich arbeitete, seit ich vierzehn war, wann immer ich es irgendwie reinquetschen konnte, und mir einen richtigen Job suchen.
Ja, das würde ich tun.
Ich straffte die Schultern, schnappte mir meine Tasche und die Autoschlüssel und stürmte aus der Tür.
Ich beschloss, als Erstes ins Burrow’s zu fahren und dort wegen meiner Bewerbung nachzuhaken. Das Café lag in der Nähe der Golden Isles Academy, und Josephine, meine einzige Freundin in der Schule, arbeitete dort als Barista. Sie hatte mir zwar gesagt, dass sie gerade niemand einstellten, aber ich hatte trotzdem ein Bewerbungsformular ausgefüllt. Einen Versuch war es immerhin wert.
Und selbst wenn es mit dem Job nicht klappte, konnte ich die schlechte Nachricht wenigstens mit einem Kaffee und vielleicht einer Schale heißer Suppe ausgleichen.
Als ich das Burrow’s betrat, wurde ich von einer warmen und behaglichen Atmosphäre begrüßt. Sofort drang mir der bekannte Geruch in die Nase: eine Mischung aus Kaffeearoma und dem süßem Duft von Sirup und Gebäck, das genauso gut schmeckte wie das meiner Grammy.
Ein Glück, dass sie mich gerade nicht hören konnte …
Ich war immer wieder überrascht, wie kuschelig es hier war. Das Hereinkommen fühlte sich jedes Mal an wie eine Umarmung.
Mit seinem modernen Farmhousestil, den lackierten Holzpaneelen und Bodendielen, der gedimmten Beleuchtung und den Sofas und Stühlen mit klaren, schmörkellosen Formen wirkte das Café gemütlich und einladend. Es unterschied sich mit seiner Einrichtung zwar kaum von den anderen Läden in Golden Isles, aber irgendwie hatte das Burrow’s etwas besonders Heimeliges. So als könnte man sich hier einen ganzen Tag lang mit einem Buch in die Ecken und Winkel zurückziehen, und als müssten alle ihre Überheblichkeit vor der Eingangstür ablegen.
In Golden Isles gab es nämlich zwei verschiedene Gruppen von Leuten – diejenigen, die von den Siedlern abstammten, die die Stadt gegen Ende des 16. Jahrhunderts gegründet hatten, und alle anderen.
Die Alle-anderen waren überwiegend diejenigen, die die alltägliche Arbeit auf der Insel erledigten. Sie führten Restaurants, reinigten die Kleidung der reichen Leute oder putzten die riesigen Häuser, die über den dunklen, unendlichen Fluten des Atlantiks thronten.
Automatisch sah ich mich nach Jo um, doch sie war nicht hinter der Theke, und sie hatte es sich auch nicht mit einem zerlesenen Liebesroman in einer Nische gemütlich gemacht. Doch dann fiel mir wieder ein, dass heute Freitag war und sie wahrscheinlich ihren Vater zu einem seiner Kurse ins Krankenhaus auf dem Festland brachte.
Eine Frau, nicht viel älter als ich, lächelte mich freundlich an, als ich sie nach meiner Bewerbung fragte.
»Ich bin Twyla, Süße, und das hier ist mein Laden. Ich bin sicher, du würdest hier super reinpassen, aber im Moment kann ich dir leider keine Stelle anbieten. Randy und Dee machen beide im Mai ihren Abschluss, das heißt, dass sie zum Ende des Sommers wahrscheinlich wegziehen. Wie wär’s, wenn du dich dann noch mal bei mir meldest?«
»Klar, kein Problem«, antwortete ich und hoffte, dass ich nicht so verzweifelt aussah, wie ich mich fühlte. »Dann nehme ich einfach nur einen schwarzen Kaffee und eine Schale Tomatensuppe.«
»Geht klar.«
Ich schlüpfte in eine der Nischen, spielte mit meinem Handy herum und wünschte, ich hätte meinen Laptop oder meine Chemiehausaufgaben mitgebracht – irgendwas, womit ich mich beschäftigen konnte. Und wodurch ich nicht ganz so jämmerlich und einsam wirkte, auch wenn genau das der Fall war. In Clover hatte ich nicht gerade zu den beliebtesten Mädchen gehört, und dadurch, dass ich nicht wie alle anderen hier aus einer reichen Familie stammte und in Golden Isles eine ziemlich ausgeprägte Kleinstadt-Mentalität herrschte, hatte ich mir nie irgendwelche Illusionen gemacht, dass sich das nach meiner Ankunft ändern würde.
Nichtsdestotrotz war ein Teil von mir nach wie vor davon überzeugt, dass nur Loser und alte Leute alleine im Café saßen und nichts besseres zu tun hatten, als die anderen Gäste zu belauschen.
Twyla brachte mir meine Bestellung an den Tisch, und bevor ich ihr sagen konnte, dass sie etwas falsch verstanden haben musste, hob sie die Hand.
»Du bist Josephines Freundin, richtig? Ich weiß, dass sie dir normalerweise einen Caramel Macchiato macht. Und in meinem Café lassen wir die Leute keine Tomatensuppe essen, ohne ihnen dazu ein gegrilltes Käsesandwich zum Eintunken zu servieren. Geht aufs Haus, Süße.«
Mein Lächeln geriet etwas ins Wanken, aber hielt sich dann doch. »Danke.«
Anstelle der günstigeren Schale, die ich bestellt hatte, hatte sie mir einen großen Teller Suppe gebracht, und das Sandwich war riesig, mit drei Sorten geschmolzenem Käse auf dickem, knusprigem Sauerteigbrot. Doch wegen dem Kloß in meiner Kehle hatte ich Schwierigkeiten, die ersten Bissen hinunterzuschlucken.
Seit Weihnachten hatte niemand mehr darauf geachtet, ob ich auch genug zu essen bekam, geschweige denn für mich gekocht.
Beim Gedanken an meine Großmutter riss ich mich zusammen und verkniff mir das Selbstmitleid – das Sandwich war viel zu gut, um es zu vergeuden, und wenn Grammy sehen könnte, dass ich wegen Käse und Tomatensuppe heulte, würde sie mich böse anfunkeln.
Davon abgesehen – wenn es irgendetwas gab, das noch peinlicher war, als alleine zu essen, dann, dabei auch noch zu flennen.
Das Essen war warm und hatte etwas Tröstliches an sich, wie die meisten Gerichte der Südstaatenküche, wenn sie richtig zubereitet waren. Als ich mich mit vollem Mund umsah, entdeckte ich mehrere Leute aus der Schule. Riley Hayes saß über ein Physikbuch gebeugt neben einem Jungen, den ich nicht kannte, während ihre beste Freundin und Alpha-Queen Ivy Summers auf der gegenüberliegenden Seite der Nische durch ihr Handy scrollte und sich dabei eine Strähne ihrer schimmernden blonden Haare um den Finger wickelte.
An einem anderen Tisch saßen ein paar Jungs aus dem Basketballteam, die an ihren Smoothies nuckelten und sich dabei in voller Lautstärke abwechselnd über ihr nächstes Spiel, Mädchen und die Colleges, an denen sie sich beworben hatten, unterhielten.
Ein paar auffällig stille Kids, die auf die Public School gingen, hatten sich an einen kleinen Tisch in der Nähe der Tür gezwängt und starrten höchstkonzentriert auf ihre Laptops.
»Hey, es tut mir echt leid, dass du extra kommen und mich abholen musstest. Ich habe Mrs. Frank gesagt, dass ich auch nach Hause laufen kann.« Die wütende Stimme eines jungen Mädchens am Nebentisch erregte meine Aufmerksamkeit.
»Du bist elf, Soph. Niemand würde dich alleine nach Hause gehen lassen, nachdem du in der Schule Ärger gehabt hast. Vor allem nicht, wenn dich dort niemand in Empfang nehmen kann.« Es folgte eine kurze Pause, dann ein Seufzen. »Weißt du, Soph, du kannst dich nicht weiter so aufführen.«
Die Stimme kam mir irgendwie bekannt vor. Als ich einen kurzen Blick riskierte, stellte ich erstaunt fest, dass es Felix James war, der dem Mädchen wegen seines Verhaltens Vorwürfe machte.
Ausgerechnet Felix James.
Bei allem, was ich über ihn gehört hatte – was, wie ich zugeben musste, zu neunzig Prozent auf Gerüchten beruhte –, war das echt ein Witz. Er war der Letzte, der jemand anders wegen unangemessenen Verhaltens Vorwürfe machen sollte.
»Sorry, großer Bruder, aber du hast es gerade nötig, mich runterzumachen.«
Es gelang mir nur mit Mühe, ein Prusten zu unterdrücken, als die Kleine meine Gedanken genauso rotzig aussprach, wie ich es auch getan hätte.
»Was?« Felix lachte ungläubig auf.
»Du hast mich schon verstanden. Meinst du, nur weil ich noch ein Kind bin, kriege ich nichts von deinen ganzen Freundinnen mit? Oder von all den Abenden, an denen Noah dich abholen muss, weil du nicht mehr fahren kannst?« Das Mädchen – Soph – saugte durch den Strohhalm lautstark an ihrem leeren Getränk, was ihr genervte Blicke der anderen Gäste einbrachte. »Ich bin elf, nicht blöd. Und außerdem haben wir in der Schule schon über Alkohol und andere Drogen gesprochen.«
Diesmal entschlüpfte mir ungewollt ein Kichern, aber die beiden waren so mit ihrer Auseinandersetzung beschäftigt, dass sie es nicht bemerkten. Es war vielleicht falsch, andere zu belauschen, aber wir waren hier schließlich in South Carolina. Man hätte es an den Schulen glatt als eigene Sportart einführen können, aber dann wäre es nahezu unmöglich gewesen, ins Auswahlteam zu kommen, weil es dafür viel zu viele Anwärter gab.
»Okay, na gut. Ich bin auch nicht perfekt, aber du kannst nicht einfach jemanden schlagen, Soph. Jetzt hör mir doch erst mal zu«, fuhr er hastig fort, als sie den Mund öffnete, um etwas zu erwidern. »Niemand versteht dich besser als ich.«
Die beiden starrten sich ein paar Sekunden lang schweigend an. Um nicht beim Lauschen ertappt zu werden, tat ich so, als würde ich etwas auf meinem Handy lesen. Aus dem Augenwinkel beobachte ich sie jedoch weiterhin, fasziniert von ihrem Schlagabtausch.
Nach einer gefühlten Ewigkeit unterbrach das Mädchen den Blickkontakt und stand auf. »Ich muss mal aufs Klo.«
Felix sagte nichts darauf. Aber nachdem sie sich genervt in Richtung Toilette verzogen hatte, sank er mit einem tiefen Seufzer auf seinem Sitz zusammen. Seine Hände waren so groß, dass er mit einer von ihnen problemlos den Kaffeebecher umfassen konnte, in den er gerade so konzentriert starrte, als würde er dort alle Antworten in Bezug auf den Umgang mit elfjährigen Mädchen finden.
Was ich ernsthaft bezweifelte. Meine eigene Mutter hatte zu diesem Zweck Schnaps bevorzugt, aber auch die »normalen« Mütter meiner Freundinnen schienen ihre Töchter nicht besser zu verstehen, egal wie viel Kaffee sie tranken.
Und sie tranken eine Menge.
Wieder entschlüpfte mir ein Kichern. Er sah so fertig aus, und die ganze Situation war so untypisch für das, was ich von ihm gehört hatte, dass ich es einfach nicht unterdrücken konnte.
Felix’ Kopf ruckte hoch. Als sich unsere Blicke trafen, konnte ich nicht mehr so tun, als hätte ich über irgendetwas auf meinem Handy gelacht. Meine Wangen liefen knallrot an, und nicht zum ersten Mal in meinem Leben verfluchte ich meine helle Haut und meine Sommersprossen.
»Was ist so komisch?«
Bei seinem angriffslustigen Ton verflüchtigte sich meine Verlegenheit darüber, dass ich die beiden belauscht hatte, schneller als Benzin in der Sommerhitze. Seit Grammy mich so plötzlich verlassen hatte, steckte ich voller Wut, von der ich nicht wusste, wie ich sie loswerden sollte; wenn er Streit suchte, hatte er sich also definitiv die Falsche ausgesucht.
Ich zuckte mit den Schultern. »Ausgerechnet du machst jemand anderem Vorwürfe wegen seines Verhaltens? Das ist echt … lustig.«
»Kenne ich dich?«
»Das bezweifle ich.« An der Golden Isles Academy war ich zwar nicht gerade unsichtbar, aber Leute wie Felix James und seine Clique hatten von meinem Einstieg zu Beginn des Schuljahrs nicht die geringste Notiz genommen.
»Dann tu nicht so, als würdest du mich kennen«, blaffte er mich an und drehte sich demonstrativ in die andere Richtung.
»Okay«, sagte ich leise und meinte es auch so.
Vielleicht war es wirklich nicht fair, ihn aufgrund von Gerüchten zu verurteilen – auch wenn ich die Geschichten über ihn von praktisch jedem gehört hatte, Grammy eingeschlossen.
Mich steckten die Leute aufgrund meiner Mutter und meiner Vergangenheit auch in eine bestimmte Schublade. Jedenfalls hatten das viele getan. Und taten es immer noch. Das war auch nicht wirklich fair, aber ich hatte gar nicht erst versucht, mich dagegen zu wehren.
In Felix’ Stimme lag ein Unterton, den ich instinktiv erkannte. Er klang nicht wütend oder abwehrend, sondern eher so, als würde er sich mühsam zusammenreißen, obwohl er am liebsten alles hingeschmissen hätte.
Ich schüttelte den Gedanken ab und schaute auf mein Handy, um zu sehen, wie spät es war. Genug Zeit, um wegen meiner Bewerbungen im Supermarkt und beim Mexikaner vorbeizuschauen, bevor ich mich um die Internetübertragung des Basketballspiels kümmern musste.
Nachdem ich meine Sachen zusammengesammelt und das Geschirr zurückgebracht hatte, blieb ich neben Felix’ Tisch stehen, obwohl mein Bauchgefühl mir deutlich signalisierte, ihn lieber in Ruhe zu lassen.
»Ähm, deine Schwester ist jetzt schon ziemlich lange auf dem Klo.« Ich biss mir auf die Unterlippe, als sein Kopf hochruckte und er mich wieder kampflustig ansah, aber ich ließ mich nicht einschüchtern.
»Du hast recht, …« Die Pause sollte wohl für meinen Namen stehen.
Ich hasste es, dass er ihn nicht kannte, aber noch mehr hasste ich mich selbst dafür, dass ich erwartet hatte, er würde ihn kennen. »May.«
»May.« Wieder stieß er einen tiefen Seufzer aus. »Könntest du mal nach ihr sehen?«
»Ich?«
Seine vollen Lippen verzogen sich zu einem Lächeln. Auch wenn es nicht mir persönlich galt, und auch wenn es kein bisschen sexy war, setzte mein Herz einen Schlag aus. Er legte es in diesem Moment nicht darauf an, aber dieses Lächeln, die dichten kastanienbraunen Haare, sein ausgeprägtes Kinn, auf dem sich der Hauch eines Bartschattens abzeichnete, und dieser durchdringende Blick aus seinen seltsamen bernsteinfarbenen Augen … Eine plötzliche Wärme breitete sich in meiner Brust aus und schoss von dort bis in meine Zehenspitzen.
Und in diesem Moment hatte ich keinen Zweifel mehr daran, dass alles, was ich über ihn gehört hatte, der Wahrheit entsprach. O Mann, dieser Typ war echt nicht ohne.
»Du bist ein Mädchen …«
Ich zog überrascht eine Augenbraue hoch. »Ähm, schön, dass es dir aufgefallen ist.«
»Ich bin ein Junge.« Er hob die Hände. »Was dir nicht entgangen sein dürfte, da du offenbar ziemlich aufmerksam bist. Und da es sich bei meiner Schwester ebenfalls um ein weibliches Wesen handelt, ist es wahrscheinlich besser, wenn ich nicht einfach mal so ins Damenklo reinplatze.«
Zu meinem Erstaunen beschloss ich, ihm den Gefallen zu tun. Und das, obwohl ich bis eben weder mit ihm noch mit seiner Schwester ein Wort gewechselt hatte. Davon abgesehen hatte ich auch keinerlei Erfahrung darin, mich mit Mädchen in ihrem Alter zu unterhalten.
Als ich kurz darauf die Toilette betrat, war Sophie schon halb aus dem Fenster gekrabbelt. Ich unterdrückte ein Seufzen. Es gab wohl keine bessere Gelegenheit, es zu lernen.
»Äh … brauchst du Hilfe?«
Es gab nur dieses eine Fenster. Es war gar nicht mal so klein, öffnete sich aber schräg nach außen, sodass das Mädchen sich auf dem Bauch hindurchschieben musste, um hinauszukommen. Da sie klein und zierlich war, würde sie es wahrscheinlich sogar schaffen, aber es würde nicht einfach werden.
Ein paar rote Streifen auf ihrem Bauch waren der Beweis dafür und zeigten auch deutlich, dass sie nicht aufgeben würde.
Niemand wusste besser als ich, dass man für seine Freiheit meist kämpfen musste.
»Hau ab«, kam ihre gedämpfte Antwort.
»Also, das hier geht mich ja eigentlich nichts an …«
»Stimmt. Und jetzt zisch ab.«
»Aber dein Bruder hat mich gebeten, nach dir zu sehen. Das heißt, dass er sich wenigstens ein bisschen Sorgen um dich macht. Falls dich das überhaupt interessiert.«
Sie beantwortete meine unausgesprochene Frage, indem sie sich ein Stückchen weiter durchs Fenster wand. Jetzt musste sie nur noch ihre Hüften freibekommen, und dann wäre sie draußen.
Etwas an ihrer Entschlossenheit, dem unangenehmen Gespräch mit ihrem Bruder zu entkommen, und ihrem Bedürfnis frei zu sein, auch wenn sie wusste, dass es nur für eine begrenzte Zeit war, weckte mein Mitgefühl, das ich nach Grammys Tod tief in mir verschlossen hatte.
»Sophie …« Ich benutzte die einzige Waffe, die ich hatte – ihren Namen.
»Dem ist doch bloß wichtig, was andere über ihn denken.« Sie machte eine kurze Pause. »Was kümmert’s dich?«
»Ich kenne mich ein bisschen mit beschissenen Familien aus«, vertraute ich ihr an.
»Wetten nicht?«
»Was hältst du davon, wenn du wieder reinkommst, und ich erzähle dir davon? Wenn du danach immer noch abhauen willst, schiebe ich dich raus. Abgemacht?«
Sie antwortete nicht, aber nach einer Weile schlängelte sie sich zurück in die Toilette. Da konnte ich sie zum ersten Mal richtig sehen. Ihre Haare waren blond, heller als die kastanienbraunen Locken von Felix und seinem Zwillingsbruder Noah, aber alle drei hatten diese faszinierenden bernsteinfarbenen Augen.
»Ich bin May Russell«, sagte ich und hielt ihr die Hand hin.
Das Mädchen strich sich den dichten Pony aus den Augen und musterte mich dann ein paar Sekunden lang eingehend. Ich nutzte die Gelegenheit und erfasste im Gegenzug ihre schmale Gestalt, die teure Jeans und den stylishen Pullover.
Sie war elf, und ihre Klamotten hatten wahrscheinlich mehr gekostet als alles, was ich jemals besessen hatte. Zum Glück war sie noch ein Kind, sonst hätte ich mich womöglich dazu hinreißen lassen, sie zu hassen.
»Sophie James«, sagte sie schließlich und schüttelte mir die Hand. »Also, was ist so beschissen an deiner Familie?«
Sie sagte beschissen mit einem herausfordernden Glitzern in den Augen, als wäre es eine Art Test. Ich tadelte sie nicht dafür. Schließlich war sie nicht meine kleine Schwester, und selbst wenn – so ein harmloses Schimpfwort wäre unser kleinstes Problem gewesen.
»Mein Vater ist abgehauen, als ich noch ein Baby war. Meine Mutter hat sich ständig zugedröhnt. Wir haben in einem Wohnwagen gelebt und hatten manchmal nicht genug zu essen, aber dafür gab es immer mehr als genug Ungeziefer.« Manchmal auch größere, männliche Exemplare. »Die meiste Zeit hatten wir weder Heizung noch fließendes Wasser, sodass es für mich schwierig war, mit sauberen Klamotten zur Schule zu gehen. Meine Mutter hat sich um diese Dinge nie besonders gekümmert.«
Bei dem Wort »zugedröhnt« schossen Sophies Augenbrauen in die Höhe, und bei jedem Geständnis wurden ihre Augen größer. Garantiert kannte sie niemanden mit solch einem Leben, und dabei hatte ich die endlose Reihe an Typen noch gar nicht erwähnt, die im Laufe der Jahre das Bett meiner Mutter gewärmt hatten. Leute wie meine Mutter wurden in einer Gemeinschaft wie Golden Isles nicht toleriert.
»Meine Eltern sind tot«, entgegnete sie nach ein paar Sekunden des Schweigens. Ihre Worte waren leise und schlicht, doch sie füllten den kleinen Waschraum aus und pressten sämtliche Luft in die Ecken, bis man kaum noch atmen konnte.
Ich hatte gehört, dass ihre Eltern letzten Sommer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen waren. Es war passiert, bevor ich hierhergezogen war, aber es war kein Geheimnis – eigentlich eher das Gegenteil. Doch es zu wissen und es von einem elfjährigen Mädchen zu hören, das offensichtlich todunglücklich war und verzweifelt versuchte, sich zusammenzureißen, waren zwei verschiedene Dinge.
»Ich weiß«, sagte ich zu ihr. »Und das ist doppelt beschissen.«
Ein schwaches Lächeln huschte über ihr Gesicht.
»Aber du und dein Bruder … ihr habt einander. Ich wünschte, ich hätte Geschwister.«
Sophie schnaubte. »Wenn du meinen Bruder hättest, würdest du das nicht sagen.
»Vielleicht. Aber Felix kam mir da draußen eben ein bisschen überfordert vor. Warum gibst du ihm nicht noch eine Chance? Nur dieses eine Mal.« Ich zog eine Braue hoch. »Vielleicht bist du ja irgendwann mal darauf angewiesen, dass er sich revanchiert.«
Sie sah mich abwägend an. Überlegte.
Dann stieß sie einen Seufzer aus, ebenso tief – wenn nicht tiefer – wie die von Felix im Café. »Okay. Aber nicht, weil mir danach ist, nett zu sein, sondern weil mich innerhalb der nächsten Stunde sowieso jemand nach Hause schleifen würde.«
»Ein ausgezeichnetes Argument.«
»Sag ihm, ich warte am Auto.« Damit stolzierte sie hinaus, während ich zurückblieb und mich verwundert fragte, wie es hatte passieren können, dass ich im Laufe weniger Minuten zur Vermittlerin in ihren Familienangelegenheiten geworden war.
Kopfschüttelnd drehte ich mich zum Waschbecken um und wusch mir die Hände. Nachdenklich starrte ich in den Spiegel. Die Frage beschäftigte mich noch einen kurzen Augenblick, doch dann ermahnte ich mich im Stillen, mich aus dem Drama der Familie James herauszuhalten.
Als ich ins Café zurückkam, saß Felix immer noch dort, wo ich ihn zurückgelassen hatte, nur, dass er jetzt auf sein Handy und nicht mehr in seinen Kaffee starrte.
»Sie wartet am Auto«, informierte ich ihn.
Seufzend stand er auf und reckte sich. Ich versuchte, nicht darauf zu achten, wie sein ausgeblichenes T-Shirt hochrutschte und dabei die glatte Haut seines Bauchs enthüllte. Doch noch während ich mir das vornahm, wanderte mein Blick automatisch über seine muskelbepackte Brust zu seinen kräftigen Armen.
Puh, Twyla heizte in ihrem Laden aber ganz schön ein.
»Sie war schon halb aus dem Fenster«, fügte ich hinzu und fragte mich gleichzeitig, warum ich ihm das überhaupt erzählte.
»Und wie hast du ihr das ausgeredet?«
»Ich fürchte, das ist Frauensache.«
»Ah. Sehr klug von dir.« Er stockte und musterte mich nachdenklich. Dabei sah er seiner Schwester so ähnlich, dass es meinem Herzen einen kleinen Stich versetzte.
In diesem Moment wurde mir wieder einmal schmerzhaft bewusst, dass ich tatsächlich gerne eine Schwester oder einen Bruder gehabt hätte, auch wenn ich meistens froh gewesen war, dass ich als Einzige gequält wurde.
»Was hältst du davon, Sophies Nanny zu werden?«
Ich brauchte einen Moment, um seinem Gedankensprung zu folgen, war mir aber trotzdem nicht sicher, ob ich ihn richtig verstanden hatte. »Was?«
»Ihre Nanny. Mein Bruder und ich sind mit Sophie inzwischen echt überfordert, und du scheinst gut mit ihr klarzukommen.«
»Du weißt doch nicht mal, was ich zu ihr gesagt habe. Vielleicht habe ich sie ja bedroht oder so.« Ich brach ab und versuchte zu verstehen, was hier abging. »Du kennst mich doch gar nicht.«
Schmunzelnd schüttelte er den Kopf. »Nie im Leben. Wenn Drohungen bei Sophie irgendetwas bringen würden, wäre alles einfacher, aber das funktioniert nicht. Hat es noch nie.«
Dass er vor zehn Minuten noch nicht mal gewusst hatte, wie ich hieß, überging er komplett. Aber das war sein Problem, und während ich fieberhaft überlegte, was ich ihm antworten sollte, fiel mir wieder ein, warum ich überhaupt in das Café gekommen war – ich brauchte einen Job.
Und vielleicht war mir gerade einer in den Schoß gefallen.
Eigentlich glaubte ich nicht an so was wie Schicksal, aber das war doch ein ziemlicher Zufall.
Ich kaute nachdenklich auf meiner Unterlippe herum. »Und was genau würde das beinhalten? Als Nanny zu arbeiten, meine ich.«
»Du holst Sophie von der Schule ab, bleibst bis zum Abendessen, oder wenn wir weg sind, auch länger. Und natürlich die Wochenenden. Ausflüge wären super.«
»Ausflüge.«
»Du weißt schon. Wie Mary Poppins.«
Ich riss die Augen so weit auf, dass ich fürchtete, sie würden mir aus dem Kopf fallen. »Findest du etwa, ich sehe wie Mary Poppins aus?«
»Kein bisschen, aber du hast eben bewiesen, dass du ein paar Tricks im Ärmel hast. Es ist vielleicht keine Zaubertasche ohne Boden, aber immerhin schon mal ein Anfang. Wir bezahlen dich selbstverständlich auch.« Seine amüsierte Miene verschwand, und er runzelte konzentriert die Stirn. »Vielleicht vierhundert pro Woche? Was meinst du?«
Fast hätte ich mich vor Schreck verschluckt. Das würde für meinen Lebensunterhalt reichen, und ich könnte sogar noch etwas Geld fürs College beiseitelegen.
Bleib cool, May. Das sind wahrscheinlich nur Peanuts für ihn.
»Weiß nicht«, sagte ich betont ruhig. »Bis jetzt hat mir noch nie jemand Geld dafür angeboten, dass ich mit einem Teenie abhänge.«
»Dann mach dich schlau und denk drüber nach. Es könnte ’ne gute Sache sein.« Er schaute auf sein Handy, runzelte die Stirn und schob es dann in die hintere Hosentasche. »Sag mir Bescheid. Ich geh jetzt besser mal, ehe Sophie keinen Bock mehr hat zu warten und selbst nach Hause fährt.«
Und ohne ein weiteres Wort ging er an mir vorbei zur Tür.
Mir schwirrte der Kopf von all den Möglichkeiten, die das Geld mir bieten würde, und der Tatsache, dass Sophie einen ziemlich coolen Eindruck machte – und offenbar eine Freundin gut brauchen konnte. Abgesehen davon machte ich mir aber auch Sorgen. Zum einen wegen Felix’ Ruf, immer zu bekommen, was er wollte, egal, um welchen Preis, und wegen der Art, wie er Menschen – insbesondere Frauen – behandelte; zum anderen wegen Sophie. Ihre Probleme sprengten definitiv den Rahmen des üblichen Mädchenkrams. Sie könnte – und würde – vielleicht mehr Hilfe brauchen, als ich ihr bieten konnte.
Mehr Hilfe, als ich irgendjemandem geben konnte.
Nicht mal mir selbst.
FELIX
»Ich bin kein Baby mehr! Ich brauche keinen Babysitter!«
Meine kleine Schwester war schon lange nicht mehr so außer sich gewesen. Dabei hatten die Therapiestunden in Bezug auf ihre Wutanfälle wahre Wunder vollbracht, das musste man diesem Trottel lassen.
Ich ignorierte ihren Ausbruch; sie war immerhin erst elf. Sie wusste noch nicht, was sie brauchte, und mein Bruder war wie immer zu sehr damit beschäftigt, den Golden Boy der Golden Isles zu spielen, um zu Hause seiner Rolle als großer Bruder gerecht zu werden.
Mit ruhiger Stimme redete ich auf Sophie ein: »Sie ist kein Babysitter, Soph. Sie ist eine Nanny. Wie Mary Poppins.«
»Mary Poppins ist was für Babys«, widersprach Sophie.
Ich warf Noah einen Hilfe suchenden Blick zu. Doch der starrte mich nur mit verschränkten Armen finster an und signalisierte damit, dass er mich nicht unterstützen würde, egal, was er von meinem Vorschlag hielt.
Ich stand also alleine da. Wieder mal. Aber nach den vergangenen Monaten war ich das ja schon gewöhnt.
»Noch hat sie nicht Ja gesagt, aber wenn sie es tut, warum gibst du ihr nicht einfach eine Woche? Nur zur Probe. Und dann reden wir noch mal drüber.« Ich versuchte, den flehenden Unterton aus meiner Stimme herauszuhalten, denn meine Schwester spürte Schwäche ebenso instinktiv wie meine Mutter und stürzte sich darauf wie eine Löwin auf eine geschwächte Antilope. Gleichzeitig musste ich mich aber auch mächtig anstrengen, um nicht einfach meine Autorität raushängen zu lassen und ihr zu sagen, sie solle die Klappe halten und auf ihr Zimmer gehen.
Mit hochrotem Gesicht verschränkte Sophie die Arme vor der Brust und wirkte dabei genauso abwehrend wie mein Zwillingsbruder. Nur in klein. »Habe ich denn eine Wahl?«
Ich überlegte einen Moment. »Ja. Nicht, was die Probezeit angeht, aber ich verspreche dir, dass wir uns danach zusammensetzen und darüber sprechen, ob, äh …«
»May«, fauchte meine Schwester, nachdem sie mich zehn Sekunden hatte zappeln lassen. »Mann, du hast sie als meine Nanny eingestellt und weißt nicht mal, wie sie heißt?«
»Ich weiß, wie sie heißt«, log ich. Wen interessierte das schon? »Also, wir werden dann darüber sprechen, wie es dir gefällt, dass May hier ist, und ob du möchtest, dass sie bleibt. Aber Soph … du musst aufhören in der Schule so einen Stress zu machen. Noah und ich können dich da nicht ständig raushauen. Wenn du mit deinen Freunden und uns hier in Golden Isles bleiben willst, musst du dich verdammt noch mal zusammenreißen.«
Sophie wurde bei diesen Worten ganz blass und sah mich so geschockt an, als hätte ich sie geschlagen. Dabei war uns allen klar, dass die Entscheidung des Richters, Noah und mir mit siebzehn das Sorgerecht für Sophie zu übertragen, darauf beruhte, dass bei uns alles glattlief – und das auch weiterhin so blieb. Und wir wussten auch, dass unsere Großtante Colleen nur darauf lauerte, uns unsere Schwester wegzunehmen und mit ihr in Kalifornien zu leben.
Normalerweise redeten Noah und ich nicht darüber, weil wir fanden, dass Sophie nicht noch mehr Druck gebrauchen konnte … aber vielleicht war ein bisschen Druck gar nicht so schlecht, da ihre Zukunft von unser aller Verhalten abhing.
»Okay«, sagte sie mit piepsiger Stimme, und meine sonst so starke kleine Schwester schien vor meinen Augen zu schrumpfen.
Eigentlich hätte ich mich dafür hassen müssen, aber ich verspürte vor allem Erleichterung – weil sie zugestimmt hatte und weil ich damit die Verantwortung fürs Erste los war.
Nachdem Sophie in ihr Zimmer verschwunden war und versprochen hatte, mit den Hausaufgaben anzufangen, drehte ich mich um, um meine schlechte Laune an meinem Bruder auszulassen. »Danke für die Unterstützung, Noah.«
Noah ließ sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen. »Ich gebe dir ja recht, dass Sophie endlich mal kapieren muss, dass ihr Verhalten Konsequenzen für ihre Zukunft hier bei uns haben könnte, aber ich finde, wir brauchen echt kein Kindermädchen. Mom und Dad haben sich nie Unterstützung geholt. Sie hätten nicht gewollt, dass eine Fremde unter unserem Dach wohnt.«
»Erstens habe ich sie nicht gebeten, bei uns zu wohnen. Ich hatte eher an eine Betreuung nach der Schule und an den Wochenenden gedacht.« Die Kopfschmerzen, die hinter meinen Schläfen pochten, verstärkten sich. »Und zweitens sind wir nicht Mom und Dad. Ich dachte, das wäre langsam mal bei dir angekommen.«
»Das weiß ich. Wir sind zwar fast achtzehn, aber wir sind keine Erwachsenen. Das Gericht erwartet trotzdem von uns, dass wir so tun als ob und dass wir es mit unserer Schwester nicht verbocken. Wenn wir jemanden für Sophie einstellen, könnte es so aussehen, als wären wir mit ihr überfordert.«
Ich kniff mir in den Nasenrücken und atmete tief durch. Vermutlich waren wir auch überfordert. Und wahrscheinlich hatten mein Bruder und ich es sogar nötiger, beaufsichtigt zu werden, als Sophie. Aber ihr zuliebe mussten wir uns jetzt zusammenreißen. Immerhin hatten wir all unsere Beziehungen spielen lassen müssen, um das Sorgerecht für Sophie zu bekommen, obwohl wir zu dem Zeitpunkt noch nicht volljährig waren.
»Du bist ständig unterwegs, Noah«, stieß ich schließlich resigniert hervor. »Basketball, Theater-AG, Schülervertretung, Krankenhausvorstand und wer weiß, was noch alles. Ich komm da nicht mehr hinterher. Vielleicht würde ein Richter es sogar anerkennen, dass wir alles tun, damit unsere Schwester gut betreut wird, während wir beschäftigt sind.«
»Wobei du vor allem damit beschäftigt bist, Mädchen rein- und rauszuschmuggeln und mich anzurufen, damit ich dich mitten in der Nacht von einer Party abhole«, konterte Noah genervt. »Tu bloß nicht so, als wärst du der perfekte Bruder und ich der letzte Scheißkerl.«
Bevor unsere Eltern gestorben waren, hatten Noah und ich uns nie gestritten. Obwohl sogar unsere Freunde uns kaum auseinanderhalten konnten, waren wir immer so verschieden gewesen wie Tag und Nacht und hatten, wenn man unserer Mutter glauben durfte, trotzdem seit unserem ersten Atemzug zusammengehalten wie Pech und Schwefel.
Aber das war jetzt vorbei.
Noch etwas, das nie wieder so sein würde wie vorher. Ich wusste einfach nicht mehr, was bei Noah lief.
Ich unterdrückte ein Seufzen. »Das hier ist kein Konkurrenzkampf, Noah. Sophie braucht jemanden, der sich nach der Schule um sie kümmert, wenn wir nicht da sind, und ich finde, es spricht absolut nichts dagegen, dass sie dann jemanden hat, mit dem sie reden kann. Jemand anderen als uns. So eine Art große Schwester. Meinst du nicht?«
Wobei ich bei May nicht automatisch an eine große Schwester dachte. Dafür wanderten meine Gedanken zu sehr in eine andere Richtung, zu ihren sanften Kurven und dem dicken honigfarbenen Haar, das sich geradezu anbot, es um meine Finger zu wickeln und daran zu ziehen …
Abrupt würgte ich meine Gedanken ab.
Eine Fremde zu bitten, Sophies Nanny zu werden, war ein spontaner Entschluss gewesen, doch je länger ich darüber nachdachte, desto besser fand ich die Idee. May hatte die Situation mit meiner Schwester im Café super geregelt.
Aber wenn May sich bereit erklärte, uns mit Sophie zu helfen, war sie für mich tabu; unergründliche braune Augen hin oder her. Es gab schließlich haufenweise Mädchen, mit denen ich mich von meinem Leben ablenken konnte.
Noah atmete resigniert aus. »Okay, sprechen wir nach ihrer Probewoche noch mal darüber. Ich muss jetzt zu meinem Spiel.«
»Klar, du willst ja nicht zu spät zu den Aufwärmübungen kommen. Dann könnte ja keiner mehr seine Uhr nach Noah-Zeit stellen, und alle wären aufgeschmissen.«
Er ignorierte meine nicht besonders originelle Stichelei und ließ mich einfach stehen. Kurz darauf setzte er mit seinem Jaguar rückwärts aus der Auffahrt und rauschte davon.
Eine Weile stand ich noch unschlüssig herum, dann stieg ich nachdenklich die geschwungene Treppe zu meinem Zimmer im ersten Stock hinauf. Das Geräusch meiner Turnschuhe hallte von den Marmorfliesen wider und wurde von den hohen Wänden zurückgeworfen. Wir hätten umziehen sollen. Dieses Haus war wie ein Grab – ein riesiges überladenes Grab, das mich nicht nur daran erinnerte, was meine Mutter für einen guten Geschmack gehabt hatte und wie der Pfeifentabak meines Vaters roch, sondern mir auch ständig vor Augen führte, was ich am liebsten verdrängt hätte: dass sie niemals wiederkommen würden.
Um die plötzlich aufsteigende Trauer zu vertreiben, holte ich mein Handy aus der Tasche und scrollte durch meine Nachrichten. Das Gute daran, mein Gesicht, meinen Ruf und mein Vermögen zu besitzen, war die Tatsache, dass an unserer Schule kein Mangel an Mädchen herrschte, die bereitwillig mitspielten, wenn ich mir mal wieder vormachte, das große, dunkle Loch in meinem Inneren irgendwie füllen zu können. Klar wurde von mir erwartet, mich bei Noahs Spiel blicken zu lassen, aber meinen Nachrichten zufolge gab es mehr als ein Mädchen, das diesen Besuch für mich lohnender gestalten wollte.
Eine Dusche, ein voller Flachmann und ein Mädchen, das gut genug roch, um meine höheren Gehirnfunktionen für ein paar Stunden in die Wüste zu schicken – das war genau das, was ich brauchte.
Und bis jetzt hatte das wunderbar funktioniert. Es gab also keinen Grund, etwas daran zu ändern.
Als der Halbzeitbuzzer ertönte, hatte der erstklassige Bourbon meines Vaters bereits all die Gefühle betäubt, die aus ihrem sorgfältig verschlossenen Gefängnis auszubrechen drohten. Sophie war zum Abendessen bei einer Freundin und würde dort auch übernachten, was hieß, dass ich zum Glück bis morgen Mittag jegliche Verantwortung los war. Es sprach also nichts dagegen, diesen Zustand bis zum Morgengrauen aufrechtzuerhalten.
Die Golden Gophers lagen vorn. Wie sollte es auch anders sein? Mein Bruder führte schließlich den Angriff – und Noah James verlor nie. Das war unmöglich.
Jedenfalls kam es allen anderen so vor.
Die Menge in der Sporthalle war laut und jubelte in einem fort, was meine Laune etwas dämpfte und die Kopfschmerzen wieder aufflammen ließ. Ich nahm noch einen Schluck.
»Gibst du von deinem Flachmann auch was ab, oder hast du vor, dich heute Abend noch mehr als sonst zuzudröhnen?«
Ich warf Ivy, meiner Freundin aus Kindertagen, einen genervten Blick zu.
Ihre himmelblauen Augen waren forschend auf mich gerichtet – sie sah vermutlich mehr, als mir lieb war –, während ihr eigenes Gesicht von ihrer glänzenden blonden Lockenmähne halb verdeckt wurde. Ivy entging nichts, sie machte keine Kompromisse und ließ anderen auch nichts durchgehen – gute Gründe, sie gleichzeitig zu lieben und zu hassen.
Sie trug ein selbstgemachtes Golden-Gophers-Shirt, das ihr über eine Schulter gerutscht war und einen spitzenbesetzten schwarzen BH-Träger enthüllte. Ivy könnte ein Vermögen machen, wenn sie die Klamotten, die sie designte, verkaufen würde, aber sie trug die Originale lieber selbst. Außerdem war sie nicht auf das Geld angewiesen.
Mit mehr Wiederstreben als nötig – oder gesund war –, reichte ich ihr den Bourbon.
Sie nahm den Flachmann entgegen, trank einen Schluck und dann noch einen, bevor sie Riley auch etwas anbot. Die rümpfte nur die Nase und schüttelte den Kopf. Neben den beiden saß der Rest unseres harten Kerns: Micah und Grant, die beide einen großen Schluck nahmen, bevor sie den Flachmann wieder zu mir zurückreichten. Wenigstens johlten und grölten meine Freunde nicht wie eine Horde Affen.
»Echt nett, dass du uns auch was abgegeben hast, Felix«, sagte Ivy in sarkastischem Ton und zwinkerte mir zu. »Großzügig wie immer.«
»Lass ihn in Ruhe«, murmelte Riley, den Blick auf ihr Handy gerichtet. Bei jeder anderen hätte ich vermutet, dass sie einem Typen schrieb, aber Riley? Wahrscheinlich lernte sie gerade Französisch oder ging noch mal ihre Notizen für den Physiktest am Montag durch, obwohl sie immer die beste Note in der Klasse hatte. »Bring dir nächstes Mal doch deinen eigenen Alk mit, du Schnorrerin.«
»Genau, ihr seid alle ein Haufen Schnorrer«, sagte ich ein bisschen zu laut und zeigte der Reihe nach auf meine Freunde. »Merkt euch das.«
»Alter, und das von dem Typen, der letztes Wochenende den wertvollen Bourbon meines Vaters gekillt hat«, beschwerte sich Grant, den Blick auf die Cheerleader gerichtet, die gerade den glänzenden Hallenboden für die Golden Dancers räumten. »Irgendwann, wenn er die Flasche zu einem besonderen Anlass köpfen will, wird er feststellen, dass nur gefärbtes Wasser drin ist.«
»Ich hab ihm eine neue bestellt. Sie müsste eigentlich diese Woche kommen.«
»Hoffen wir, dass sie rechtzeitig da ist. Sonst sehen wir uns erst nach der Abschlussprüfung wieder«, witzelte er.
Grant war mir nicht ernsthaft böse. Sein Dad würde stinksauer sein, wenn er herausfand, dass wir seinen teuren Whisky getrunken hatten, aber er würde sich wahrscheinlich nicht lange genug von seiner Arbeit losreißen, um ernsthafte Erziehungsmaßnahmen zu ergreifen.
»Wo feiern wir eigentlich dieses Wochenende?«, fragte Ivy, die unser Gespräch über Whisky sichtlich anödete. »Bei euch können wir es vergessen, Felix. Dein Bruder wird von Tag zu Tag spießiger. Meine Eltern sind zu Hause, und Riley ist auf dem besten Weg zu einem Magengeschwür, weil sie sich wegen der Zulassungstests fürs College unnötig fertigmacht. Alsoooo?«
Ivy warf den Jungs einen auffordernden Blick zu, aber die ignorierten sie. In letzter Zeit landeten wir meistens bei Grant, weil Micahs Mom gerade eine Jesusphase durchmachte, die deutlich länger dauerte, als ihr bisheriges Engagement für verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen. Ihr neu entdeckter Glaube schränkte unsere Optionen fürs Wochenende ziemlich ein.
Die Wintermonate waren verdammt lang – die Touristen blieben weg, der Ozean war kalt und unsere Eltern verkrochen sich wie die Bären in ihrer Höhle.
Ihre Eltern, flüsterte eine Stimme in meinem Kopf.
Ich nahm noch einen großen Schluck von dem Bourbon. Er brannte zwar den ganzen Weg die Kehle hinunter, brachte dafür aber die Stimme zum Schweigen.
»Justin Watts hat irgendwas gesagt, dass sich morgen Abend ein paar Leute bei ihm treffen«, warf Riley ein und legte zum ersten Mal ihr Handy weg. »Soll eigentlich nur eine kleine Sache werden, aber ihr wisst ja, wie das läuft. Da treffen sich dann doch wieder alle.«
Unsere Schule war relativ klein. Es gab Cliquen und es gab eine Hierarchie, aber sobald sich irgendwo eine Möglichkeit bot, ohne lästige Erwachsene zu feiern, tauchten alle auf.
Wir sechs waren immer eingeladen, auch wenn wir eigentlich nicht erwünscht waren. Aber niemand hätte es gewagt, uns das ins Gesicht zu sagen.
Justin Watts war ein blinder Junge, der immer die lustigen Rollen in den Schulaufführungen an Land zog. Im Gegensatz zu den meisten Leuten, die nur behaupteten, mit allen befreundet zu sein, traf es bei ihm größtenteils tatsächlich zu. Ich war manchmal ziemlich nah dran, ihn wegen seiner lockeren Art zu hassen, aber das hielt mich nicht davon ab, samstags bei ihm zu trinken und rumzumachen.
Nachdem das geregelt und die Halbzeit immer noch nicht zu Ende war, verzog sich Riley mit Micah im Schlepptau zum Getränkestand, um sich eine Flasche Wasser zu holen.
Kurz darauf stand auch Grant auf und reckte sich. »Ich geh mal pinkeln«, sagte er. »Braucht irgendjemand was?«
»Nee.« Ich hielt meinen Flachmann hoch und winkte damit.
Ivy schüttelte den Kopf und holte ihr Handy aus der Tasche. Ihre Finger flogen nur so über das Tastenfeld, und als ich mich rüberlehnte, um zu sehen, wem sie schrieb, drehte sie das Display weg. »Das geht dich nichts an, Felix.«
»Du weißt, dass mich das nur noch neugieriger macht.«
»Ich weiß. Was glaubst du, warum ich es gesagt habe?«
»Ist es ein Kerl? Ich dachte, du wärst so was von fertig mit jedem männlichen Wesen in Golden Isles, das auch nur ansatzweise infrage kommt.«
Sie ignorierte mich und tippte mit einem feinen Lächeln auf den Lippen weiter. Ich ließ das Thema fallen – sie würde sowieso nichts sagen – und nahm einen weiteren Schluck aus dem Flachmann, bevor ich den inoffiziellen »Familien«bereich der Tribüne nach meiner Schwester absuchte.
Wir hatten abgemacht, dass Sophie zusammen mit den Eltern ihrer Freundin Emily zu dem Spiel kommen und hinterher dort übernachten würde – nach dem heutigen Tag würde uns allen eine kleine Pause guttun.
Ich ließ gerade den Flachmann in meiner Tasche verschwinden, als ich ihre mürrische Miene zwischen all den lachenden Gesichtern um sie herum entdeckte. Sophie sah meiner Mutter unglaublich ähnlich. So sehr, dass sich der Anblick ihrer blonden Haare und haselnussbraunen Augen manchmal – jetzt zum Beispiel – wie ein Tritt in den Magen anfühlte.
Vielleicht würde es eines Tages anders sein. Vielleicht würde mir die Erinnerung daran, dass ein Teil meiner Mutter immer noch bei uns war, eines Tages ein Lächeln entlocken und mir ein wohlig-warmes Gefühl vermitteln – so wie früher, wenn sie sich nach einer Party in unser Zimmer schlich, um uns einen Gute-Nacht-Kuss zu geben.
Sie hatte sich dann immer zu mir auf die Bettkante gesetzt, und der Duft ihres Parfüms und von etwas Süßerem – Gin Tonic, wie ich herausfand, als ich älter wurde – stieg mir in die Nase und zu Kopf. Dann beugte sie sich zu mir herunter, strich mir das Haar aus der Stirn und drückte einen Kuss darauf, bevor sie das Ritual bei Noah wiederholte.
Ich fischte den Flachmann wieder heraus, behielt dabei aber Sophie im Blick, um sicherzugehen, dass sie nicht in meine Richtung schaute.
Nach ein paar Schlucken stellte sich das wohlig-warme Gefühl wieder ein. Es war zwar nicht das Gleiche wie die geborgenen Nächte meiner Kindheit, aber immer noch besser als die düstere Kälte, die unsere Eltern nach ihrem Tod hinterlassen hatten.
»Diese Cheerleaderin schmachtet dich seit dem Beginn der Halbzeitpause an«, sagte Ivy und holte mich dadurch wieder in die Gegenwart.
Gott sei Dank.
»Hmmm?«
Ivy schnappte sich meinen Flachmann und nahm einen kräftigen Schluck. »Die Rothaarige mit den vielen Locken.«
Ich sah auf das Spielfeld hinunter und quälte mir ein schiefes Lächeln ab, als sich mein Blick mit dem der Cheerleaderin kreuzte. »Oh. Marla. Ja.«
»Deine neueste Eroberung?«
Statt zu antworten, hielt ich Ivy mein Handy hin und zeigte ihr ein paar heiße Nachrichten, die mich eigentlich todsicher von all dem deprimierenden Scheiß in meinem Leben hätten ablenken müssen. Die Art von Nachrichten, bei denen ich immer wieder froh war, dass ich den Generalschlüssel nachgemacht hatte, den Grant unserem Hausmeister im ersten Jahr auf der Highschool geklaut hatte.
»So, so. Mal wieder eine Eroberung auf der Couch in der Journalistikabteilung? Ich finde es total eklig, dass tatsächlich Leute auf diesem Ding sitzen. Du solltest dich was schämen.«
»Ach, ja? Hoffentlich leuchten sie den Raum nie mit Schwarzlicht aus.«
»Du bist wirklich widerlich.«
Ich stieß sie mit meinem Knie an. »Ich weiß. Aber du liebst mich trotzdem.«
»So weit würde ich nicht gehen.« Nach einer kurzen Pause tippte sie wieder auf ihrem Handy herum. »O Mann, ich kann’s kaum noch erwarten, dass es endlich Sommer wird.«
»Und du dir wieder die sexy Touristen krallen kannst?«, sagte ich mit spöttischem Unterton.
»Ich glaube nicht, dass es schlecht ist, gegen Inzest zu sein.« Sie rümpfte die Nase. »Mir ist schon klar, dass nicht alle Leute in Golden Isles blutsverwandt sind. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich darauf stehe, Typen zu daten, mit denen ich seit dem Kindergarten befreundet bin oder für die ich früher den Babysitter gespielt habe. Kannst du das verstehen?«
»Nicht wirklich. Ich babysitte nicht so oft.«
Das brachte sie zum Lachen, doch als sie meinem Blick zum Tribünenbereich für die Familien der Spieler folgte, wurde sie schnell wieder ernst. »Wie geht’s Sophie? Hat sie immer noch ständig Ärger?«
»Sie tritt in meine Fußstapfen.«
Diesmal stieß Ivy mich an. »Du bist kein Unruhestifter, Felix. Du triffst ab und zu fragwürdige Entscheidungen, die dir wahrscheinlich irgendwann auf die Füße fallen werden, aber du machst anderen Leuten keinen Ärger. Den machst du nur dir selbst.«
Wieder summte ihr Handy – und wieder drehte sie das Display weg, sodass ich nicht sehen konnte, wer ihr schrieb. Ich ließ mir ihre Worte noch einmal durch den Kopf gehen und versuchte, etwas herauszufiltern, das so ermutigend klang, wie sie es sicher gemeint hatte.
Ich war vielleicht kein typischer Unruhestifter, aber ich wusste, dass ich Sophie kein gutes Beispiel war. Ein Teil von mir wehrte sich gegen die Vorstellung, ein leuchtendes Vorbild sein zu müssen, anstatt einfach mein Leben zu leben wie jeder andere Achtzehnjährige auch – ganz auf mich und mein eigenes Vergnügen konzentriert. Aber der andere Teil spürte bei solch egoistischen Gedanken den vorwurfsvollen Blick meiner Eltern sogar aus dem Grab heraus.
Sophie stand auf, sagte etwas zur Mutter ihrer Freundin und verließ die Sporthalle. Sie sah aufgewühlt aus. Ich dachte daran, ihr zu folgen, aber dann hätte sie den Alkohol in meinem Atem gerochen und mich zum Teufel geschickt.
Und das konnte ich ihr nicht mal übel nehmen.
Meine Schwester stürmte an dem Mädchen aus dem Café vorbei – May –, und eine Minute später steckte unsere potenzielle neue Nanny ihren Laptop in ihre Tasche und folgte Sophie aus der Halle.
Während der egoistische Felix James auf seinem Hintern hocken blieb und es einem Mädchen, dessen Namen er bis vor Kurzem nicht mal gewusst hatte, überließ, sich um den einzigen Menschen auf der Welt zu kümmern, der ihn wahrscheinlich wirklich brauchte.
Tja. Dann eben ein andermal.
MAY
Ich klickte auf ein paar Tasten, um den Code der Schulwebsite dem schnell wechselnden Punktestand beim Basketballspiel anzupassen. Das war eine neue Funktion, denn bevor ich zu Anfang des Schuljahres aufgetaucht war, hatte offenbar niemand großes Interess daran gehabt, die Website zu aktualisieren und umzugestalten. Aber als ich es im Unterricht vorgeschlagen hatte, war Mrs. Reynolds sofort darauf angesprungen.
Mir war es ehrlich gesagt völlig egal, ob die Leute zu Hause ein Basketballspiel der Gophers in Echtzeit verfolgen konnten. Die Website zu optimieren, meine schlummernden Fähigkeiten zu nutzen und an technischen Problemen herumzutüfteln, lenkte mich jedoch nicht nur von Grammys Tod ab, sondern auch von der Tatsache, dass ich mich dringend mit dem Jugendamt in Verbindung setzen musste, bevor mein Leben in sich zusammenkrachte.
Wieder mal.
Es war gerade Halbzeit, und die Golden Isles Gophers machten irgendein Team vom Festland fertig, das aus einer Stadt kam, von der ich noch nie gehört hatte – in South Carolina gab es kleine Orte wie Sand am Meer, allerdings waren Privatschulen dünner gesät und weiter von der Küste entfernt.
Nachdem die Website wieder ordentlich lief, fiel mir ein, dass ich eigentlich noch genug Kleingeld haben müsste, um mir eine Flasche Wasser aus dem Automaten zu holen.
Diesen Plan verwarf ich jedoch gleich wieder, als ich mit meinem zerknitterten Dollar in der Hand aufblickte und sah, wie Sophie James an mir vorbei und durch die Tür der Sporthalle stürmte.
Ihr Gesichtsausdruck, die herzzerreißende Miene eines Kindes, das um jeden Preis stark wirken wollte und gleichzeitig verzweifelt auf der Suche nach einem Ort war, wo es seinen Tränen ungestört freien Lauf lassen konnte, traf mich an einer Stelle in meinem Inneren, die ich gut abgeschottet geglaubt hatte. Dieses dringende Bedürfnis, nach außen hin so lange cool zu erscheinen, bis man sich irgendwo, wo einen niemand sehen würde, seinem Schmerz hingeben konnte, kannte ich nur zu gut.
Auf der Suche nach ihrem Bruder Felix ließ ich meinen Blick über die Menge schweifen. Noah war bestimmt noch mit dem Team im Umkleideraum, denn sein beeindruckendes Punkteergebnis, mit dem er an der Spitze der Mannschaft lag, hatte ganz oben auf der Website gestanden, als die Halbzeitstatistik über den Bildschirm zu scrollen begann.
Ich entdeckte Felix auf der Tribüne, wo er sich mit Ivy Summers unterhielt. Falls er gesehen hatte, wie seine Schwester nach draußen gestürmt war, hatte er anscheinend nicht vor, ihr zu folgen.
Eigentlich war es nicht meine Aufgabe, Sophie zu helfen – jedenfalls noch nicht. Aber ihre grimmige Entschlossenheit auf der Toilette des Burrow’s und jetzt ihr verzerrtes Gesicht, als sie an mir vorbeigestürmt war, ließen mich trotzdem in den Eingangsbereich der Sporthalle hetzen.
Sophie stand nicht in der Schlange von Eltern und Schülern, die darauf warteten, irgendetwas Unappetitliches wie einen Hotdog zu bestellen, und sie hatte sich auch keinem der vielen lockeren Grüppchen in ihrem Alter angeschlossen, die im Eingangsbereich herumalberten.
Die Toilette. Wenn es einen Ort gab, an dem sich Mädchen seit Menschengedenken versteckten, um ungestört weinen zu können, dann diesen.
Auch das wusste ich nur zu gut.
Alle Kabinen waren besetzt, die Türen geschlossen und verriegelt. Unter jeder waren Schuhe zu sehen, von denen nur ein Paar klein genug war, um einem elfjährigen Mädchen zu gehören.
Ich wollte schon klopfen, zögerte jedoch, als meine Fingerknöchel nur noch einen Zentimeter von der verschrammten und ramponierten Oberfläche der Tür entfernt waren. Hätte eine mehr oder weniger fremde Person, die es offenbar gut mit mir meinte, versucht, mich aus meiner Kabine zu locken, sodass alle mitbekommen würden, dass ich heule, hätte ich ihr gesagt, sie solle sich verpissen. Und ich wäre so lange in dieser Kabine geblieben, bis diese Person verschwunden war.
Es gab keine Möglichkeit herauszufinden, ob Sophie James genauso stur war wie ich, aber abgesehen davon hatte ich auch keine Zeit für einen solchen Machtkampf, selbst wenn ich mir sicher war, dass ich ihn gewinnen würde. Die Halbzeit näherte sich dem Ende, und ich musste bald zurück und die Website betreuen.
Geduldig wartete ich am Waschbecken und versuchte, möglichst unauffällig zu wirken, während der Waschraum sich leerte, füllte und wieder leerte. Mit jeder Minute, die verstrich, stieg meine Nervosität; die Halbzeit würde jeden Augenblick vorbei sein. Aber jetzt aufzugeben, lag mir nicht, die Website würde also warten müssen.
Es würde schon alles gut gehen. Seit meine Lehrerin uns in der fünften Klasse das Programmieren beigebracht hatte, war es für mich immer einfacher gewesen, mit Computern zu sprechen als mit Menschen.
Außerdem war ich mir sicher, dass höchstens drei Leute den Spielstand online checkten, sodass es außer mir kaum jemandem auffallen würde, wenn es nicht funktionierte. Nicht mal unserer Journalistiklehrerin, von der ich zusätzliche Punkte für die Betreuuung der Website bekam.
»Ich weiß, dass du da draußen auf mich wartetst«, drang eine leise, genervte Stimme aus Sophies Kabine.
Ich konnte mir das Lächeln nicht verkneifen. »Woher willst du wissen, dass ich mich nicht auch hier drinnen verstecke?«
»Weil du nicht wie jemand aussiehst, der sich auf einem stinkenden alten Klo versteckt.« Ihre Stimme war noch dünner geworden, und der Satz wurde von einem kleinen Schniefen unterbrochen.
Mein Herz zog sich zusammen, eine schmerzhafte und etwas überraschende Erinnerung daran, dass ich überhaupt noch eins besaß. »So gut kennen wir uns doch gar nicht, oder? Vielleicht liegst du ja falsch. Warum öffnest du nicht die Tür und findest es raus?«
Ich hielt die Luft an. Erst in diesem Moment wurde mir klar, wie sehr ich mir wünschte, sie würde mir vertrauen. Um herauszufinden warum, hätte ich einiges an Seelenerforschung betreiben müssen, aber dafür war jetzt keine Zeit, denn Sophie entriegelte die Tür und schlich langsam zum Waschbecken.
Besonders gut kannten wir uns tatsächlich nicht, genauer gesagt überhaupt nicht. Zumindest das stimmte. Aber wenn Sophie auch nur ein bisschen so war wie ich mit elf – denn das war das Einzige, woran ich mich orientieren konnte –, dann würde sie sich nur öffnen, wenn sie mir vertraute.
Was hieß, dass ich zuerst etwas von mir preisgeben musste.