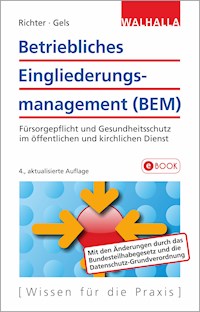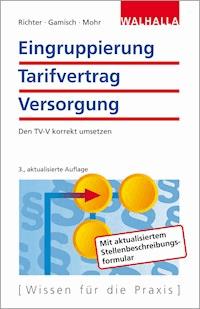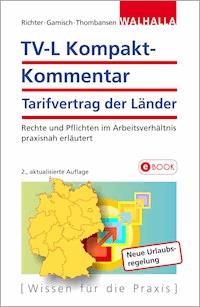
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Walhalla Digital
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das Tarifrecht der Länder verstehen
Den eigenständigen Tarifvertrag der Länder (TV-L) zeichnen viele wichtige Besonderheiten aus. Der Kompakt-Kommentar bietet einen systematischen Einstieg in die Rechte und Pflichten im Arbeitsverhältnis - von der Einstellung bis zur Kündigung:
- Personalauswahl und Vertragsgestaltung
- Grundfragen des Arbeitszeitrechts
- Urlaub und Arbeitsbefreiung
- Teilzeit und Befristung von Arbeitsverhältnissen
- Weisungsrechte und Fürsorgepflichten des Arbeitgebers
- Ermahnung und Abmahnung
- Umsetzung, Versetzung, Abordnung
- Kündigung und Auflösung von Arbeitsverhältnissen
- Arbeitszeugnis
- Neue Flexibilität im Personalmanagement
- Ausschlussfristen
Die ideale Arbeitshilfe für Personalverantwortliche und mit dem Arbeits- und Tarifrecht befassten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 513
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
2. Auflage
© WALHALLA Fachverlag, Regensburg
Dieses E-Book ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert, vervielfältigt oder verbreitet werden. Eine entgeltliche oder unentgeltliche Weitergabe oder Leihe an Dritte ist nicht erlaubt. Auch das Einspeisen des E-Books in ein Netzwerk (z. B. Behörden-, Bibliotheksserver, Unternehmens-Intranet) ist nicht erlaubt. Sollten Sie an einer Serverlösung interessiert sein, wenden Sie sich bitte an den WALHALLA-Kundenservice; wir bieten hierfür attraktive Lösungen an (Tel. 0941/5684-210).
Hinweis: Unsere Werke sind stets bemüht, Sie nach bestem Wissen zu informieren. Eine Haftung für technische oder inhaltliche Richtigkeit wird vom Verlag aber nicht übernommen. Verbindliche Auskünfte holen Sie gegebenenfalls bei Ihrem Rechtsanwalt ein.
Kontakt: Walhalla Fachverlag Haus an der Eisernen Brücke 93042 Regensburg Tel. (09 41) 56 84-0 Fax. (09 41) 56 84-111 E-Mail [email protected] Web
Kurzbeschreibung
Das Tarifrecht der Länder verstehen
Den eigenständigen Tarifvertrag der Länder (TV-L) zeichnen viele wichtige Besonderheiten aus. Der Kompakt-Kommentar bietet einen systematischen Einstieg in die Rechte und Pflichten im Arbeitsverhältnis - von der Einstellung bis zur Kündigung:
Personalauswahl und VertragsgestaltungGrundfragen des ArbeitszeitrechtsUrlaub und ArbeitsbefreiungTeilzeit und Befristung von ArbeitsverhältnissenWeisungsrechte und Fürsorgepflichten des ArbeitgebersErmahnung und AbmahnungUmsetzung, Versetzung, AbordnungKündigung und Auflösung von ArbeitsverhältnissenArbeitszeugnisNeue Flexibilität im PersonalmanagementAusschlussfristenDie ideale Arbeitshilfe für Personalverantwortliche und mit dem Arbeits- und Tarifrecht befassten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Autor
Achim Richter M.A. M.A., † Fachanwalt für Arbeitsrecht; Studium der Rechtswissenschaft, Mediation, Personalentwicklung und Erwachsenenbildung; Trainerausbildung; langjährige Erfahrung als Rechtsanwalt, Berater und Trainer im Arbeits- und Tarifrecht des öffentlichen und kirchlichen Dienstes; Sozius der Kanzlei Brüggemann & Richter, Mönchengladbach
Annett Gamisch, Diplom-Betriebswirtin (BA) für öffentliche Wirtschaft, Schwerpunkt Versorgungswirtschaft; Trainerausbildung; langjährige Erfahrung in der Eingruppierung und Stellenbeschreibung für den öffentlichen und kirchlichen Dienst; Geschäftsführerin des Instituts für PersonalWirtschaft (IPW) GmbH in Fulda, das den öffentlichen und kirchlichen Dienst schult und personalwirtschaftlich berät.
Gabriele Thombansen, Rechtsanwältin für Arbeitsrecht mit dem Schwerpunkt Arbeitsrecht des öffentlichen und kirchlichen Dienstes; Studium der Rechtswissenschaft; langjährige Tätigkeit als selbstständige Rechtsanwältin, Rechtsdozentin sowie in der Personalberatung; erfolgreiche Fachautorin.
Schnellübersicht
1. Abkürzungen / Das neue Tarifrecht ein langer Weg
1. Die Struktur des TV-L
2. Der Weg in den TV-L
3. Vom Sollen und Müssen des Arbeitnehmers
4. Die Rolle des Arbeitgebers: Partner oder Betreuer?
5. Die Arbeitszeit
6. Wenn der Arbeitnehmer nicht arbeitet
7. Ermahnung und Abmahnung
8. Die Wege trennen sich
9. Das Arbeitszeugnis: Beurteilungsfehler vermeiden
10. Ausschlussfristen: Ansprüche anmelden
11. Literaturhinweise
Auszüge aus referenzierten Vorschriften
1. Abkürzungen / Das neue Tarifrecht ein langer Weg
Das neue Tarifrecht – ein langer Weg
Abkürzungen
Das neue Tarifrecht – ein langer Weg
Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) benötigte Anlauf: Die lang anhaltende Kritik am Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT) und Meinungsverschiedenheiten über den richtigen Weg zu einem modernen Tarifrecht führten dazu, dass zunächst nur der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) in Kraft gesetzt wurde, der das Tarifrecht der Beschäftigten des Bundes und der Kommunen regelt.
Mit Wirkung zum 01.11.2007 folgte der TV-L, der sich anfangs auf die Regelung der Rechte und Pflichten im Arbeitsverhältnis sowie Vergütungsfragen beschränkte. Das ursprünglich ausgesparte Eingruppierungsrecht gilt seit 01.01.2012 (siehe Richter/Gamisch, EG TV-L).
Seit vielen Jahren schulen wir Arbeitnehmer, Personal- und Betriebsräte, Führungskräfte und Funktionsträger des öffentlichen (und kirchlichen) Dienstes zum Tarifrecht, einschließlich des TV-L. In Seminaren und Trainings wurden uns viele Fragen gestellt, die wir nunmehr auch in der Form eines Buchs beantworten wollen.
Dieser Kompakt-Kommentar ist eine kurze Darstellung der Rechte und Pflichten im TV-L-Arbeitsverhältnis und beantwortet prägnant die wesentlichen und immer wieder gestellten Fragen der Praktiker. Im Mittelpunkt steht eine gute Lesbarkeit: Wir wollten keine umfassende und erschöpfende Kommentierung vorlegen, die jedes Einzelproblem in seiner Tiefe behandelt. Vielmehr geht es uns darum, das System verständlich zu erklären, um für den interessierten Leser ein gezieltes Nacharbeiten anhand von Rechtsprechung, Aufsatz- und Kommentarliteratur zu ermöglichen.
Unser Ziel ist erreicht, wenn wir „die Schwellenangst“ genommen haben, sich sicher mit dieser weitreichenden Rechtsmaterie zu befassen. So richtet sich der Kompakt-Kommentar an Beschäftigte, seien es Arbeitnehmer oder Führungskräfte, Interessenvertreter wie Personal-/Betriebsratsmitglieder oder Schwerbehindertenvertreter sowie Frauen-/Gleichstellungs- und Datenschutzbeauftragte.
Leserinnen und Leser finden fortlaufend im Text Vertiefungshinweise auf weiterführende Rechtsprechung und Literatur. Bei der Auswahl der Texte haben wir Wert auf gute Lesbarkeit, leichte Verfügbarkeit und eine ausgewogene Meinung gelegt. Ausschließlich im Interesse der Lesefreundlichkeit verwenden wir die männliche Sprachform.
Mönchengladbach und Fulda
Achim RichterAnnett GamischGabriele ThombansenKanzlei Brüggemann & RichterIPW – Institut fürKanzlei Thombansenwww.brueggemann-richter.dePersonalWirtschaft GmbHwww.kanzlei-thombansen.dewww.ipw-fulda.deAbkürzungen
a. A.anderer AnsichtAbs.Absatza. F.alte FassungAGBAllgemeine GeschäftsbedingungenÄrzte BefrGGesetz über befristete Arbeitsverträge mit Ärzten in der WeiterbildungAPHueck, Nipperdey, Dietz, Arbeitsrechtliche Praxis, Nachschlagewerk des BundesarbeitsgerichtsArbGArbeitsgerichtArbStättVOArbeitsstättenverordnungArbZGArbeitszeitgesetzAuAArbeit und Arbeitsrecht (Zeitschrift)AÜGArbeitsüberlassungsgesetzAuRArbeit und Recht (Zeitschrift)AVOArbeitsvertragsordnung für den kirchlichen Dienst in der Erzdiözese FreiburgBABundesagentur für ArbeitBAGBundesarbeitsgerichtBATBundes-AngestelltentarifvertragBAT-KFBundes-Angestelltentarifvertrag – Kirchliche FassungBayPersVGBayerisches PersonalvertretungsgesetzBBBetriebs-Berater (Zeitschrift)BBGBundesbeamtengesetzBBiGBerufsbildungsgesetzb+pZeitschrift für Betrieb + Personal (Zeitschrift)BDSGBundesdatenschutzgesetzBeamtStGBeamtenstatusgesetzBEEGBundeselterngeld- und ElternzeitgesetzBerlPersVGBerliner PersonalvertretungsgesetzBetrVGBetriebsverfassungsgesetzBGBBürgerliches GesetzbuchBMIBundesministerium des InnernBPersVGBundespersonalvertretungsgesetzBRBetriebsratBRRGBundesrechtsrahmengesetzBSHGBundessozialhilfegesetzBUrlGBundesurlaubsgesetzBVerfGBundesverfassungsgerichtBVerwGBundesverwaltungsgerichtca.circaDÖDDer Öffentliche Dienst (Zeitschrift)DRiGDeutsches RichtergesetzDSG NRWDatenschutzgesetz Nordrhein-Westfalendto.ditoEFZGEntgeltfortzahlungsgesetzEGEntgeltgruppeEUGHEuropäischer Gerichtshoff., ff.folgendeFAZFrankfurter Allgemeine Zeitung (Tageszeitung)FPfZGFamilienpflegezeitgesetzGdBGrad der BehinderungGewArchGewerbearchiv (Zeitschrift)GewOGewerbeordnungGGGrundgesetzggf.gegebenenfallsHess. LAGHessisches Landesarbeitsgerichth. M.herrschende MeinungHRGHochschulrahmengesetzi. A.im Auftragi. V. m.in Verbindung mitJArbSchGJugendarbeitsschutzgesetzKSchGKündigungsschutzgesetzLAGLandesarbeitsgerichtLAGEEntscheidungen der LandesarbeitsgerichteLPartGLebenspartnerschaftsgesetzLPVGLandespersonalvertretungsgesetz[Ls]LeitsatzMDKMedizinischer Dienst der KrankenversicherungMuSchGMutterschutzgesetzMTArbManteltarifvertrag für Arbeiterinnen und Arbeiter des Bundes und der Länderm. w. N.mit weiteren NachweisenNachwGNachweisgesetzn. F.neue FassungNPDNationaldemokratische Partei DeutschlandsNr./Nrn.Nummer/Nummernn. v.nicht veröffentlichtNWRettGRettungsdienstgesetz Nordrhein-WestfalenNZANeue Zeitschrift für Arbeitsrecht (Zeitschrift)NZA-RRNeue Zeitschrift für Arbeitsrecht – Rechtsprechungsreport (Zeitschrift)o. g.oben genanntOVGOberverwaltungsgerichtPersRDer Personalrat (Zeitschrift)PersVGPersonalvertretungsgesetzPflegeZGPflegezeitgesetzPNProtokollnotiz/enrkr.rechtskräftigRn.RandnummerRspr.RechtsprechungS.SeiteSGB ISozialgesetzbuch Erstes Buch – Allgemeiner TeilSGB IIISozialgesetzbuch Drittes Buch – ArbeitsförderungSGB IVSozialgesetzbuch Viertes Buch – Gemeinsame Vorschriften für die SozialversicherungSGB VSozialgesetzbuch Fünftes Buch – Gesetzliche KrankenversicherungSGB VIIISozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und JugendhilfeSGB IXSozialgesetzbuch Neuntes Buch – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschens. o.siehe obens. u.siehe untenTdLTarifgemeinschaft deutscher LänderTHWTechnisches HilfswerkTVA-LTarifvertrag für Auszubildende der LänderTV-ÄrzteTarifvertrag für Ärzte an UniversitätsklinikenTVGTarifvertragsgesetzTV-HTarifvertrag für den öffentlichen Dienst des Landes HessenTV-LTarifvertrag der LänderTVöDTarifvertrag für den öffentlichen DienstTVöD-VTarifvertrag für den öffentlichen Dienst – VerwaltungTVÜ-BundTarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten des Bundes in den TVöD und zur Regelung des ÜbergangsrechtsTVÜ-LänderTarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Länder in den TV-LTVÜ-VKATarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des ÜbergangsrechtsTV-VTarifvertrag für VersorgungsbetriebeTV-WW/NWTarifvertrag für Arbeitnehmer/innen in der Wasserwirtschaft in Nordrhein-WestfalenTzBfGTeilzeit- und Befristungsgesetzvgl.vergleicheVwVfGVerwaltungsverfahrensgesetzz. B.zum BeispielZFAZeitschrift für ArbeitsrechtZMVDie Mitarbeitervertretung (Zeitschrift)zit.zitiertZTRZeitschrift für Tarifrecht (Zeitschrift)zzt.zurzeit1. Die Struktur des TV-L
1. Ein „schlanker“ Tarifvertrag
2. Allgemeines Arbeitsrecht
3. Die Normenpyramide
4. Aktuelle Texte und Literatur
5. Die Geltung des TV-L
6. Die Bedeutung des allgemeinen Arbeitsrechts
7. Auslegung des TV-L
8. Betrieb/Dienststelle
9. Bezugnahme auf den Tarifvertrag
10. Geltungsbereich des TV-L
1. Ein „schlanker“ Tarifvertrag
Dem BAT wurde regelmäßig vorgeworfen, zu viele zu detaillierte Regelungen zu treffen, die sich zudem stark an das Beamtenrecht anlehnten oder gar auf dieses verwiesen. Für ein modernes Tarifrecht wurde demgegenüber ein „schlanker Text“ gefordert, der sich vom Beamtenrecht löst. Dementsprechend wurde der Text des TV-L gestrafft: Entweder sind Vorschriften entfallen oder das allgemeine Arbeitsrecht wird als bekannt vorausgesetzt. Auf das Beamtenrecht wird nur noch vereinzelt Bezug genommen.
Ohne Kenntnis des allgemeinen Arbeitsrechts ist der TV-L nicht verständlich.
Der TV-L gleicht nicht mehr einer Verwaltungsvorschrift, die „alles und jedes“ regelt. Vielmehr bilden die Arbeitsgesetze bzw. das allgemeine Arbeitsrecht den rechtlichen Rahmen, den der TV-L – teilweise – mit seinen Sonderregeln weiter ausfüllt. Im Übrigen muss grundsätzlich auf das allgemeine Arbeitsrecht und nur in wenigen Ausnahmefällen auf das Beamtenrecht zurückgegriffen werden.
2. Allgemeines Arbeitsrecht
Das deutsche Recht kennt nach wie vor kein Arbeitsgesetzbuch. An seine Stelle tritt eine Vielzahl von Einzelgesetzen, die die besonderen Belange eines Arbeitsverhältnisses regeln, denn bereits in der Entstehungszeit des BGB war klar, dass für das Recht der Arbeitnehmer besondere Vorschriften gelten müssen.
Das Arbeitsrecht ist ein Teil des Zivilrechts, für den allerdings viele Besonderheiten gelten. Denn anders als die Vertragsparteien eines Dienstvertrags gemäß § 611 ff. BGB oder Werkvertrags gemäß § 631 ff. BGB trifft ein strukturell starker Arbeitgeber auf einen potenziell schutzbedürftigen Arbeitnehmer, der sich im Rahmen des Arbeitsverhältnisses in eine „persönliche Abhängigkeit“ begibt. Das heißt, der Arbeitgeber bestimmt die Arbeitsorganisation sowie die Arbeitsmittel und erteilt Weisungen gemäß § 106 GewO. Auf diesem Weg wird der Arbeitnehmer in die Dienststelle bzw. den Betrieb „eingegliedert“. Vor diesem Hintergrund darf bei der Beantwortung arbeitsrechtlicher Fragen nie vergessen werden, dass es um den Ausgleich der unterschiedlichen Stärke geht und das Arbeitsrecht vor allem ein „Arbeitnehmerschutzrecht“ darstellt. Das gilt zunächst für die Privatwirtschaft, in der der Interessengegensatz zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf der Hand liegt, aber auch im Arbeitsverhältnis des öffentlichen Dienstes, das ggf. weitaus weniger vom Gewinnstreben des (öffentlichen) Arbeitgebers geprägt wird. Auch dieses Rechtsverhältnis ist kein besonderes Treueverhältnis wie im Fall des Beamten.
Literatur
Zum Beamtenrecht: Spieß, Neues Statusrecht der Beamtinnen und Beamten; Auerbach/Pietsch, Beamtenstatusgesetz; Lenders/Peters/Weber, Das neue Dienstrecht des Bundes
Ein schwerer Fehler der Praxis im öffentlichen Dienst ist es, aus unterschiedlichen Gründen das Beamtenrecht auch auf Arbeitnehmer anzuwenden.
Der alte BAT verwies an vielen Stellen auf das Dienstrecht der Beamten. Mit dem neuen, geänderten Tarifrecht des öffentlichen Dienstes wollte man von derartigen Regelungen Abschied nehmen und sich mehr am Arbeitsrecht der Privatwirtschaft orientieren. Die (vereinzelt verbliebenen) Bezugnahmen im TV-L stellen nur noch eine Ausnahme dar. Das Beamtenrecht gilt im Hinblick auf die Haftungsbeschränkung (vgl. § 3 Abs. 7 TV-L) und die Ablieferungspflicht bei Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst (vgl. § 3 Abs. 4 Satz 3 TV-L). Im Wege des Günstigkeitsprinzips kann der Arbeitgeber – sofern eine Erlaubnis vorliegt – übertariflich das Beamtenrecht anwenden, zum Beispiel günstigere Regelungen bei der Urlaubsübertragung gewähren.
In anderen Fällen sind Rückgriffe auf das Beamtenrecht unzulässig.
3. Die Normenpyramide
Die anzuwendenden Rechtsvorschriften bilden eine Pyramide, für die das sogenannte Rangprinzip gilt: Das niederrangige Recht darf nicht gegen höherrangiges Recht verstoßen. So muss sich der Arbeitsvertrag an die Vorgaben des TV-L halten und darf auch nicht gegen eine Dienst-/Betriebsvereinbarung verstoßen. Weiterhin darf der Tarifvertrag wiederum das (Grund-)Gesetz nicht verletzen, die Weisung des Arbeitgebers gemäß § 106 GewO darf nicht gegen Grundrechte des Grundgesetzes verstoßen usw.
Ausnahme 1 von der Geltung des Rangprinzips
Das Rangprinzip wird im Arbeitsrecht durch das sogenannte Günstigkeitsprinzip ergänzt: Ausnahmsweise gilt die niederrangige Rechtsvorschrift, wenn diese für den Arbeitnehmer (!) günstiger ist. Im Arbeitsvertrag kann eine gegenüber dem TV-L für den Beschäftigten bessere Regelung getroffen werden oder der Tarifvertrag stellt den Arbeitnehmer im Verhältnis zum Gesetz günstiger usw. Ob in diesem Zusammenhang im Geltungsbereich des TV-L eine sogenannte betriebliche Übung entstehen kann, ist umstritten.
Ausnahme 2 von der Geltung des Rangprinzips
Einzelne Gesetze enthalten sogenannte Öffnungsklauseln. In diesem Fall darf in einem Tarifvertrag oder in einer Dienst-/Betriebsvereinbarung auf der Grundlage eines Tarifvertrags auch zuungunsten des Arbeitnehmers vom Gesetz abgewichen werden. Das gilt vor allem für das Arbeitszeitgesetz, von dem unter bestimmten Voraussetzungen gemäß § 6 Abs. 4 TV-L oder § 42 Nr. 4 zu § 7 TV-L abgewichen werden kann.
Literatur
Rothländer, PersR 2007, S. 459–464
Besonderheiten gelten im Datenschutzrecht. Das Bundes- bzw. Landesdatenschutzgesetz findet nur Anwendung, wenn kein Spezialgesetz (z. B. § 16 Abs. 2 ArbZG, § 5 MuSchG, § 65 Abs. 1, 2 LPVG NRW usw.), aber auch keine andere Rechtsvorschrift gilt. Darunter fallen zum einen Tarifverträge (z. B. das tarifvertragliche Untersuchungsrecht des § 3 Abs. 4 TV-L), zum anderen Dienst-/Betriebsvereinbarungen.
4. Aktuelle Texte und Literatur
Der aktuelle Text des TV-L wird regelmäßig im Walhalla Fachverlag veröffentlicht: Jährlich in der gebundenen Ausgabe „TV-L Jahrbuch Länder“ sowie in der regelmäßig aktualisierten Loseblattwerk-Sammlung „Taschenbuch öffentlicher Dienst – TV-L“.
Diese Werke enthalten auch die Texte der wichtigsten Arbeitsgesetze sowie praktische Arbeitshilfen, insbesondere die aktuellen Arbeitsvertragsmuster der Tarifgemeinschaft der Länder als zuständiger Arbeitgeberverband.
Für eine vertiefte Bearbeitung tarifrechtlicher Fragestellungen muss auf eine umfangreiche Kommentierung des TV-L zurückgegriffen werden. Zudem ist die Anschaffung eines Handbuchs zum allgemeinen Arbeitsrecht ratsam. Aktuelle Entscheidungen der Arbeitsgerichte werden in den weit verbreiteten Zeitschriften veröffentlicht (z. B. NZA, NZA-RR, ZTR und PersR). Kirchliche TV-L-Anwender greifen regelmäßig auf die Zeitschrift ZMV zurück. Die Zeitschrift AuA informiert zeitnah über neueste Rechtsprechung und Trends, die Zeitschrift DÖD behandelt praxisgerecht Besonderheiten des öffentlichen Dienstes.
Aktuelle Urteile und Beschlüsse des Bundesarbeitsgerichts werden kostenlos im Internet veröffentlicht unter: www.bundesarbeitsgericht.de
Die Justizverwaltungen der Länder stellen ebenfalls unentgeltlich wichtige Entscheidungen zur Verfügung, in NRW zum Beispiel unter: www.nrwe.de
Literatur
Zu Rechtsquellen im Arbeitsrecht: Schaub, Arbeitsrechts-Handbuch, § 3 Rn. 1 ff.
Aktuelle Literatur zum allgemeinen Arbeitsrecht unter: www.walhalla.de
5. Die Geltung des TV-L
Der TV-L regelt das Arbeitsrecht der Länder, mit Ausnahme von Hessen. Für Hessen gilt der TV-H, der sich stark am TV-L orientiert (siehe Spieß, Das neue Tarifrecht in Hessen, Regensburg 2011). Der TV-L ist nicht allgemeinverbindlich. Er gilt für das Arbeitsverhältnis nur, wenn die Parteien des Arbeitsvertrags tarifgebunden sind oder im Arbeitsvertrag auf den TV-L Bezug genommen wird (siehe Seite 23 ff.).
Vorbild des TV-L ist der TVöD, der an viele Regelungen des BAT anknüpft. Insoweit ist die Rechtsprechung der Arbeitsgerichte zum BAT weiterhin von Bedeutung. Für das Arbeitszeitrecht des TV-L und TVöD stand der Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V) Pate. Die Regelungen der §§ 8, 9 TV-V gleichen den §§ 6, 7 TVöD/TV-L in vielen Dingen, enthalten aber auch erhebliche Abweichungen. Die Qualifizierungsvorschrift des § 5 TV-L/TVöD folgt Vorbildern aus der Privatwirtschaft (vgl. Richter/Gamisch, AuA 2/2007, S. 95–98). Keine Anwendung findet der Tarifvertrag auf kirchliche Arbeitsverhältnisse.
Während der Entstehung des TV-L war umstritten, ob die Arbeitsverhältnisse im – inhomogenen öffentlichen Dienst – durch Spartentarifverträge geregelt werden sollten oder ob es bei einheitlichen Arbeitsbedingungen, wie sie der BAT darstellt, bleiben sollte. Wie auch im TVöD hat man sich für einen Mittelweg entschieden: Vor dem Hintergrund von Besitzstandsregelungen im TVÜ gliedert sich der TV-L in einen Allgemeinen Teil (§§ 1 bis 39 TV-L), der für alle Sparten des öffentlichen Dienstes gilt und besondere Teile mit Sonderregelungen für:
Hochschulen und Forschungseinrichtungen (§ 40)
Ärzte an Universitätskliniken (§ 41)
Ärzte außerhalb von Universitätskliniken (§ 42)
Nichtärztliche Beschäftigte in Universitätskliniken und Krankenhäusern (§ 43)
Lehrkräfte (§ 44)
Personal an Theatern und Bühnen (§ 45)
Beschäftigte auf Schiffen und schwimmenden Geräten (§ 46)
Beschäftigte im Justizdienst (§ 47)
Beschäftigte im forstlichen Außendienst (§ 48)
Beschäftigte in landwirtschaftlichen Verwaltungen (§ 49).
Die Rechtsanwendung erfolgt in einem Dreier-Schritt: Zuerst wird geprüft, ob der allgemeine Teil (§§ 1 bis 39) eine Regelung trifft. Dann muss beachtet werden, ob die jeweilige Sonderregelung gemäß § 1 Abs. 4 TV-L eine Abweichung vorsieht. Schließlich stellt sich die Frage, ob für übergeleitete Arbeitnehmer Besitzstandsregelungen des TVÜ-Länder zur Anwendung kommen.
Vom Geltungsbereich einer Sonderregelung mit seinen abweichenden Vorschriften werden alle Arbeitnehmer erfasst.
Anders als im Beamtenrecht sind gemäß § 3 Abs. 4 TV-L nur entgeltliche Nebentätigkeiten von Bedeutung. Unentgeltliche Nebentätigkeiten, zum Beispiel ein ehrenamtliches Engagement, sind für den Arbeitgeber ohne Interesse. Davon abweichend regelt – für alle Arbeitnehmer – § 40 Nr. 2 zu § 3 TV-L, dass auch unentgeltliche Nebentätigkeiten „rechtzeitig vorher schriftlich anzuzeigen“ sind. Die Auslegung folgt daraus, dass § 40 nicht von „Nebentätigkeiten gegen Entgelt…“, sondern von „Nebentätigkeiten“ spricht.
Das neue Tarifrecht stellt die sogenannte Leistungsaustauschbeziehung in den Vordergrund. Abweichend vom Vorbild des TVöD wurde auf das leistungsorientierte Entgelt verzichtet, eine dem § 18 TVöD vergleichbare Vorschrift fehlt im allgemeinen Teil. Allerdings können gemäß Sonderregelung § 40 Nr. 6 zu § 18 TV-L in Hochschulen und Forschungseinrichtungen besondere Zahlungen im Drittmittelbereich erfolgen. Auch kennt § 17 Abs. 2 TV-L nach wie vor den beschleunigten und verzögerten Stufenaufstieg.
Literatur und Rechtsprechung zum TVöD sind deshalb auch von Bedeutung für den TV-L-Anwender. Es muss aber stets geprüft werden, ob die Rechtslage nicht im Detail vom TVöD abweicht. Das gilt entsprechend für die „verwandten“ Tarifverträge TV-H, TV-V oder andere Spartentarifverträge wie den TV-WW/NW.
6. Die Bedeutung des allgemeinen Arbeitsrechts
Für den gestrafften TV-L ist das allgemeine Arbeitsrecht von Bedeutung: Entweder enthält der Tarifvertrag für den Rechtsbereich keine ausdrückliche Regelung, sodass auf das Gesetz zurückgegriffen werden muss (z. B. die Anzeige der Arbeitsunfähigkeit gemäß § 5 EFZG), oder der TV-L verweist auf das Gesetz (z. B. im Urlaubsrecht des § 26 Abs. 2 TV-L). Möglich ist auch, dass tarifliche und gesetzliche Ansprüche nebeneinander treten: der Teilzeitanspruch aus § 8 TzBfG und § 11 TV-L, der Anspruch auf unbezahlte Freistellung gemäß § 28 TV-L und § 3 PflegeZG usw.
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
Arbeitszeitgesetz (ArbZG)
Berufsbildungsgesetz (BBiG)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Bundesurlaubsgesetz (BUrlG)
Gewerbeordnung (GewO)
Kündigungsschutzgesetz (KSchG)
Landesdatenschutzgesetz (LDSG)
Mutterschutzgesetz (MuSchG)
Nachweisgesetz (NachwG)
Pflegezeitgesetz (PflegeZG)
Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)
Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG)
Gesetz über befristete Arbeitsverträge in der Wissenschaft (WissZeitVG)
7. Auslegung des TV-L
Die Methode der Auslegung von Rechtsvorschriften ist gesetzlich nicht geregelt. Sie wird vielmehr der Rechtswissenschaft überlassen. Gerichte entscheiden, in welcher Art und Weise die wissenschaftlichen Erkenntnisse in den Rechtsalltag einziehen. Danach werden Tarifverträge wie Gesetze ausgelegt, das gilt auch für den TV-L:
Protokollerklärungen (z. B. zu § 1 Abs. 1 TV-L) sind uneingeschränkter Bestandteil des Tarifvertrags. Rundschreiben und Hinweise von Arbeitgeber-Verbänden stellen demgegenüber nur eine subjektive Lesart der Vorschrift dar. Im Einzelfall können solche Erklärungen aber zu einer Selbstbindung des Arbeitgebers im Sinne des § 242 BGB führen.
Zudem prüfen die Gerichte die Vereinbarkeit des TV-L mit höherrangigem Recht, das heißt dem Europarecht, dem Grundgesetz oder Arbeitsgesetzen. Gemäß der Vorgabe des § 310 Abs. 4 BGB erfolgt jedoch keine Kontrolle nach Maßgabe der § 305 ff. BGB, mit der Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) überprüft werden. Demgegenüber müssen formularmäßige Arbeitsverträge als AGB den gesetzlichen Anforderungen genügen: Eine vertragliche Bezugnahme auf die für Beamte geltende Arbeitszeit ist weder unklar noch unverständlich im Sinne des § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB (vgl. BAG 14.03.2007, ZTR 2007, S. 383). Beschränkt sich der Arbeitgeber darauf, im Arbeitsvertrag auf die Anwendung des TV-L zu verweisen, mit anderen Worten auf diesen Bezug zu nehmen, erhöht er die Rechtssicherheit erheblich.
Deshalb ist es grundsätzlich ratsam, die bewährten Arbeitsvertragsmuster der Arbeitgeber-Verbände neben einem tarifkonformen Stellenbeschreibungsformular zu verwenden. Die jeweiligen Musterarbeitsverträge werden unter anderem im Walhalla Fachverlag veröffentlicht. Ein Stellenbeschreibungsformular finden Sie in Kapitel 2.
Im Unterschied zu Gesetzen und Tarifverträgen werden Arbeitsverträge nach Maßgabe der §§ 157, 133 BGB ausgelegt. Gegebenenfalls ist der wirkliche Wille der Vertragsparteien zu erforschen. Grundsätzlich bestehen keine Besonderheiten gegenüber der Privatwirtschaft. So gilt für die Auslegung von Verträgen die Auslegungsregel des § 150 Abs. 2 BGB. Bei Verträgen im Rahmen des öffentlichen Dienstes ist zudem das Gebot der sparsamen Haushaltsführung zu berücksichtigen (vgl. LAG Nds. 15.05.2009, 10 Sa 1584/08, NZA-RR 2009, S. 507).
8. Betrieb/Dienststelle
Bei der Anwendung des TV-L müssen die Beteiligungsrechte des Personal-/Betriebsrats berücksichtigt werden, wenn im Betrieb bzw. in der Dienststelle eine Interessenvertretung gebildet worden ist. Zu beachten ist, dass die Dienststellenleitung im Geltungsbereich des Personalvertretungsrechts ggf. eine Personalratswahl initiieren muss, was jedoch nicht für das Betriebsverfassungsgesetz gilt. In diesem Zusammenhang verwendet der TV-L den allgemeinen Betriebsbegriff, der grundsätzlich dem Begriff der Dienststelle im Personalvertretungsrecht gleicht. Der Arbeitszeit-TV Niedersachsen stellt hinsichtlich der Differenzierung der Arbeitszeiten auf Bereiche ab, bei denen es sich auch um Betriebsteile handeln kann (vgl. BAG 22.01.2009, 6 AZR 922/07, ZTR 2009, S. 325).
9. Bezugnahme auf den Tarifvertrag
Die tarifgebundenen Arbeitgeber haben in der Vergangenheit alle BAT-Arbeitsverhältnisse auf den TV-L übergeleitet. Zweifelhaft war die Rechtslage bei nicht tarifgebundenen Anwendern des BAT in der Fassung Bund/Land, die keine sogenannte Tarifwechselklausel im Arbeitsvertrag vereinbart hatten. Eine Vereinbarung im Arbeitsvertrag, die Vergütung richte sich nach dem „BAT Bund/TdL in der jeweils gültigen Fassung“ ist eine sogenannte kleine dynamische Bezugnahme, die keine Erstreckung auf den TVöD bzw. TV-L trägt.
Die so entstandene Lücke ist derart zu schließen, dass sich die Vergütung nach dem den BAT ersetzenden Tarifvertrag richten soll (vgl. BAG 16.12.2009, 5 AZR 888/08, NZA 2010, S. 401). Das kann im Einzelfall der TVöD-Bund oder TV-L sein. Die formularmäßige Vereinbarung, die Dynamisierung einer vertraglichen Bezugnahme auf den TVöD/TV-L in der jeweils gültigen Fassung jederzeit widerrufen zu können, ist intransparent sowie unangemessen und deshalb unwirksam (vgl. LAG München 13.04.2010, 6 Sa 132/10, ZTR 2011, S. 42).
10. Geltungsbereich des TV-L
Der TV-L gilt gemäß § 1 Abs. 1 TV-L für Arbeitnehmer (Beschäftigte), die in einem Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber stehen, der Mitglied der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) ist. Wir verwenden gleichwohl den Begriff Arbeitnehmer, um die Bezüge zum allgemeinen Arbeitsrecht zu verdeutlichen.
Für Ärzte, die Mitglieder des Marburger Bundes sind, gilt der mit dem TV-L vergleichbare Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken (TV-Ärzte).
Galt für das Arbeitsverhältnis der BAT, kann der Arbeitgeber den Arzt nicht in den TVöD (bzw. TV-L) überleiten, obwohl der Arbeitnehmer Mitglied des Marburger Bundes ist. Der sogenannte Grundsatz der Tarifeinheit rechtfertigt dieses Vorgehen nicht (vgl. LAG BW 22.01.2008, 14 Sa 87/07, NZA-RR 2008, S. 443).
Den Parteien des Arbeitsverhältnisses steht es frei, im Arbeitsvertrag die Geltung des TV-L zu vereinbaren (einzelvertragliche Bezugnahme auf den TV-L). Auf diesem Weg erhält der Arbeitgeber eine einheitliche Regelung der Arbeitsverhältnisse, was personalwirtschaftliche Vorteile bietet. Wurde in einem Arbeitsvertrag pauschal auf die Vergütung nach BAT verwiesen und ergeben sich im Nachhinein unterschiedliche Regelungen für den Bund, die Länder und Kommunen, ist eine Vertragslücke entstanden. Bei Unternehmen, die bundesweit arbeiten, spricht vieles dafür, dass die Vertragsparteien auf die für den Bund geltenden Regelungen verwiesen hätten (vgl. LAG Nds. 06.07.2007, 3 Sa 1790/06, ZTR 2007, S. 690).
Mit der Aufgabe der Unterscheidung zwischen Angestellten und Arbeitern wurde das Ziel der Diskriminierungsfreiheit ein Stück weit verwirklicht.
Im Einzelfall kann die Unterscheidung aber weiterhin von Bedeutung sein: Die Vorschrift des § 30 Abs. 2 bis 5 TV-L gilt nur für Arbeitnehmer, die nach altem Recht Angestellte gewesen wären, sodass der BAT gegolten hätte. Die Regelung gilt nicht für ehemalige Arbeiter, deren Arbeitsverhältnis sich nach dem MTArb-Länder gerichtet hätte.
Ausnahmen vom Geltungsbereich
Trotz der personalwirtschaftlichen Vorteile eines einheitlichen Rechts soll der TV-L nicht in jedem Fall gelten. Bestimmte Arbeitnehmer werden gemäß § 1 Abs. 2, 3 TV-L vom Geltungsbereich des Tarifvertrags ausgenommen, insbesondere
Buchstabe a): Leitende Angestellte im Sinne des § 5 Abs. 3 BetrVG, wenn ihre Arbeitsbedingungen einzelvertraglich besonders vereinbart sind, sowie Chefärzte.
Leitende Angestellte sind Arbeitnehmer, die gemäß § 5 Abs. 3 BetrVG typische Arbeitgeberfunktionen ausüben. Nach h. M. sind Chefärzte in der Regel keine Leitenden Angestellten, sodass diese Ausnahme gesondert zu regeln war.
Literatur
Zum leitenden Angestellten siehe Fitting, § 5 Rn. 384 ff., zum Chefarzt siehe Besgen, Kapitel 4, Rn. 1 ff.
Buchstabe b): Außertarifliche Angestellte. Diese Gruppe bilden Arbeitnehmer mit einem regelmäßigen Arbeitsentgelt oberhalb der Entgeltgruppe 15.
Buchstabe c) und d): Arbeitnehmer, für die die Spartentarifverträge gelten.
Buchstabe e): Auszubildende, für die der TVA-L gilt.
Für Auszubildende gilt der TVA-L, der dem TV-L gleicht oder sogar auf diesen verweist. In jedem Fall sind die Besonderheiten des Ausbildungsrechts zu beachten: „Bei Auszubildenden ist alles anders.“ Das gilt vor allem für das Berufsbildungsgesetz (vgl. Herkert/Töltl), aber auch für andere Ausbildungsgesetze (z. B. das Krankenpflegegesetz) und Praktikantenverhältnisse (vgl. Schade).
Buchstabe i): Geringfügig Beschäftigte gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV
Anders als im BAT gilt der Ausschluss vom Geltungsbereich im TV-L nicht für alle geringfügig Beschäftigten. Für die sogenannten geringfügig entlohnten Beschäftigten gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV gilt der TV-L, nicht aber für die sogenannten kurzfristig Beschäftigten. Das sind Arbeitnehmer, die innerhalb eines Kalenderjahres längstens drei Monate (5-Tage-Woche) oder 70 Arbeitstage (< 5-Tage-Woche) arbeiten, sofern die Tätigkeit nicht berufsmäßig ausgeübt wird. Die Herausnahme soll nicht gegen § 4 Abs. 1 TzBfG verstoßen, weil diese Mitarbeiter nicht zwingend Teilzeitbeschäftigte sein müssen. Nach a. A. verstößt diese Regelung gegen das Teilzeit- und Befristungsgesetz (vgl. Herzberg/Schlusen, Kapitel B, Abschnitt 1, Rn. 35 zur vergleichbaren Rechtslage im TV-V). Sollte der Ausschluss rechtmäßig sein (was wir bezweifeln), ist das allgemeine Arbeitsrecht anzuwenden.
Buchstaben j) bis o): Sonderregelungen für bestimmte Arbeitnehmer und Arbeitgeber
Wissenschaftliche/künstlerische Hilfskräfte
Der TV-L gilt gemäß § 1 Abs. 3 TV-L nicht für bestimmte Arbeitnehmer von Hochschulen. So schließt Buchstabe b) wissenschaftliche und künstlerische Hilfskräfte aus. Die wissenschaftliche bzw. künstlerische Hilfskraft wird in den Hochschulgesetzen der Länder definiert. Vor diesem Hintergrund ist es fraglich, ob die Vorschrift mit dem Teilzeit- und Befristungsgesetz zu vereinbaren ist. Ein Student, der neben seinem Studium im Akademischen Auslandsamt an einer Universität beschäftigt wird und ein Internetportal für ausländische Studienbewerber neu gestaltet, erbringt keine wissenschaftlichen Dienstleistungen. Deshalb gilt in diesen Fällen das öffentliche Tarifrecht (vgl. BAG 08.06.2005, 4 AZR 396/04).
Freie Mitarbeiter/Honorarkräfte
Das Arbeitsrecht und damit der TV-L findet keine Anwendung auf sogenannte freie Mitarbeiter bzw. Honorarkräfte. Diese werden aufgrund eines zivilrechtlichen Dienstvertrags gemäß § 611 BGB oder Werkvertrags gemäß § 631 BGB tätig und sind wegen der fehlenden persönlichen Abhängigkeit keine Arbeitnehmer.
Die Abgrenzung zwischen dieser Personengruppe und Arbeitnehmern erfolgt nach den von der Rechtsprechung aufgestellten Kriterien:
Grad der persönlichen Abhängigkeit zum Arbeitgeber (BAG 25.09.20113, 10 AZR 282/12)
Weisungsgebundenheit
Fremdbestimmte Arbeit
Der jahrelange Verzicht auf die Ausübung des Direktionsrechts durch den Arbeitgeber wandelt das Arbeitsverhältnis nicht in einen Vertrag über freie Mitarbeit (vgl. BAG 25.01.2007, 5 AZB 49/06, NZA 2007, S. 580). Der Missbrauch beim Einsatz freier Mitarbeiter wird Scheinselbstständigkeit genannt.
Literatur
Zum Dienst- und Werkvertrag: Prütting/Wegen/Weinreich, BGB-Kommentar
Gerber, KHR, S. 186
2. Der Weg in den TV-L
1. Die Anbahnung des Arbeitsverhältnisses: Aller Anfang ist schwer
2. Der Arbeitsvertrag: Das Fundament
3. Die Befristung des Arbeitsvertrags: Ein Stück des Wegs
2. Der Arbeitsvertrag: Das Fundament
Vertrag
Schriftform
Für Arbeitsverträge besteht kein generelles Schriftformgebot, sodass sie grundsätzlich mündlich vereinbart werden können. Lediglich die Befristungsabrede eines befristeten Arbeitsvertrags muss gemäß § 14 Abs. 4 TzBfG schriftlich abgeschlossen werden, nicht aber der gesamte Vertrag. Dabei ist das Nachweisgesetz zu beachten.
§ 2 Abs. 1 TV-L schreibt abweichend eine Schriftform vor. Die Formulierung „wird schriftlich abgeschlossen“ bedeutet aber nur eine deklaratorische, das heißt beschreibende Formvorschrift. Die Schriftform ist nicht konstitutiv, das heißt nicht rechtsbegründend.
Auch im Geltungsbereich des TV-L kann mündlich ein wirksames Arbeitsverhältnis begründet werden. Gleiches gilt für Änderungsverträge (vgl. BAG 09.02.1972, AP Nr. 1 zu § 4 BAT).
Die Schriftform des § 2 Abs. 1 TV-L bezieht sich auf die sogenannten Hauptabreden, worunter man die Vereinbarung über die geschuldete Leistung, das Arbeitsentgelt und die Arbeitszeit fasst. Die Änderung der Hauptabreden (z. B. Erhöhung der Arbeitszeit) kann eine mitbestimmungspflichtige Einstellung darstellen, bei der der Personal-/Betriebsrat zu beteiligen ist. In einzelnen Landespersonalvertretungsgesetzen existiert neben diesem Mitbestimmungsrecht auch eine Beteiligungspflicht bei „wesentlichen Änderungen des Arbeitsvertrages“ (siehe § 72 Abs. 1 Nr. 4 LPVG NRW) oder der „Änderung der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit“ (siehe § 29 Abs. 3 Nr. 15 Buchstabe d) LPVG BW; vgl. Lenders/Richter, PersV, S. 165). Die Vereinbarung von Nebenabreden unterliegt nur in NRW gemäß § 72 Abs. 1 Nr. 1 LPVG NRW der Beteiligung von Personalräten.
Haupt- und keine Nebenabreden liegen bei folgenden Vereinbarungen vor:
Vereinbarung mit einem Hausmeister, freiwillige Reinigungsarbeiten zu leisten (vgl. BAG 12.07.1983, AP Nr. 9 zu § 17 BAT)
Zusage einer übertariflichen Vergütung (BAG 06.09.1972, AP Nr. 2 zu § 4 BAT 03.08.1982; AP Nr. 12 zu § 242 BGB – Betriebliche Übung)
Die Arbeitgeberverbände haben (bewährte) (Vertrags-)Muster herausgegeben, die von den meisten Arbeitgebern verwendet werden. Bei Abweichungen trägt der Arbeitgeber das Risiko, dass die § 305 ff. BGB missachtet werden und gegen verbindliche Vorgaben des TV-L verstoßen wird.
Ein bestehender Arbeitsvertrag kann jederzeit im Einvernehmen geändert werden (Änderungsvertrag). Die Vereinbarung mit einem Arbeitnehmer im Geltungsbereich des TVöD (bzw. TV-L), über das 65. Lebensjahr (bzw. das Renteneintrittsalter) hinaus zu arbeiten, ist keine Verlängerung des Arbeitsvertrags, sondern ein Neuabschluss (LAG BW 30.04.2009, 3 Sa 11/09, DÖD 2009, S. 291). Ein Arbeitsvertrag kann aber auch von einem zivilrechtlichen Vertrag abgelöst werden. Grundsätzlich muss die Schriftform gewahrt werden.
Dienstvertrag
So wird ein Arbeitsverhältnis formwirksam aufgelöst, wenn der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer schriftlich einen Geschäftsführer-Dienstvertrag vereinbaren (BAG 03.02.2009, 5 AZB 100/08, NZA 2009, S. 669). Auch kann das Arbeitsverhältnis in ein Freies-Mitarbeiter-Verhältnis umgewandelt werden. In beiden Fällen gilt der TV-L dann nicht mehr.
Literatur
Schiefer, ZFA 2013, S. 41
Kein Verstoß gegen höherrangiges Recht
Der Arbeitsvertrag ist nichtig, wenn dieser gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, beispielsweise weil der angebliche Arzt nicht über eine Approbation verfügt oder ein Ausländer keine Arbeitserlaubnis hat (vgl. BAG 03.11.2004, 5 AZR 592/03, NZA 2005, S. 1409). Zudem dürfen Vereinbarungen nicht gegen den TV-L verstoßen.
Mit dem Wechsel vom BAT bzw. MTArb auf den TV-L sind frühere Praktiken ggf. nicht mehr zulässig. So verletzt eine vertragliche Vereinbarung, wonach der Arbeitgeber gemäß § 15 Abs. 3 MTArb die Arbeitszeit einseitig auf bis zu zehn Stunden verlängern kann, bei beiderseitiger Tarifbindung nunmehr § 6 TV-L und ist gemäß § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 3 TVG unwirksam (vgl. BAG 28.01.2009, 4 AZR 904/07, NZA 2009, S. 444).
Nachweisgesetz
Ungeachtet des § 2 Abs. 1 TV-L ist der Arbeitgeber verpflichtet, dem Arbeitnehmer zumindest einseitig schriftlich die wesentlichen Vertragsbedingungen innerhalb eines Monats nach Beginn der Beschäftigung mitzuteilen. Diese Vorschrift gilt für alle Arbeitnehmer, die länger als einen Monat beschäftigt werden.
Änderungen wesentlicher Vertragsbedingungen müssen spätestens einen Monat nach Vertragsänderung schriftlich mitgeteilt werden.
Nach h. M. führt die Erteilung eines Nachweises nicht zu einer Einschränkung des Weisungsrechts des Arbeitgebers, denn die Nachweiserklärung ist eine „Wissenserklärung“, nicht aber eine „Willenserklärung“. Etwas anderes gilt, wenn der Arbeitgeber seinen Nachweis „im Arbeitsvertrag“ gibt. In diesem Fall engt er sein grundsätzlich weites Weisungsrecht ein. Das Nachweisgesetz fordert etwa gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 4 NachwG die Mitteilung des Arbeitsorts. Wird dieser schriftlich in einer Niederschrift mitgeteilt, verengt sich das Weisungsrecht nicht. Die Rechtslage ist ggf. anders, wenn der Arbeitsort in den Arbeitsvertrag aufgenommen wird.
Mit einer tarifkonformen Stellenbeschreibung ermittelt der Arbeitgeber zunächst die zutreffende Eingruppierung gemäß § 12 TV-L, zugleich erfüllt er seine Informationspflicht gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 5 NachwG.
Literatur
Repkewitz/Richter-Richter, Stichwort Nachweisgesetz, Rn. 1 ff.
Richter/Gamisch, StB, S. 34 f.
Nebenabreden
Im Unterschied zu Hauptabreden, für die eine deklaratorische Schriftform besteht, sind Nebenabreden „nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden“. § 2 Abs. 3 TV-L bestimmt eine konstitutive Schriftform. Ohne eine schriftliche Vereinbarung können keine Ansprüche begründet werden.
Nicht jede Nebenvereinbarung ist eine Nebenabrede. Die Zusage einer höheren als die tarifliche Vergütung ist zum Beispiel eine Hauptabrede, keine Nebenabrede (vgl. BAG 01.04.2009, 10 AZR 393/08, ZTR 2009, S. 485).
Hauptabreden (geschuldete Arbeitsleistung, Arbeitsentgelt, Arbeitszeit) können nicht Gegenstand einer Nebenabrede sein. Diese liegt nur vor, wenn außerhalb der Hauptleistungspflichten zusätzliche Vereinbarungen getroffen werden. Die Abgrenzung von Haupt- und Nebenabreden bereitet zuweilen Probleme.
übertarifliche Anerkennung von Beschäftigungszeiten
Essenszuschuss
Fahrtkostenzuschuss
kostenlose Fahrgelegenheiten
Zusagen über die Teilnahme an Lehrgängen
zusätzliche bezahlte Freistellungen von der Arbeit
Sofern keine entsprechende Nebenabrede getroffen worden ist, entsteht kein Rechtsanspruch auf eine Leistung, denn im Geltungsbereich des TV-L kann grundsätzlich keine betriebliche Übung entstehen (vgl. Repkewitz/Richter-Richter/Gamisch, Stichwort Betriebliche Übung, Rn. 1 ff.).
Nebenabreden können gesondert gekündigt werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart wurde. Unterliegt der Widerruf einer Nebenabrede der Mitbestimmung des Personalrats (z. B. § 87 Nr. 3, § 79 Abs. 1 BerlPersVG), ist der Widerruf ohne vorherige Durchführung des Mitbestimmungsverfahrens unwirksam (BAG 26.01.2005, 10 AZR 331/04, NZA-RR 2005, S. 389).
Auch Nebenabreden werden an § 305 ff. BGB gemessen. Eine Vertragsstrafe ist wegen des Verstoßes gegen das Transparenzgebot des § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB unwirksam, wenn sie für jeden Fall der Zuwiderhandlung des Arbeitnehmers gegen ein Wettbewerbsverbot eine Vertragsstrafe in Höhe von zwei durchschnittlichen Bruttomonatseinkommen vorsieht und zugleich bestimmt, dass im Falle einer dauerhaften Verletzung des Wettbewerbsverbots jeder angebrochene Monat als eine neue Vertragsverletzung gilt (BAG 14.08.2007, 8 AZR 973/06, NZA 2008, S. 170).
In einem Formulararbeitsvertrag kann der Arbeitnehmer nicht auf die Erhebung einer Kündigungsschutzklage verzichten (BAG 06.09.2007, 2 AZR 722/06, NZA 2008, S. 219). Änderungen des Tarifvertrags können zur Unsicherheit führen, ob eine Nebenabrede noch wirksam ist. So ist zum Beispiel die Schreibkräftezulage im TVöD umstritten: Eine Nebenabrede, wonach die Schreibkräftezulage (bis zu einer tariflichen Neuregelung des TVöD nach Maßgabe des BMI-Rundschreibens vom 02.09.1986 in seiner jeweiligen Fassung) zusteht, bleibt vom Inkrafttreten des neuen Tarifrechts unberührt. Sie konnte durch das spätere Rundschreiben vom 10.10.2005 nicht eingeschränkt werden (LAG Köln 12.03.2010, 4 Sa 1308/09, ZTR 2010, S. 580; a. A. LAG Düsseldorf 25.05.2010, 16 Sa 327/10, ZTR 2010, S. 473).
Literatur
Repkewitz/Richter-Richter, Stichwort Nebenabrede, Rn. 1 ff.
Mehrere Arbeitsverhältnisse (§ 2 Abs. 2 TV-L)
Mehrere Arbeitsverhältnisse mit demselben Mitarbeiter dürfen gemäß § 2 Abs. 2 TV-L nur begründet werden, wenn die jeweils übertragenen Tätigkeiten nicht in einem unmittelbaren Sachzusammenhang stehen. Anderenfalls würde das Eingruppierungsrecht des § 12 TV-L umgangen.
Kein unmittelbarer Sachzusammenhang
Bote – Reinigungskraft; Fernmeldedienst – Hilfssachbearbeiter
Unmittelbarer Sachzusammenhang
Hilfssachbearbeiter – Schreibkraft
Besteht kein unmittelbarer Sachzusammenhang, bleibt jeder Arbeitsvertrag für sich bestehen und erfährt sein eigenes rechtliches Schicksal (z. B. hinsichtlich des Bestehens bei Kündigung, Auflösungsvertrag oder Auslaufen einer Befristung). Demgegenüber ist es regelmäßig problematisch, neben einem TV-L-Arbeitsvertrag ein Rechtsverhältnis als freier Mitarbeiter (Honorarkraft) wirksam zu vereinbaren, ohne dass sogenannte Scheinselbstständigkeit vorliegt.
Probezeit (§ 2 Abs. 4 TV-L)
Die ersten sechs Monate der Beschäftigung sind Probezeit. In einer Nebenabrede kann diese verkürzt oder sogar ganz auf sie verzichtet werden. Die Probezeit dient zunächst dazu, die Kündigungsfrist gemäß § 34 Abs. 1 TV-L zu verkürzen. Bestimmte Personalvertretungsgesetze sehen zudem während der Probezeit im Fall einer Kündigung nur eine „Anhörung“ des Personalrats anstelle einer „Mitbestimmung“ vor (z. B. § 74 Abs. 1, 2 LPVG NRW).
Der TV-L beinhaltet keine Verlängerungsmöglichkeit der Probezeit. Bei sachgrundlos befristeten Arbeitsverträgen ist unter bestimmten Voraussetzungen § 30 Abs. 4 TV-L zu beachten. Im Anschluss an ein Berufsausbildungsverhältnis entfällt die Probezeit.
Die Probezeit muss von der Wartezeit gemäß § 1 Abs. 1 KSchG unterschieden werden. Auch eine Verkürzung der Probezeit (z. B. auf drei Monate) führt regelmäßig nicht dazu, dass der Arbeitnehmer nach Ablauf der Erprobung dem allgemeinen Kündigungsschutz unterliegt. Dieser beginnt regelmäßig erst mit Ablauf der Wartezeit des Kündigungsschutzgesetzes, somit nach sechs Monaten.
Literatur
Repkewitz/Richter-Richter, Stichwort Kündigungsschutz, Rn. 1 ff.
Beschäftigungszeit (§ 34 Abs. 3 TV-L)
Bei der Begründung des Arbeitsverhältnisses muss die Beschäftigungszeit festgesetzt werden. Diese Festsetzung erfolgt nicht im Arbeitsvertrag, sondern in einem gesonderten Formular bzw. über einen Eintrag in einer Datei der elektronischen Personalakte. Der Begriff der Beschäftigungszeit in § 34 Abs. 3 TV-L weicht erheblich von dem der Beschäftigungszeit nach § 19 BAT ab und gleicht eher der alten Dienstzeit gemäß § 20 BAT.
Der TV-L unterscheidet zwei Beschäftigungszeiten, nämlich die Beschäftigungszeit
gemäß § 34 Abs. 3 Satz 1, 2 TV-L zur Berechnung der Kündigungsfrist und zum Eintritt des tarifvertraglichen Kündigungsschutzes, und
2.zur Ermittlung von „Arbeitsentgelt“ (§ 34 Abs. 3 Satz 3, 4 TV-L).
Zunächst werden Zeiten bei demselben Arbeitgeber anerkannt. Wie bisher darf die Beschäftigungszeit nicht ununterbrochen sein.
Diese Zeit ist für die Bestimmung der Kündigungsfrist und des tarifvertraglichen Kündigungsschutzes maßgeblich.
Darüber hinaus werden auch Zeiten bei anderen Arbeitgebern anerkannt, sofern diese vom Geltungsbereich des TV-L erfasst sind. Mit anderen Worten: Es muss ein tarifgebundener Arbeitgeber sein, der den TV-L anwendet. In diesem Fall ist die Rechtsform (juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts) unerheblich.
Auch Zeiten bei anderen „öffentlich-rechtlichen“ Arbeitgebern (z. B. TVöD-Anwendern) werden anerkannt. Unerheblich ist, ob und welchen Tarifvertrag diese anwenden. Der Arbeitgeber muss allerdings eine juristische Person des öffentlichen Rechts sein (Körperschaft, Anstalt, Stiftung des öffentlichen Rechts).
Ausbildungsverhältnisse bleiben unberücksichtigt (vgl. LAG Berlin 03.01.2011, 13 Sa 2018/00, ZTR 2001, S. 315).
die Kündigungsfrist gemäß § 34 Abs. 1 TV-L (nur Zeiten beim Arbeitgeber)
den Eintritt der sogenannten Unkündbarkeit gemäß § 34 Abs. 2 TV-L (nur Zeiten beim Arbeitgeber)
die Berechnung des Krankengeldzuschusses gemäß § 22 Abs. 3 TV-L (auch Zeiten im öffentlichen Dienst)
das Jubiläumsgeld gemäß § 23 Abs. 2 TV-L (auch Zeiten im öffentlichen Dienst)
Es liegt kein Wechsel im Sinne des § 34 Abs. 3 TV-L vor, wenn eine Lehrkraft das Arbeitsverhältnis kündigt, zum Schuljahresende ausscheidet und beim neuen Arbeitgeber nach den Sommerferien eingestellt wird. Deshalb erfolgt keine Anerkennung der Zeiten (vgl. LAG Rh-Pf 04.03.2010, 11 Sa 571/09, ZTR 2010, S. 420).
Exkurs: Stellenbeschreibung
Das allgemeine Arbeitsrecht kennt grundsätzlich keine Verpflichtung, Stellenbeschreibungen anzufertigen. Gleichwohl erfüllen diese auch arbeitsrechtliche Funktionen. So ist der TV-L-Anwender, für den das Betriebsverfassungsgesetz gilt, gemäß § 81 Abs. 2 BetrVG verpflichtet, den Arbeitnehmer über dessen Aufgabe und Verantwortung sowie über die Art seiner Tätigkeit und ihre Einordnung in den Arbeitsablauf des Betriebes zu unterrichten. Diese Pflicht muss vor der tatsächlichen Arbeitsaufnahme erfüllt werden.
Für Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes, die einen Personalrat bilden, fehlt eine vergleichbare Regelung. Eine dementsprechende Verpflichtung folgt aber aus dem Gesichtspunkt der Fürsorgepflicht nach § 241 Abs. 2 BGB. Eine Stellenbeschreibung erleichtert die Durchführung dieser Aufgaben. Zugleich erfüllt der öffentliche Arbeitgeber mit der Stellenbeschreibung die Vorgabe des § 2 Abs. 1 Nr. 5 NachwG (vgl. BAG 08.06.2005, AP Nr. 8 zu § 2 NachwG).
Die Stellenbeschreibung ist „vorweggenommenes Weisungsrecht“ im Sinne des § 106 GewO. Das Weisungs- bzw. Direktionsrecht des Arbeitgebers wird nicht eingeschränkt.
Im Geltungsbereich des TV-L besteht grundsätzlich ein weites Weisungsrecht des Arbeitgebers. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, jede ihm zugewiesene zumutbare Tätigkeit zu verrichten, die den Merkmalen seiner Entgeltgruppe entspricht (siehe § 12 TV-L; vgl. BAG 12.04.1973, AP Nr. 24 zu § 611 BGB Direktionsrecht).
Die Tätigkeitsbeschreibung hat keinen tariflichen Charakter, auch keinerlei vertragsrechtliche Bedeutung und insbesondere nicht die rechtliche Qualifikation eines Anerkenntnisses gleich welcher Art. (…)
Der Arbeitgeber könnte die Stellenbeschreibung demnach jederzeit ändern und sollte sie tatsächlich jährlich auf Aktualität prüfen. Dementsprechend unterschreibt der Arbeitnehmer das Formular nur zur Kenntnis, es handelt sich um eine sogenannte Wissenserklärung. Mit der Unterschrift wird kein Einverständnis gegeben.
Die Stellenbeschreibung ist die Gesprächsgrundlage des jährlichen Mitarbeitergesprächs nach § 5 TV-L.
Literatur
einführend Richter/Gamisch, RiA 2006, S. 245–252
vertiefend Richter/Gamisch, StB
3. Die Befristung des Arbeitsvertrags: Ein Stück des Wegs
Die Rechtmäßigkeit der Befristung
Das Arbeitsrecht ist Teil des Zivilrechts, für das der Grundsatz der Vertragsfreiheit gilt. Dementsprechend könnten befristete Arbeitsverhältnisse ohne Einschränkung geschlossen werden. Das BAG hatte aber bereits in den 1960er-Jahren entschieden, dass im Bereich des Arbeitsrechts auf diesem Weg der allgemeine Kündigungsschutz des Kündigungsschutzgesetzes umgangen würde. Deshalb führte es das Erfordernis eines Sachgrunds für Befristungen ein. Der Gesetzgeber hat diese Rechtsprechung aufgegriffen und gesetzlich verankert.
Die Rechtmäßigkeit einer Befristung ergibt sich aus den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere das Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG), aber auch § 21 BEEG, § 6 PflegeZG, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz oder das Gesetz über befristete Arbeitsverträge mit Ärzten in der Weiterbildung.
Ein befristeter Arbeitsvertrag liegt vor, wenn zwischen den Vertragsparteien vereinbart ist, dass das Arbeitsverhältnis nach einer bestimmten Zeit enden soll. Bei einer Zeitbefristung ist das Arbeitsverhältnis nach einem fest begrenzten Zeitraum eindeutig bestimmt (kalendermäßige Befristung), bei einer Zweckbefristung endet das Arbeitsverhältnis mit dem Eintritt eines bestimmten Ereignisses.
§ 30 TV-L spiegelt diese Rechtslage wider. Der Vorschrift kommt deshalb hinsichtlich der Befristung keine eigenständige Bedeutung zu.
Die Frage, ob eine Befristung dem Grunde nach rechtmäßig ist, beantwortet das Gesetz.
§ 30 Abs. 1 Satz 2 TV-L enthält aber eine eigenständige Formvorschrift, die gegenüber dem Gesetz eine Abweichung zugunsten des Arbeitnehmers darstellt.
Die Regelungen in § 30 Abs. 2 bis 5 TV-L gelten nur für Arbeitnehmer, die im Tarifgebiet West arbeiten und deren Tätigkeit vor dem 01.01.2005 der Rentenversicherung der Angestellten unterlegen hätte.
Der TV-L unterscheidet an verschiedenen Stellen nach wie vor zwischen West und Ost, Arbeiter und Angestellten.
Eine unzulässige Befristung führt gemäß § 16 TzBfG zu einem unbefristeten Arbeitsverhältnis.
Schriftformerfordernis
Die Befristungsabrede des Arbeitsvertrags muss gemäß § 14 Abs. 4 TzBfG schriftlich vor dem Beginn des Arbeitsverhältnisses abgeschlossen werden. Eine nachträgliche schriftliche Bestätigung eines mündlich vereinbarten befristeten Arbeitsvertrags ist unwirksam und führt zu einem unbefristeten Arbeitsverhältnis.
Rechtsprechung
BAG 01.12.2004, 7 AZR 198/04, NZA 2005, S. 575
Hat der Arbeitgeber in den Vertragsverhandlungen der Parteien den Abschluss des befristeten Arbeitsvertrags ausdrücklich unter den Vorbehalt eines schriftlichen Vertragsschlusses gestellt oder dem Arbeitnehmer die schriftliche Niederlegung des Vereinbarten angekündigt, so ist diese Erklärung dahingehend zu verstehen, dass der Arbeitgeber dem Schriftformgebot entsprechen will und seine auf den Vertragsschluss gerichtete Erklärung nur durch eine die Schriftform genügende Unterzeichnung der Vertragsurkunde(n) angenommen werden kann. Dies gilt gleichermaßen, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer – ohne vorangegangene Absprache – ein von ihm bereits unterschriebenes Vertragsformular mit der Bitte um Unterzeichnung übersendet. Unterschreibt der Arbeitnehmer erst nach Aufnahme der Arbeit, liegt kein unbefristetes Arbeitsverhältnis vor (vgl. BAG 16.04.2008, 7 AZR 1048/06, NZA 2008, S. 1184).
Die Schriftform setzt eine eigenhändige Unterschrift mit dem ganzen Namen voraus, eine Paraphe genügt nicht (vgl. BAG 24.01.2008, 6 AZR 519/07, NZA 2008, S. 521). Vereinbaren die Vertragsparteien mündlich einen befristeten Arbeitsvertrag, ist die Befristungsabrede nach § 14 Abs. 4 TzBfG unwirksam und der Vertrag unbefristet. Erfolgt nach Arbeitsaufnahme die Unterzeichnung eines schriftlichen Arbeitsvertrages, liegt in der Regel keine neue Befristung des ursprünglich unbefristeten Arbeitsvertrages vor. Die Rechtslage ist nur anders, wenn die Parteien vor der Unterzeichnung des schriftlichen Arbeitsvertrages mündlich keine Befristung vereinbart oder eine Befristungsabrede getroffen haben, die inhaltlich nicht mit der im schriftlichen Vertrag enthaltenen Befristung übereinstimmt. Dann liegt eine eigenständige, neue Befristungsabrede vor.
Das gilt auch für Befristungen gemäß dem Ärzte Befristungsgesetz (vgl. BAG 13.06.2007, 7 AZR 700/06, NZA 2008, S. 108). Es reicht aus, wenn eine Vertragspartei in einem von ihr unterzeichneten, an die andere Vertragspartei gerichteten Schreiben den Abschluss eines befristeten Arbeitsvertrags anbietet und die andere Partei dieses Angebot annimmt, indem sie das Schriftstück ebenfalls unterzeichnet (vgl. BAG 26.07.2006, 7 AZR 514/05, ZTR 2007, S. 45).Das befristete Arbeitsverhältnis geht gemäß § 15 Abs. 5 TzBfG in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis über, wenn der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer nur mündlich eine befristete Verlängerung vereinbart haben (vgl. LAG Düsseldorf 14.05.2009, 5 Sa 108/09). Ist die Befristung allein wegen der fehlenden Schriftform unwirksam, können nach § 16 Satz 2 TzBfG beide Vertragsparteien den Arbeitsvertrag kündigen. Gleiches gilt für den Fall, dass ein Kündigungsrecht im Arbeitsvertrag unklar formuliert ist bzw. nicht besteht (vgl. BAG 23.04.2009, 6 AZR 533/08, NZA 2009, S. 1260).
Die sonstigen Voraussetzungen einer ordentlichen Kündigung müssen in diesen Fällen erfüllt sein. Beispielsweise muss die Kündigung eines Arbeitnehmers, der dem Kündigungsschutzrecht unterliegt, sozial gerechtfertigt sein.
Befristung mit Sachgrund
Eine Möglichkeit zur wirksamen Befristung eines Arbeitsvertrags ist das Vorliegen eines sachlichen Grunds für die Befristung. Dabei werden als Beispiele im Gesetz die folgenden sachlichen Gründe genannt:
Nr. 1: Vorübergehender betrieblicher Bedarf an der Arbeitsleistung
Nr. 2: Befristung im Anschluss an eine Ausbildung oder ein Studium, um dem Arbeitnehmer den Übergang in eine Anschlussbeschäftigung zu erleichtern
Nr. 3: Vertretung eines anderen Arbeitnehmers
Nr. 4: Eigenart der Arbeitsleistung
Nr. 5: Befristung der Erprobung
Nr. 6: In der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe
Nr. 7: Haushaltsmittel
Nr. 8: Befristung aufgrund gerichtlichen Vergleichs
Diese Aufzählung ist nicht abschließend, sodass weitere Sachgründe, die von der Rechtsprechung anerkannt werden, zu berücksichtigen sind.
Andere Sachgründe können die Befristung von Arbeitsverträgen jedoch nur rechtfertigen, wenn sie den in § 14 Abs. 1 TzBfG zum Ausdruck kommenden Wertungsmaßstäben entsprechen. Das gilt auch für tariflich geregelte Sachgründe (BAG 09.12.2009, 7 AZR 399/08).
Mit einem Gastdozenten kann ein befristetes Vertragsverhältnis für die Dauer des Besetzungsverfahrens auf einer vakanten Professorenstelle abgeschlossen werden. Dieses Vertragsverhältnis kann Dienstverhältnis im Sinne von § 113 BerlHG oder Arbeitsverhältnis im Sinne von § 14 Abs. 1 TzBfG sein (vgl. LAG Berlin-Brandenburg 19.09.2014, 2 Sa 1029/14).
Einzelheiten
Für die Praxis sind vor allem folgende Befristungsgründe erheblich:
Vorübergehender Arbeitskräftebedarf (§ 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 TzBfG)
Der Arbeitgeber muss im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses die Prognose aufstellen können, dass der Arbeitskräftebedarf zukünftig wegfallen wird. Die Befristung nach § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 TzBfG setzt eine derartige Prognose des Arbeitgebers voraus, die auf der Grundlage konkreter Anhaltspunkte aufgestellt werden muss. Die Vorhersage wird nicht dadurch erschüttert, dass der Arbeitskräftebedarf über das Vertragsende hinaus fortbesteht. Der Arbeitnehmer muss aber zur Deckung des Mehrbedarfs beschäftigt werden. Daher reicht es aus, dass ein ursächlicher Zusammenhang besteht (vgl. BAG 17.03.2010, 7 AZR 640/08; BAG 20.02.2008, 7 AZR 950/06, ZTR 2008, S. 508).
Positivbeispiele aus der Rechtsprechung
Aufgaben von begrenzter Dauer BAG 11.02.2004, 7 AZR 362/03, NZA 2004, S. 978
Arbeitsspitzen
ProjektarbeitBAG 25.08.2004, 7 AZR 7/04, NZA 2005, S. 357
Rückgang des Auftragsvolumens
Saison- und Kampagnearbeiten BAG 29.01.1987, AP Nr. 1 zu § 620 BGB Saisonarbeit
Eine Befristung nach § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 TzBfG ist nicht möglich, wenn der Arbeitgeber den Zeitraum überbrücken möchte, ab dem er die Tätigkeiten durch Leiharbeitnehmer ausüben lassen will. Es fehlt an einem vorübergehenden Bedarf, denn der Arbeitgeber erledigt die Arbeiten nach wie vor (vgl. BAG 17.01.2007, 7 AZR 20/06, NZA 2007, S. 566). Der vorübergehende Bedarf darf nicht durch den normalen Betriebsablauf hervorgerufen werden, sondern muss auf besonderen Gründen beruhen. Im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die anfallenden Arbeiten in absehbarer Zeit wieder mit der normalen Belegschaft bewältigt werden können.
Der zeitlich befristete Einsatz von Arbeitnehmern zur Durchführung eines Projekts ist ein Unterfall des vorübergehenden Arbeitskräftebedarfs. Es muss aber tatsächlich ein Projekt vorliegen. In keinem Fall darf das unternehmerische Risiko auf den Arbeitnehmer abgewälzt werden. Auch die Daueraufgabe des Arbeitgebers darf nicht in Projekte „atomisiert“ werden. Ein Projekt ist nur dann ein Sachgrund gemäß § 14 Abs. 1