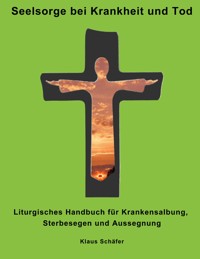5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Schule, Studium, Traumberuf, Hochzeit, Kinder, eine große Erbschaft, ... Für Niko Hirt verlief das Leben wirklich glatt, bis zu dem Tag, an dem ihm sein Arzt sagte, dass er ohne Lebertransplantation in einigen Jahren tot sein wird, unter Umständen sogar nachts unbemerkt innerlich verblutet. Niko Hirt nahm es nicht so ernst, bis er nachts fast innerlich verblutet wäre. Da erwachte sein Lebenswille. Niko Hirt wollte leben, um jeden Preis. Er hatte doch noch kleine Kinder und wollte noch seine Enkel erleben. Ohne Leber-TX war ihm das nicht möglich. Doch wie soll man an eine Leber kommen, wenn in Deutschland nach den Skandalen um Organspende im Jahr 2012 die Zahl der Organspender ständig zurück geht? Da wird ihm eine Möglichkeit angeboten, zwar strafbar, aber was tut man nicht alles, wenn man nichts zu verlieren hat, außer seinem Leben? Ein fiktiver Krimi mit wahren Fakten, spannend bis zur letzten Seite.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
0 Vorspann
0.1 Inhaltsverzeichnis
0.2 Abkürzungen
0.3 Literaturliste
0.4 Prolog
1 Der Befund
1.1 Wie alles begann
1.2 Befunderöffhung
2 Die TX
2.1 Die Recherche
2.2 Die TX
2.3 Der Unfall
3 Anhang
0.2 Abkürzungen
BÄK BÄK
DSO Deutsche Stiftung Organtransplantation (koordiniert die TX)
ET Eurotransplant (Vermittlungsstelle für die zu transplantierenden Organe)
LTX Lebertransplantation
OA Oberarzt
P. Pater
PSC Primär sklerosierende Cholangitis (unheilbare, tödlich verlaufende, chronische Entzündung der Gallenwege)
Sr. Schwester
TX (Organ)Transplantation
0.3 Literaturliste
Bücher von Klaus Schäfer rund um das Thema Organtransplantation:
Hirntod. Medizinische Fakten - diffuse Ängste - Hilfen für Angehörige. Regensburg 2014.
Leben - dank dem Spender. Ergebnisse aus Umfragen unter 203 Transplantierten. Karlsruhe 2014
Dank dem Spender. 20 Transplantierte berichten. Karlsruhe 2014.
25 x 25 geschenkte Jahre. 25 Transplantierte berichten über die mindestens 25 Jahre ihres 2. Lebens. Karlsruhe 2015.
Ein Tag auf dem Friedhof. Ein Kind lernt verschiedene Bestattungsformen kennen. (5-12 Jahre) Karlsruhe 2015.
Das Herz von Onkel Oskar. Organspende für Jugendliche erklärt. (14-18 Jahre) Karlsruhe 2015.
Seelsorge bei Krankheit und Tod. Liturgisches Handbuch für Krankensalbung, Sterbesegen und Aussegnungen. Karlsruhe 2015.
Wer ist mein Nächster? Organspende aus christlicher Sicht. Karlsruhe 2015.
Leben - aber wie? Leitfaden für ein gelungenes Leben. Karlsruhe 2013.
Sterben - aber wie? Leitfaden für einen guten Umgang mit dem Tod. Regensburg 2011.
Trösten - aber wie? Ein Leitfaden zur Begleitung von Trauernden und Kranken. Regensburg 2015. 3. Auflage.
Wichtige Quelle: www.organspende-wiki.de
0.4 Prolog
Ein Toter ist immer dabei - Sie könnten der Nächste sein
Diese Worte sind in zweifacher Hinsicht zu verstehen: als Organspender und als Organempfänger.
Organspender
Organempfänger
Jeder Mensch lebt mit dem Risiko, den Hirntod zu sterben. Kein Ort, keine Uhrzeit, kein Alter, nichts gibt uns davor Sicherheit.
Jeder Mensch kann unverschuldet eine Krankheit bekommen, für die es keine Heilung gibt, aber die in Jahren, Monaten oder wenigen Wochen den sicheren Tod bringt.
Ab Eintritt dieses Ereignisses (massive Gehirnblutung, Schädelverletzung (Unfall), Herzstillstand oder massiver Hirninfarkt) haben diese Menschen keine Handlungsmöglichkeit. Binnen Sekunden verlieren sie das Bewusstsein und sterben trotz Aufbietung aller intensivmedizinischer Maßnahmen in den Hirntod.
Es kommen bei ET nur die Menschen auf die Warteliste, für die die Medizin keine weitere Hilfe anbieten kann. - Manchmal, so hier in diesem Roman, kann man zwar noch am normalen Leben teilnehmen, aber über Nacht an den Folgen dieser Krankheit sterben.
Der Hirntote ist immer tot, unabhängig von der Organspende.
Der Patient kann alleine durch die TX aus dieser lebensbedrohlichen Situation gebracht werden.
Die Wahrscheinlichkeit, selbst ein Organ zu benötigen, ist etwa dreimal höher, als die Wahrscheinlichkeit den Hirntod zu sterben. Da aber nicht alle Hirntote der Organspende zustimmen, entsteht ein Organmangel, der zu Wartelisten führt. Jährlich sterben in Deutschland rund 1.000 Menschen – das sind täglich etwa drei Menschen – denen man mit einer TX das Leben hätte retten können, aber es stand hierfür kein passendes Organ rechtzeitig zur Verfügung.
Der Organmangel (Bedarf zu gespendeten Organen) zeigt sich für Deutschland in dieser Weise: (Quelle: ET und DSO)
Jahr............................2010
2011
2012
2013
2014
Transplantiert in Deutschland
(DSO)
1
Niere.........................2.937
2.850
2.586
2.272
2.128
Leber........................1.283
1.199
1.097
970
941
Herz.............................393
366
346
313
304
Lunge..........................298
337
359
371
352
Pankreas......................163
171
161
129
120
Insgesamt
2
.................5.083
4.932
4.555
4.059
3.710
Wartende Patienten in Deutschland
am 31.12. (ET)
Niere.........................7.869
7.873
7.919
7.908
7.961
Leber........................2.161
2.119
1.868
1.534
1.351
Herz.............................981
1.039
1.012
929
858
Lunge..........................642
606
483
443
432
Pankreas......................304
282
254
229
244
Insgesamt................11.562
11.686
11.233
10.784
10.585
Starben auf der Warteliste – nur für Deutschland
(ET)
Niere............................395
398
394
422
340
Leber...........................478
465
522
382
312
Herz.............................206
177
173
164
136
Lunge..........................114
108
86
70
72
Pankreas........................27
24
13
23
17
Insgesamt..................1.158
1.103
1.132
998
826
Organspender (OS) und Organverweigerer in Deutschland
(DSO)
Jahr............................2010
2011
2012
2013
2014
Potenzielle OS
3
........1.876
1.799
1.585
1.370
4
Organspender............1.296
1.200
1.046
876
864
Organverweigererr........482
486
434
402
In Anbetracht dessen, dass rein statistisch von einem Organspender drei Organe entnommen werden, hätte den meisten dieser auf der stehend Warteliste verstorbenen Patienten mit einer TX das Leben gerettet werden können. Durch den Organmangel war dies leider nicht möglich. Daher gilt:
Ein Toter ist immer dabei – Sie könnten der Nächste sein
Diese Möglichkeit besteht als Organspender oder als potenzieller Organempfänger. Jeder kann der Nächste sein, auf der einen oder auch anderen Seite.
Dieser Roman wurde sehr realitätsnah mit echten Fakten verfasst und auf deren Quellen hingewiesen. Organisationen, Gruppen und einzelne Personen, die allgemein bekannt sind (z.B. BZgA, DSO, bpb, ZDF) oder bei denen jeweils die Quellenangaben mit genannt sind, sind keine Fiktion. Auch mit Datum versehene Medienberichte sind Realität und können nachgelesen werden. Damit wird die Realitätsbezogenheit unterstrichen.
Für die sonst in der Handlung genannten Personen gilt: Parallelen zu lebenden oder verstorbenen Menschen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
1 Die Zahlen beinhalten Tod- und Lebendspende.
2 Summarisch TX aus Tot- und Lebendspende.
3 Die Differenz zur Summe zwischen Organspender und Organverweigerer ergibt sich daraus, dass einige geplante Organentnahmen vorzeitig beendet werden mussten, z.B. weil es vor der Organentnähme zu einem Herzstillstand kam, aus dem man den Hirntoten nicht mehr zurückholen konnte, oder weil bei der Organentnahme Tumore entdeckt wurden, die zuvor unentdeckt waren.
4 Die Zahl der potenziellen Organspender und die der Organverweigerer lagen zum Zeitpunkt der Drucklegung (20.4.2015) noch nicht vor.
1 Der Befund
1.1 Wie alles begann
Ich
Die Tür schloss sich. Ich lag wieder alleine im Einzelzimmer im Krankenhaus in Mannheim. Gesprächsfetzen und Gedankensplitter schwirren mir durch meinen Kopf. War jetzt die ganze Anstrengung der letzten Jahre vergebens? Hätte ich gleich von Anfang an dem Schicksal seinen Lauf lassen sollen? Dann hätte ich mir vieles erspart, auch viel Geld. Aber dann wäre ich jetzt vielleicht nicht mehr am Leben.
Ich wollte aber leben! Ich wollte nicht vor meinem 50. Lebensjahr schon auf dem Friedhof liegen, zumal die Medizin mir noch eine lange Zukunft ermöglichte. Warum sollte ich diese Gelegenheit nicht nutzen?
Ich wollte noch auf der Hochzeit meiner drei Kinder tanzen! Ich wollte noch meine Enkelkinder erleben! Ich wollte, wie so viele andere, noch ein paar schöne Jahre Großvater sein! Und ich wollte zusammen mit meiner Frau Gabi gemeinsam alt werden!
Ich wollte das, was alle Menschen wollten. Das ist doch kein Verbrechen. Was kann ich dafür, dass ich von der Natur nicht in vollem Umfang mit Gesundheit gesegnet bin? Warum sollte ich mir da nicht helfen lassen, wo Hilfe möglich ist, um das zu erlangen, was die meisten Menschen ganz natürlich erlangen - ihre Rente?
Dies zu wollen ist doch kein Verbrechen! Warum geht man mit mir um, als hätte ich etwas Verwerfliches getan? Ich habe doch keinen Menschen geschädigt oder gar umgebracht! Warum geht man dann mit mir wie mit einem Mörder um? Warum bringt man mich mit einem Mord in Verbindung? Ich habe niemanden ermordet!
Pardon – ich hatte mich noch gar nicht vorgestellt. Zu sehr haben mich die Gespräche der letzten Minuten aufgebracht. Sie kennen mich noch nicht. Sie sollen mich jedoch kennenlernen. Ich habe nichts zu verbergen. Sie sollen auch meine Geschichte kennenlernen, damit Sie sich ein Bild von mir machen können. Sie sollen erkennen, dass ich nichts Unrechtes getan habe. Kein Mensch kam durch mich zu Schaden. Überzeugen Sie sich selbst:
Ich bin Nikolaus Hirt. Meine Freunde nennen mich Niko. Ich wurde am 5. September 1972 in Rheinbach geboren. Es war der Tag, an dem acht bewaffnete Männer der palästinensischen Terrororganisation „Schwarzer September“ das Wohnquartier der israelischen Mannschaft während der Olympischen Sommerspiele in München stürmten und elf Mitglieder der israelischen Olypiamannschaft als Geiseln nahmen. Zwei der Israelis starben bereits in den ersten Stunden der Geiselnahme an den Folgen ihrer schweren Schussverletzungen.
Meine Eltern erzählten mir schon als Kind, an welch schicksalhaftem Tag ich geboren wurde. Für Deutschland, das sich zur Sommerolympiade der Welt sehr gastlich zeigen wollte, war diese Geiselnahme ein enormer Image-Verlust. Nie wieder hat sich so etwas bei einer Olympiade wiederholt, weder in China, noch in der Sowjetunion.
Ich war ein begabter Junge. Ich lernte schnell. Daher schickten mich meine Eltern auch in das Vinzenz-Pallotti-Kolleg. Es war bis vor wenigen Jahren ein von den Pallottinern geleitetes Gymnasium. Vinzenz-Pallotti war ein katholischer Priester, der von 1795 bis 1850 in Rom lebte. Er gründete 1835 die „Gemeinschaft des Katholischen Apostolats“, aus dem später die Pallottiner hervorgegangen sind. Die Jahre in diesem Gymnasium haben mich religiös geprägt.
Ich entschied mich jedoch anders. Ich studierte nach meinem Abitur im Jahr 1990 in Mannheim Informatik. Technik lag mir schon immer, insbesondere Computer. Schon im Pallotti-Kolleg war ich in der Computer-AG und programmierte an dem 1982 auf den Markt gekommenen und 1986 in unser Gymnasium gekommenen VC 64 - für viele der „Volkscomputer 64“ -, wie man den Commodore 64 nannte. Er hatte einen „sensationellen“ Arbeitsspeicher von 64 KB und eine Grafikauflösung von 320x200 Punkte mit 16 Farben. Seine 5¼-Zoll-Disketten hatten ein Speichervolumen von 170 KB.
Bei diesen Zahlen strahlten damals unsere Kinderaugen. Wir waren begeistert von diesem Gerät. Die heutige Generation hat hierfür noch nicht einmal ein müdes Lächeln übrig. Es hat doch heute jedes Handy mehr Leistung, jedes Smartphone ein Vielfaches an Leistung. 64 KB Arbeitsspeicher waren damals ein Spitzenwert. Heute haben Handys und Smartphons 64 GB als Standard. In den 30 Jahren hat er sich um den Faktor 1.000.000 vervielfacht. - Jedenfalls half mir dieser VC 64 zu meiner Studienwahl. Noch heute muss ich sagen: Es war die richtige Wahl.
Mein Spezialgebiet ist Datensicherung. Beim PC und Laptop spricht man meist von dem „Backup“, hergeleitet vom gleichnamigen alten MS-DOS-Befehl. Wie wichtig regelmäßige Backups sind, habe ich mehrmals erlebt, einmal sehr schmerzhaft. Während meines Studiums hatte die Festplatte einen Plattenschaden, kurz vor Abgabe meiner Seminararbeit über Betriebssysteme. Ich hatte nicht nur die Arbeit, die Festplatte auszutauschen, MS-DOS, Windows 3,11 und die ganzen Programme aufzuspielen, das alles noch in mühsamer Kleinarbeit per 3,5-Zoll-Diskette, sondern auch die Seminararbeit neu zu schreiben. Mir ist solch ein Datenverlust nie wieder passiert.
Zu diesem Zweck kaufte ich mir einen „Streamer“, d.h. ein Bandlaufwerk, das die gewaltige Datenmenge von 250 MB sichern konnte. Damit sicherte ich jährlich die gesamte Festplatte und nach jedem wichtigen Studienabschnitt (z.B. nach Fertigstellung einer Seminararbeit) alle seit der letzten Sicherung veränderten Dateien. Im Gegensatz zu Unix, was ein sehr gutes Betriebssystem ist, hat MS-DOS hierzu das sogenannte Archiv-Bit. Es wird bei jedem Schreibvorgang einer Datei gesetzt. Damit ist im Directory, dem Inhaltsverzeichnis eines Ordners gekennzeichnet, ob seit der letzten Datensicherung diese Datei verändert wurde. Im sogenannten inkrementellen Backup werden nur die Daten gesichert, die seit der letzten Sicherung verändert wurden. Dies spart Zeit beim Datensichern und Platz beim Datenträger der Datensicherung.
Ein spezielles Erlebnis hatte ich 1995, als mein Zimmernachbar im Studienheim verzweifelt zu mir gekommen war. Er hatte sich einen Computervirus eingefangen. Dieser war so hartnäckig, dass er sich mit den aktuellen Anti-Viren-Programmen nicht löschen ließ. Schweren Herzens entschied sich Fritz dazu, die Festplatte neu zu formatieren. Danach wollte er das System wieder neu aufspielen. Das Formatieren gelang zwar, aber hernach war die Festplatte nicht mehr ansprechbar. Verzweifelt kam Fritz daraufhin zu mir. Wenige Tage zuvor hatte ich die neueste Version der Norton-Utilities zugesandt bekommen. Es war das Beste, was es damals auf diesem Gebiet gab. Ich nahm die Diskette mit zu Fritz in der Absicht, die Festplatte ordentlich zu formatieren. Ich schob die 3,5-Zoll-Diskette in den Diskettenschacht und startete den PC. Von der Diskette wurden wichtige Teile des Betriebssystems geladen. Dann erschienen auf dem Bildschirm einige Fragen, die ich beantwortet habe. Dann war der PC ca. 5 Minuten beschäftigt. Schließlich hieß es, dass ich die Diskette entfernen und danach „Enter“ drücken solle. Ich tat es – und zu unser aller Verwunderung war der PC wieder in seinem alten Zustand, sogar ohne Virus. Diese Erfahrung brachte mir unter den Mitstudenten eine hohe Achtung ein, die ich jedoch an die Norton-Utilities weitergab. Sie waren es, die alles wieder gerettet haben.
1998 schloss ich mein Studium mit einer glatten 2,0 ab. Ich war kein Streber. Es gab Fächer, in denen ich sehr gut war. Bei anderen Fächern ging es mir rein ums „Überleben“, wie wir es damals sagten. Man muss das Studium bestehen, das war alles. In meinem Fachgebiet war es jedoch wichtig, dass ich die 1,0 erhielt. Durch viel Fleiß gelang mir dies auch.
Im Sommer 1998 „war ich dann mal weg“. Lange vor Hape Kerkeling pilgerte ich nach Santiago de Compostela. Ich wollte den gesamten Pilgerweg von Deutschland aus bis zum Jakobusgrab pilgern. Da mir jedoch nur 6 Wochen zur Verfügung standen, fuhr ich mit dem Fahrrad. Meine Route führte von Mannheim aus über Freiburg, Taizé, Cluny, Le Puy-en-Velay, Moissac, Oloron, Jaca, Burgos, Leon nach Santiago de Compostela. Von dort aus fuhr ich noch an das Cap Finisterre, den westlichsten Punkt des europäischen Festlands. Von Santiago aus ging es mit dem Flugzeug wieder zurück nach Deutschland, das Fahrrad im Laderaum.
Diese 6 Wochen haben mich sehr geprägt. Von großer Hitze mit über 40°C im Schatten, bis zum Schneeregen über den Cebreiro, einem über 1.400 m hohen Pass vor Santiago, erlebte ich alles. Hier zahlte es sich aus, dass ich mich vor dieser großen Reise gut informierte und gut beraten ließ. Ich wäre sonst nicht heil und gesund in Santiago angekommen.
Am 1.9.1998 trat ich meinen Ersatzdienst im Mannheimer Theresienkrankenhaus in der EDV-Abteilung an. Nachdem es den dortigen EDV-Leuten passiert war, dass sie zwar Datensicherungen durchgeführt hatten, aber keine dieser nach einem Schadensfall beim Zurückspielen funktionierte, wollte die Klinikleitung verhindern, dass diese Panne noch mal passierte. Daher war es ihnen wichtig, einen Mann in ihrer EDV-Abteilung zu haben, der für die Datensicherung fit ist. Da war ich genau der richtige Mann.
Da aber Datensicherung alleine in einer Klinik keine erfüllende Arbeit ist, wurde mir bald aufgetragen, für die Mitarbeiter einen E-Mail-Server einzurichten und die Homepage der Klinik zu erstellen. Damit war ich wirklich ausgelastet.
Der Retter in der Not
Wöchentlich ging ich noch ins Fitness-Studio. Ansonsten genoss ich mein Leben und meine Arbeitsstelle. Doch Freitag, der 23. April 1999 wurde ein wichtiger Tag für mich. OA Dr. Müller, ein Anästhesist (Narkosearzt) rief vormittags an und fragte, ob ich heute Abend Zeit hätte. Seine Tochter konnte ihren Laptop nicht mehr hochfahren. Sie kommt zwar noch zur Eingabe des Passwortes, aber dann ist es aus. Sie hat jedoch ihre Diplomarbeit für Neurologie auf dem Laptop und sollte diese bis zum Freitag, den 30. April abgegeben haben. Wie ich damals bei meiner Seminararbeit, hatte auch sie keine Datensicherung.
Ich sagte zu, nicht wissend, auf was ich mich damit eingelassen hatte. Dieser Abend wurde für mein Leben eine wichtige Weichenstellung, mit Folgen, die bis in die Gegenwart hinein reichen.
Ich klingelte gegen 19 Uhr bei der mir angegebenen Adresse. Dr. Müller öffnete mir und stellte mich gleich seiner Frau vor. „Das ist Herr Hirt, in unserer Klinik der Spezialist für Datensicherung. Er kann vielleicht die Datei von Gabis Diplomarbeit retten.“ Ich begrüßte beide freundlich. Dann war mir, als stünde hinter den beiden ein schwarz gelockter Engel. Mit langem gewelltem Haar, deutlich weiblichen Kurven, dazu noch Augen, die mich verzauberten. Ich weiß nicht, was ich damals sagte, ob ich überhaupt etwas sagte. Ich wusste nur, das ist die Frau meines Lebens. Bisher lächelte ich darüber, wenn andere Menschen von der „Liebe auf den ersten Blick“ sprachen. Ich sagte, man muss sich doch erst mal kennenlernen, muss erst mal einige Jahre zusammen gelebt haben, um zu wissen, ob man zueinander passt. Dieses Bild von Liebe war wie ein zu Boden gefallener Spiegel zerbrochen. Seit diesem Augenblick wusste ich, es gibt sie, die Liebe auf den ersten Blick.
Im Wohnzimmer kam die Ernüchterung, der Laptop. Sein Windows 95 fuhr ganz normal hoch, erlangte das Passwort und verlangte nach der Eingabe wieder das Passwort. Der Laptop schien in einer Endlosschleife der Passwortabfrage gefangen zu sein.
Ich gestand: „So etwas ist mir bislang noch nie untergekommen. Da hat sich jemand einen wirklich üblen Virus einfallen lassen, einen Computer, der sich nicht mehr anmelden lässt. - Da werde ich wohl die Festplatte ausbauen müssen.“
„Sie dürfen mit dem Computer machen, was Sie wollen, wenn Sie mir nur meine Diplomarbeit retten“, hauchte mein schwarzer Engel. Für mich klang es so wie, „Sie können mit mir machen, was Sie wollen, wenn Sie mich nur aus dieser Situation retten.“
Daten retten habe ich während meines Studiums auch gelernt. Daher wusste ich, worauf es ankommt und was für ein Werkzeug man dafür benötigt. Für dieses Problem brauchte ich einen Adapter, mit dem ich über die USB-Schnittstelle die ausgebaute Festplatte an meinen mitgebrachten Laptop anschließen konnte. Damit war es mir möglich, mit meinem Rechner auf die ausgebaute Festplatte zuzugreifen, so wie auf jede sonstige USB-Festplatte. Damit hatte ich vollen Zugriff auf die Festplatte.
Ich fragte: „Haben Sie einen USB-Stick, auf den ich Ihre Daten sichern kann?“
Ratlose Gesichter sahen mich an. „USB-Stick?“, fragte Dr. Müller schließlich. - Man bedenke, es war das Jahr 1999. USB-Sticks waren selten. Damit hatte ich schon gerechnet. Daher nahm ich meinen 512-MB-USB-Stick aus meiner Werkzeugtasche für den ich damals über 100 DM ausgegeben hatte. Heute erhält man einen USB-Stick dieser Größenordnung als Werbegeschenk.
Ich sicherte alle DOC-Dateien, die ich auf dem Rechner finden konnte. Weil noch reichlich Platz auf dem USB-Stick war, sicherte ich noch weitere Dateien, die ich in dem Benutzerkonto meines schwarzen Engels fand. Als dies abgeschlossen war, ging es daran, diese Dateien auf den PC von Dr. Müller zu übertragen. Gabi kontrollierte rasch die Dateien. Sie waren in Ordnung. Voller Freude umarmte sie mich und drückte mich fest.
Ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Ich hielt mich an ihr fest, denn ich war nahe dran, in Ohnmacht zu fallen oder vor Wohlempfinden langsam in den Boden zu versinken. Nach einer Weile, die mir wie eine Ewigkeit erschien und dennoch viel zu kurz war, sagte sie „Danke. Sie sind mein Retter in größter Not. Sie wissen gar nicht, wie wichtig mir diese Datei ist.“
Nachdem wir uns losgelassen hatten, sagte ich: „Mir ist etwas Ähnliches mit meiner Seminararbeit passiert. Allerdings musste ich sie neu schreiben.“
Gabi hierauf: „Dann können Sie erahnen, wie wichtig mir das Retten dieser Datei war.“
„Ja, das kann ich erahnen“, bestätigte ich.
Frau Müller erkannte wohl, was zwischen Gabi und mir gerade ablief. Daher sagte sie: „Ich hatte einen anstrengenden Tag. Ich werde mich zurückziehen. Euch beiden wünsche ich noch einen schönen Abend.“
Dr. Müller reagierte ähnlich: „Ich glaube, ich störe hier nur. Ich gehe mit Dir ins Bett, mein Schatz. Also einen schönen Abend euch beiden.“
Mit allem hatte ich gerechnet, aber nicht mit der Möglichkeit, gleich am ersten Abend mit meinem schwarzen Engel für Minuten oder gar Stunden alleine zu sein. Ich erinnere mich nicht mehr, was wir miteinander sprachen. Mir war dies in dieser Stunde auch gleichgültig. Mir war nur wichtig, mit Gabi zusammen zu sein.
Beim Verabschieden, es war nach Mitternacht, fragte ich: „Darf oder soll ich morgen Nachmittag wieder kommen, um mich zu vergewissern, dass mit dem Ausdruck der Diplomarbeit auch alles klappt?“
„Du darfst“, hauchte Gabi. - Sie hatte mich geduzt. Ich war ganz baff. Ich muss ein seltsames Gesicht gemacht haben, denn sie sagte weiter: „Ich heiße Gabi.“
„Ich heiße Niko“, brachte ich nur heraus, und nach einer Weile: „Dann bis morgen Nachmittag.“
„Ja, bis morgen Nachmittag“, bestätigte Gabi und schloss langsam die Haustüre.
Es war eine milde Nacht, fast schon zu warm für diese Jahreszeit. Vielleicht waren es auch meine Hormone. Ich hätte die ganze Welt umarmen können, so ein Glücksgefühl steckte in mir.
Am nächsten Tag besuchte ich wieder die Familie Müller. Gabi öffnete mir bereits die Haustür und umarmte mich. Strahlend sagte sie: „Ich konnte es gar nicht erwarten und habe gleich heute früh die Diplomarbeit ausgedruckt. Es ist alles da und fertig. Wir können somit heute Nachmittag spazieren gehen.“
Mit Gabi erlebte ich eine angenehme Überraschung nach anderen. Somit gingen wir an diesem sonnigen Nachmittag spazieren.
In den folgenden Monaten nahm ich sie mit ins Fitness-Studio. Sie nahm mich dafür jeden 2. und 4. Samstag im Monat mit zum Radfahren. Unter 100 km kehrten wir nie zurück. Meist wurden es über 200 km an einem Tag, insbesondere, wenn wir an Rhein oder Neckar entlang fuhren. Gabi und ich verbrachten eine schöne Zeit.
Zum 1.9.1999 trat Gabi ihre Stelle als Assistenzärztin an der Uni-Klinik in Heidelberg an.
Der große Wechsel
Der Jahreswechsel 1999 auf 2000 ist noch erwähnenswert, da es ein historisches Ereignis ist, das der heutigen Jugend völlig fremd ist, sie kann es sich gar nicht so recht vorstellen. Es war die Angst, dass die Computer beim Jahreswechsel von 1999 auf 2000 weltweit verrückt spielen würden. Einige Menschen hatten sogar die Sorge, dass Atomraketen von Ost und West in dieser Nacht automatisch starten und zu den eingegebenen Zielen fliegen würden. Für die Klinik wurden ähnliche Szenarien verbreitet, weswegen die ganze Mannschaft der EDV dazu verdonnert wurde, an Sylvester 1999 ab 23 Uhr in der Klinik zu sein. Vor 1 Uhr durfte keiner damit rechnen, nach Hause gehen zu können. Zuerst müsse von allen Stationen und Bereichen zurückgemeldet werden, dass alles in Ordnung ist. Anderenfalls müssten wir noch so lange bleiben, bis dieses Problem gelöst war. Die Sicherheit der Patienten hatte absolute Priorität. Diese eine Nacht hatten wir von der EDV als Notfall anzusehen, so wie ein Arzt zu einem Notfall gerufen wird.
Ende 1999 kursierte diese Geschichte durch das Internet: Gott hatte genug von den Menschen. Ihre Bosheiten waren noch schlimmer als zur Zeit Noach´s. Daher beschloss Gott die totale Vernichtung der Erde. Um den Menschen jedoch noch eine Chance zu geben, sich zu bekehren und zu ihm in den Himmel zu kommen, ließ er Boris Jelzin (Parteichef der Sowjetunion), Bill Clinton (Präsident der USA) und Bill Gates (Chef von Microsoft) zu sich kommen. Ihnen sagte er: „Mein Entschluss ist endgültig. Am 31.12.1999 wird um 24 Uhr die Erde vernichtet und alle Menschen werden sterben. Jetzt liegt es in eurer Hand, wie ihr noch möglichst viele Menschen in den Himmel bekommt. Dazu habe ich euch, die drei wichtigsten Männer, zu mir gerufen.“ - Jelzin ordnete nach seiner Rückkehr in Moskau einen Sonderparteitag an und sagt: „Ich habe zwei schlimme Nachrichten: Gott gibt es wirklich. Ich habe persönlich mit ihm gesprochen. Und zweitens: Gott wird die Erde am 31.12.1999 um 24 Uhr zerstören.“ - Bill Clinton sagt zu seinen Beratern: „Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist: Gott gibt es wirklich. Ich habe persönlich mit ihm gesprochen. Die schlechte Nachricht ist: Gott wird am 31.12.1999 um 24 Uhr die Erde zerstören.“ - Bill Gates nutzt alle seine Möglichkeiten und bringt in alle Welt zwei gute Nachrichten hinaus: „Erstens: Bill Gates gehört zu den drei wichtigsten Menschen der Welt. Zweitens: Das 2000-Problem ist gelöst.“
In der Sylvesternacht geschah nichts Aufregendes. Einige medizinische Geräte hatten an Neujahr das Datum 1.1.0000 oder 1.1.1972 oder eine andere Jahreszahl. Ansonsten ist in dieser Nacht nichts Aufregendes geschehen, weder in unserer Klinik noch in der Welt.
Als die Zeit meines Ersatzdienstes auslief, wurde ich vom Leiter der EDV gefragt, ob ich denn nicht als Fachkraft in der Klinik bleiben wolle. Ich hatte mich so gut in das Team wie auch in diese Tätigkeiten eingearbeitet. Man bot mir sogar im Falle meiner Zusage sofort einen unbefristeten Arbeitsvertrag an.
Ich hatte mir den Einstieg ins Berufsleben gar nicht so einfach vorgestellt. Ich musste keine Bewerbungen schreiben, sondern bekam einfach eine Stelle angeboten. Mein Leben verlief noch besser, als in einem Wunschkonzert, denn noch ehe ich mich um etwas kümmerte, da war es mir bereits geschenkt. Zuerst Gabi und nun diese Arbeitsstelle. Ich nahm das Angebot an.
Abends telefonierte ich zuerst kurz mit meinen Eltern, denn die hatten die Hoffnung, dass ich wieder in die Gegend um Bonn zurückkommen würde. Dieser Traum war mit der Annahme dieser Arbeitsstelle geplatzt. Einerseits freuten sie sich, dass ich eine Arbeit habe, die mir Spaß macht und Kollegen, mit denen ich mich gut verstehe, dazu noch die feste Freundschaft mit Gabi hier vor Ort. Andererseits schmerzte sie diese Trennung. Mich schmerzte es, ihnen diesen Schmerz zufügen zu müssen, denn dies war für mich sicherlich die richtige Entscheidung. Irgendwann würde ich ja eine Familie gründen. Dann wäre ich sowieso nur noch zu Besuch bei meinen Eltern.
Später rief ich bei Gabi an. Sie hatte diese Woche Spätschicht und kam damit erst nach 22 Uhr nach Hause. Ich fragte sie, ob ich noch kurz zu ihr kommen könne. Ich durfte. Freudig fuhr ich mit dem Fahrrad zu ihr. Ich wusste, was ich ihr sagen wollte, aber ich wusste nicht, wie.
Als wir uns gegenüber standen, fragte ich sie: „Gabi, willst Du meine Frau werden?“
Sie schien mit Vielem gerechnet zu haben, aber nicht mit einem Heiratsantrag. Nüchtern, sachlich, wie Gabi sein konnte sagte sie mir: „Aber Niko, Du hast ja noch keinen rechten Arbeitsplatz. Wovon sollen wir leben?“
Da strahlte ich sie an und antwortete: „Das war noch gestern. Heute wurde mir in der Klinik ein unbefristeter Arbeitsvertrag angeboten. Ich kann nach Ende meines Ersatzdienstes sogleich in der EDV-Abteilung bleiben und die gleiche Arbeit machen wie bisher, nur dann mit ordentlichem Lohn.“
Da leuchteten auch die Augen von Gabi auf. „Oh, Niko“, hauchte sie, „gerne werde ich deine Frau, sehr gerne.“ Mit diesen Worten nahm sie mich in den Arm, drückte mich kräftig und gab mir einen dicken Kuss.
Ein höchst angenehmes Prickeln durchfuhr meinen ganzen Körper, von den Haarspitzen bis zur Fußsohle. Es war ein schönes Gefühl. Ich vergaß alles um uns herum.
„Darf ich an euer beider Glück teilhaben“, hörte ich irgendwann die Stimme von Frau Müller. Da wurde mir bewusst, dass Gabi und ich nicht mehr alleine waren. Noch ehe ich etwas sagen konnte, antwortete bereits Gabi voller Glückseligkeit: „Niko bekam heute von der Klinik einen unbefristeten Arbeitsvertrag angeboten und hat mir aus diesem Anlass einen Hochzeitsantrag gemacht.“
„Und?“, fragte Frau Müller nach.
Gabi und ich verstanden die Frage nicht.
„Und?, wiederholte Frau Müller, „Wie war Deine Antwort darauf?“
Schlagfertig, wie Gabi sein konnte, sagte sie: „Das hast Du ja soeben gesehen.“
„Dann meinen herzlichen Glückwunsch zu eurem gemeinsamen Lebensweg“, sagte sie und reichte uns dabei die Hand zum Glückwunsch. „Möget ihr beide gemeinsam alt und glücklich werden.“
„Danke, Mutti“, kam von Gabi.
„Danke, Frau Müller“, kam von mir.
„Dann will ich mal zu meinem Mann gehen und ihm sagen, dass wir nun auch einen Sohn haben“, sagte Frau Müller, und noch ehe Gabi oder ich was sagen konnten, ergänzte Frau Müller: „einen Schwiegersohn.“
Bei diesen Worten drückte sie mich ganz fest an ihre großen Brüste, die ich deutlich durch Hemd und Jacke spüren konnte. Danach verschwand sie und kam mit einem verschlafenen Dr. Müller im Morgenmantel zurück.
„Welch freudige Nachricht riss mich aus dem Schlaf? Ist das richtig, was meine müden Ohren da vernommen haben?“, fragte er fast schon theatralisch.
„Es stimmt, Vater. Niko und ich wollen heiraten“, bestätigte Gabi.
„Na, darauf wollen wir doch eine Flasche Sekt trinken“, sagte Dr. Müller, und noch ehe ich einwenden konnte: „Ich weiß, dass du, lieber Schwiegersohn keinen Alkohol trinkst, ebenso wie auch Gabi, aber zur Feier dieses Tages werden wir zu viert doch wohl einen Piccolo leeren können?!“
„Einverstanden“, stimmten Gabi und ich im Chor zu.
„Ich geh’ mal schnell in den Keller, und hole die Flasche“, sagte Dr. Müller.
„Und ich hole schnell vier Gläser, damit wir auch miteinander auf eure gemeinsame Zukunft anstoßen können“, sagte Frau Müller und verschwand in der Küche.
Sofort legte Gabi ihre Arme um meinen Hals. Wir sahen uns nur stumm und glücklich an. Manchmal rieb Gabi ihre Nase an meiner Nase. Auch dies war eine Form von Zärtlichkeit, die ein angenehmes Prickeln in mir auslöste.
Dann waren Herr und Frau Müller mit ihren mitgebrachten Utensilien da. Dr. Müller schenkte ein, zuerst Gabi und mir ein paar Tropfen zum Anstoßen, für seine Frau und sich je die Hälte des Piccolo.
„Auf eine glückliche gemeinsame Zukunft für euch beide“, prostete uns Dr. Müller zu.
„Ja, auf eine glückliche und gemeinsame Zukunft für euch beide“, bestätigte Frau Müller.
Mit diesen Worten stießen wir miteinander an. Dann sagte Dr. Müller: „Ich heiße Rudi.“ „Und ich heiße Elfriede“, machte Frau Müller weiter. Und ich sagte: „Ich heiße Niko.“
„Herzlich willkommen ins unserer Familie, Niko“, freute sich Rudi ersichtlich.
„Und wann können wir Deine Eltern kennenlernen?“, fragte Elfriede interessiert.
„Ich würde sagen, so schnell wie möglich“, antwortete ich.
„Das wäre schön. Ich freue mich schon sehr darauf, auch deine Eltern kennen zu lernen“, sprach Gabi in spürbar freudiger Erwartung.
Am nächsten Abend rief ich wieder bei meinen Eltern an und erzählte davon, dass ich Gabi einen Heiratsantrag gemacht habe, den sie freudig angenommen hatte. Nun will Familie Müller Familie Hirt kennenlernen. Wir machten einen Termin für das kommende Wochenende aus. Da sollte im kleinen Rahmen Verlobung gefeiert werden.
Der freundlichen und gastlichen Art der Familie Müller konnte selbst meiner Mutter nicht widerstehen. Bei ihr hatte ich die Sorge, dass sie die Haltung an den Tag legen könnte, dass Gabi mich ihr weggenommen haben könnte. Doch kein Wort kam aus dieser Richtung. Im Gegenteil, meine Mutter war erfreut, dass sie nun eine Tochter in die Familie bekam.
Familiengründung
Gabi und ich hatten es nicht eilig. Wir vertrauten uns gegenseitig. Wir hatten beide ein gemeinsames Ziel, das wir Schritt für Schritt angehen wollten. Zunächst suchen wir uns eine Wohnung aus, die für unsere Familie groß genug sein würde. Beide träumten wir von drei bis vier Kindern. Daher sollte die Wohnung mindestens zwei Kinderzimmer haben. Eines würden wir immer wieder als Gästezimmer für meine Eltern brauchen. Auch sollte ein Kinderspielplatz oder einfach nur Natur in der Nähe sein. Das war uns auch sehr wichtig. Eine Bus- oder Straßenbahnhaltestelle in der Nähe wäre natürlich auch nicht schlecht.
Auch hier war uns das Glück hold. Bereits die 5. Wohnung, die Gabi und ich uns ansahen, gefiel uns sehr. Sie lag zwar im 4. OG, unter dem Dach, ohne Aufzug, im Altbau, aber außen wie innen sehr gut hergerichtet. Auch der Preis war für uns erschwinglich. Frau Schmidt, der Vermieterin, gefiel es, dass hier ein junges Paar einziehen wollte. Dies drücke Beständigkeit und Zukunft aus. Da ihre Ehe leider kinderlos blieb und ihr Mann 1998 starb, freute sie sich darauf, bei uns so etwas wie Ersatz-Oma sein zu können. Ich hatte den Eindruck, dass sie unsere Kinder schneller haben wollte, als wir selbst. Die anderen Stockwerke waren als Büroräume ausgebaut. Dadurch war zwar tagsüber viel Geschäftigkeit, aber nachts und am Wochenende hatten wir unsere Ruhe. Umgekehrt würden unsere Kinder, wenn sie mal nachts schreien, niemanden stören.
Für den 4. Mai 2002 setzten wir unsere Hochzeit an. Voller Freude planten und organisierten wir seit Herbst 2001 auf diesen Termin hin. Es sollte der schönste Tag in unserem Leben werden. Vom 1. bis 26. Mai nahmen wir beide Urlaub, damit wir mit möglichst wenig Urlaubstagen möglichst lange zusammen sein konnten.
Die Hochzeit verlief traumhaft. Gabi war für mich immer mein schwarz gelockter Engel, ob in Rock, Kleid oder Hose. Sie war einfach toll gekleidet. Doch in ihrem weißen Brautkleid, mit dem sie mich vor der Kirche überraschte, da war sie gänzlich wie ein Wesen aus einer anderen Welt. Fast getraute ich nicht, sie anzufassen, aus Angst, dass dann dieser schöne Traum wie eine Seifenblase zerplatzen könnte.
Es war ein wirklich schönes Fest mit unseren Familien und Freunden. Gabis Professor aus der Uni-Klinik Heidelberg kam sogar zusammen mit einigen Ärzten und Schwestern aus ihrer Klinik. Von meiner Klinik kamen alle vier Mann der EDV, auch mein Chef. Es war ein rundherum schönes und harmonisches Fest. Es fiel kein schiefes Wort. Wir erhielten zahlreiche Glück-und Segenswünsche. Gegen 1 Uhr morgens verabschiedeten wir uns vom harten Kern, der noch zusammensaß.
Gabi und ich schliefen am Sonntag noch bis Mittag. Dann frühstückten wir gemütlich, um danach mit dem Zug zum Flughafen zu fahren. Mit dem Flugzeug ging es dann ab nach Mallorca. Mir war, als hätte Petrus es nicht nur am Samstag bei der Hochzeit mit einem sonnigen, aber nur warmen Tag gut mit uns gemeint, er bescherte uns beim Anflug auf Mallorca mit einem herrlichen Sonnenuntergang über den Wolken ein herrliches Geschenk. Ich hatte so etwas noch nie erlebt. Die Sonne verschwand hinter dem Horizont und die zuvor noch weißen Wolken wurden ein herrlich aufgelockerter roter Wolkenteppich.
Auf Mallorca erlebten Gabi und ich herrlich schöne Tage. Mal in den steilen Bergen, mal am herrlichen Sandstrand, mal im Landesinneren. Vor allem genossen wir die gemeinsame Zeit. Immer wieder stellten wir fest, wie gut Gabi und ich miteinander harmonierten. Seit wir uns kannten, gab es nie ein ungutes Wort. Das heißt nicht, dass wir auch mal verschiedener Meinung waren, das akzeptierten wir. Keiner von uns versuchte dann, den anderen auf seine Seite zu ziehen. Gefühle wie Freude und Enttäuschung sprachen wir an, sowie sie uns bewusst wurden. Damit wurde alles wieder gut.
Nach Deutschland zurückgekehrt, kam ich mir vor, als hätte man Gabi und mich aus dem Paradies geworfen. Die Arbeitswelt mit ihren Anforderungen hatte uns Ende Mai ganz schnell und unbarmherzig wieder. Bei Georg, den Stellvertreter im EDV-Team, wurde vor 2 Wochen Lungenkrebs festgestellt. Es wurde bei einer routinemäßigen Blutuntersuchung festgestellt, dass die Tumormarker stark überhöht waren. Er wurde sofort nach Heidelberg verlegt. Dort wurde klar, dass eine Operation nicht in Frage kommt. Wenn, dann hilft nur noch Chemotherapie. Die Chancen stünden sehr schlecht. Selbst wenn es Georg überleben wird, so würde er mindestens ein ganzes Jahr ausfallen, bevor er wieder zur Arbeit zurück kommen kann.
Das Angebot
Im Juni holte mich Hans-Peter zu einem Gespräch in sein Büro. Er wolle in Urlaub fahren und ich solle kommissarisch die Leitung der EDV übernehmen. Ob ich dafür bereit sei. Die Entscheidung müsse noch diese Woche gefällt werden. Ich wollte mich nicht so schnell entscheiden, da ich ahnte, was damit auf mich zukäme. Hans-Peter ist im Urlaub und Georg ist dauerhaft krank. Die verbleibende Mannschaft, drei von fünf, hatten den alltäglichen Betrieb zu schultern. Wenn dann noch einer krank würde, stünden nur noch 40% der Manpower zur Verfügung. Das war ein sehr dünnes Eis. - Andererseits würde ich damit bei meinem Chef punkten und vielleicht dauerhaft sein Stellvertreter werden. Das war sehr verlockend.
Während mir noch diese Gedanken durch den Kopf schossen, sagte Hans-Peter: „Ich werde mich im Falle deiner Zustimmung bei der Klinikleitung dafür einsetzen, dass Du für diese Zeit nicht nur den Titel bekommst, sondern auch das entsprechende Geld.“
Verlockend, dachte ich, aber ich habe dann nicht nur Titel und Geld, sondern auch Mehrarbeit. War es mir das wert? Ich blieb hart: „Ich danke Ihnen für dieses wirklich verlockende Angebot. Ich sehe auch die Notwendigkeit eines solchen Schrittes. Ich will aber dennoch gerne eine Nacht darüber schlafen. Ich sage Ihnen morgen Bescheid.“
Zuhause erzählte ich es Gabi. Diese motivierte mich dazu, das Angebot anzunehmen. Wir hatten noch keine Kinder und das Geld könnten wir gut gebrauchen. Schließlich sei es nur für die Monate von Georgs Erkrankung.
Ich stimmte somit am nächsten Tag zu. Hans-Peter war glücklich, doch ich hatte ein ungutes Gefühl. Bevor Hans-Peter in seinen Urlaub fuhr, wies er mich in alle Bereiche ein, die er für wichtig erachtete. Er gab mir auch seine private Handy-Nummer, für den Fall, dass ich irgendwelche Fragen hätte. - Dies beruhigte mich, aber das ungute Gefühl blieb.
Hans-Peter ging für vier Wochen in Urlaub. In der 1. Woche war noch alles normal. Mitte der 2. Woche gab der E-Mail-Server den Geist auf. Die Daten waren zwar auf zwei Festplatten gespiegelt, d.h. doppelt vorhanden, aber der Rechner musste ausgetauscht werden, damit die Klinik möglichst rasch wieder per E-Mail erreichbar war bzw. auch selbst E-Mails schreiben konnte. Dies kostete mich eine Nachtschicht bis 2 Uhr Donnerstagmorgen. Danach lief wieder alles, aber ich war platt. Der Rest der Woche verlief ohne weitere Probleme.
In der 3. Woche gab es ein neues Problem. Irgendjemand hatte sich einen Virus eingehandelt und damit den ganzen E-Mail-Server infiziert. Da es ein neuer Virus war, erkannte unser Anti-Virus-Programm den Virus nicht. Was noch schlimmer war: Es gab noch keinen Hinweis, wie man diesen Virus wieder los wird. Die einzige Möglichkeit, die ich sah: die beiden befallenen Festplatten ausbauen, neue Festplatten einbauen und das Backup der letzten Woche wieder aufspielen. Damit sind die seither eingegangenen E-Mails verloren. Eine der beiden befallenen Festplatten sandte ich an den Hersteller unserer Anti-Viren-Software zur Untersuchung. Diese Arbeit kostete mich einen ganzen Arbeitstag.
Am nächsten Tag war dieser Virus auch auf den neu aufgespielten Daten. Mir schwante, wie der Virus programmiert wurde: Er verbreitete sich als Schläfer, ohne aktiv zu werden. Wenn ein vorgegebenes Datum oder eine bestimmte Bedingung erreicht war, wird er aktiv und schlägt zu. Damit hatte auch die Datensicherung der letzten Woche bereits den Virus. Ich hatte keine Ahnung, wie lange der Virus schon auf dem E-Mail-Server geschlummert hatte, ohne Schaden anzurichten.
Um auf der einen Seite den Virus auszutricksen und andererseits den Schaden möglichst gering zu halten, entschied ich mich, das Datum des E-Mail-Servers um ein ganzes Jahr zurück zu setzen. Damit schaffte ich und dem Anti-Viren-Programm ein ganzes Jahr Zeit. Somit setzte ich das Backup neu auf – und hatte Glück. Der Virus trat nicht wieder auf. Die restliche Zeit des Urlaubs von Hans-Peter blieb es ruhig. Ich sah jedoch, wie schnell alles anders werden konnte.
Im August erhielten wir ein Update des Anti-Viren-Programms, das den Virus entfernen konnte. Danach setzten wir das Systemdatum des E-Mail-Servers wieder auf 2002. Niemand aus der Klinik meldete in diesen Wochen, dass die E-Mails das falsche Jahr anzeigten. Vielleicht hatte das auch niemand mitbekommen.
Auch Gabi und ich hatten etwas nicht mitbekommen. Gabi war schwanger. Der erste Ultraschall beim Frauenarzt zeigte bereits deutlich das schlagende Herz des neuen „Untermieters“. Gabi und ich waren überglücklich über diese Nachricht. Damit würde unsere eigene Familie beginnen. Der errechnete Geburtstermin war der 22.2.2003.
Gabi erging es prächtig. Sie hatte keine morgendliche Übelkeit wie andere Frauen zu Beginn der Schwangerschaften. Sie spürte zwar die Anspannung in ihren Brüsten und ein angenehmes Glücksgefühl, das wohl von der Hormonumstellung herrührt. Daher genossen wir beide die Zeit der Schwangerschaft.
Über Weihnachten und Neujahr luden wir meine Eltern zu uns ein. Sie sollten an unserem wachsenden Glück einige Tage Anteil haben. Sie waren dafür sehr dankbar. Somit konnten sie auch mehr die Familie Müller kennenlernen. Meine Eltern freuten sich sehr auf ihr erstes Enkelkind. Der schwangere Bauch von Gabi war inzwischen nicht zu übersehen. Wir erlebten schöne Tage. Am Sonntag, den 12. Januar 2003, reisten meine Eltern nach Rheinbach zurück.
Der Tod klopft an
Am Mittwoch, den 15. Januar, bat mich Hans-Peter in sein Büro. Bereits anwesend war Frau Bauer, Georgs Frau. Ihr Gesichtsausdruck verhieß nichts Gutes. Sie erzählte uns, dass man bei einem Ganzkörperscreening am 27. Dezember im ganzen Körper ihres Mannes Metastasen festgestellt hat. Zur Absicherung entnahm man am 30. Dezember an einigen Stellen Gewebeproben. Diese bestätigten, dass es sich um Metastasen des Lungenkrebses handelt. Die Metastasen gibt es auch im Kopf. Jede weitere Therapie wurde daraufhin eingestellt, da sie Georg nur unnötig belasten würde. Er wird nur noch palliativ behandelt, d.h. es werden die Symptome behandelt, um Lebensqualität zu erlangen. Die Lebenszeit wird von den Ärzten in Wochen bis wenigen Monaten eingeschätzt. Damit war klar, dass Georg nicht wieder in die Arbeit zurück kommen würde.
Hans-Peter und ich waren zunächst völlig sprachlos, als wir das hörten. Dann sagte ich: „Es tut mir sehr Leid, dass der Krebs so aggressiv ist und Georg nicht geheilt werden kann. Können wir irgend etwas für Sie oder Georg tun?“
„Wenn sie ihn immer wieder besuchen würden, täte es ihm sicherlich gut. Er hat sich hier im Team sehr wohl gefühlt“, antworte Frau Bauer. „Und was können wir für Sie tun?“, fragte Hans-Peter weiter. „Im Moment habe ich noch Georg“, antwortete Frau Bauer. „Wie es mir aber nach seinem Tod geht, das weiß ich heute noch nicht.“ „Darüber reden wir, wenn es soweit ist“, sagte Hans-Georg darauf und machte das Angebot. „Sie können jederzeit bei uns anrufen, auch privat. Wir sind für sie da.“ „Ja, das sind wir“, bestätigte ich.
„Wie geht es mit Georg weiter? Ist er noch in der Klinik?“, fragte Hans-Peter. „Georg ist noch in der Klinik“, antwortete Frau Bauer. „Er wird noch medikamentös eingestellt, dann wird er nach Hause entlassen. Er will nicht in einem Hospiz sterben, sondern bei uns Zuhause. Wenn ich pflegerische Hilfe brauche, bekomme ich sie vom ambulanten Pflegedienst. Dieser ist bereits informiert, aber noch geht es ohne. Wenn alles klappt, soll er am Wochenende entlassen werden. So sieht es im Augenblick aus.“
„Wir werden Georg immer wieder besuchen, solange er lebt. Er war ein tolles Teammitglied und die Klinik hat ihm vieles zu verdanken“, sagte Hans-Peter zu. Frau Bauer bedankte sich für diese Worte, verabschiedete sich.
Da saßen Hans-Peter und ich und mussten das Gehörte erstmal verdauen. „Da arbeiten wir in einer Klinik, in der Sterben zum Alltag gehört. Doch diese Toten sind nur reine Zahlen. Wenn es jedoch einen Menschen trifft, den man kennt, an dessen Leben man Anteil nimmt, sieht es plötzlich ganz anders aus. Die Ehe von Georg blieb kinderlos. Seine Frau tat sich sehr schwer, dass sie nicht schwanger wurde. Den Antrag auf Adoption haben sie zu spät eingereicht. Sie waren zu alt dafür. So ist es eben, wenn man kein Bundeskanzler ist.“ „Was hat das mit dem Amt eines Bundeskanzlers zu tun?“, wollte ich wissen.
Hans-Peter klärte mich auf: „Der 1944 geborene Gerhard Schröder will ein russisches Kind adoptieren. Dabei wird er nächstes Jahr 60. Normalen Bundesbürgern wird mit 50 Jahren eine Adoption verweigert. Bereits mit 40 Jahren wird es ihnen schwer gemacht. Aber wenn man Bundeskanzler ist, gelten diese Regeln nicht mehr, dann scheint man über dem Gesetz zu stehen.“5
„Das habe ich gar nicht so bewusst mitbekommen“, gestand ich.
„Das haben viele Menschen nicht so bewusst mitbekommen“, tröstete mich Hans-Peter und machte mit Georg weiter: „In fünf Jahren wäre Georg in Rente gegangen. Er und seine Frau wollten danach reisen und die Welt ansehen. Durch ihrer beiden soziales Engagement nahmen sie sich nie die Zeit dafür. Georg wollte sich ein Wohnmobil kaufen und mit seiner Frau zu schönen Plätzen der Erde fahren. In den letzten Jahren hatte Georg begonnen, auf diesen Traum hin zu leben.“
„Und jetzt? Aus der Traum, wie eine Seifenblase zerplatzt“, sagte ich.
„Das kann man wohl sagen“, bestätigte Hans-Peter und wurde dann sachlich: „Wie machen wir es mit den Besuchen? Ich schlage vor, dass wir uns dabei abwechseln. Wenn es Georg nicht zu viel wird, geht jeder von uns beiden dreimal die Woche zu ihm. Wenn er nicht mehr ansprechbar ist, wollen wir für seine Frau Ansprechpartner sein.“
„Dies halte ich für einen guten Vorschlag“, antwortete ich und fragte: „Welche Tage willst Du übernehmen?“ „Ich hätte gerne Montag, Mittwoch und Freitag“, gab Hans-Peter kund. „Das ist mir sehr recht. Dann nehme ich Dienstag, Donnerstag und Samstag.“ „Den Sonntag können wir uns nach Belieben einrichten. Und wenn wir uns dann bei Georg treffen, ist das nichts Schlechtes“, fuhr Hans-Peter fort.
„Ich werde unserem Personalchef hiervon berichten. Vielleicht besucht der auch mal Georg. Wichtiger ist es mir jedoch, dass er dich fest auf die Stelle meines Stellvertreters einsetzt“, sprach Hans-Peter ein anderes Thema an. Ich bedankte mich dafür. Faktisch war ich bereits seit Georg’s Erkrankung sein Stellvertreter und hatte alle Anforderungen zu seiner Zufriedenheit gelöst.
So verblieben wir und machten uns wieder an die Arbeit. Das Gespräch hing mir jedoch noch lange nach. Da arbeitete man sein ganzes Leben lang, freut sich auf den Ruhestand und kurz davor ist dann plötzlich das Leben zu Ende. Der Traum, auf den man hingelebt hatte, kann nicht mehr gelebt werden.
Abends erzählte ich Gabi von dem Gespräch. Sie wollte gerne auch immer wieder zu diesen Krankenbesuchen mitkommen und als Frau auch für Frau Bauer da sein. Ich besuchte meist wöchentlich drei bis vier Mal Georg. Am 17. Januar kam Georg nach Hause. In seinem Schlafzimmer wurde eigens ein Pflegebett aufgestellt. Am Sonntag, den 19. Januar nahm ich Gabi erstmals mit zu dem Besuch. Frau Bauer störte es überhaupt nicht, dass Gabi hochschwanger mitgekommen ist. „Ihre Schwangerschaft tut mir richtig gut, denn es zeigt mir, dass das Leben weiter geht. Wir alle sind nur Gast auf Erden, wie es in einem Kirchenlied heißt. Das vergessen wir nur zu häufig. Bitte kommen sie öfters mit. So kann ich an Ihrer Schwangerschaft Anteil nehmen, was mir leider nicht gegönnt war“, sagte Frau Bauer.
Die beiden Frauen verstanden sich prächtig, obwohl Gabi fast die Tochter von Frau Bauer hätte sein können. So kam es, dass Gabi bei den meisten Besuchen mit dabei war. Während ich mit Georg redete, verschwanden die beiden Frauen meist im Wohnzimmer.
Sonntagnachmittag, den 2. Februar, die Sonne ging mit einem herrlichen Abendrot unter, verstarb Georg. Sein Atem wurde immer flacher, bis er schließlich nicht mehr atmete. Sein Herz schlug noch etwa eine Minute weiter. Dies konnte ich an seiner pochenden Halsschlagader deutlich sehen. Dann regte sich nichts mehr. Trotz ihres dicken Bauches nahm Gabi Frau Bauer in den Arm und drückte sie.
Frau Bauer rief den Hausarzt, der wenig später kam, den Tod bestätigte und den Totenschein ausfüllte. Frau Bauer wollte den Leichnam erst am Montag abholen lassen. Diese eine Nacht wollte sie noch mit ihrem Mann zusammen sein. Wir blieben bis in die Nacht hinein bei Frau Bauer, bis wir uns verabschiedeten.
Die Beerdigung wurde auf Freitagnachmittag festgelegt. Obwohl Georg und seine Frau Einzelkinder waren und keine große Verwandtschaft hatten, war es eine sehr große Beerdigung. Die Trauergäste kamen aus allen Gruppen, in denen Georg und seine Frau tätig waren. Von der Klinik waren das ganze Team der EDV, ein Vertreter des Betriebsrats und der Personalchef gekommen.
Am Sonntag sprachen Gabi und ich über die anstehende Geburt. Dass es eine Hausgeburt werden sollte, war von vorne herein klar. Die begleitende Hebamme war bereits ausgewählt. Dass ich dabei sein sollte, war auch klar. Doch nun gab es für mich eine Überraschung: Gabi hatte Frau Bauer angeboten, auch mit bei der Geburt dabei zu sein. Sie sollte in ihrem Leben einmal live miterleben, wie eine Geburt abläuft. Frau Bauer hatte dankend angenommen.
Ich hatte bereits mitbekommen, dass sich Gabi und Frau Bauer gut verstanden, dass dies jedoch so weit ging, überraschte es mich. Es brauchte Zeit, bis ich dies verarbeitet hatte. Schließlich war für mich die Geburt etwas sehr persönliches und Intimes. Dazu noch eine Frau mitzunehmen, die man erst seit wenigen Wochen näher kennt, war mir doch zu viel. Ich werde es als Mann wohl nie verstehen, was da zwischen Frauen ablaufen kann.
Ich stimmte schließlich aus dem Hintergrund zu, da Frau Bauers Mann erst kürzlich verstorben ist und es ihrer Trauer gut tut, bei der Geburt unseres ersten Kindes mit dabei zu sein. Das Geschlecht des Kindes wusste zwar der Frauenarzt, aber wir wollten es nicht wissen. Wir wollten uns, wie alle Generationen vor uns, bei der Geburt über das Geschlecht überraschen lassen. Gabi und ich hatten uns nur über den Namen geeinigt. Falls es ein Junge wurde, sollte er Peter heißen, ein Mädchen hingegen sollte Petra heißen.
Am Samstag, den 22. Februar, war es schließlich so weit. Morgens, noch im Bett, platzte die Fruchtblase. Bald darauf setzten die Presswehen ein. Gabi rief sofort Frau Bauer und danach die Hebamme an. Beide waren bald da. Noch am Vormittag war unsere Tochter Petra geboren. Sie war wie eine Kopie von Gabi. Augen, Nase, Ohren, es stimmte alles überein.
Gabi und ich waren sehr froh über diese Geburt unseres ersten Kindes. Frau Bauer war sehr dankbar, dass sie bei dieser Geburt dabei sein durfte. Noch am Nachmittag kam sie und brachte Gabi einen schönen Blumenstrauß und mir ein kleines Büchlein als Dankeschön für die Erlaubnis, dass sie diese Geburt miterleben durfte. In ihren Augen war keine Trauer über den Tod ihres Mannes, sondern Freude über Petras Geburt. Da erkannte ich, dass es die richtige Entscheidung war, Frau Bauer bei Petras Geburt dabei zu lassen. Frau Bauer hatte für Stunden die Trauer um ihren Mann vergessen können. Vielleicht hielt dies noch einige Tage an. Ich wünschte es ihr.
Auch unsere Vermieterin, Frau Schmidt, kam noch am Nachmittag mit einem Blumenstrauß für Gabi. Auch sie freute sich sehr über die Geburt unserer ersten Tochter. Sie bot sich als Babysitterin an. Wir bedankten uns dafür. Wir würden sicherlich auf ihr Angebot zurück kommen.
Die nächsten Monate verliefen ohne nennenswerte Ereignisse. Petra wuchs heran und wir erfreuten uns an ihr. Im Sommer machten wir drei Wochen Urlaub auf einem Campingplatz an einem Baggersee. Dort konnte man ein Zimmer eines Bungalows anmieten. Wir erlebten einen herrlichen Urlaub. Petra war vom Wasser ganz fasziniert. Sie hielt sich gerne am Ufer auf, ohne wirklich ins Wasser zu gehen. Mit ihren kleinen Händen platschte sie immer wieder in das flache Wasser und freute sich riesig, dass das Wasser so spritzte.
Es war schön, mitzuerleben, wie sehr sich Petra über so eine Kleinigkeit freute. Es machte mir deutlich, wie hoch die Wünsche von uns Erwachsenen oft waren. Ein Highligth musste dem anderen folgen. So einfache Freuden wurden von uns Menschen gar nicht gesehen.
In der EDV-Abteilung wurde ein neuer Mitarbeiter eingestellt. Auch er hieß Georg. Der Zufall wollte es so. Er übernahm rasch die Aufgaben des verstorbenen Georg. Der stellvertretende Leiter blieb jedoch ich. Alles verlief gut.
Im Dezember 2003 kündigte sich unser zweites Kind an. Der errechnete Geburtstermin war der 10. Juli 2004. Damit fiel die Geburt mitten in die Sommerhitze. Das konnte was werden. Petrus hatte jedoch Mitleid mit Gabi. Nach der Sommmerhitze im Juni ließ er es Anfang Juli abkühlen. Darüber war Gabi sehr froh. Sonntag, der 4. Juli begann morgens um 4 Uhr mit einem Gewitter. Bei einem nahen Blitzeinschlag platzte die Fruchtblase. Gabi rief wieder die Hebamme an. Sie war kurz darauf da. Am Vormittag entband Gabi wieder eine Tochter. Wir hatten uns auf Lisa geeinigt.
Nun luden wir meine Eltern für einige Wochen zu uns ein. Sie freuten sich auch sehr über unseren Familienzuwachs. Auch Frau Schmidt und Frau Bauer freuten sich über diese Geburt. Auch freuten sie sich darüber, dass sie weiter Babysitter sein konnten.
Die Zeit verstrich. Über Weihnachten und Neujahr kamen wieder meine Eltern zu uns zu Besuch. Zusammen mit Gabis Eltern feierten wir den Jahreswechsel. Ende März 2005 wurde OA Dr. Müller in den Ruhestand verabschiedet. Er hatte damit mehr Zeit für seine beiden Enkeltöchter, die er sichtlich genoss.
Ende Mai kündigte sich unser drittes Kind an. Als Geburtstermin wurde der 20. Dezember errechnet. „Etwas später, dann könnte es ein Christkind werden“, meinte ich sofort. „Wer weiß, vielleicht gibt es eine kleine Verzögerung und es wird der 24. Dezember“, sagte Gabi sofort darauf.
Wieder verbrachten wir drei Wochen Urlaub am Baggersee. Es war eine herrliche Zeit. Petra verstand sich prächtig mit Lisa und war sehr besorgt um sie.
Es kam der 20. Dezember, aber es kam kein Kind. Ich hatte die Hoffnung, dass es der 24. oder 25. Dezember werden würde. Dieses stille Gebet wurde erhört. Am Nachmittag des 24.12. platzte die Fruchtblase. Um 23 Uhr wurde unser Sohn Lukas geboren. Wir einigten uns auf diesen Namen, weil der Evangelist Lukas von der Geburt Jesu berichtet.
Wie die Jahre zuvor, waren auch in diesem Jahr meine Eltern über Weihnachten und Neujahr zu Besuch bei uns. Mit inzwischen fünf Familienmitgliedern wurde unsere Wohnung dafür nun langsam eng. Noch lag Petra gerne bei den Großeltern im Zimmer.
Auch von Frau Schmidt und Frau Bauer hatten wir tolle Unterstützung. Das Leben verlief in geordneten Bahnen und wir alle freuten uns. So gingen wir voller Zuversicht in das Jahr 2006.
Der Tod schlägt zu
Das Jahr 2006 begann auch hoffnungsvoll. Es änderte sich jedoch am Gründonnerstag, den 13. April. Da erlitt Hans-Peter einen Herzstillstand. Ich fand ihn regungslos in seinem Büro und rief sofort die Intensivstation an. Die schickten sofort ein Reanimationsteam los. In der Zwischenzeit versuchte ich per Herzdruckmassage den Blutkreislauf aufrecht zu erhalten. Georg beatmete ich in den kurzen Pausen, die ich nach etwa 30 Drücken machte.
Nach wenigen Minuten war das Reanimationstem da und übernahm Hans-Peter. Sie brauchten noch über eine Viertelstunde, bis das Herz wieder selbständig schlug. Da die Atmung nicht eingesetzt hatte, wurde Hans-Peter künstlich beatmet. In diesem Zustand wurde er auf die Intensivstation mitgenommen.
Bevor ich nach Hause fuhr, besuchte ich Hans-Peter auf der Intensivstation. Durch meine jahrelange Tätigkeit in der Klinik kannten mich die meisten in der Intensivstation. So bekam ich auch Auskunft.
Hans-Peter lag künstlich beatmet im Bett. Vor dem Bett stand ein koffergroßes Gerät, das die Temperatur von 35,6°C anzeigte. Pfleger Ralf erklärte mir: „Wir kühlen damit das Blut für 24 Stunden auf 33°C herunter, damit das Gehirn keinen größeren Schaden nimmt. Das Problem ist, dass bei Herzstillstand und bei Herzkammerflimmern das Gehirn nicht mehr mit Sauerstoff versorgt wird. Damit besteht die Gefahr der Gehirnschädigung. Dies kann zu einem Pflegefall oder im schlimmsten Fall zum Hirntod führen. Dies versuchen wir durch diese Maßnahme zu vermeiden. Derzeit sind wir in der Phase der Abkühlung. Heute Nacht werden wir 33°C erreicht haben und dann für 24 Stunden halten. Danach erwärmen wir das Blut wieder auf 37°C und hoffen, dass das Gehirn sich wieder erholt hat. Die große Frage ist, wie lange Herr Schlund schon mit Herzstillstand dalag und das Gehirn nicht durchblutet wurde. Das Herz kann zwar bei einem Erwachsenen bis zu 30 Minuten nach Herzstillstand noch zum Schlagen angeregt werden, was aber über 10 Minuten Herzstillstand hinaus geht, verursacht eine schwere Gehirnschädigung. Bis diese Behandlung der Hypothermie, so wird diese Behandlung genannt, abgeschlossen ist und die Temperatur von 37°C wieder erreicht ist, kann niemand etwas sagen.“
Mit diesen Informationen ging ich nach Hause. Gabi erkannte sofort, dass was nicht stimmte. Ich erzählte, was geschehen war. Als ich geendet hatte, sagte Gabi: „Du hast getan, was man in der Situation tun konnte. Mehr hätte kein Arzt tun können. Ich bin echt stolz auf dich.“
Diese Worte taten mir sehr gut.
Karfreitag bekam mit dem Hintergrund des Herzstillstands von Hans-Peter eine ganz neue Bedeutung. Ich konnte voll und ganz in die Worte Jesu einstimmen „Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?“
Nach dem Gottesdienst besuchte ich Hans-Peter auf der Intensivstation. Wie Pfleger Ralf am Vortag bereits sagte, das Gerät zeigte nun 33°C an. Dr. Huy kam zu mir und fragte: „Wissen Sie, ob Herr Schlund Angehörige hat? Er hatte keine Papiere dabei.“
Da wurde mir bewusst, dass wir über vieles gesprochen hatten, aber Hans-Peter nie über sein Privatleben. Ich wusste einfach nichts über ihn. Da es mein Chef war, dachte ich mir auch nichts dabei. Nun wurde es mir peinlich bewusst. Daher musste ich bekennen: „Nein, ich weiß nichts über Angehörige von Herrn Schlund.“
„Bis Ostermontag ist es nicht dringlich, aber im Laufe der nächsten Woche werden Entscheidungen anstehen, die Herr Schlund noch nicht fällen kann. Daher ist es uns sehr wichtig, dass wir bis zum Dienstag Angehörige hätten, die uns sagen, wie wir weiter verfahren sollen“, erklärte Dr. Huy.
„Ich werde schauen, was ich für Sie tun kann“, sagte ich ihm zu.
In der Eingangshalle der Klinik rief ich mit meinem Handy Georg an, wann er Zeit hat, um im Büro von Hans-Peter nachzusehen, ob wir dort irgendwelche Hinweise auf Angehörige finden. Georg hatte sofort Zeit. Somit trafen wir uns in meinem Büro. Gemeinsam gingen Georg und ich in das Büro von Hans-Peter. Dort fanden wir einen Geldbeutel mit etwas Geld, einer EC-Carte, einem Ausweis der Krankenkasse, einer Bahncard 50%, einer Payback-Karte und einen Organspendeausweis. Keinen Hinweis auf irgendwelche Personen. Den Ausweis der Krankenkasse nahm ich an mich, um diesen auf der Intensivstation abzugeben. Den Rest an Wertsachten notierten wir. Diese Liste unterschrieben wir beide. Den Geldbeutel verwahrte ich in meinem Schreibtisch.
Bei der weiteren Suche auf Hinweise nach Angehörige fanden wir ein Smartphone. Es war zum Glück eingeschaltet, aber der Akku war bald leer. Somit suchten wir nach dem Netzteil, fanden es aber nicht. Georg hatte aus der Baureihe ein kleineres Smartphone. Damit müsste das Netzteil passen. Er hatte es jedoch Zuhause. Ich fuhr somit mit Georg nach Hause. Das Netzteil passte. Damit lieh ich mir bis zum Samstag das Netzteil aus.
Zuhause angekommen, sah ich zunächst zu, dass das Smartphone schnell an das Ladegerät angeschlossen wurde. Die Kinder waren bereits im Bett. Gabi erzählte ich den aktuellen Stand und dass wir nun auf der Suche nach Angehörigen von Hans-Peter sind. Bisher fanden wir nichts. Vielleicht hilft hier das Adressbuch des Smartphones weiter. Am Samstag wollte ich die gespeicherten Telefonnummern notieren und der Reihe nach anrufen. Sicherlich ist ein Angehöriger darunter.
Gabi ging nach dem Frühstück mit den Kindern bei strahlendem Sonnenschein spazieren, damit ich in Ruhe telefonieren konnte. Bei den meisten Telefonnummern erreichte ich nichts. Bei den Personen, die sich gemeldet haben, gab ich vor, dass ich das Smartphone gefunden hätte und nun den Besitzer suche. Beim achten Gesprächsparter meldete sich ein Herrn Schlund. Ich sagte: „Ich habe dieses Handy gefunden und suche nun den Besitzer des Handys. Hierzu rufe ich die gespeicherten Telefonnummern an. Können Sie mir bitte sagen, wem dieses Handy gehört?“
Herr Schlund antwortete: „Das Handy gehört meinem Sohn Hans-Peter. Wo haben Sie denn das Handy gefunden?“ „Es lag in einer Garderobe auf dem Boden“, log ich und dachte mir, wie kriege ich die Kurve zur Wahrheit. Da fiel mir ein, dass diese Telefonnummer die Vorwahl von Mannheim hatte. Dann musste Herr Schlund im Stadtgebiet wohnen. Somit fragte ich: „Die Vorwahl sagt mir, dass Sie im Stadtgebiet von Mannheim wohnen. Kann ich Ihnen das Handy kurz vorbeibringen, damit Ihr Sohn es bei Ihnen abholen kann?“