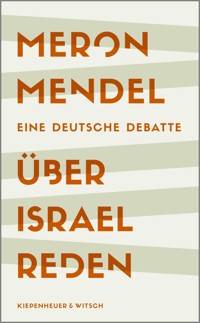
18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Über kaum ein anderes Land wird in Deutschland so viel geredet und gestritten: Zu Israel hat jeder eine Meinung. Warum ist das so? Wieso hat der Nahostkonflikt eine solche Bedeutung? Und warum ist die Debatte so emotional – und oft so vergiftet? Als Meron Mendel vor zwanzig Jahren nach Deutschland kam, stellte er überrascht fest, welche Bedeutung sein Heimatland Israel hier im öffentlichen Diskurs hatte. Schon damals konnten nahezu alle, mit denen er sprach, klare Positionen zu Israel und seiner Politik formulieren. Heute werden die Debatten noch heftiger geführt. Zuletzt haben sich Skandale aneinandergereiht – vom öffentlichen Streit um den antiisraelischen Philosophen Achille Mbembe im Jahr 2020 bis zur Documenta-Debatte von 2022. Einerseits wird eine Art "Freundschaftspflicht" aufgrund der NS-Vergangenheit und dem andauernden Antisemitismus in Deutschland proklamiert. Andererseits stellt sich die Frage, wie Deutschland auf den sich verschärfenden Rechtskurs der Regierung in Jerusalem reagieren soll. Meron Mendel schildert in diesem Buch, wie das Verhältnis zu Israel und zum Nahostkonflikt in Deutschland verhandelt wird, in der Politik und in den Medien, unter Linken, unter Migranten und unter Juden. Deutschlands Verhältnis zu Israel steht vor großen Herausforderungen: Meron Mendel zeigt, wie wir ihnen mit Mut und Offenheit begegnen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Meron Mendel
Über Israel reden
Eine deutsche Debatte
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Meron Mendel
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Meron Mendel
Meron Mendel (*1976) wuchs in einem Kibbuz auf, studierte in Haifa und in München Pädagodik und Jüdische Geschichte, promovierte in Frankfurt und ist heute Professor für Soziale Arbeit und Leiter der Bildungsstätte Anne Frank.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Über kaum ein anderes Land wird in Deutschland so viel geredet und gestritten: Zu Israel hat jeder eine Meinung. Warum ist das so? Wieso hat der Nahostkonflikt eine solche Bedeutung? Und warum ist die Debatte so emotional – und oft so vergiftet?
Als Meron Mendel vor zwanzig Jahren nach Deutschland kam, stellte er überrascht fest, welche Bedeutung Israel im öffentlichen Diskurs hat. Nahezu alle, mit denen er sprach, konnten sehr klare Positionen zu Israel und seiner Politik formulieren. Daran hat sich bis heute nichts geändert: Die Haltung zu Israel ist für viele Deutsche konstitutiv in ihrer politischen Positionierung.
Gehört Israel zur deutschen Staatsräson? Darf man mit BDS-Aktivisten reden? Sollten radikale palästinensische Positionen Raum bekommen in deutschen Medien? Was steckt hinter diesen Fragen, die im Land der Täter so leidenschaftlich diskutiert werden?
Es geht in diesem Buch nicht um Israel und auch nicht um den Konflikt mit den Palästinensern – es geht darum, wie in Deutschland der Nahostkonflikt verhandelt wird, in der Politik und in den Medien, unter Linken, unter Migranten und unter Juden. Es geht um: den deutschen Israelkomplex.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Die Geschichte des Anderen ertragen
Die beiden einzigen Linken in der Brigade
Besatzung bedeutet Gewalt und Angst
Haifa: Ist Alltagsfriede möglich?
Deutschland als Alternative
Israel schafft sich ab
Vorwort
Die Bundeswehr an der Klagemauer
Merkel vor der Knesset
Adenauer und die Wiedergutmachung
Sechstagekrieg 1967
Golfkrieg 1990/91
U-Boote für Israel
Prägende Gestalten: Axel Springer und Günter Grass
Das Israelkalkül der AfD
Ein Ende der Staatsräson?
Drei Buchstaben mit Schlagkraft
Nicht der erste Boykott gegen Israel
BDS: Neue Bewegung, alte Idee
BDS stoppt nicht den Siedlungsbau, sondern Friedensprojekte
Die Gretchenfrage: Sag, wie hältst du’s mit der BDS-Bewegung?
Der BDS-Vorwurf lässt palästinensische Stimmen verstummen
Palästinenser in Deutschland
Der Bundestag spricht ein machtloses Machtwort
Ausladen oder zurücktreten bitte!
Museumsdirektor stürzt über BDS-Tweet
Die Debatte um Achille Mbembe
Weltoffenheit und Meinungsfreiheit
documenta fifteen: Vorwürfe statt Freundschaften
Die Wirklichkeit ist komplexer, als beide Lager behaupten
Begegnung mit Documenta-Besuchern
Warum ist eine Diskussion um BDS in Deutschland unmöglich?
Aus der Geschichte verlernt
Der antiisraelische Turn 1967
Der antideutsche Turn 1990/91
Antiimperialisten und ihr Hass auf Israel
Der Wunsch nach jüdisch-israelischen Kronzeugen
Festival »Dear White People …« – Antirassismus und Antisemitismus
Erfolgreiche Lernprozesse?
Vergleichbar einzigartig
Shoah-Religion im Täterland?
Nicht der erste Historikerstreit
Ein australischer Historiker und deutsche Hohepriester
Was mögen viele Deutsche an Moses?
Am Ende sind die Juden schuld
Multidirektionales Erinnern
Wird der Vergleich tabuisiert?
Das Vergleichen begann schon im Krieg
Inwiefern war die Shoah einzigartig?
Holocaust und andere Genozide
Vergleich von Shoah und Nakba
Wie könnten wir besser über Erinnerung streiten?
Nachwort
Dank
Literaturverzeichnis
Prolog
Meine erste Kindheitserinnerung ist aus dem Sommer 1982. Als ich aus dem Kindergarten nach Hause kam, stand mein Vater vor unserer Haustür, in Soldatenuniform und mit einem schweren Seesack über der Schulter. Wir verabschiedeten uns hastig, da er als Reservist schnellstmöglich zu seiner Armeeeinheit fahren musste: von unserem Kibbuz in der Negevwüste, ganz im Süden Israels, hoch in den Norden an die libanesische Grenze, die nun eine Front war. Der erste Libanonkrieg war ausgebrochen. Damals sprach man jedoch weder von »Krieg« noch davon, dass er der erste in einer Reihe sein könnte. Uns Angehörigen wurde erklärt, es gehe lediglich um eine kurze militärische Operation mit dem beruhigenden Namen »Frieden für Galiläa«.
Wenige Monate später wurde die »Operation« in »Krieg« umbenannt. Mein Vater kehrte zwar schon nach einigen Wochen zurück, die israelische Armee aber blieb fast 20 Jahre. 1995 wurde ich selbst zum Wehrdienst einberufen und als Infanteriesoldat in den Libanon geschickt. Ich war an einem Militärstützpunkt in der Stadt Mardsch Uyun stationiert, von der mir mein Vater schon erzählt hatte.
Warum ich das erzähle? Es liegt auf der Hand, dass mein Blick auf Israel und den Nahostkonflikt stark biografisch geprägt ist – obwohl ich nun schon seit mehr als zwei Jahrzehnten in Deutschland lebe, wo auch meine Kinder geboren sind.
Mein Alltag als Kind und Jugendlicher war kaum von der Politik beeinflusst. Oder genauer gesagt: Die militärischen Konflikte mit den Palästinensern und den israelischen Nachbarstaaten waren so stark in unserem Alltag verankert, dass wir sie kaum bemerkt haben. Unser Kibbuz in der Wüste war auf allen Seiten von Truppenübungsplätzen umgeben. Kampfjets und Militärhubschrauber flogen in virtuosen Manövern täglich über unsere Köpfe hinweg. Der Sound von Panzermotoren und Artilleriesalven war uns so vertraut, dass wir ihn gar nicht mehr wahrnahmen. Auf unseren Spaziergängen über karge Hügel sammelten wir alte Munition, die wir als Blumentöpfe oder einfach als Dekoration benutzten. Auch die Gasmasken, die wir Anfang der 90er-Jahre während des Zweiten Golfkriegs zum Schutz vor den Scud-Raketen aus dem Irak bekamen, haben wir umfunktioniert: als Atemschutz beim Lackieren von Bettgestellen oder als lustige Kostüme an Purim, dem jüdischen Freudenfest, das so ähnlich gefeiert wird wie Karneval.
Zu Hause im Kibbuz hielten wir uns für links, tolerant und weltoffen. Die Lebensrealität war aber wenig bunt: Hier lebten nur Juden – und so ist es bis heute. Arabern begegneten wir nur, wenn wir in die Zelte der benachbarten Beduinen eingeladen waren. Ansonsten kannten wir sie vor allem aus den Fernsehnachrichten über militärische Konflikte an den israelischen Grenzen. In der Theorie wollten wir alle in Frieden mit den Arabern leben, aber als tatsächlich eine arabische Familie in unseren Kibbuz ziehen wollte, stand ihre Aufnahme nicht einmal zur Debatte.
Die Geschichte des Anderen ertragen
In meiner Jugend wurde der Nahostkonflikt zur treibenden Kraft meiner Politisierung. Leider hatten meine Freunde im Kibbuz kaum Interesse an Politik, aber nach der achten Klasse wechselte ich auf ein Gymnasium in der Stadt. Mein Schulweg mit dem Bus war nun sehr lang (anderthalb Stunden hin, anderthalb Stunden zurück), aber ich fand dort Freunde, die sich so sehr für Politik interessierten wie ich. Die Eltern einiger Mitschüler hatten Ende der 70er-Jahre die Bewegung »Peace Now« mitbegründet. Meine neuen Freunde gehörten zur zweiten Generation Friedensaktivisten.
Damals haben wir viel gelesen und diskutiert, unter anderem »Der geteilte Israeli« von David Grossmann.[1] Für sein Buch hatte der Schriftsteller Palästinenser begleitet, die 1948 im ersten israelisch-arabischen Krieg geflüchtet waren und nun nach Israel zurückkehrten – nur um festzustellen, dass es ihre alten Häuser nicht mehr gab.
Schon bald wollten wir Kontakt mit Palästinensern aufnehmen – aber auf unserer Schule war kein einziger. Das israelische Bildungssystem war damals stark getrennt in jüdische und arabische Schulen. Bis heute sind binationale Schulen in Israel eine Ausnahme. Aber wir erfuhren von einem Dorf bei Jerusalem mit dem vielversprechenden Namen Neve Shalom (»Oase des Friedens«). Dort finden regelmäßig Begegnungen zwischen arabischen[2] und jüdischen Schülern statt. Wir kontaktierten das Dorf und trugen die Idee unseren Klassenkameraden und schließlich der Schulleitung vor. Am Ende durfte eine handverlesene Gruppe aus unserer Jahrgangsstufe nach Neve Shalom fahren. Dort trafen wir uns eine Woche lang mit Jugendlichen aus der nordisraelischen arabischen Stadt Sachnin – und mussten schon bald feststellen, wie weit entfernt voneinander unsere Sichtweisen auf den jüdisch-arabischen Konflikt waren. Wir Juden waren überzeugt, dass die Araber uns dankbar sein sollten, dass wir für ein Ende der israelischen Besatzung eintraten. Deshalb waren wir erst mal beleidigt, als sie unserer Haltung keinerlei Respekt zollten – dabei hielten wir diese für äußerst fortschrittlich! Für die palästinensischen Schüler war die Begegnung mit einer jüdischen Gruppe vielmehr eine Gelegenheit, endlich einmal ihren Frust über Diskriminierung und Ausgrenzung in Israel rauszulassen. »Warum müssen wir mit euch eigentlich Hebräisch sprechen?«, fragten sie uns. »Lernt doch mal Arabisch!«
Es mussten noch Hunderte Stunden mit Gesprächen vergehen, bis ich – einige Jahre später – Palästinensern empathisch zuhören und ohne Abwehrreflexe ihre Sicht auf den Nahostkonflikt akzeptieren konnte. Erst allmählich konnte ich »die Geschichte des Anderen kennen lernen«, wie es der Psychologe und Friedensforscher Dan Bar-On formuliert hat.[3]
Unser politisches Selbstbewusstsein beruhte auf einem optimistischen Fortschrittsglauben, denn wir sahen uns gemeinsam mit den arabischen Jugendlichen auf der richtigen Seite der Geschichte. Auf der anderen, dunklen Seite der Historie standen nur noch die rückwärtsgewandten Religiösen und Nationalisten beider Seiten.
Woher kam unsere damalige Zuversicht? Nun, als ich in der zehnten Klasse war, gewann der Sozialdemokrat Jitzchak Rabin (1922–1995) die Wahl und wurde Ministerpräsident. Nur ein Jahr später, 1993, unterzeichnete er in Oslo das Friedensabkommen mit dem damaligen Palästinenserführer Jassir Arafat (1929–2004). Einen besseren Beweis hätten meine Freunde und ich uns nicht wünschen können: Der Frieden zwischen Israelis und Palästinensern würde schon bald keine Utopie mehr sein, sondern eine Tatsache! Fast jede Woche gingen wir demonstrieren, um Rabins Friedenspolitik zu unterstützen, voller Leidenschaft diskutierten wir untereinander die Möglichkeiten einer friedlichen Zukunft.
Die beiden einzigen Linken in der Brigade
Eine wichtige Leitfigur war für uns der Philosoph Jeschajahu Leibowitz (1903–1994). Damals fast 90 Jahre alt, war er eine außerordentliche Persönlichkeit: zugleich orthodoxer Jude, kompromissloser Humanist und scharfer Kritiker der israelischen Besatzungspolitik. Bereits 1968, nur wenige Monate nach dem spektakulären Sieg Israels über drei arabische Nachbarländer, hatte er geschrieben: »Der wichtigste Tag im Sechstagekrieg ist der siebte Tag.« Am siebten Tag nämlich hätte sich die israelische Armee aus seiner Sicht aus den besetzten Gebieten – Ostjerusalem, Westjordanland und Gazastreifen – vollständig zurückziehen müssen.
Wir schwänzten die Schule, um nach Jerusalem zu fahren und seine Vorträge zu hören. Einmal sprach Leibowitz uns hinterher an und lud uns zu sich nach Hause ein. Tagelang bereiteten wir uns auf das Treffen vor. Die Reise zu seinem Haus im historischen Jerusalemer Stadtteil Rechavia kam mir vor wie eine Pilgerfahrt. Wir sprachen mit unserem Idol über unseren Frust, dass sich der Friedensprozess so lange hinzog. Leider fand Leibowitz keine ermutigenden Worte für uns, im Gegenteil. Er widersprach unserer Vorstellung, dass der Friede mit den Palästinensern vor der Tür stehe. Ein Grundproblem sah er in der Ausbreitung einer neuen, messianischen Ideologie unter den jüdischen Israelis: Nationalistische, religiöse Juden, die der Idee eines Großisrael anhingen und Araber nicht als gleichwertige Menschen betrachteten, würden auch in Zukunft einen dauerhaften Frieden verhindern. Jeschajahu Leibowitz’ Urteil über sie war unmissverständlich: Er nannte diese Nationalisten »Judeo-Nazis«.
Damals kannte ich keinen einzigen jüdischen Siedler in den besetzten Gebieten. Aber es sollte nicht mehr lange dauern, bis auch ich ihnen persönlich begegnete, im Wehrdienst. Wie alle jüdischen Israelis musste ich als 18-Jähriger drei Jahre zur Armee. »Kein Grund zur Sorge«, dachte ich mir damals. »Der Friedensprozess ist ja fast vollendet. Wir sind bestimmt der letzte Soldatenjahrgang, der noch einen militärischen Konflikt erleben muss.«
Eine Woche vor meiner Einberufung, am 4. November 1995, wurde Jitzchak Rabin von einem jüdisch-nationalreligiösen Terroristen erschossen. Für eine ganze Generation linker, säkularer Israelis brach die Welt zusammen. Meine Freunde gingen in Tel Aviv auf die Straße und zündeten Kerzen an, um an Rabin zu erinnern. Später nannte man sie die »Kerzenkinder-Generation«. Ich weiß nicht, ob mir diese Art des kollektiven Trauerns geholfen hätte, so oder so hatte ich keine Zeit dafür: Mit neuer Kakiuniform und altem M16-Gewehr wurde ich als Infanteriesoldat zur Grundausbildung ins besetzte Westjordanland geschickt.
Ich war kein Pazifist, aber die Vorstellung, dass der vorher fast greifbare Frieden nun in ferne Zukunft gerückt war, machte mir große Angst. Und die Armee war wohl der schlechteste Ort, um mit ihr umzugehen. Meine bedrückte Stimmung wurde zur vollständigen Verzweiflung, als ich der Golani-Einheit zugeteilt wurde – einem Infanteriebataillon, das unter rechtsnationalistischen jungen Männern besonders beliebt war und es bis heute ist. Wie erleichtert war ich, als ich unter den neuen Kameraden doch einen weiteren linken Soldaten kennenlernte! Schnell galten wir beide als potenzielles Problem unserer Einheit – womöglich waren wir der verlängerte Arm der Menschenrechtsorganisation B’Tselem in der Golani-Brigade… Darüber haben wir alle viel gelacht, aber wir wussten auch, dass unsere politischen Differenzen im Ernstfall tatsächlich ein Problem werden könnten. Wir waren in Hebron stationiert. In dieser im Westjordanland gelegenen Stadt mit etwa 200.000 Einwohnern war es unsere erklärte Aufgabe, 500 jüdische Siedler zu verteidigen.
Bei meinem Wehrdienst in Hebron habe ich immer wieder versucht, mein Schularabisch alltagstauglich zu machen – mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Und seit ich in Deutschland lebe, wird mein rudimentäres Arabisch immer schlechter. Im Ägyptenurlaub muss ich mir schon Mühe geben, um erfolgreich eine Kanne Minztee zu bestellen. Doch auch falls ich mein Arabisch irgendwann ganz verlernen sollte, werde ich einen Satz niemals vergessen: »Iftach el bab!« (»Tür auf!«) Oft genug musste ich ihn während meines Militärdienstes verwenden, denn zum Alltag der Besatzung gehörte damals in den 90er-Jahren die Schikanierung der arabischen Zivilbevölkerung durch nächtliche Hausdurchsuchungen – zu denen die durch viele Kontrollposten eingeschränkten Bewegungsfreiheit und die allmähliche Verdrängung aus dem eigenen Land durch den Ausbau der jüdischen Siedlungen kam.
Besatzung bedeutet Gewalt und Angst
Während meines Wehrdienstes brachen im September 1996 heftige Unruhen in den Palästinensergebieten aus. Auslöser war die Öffnung eines antiken Tunnels unter der Westmauer der Al-Aksa-Moschee, um den Israelis und Palästinenser schon ewig rangen. Der damalige und heutige Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte für den Zugang zu der archäologischen Passage grünes Licht gegeben, was von palästinensischer Seite als Provokation und Eingriff ins arabische Ostjerusalem aufgefasst wurde. Die eigentliche Ursache war aber, dass kurz nach dem Osloer Abkommen alle Friedenshoffnungen verflogen waren. Die neue rechte Regierung war nicht bereit, den Friedensvertrag umzusetzen, und setzte auf eine Kombination aus Hinhaltetaktik und weiterer Besiedlung der besetzten Gebiete.
Mitten in dieser neuen arabischen Protestwelle wurde ich mit meiner Einheit nach Ramallah versetzt. Im Norden der Stadt bezogen wir Posten auf dem Dach einer schönen Villa. Einen Monat lang lebten wir praktisch über einer palästinensischen Familie – einem Arzt, seiner Frau und den drei Kindern. Wir Soldaten nutzten nicht nur das Dach, sondern auch die Toiletten und die Küche der Familie. Unsere surreale Koexistenz zeigte mir deutlich, was Besatzung bedeutet. Wir versuchten freundlich zur Familie zu sein, und die Hausbewohner versuchten, ihren Alltag normal fortzusetzen, soweit das möglich ist, wenn plötzlich bewaffnete junge Männer in der Küche stehen. Mich beschlich bald das Gefühl, auf der falschen Seite zu sein. Und ich konnte es nicht mehr loswerden.
Die Rede von der »humanen Besatzung« – so die Rhetorik der israelischen Politiker meiner Jugendzeit – gehört bis heute zur großen Lebenslüge vieler Israelis. Die Erfahrung in Ramallah zeigte mir, dass es so etwas nicht geben kann, denn jedes Besatzungsregime funktioniert nur über die Gewalt der Besatzer und die Angst der einheimischen Bevölkerung.
Als wir nach Hebron zurückkehrten, wurde mir zudem vor Augen geführt, dass dort eigentlich die palästinensischen Zivilisten militärischen Schutz benötigten – und zwar vor Gewalt der jüdischen Siedler. Doch wir Soldaten hatten hauptsächlich die Aufgabe, die Siedler gegen palästinensische Angriffe zu verteidigen. Solche Angriffe habe ich zwar auch erlebt. Denn auch in Hebron haben bewaffnete Palästinenser versucht, Anschläge gegen die Siedler zu verüben. Dennoch war es im Alltag häufiger die palästinensische Zivilbevölkerung, die Schutz vor den Siedlern brauchte. Besonders erschreckend war für mich, dass die Siedlerjugend von ihren Eltern ermutigt wurde, arabische Passanten mit Müll, Steinen und Urinbeuteln zu bewerfen. Auf meine Frage hin, erklärte mir mein Vorgesetzter, dass wir gegen diese täglichen Demütigungen nicht viel machen könnten. Weder die Jugendlichen noch ihre Eltern würden dafür bestraft.
In Hebron habe ich auch den heutigen Minister Itamar Ben-Gvir kennengelernt. Ben-Gvir, gleicher Jahrgang wie ich, war wegen rechtsradikaler Aktivitäten ausgemustert worden und lebte in der jüdischen Siedlung innerhalb der arabischen Stadt. Mal warf er mit seinen Freunden Steine vom Dach auf die arabischen Passanten, mal schikanierte er die Straßenverkäufer und sorgte für Tumult auf dem Markt. Wir Soldaten konnten den Provokateur kaum aufhalten, uns beschimpfte er als Nazis und Verräter, bespuckte uns. Über die Jahre hat er seine Arbeitsmethoden verfeinert. Er studierte, wurde Rechtsanwalt und vertrat seine Gesinnungsfreunde, wenn sie wegen Terrors gegen Araber vor Gericht standen. Er ruft nicht mehr »Tod den Arabern«, wie damals in Hebron. Heute sagt er, etwas anschlussfähiger: »Tod den Terroristen.« Im Wesentlichen hat sich Ben-Gvir aber nicht verändert. Verändert hat sich die israelische Gesellschaft. Wer vor einer Generation als rechtsradikaler Paria galt, ist heute gern gesehener Gast in Talkshows und legitimer Koalitionspartner. Ben-Gvir wird heute als Held auf den Straßen, in Einkaufzentren und sogar in Schulen gefeiert. Kinder bitten um Selfies mit diesem freundlichen Araberhasser.
Mit Ben-Gvir und seinesgleichen waren Gespräche zwecklos. Sein Hass auf Araber und Linke und seine rassistische Ideologie waren schon damals fest zementiert. Deshalb versuchte ich, die Kinder und Teenager mit Argumenten und soldatischer Autorität zu überzeugen. Die jungen Siedler gingen sogar auf die Diskussion ein. Sie fanden es offensichtlich interessant, ihre Ideologie von der Überlegenheit des jüdischen Volkes einem linken jüdischen Soldaten vorzutragen. Und so standen wir manchmal bis in die späten Nachtstunden und diskutierten. Ich hatte oft das Gefühl, mit meinen Argumenten nicht zu ihnen durchzudringen. Immer wieder erinnerte ich mich selbst daran, dass diese jungen Leute gar keine andere Realität als die Besatzung kannten, dass sie von ihren Eltern und Lehrern vom Kindesalter an indoktriniert wurden.
Schon damals habe ich mich oft gefragt, ob diese langen Diskussionen völlig umsonst waren. Einige Jahre später aber, als ich in Haifa studierte, rief mich einer der jungen Siedler aus Hebron an. Unsere Gespräche hätten bei ihm nachgewirkt, erzählte er mir. Er bereue die Art und Weise, wie er damals seine arabischen Nachbarn behandelt habe. Mit 18 hatte er die Siedlung verlassen, den Kontakt mit seiner Familie abgebrochen und wollte nun ein neues Leben anfangen. Das Gespräch mit ihm verschaffte mir Genugtuung. Wenn sich eine Person ändern kann, dachte ich mir, könnte es vielleicht auch bei anderen klappen.
Haifa: Ist Alltagsfriede möglich?
Nach drei Jahren als Soldat wollte ich das Kapitel Armee endgültig schließen. Konsequent brach ich den Kontakt zu meinen Kameraden ab. Nur mit dem einzigen anderen Linken blieb ich über Facebook in Verbindung. Als ich telefonisch zum Reservedienst gerufen wurde, legte ich einfach auf. Und zum Termin vor dem Militärgericht ging ich einfach nicht hin. In meiner Abwesenheit wurde ich zu einer Strafzahlung verurteilt. Seitdem war ich nie wieder Soldat, aber die Erinnerungen aus Hebron, Ramallah und dem Südlibanon haben mich viele Jahre noch bis in den Schlaf verfolgt. In einem Traum, der sich unzählige Male wiederholt hat, musste ich in die Armee zurück, ohne mich dagegen wehren zu können. Erst nach einem Jahrzehnt in Deutschland ließen diese Albträume allmählich nach.
Nach der Armee entschied ich mich für ein Gegenprogramm: ein Studium in Haifa. Diese Stadt ist in den Augen vieler Israelis das Sinnbild für ein friedliches Zusammenleben von Juden und Arabern, quasi der Gegenentwurf zum umkämpften, religiös-fundamentalistischen Jerusalem. Auch die Universität dort gilt als besonders progressiv, etwa ein Drittel der Studierenden ist arabisch. Ich hatte idyllische Vorstellungen vom multikulturellen Studentenleben in Haifa. Doch auch wenn es dort keine formale Segregation gab, so galt doch eine informelle, gleichfalls strenge Trennung zwischen den Bevölkerungsgruppen. Wir hörten zwar dieselben Vorlesungen, aßen in derselben Mensa und saßen auf derselben Campuswiese – aber nie zusammen.
Eine kleine Gruppe arabischer und jüdischer Studierender wollte diese Normalität nicht akzeptieren. Ich war einer davon. Wir lernten uns in Seminaren kennen und begannen, in der Bibliothek gemeinsam für Klausuren zu lernen. Bald organisierten wir auch politische Diskussionen. Wir debattierten, ob Israel eine arabischsprachige Universität brauchte, ob arabische Bürger Anspruch auf eigene nationale Symbole haben sollten und ob die jüdische Selbstdefinition des Staates Israel mit demokratischen und liberalen Prinzipien zu vereinbaren ist.
Deutschland als Alternative
Dann kam der Oktober 2000. Bei gewalttätigen Demonstrationen arabischer Staatsbürger gegen die Regierung kamen in der Nähe von Haifa 13 Araber und ein Jude ums Leben. Der Riss zwischen Juden und Arabern wurde zum offenen Bruch. Als das neue Semester begann, kamen die arabischen Studierenden nicht mehr zur Uni. Am Telefon waren Wut und Verzweiflung nicht zu überhören. Als wir uns in den nächsten Wochen und Monaten wiedersahen, war die Stimmung völlig anders. Ich merkte, wie mich die politische Ausweglosigkeit frustrierte. Ich wollte so nicht weitermachen und entschied mich für einen Tapetenwechsel. Ein Jahr später zog ich nach München, um dort mein Studium fortzusetzen.
Ich war nicht der Einzige an der Uni, der Abstand vom politischen Dampfkessel Israel suchte. Einige meiner Freunde entschieden sich ebenfalls, ihre Heimat zu verlassen – für eine begrenzte Zeit oder für immer. Viele andere blieben in Israel, entwickelten aber zunehmend inneren Abstand zur Politik. Bei einem meiner ersten Heimatbesuche bemerkte ich, dass nun alle vegan aßen. »Klar, wenn wir das politische Unrecht im Land nicht verändern können, dann sind wir wenigstens mit unserer Ernährung auf der guten Seite«, lautete die ironische Erklärung.
Ich dagegen war damals damit beschäftigt, meine Ernährung an die bayerische Küche anzupassen und gleichzeitig meine Zeit in Seminare und Studentenpartys zu investieren. Es dauerte aber nicht lang, bis mich das Thema Nahostkonflikt auch in Deutschland einholte: in Fragen von Kommilitonen, in Bemerkungen von Fremden, die sich auf meinen israelischen Akzent bezogen, in Kontakten mit anderen Israelis in Deutschland. Seitdem beobachte ich, wie der Nahostkonflikt hierzulande verhandelt wird. Manchmal wünschte ich mir das Privileg, keine Meinung dazu zu haben. Das steht mir als Israeli aber nicht zu. Ich verspüre eine Verantwortung für das Land, das ich trotz allem liebe.
Wenn ich über Israel spreche, denke ich an meine Familie und an meine jüdischen und arabischen Freunde dort. Es ist ein permanenter Versuch, meine politischen Urteile mit meiner Empathie für die Menschen vor Ort in Einklang zu bringen. Denn an Rechthaberei und einseitiger Identifikation fehlt es in diesem Konflikt bekanntlich nicht.
Dass die beiden Jahrzehnte in Deutschland meine Perspektive auf den Konflikt ebenfalls beeinflusst haben, wurde mir vor einiger Zeit bewusst. Da erzählte mir mein Bruder, er sei an seiner Universität in Beer Sheva einer Friedensinitiative beigetreten. Auf meine Nachfrage, mit welchem palästinensischen Partner diese zusammenarbeite, reagierte er verdutzt: Der Initiative gehe es nicht um Dialog, sondern lediglich darum zu überlegen, welche Maßnahmen auf israelischer Seite zur Eindämmung des Konflikts beitragen könnten. Warum »eindämmen« und nicht »beenden«, fragte ich. »Du lebst zu lange in Deutschland, um das zu verstehen«, erwiderte mein Bruder mit hörbarem Trotz. Das stimmt, dachte ich, und sagte: »Aber vielleicht sehe ich aus der Entfernung etwas, was du nicht siehst.«
Israel schafft sich ab
Inzwischen meine ich nicht mehr, dass ich aus der Entfernung etwas besser sehen kann. So sehr bin ich von der politischen Situation in Israel desillusioniert. Mit der Wiederwahl von Benjamin Netanjahu und seinen rechtsextremen Verbündeten im Herbst 2022 ist meine Hoffnung auf eine friedliche Lösung zwischen Israelis und Palästinensern in absehbarer Zeit verschwunden. Am Wahlabend im November 2022 war Itamar Ben-Gvir, den ich aus meiner Zeit in Hebron kannte, der größte Gewinner. Seine Partei wurde zur drittstärksten Kraft in der Knesset. Der Aufstieg des verurteilten Rechtsextremisten, der mehrfach wegen Volksverhetzung und Anstiftung zum Terror im Gefängnis saß, zum Königsmacher in der israelischen Politik und zum wichtigen Minister im Kabinett Netanjahus ist ein Beispiel für den Wandel, den die israelische Gesellschaft in den vergangenen Jahrzehnten durchlebt hat. Eine Gesellschaft, die heute gespaltener denn je ist: zwischen dem (immer kleiner werdenden) liberal-säkularen Lager und dem (immer stärker werdenden) nationalistisch-religiösen Lager. Die Polarisierung wird verkörpert durch die beiden großen israelischen Städte, die, folgt man dem israelischen Diskurs, unterschiedlicher nicht sein könnten: Da das hedonistische, weltoffene, westliche, queere Tel-Aviv – dort das jüdisch-nationalistische und religiös-orthodoxe Jerusalem.
Der Wandel Israels ist auch eine Folge demografischer Entwicklungen. Zu den Bürgern des »Tel-Aviv-Staats« zählen vor allem säkulare Aschkenasim, also europäischstämmige Juden, die in der Weltmetropole oder in den Kibbuzim leben. Sie verfügen über ein überdurchschnittlich hohes Bildungsniveau, unterhalten Kontakte ins Ausland und sehen sich als Teil der westlichen Welt. Diese Bevölkerungsgruppe hinkt mit etwa zwei Kindern pro Familie in der Geburtenrate deutlich den Bürgern des »Jerusalem-Staats« hinterher. Diese sind mehrheitlich Misrachi, also arabischstämmige Juden, Bewohner der israelischen Kleinstädte im Umland oder der Siedlungen im Westjordanland. Eine weitere entscheidende Bevölkerungsgruppe im »Jerusalem-Staat« sind die orthodoxen und ultraorthodoxen Juden. Bei ihnen liegt die durchschnittliche Geburtenrate seit Jahren bei etwa 6,7 Kindern pro Familie. Bürger des »Jerusalem-Staats« zeigen sich zum Beispiel völlig unbeeindruckt von den Korruptionsaffären Netanjahus. Für sie sind demokratische Prinzipien wie Rechtsstaatlichkeit oder Gewaltenteilung offenbar weniger wichtig als das Gefühl, von einem »starken Mann« an der Spitze des Staats vertreten zu werden.
Israel erntet aktuell das, was vor Jahrzehnten gesät wurde. Dass die Arbeiterpartei, die Partei der Staatsgründer, bei der Wahl 2022 fast vollständig von der politischen Landkarte gefegt wurde, mögen manche als verspätete Gerechtigkeit werten. Schließlich war es Staatsgründer David Ben-Gurion, der zugelassen hat, dass ultraorthodoxe Juden immer mehr Macht erlangen konnten. In geschlossenen Communitys werden seit langer Zeit antidemokratische Werte weitergegeben. Ultraorthodoxe Juden durften eigene staatlich finanzierte Schulen gründen, in denen weder Mathematik noch Englisch unterrichtet werden. Und am Arbeitsmarkt müssen die Männer nicht teilnehmen, da der Staat die Kosten für ihr Tora-Studium bis zum Rentenalter übernimmt.
Über Jahrzehnte wuchs und gedieh in den segregierten ultraorthodoxen Communitys in Jerusalem, Bnei Brak und später in den Siedlungen im Westjordanland der Hass auf liberale Werte und Palästinenser. Es waren auch die Ministerpräsidenten der Arbeiterpartei, die nach dem Krieg 1967 die besetzten Gebiete im Westjordanland beibehalten wollten. Das Siedlungsprojekt im Westjordanland begann, als die Arbeiterpartei noch an der Macht war. Dem Ratschlag von Jeschajahu Leibowitz, sich wenige Monate nach dem spektakulären Sieg aus den besetzten Gebieten zurückzuziehen, wollte niemand in der Politik folgen. Ansonsten, warnte Leibowitz, würde die zionistische Idee der »Wahnvorstellung des großen Israels« aufgeopfert. Nun wurde seine Prophezeiung zur Realität. Diese Wahnvorstellung ist ein demokratiegefährdendes all-inclusive Paket: Abbau des Rechtsstaates und der Justiz, Zerlegung der Zivilgesellschaft und das Aus für alle Hoffnung auf ein gleichberechtigtes Zusammenleben mit den palästinensischen Bürgern Israels und eine friedliche Lösung mit den Palästinensern im Westjordanland und in Gaza.
Meine Familie und Freunde in Israel, Bürger des »Tel Aviv«-Staats, fühlen sich zunehmend fremd im eigenen Land. Sie fragen sich, ob die israelische Demokratie noch zu retten ist. Die Gefahr, dass sich Israel in den kommenden Jahren zu einer illiberalen Demokratie oder »defekten Demokratie« nach dem Vorbild der Türkei und Ungarns verwandeln wird, ist sehr real. Bei den amerikanischen Politikwissenschaftlern Steven Levitsky und Daniel Ziblatt lässt sich nachlesen, wie das geschieht: in der Regel nicht in einer Revolution oder während eines Putsches, sondern in einem langsamen alltäglichen Prozess. Wenn die Bürger es bemerken, ist es meist zu spät.[4]
Über meinen Pessimismus angesichts dieser Lage zu sprechen, fällt mir schwer. Über die Jahre habe ich gelernt, mit meinen Äußerungen zum Nahostkonflikt vorsichtig zu sein: nicht nur, weil – vor allem in den sozialen Medien – eine unliebsame Aussage schnell mit Spott und persönlicher Diffamierung bestraft wird, sondern auch, weil ich merkte, dass meine Stimme als Israeli in Deutschland auf ein anderes Echo stößt. Aber ich will nicht die Rolle des jüdisch-israelischen Kronzeugen übernehmen. Und das passiert leider zu oft. Immer wieder wird meine Kritik an der israelischen Politik von Leuten zitiert, die einseitig Schuld zuweisen möchten. »Ich bin längst nicht der Einzige, der die deutsche Israelpolitik kritisiert«, konstatierte zuletzt in der Zeit einer dieser »Israelkritiker« und zitierte äußerst selektiv aus einem meiner Texte.[5]





























