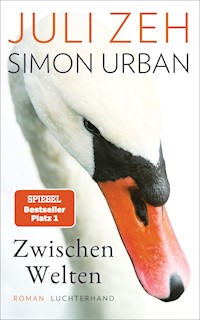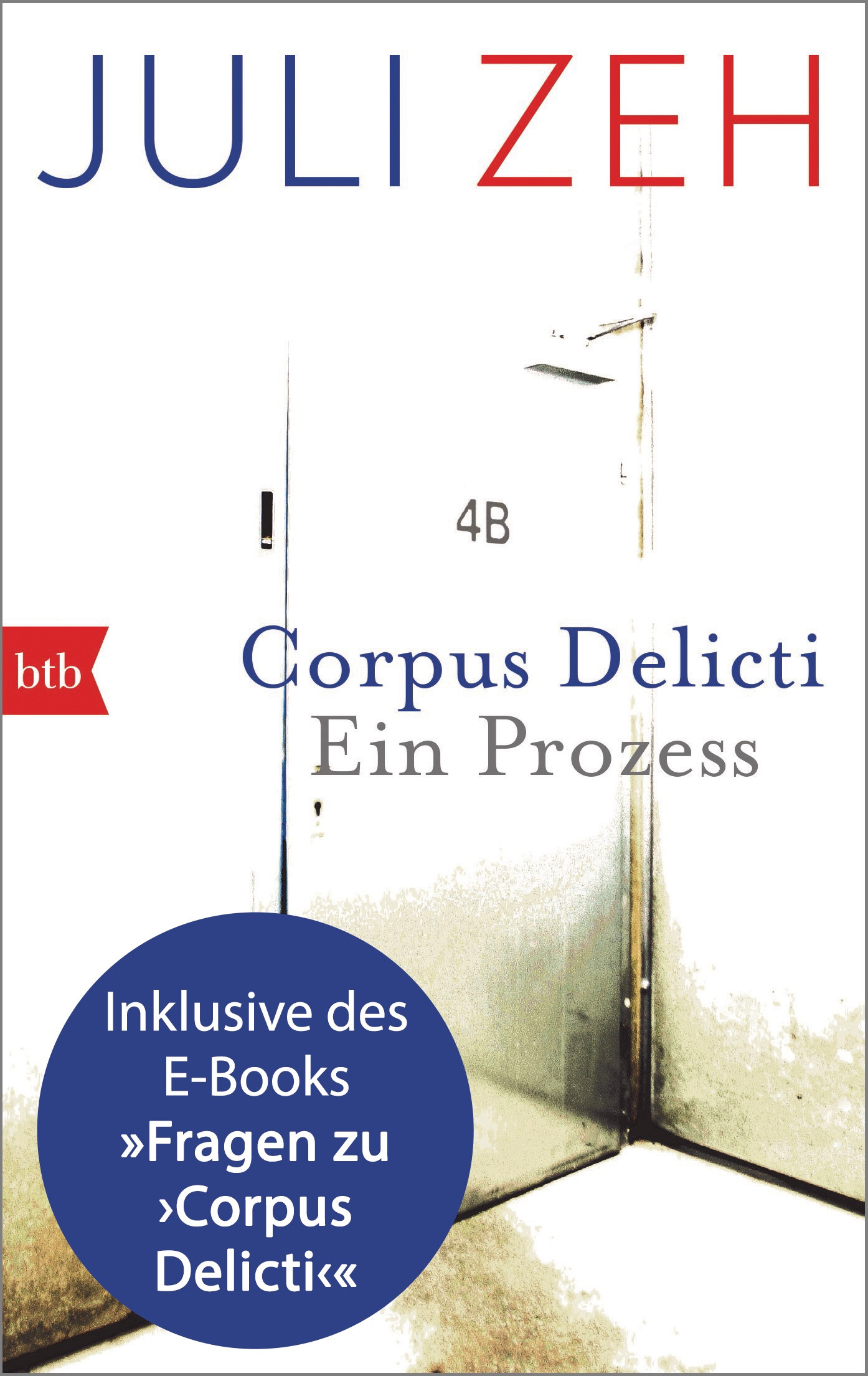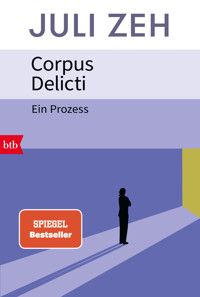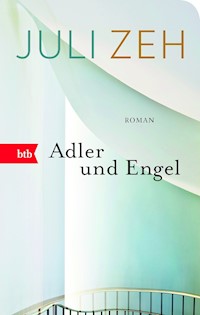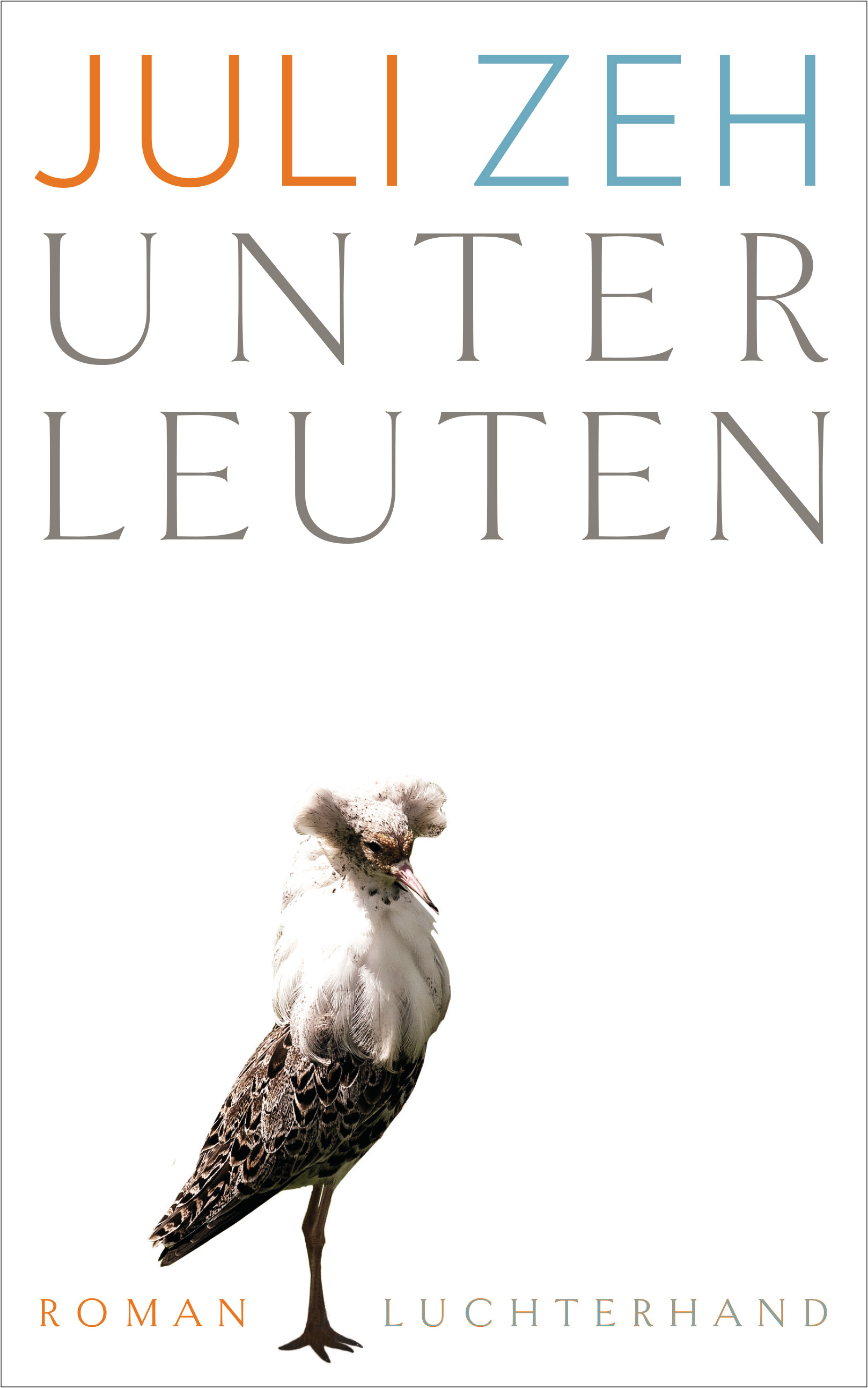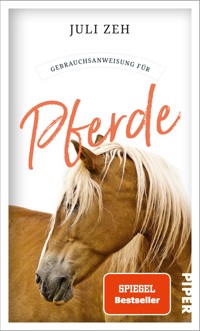11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ab 10 Euro
- Sprache: Deutsch
Trauen wir uns, Mensch zu sein?
Dora ist mit ihrer kleinen Hündin aufs Land gezogen. Sie musste dringend raus aus der Stadt, auch wenn sie nicht genau weiß, wovor sie auf der Flucht ist. Großstadt, Lockdown, stressiger Job, ein übereifriger Freund, dazu Donald Trump, Brexit und Rechtspopulismus – wann ist die Welt eigentlich dermaßen durcheinandergeraten? Dass Bracken, dieses kleine Dorf im brandenburgischen Nirgendwo, nicht die ländliche Idylle ist, von der manche Städter träumen, war Dora klar. Alle haben sie vor der Provinz gewarnt. Jetzt sitzt sie trotzdem hier, in einem alten Haus auf einem verwilderten Grundstück, mit einem kahlrasierten Nachbarn hinter der Gartenmauer, der sämtlichen Vorurteilen zu entsprechen scheint. Doch dann passieren Dinge, die ihr Weltbild ins Wanken bringen. Sie trifft Menschen, die in kein Raster passen, und steht vor einer Herausforderung, die Antwort auf die große Frage verlangt, worauf es im Leben eigentlich ankommt.
Juli Zehs neuer großer Roman erzählt von unserer unmittelbaren Gegenwart und den Menschen, die sie hervorbringt. Von ihren Befangenheiten, Schwächen und Ängsten. Und von ihren Stärken, die zum Vorschein kommen, wenn sie sich trauen, Mensch zu sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zum Buch
Dora ist mit ihrer kleinen Hündin aufs Land gezogen. Sie musste dringend raus aus der Stadt, auch wenn sie nicht genau weiß, wovor sie auf der Flucht ist. Großstadt, Lockdown, stressiger Job, ein übereifriger Freund, dazu Donald Trump, Brexit und Rechtspopulismus – wann ist die Welt eigentlich dermaßen durcheinander geraten? Dass Bracken, dieses kleine Dorf im brandenburgischen Nirgendwo, nicht die ländliche Idylle ist, von der manche Städter träumen, war Dora klar. Alle haben sie vor der Provinz gewarnt. Jetzt sitzt sie trotzdem hier, in einem alten Haus auf einem verwilderten Grundstück, mit einem kahlrasierten Nachbarn hinter der Gartenmauer, der sämtlichen Vorurteilen zu entsprechen scheint. Doch dann passieren Dinge, die ihr Weltbild ins Wanken bringen. Sie trifft Menschen, die in kein Raster passen, und steht vor einer Herausforderung, die Antwort auf die große Frage verlangt, worauf es im Leben eigentlich ankommt. Juli Zehs neuer großer Roman erzählt von unserer unmittelbaren Gegenwart und den Menschen, die sie hervorbringt. Von ihren Befangenheiten, Schwächen und Ängsten. Und von ihren Stärken, die zum Vorschein kommen, wenn sie sich trauen, Mensch zu sein.
Zur Autorin
JULI ZEH, 1974 in Bonn geboren, Jurastudium in Passau und Leipzig, Studium des Europa und Völkerrechts, Promotion. Längere Aufenthalte in New York und Krakau. Schon ihr Debütroman »Adler und Engel« (2001) wurde zu einem Welterfolg, inzwischen sind ihre Romane in 35 Sprachen übersetzt. Juli Zeh wurde für ihr Werk vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Rauriser Literaturpreis (2002), dem Hölderlin-Förderpreis (2003), dem Ernst-Toller-Preis (2003), dem Carl-Amery-Literaturpreis (2009), dem Thomas-Mann-Preis (2013), dem Hildegard-von-Bingen-Preis (2015) und dem Bruno-Kreisky-Preis (2017) sowie dem Heinrich-Böll-Preis der Stadt Köln (2019). 2018 wurde sie mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Im selben Jahr wurde sie zur Richterin am Verfassungsgericht des Landes Brandenburg gewählt. Mehr unter www.juli-zeh.de.
JULI ZEH
Über Menschen
Roman
Luchterhand
Die Handlung und alle handelnden Personen dieses Romans sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder realen Personen wäre rein zufällig.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2021 Luchterhand Literaturverlag, München
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Covergestaltung: buxdesign, München
Covermotiv: Plainpicture/DEEPOL
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-27718-5V003
www.luchterhand-literaturverlag.de
www.facebook.com/luchterhandverlag
Inhalt
TEIL EINS RECHTE WINKEL
1 Bracken
2 Robert
3 Gote
4 Müllinsel
5 Gustav
6 Pfandflaschen
7 R2-D2
8 Pflanzkanacken
9 Taschenlampe
10 Bus
11 Center
12 Axel
13 Tom
TEIL ZWEISAATKARTOFFELN
14 AfD
15 Jojo
16 Brandenburg
17 Steffen
18 Mon Chéri
19 Franzi
20 Horst Wessel
21 Rochen
22 Krisse
23 Hortensien
24 Soldaten
25 E-Mail
26 Farbe
27 Sadie
28 Museum
29 Messer
30 Über Menschen
TEIL DREI RAUMFORDERUNG
31 Au revoir
32 Skulptur
33 Vater, Tochter
34 Herr Proksch
35 Raumforderung
36 Frühkartoffeln
37 Einhorn
38 Fleischlappen
39 Pudding
40 Pieps
41 Gebrüll
42 Floyd
43 Blühende Freundschaften
44 Fest
45 Schütte
46 Hochsitz
47 Power Flower
48 Stau
49 Proksch ist tot
50 Regen
TEIL EINS RECHTE WINKEL
1 Bracken
Weitermachen. Nicht nachdenken.
Dora rammt den Spaten in den Boden, zieht ihn wieder heraus, durchtrennt mit einem Hieb eine hartnäckige Wurzel und wendet das nächste Stück sandiger Erde. Dann wirft sie ihr Werkzeug beiseite und presst die Hände ins Kreuz. Rückenschmerzen. Mit – sie muss kurz rechnen – 36 Jahren. Seit dem fünfundzwanzigsten Geburtstag muss sie immer nachrechnen, wenn es um ihr Alter geht.
Nicht nachdenken. Weitermachen. Der schmale Streifen umgegrabener Erde taugt noch lange nicht zum Erfolgserlebnis. Wenn sie sich umsieht, wird das Gefühl existenzieller Chancenlosigkeit übermächtig. Das Grundstück ist viel zu groß. Es sieht nicht aus wie etwas, das »Garten« heißen könnte. Ein Garten ist ein Stück Rasen, auf dem ein Würfelhaus steht. Wie in dem Münsteraner Vorort, in dem Dora aufgewachsen ist. Oder vielleicht auch eine Miniaturblumenwiese auf einer Baumscheibe in Berlin-Kreuzberg, wo Dora zuletzt gewohnt hat.
Was sie jetzt umgibt, ist kein Garten. Es ist auch kein Park oder Feld. Am ehesten ist es ein »Flurstück«. So heißt es im Grundbuch. Aus dem Grundbuch weiß Dora, dass eine Fläche von 4.000 Quadratmetern zum Haus gehört. Ihr war nur nicht klar, was 4.000 Quadratmeter sind. Ein halbes Fußballfeld, darauf ein altes Haus. Eine verwilderte Brachfläche, platt gedrückt und ausgeblichen von einem Winter, der gar nicht stattgefunden hat. Eine botanische Katastrophe, die sich durch Doras Anstrengung in einen romantischen Landhausgarten verwandeln soll. Mit Gemüsebeet.
Das ist der Plan. Wenn Dora im Umkreis von 70 Kilometern schon niemanden kennt und keine Möbel besitzt, will sie wenigstens eigenes Gemüse. Weil Tomaten, Möhren und Kartoffeln täglich davon erzählen würden, dass sie alles richtig gemacht hat. Dass der plötzliche Kauf eines alten Gutsverwalterhauses, sanierungsbedürftig und fernab aller Speckgürtel, keine neurotische Kurzschlussreaktion war, sondern der nächste logische Schritt auf dem Wanderweg ihrer Biographie. Wenn sie einen Landhausgarten besitzt, werden Freunde aus Berlin am Wochenende zu Besuch kommen, auf alten Stühlen im hohen Gras sitzen und seufzen: »Mann, hast du es schön hier.« Falls ihr bis dahin einfällt, wer ihre Freunde sind. Und falls man sich jemals wieder gegenseitig besuchen darf.
Dass Dora vom Gärtnern nicht die geringste Ahnung hat, ist kein Hindernis. Wozu gibt es YouTube. Glücklicherweise gehört sie nicht zu den Menschen, die glauben, man müsse Maschinenbau studieren, bevor man den Heizungszähler ablesen kann. Wie Robert mit seiner Bedenkenträgerei und seinem Perfektionismus. Robert, der ihre Beziehung einfach weggeworfen und sich in die Apokalypse verliebt hat. Die Apokalypse ist eine Nebenbuhlerin, mit der es Dora nicht aufnehmen kann. Die Apokalypse verlangt Gefolgschaft, hinauf zu den Höhen kollektiver Schicksalsbewältigung. Dora ist nicht gut im Folgen. Warum sie fliehen musste und dass es nicht um den Lockdown ging, hat Robert nicht verstanden. Als sie ihre Sachen die Treppe hinuntertrug, sah er sie an, als hätte sie den Verstand verloren.
Nicht nachdenken. Weitermachen. Aus dem Internet weiß sie, dass die Pflanzzeit im April beginnt, dieses Jahr aufgrund des milden Winters sogar noch früher. Jetzt ist Mitte April, also muss sie sich mit dem Umgraben beeilen. Vor zwei Wochen, kurz nach ihrem Umzug, hat es plötzlich geschneit. Das erste und einzige Mal in diesem Jahr. Große Flocken schwebten vom Himmel und sahen aus wie etwas Künstliches, ein Special Effect der Natur. Das Flurstück verschwand unter einer dünnen weißen Decke. Endlich sauber, endlich still. Dora erlebte einen Moment tiefer Ruhe. Ohne Schnee erzählt das Flurstück unablässig von Verwüstung und Vernachlässigung. Ein ständiger Imperativ, alles in Ordnung zu bringen, und zwar schnell.
Dora ist kein typischer Großstadtflüchtling. Sie ist nicht hergekommen, um sich mithilfe von Biotomaten zu entschleunigen. Natürlich ist das Leben in der Stadt oft stressig. Überfüllte S-Bahnen und die ganzen Spinner auf den Straßen. Dazu Deadlines, Meetings, der hohe Zeit- und Konkurrenzdruck in der Agentur. Aber das kann man auch mögen, und der Stress in der Stadt ist wenigstens einigermaßen gut organisiert. Hier draußen auf dem Land herrscht eine Anarchie der Dinge. Dora ist umgeben von Sachen, die tun, was sie wollen. Gegenstände, die reparaturbedürftig, halb funktionstüchtig, verdreckt, verwahrlost, völlig zerstört oder gar nicht vorhanden sind, obwohl man sie dringend benötigt. In der Stadt sind die Dinge halbwegs unter Kontrolle. Städte sind Kontrollzentren für die dingliche Welt. Für jeden Gegenstand gibt es dort mindestens eine Person, die zuständig ist. Es gibt Orte, an denen man Sachen bekommt und an die man sie bringen kann, wenn man sie nicht mehr will. Auf dem Flurstück hingegen gibt es nur Dora als Zuständige sowie eine herrschsüchtige Natur, die alles überwuchert, was sie in die rankigen Finger kriegt.
Ein paar Amseln fliegen heran, um in der umgegrabenen Erde nach Regenwürmern zu suchen. Einer der schwarzen Vögel setzt sich auf den Spatenstiel, eine Impertinenz, die Doras kleine Hündin namens Jochen-der-Rochen den Kopf heben lässt. Eigentlich erholt sich Jochen-der-Rochen gerade in der Frühlingssonne von einer weiteren Nacht im kalten Landhaus. Aber jetzt muss sie aufstehen, mit der Würde eines Großstadttiers, das den gefiederten Landpomeranzen die Meinung sagt. Danach kehrt sie auf ihr sonnenwarmes Plätzchen zurück, lässt sich auf den Bauch sinken und spreizt die Hinterbeine, was ihrem Körper die dreieckige Rochenform verleiht, der Jochen ihren Namen verdankt.
Manchmal bleibt Doras Verstand an Sätzen hängen, die sie irgendwo gelesen hat, oder, besser gesagt, die Sätze bleiben an ihr haften, und ihr Geist betastet sie wie eine Kruste, die sich nicht entfernen lässt. So eine Kruste ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, der besagt, dass Unordnung immer ihrem maximalen Wert zustrebt, wenn man nicht enorme Energie aufbringt, um wieder Ordnung zu schaffen. Entropie. Daran muss Dora denken, wenn sie sich umsieht, nicht nur auf ihrem Flurstück, sondern im ganzen Dorf, im ganzen Landkreis. Bröckelnde Straßen, halb eingestürzte Scheunen und Ställe, von Efeu überwucherte ehemalige Kneipen. Schrottberge auf den Brachflächen, aufgeplatzte Mülltüten im Wald. Die Gärten mit ihren neuen Zäunen und frisch gestrichenen Häusern sind Inseln, auf denen die Menschen gegen die Entropie kämpfen. Als reiche die Kraft jedes Einzelnen nur für ein paar Quadratmeter Welt. Dora hat noch keine Insel. Sie steht gewissermaßen auf einem Floß, bewaffnet mit rostigen Werkzeugen, die sie im Schuppen gefunden hat, und stemmt sich der Entropie entgegen.
Sie hat das Dorf gegoogelt, damals vor sechs Monaten, in einer anderen Epoche, in einer anderen Welt, als sie die Anzeige auf eBay Kleinanzeigen entdeckte. Laut Wikipedia ist »Bracken ein Wohnplatz der Gemeinde Geiwitz nahe der Stadt Plausitz im Landkreis Prignitz des Landes Brandenburg. Zugehörig ist der Siedlungsplatz Schütte, unbewohnt. Das Dorf wird erstmals in einer Urkunde des Bischofs Siegfried vom Jahre 1184 erwähnt. Aufgrund slawischer Funde in der Ortslage lässt sich davon ausgehen, dass Bracken aus einer slawischen Siedlung hervorgegangen ist«.
Ein typisches ostdeutsches Straßendorf. In der Mitte eine Kirche mit Dorfplatz. Bushaltestelle, Feuerwehr, Briefkasten. 284 Einwohner. Mit Dora 285, wobei sie noch nicht beim Meldeamt gewesen ist. Das hat wegen Corona geschlossen. Derzeit kein Publikumsverkehr. So steht es auf der Homepage vom Amt Geiwitz.
Dora wusste gar nicht, dass sie zu einem Publikum gehört. Wer sind die Schauspieler? Nicht darüber nachdenken. Nicht hängen bleiben. Es gibt jetzt so viele seltsame neue Begriffe. Social Distancing. Exponentielles Wachstum. Übersterblichkeit und Spuckschutzscheibe. Dora kommt schon seit Wochen nicht mehr mit. Vielleicht auch schon seit Monaten oder Jahren, aber durch Corona ist das Nicht-mehr-Mitkommen manifest geworden. Die neuen Begriffe umschwirren ihren Kopf wie Fliegen, die sich nicht vertreiben lassen, egal, wie heftig man mit den Armen wedelt. Deshalb hat Dora beschlossen, dass alle diese Wörter sie nichts mehr angehen. Sie stammen aus einer fremden Sprache in einem fremden Land. Zum Ausgleich hat sie das Wort »Bracken« bekommen. Auch dieses Wort fühlt sich noch fremd an. Es klingt nach einer Mischung aus Brachen und Baracken. Oder nach einer Tätigkeit, die auf Baustellen ausgeübt wird, unter starker Lärmentwicklung, mit schwerem Gerät. Morgen wird gebrackt. Wir brauchen noch ein paar Leiharbeiter zum Bracken. Bevor die Fundamente gegossen werden können, müssen wir das hier noch einmal gründlich bracken.
En-tro-pie, En-tro-pie, skandieren die Gedanken. Weitermachen, setzt Dora bewusst dagegen. Sie kann das: weitermachen, auch wenn es sich unmöglich anfühlt. In der Werbeagentur gehört das Weitermachen zum Alltag. Neue Deadline, neuer Pitch. Zu wenig Leute, zu wenig Zeit. Präsentation lief super, Präsentation lief scheiße. Etat gewonnen, Etat verloren. Wir müssen digitaler denken, wir müssen 360 Grad denken, von der Karussell Ad über den Funkspot bis zum Social Video, sagt Susanne, die Gründerin von Sus-Y, bei jedem Monday Breakfast, einem als Frühstück getarnten Zwei-Stunden-Meeting. Wir verdienen an kreativer Exzellenz und unserer einzigartigen Positionierung. Und daran, dass wir unsere Kunden wirklich verstehen. Dass wir ihnen helfen, ihre Probleme nachhaltig zu lösen. – Das Monday Breakfast vermisst Dora nicht. Was das Monday Breakfast betrifft, könnte Corona noch ewig dauern.
Wenn man weitermacht, obwohl es sich unmöglich anfühlt, kommt manchmal das Würgen. Als hätte man etwas Verdorbenes auf dem Teller, das es trotzdem zu schlucken gilt. Dagegen hilft nur Augen schließen, Nase zuhalten und durch. Den Spaten in die Erde stechen. Entropie. En, zustechen. Tro, nachtreten. Pie, die nächste Ladung heraushebeln.
Sie hat eine schöne Stelle zwischen den Obstbäumen ausgesucht – Äpfel, Birnen und eine Kirsche, die gerade zaghaft zu blühen beginnt. Ein Stück entfernt vom Haus, aber nah genug, um das Beet vom Küchenfenster aus zu sehen. Die Fläche ist einigermaßen eben und nicht so dicht mit Jungbäumen bewachsen wie der vordere Teil des Flurstücks, der stellenweise vergittert wirkt von daumendicken Stämmchen. Ahorn und Robinie. Mit Bäumen kennt Dora sich aus. Robert hat Biologie studiert und ihr bei jedem Spaziergang im Tiergarten ausführlich von den Bäumen erzählt. Wie sie wachsen, wie sie sich vermehren. Was sie denken und fühlen. Dora mochte diese Gespräche, und sie hat einiges gelernt. Die Robinie ist ein invasiver Neophyt, ein Baum-Migrant. Sie vermehrt sich schnell und verdrängt andere Arten. Von den Bienen wird die Robinie allerdings heiß geliebt. Die unzähligen Bäumchen mit Gartenschere und Handsäge zu entfernen wird Wochen in Anspruch nehmen.
Zwischen den Obstbäumen wächst kein Robiniendickicht, dafür aber Brombeeren, besser gesagt ein trockenes Rankengewirr vom Vorjahr, das den Boden bei Doras Ankunft fast vollständig bedeckte. Die alte Sense kann sie zwar führen, trotz YouTube-Tutorial aber nicht richtig schärfen, weshalb sie mit der stumpfen Klinge auf die Brombeeren eingedroschen hat, als wollte sie mit einer Machete den Dschungel durchqueren. Am ersten Tag ist sie nach einer durchfröstelten Nacht noch in Winterkleidung rausgegangen: langes Baumwollhemd, dickes Sweatshirt, gefütterte Jacke. Eine Viertelstunde später fing sie an, sich wie eine Zwiebel zu häuten, und stand bald im Unterhemd neben einem Berg Klamotten. Seitdem geht sie nur noch im T-Shirt vor die Tür, egal, wie frostig der Morgen wirkt. Morgens ist die Luft wie frisch gewaschen; die Gänsehaut fühlt sich angenehm an. Während es im Haus kühl bleibt, klettert die Temperatur draußen im Lauf des Tages fast auf zwanzig Grad. Sehr zur Freude von Jochen, die seit dem Umzug ins neue Domizil darauf besteht, die Nächte unter Doras Bettdecke zu verbringen. Tagsüber zieht die Hündin auf der Suche nach den kräftigsten Sonnenstrahlen durch den Garten wie eine wandelnde kleine Solarzelle.
Ostern ist geräuschlos vorübergegangen. Der Lockdown, heißt es, vergrößere viele Unterschiede; den zwischen Werktagen und Feiertagen ebnet er ein. Nach der Rodung hat Dora zwischen den Obstbäumen ein Rechteck von zehn mal fünfzehn Metern freigelegt und die Grenzen mit einer gespannten Schnur markiert. Die Kanten sind herrlich gerade geworden und die Winkel extrem rechts. Die roten Schnüre ließen die neu eröffnete Baustelle professionell und den Rest der Aufgabe wie reine Formsache wirken.
Was sich als Irrtum herausstellt. Seit Tagen stößt Dora den Spaten entlang der Schnüre in die Erde, um die Grasnarbe in großen Brocken zu entfernen. Wobei von Gras eigentlich keine Rede sein kann; »Unkrautnarbe« müsste es heißen. Die Wurzeln halten den Boden so fest zusammen, dass sich Dora mit beiden Füßen aufs Spatenblatt stellen und mehrmals auf und nieder springen muss, um es in die Erde zu treiben. Ein Knochenjob und erst der Anfang der Probleme, denn die eigentliche Herausforderung beginnt ein Stück tiefer. Sie besteht in den Hinterlassenschaften eines Systems, in dem anscheinend niemand glaubte, für den Kampf gegen die Entropie zuständig zu sein. Wer auch immer zu DDR-Zeiten im alten Gutsverwalterhaus gelebt hat, fand es angemessen, Schutt, Schrott und Müll in den Garten zu werfen. Doras Spaten trifft auf zerbrochene Ziegelsteine, rostige Metallteile, alte Plastikeimer, kaputte Flaschen, einzelne Schuhe und rostige Kochtöpfe. Auch Kinderspielzeug ist dabei: bunte Sandförmchen, Räder von kleinen Autos, einmal sogar ein Puppenkopf, der unheimlich aus der Erde heraufschaute. Die Fundstücke sammelt Dora am Rand, sie säumen den Streifen umgegrabener Erde.
Sie hebt den Spaten auf und stützt sich auf den Griff. Langsam kehrt die Kraft in Arme und Beine zurück. Schon nach zwei Wochen Landleben wirken ihre Hände rot und schwielig. Dora wendet sie hin und her und betrachtet sie wie Gegenstände, die nicht zu ihrem Körper gehören. Die Hände waren schon immer zu groß. Manchmal bekommt Dora Angst, sie könnten sich ohne ihr Zutun bewegen. Als stünde ein größerer Mensch hinter ihr und hätte seine Arme durch ihre Ärmel gesteckt. Früher hat sie ihr Bruder Axel deswegen gehänselt. »Doraflossen!«, rief er, worüber sie stets in heftige Wut geriet. Bis zum Tod der Mutter. Danach ärgerten sie einander nicht mehr, sondern waren unentwegt nett zueinander. Als wäre alles, sogar Doras große Hände, zu zerbrechlichem Glas geworden.
Robert hat immer behauptet, ihre Hände zu mögen, jedenfalls solange er überhaupt noch etwas an ihr gemocht hat. Bevor sie sich erst in ein CO2-Problem, dann in eine potenzielle Corona-Keimschleuder verwandelt hat.
Aus Erfahrung weiß Dora, dass sie sich nicht zu lange ausruhen darf. Wenn die Pause zu lang dauert, beginnt sie zu rechnen, und auf Berechnungen folgt die Sinnfrage. Vor knapp zwei Wochen hat sie mit dem Roden begonnen; seit drei Tagen verausgabt sie sich beim Umgraben. Der fertige Streifen ist etwa anderthalb Meter breit. Folglich hat Dora nicht einmal ein Sechstel der Gesamtfläche geschafft. Wenn sie in diesem Tempo weitermacht, geht noch der halbe Mai vorbei, bis sie aussäen kann. Das Schlimme ist, dass das nicht schlimm ist. Gemüse kann man im Supermarkt kaufen. Wahrscheinlich ist es dort sogar günstiger als im eigenen Garten, wenn man die Kosten der Bewässerung einberechnet. Der Lockdown ist unheimlich, aber nicht bedrohlich genug, um den Anbau eigener Kartoffeln zwingend zu machen. Es gibt keinen Grund für einen Gemüsegarten. Außer Landhausromantik und Freunde, die zu Besuch kommen sollen. Nur dass Dora mit Landhausromantik nichts anfangen kann und keine Freunde hat. In Berlin fiel das nicht auf. Die Arbeit ließ wenig Zeit, und Robert hatte genug Freunde für sie beide. Hier auf dem Land wird die Nicht-Existenz von Freunden zu einem dumpfen Grollen am Horizont.
Es war idiotisch, gleich ein so großes Terrain abzustecken. Typischer Anfängerfehler. Fünfzehn Quadratmeter statt hundertfünfzig hätten für den Einstieg vollkommen gereicht. Aber Dora hat keine Lust, ihre sauber gespannten Fäden wieder abzubauen. Immerhin lebt sie seit Jahren von der Fähigkeit, angefangene Projekte zu Ende zu bringen, ganz egal, wie absurd es sich anfühlt. Der Umgang mit Kunden, die ihre Meinung täglich ändern, die immer wieder neue Varianten verlangen, sich gegenseitig widersprechen und aus Angst vor ihren Vorgesetzten keine Entscheidungen treffen, ist mit Sicherheit schwieriger als Gartenarbeit.
Weitermachen. Wenn sie den Garten nicht schafft, muss sie sich fragen, warum sie das Haus gekauft hat.
Die Antwort wäre einfach, wenn sie behaupten könnte, schon im letzten Herbst geahnt zu haben, das Corona im Anmarsch war. Dann wäre das Haus auf dem Land ein Refugium, in dem sie sich verstecken kann, bis die Pandemie vorbei ist. Aber sie hat nichts geahnt. Als Dora anfing, Immobilienanzeigen im Internet zu lesen, schienen Klimawandel und Rechtspopulismus die wichtigsten Probleme zu sein. Als sie im Dezember heimlich zum Notar in Berlin-Charlottenburg ging, war Corona eine Schlagzeile, für die man weit nach unten scrollen musste, irgendetwas, das in Asien stattfand. Als sie das kleine Erbe ihrer Mutter sowie sämtliche Ersparnisse zusammenkratzte, um den Eigenkapitalanteil des Kaufpreises zu überweisen, wusste Dora immer noch nicht, ob sie überhaupt aufs Land ziehen wollte. Sie wusste nur, dass sie das Haus brauchte. Dringend. Als Idee. Als mentale Überlebenstechnik. Als hypothetischen Notausgang aus dem eigenen Leben.
In den vergangenen Jahren hat Dora immer wieder gehört, dass Menschen ein Haus auf dem Land erwerben. Meist als Zweitwohnsitz. Sie tun das in der Hoffnung, dem Kreislauf der Projekte zu entkommen. Alle Leute, die Dora kennt, sind mit diesem Kreislauf vertraut. Man beendet ein Projekt, um gleich darauf das nächste anzufangen. Für eine Weile glaubt man, das aktuelle Projekt sei das Wichtigste auf der Welt, man tut alles dafür, um es rechtzeitig und so gut wie möglich zu beenden. Nur um dann zu erleben, wie alle Bedeutung im Moment der Fertigstellung kollabiert. Gleichzeitig beginnt das nächste, noch wichtigere Projekt. Es gibt kein Ankommen. Streng genommen gibt es nicht mal ein Weiterkommen. Es gibt nur Kreisbahnen, auf denen sich alle bewegen, weil sie Angst vor dem Stillstand haben. Inzwischen hat fast jeder heimlich verstanden, dass das sinnlos ist. Auch wenn man ungern darüber spricht. Dora sieht es in den Augen ihrer Kollegen, im tief verunsicherten Blick. Nur Neueinsteiger glauben noch, man könne »es« schaffen. Dabei ist »es« unschaffbar, weil »es« die Gesamtheit aller denkbaren Projekte darstellt und weil in Wahrheit nicht das Eintreffen, sondern das Ausbleiben des nächsten Projekts die größte anzunehmende Katastrophe wäre. Die Schaffbarkeit von »es« ist die Grundlüge der modernen Lebens- und Arbeitswelt. Ein kollektiver Selbstbetrug, inzwischen lautlos zerplatzt.
Seit diese Erkenntnis in die U-Bahn-Schächte der Metropolen eingesickert ist und an jedem Kaffeeautomaten, in jedem Fahrstuhl, auf jeder Etage der Bürotürme heimlich umgewälzt wird, bekommen die Menschen Burn-out. Gleichzeitig dreht sich das Rad immer schneller. Als könnte man der Unsinnigkeit des Rennens durch Schneller-Rennen entkommen.
Das kann man auch. Jedenfalls hat Dora es immer gekonnt. Sie hat sich nie gegen den Kreislauf der Projekte gewehrt, sondern ihn als zeitgemäßes Lebensmodell akzeptiert. Aber dann hat sich etwas verändert. Nicht in Dora, sondern außen herum. Dora kam nicht mehr mit, und die Idee vom Landhaus hat dem Nicht-mehr-Mitkommen ein Gehäuse gegeben. Das war letzten Herbst, und jetzt steht sie hier, inmitten ihrer Brackener Brache, und bekommt es mit der Angst zu tun. Der Kreislauf der Projekte könnte außer Kontrolle geraten. Der Anblick des Flurstücks macht das klar. Das Flurstück ist ihr nächstes verdammtes Projekt, und vielleicht ist es dieses Mal eine Nummer zu groß.
Verärgert beschließt sie, mit dem Weitermachen aufzuhören. Sie wird sich zwingen, eine halbe Stunde Nichtstun zu ertragen. Sie lässt den Spaten los und stapft durch die Brennnesseln vom Vorjahr Richtung Haus, wo im Schatten der Linde eine kleine Sitzgruppe steht. Die wackligen Gartenmöbel hat Dora im Schuppen gefunden, genau wie die anderen Requisiten ihrer Landhauszukunft. Wie sagte der Makler? »Idylle ist, wenn man sich’s gemütlich macht.« Wahrscheinlich einer der Sprüche, die man dringend braucht, um in dieser Gegend kaputte Häuser zu verkaufen.
Dora setzt sich auf einen der Stühle, streckt die Beine und fragt sich, ob sie inzwischen genauso bescheuert ist wie die Leute in Prenzlauer Berg, die zur Entschleunigung Yoga-Stunden und Meditation in ihre übervollen Zeitpläne packen. Sie weiß, dass der Projekte-Kreislauf eine Falle ist, der man nicht leicht entkommt. Er verwandelt auch die Ent-Projektierung des Daseins in ein neues Projekt. Andernfalls würde er nicht Millionen von Opfern fordern. Dora atmet tief in den Bauch und sagt sich, dass ihr Problem völlig anders gelagert ist. Sie hat kein Problem mit Projekten, sondern mit Robert. Etwas ist passiert, und sie kommt einfach nicht mit.
2 Robert
Dora weiß nicht mehr, wann es angefangen hat. Sie weiß noch, dass sie schon während Roberts Klimaschützerphase manchmal dachte, dass er übertreibt. Wenn er die Politiker als Volltrottel und seine Mitmenschen als selbstsüchtige Ignoranten beschimpfte. Wenn er sich über Doras Fehler bei der Mülltrennung aufregte, als hätte sie ein Verbrechen begangen. Da schien er ihr manchmal übereifrig und unversöhnlich, und sie überlegte, ob er vielleicht an einer Neurose, an einer Art politischem Waschzwang litt, der aus dem nachdenklichen, sanften Menschen einen Besessenen gemacht hat.
Wobei sie am Anfang vor allem Bewunderung für ihn empfand, gewürzt mit einer Prise schlechtem Gewissen. Robert nahm die Sache ernst. Robert wurde politisch aktiv. In der Online-Zeitung, für die er arbeitete, gründete er ein eigenes Ressort für Klimafragen. Außerdem fing er an, sein Leben zu ändern, ernährte sich vegan, kaufte klimafreundliche Klamotten und ging regelmäßig zu den Freitagsdemonstrationen. Dass Dora nicht mitkommen wollte, verstörte ihn. Glaubte sie nicht an den menschengemachten Klimawandel? Sah sie nicht, dass die Welt auf den Untergang zusteuerte? Die Statistiken hielten Einzug in ihre Gespräche. Robert verwies auf Zahlen, Experten und Wissenschaft. Dora saß vor ihm als Repräsentantin der dummen Masse, die sich partout nicht überzeugen lassen wollte. Wenn er richtig in Fahrt kam, warf er ihr sogar ihren Job vor. Dass sie mit ihrer Arbeit den Konsum ankurbele. Dass sie Menschen dazu bringe, Dinge zu kaufen, die sie gar nicht wollten und erst recht nicht brauchten. Dora als Agentin der Wegwerfgesellschaft. Energievernichtend und müllbergvergrößernd. Sie hatte noch nie das Bedürfnis, die Werbebranche zu verteidigen. Trotzdem tat es weh, wenn Robert so mit ihr sprach.
Schließlich mangelt es ihr nicht an Überzeugung. Natürlich hält sie den Klimawandel für ein schwerwiegendes Problem. Was sie lähmt, ist die Ansprache. »How dare you« statt »I have a dream«. Statt über Temperaturziele zu streiten, sollte man sich ihrer Meinung nach lieber auf das Wesentliche konzentrieren – das Ende des fossilen Zeitalters, welches sich nicht erreichen lässt, indem man die Bürger besser erzieht, sondern nur durch einen Umbau von Infrastruktur, Mobilität und Industrie. Dass Robert im Angesicht dieser Aufgabe stolz darauf ist, kein Auto zu fahren, kommt ihr merkwürdig vor.
Dora mag keine absoluten Wahrheiten und keine Autoritäten, die sich darauf stützen. In ihr wohnt etwas, das sich sträubt. Sie hat keine Lust auf den Kampf ums Rechthaben und will nicht Teil einer Meinungsmannschaft sein. Normalerweise ist ihr Sträuben kein Sich-Wehren. Man sieht es nicht. Sie lebt angepasst. Das Sträuben erzeugt eher eine Art Trotz, ein inneres Ankämpfen gegen die Verhältnisse. Deshalb musste sie Robert irgendwann sagen, dass er aufpassen solle, ab wann es bei seinen Statistiken nicht mehr um ernsthafte Anliegen, sondern ums Rechthaben gehe. Er schaute sie erschrocken an und fragte, ob sie die alternativen Fakten eines Donald Trump bevorzuge.
Da zeigte sich zum ersten Mal das Problem mit Doras Gedanken: Sie waren jetzt unverständlich, vielleicht sogar verwerflich. Man konnte nicht darüber sprechen. Jedenfalls nicht mit Robert. Nicht mehr. Er saß vor ihr wie eine Instanz, strahlend und selbstsicher. Über jeden Irrtum, jeden Zweifel erhaben. Angehöriger einer Gruppe, die das Mängelwesen Mensch transzendiert hat. Da kam Dora nicht mit.
Gleichzeitig schämte sie sich für ihr Sträuben und den Trotz. Im Grunde war es doch gleichgültig, ob es Robert ums Rechthaben ging, solange er wirklich recht hatte. Klimapolitik war und ist eine wichtige Sache. Außerdem wirkte Robert zufrieden, während Dora häufig an Selbstzweifeln litt. Es musste sich gut anfühlen, für eine wichtige Sache zu kämpfen. Robert brauchte sich die Sinnfrage nicht mehr zu stellen. Er hatte sogar den Projekte-Kreislauf überwunden, indem er viele kleine zu erreichende Ziele gegen ein vermutlich unerreichbares Großziel eintauschte. Ein genialer Schachzug, eine geschickte Rochade.
Dora beschloss, sich Mühe zu geben. Sie verzichtete auf Fleisch. Sie kaufte im Bioladen ein. Robert zuliebe wechselte sie sogar die Agentur. Sus-Y ist mittelgroß, auf nachhaltige Produkte sowie Non-Profit-Organisationen spezialisiert und hat sich vorgenommen, verantwortungsvolle Unternehmen bei der Umsetzung ihrer sozialökologischen Ideen zu unterstützen. Statt Dosensuppen, Luxus-Kreuzfahrten oder Direktversicherungen zu bewerben, entwickelt Dora bei Sus-Y Ideen für vegane Schuhe, den plastiktütenfreien Tag oder fair gehandelte Schokolade. Dass auf ihrer Visitenkarte statt »Senior-Copywriter« nur noch das einsame Wörtchen »Text« steht, hat sie nie gestört. Auch nicht, dass sie etwas weniger verdient als zuvor. Aber aus Roberts Sicht genügte das alles nicht. Noch lange nicht. Schließlich begriff Dora, was er wollte, und das konnte sie ihm nicht geben. Er wollte Gefolgschaft. Er wollte ihr Sträuben bezwingen. Er wollte, dass sie einen Treueschwur auf die Apokalypse leistete, und wurde immer wütender auf ihren heimlichen Trotz. Auf ihre Unfähigkeit, mit ihm gemeinsam in erster Reihe zu marschieren. Er war unzufrieden mit ihr, und sie lachten weniger miteinander als früher. Aber irgendwie waren sie trotz allem noch ein Team.
Dann kam Corona, und Robert entdeckte seine wahre Berufung. Mit der Empfindlichkeit eines Katastrophen-Seismographen sagte er schon im Januar voraus, dass die Lage weltweit eskalieren würde. In seiner Online-Kolumne empfahl er der Regierung die Anschaffung von Atemschutzmasken, während der Rest der westlichen Welt noch glaubte, es handele sich mal wieder um ein chinesisches Problem.
Erst belächelten ihn die Journalistenkollegen wegen seiner Kassandrarufe. Wenig später hatte er den Status eines Hellsehers inne. Robert wurde zum Corona-Experten. Als hätte er heimlich schon jahrelang auf das Virus gewartet. Endlich hat das Warten ein Ende, die Katastrophe ist da. Das Schiff ist leck geschlagen, endlich kann man etwas tun. Alles hört auf ein Kommando, jeder Zweifel wird zur Meuterei. Endlich denken alle dasselbe. Endlich reden alle über dasselbe. Endlich gibt es verbindliche Regeln für eine außer Kontrolle geratene Welt. Endlich geht die verdammte Globalisierung in die Knie. Endlich Schluss mit dem grenzenlosen Herumwandern von Menschen, Waren, Informationen.
Dora versteht ihn. Der Klimakampf ist mühsam. Niemand kommt so richtig aus dem Quark. Aber jetzt. Was auf einmal alles möglich ist. Was eben noch als ausgeschlossen galt, ist plötzlich kein Problem. Ausbremsen des Raubtierkapitalismus, Radikaleinschränkung der Mobilität. Corona ist anschaulich. Schnell, dramatisch, gut zu bebildern. Messbar in den Folgen. Außerdem scheint dem Virus eine geradezu biblische Zwangsläufigkeit innezuwohnen. Wie lange ist es schon fünf vor zwölf? Irgendwann musste das dicke Ende kommen. Alle wussten das. Alle haben es geahnt. Die abendländische Kultur ist längst zu einer großen Untergangsahnung geworden, falls sie das nicht schon immer war. Und da ist sie nun, die große Seuche, die Strafe für alle Sünden, für Gier und Ausbeutung und den ganzen entfesselten Lebensstil.
Daran kommen all jene, denen Robert seit zwei Jahren Untätigkeit vorwirft, nicht mehr vorbei. Aufgescheucht rennen sie durcheinander und sind mit einem Mal bereit, auf die Experten zu hören. Politiker und Private, Linke und Rechte, Reiche und Arme, in Angst vereint.
Dora wurde den Eindruck nicht los, dass die allgemeine Panik Robert Genugtuung bereitete. Er stürzte sich regelrecht in das Endzeitspiel. The Walking Dead in Berlin. Er füllte die Vorratsschränke, bestellte Klopapier und Handdesinfektionsmittel im Internet und redete ständig davon, dass man sich auf das Schlimmste gefasst machen müsse. Auch Dora war verunsichert. Manchmal bekam sie sogar heftige Angst. Aber sie fand es am besten, Ruhe zu bewahren. Erst einmal abzuwarten. Darauf zu vertrauen, dass die Politiker die Lage richtig einschätzen und die richtigen Empfehlungen abgeben würden. Robert lachte sie aus. Er lachte auch die Politiker aus, die in seinen Augen nichts richtig machen konnten. Zu wenig, zu spät. Wenn Dora daran erinnerte, dass sie in einer Demokratie lebten, in der Entscheidungsprozesse eine gewisse Zeit in Anspruch nahmen, wurde er wütend. Mit einer früh bestellten Atemmaske vor Mund und Nase radelte er durch die Stadt und sammelte Meinungen in Ämtern und auf der Straße. Tagsüber saß er auf dem Fahrrad, nachts vor dem Computer, wo er seinen Eifer mit immer neuen Meldungen, Zahlen und Berechnungen fütterte. Er war wie im Rausch. Seine Kolumne wurde von Tag zu Tag erfolgreicher. Dora schien er immer fremder. Unter jeden Text, jede E-Mail, jede SMS setzte er die Formel »Bleib gesund!«, wie die Parole eines Geheimbunds, der zur Massenbewegung wurde.
Mit Robert zusammenzuleben war schon im letzten Jahr anstrengend gewesen. Im Januar wurde es nervtötend, im Februar unerträglich. Im März schlossen Schulen, Restaurants und Geschäfte. Noch mehr neue Begriffe machten die Runde. Lockdown, shutdown, flattening the curve. Mortalität, Morbidität, Triage. Die Panik stieg, als wären Krankheit und Tod neu erfunden worden.
Von einem Tag auf den anderen fand sich Dora im Home-Office wieder. Was ihr erst gar nicht so schlimm erschien, im Gegenteil, sie dachte, dass es auch Vorteile habe. Bei Sus-Y gibt es, wie in fast allen Agenturen, keine Einzelbüros für Kreative. Stattdessen sitzen rund fünfundzwanzig Leute im sogenannten »Open Space«, was für eine enorme Lärmkulisse sorgt. Vor allem die Berater hängen den ganzen Tag am Telefon, versuchen, den Kunden Informationen zu entlocken und gute Stimmung zu verbreiten. Im Grunde reden sie ununterbrochen, ohne dabei irgendeinen Mehrwert zu erzeugen, was den Textern, die sich auf Ideenfindung konzentrieren müssen, das Leben schwer macht. Im Home-Office war es definitiv ruhiger. Allerdings schmollte Jochen, die die Agentur vermisste, wo sie als Maskottchen verhätschelt wird. Während Dora an der Kaffeemaschine auf den ersten Espresso des Tages wartet, pflegt die Hündin von Schreibtisch zu Schreibtisch zu laufen, um ihre Fans zu begrüßen und Leckerlis einzusammeln, die in kleinen Beuteln extra für sie mitgebracht werden.
Die ersten Tage im Home-Office funktionierten ganz gut. Brainstormen mit den Kollegen konnte Dora per WhatsApp. Meetings absolvierte sie per Videokonferenz. Eigentlich vermisste sie vor allem den randvollen Kühlschrank mit kostenlosem Bio-Feierabend-Bier, den Sus-Y nach dem Etatgewinn der Kröcher Braumanufaktur angeschafft hatte.
Aber dann wurde es in der Kreuzberger Wohnung zu eng. Als freier Journalist arbeitet Robert schon immer zu Hause und hat das einzige Arbeitszimmer mit Beschlag belegt. Beim Einzug waren Dora die Räume riesig erschienen. Jetzt schrumpfte alles um sie herum. Wegen der Kontaktbeschränkungen reduzierte Robert seine systemrelevanten Stadtexkursionen auf eine Stunde pro Tag. Die restliche Zeit waren Dora, Jochen und er einander auf 80 Quadratmetern ausgeliefert. Im Wohnzimmer stand nur ein flacher Couchtisch, so dass Dora mit ihrem Notebook in der Küche sitzen musste. Sie ging viel mit Jochen spazieren. Die Gassi-Pflicht der Hundebesitzer wurde zum Privileg.
Auf den leeren Straßen herrschte gespenstische Atmosphäre. Wenige Autos, kaum Passanten. Im Viktoriapark waren die Rollatoren verschwunden. Weiß bedeckte Gesichter hinter den Schaufenstern einer Apotheke. Robert sagte, diese Menschen kämpften an vorderster Front. Solche Formulierungen verstörten Dora. Ein Krieg war die Pandemie trotz allem nicht. Kriege richteten sich gegen Menschen.
Einmal zog ein Mann auf der Straße hastig seinen Hund zur Seite, als könnte Jochen-der-Rochen sonst das Virus übertragen. Das Keuchen des Vierbeiners und das Kratzen der Pfoten auf dem Asphalt waren ebenfalls verstörend. Eine junge Mutter schrie einen Jogger an, er solle nicht so heftig atmen. In manchen Fenstern verkündeten Fahnen: »Wir bleiben zu Hause!« Diese Menschen waren Teil von etwas, auch wenn Dora nicht wusste, wovon. Sie saßen hinter den Fahnen und hofften, dass es in Berlin nicht so schlimm werden würde wie anderswo.
Die Spaziergänge waren bedrückend und gleichzeitig eine Erleichterung. Ein kurzes Ausbüxen aus der Klaustrophobie. Robert hingegen fand es unmöglich, dass Dora dreimal am Tag mit Jochen das Haus verließ. Überhaupt konnte er sich wegen des fehlenden Gehorsams der Bevölkerung furchtbar aufregen. Während sie am Küchentisch versuchte, die Wünsche ihrer Kunden in kreative Konzepte zu verwandeln, marschierte er durch die Wohnung und schimpfte lautstark darüber, wie unfassbar dumm sich die Leute verhielten. Er wartete, damit Dora Zustimmung signalisieren konnte. Wenigstens ein Nicken. Aber Dora konnte nicht. Sie wusste nicht, ob die Leute dumm waren. Welche Leute denn genau? Die mit den weggezogenen Hunden oder diejenigen, die demonstrativ vor den Spätis ihr Gruppenbier tranken?
Wer sind die Guten und wer die Bösen? Dora weiß es nicht und will es auch nicht wissen. Sie findet, dass das eine sehr gefährliche Frage ist. Sie weiß, dass sie es nicht mag, wenn man von »historischem Ausmaß« und »Zeitenwende« spricht, obwohl weltweit ständig viel schlimmere Dinge passieren, nur eben meistens anderswo. Sie beharrt darauf, sich keine klare Meinung bilden zu müssen, wenn es keine einfache Lösung gibt, und die gibt es momentan noch weniger als sonst. Weder Politiker noch Virologen verfügen über Wahrheiten, die man einfach nur befolgen müsste, damit alles gut wird. Meistens besteht das Leben aus Trial and Error, und der Mensch kann viel weniger begreifen und kontrollieren, als er glaubt. Auf dieses Dilemma kann weder Nichtstun noch Aktionismus die richtige Antwort sein. Nach Doras Ansicht geht es um Augenmaß beim Handeln und größtmögliche Ehrlichkeit in der Kommunikation. Voraussetzung von Ehrlichkeit ist das Bekenntnis zum Nicht-genau-Wissen. Deshalb richtet sich ihr Sträuben nur gegen Denk-Imperative, nicht gegen die Regeln an sich. Dora kann Regeln befolgen, sie will sie nur nicht gut finden müssen. Sie muss nicht mit zehn Leuten Bier vor dem Späti trinken, um sich zu beweisen, dass sie frei oder wichtig ist. Wenn Social Distancing die Strategie ist, für die sich die Gesellschaft entschieden hat, dann ist sie bereit, den Weg mitzugehen. Auf vernünftige Weise. Nicht als Vorreiterin. Vielleicht würde der schwedische Ansatz besser zu ihr passen, aber sie ist hier und nicht in Schweden. Sie hält sich an die Bestimmungen. Die Gedanken bleiben frei. Niemand kann sie zwingen, Biertrinker vor dem Späti für gemeingefährliche Volksverräter zu halten.
Außer Robert. Er wollte, dass sie ihm beipflichtete. Da war sie wieder, die verweigerte Gefolgschaft. Der fehlende Schwur auf die Apokalypse. Weil Dora in seine Hasstiraden nicht einstimmte, sondern weiter stur auf das Notebookdisplay schaute, richtete sich seine Aggression zunehmend gegen sie. Ihr Notebook entwickelte die Angewohnheit, mindestens einmal am Tag abzustürzen, was das Schließen sämtlicher Programme erforderlich machte. Runtime Error 0✕0. We are sorry for the inconvenience. Dora ertappte sich bei dem Gedanken, dass das mit Robert zu tun habe. Sie hätte fast geweint. Er war ihr Partner, ihr Gefährte, ihr bester Freund gewesen. Jetzt glaubte sie, dass seine Aura ihren Computer zum Absturz brachte.
Einmal sah sie beim Spazierengehen einen Mann, der ein Abstandsmessgerät bei sich trug. Wenn es piepste, wedelte er mit den Armen und schrie: »Bleiben Sie weg!«
Das erschreckte sie mehr als alles zuvor. Konnte es passieren, dass eine Gesellschaft kollektiv den Verstand verlor? Als sie Robert davon erzählte, nannte er sie ignorant. Er warf ihr vor, sich nicht ausreichend zu informieren. Die Augen vor der Gefahr zu verschließen. Er hielt den Mann mit dem piepsenden Kästchen für vernünftig. Dora fühlte sich wie ein Kind, das nicht versteht, worum es geht.
Roberts Vorwurf der mangelnden Information traf einen wunden Punkt. Tatsächlich hat Dora ihren Nachrichtenkonsum seit Ausbruch der Pandemie stark eingeschränkt. Sie will nicht die Augen verschließen. Aber sie erträgt es nicht, dass plötzlich nur noch Corona existiert. Als wären der Krieg in Syrien, das Leid von Flüchtlingen, Nazi-Terroristen und die Armut überall auf der Welt niemals reale Probleme gewesen. Nur Infotainment, ein Zeitvertreib für gelangweilte Medienkonsumenten. Jetzt, da es eine Pandemie gibt, braucht man den anderen Quatsch nicht mehr. Das macht Dora fassungslos. Ihr wird übel, wenn sie die Schlagzeilen liest. Gleichzeitig schämt sie sich heimlich dafür, dass sie die neuesten Infektionszahlen nicht kennt. Als gäbe es eine Mitmachpflicht in Sachen Medienkonsum. Wie Robert glaubt, der ihre Abstinenz verbrecherisch findet.
Abgesehen vom Ringen um die richtigen Gedanken waren sie einander schlicht im Weg. Wenn Dora ein Fenster schloss, hatte Robert gerade vorgehabt, ein weiteres zu öffnen. Wenn sie auf der Toilette saß, klopfte es an der Tür, und Roberts Stimme fragte, wie lange es noch dauere. Während sie gerade seitenweise Claims schreiben musste oder nach einer Funkspot-Mechanik suchte, die für eine lang laufende Kampagne geeignet war und am besten noch jede Menge Award-Potenzial mitbringen sollte, verfiel er auf die Idee, zwanzig Zentimeter neben ihrem Ellenbogen die Spülmaschine auszuräumen. Robert stolperte über Jochen und trat auf Doras Unterlagen, die sie aus Platzmangel auf dem Boden verteilte. Wollte sie an den Kühlschrank, stand er mit Sicherheit gerade davor. Machte sie sich einen Kaffee, stellte er sich daneben und wartete demonstrativ darauf, dass sie mit ihren Verrichtungen fertig wurde. Wenn sie auf dem Balkon eine Zigarette rauchte, rief er von drinnen, man könne den Rauch in allen Zimmern riechen. Beim Schreiben seiner Kolumnen lief er im Flur auf und ab und redete halblaut vor sich hin. Als Dora ihn bat, damit aufzuhören, behauptete er, anders nicht produktiv sein zu können.
Obwohl sie sich die Miete teilten, schienen die Räume allein ihm zu gehören. Schließlich hatte er immer hier gearbeitet, während Dora in die Agentur gegangen war. Außerdem hatte sie aufgrund ihrer fehlenden Bereitschaft zu apokalyptischem Denken sowieso ihr Existenzrecht verwirkt. Doras Sträuben wurde so übermächtig, dass sie die Sache mit den Pfandflaschen anfing, an die sie heute äußerst ungern zurückdenkt.
Außerdem blieb sie immer länger fort. Sie setzte sich am Rand des gesperrten Spielplatzes auf eine Parkbank, nahm Jochen auf den Schoß und versuchte, auf dem Handy ein Buch zu lesen. Meistens gab sie nach wenigen Minuten auf und schaute einfach vor sich hin. Auf einmal schwieg alles. Stimmen, Gedanken, Schlagzeilen, Ängste. Ihre großen Hände streichelten das warme Hundefell. Um sie herum dehnte sich ein Raum, der in diesen Augenblicken niemandem gehörte. Dora durfte still sein. Sie durfte hier sitzen. Dann kam sie nach Hause, und Robert fragte, warum sie so lange weg gewesen sei und was sie gemacht habe. Sie fing an, ihn in Gedanken »Robert Koch« zu nennen. In Bayern erklärte die Polizei, es sei verboten, auf Parkbänken zu sitzen. Wenig später teilte Robert ihr mit, dass er ihre Spaziergänge nicht länger toleriere. Er sprach langsam und deutlich, als litte Dora unter Verständnisschwierigkeiten. Bei jeder Form von Bewegung im öffentlichen Raum bestehe ein Ansteckungsrisiko. Indem sie sich unvernünftig verhalte, gefährde sie auch ihn, Robert, und das hinzunehmen sei er nicht länger bereit. Für Jochen sei es schließlich absolut ausreichend, dreimal am Tag eine Baumscheibe aufzusuchen.
Zunächst hielt Dora das für einen Aprilscherz. Sie wies darauf hin, dass es in Berlin keine totale Ausgangssperre gebe. Dass einsames Spazierengehen immer noch erlaubt sei, vor allem mit Hund.
Robert antwortete, das sei nicht der Punkt. Es gehe darum, in der jetzigen Situation alles zu tun, um eine Ausbreitung des Virus zu vermeiden. Jeder müsse mithelfen, so gut er könne. Jede Bewegung, die nicht unbedingt notwendig sei, solle man gefälligst unterlassen.
Dora erinnerte ihn daran, dass er selbst noch immer mit dem Fahrrad durch die Stadt fahre, wenn auch nur eine Stunde täglich.
Robert sagte wütend, das gehöre zu seinem Job. Er schreibe über die Krise, und seine Kolumnen gehörten inzwischen zu den meistgelesenen Texten der Online-Zeitung. Seine Arbeit sei absolut systemrelevant, was man von ihrer, mit Verlaub, wohl nicht behaupten könne.
Sie fragte noch einmal nach, ob er tatsächlich gerade versuche, ihr das Verlassen der Wohnung zu verbieten.
Robert dachte kurz nach, er lachte sogar verlegen. Dann nickte er. Doras Notebook, das auf dem Küchentisch lief, stürzte ab. 0✕0. We are sorry for the inconvenience.
Das war der Augenblick, in dem sich in Doras Kopf ein Schalter umlegte. Sie schaute das schwarze Display an und dann Robert, der immer noch vor ihr stand. Sie glaubte, diesen Mann nicht mehr zu kennen. Es gab drei Möglichkeiten: Entweder war sie in einen absurden Film geraten, in dem sie eine Rolle spielen musste, ohne das Drehbuch gelesen zu haben. Oder Robert war verrückt geworden. Oder sie selbst. Dora wollte nichts davon. Sie wollte nur noch weg. Ihr Gehirn kam bei dem, was gerade passierte, nicht mehr mit. Sie spürte keinen Schmerz. Nur Verstörung und einen überwältigenden Fluchtreflex. Sie sagte Robert, dass sie eine Weile woanders leben werde, und packte ihre Sachen.
Von dem Haus auf dem Land hatte sie ihm noch immer nichts erzählt, und jetzt war definitiv nicht der richtige Moment, um das nachzuholen. Er fragte sowieso nicht, wo sie hinwolle. Vielleicht war er erschrocken. Vielleicht froh, dass sie ging. Vielleicht glaubte er, sie würde für eine Weile nach Charlottenburg ziehen, in die Wohnung ihres Vaters, die meistens leer steht, weil Jojo nur alle zwei Wochen zum Operieren nach Berlin kommt. Robert half ihr nicht, die Sachen runterzutragen. Wahrscheinlich merkte er gar nicht, was sie alles mitnahm. Zwei Koffer und drei Umzugskartons mit Klamotten, Büchern, Bettzeug, Handtüchern, ein paar Küchenutensilien, Arbeitsunterlagen und technischen Geräten. Die schwere Matratze von ihrer Bettseite ließ Dora wie auf einer Rutschbahn die Treppe hinuntergleiten.
Ein Miet-Kombi brachte sie aus der Stadt. Mit jedem gefahrenen Kilometer wurde ihr leichter zumute. Sie ließ nicht nur Robert hinter sich, sondern auch die Großstadt, die Enge, das Dauerfeuer der Informationen und Emotionen. Es fühlte sich an, als verließe sie die bekannte Welt, in einem Raumschiff auf dem Weg zu neuen Galaxien. Sie kannte das Gefühl schon von ihren heimlichen Besichtigungstouren im vergangenen Herbst.
Ausgebüxt. Sie mochte das Wort. Es klang nach Aus-der-Büchse-Entwischen. Bei ihren Besichtigungen war sie meistens ohne Makler gefahren, was den Maklern nur recht war. Zu weit weg, zu niedrige Provision. PDF, Fotos, Adresse, Außenbesichtigung. Der Gedanke, dass es tatsächlich möglich war, ein Haus zu kaufen, hatte sie elektrisiert. Wenn man weit genug fuhr, waren die Preise noch immer erschwinglich. In ihrem Alter, mit festem Job sollte es kein Problem darstellen, einen Kredit zu bekommen. Die Zinsen waren im Keller, und Dora besaß eine Rücklage: das kleine Erbe ihrer Mutter sowie Erspartes, das sie Monat für Monat zurückgelegt hat, seit sie als Senior-Texterin so gut verdient wie ein Oberstudienrat. Ein Haus im Grünen. Das hätte ihrer Mutter gefallen. Sie hätte es geliebt. Und sie hätte darüber gelacht, dass Dora niemandem von ihren Plänen erzählte. »Meine Räubertochter«, hätte sie gesagt und ihr über die Haare gestrichen. Manchmal dachte Dora, dass das Sträuben ein Vermächtnis ihrer Mutter sei.
Ein schlechtes Gewissen hatte sie bei ihren heimlichen Fahrten trotzdem gehabt. Warum saß Robert nicht neben ihr? Warum fuhr sie hinter seinem Rücken und nicht mit ihm gemeinsam? Als würde sie ihn betrügen und den Betrug genießen. Aber es fühlte sich einfach so gut an. Ausgedehnte Felder, blasse Farben, ein riesiger Himmel. Es war lange her, dass Dora etwas in vollen Zügen genossen hatte. Auch wenn ihr die besichtigten Häuser nicht gefielen. Sie waren zu klein, zu groß oder zu seelenlos. Als die Blätter von den Bäumen fielen, glaubte sie nicht mehr daran, ein Haus zu finden. Trotzdem setzte sie die Ausflüge fort, an den Wochenenden, während Robert glaubte, dass sie bei einem Workshop sei.
Doch dann war sie auf das Gutsverwalterhaus in Bracken gestoßen. Sie hatte mit dem Mietwagen vor dem wackligen Zaun gehalten und sofort gewusst: Das ist es. Große Bäume, verwildertes Grundstück, graue Stuckfassade. Dorfrandlage. Sechs Wochen später saß sie bei einem Provinznotar und unterschrieb den Kaufvertrag.
Dann kamen Weihnachten, Silvester und schließlich Corona, und jetzt fuhr sie wieder nach Bracken und hatte den Mietwagen mit ihrer Habe vollgepackt. Heimlich fürchtete sie, das Haus könne in Wahrheit gar nicht existieren. Drei Monate waren seit dem Kauf vergangen. Erst hatte es sechs Wochen gedauert, bis sie den Kaufpreis überweisen konnte, dann hatte sie wegen des Lockdowns in Berlin festgesessen. Vielleicht würde man sie gleich an einer Straßensperre aufhalten und zurück in die Stadt schicken. Oder sie käme in Bracken an, und der Platz am Dorfrand wäre leer. Alles Einbildung. Bei diesen Gedanken brach Dora der Schweiß aus. Aber sie traf auf keine Straßensperre. Und als sie Bracken erreichte, stand das Gutsverwalterhaus auf seinem Flurstück wie beim ersten Mal.
Dora sprang aus dem Auto, blieb stehen und schaute. Sie musste sich die Augen reiben, nicht aus Unglauben, sondern weil ihr die Tränen kamen. Es war so schön. Im Spätherbst waren die ausladenden Kronen der Bäume bunt gefärbt gewesen. Jetzt waren sie von zartem Hellgrün bedeckt, wie angesprüht. Unter den Bäumen stand das Haus, wie sie es in Erinnerung hatte, weit zurückversetzt von der Straße, erbaut in beruhigender Symmetrie. Links und rechts jeweils drei Fenster, dazwischen die doppelflügelige Eingangstür. Fenster und Türen eingerahmt von Stucksäulen, die dreieckige Dächlein tragen. Das Erdgeschoss liegt im Hochparterre, zur Haustür führt eine Freitreppe mit sechs Stufen, die in einen Absatz mündet, so geräumig, dass man einen Tisch mit vier Stühlen darauf platzieren könnte. Wie ein Balkon ist der Absatz von einem gusseisernen Geländer umgeben. Das Dach des Gutsverwalterhauses sitzt direkt auf dem Erdgeschoss, als hätte es sich einen schwarzen Hut tief in die Stirn gezogen. Anscheinend hat der Gutsverwalter von Bracken einst nicht genug Geld für eine weitere Etage besessen.
Vom Makler weiß Dora, dass das Haus nach der Wende an eine Erbengemeinschaft übereignet wurde, die Jahre brauchte, um sich auf einen Verkauf zu einigen. Danach erwarb es ein junges Pärchen, das zaghaft mit der Sanierung begann, sich aber bald zerstritt und kapitulierte. Bevor Dora kam, hatte das Haus lange leer gestanden. Wie lange genau, sagte der Makler nicht. Er nannte es »ein Schmuckstück mit zahllosen Möglichkeiten«, was ein anderer Ausdruck für »desolater Zustand« ist.
Dora ist das egal. Sie hat sofort gespürt, dass das Haus zu ihr passt. Irgendwie wirkt es zu klein für seinen Stuck und für das große Dach. Aber es besteht trotzig auf seiner Würde wie ein komischer alter Herr, der streng auf Haltung achtet. Die Dreiecke über den Fenstern sehen aus wie hochgezogene Augenbrauen. Offensichtlich braucht das Haus eine Menge Platz um sich herum. Die wacklige, mindestens zwei Meter hohe Mauer des Nachbarn zur Rechten liegt einen Steinwurf entfernt. Als Kind hätte Dora auf die Freitreppe gezeigt und gesagt: »Guck mal, das Haus streckt die Zunge raus.«
Erst war das Gutsverwalterhaus eine fixe Idee. Jetzt ist es eine Folgerichtigkeit. Ein Zufluchtsort. Trotzdem kann Dora immer noch kaum glauben, dass es möglich ist, etwas so Großes zu besitzen. Wenn sie das Haus ansieht, scheint es immer noch zu fragen: »Wer besitzt hier wen?«
3 Gote
Hinten hat das Gutsverwalterhaus keinen Stuck. Von hinten sieht es einfach nur aus wie ein alter Kasten. Die graue Wand wirkt pockennarbig; vor allem die obere Hälfte ist von runden Flechten bedeckt. Dora sitzt hinter dem Haus und überblickt das Flurstück. Eine Frau und ihr Land. Jede Menge Beinfreiheit. Wenn man das Nachdenken unterbricht, sind unzählige Vogelstimmen zu hören. Rotschwänzchen fliegen zur Schuppentür hinein und heraus und sind so vom Nestbau in Anspruch genommen, dass sie Dora auf ihrem Gartenstuhl gar nicht bemerken. Im hohen Wipfel einer Robinie hockt ein Star, singt laut und viel schöner, als sein proletarisches Federkleid vermuten ließe.
Kein Mensch ist zu sehen, nur gelegentlich ein Auto zu hören. Kein Fernseher, der CNN-Nachrichten in die Gegend plärrt. Kein Smartphone, auf dem sich Podcaster und YouTuber gegenseitig erzählen, wie sie ihre Tage im Home-Office verbringen. Doras Handy liegt im Haus; im Garten gibt es sowieso kaum Empfang. In Bracken scheint Corona gar nicht stattzufinden. Die Luft schmeckt sauber, jeder Tag hat ein anderes Aroma.
Dora erlaubt sich den Gedanken, dass alles in Ordnung sein könnte. Gut gelaufen. Glück gehabt. Wenn sie ohnehin nicht in die Agentur darf, kann sie ebenso gut in Bracken arbeiten wie in Berlin. Zumal sie wenig zu tun hat. Unter normalen Umständen absolviert sie zehnstündige Arbeitstage in der Agentur, führt noch auf dem Heimweg Telefonate und beantwortet ihre letzten E-Mails vor dem Schlafengehen. Wenn ein Berater die neuen Headline-Varianten an den Kunden geschickt hat, steht der nächste schon mit dem Briefing für einen Muttertag-Spot auf der Matte, während im Hintergrund eifrige Junior-Beraterinnen mit weiteren Aufgaben lauern. Aber jetzt hat Corona alles verändert, sogar die Werbung. Kunden frieren Etats ein. Lang geplante Kampagnen-Flights werden gestrichen. Sus-Y hat Kurzarbeit angemeldet. Deshalb hat Dora nur noch zwei Jobs auf dem Tisch und kommt sich beinahe vor wie eine Arbeitslose. Eine dünne Broschüre für den Bio-Bier-Hersteller, die sie nebenher schreiben kann. Und eine Launch-Kampagne für einen nachhaltigen Textilhersteller mit Namen »FAIRkleidung«.
Alles kein Grund zur Panik. Dora bekommt noch einen großen Teil ihres Gehalts. Das WLAN läuft, und zwar auf Glasfaser – in Bracken vielleicht das einzige Stück funktionierender Infrastruktur. Möglicherweise schafft sie es, sich zeitnah einen Schreibtisch zu organisieren. Wenn nicht, kann sie mit dem Notebook in der Küche sitzen oder auf ihrer Matratze mit dem Rücken zur Wand oder hier draußen im Gartenstuhl. Kein Problem. Irgendwann wird es auch Jochen gefallen. Irgendwann wird das Flurstück erträglicher aussehen. Sie wird sich im Haus noch ein wenig einrichten, viel braucht sie ja nicht. Außer Kaminöfen gibt es keine Heizung, aber der Winter ist noch weit weg, und wer weiß, ob Dora dann überhaupt noch hier sein wird. Vielleicht ist bis dahin alles wieder normal. Corona verschwunden und Robert zurückverwandelt, so dass man wieder mit ihm reden und lachen und nachdenken kann. Die Flucht nach Bracken könnte im Rückblick wie eine Großstadtpause aussehen, ein Dorf-Sabbatical, ermöglicht durch die Verwerfungen einer Pandemie. Dora könnte wieder in die Agentur gehen, hart an ihrer Karriere arbeiten, in den nächsten Jahren ein paar internationale Awards erkämpfen, sich endlich zur Kreativdirektorin befördern lassen und in den Nachtschichten auf Agenturkosten nachhaltiges Sushi oder vegane Pizza mit den Kollegen bestellen. Sie würde in Berlin-Kreuzberg leben und die Wochenenden gemeinsam mit Robert in Bracken verbringen, wo sie gemeinsam am Haus basteln und das Landleben genießen könnten, wie es den Landlust-Träumen vieler Großstädter entspricht. Glückliche Menschen in einer normalen Welt.
Erst zehn Minuten um. Eine halbe Stunde Nichtstun hat sich Dora verordnet. Noch zwanzig, bis sie weitergraben darf.
»Ist das dein Hund?«
Erschrocken schaut sie sich um. Die Stimme ist männlich, tief und kräftig, und sie kommt aus dem Nichts. Auch als Dora aufsteht, kann sie niemanden entdecken. Jochen-der-Rochen ist ebenfalls nicht zu sehen. Eben lag die Hündin noch zwischen den Ahornsprösslingen auf einem Sonnenfleck. Oder nicht? Wann hat Dora sie zuletzt bewusst wahrgenommen? Als Jochen die Amseln verbellt hat. Und danach?
»Hey! Ob das dein Scheißköter ist!«
Endlich kann sie den Mann orten. Er steht hinter der hohen Mauer aus Hohlbausteinen, die die Flurstücke trennt. Ein runder, kahl geschorener Kopf guckt über den Mauerrand. Wie eine Kugel scheint er auf der Kante zu balancieren. Der Mann muss mindestens 2,50 Meter groß sein.
In Doras Augen ist Nachbarschaft eine Form von Zwangsehe. Man kann glücklich miteinander werden, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch. In den letzten zwei Wochen hat sie nebenan niemanden bemerkt. Sie ist davon ausgegangen, dass das Nachbargrundstück unbewohnt sei. Vom Wohnhaus sieht man nur die obere Hälfte. Es liegt viel dichter an der Straße als das Gutsverwalterhaus und wird auch nach vorne von einer hohen Mauer abgeschirmt, mit einem breiten, stets verschlossenen Holztor. Ein Fenster im ersten Stock ist mit Sperrholzplatten abgedeckt, was aussieht, als wäre das Haus auf einem Auge blind. Einmal ist Dora auf einen Stuhl gestiegen, um über die Mauer zu sehen. Wider Erwarten ist das Grundstück nebenan nicht verwildert, sondern relativ gepflegt. Kein Flurstück, sondern ein Garten. Das Gras gemäht. Kein herumliegender Schrott. Ein aufgebockter Bauwagen, hübsch gestrichen in Dunkelgrün und Weiß, der Eingang mit Geranientöpfen geschmückt. Ein alter Pick-up in Weiß, ordentlich geparkt neben dem Haus.
Dora hat vermutet, dass ein Berliner den Bauwagen gelegentlich als Ferienhäuschen nutzt. Den Garten pflegt und mit dem Pick-up herumfährt. Zurzeit kann er nicht kommen, weil die Brandenburger wegen Corona versuchen, die Berliner auszusperren. Vielleicht ein Kreativer aus Friedrichshain. Vielleicht jemand, mit dem sie sich gut verstehen könnte. Wobei Gut-Verstehen in Bezug auf Nachbarn nur die zweitbeste Alternative darstellt. Gar-nicht-da-Sein ist noch besser.
Das aktuelle Exemplar an der Mauer wirkt nicht wie ein Kreativer aus Friedrichshain. Zögernd geht Dora auf den Mann zu. Als sie die Mauer erreicht, muss sie den Kopf in den Nacken legen. Hoffentlich steht der Mann auf einer Kiste.
»Bist du schwerhörig?« Er kratzt sich den geschorenen Schädel. »Ich hab dich was gefragt.«
Bevor Dora erwidern kann, dass sie die Frage verstanden habe, ihre Antwort aber davon abhänge, welchen Hund er genau meine, kommt Jochen-der-Rochen durch die Luft geflogen. Die kleine Hündin hat alle viere ausgestreckt, als könnten die aufgespannten Häute an den Hinterbeinen beim Segelflug helfen. Fast gelingt es Dora, ihr Haustier aufzufangen, aber dann rutscht ihr der kompakte Körper durch die Hände und schlägt auf den Boden, wo Jochen einen halben Purzelbaum vollführt wie eine Comicfigur. Sogleich beginnt die Hündin, euphorisch an Dora hochzuspringen, als hätten sie einander jahrelang nicht gesehen.
»Sind Sie verrückt geworden?«, schreit Dora und tastet Jochens Beine ab, obwohl bereits feststeht, dass der Kleinen nichts passiert ist. Wenn Jochen etwas weh tut, leidet sie mit der Ausdruckskraft einer Diva.
»Dein Köter buddelt in meinen Kartoffeln.«
Tatsächlich trägt Jochen dunkle, erdige Strümpfe, ein Anblick, der Dora rührt. Jochen hat noch nie in ihrem Leben gebuddelt. Dort, wo sie bislang gelebt hat, gab es keine Buddelplätze, sondern nur Baumscheiben und Bürgersteige und eingezäunte Spielplätze. Kieswege und Blumenbeete. Leinenzwang und Plastiktüten, in denen am Wegesrand abgesetzte Häufchen einzusammeln sind. Vielleicht schläft tief in Jochens Herzen sogar eine Art Beutetrieb. Auch wenn gewiss keiner ihrer Vorfahren ein langbeiniger, stromlinienförmiger Jagdhund war.
»Das mit den Kartoffeln tut mir leid.« Dora richtet sich auf und stemmt die Hände in die Seiten. »Aber Jochen hätte sich was brechen können!«
»Du hast nicht richtig gefangen«, sagt der Nachbar.
Jochen scheint die Aufregung zu gefallen. Begeistert hechelnd sitzt sie vor Dora, klopft den dünnen Schwanz auf den Boden und schaut sie aufmunternd an. Nur zu! Kämpfe für mich! Eine Weile schauen sie gemeinsam auf Jochen hinunter, Dora auf der einen Seite der Mauer, der Nachbar auf der anderen.
»Ziemlich hässlicher Köter, oder?«, fragt er schließlich.
Das lässt sich nicht von der Hand weisen. Rassemäßig müssen ein Mops, eine französische Bulldogge und vielleicht noch ein Chihuahua zu Jochens Erscheinungsbild beigetragen haben. Ihr Fell ist von gelblichem Weiß und weder lang noch kurz. Der Körper gedrungen, die Beine krumm. Das Gesicht geprägt von Glubschaugen, Klappohren und einem so stark hervortretenden Unterkiefer, dass man sich fragt, ob sie eigentlich in der Lage wäre, jemanden zu beißen, falls sie eines Tages, was ziemlich unwahrscheinlich ist, einen solchen Entschluss fassen sollte. Erstaunlicherweise geraten die meisten Leute, die Jochen kennen lernen, trotz aller Makel in helles Entzücken. Sie finden Jochen nicht hässlich, sondern drollig. Dora findet, dass Jochen aussieht wie etwas, das sich die japanische Spielzeugindustrie ausgedacht hat. Etwas, das auf Knopfdruck blinkt, zappelt und Musik spielt. Aber das macht nichts. Dora liebt Jochen für ihren lakonischen Missmut, der von plötzlichen Euphorieschüben unterbrochen wird. Sie muss ihren Hund nicht hübsch finden.
»Total hässlich ist der«, wiederholt der Nachbar, als wäre die Aussage beim ersten Mal nicht klar gewesen.
»Sie ist eine Hündin«, sagt Dora würdevoll.
»Ich denk, der heißt Jochen.«
Dora zuckt die Achseln. »Ich fand das mal lustig, schätze ich.«
»Euch Städtern muss echt langweilig sein.«
Spontan will Dora zurückfragen, wieso er glaubt, dass sie aus der Stadt kommt. Sie hat zwar zuletzt in Berlin und davor in Hamburg gelebt, ist aber in einem Vorort von Münster aufgewachsen, der den Titel »Stadt« nur bedingt verdient. Aber aus Brackener Perspektive zählt vermutlich jede nennenswerte Ansammlung von Häusern zur Kategorie »Stadt«, und dass Dora keine Hiesige ist, liegt wohl auf der Hand.
»Sehr langweilig. Besonders in Zeiten wie diesen«, sagt Dora im Bemühen, das Stadt-Land-Thema mit einem kleinen Scherz zu krönen.
Aber der Nachbar scheint den Witz nicht zu verstehen. Vielleicht weiß er nichts von Corona oder nichts von Berlin oder ihm ist beides völlig egal. Schweigend betrachten sie sich gegenseitig, er sie von oben bis unten, sie ihn vom Hals aufwärts, weil der Rest seines Körpers von der Mauer verdeckt wird. Sein Schädel ist sauber rasiert und glänzt wie eine Bowlingkugel, dafür ist die untere Hälfte des Gesichts mit Bartstoppeln bedeckt. Tränensäcke, verwaschener Blick. Das Kompliment mit dem hässlichen Köter hätte Dora ohne Weiteres zurückgeben können. Das Alter des Mannes ist schwer zu schätzen. Vielleicht Mitte vierzig und damit rund zehn Jahre älter als sie.
»Gote«, sagt der Nachbar.
Irritiert schaut Dora zur Straße, ob sich irgendetwas nähert, das diese Bezeichnung verdient.
»Gote«, wiederholt der Nachbar nachdrücklich, als wäre Dora schwerhörig oder jedenfalls schwer von Begriff. Anscheinend soll das ein Name sein, auch wenn nicht klar ist, ob es sich um Vor- oder Nachnamen handelt.
»Westgote oder Ostgote?«, fragt Dora.
Jetzt ist es wieder am Nachbarn, irritiert zu schauen. Ein Zeigefinger erscheint über der Mauer und deutet auf seine rechte Schläfe.
»Gote«, sagt er noch einmal. »Wie Gottfried.«
Ein bisschen fühlt sich das an wie die Kommunikation zwischen Robinson und Freitag, nur ohne zu wissen, wer Robinson und wer Freitag ist. Auch Dora hebt einen Zeigefinger und deutet auf sich selbst.
»Dora«, sagt sie. »Wie Dorf-Randlage.«
Das ist ihr spontan eingefallen. Manchmal bringt ihr Werber-Gehirn solche Kurzschlüsse hervor. Der Nachbar ignoriert den Spruch. Er ist in einem komplizierten Bewegungsablauf verstrickt. Er reckt sich, neigt sich zur Seite, verliert fast das Gleichgewicht und fängt sich wieder, bis seine rechte Schulter, dann der ganze Arm über der Mauer erscheinen. Vorsichtig streckt er die Hand zu Dora herüber, bemüht, die obere Reihe Hohlbausteine nicht runterzuwerfen. Anscheinend nimmt man es mit dem Händeschüttelverbot in Brandenburg nicht so genau. Wahrscheinlich wäre es leichter, einem Schwaben die Kehrwoche zu verbieten. Dora beschließt, keine Spielverderberin zu sein, kommt dicht an die Mauer heran, streckt den eigenen Arm nach oben und drückt schnell Gotes Hand, damit er das Manöver beenden kann. Der Gedanke, was Robert bei diesem Anblick sagen würde, lässt sie beinahe auflachen.
»Angenehm«, sagt Gote. »Ich bin hier der Dorf-Nazi.«