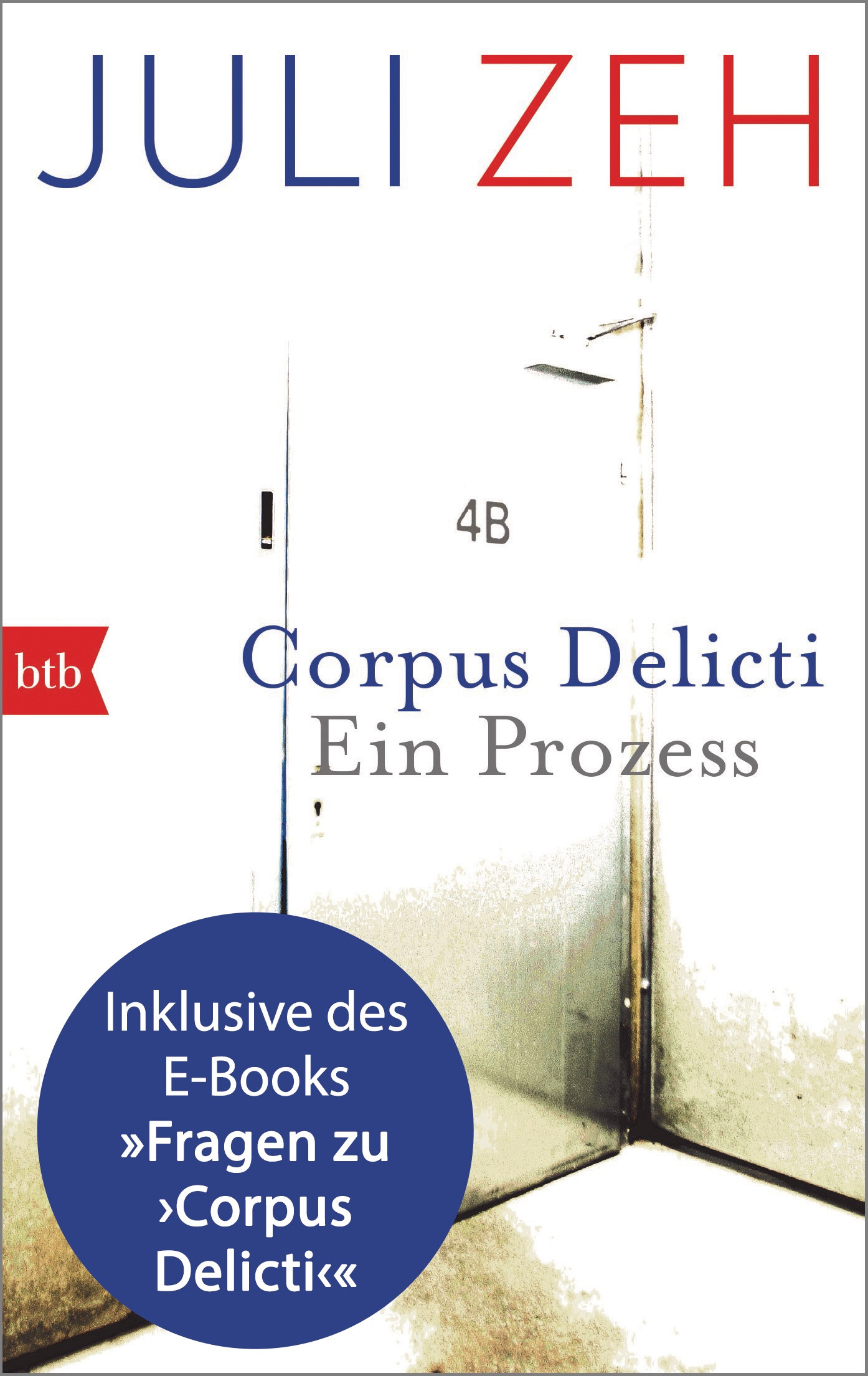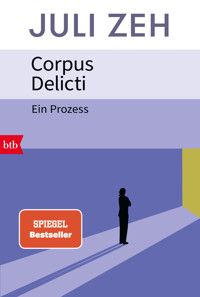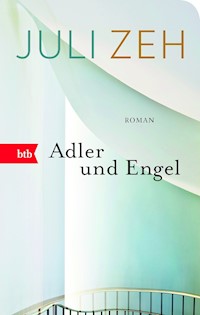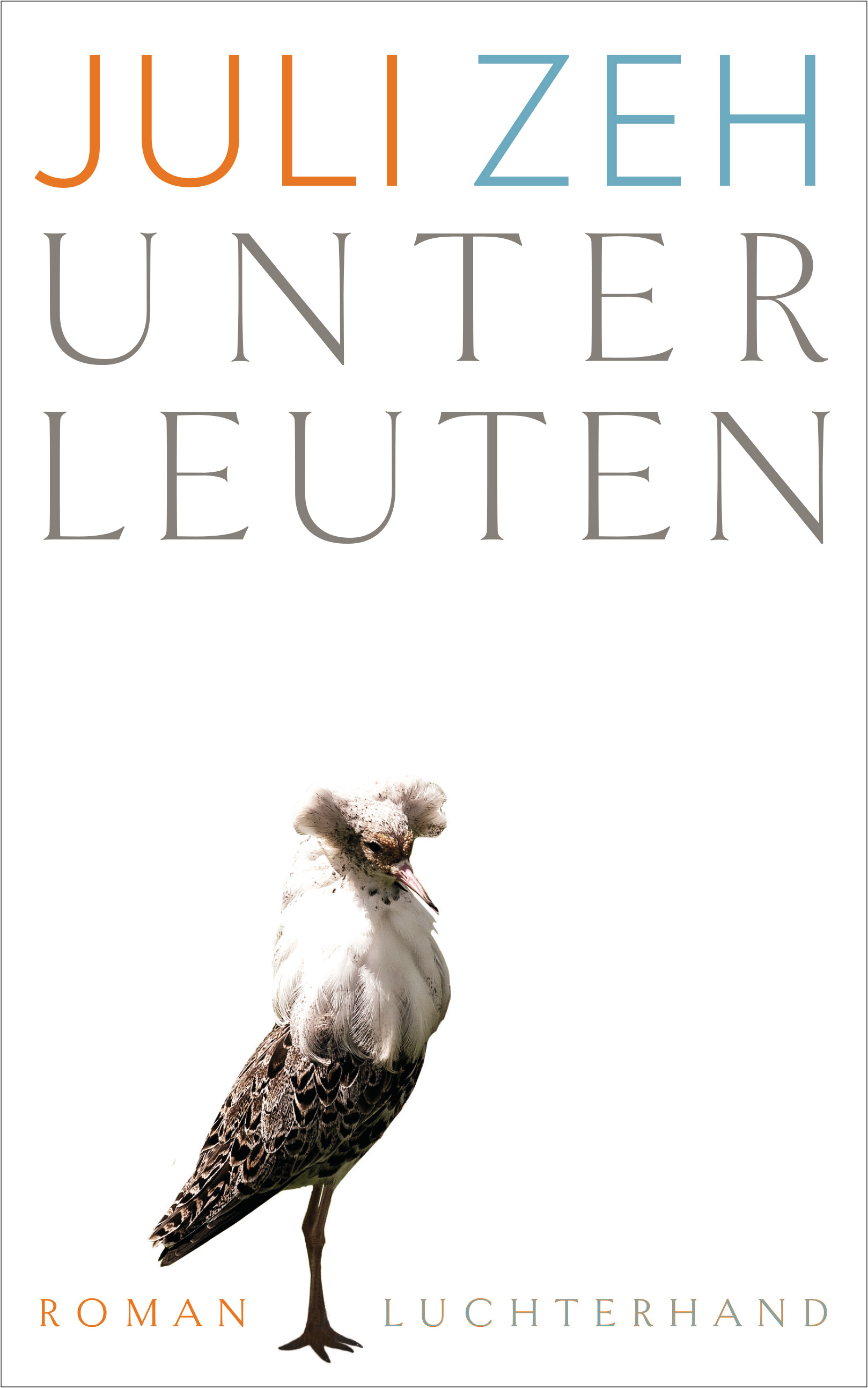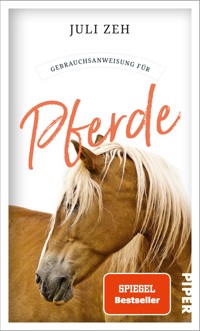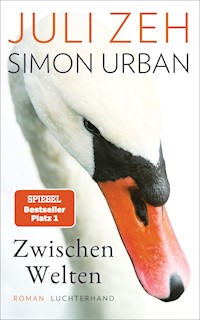
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwanzig Jahre sind vergangen: Als sich Stefan und Theresa zufällig in Hamburg über den Weg laufen, endet ihr erstes Wiedersehen in einem Desaster. Zu Studienzeiten waren sie wie eine Familie füreinander, heute sind kaum noch Gemeinsamkeiten übrig.
Stefan hat Karriere bei Deutschlands größter Wochenzeitung DER BOTE gemacht, Theresa den Bauernhof ihres Vaters in Brandenburg übernommen. Aus den unterschiedlichen Lebensentwürfen sind gegensätzliche Haltungen geworden. Stefan versucht bei seiner Zeitung, durch engagierte journalistische Projekte den Klimawandel zu bekämpfen. Theresa steht mit ihrem Bio-Milchhof vor Herausforderungen, die sie an den Rand ihrer Kraft bringen.
Die beiden beschließen, noch einmal von vorne anzufangen, sich per E-Mail und WhatsApp gegenseitig aus ihren Welten zu erzählen. Doch während sie einander näherkommen, geraten sie immer wieder in einen hitzigen Schlagabtausch um polarisierende Fragen wie Klimapolitik, Gendersprache und Rassismusvorwürfe. Ist heute wirklich jeder und jede gezwungen, eine Seite zu wählen? Oder gibt es noch Gemeinsamkeiten zwischen den Welten? Und können Freundschaft und Liebe die Kluft überbrücken?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
JULI ZEH SIMON URBAN
Zwischen Welten
ROMAN
Luchterhand
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2023 Luchterhand Literaturverlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: buxdesign/Ruth Botzenhardt unter Verwendung eines Motivs von © plainpicture/Buiten-Beeld/Nico van Kappel
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-30528-4V004
www.facebook.com/luchterhandverlag
Für Marie. Du fehlst.
TEIL I 5. Januar bis 18. Mai
Mittwoch, 5. Januar
09:31 Uhr, Stefan per WhatsApp: Die heftigsten Kopfschmerzen meines Lebens … Nicht mal nach Silvester war es so schlimm. Und gleich ist Redaktionskonferenz. Sprichst du noch mit mir?
09:45 Uhr, Stefan per WhatsApp: Theresa? Lebst du noch? Hast du dein Telefon vor Wut in die Außenalster geworfen, und ich schreibe gerade an einen Schwan?
09:55 Uhr, Stefan per WhatsApp: Muss jetzt in die Konferenz, den nächsten Kulturteil durchplanen. Kann aber unterm Tisch aufs Handy gucken. Bitte schreib mir. Wenigstens kurz! Ob alles in Ordnung ist.
17:22 Uhr, Stefan per E-Mail:
Hallo Theresa!
Trotz meines WhatsApp-Terrors von heute Morgen keine Nachricht von dir. Das kann man konsequent nennen. Oder sadistisch. Diese Seite an dir ist neu. Aber ich habe ja gestern Abend viel Neues entdeckt. An dir und an mir.
Ich verstehe, dass du mich mit deinem Schweigen quälen willst. Nichts anderes habe ich verdient. Aber das, was gestern passiert ist, ging nicht nur von mir aus. Du warst genauso daran beteiligt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das anders siehst.
Den ganzen Tag habe ich aufs Handy gestarrt wie ein Teenager, der darauf wartet, dass die erste große Liebe ihm endlich auf sein Herzchen-Emoji antwortet. Dazu diese grausamen Kopfschmerzen. Drei Novalgin, keine Wirkung. Außerdem ist gestern ein wichtiges Projekt gescheitert, für das ich mich in der Redaktion ziemlich starkgemacht hatte. Vermutlich war ich auch deshalb so aggressiv. Wäre unser Abend anders verlaufen, hätte ich dir wahrscheinlich stundenlang davon erzählt.
Antwortest du mir in diesem Leben überhaupt noch mal? Sei gnädig, Sadistin. Ich warte.
Dein hundemüder Stefan
18:11 Uhr, Theresa per E-Mail:
Mann, Stefan, du klingst wie der Waschlappen, als den ich dich gestern beschimpft habe. Falls ich das wirklich getan habe. Ehrlich gesagt, ich erinnere mich schlecht. Haben wir früher auch so viel gesoffen? In Münster? Am Bodensee? Jedenfalls haben wir uns früher nicht so angeschrien. Ich schreie überhaupt selten. Was du mir jetzt wahrscheinlich nicht glauben wirst.
Ein paar Stunden keine Antwort auf WhatsApp, und du glaubst an Sadismus. Wenn es vier Wochen nicht regnet, hältst du das vermutlich für eine Strafe der Götter, für dich ganz persönlich. Wahrscheinlich bist du auch sonst der Dreh- und Angelpunkt des Universums. Wobei es euch Städtern eher egal ist, ob es regnet oder nicht. Ihr merkt das gar nicht.
Ich glaube, ich fange schon wieder an, dich zu beleidigen. Eigentlich wollte ich dich fragen, ob wir noch einmal von vorn anfangen wollen. Ich hatte mich so gefreut, dich wiederzutreffen. Nach fast zwanzig Jahren! Wie ein unverhofftes Neujahrsgeschenk. Und dann dieser unfassbare Zufall! Es kommt höchstens zwei oder drei Mal im Jahr vor, dass ich in den Westen fahre, um irgendeinen alten Herrn oder eine Dame zu besuchen, die bei uns in der Gegend noch Land besitzen und vielleicht verpachten oder verkaufen wollen. Zufällig war das dieses Mal in Hamburg. Zufällig wollte Herr Kröcher sich gleich Anfang des Jahres treffen – und da stehst du plötzlich in der U-Bahn vor mir und breitest die Arme aus. Wenn das kein Schicksal war. Danach ist das Ganze allerdings ziemlich aus dem Ruder gelaufen. Herrn Kröcher muss ich dann wohl ein andermal besuchen.
Wie du vielleicht weißt, geht der erste Zug von Hamburg nach Berlin um halb fünf. Ich bin also seit vier Uhr auf den Beinen, nachdem ich zwei Stunden in der Lobby des Ibis-Hotels vor mich hin gedöst hatte. Der Nachtportier hatte mich reingelassen, andernfalls wäre ich wahrscheinlich erfroren. In Berlin musste ich dann noch eine Stunde auf den Regionalbahnanschluss warten, dann weiter mit dem Auto von Plausitz nach Schütte. Seit neun bin ich auf der Arbeit, das Ganze bei Minusgraden. Deine Kopfschmerzen in allen Ehren, aber du kannst ja mal versuchen, dir vorzustellen, wie es mir geht.
Wenigstens ist mir jetzt wieder warm. Es ist wesentlich angenehmer, am Rechner zu sitzen und dir zu schreiben, als dir auf der hartgefrorenen Wiese an der Außenalster gegenüberzustehen, während du irgendwelche absurden Dinge behauptest. Wir sind ja gestern vor lauter Streiten nicht einmal dazu gekommen, uns in groben Zügen zu erzählen, was wir so tun und wie es uns so geht. Wie zum Teufel sind wir auf die fürchterliche Idee verfallen, uns bei diesen Temperaturen im Freien zu betrinken? Ein Wunder, wenn keiner von uns eine Lungenentzündung bekommt.
Lass es uns besser machen, per E-Mail. Wenn ich zwischendurch etwas Zeit finde, schreibe ich dir gern, was bei mir passiert. Und ich würde mich freuen, wenn du auch ein bisschen aus deinem Leben berichtest. Von außen betrachtet sind wir zwei ein ziemlicher Komödienstoff: du der Topjournalist aus Hamburg, ich die Milchbäuerin aus der brandenburgischen Provinz. Könnte eine ganz lustige Story werden.
Theresa
19:33 Uhr, Stefan per WhatsApp: Von vorn anfangen finde ich super. Ich lege einfach mal los. Name – Stefan Jordan. Alter – 46 Jahre. Beruf – Kulturchef bei der Hamburger Wochenzeitung BOTE. Beziehungsstatus – ledig und Single. Kinder – keine, von denen ich weiß. Tiere – heute einen Kater. Ist das ein Match?
19:43 Uhr, Theresa per WhatsApp: Keine Ahnung, frag den Algorithmus. Ich mach mal weiter. Name: Theresa Kallis. Alter: 43. Beruf: Vorstand der Kuh & Co. Schütte e. G. Glücklich verheiratet, zwei tolle Kinder, Jonas und Phil, acht und zehn.
19:52 Uhr, Stefan per WhatsApp: Du bist »Vorstand« von Beruf? Nicht vielleicht eher Vorständin? Oder Vorstandsvorsitzende? Angehörige des Vorstands?
20:01 Uhr, Theresa per WhatsApp: Nein, Stevie, du hast schon richtig gelesen, ich bin der Vorstand. Le Vorstand, c’est moi. Bei eingetragenen Genossenschaften mit weniger als zwanzig Mitgliedern genügt eine einzelne Person. Und ich hoffe sehr, dass du mir jetzt nicht wieder mit deinem Gender-Thema kommst, sonst können wir auch gleich zurück an die Außenalster und uns anschreien.
20:20 Uhr, Stefan per WhatsApp: Ruhig Blut, war nur eine Verständnisfrage. Mein Bedarf an Geschrei ist bis Mitte des Jahrhunderts gedeckt.
20:22 Uhr, Theresa per WhatsApp: Du schuldest mir übrigens Geld.
20:29 Uhr, Stefan per WhatsApp: Dann ist mein Filmriss deutlich schlimmer, als ich dachte. Hab ich dir das Portemonnaie geklaut? Oder dich angeschnorrt? Oder war dein ganzes Gezeter gestern Abend in Wahrheit eine Stand-up-Performance und ich muss dafür nachträglich Eintritt zahlen? Das kannst du vergessen.
20:31 Uhr, Theresa per WhatsApp: Du hast mit einer Idee von mir Karriere gemacht, und ich verlange eine Dividende von zehn Prozent auf alle deine Gehälter seit dem Jahr 2005. Da ist HEFTIG zum ersten Mal erschienen, wenn ich nicht irre.
20:40 Uhr, Stefan per WhatsApp: Du irrst keineswegs, und dein Selbstbewusstsein hat unter dem Landleben offenbar nicht gelitten. Das war nicht deine Idee, meine Schöne, sondern bestenfalls unsere Idee, oder, noch besser gesagt: Du hattest die Ehre, dabei zu sein, als mich der göttliche Funke traf.
20:44 Uhr, Theresa per WhatsApp: Mal im Ernst: Ich finde es großartig, dass du die Idee wahr gemacht hast. Ich glaube, wir haben damals am WG-Küchentisch jede Woche eine Man-müsste-mal-Idee produziert. Man müsste mal einen Duschkopf mit integrierter Shampoo-Düse erfinden. Oder ein Kondom mit Füllstandsanzeige. Oder man müsste mal ein Magazin rausbringen, das mit dem Zeitgeist Schritt hält. Echte Jugendkultur. Intellektuelles Trendsetting für unsere Generation. Und du gehst hin und machst das tatsächlich. Das ist echtHEFTIG. War der Name nicht auch von mir?
20:48 Uhr, Stefan per WhatsApp: Hm, ja, könnte sein. Und du hast Recht: Das HEFTIG-Magazin ist wirklich zum Sprungbrett für meine Karriere geworden. Die Reputation hält sich, obwohl der BOTE das Ding vor ein paar Jahren eingestellt hat. Trotzdem wäre ich ohne HEFTIG bestimmt nicht Kulturchef geworden. Nur das ganze Geld habe ich verprasst, fürchte ich.
21:01 Uhr, Theresa per WhatsApp: Keine Sorge. Wenn mir Geld wichtig wäre, hätte ich keinen Bauernhof.
21:13 Uhr, Stefan per WhatsApp: Das leuchtet ein.
21:20 Uhr, Theresa per WhatsApp: Ich muss Schluss machen. Basti ist schon genervt, weil ich die ganze Zeit auf dem Handy tippe. Vielleicht hören wir uns morgen.
Donnerstag, 6. Januar
18:33 Uhr, Stefan per E-Mail:
Hey Theresa,
ich finde es wirklich schön, dass wir uns schreiben. Eigentlich ist es ein Skandal, dass wir uns für so lange Zeit aus den Augen verloren haben. Dein Verschwinden hat mich damals ziemlich getroffen. Natürlich wusste ich von deinen Eltern, und dass du plötzlich einen Bauernhof führen musstest oder wolltest, aber verstanden habe ich das nicht. Und du hast nie versucht, es mir zu erklären. Vielleicht holst du das bei Gelegenheit einmal nach.
Nach unserem kleinen WhatsApp-Austausch habe ich lange am Fenster gesessen, über die Dächer des Schanzenviertels geschaut und an früher gedacht. Wir beide in Münster. Wie wir uns im Erzähltheorie-Seminar von Dr. Renate »Reni« Werner kennengelernt haben. Du kamst rein mit deinen sensationellen blonden Locken, die du an dem Tag offen getragen hast (das war wirklich umwerfend), und ich hatte den Eindruck, dass dich alle anstarrten. Wenn mir in diesem Moment jemand gesagt hätte, dass du ein paar Wochen später bei mir einziehst (okay, du brauchtest dringend ein Zimmer, und ich hatte eins übrig) wäre ich vermutlich umgefallen. Ich konnte mein Glück kaum fassen – die hübscheste Erstsemester-Studentin der gesamten WWU saß plötzlich bei mir am Küchentisch, ohne dass ich mehr vorweisen musste als einen Mietvertrag über Zwei-Zimmer-Küche-Bad. Auch wenn dann tatsächlich eine WG und kein Liebespaar aus uns geworden ist, habe ich es immer als Geschenk betrachtet, mit dir zusammenwohnen zu dürfen. Überhaupt, diese absurde Wohnung! Teppich auf dem Klo. Der andauernd betrunkene Hausmeister Haverkamp. Jahrelang das Gerüst vor meinem Fenster, mit Bauarbeitern darauf, die mir beim Martin-Walser-Lesen zuschauten. Irgendwann später habe ich auf einer Party von unserer WG erzählt … Wie wir zusammengelebt haben, platonisch, auf engstem Raum. Dass mein Zimmer hinter dem Bad lag, so dass ich nicht rein- oder rauskonnte, wenn du unter der Dusche warst. Man hat mir das nicht geglaubt.
Wir haben so viel geredet damals – über Politik und Kunst, Gott und die Welt, Sex und Tod. Wir waren so radikal ehrlich und voll von unerschütterlichem Vertrauen. In uns, in unsere Zukunft. Manchmal denke ich, die gemeinsame Zeit mit dir war die Keimzelle für alles, was ich später beruflich gemacht habe.
Wobei ich mich für manches schäme. Zum Beispiel für HEFTIG. Das Magazin war so erfolgreich und hat meiner Karriere so gutgetan – aber diese unfassbar naive Konsumfreude, der hemmungslose Hedonismus, das ist aus heutiger Sicht kaum noch nachvollziehbar. In HEFTIG haben wir allen Ernstes Reportagen über die schönsten Urlaubsziele in der Karibik geschrieben, während der Klimawandel immer schneller voranschritt. Wir haben überhaupt nichts gemerkt! Das war wie ein kollektives Koma, ein Totalversagen, nicht nur politisch, sondern auch journalistisch. Ich habe definitiv etwas wiedergutzumachen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich zurzeit an einer neuen Idee arbeite. Es soll wieder ein Magazin im DIN-A4-Format werden, das dem BOTEN beigelegt wird. Erst mal nur mit einer Pilotausgabe, aber meine Hoffnung ist natürlich, dass die Sache gut ankommt und wir in Serie gehen.
Auch dieses Mal gibt es übrigens eine Frau, die mich inspiriert hat. Sie heißt Carla al-Saed, eine junge Kollegin aus unserer Berliner Online-Redaktion. Carla und ich haben den Verlag vor ein paar Wochen bei einem nervtötenden Branchen-Event in München vertreten und sind in der Veranstaltungspause ins Gespräch gekommen. Sie hat sicher auch so etwas wie »Man müsste mal …« gesagt, jedenfalls fing sie plötzlich an, von einer monothematischen Klima-Beilage zu sprechen, einem Heft zum wichtigsten Thema unserer Zeit. Zunächst als einmalige Aktion. Ich hörte ihr zu und hatte plötzlich eine spontane Idee, die, wenn ich das in aller Bescheidenheit sagen darf, ein ziemlicher Clou ist: Die Klima-Beilage soll nicht nur von Redakteur*innen aus den Umwelt- und Wissenschaftsressorts geschrieben werden, sondern auch von ausgewählten Aktivist*innen der Klimabewegung. Carla und ich haben uns gleich in Rage geredet und die zweite Hälfte des Symposiums einfach geschwänzt. Vermutlich war ich dem Münsteraner Küchentisch an diesem Nachmittag so nahe wie seit Jahren nicht.
Ein paar Tage später habe ich das Konzept unserem Chefredakteur Flori Sota vorgestellt (du kennst ihn bestimmt aus den Talkshows), nicht hochoffiziell in einer Konferenz, sondern bei einem unserer vielen Gespräche in seinem Büro. Ich schätze den Mann. Er ist gewissermaßen mein Förderer und wohl auch eine Art väterlicher Freund. Wir reden Klartext miteinander und sind manchmal nicht gerade zimperlich, aber immer absolut fair. Flori fragte als Erstes, ob wir dann demnächst auch ein Themenheft Tierwelt gemeinsam mit Seegurken, Flughörnchen und Wombats verfassen würden – da haben wir noch beide gelacht. Als er merkte, dass ich die Sache absolut ernst meinte, wurde die Unterhaltung deutlich unharmonischer. Am Ende ein richtiger Streit. Flori warnt schon seit geraumer Zeit vor einer »hochriskanten« Vermischung von Journalismus und Aktivismus. Ich sehe darin eher eine Notwendigkeit und vor allem eine Chance. Letztlich geht es um die Frage, ob Journalismus sich eine Haltung erlauben darf oder sogar muss, was ich angesichts der Klimakrise und des wachsenden Rechtspopulismus ziemlich alternativlos finde.
Als sich abzeichnete, dass Flori meine Idee mit der Klima-Beilage tatsächlich rundheraus ablehnte, habe ich das »undemokratisch« genannt, woraufhin er sein berühmtes ironisches Lächeln zeigte und sagte: »Dann lass uns doch mehr Demokratie wagen.« Er hat einen Vorschlag zur Güte gemacht: dass wir ein »Stimmungsbild im Haus« abfragen. Redaktionelle Mitbestimmung besitzt bei uns eine lange Tradition, das ist nichts Ungewöhnliches, und ich muss sagen, ich hatte ein gutes Gefühl. Der Print-Markt ist nach wie vor in der Krise. Alle suchen nach Möglichkeiten zur Erneuerung. Warum sollten die Kolleg*innen etwas dagegen haben, mit einer solchen Idee nach vorn zu gehen?
Dieses Stimmungsbild-Meeting fand jedenfalls gestern Nachmittag bei uns im großen Konferenzsaal statt, drei Stunden, bevor ich dich dann plötzlich in der U2 getroffen habe. Es waren auch Mitglieder (m/w/d) der Online-Redaktion aus Berlin zugeschaltet, unter anderem natürlich Carla al-Saed. Sie hat dann auch gleich zu Beginn ein starkes Statement pro Klima-Beilage abgegeben, Tenor: Wir sind der Aufklärung verpflichtet, der Wissenschaft, der Bildung. Wir müssen ein Zeichen setzen und den anderen Zeitungen mit gutem Beispiel vorangehen. Carlas Wortbeitrag hatte etwas von einem Manifest. Die jüngeren Mitarbeiter*innen haben spontan applaudiert. Aber es gibt eben auch die Fraktion der »Alten«, die bei einem ehrwürdigen Blatt wie dem BOTEN noch immer in der Überzahl sind – jedenfalls in der Redaktionskonferenz. Sota kann zählen, er kennt seine Schäfchen, und er hatte mit Sicherheit im Vorfeld sondiert. Nachdem die offene Diskussion kein eindeutiges Ergebnis brachte, rief er eine Kampfabstimmung aus – 37 Leute für die Klima-Beilage, 44 dagegen. Sota hatte von Anfang an gewusst, wie das ausgehen würde. Auf diese Weise ist er mich und meine Idee ganz demokratisch losgeworden.
Bei allem Respekt für Flori – ich war mächtig angekotzt. Bin ich noch immer. Du siehst, unser Zufallstreffen stand unter keinem guten Stern.
So, lang genug Interna ausgeplaudert. Aber immerhin konnte ich mir mal den Frust von der Seele schreiben. Was machst du gerade? Lass mich raten. Du stapfst nach der Feldarbeit über eine verschneite Wiese nach Hause zu deinem Fachwerkhof, feuerst den offenen Kamin an und ziehst die Stiefel aus. Liest du dann einen Krimi zur Entspannung? Oder immer noch Martin Walser?
Dein Stefan
19:24 Uhr, Theresa per E-Mail:
Ist das nicht die Kernidee von Demokratie? Wenn die Mehrheit dagegen ist, wird die Sache abgeblasen?
19:33 Uhr, Stefan per E-Mail:
So einfach ist das nicht, und man kann ja auch nicht alles demokratisch entscheiden … Das würde jetzt zu weit führen.
Freitag, 7. Januar
10:36 Uhr, Theresa per E-Mail:
Lieber Stefan,
klar, demokratische Entscheidungen sind eine Zumutung, vor allem, wenn man verliert. Niedlich, wie du versuchst, Flori Sota dafür die Schuld zu geben.
Noch niedlicher, wie du dir mein Leben vorstellst. Verschneite Felder und offener Kamin. Wahrscheinlich hast du diese Bilder aus einem Kinderbuch. Oder vom Playmobil-Bauernhof. Drei Heuballen, zwei Kühe, ein Schwein. Links der Misthaufen, rechts die Fachwerkscheune.
Dazwischen laufen ein paar Hühner, und die Bäuerin mit den langen blonden Locken pflückt Äpfel in einen Korb. Wahrscheinlich sind solche Provinzphantasien normal für einen Großstadtintellektuellen, der mit Talkshow-Größen wie Flori Sota über die Zukunft des Journalismus diskutiert (ich gucke normalerweise keine Talkshows, aber dass du Sota so gut kennst, hat mich schon beeindruckt. Er ist ein wirklich schlauer Typ, und dabei auch noch ziemlich sympathisch, liegt vermutlich an seiner ironischen Art). Weil es hier so verdammt anders aussieht, als du glaubst, will ich ein bisschen beschreiben, was mich umgibt.
Der Hof, den ich nach dem Tod meines Vaters übernommen habe, heißt jetzt »Kuh & Co. Schütte e.G.« und war vor der Wende eine LPG, was man immer noch deutlich sieht. Keine Fachwerkscheunen, sondern weitläufige Betonflächen, auf denen flache Hallen stehen. Dazu Futtersilos, ein Maschinenpark, Gülletanks. Strohmieten und Silage-Berge. Melkmaschine und Kühlanlage. Der Misthaufen hat die Höhe eines zweistöckigen Hauses und wird vom Teleskoplader an die Biogasanlage verfüttert. Nachts kommen silberne Tanklaster auf den Hof, um die Milch abzuholen. Jede Kuh trägt einen Transponder um den Hals, der uns modernes Herdenmanagement ermöglicht. Romantik ist anders, dafür sind wir ziemlich gut organisiert. Die Büros befinden sich in einem Flachbau, den wir neu errichtet haben. Davor waren meine Sekretärin Britta und ich in Containern untergebracht, die im Sommer unerträglich heiß wurden. Jetzt habe ich ein Büro mit Klimaanlage und Kaffeemaschine und muss mir den Computer nicht mehr mit Britta teilen. Nur deshalb kann ich überhaupt hier sitzen und dir schreiben, auch wenn ständig jemand reinkommt und fragt, ob noch Kaffee da ist. Britta verfügt mittlerweile über einen eigenen Raum, klein, aber fein und so vollgestopft mit Leitz-Ordnern, dass man sich kaum noch bewegen kann. Sie hat die Angewohnheit, sich beim Telefonieren mit dem Stuhl um die eigene Achse zu drehen, was mich früher fast in den Wahnsinn getrieben hat. Seit ich ihr nicht mehr dabei zugucken muss, verstehen wir uns viel besser.
Vor meiner Zeit gab es auf dem Hof ein schickes Wohnhaus, das mein Urgroßvater um 1900 erbaut hatte. Auf alten Postkarten kann man es noch bewundern: symmetrische Stuckfassade, Freitreppe, zwei Linden vor dem Haus und die Nebengebäude tatsächlich mit Fachwerk. Bestimmt gab es damals auch freilaufende Hühner. Mein Vater hat seine ersten Kindheitsjahre dort verbracht, bevor Anfang der Fünfziger die Zwangskollektivierung begann. Seine Familie wurde enteignet und musste den Hof verlassen, und das Wohnhaus wurde abgerissen – als unerwünschtes Symbol des Großbauerntums. Sie sind in ein kleineres Haus in der Dorfmitte gezogen, das mein Vater dann später übernommen hat. Dort bin ich geboren und aufgewachsen, und heute lebe ich mit Basti und den Jungs wieder darin. Die Kuh & Co. liegt gleich hinter dem Ortsschild am östlichen Dorfrand, so dass ich morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann. Ehrlich gesagt bin ich ganz froh, nicht auf dem Hof zu wohnen. Die Arbeit verfolgt mich auch so schon oft genug bis in den Schlaf.
Obwohl in den letzten Jahren alles viel besser geworden ist. In der Anfangszeit war der Job eine ziemliche Katastrophe, und ich war mit meinem abgebrochenen Germanistikstudium (kurz vor dem Abschluss … mein Gott!) auch nicht gerade eine Idealbesetzung. Mein Vater hatte den Betrieb im alten Stil geführt, der Investitionsstau war gewaltig, die Umstellung auf Biogas und Öko-Siegel unvermeidlich. Außerdem sind wir seit der Wende eine eingetragene Genossenschaft, das heißt, fast jeder, der hier arbeitet, hält Anteile am Unternehmen und kann über grundlegende Fragen mitentscheiden. Kündigungen von größeren Anteilseignern sind so gut wie ausgeschlossen, weil die Genossenschaft sie auszahlen müsste und dafür nicht genug Rücklagen besitzt. Mein Vater wollte das so, er hat an das Prinzip geglaubt, und natürlich verstehe ich das ethische Konzept, aber die Umständlichkeit der Prozesse kann einen manchmal geradezu in den Wahnsinn treiben. Versuch mal, eine Neuausrichtung vorzunehmen, wenn zehn Leute mitreden dürfen – Melker, Stallknechte, Traktoristen. Ohne Britta hätte ich das niemals geschafft. Sie hat schon für meinen Vater gearbeitet und kennt den Laden besser als jeder andere. In gewisser Weise war sie hier immer die heimliche Chefin. Wenn sie über den Hof brüllt »Rauchen verboten!«, schmeißt selbst mein Vorarbeiter Christian die Zigarette weg.
Es hat eine Weile gedauert, aber inzwischen bin ich in meine Rolle hineingewachsen. Ich habe noch Agrarwissenschaften im Fernstudium absolviert (dieses Mal mit Abschluss!), dazu viele Fortbildungen mit Schwerpunkt Ökologie und Milchwirtschaft gemacht. Am meisten hat mich letztlich der Alltag gelehrt, die tägliche Arbeit auf dem Hof. Mein Beruf ist eine Wundertüte, man kann niemals richtig vorbereitet sein. Ausnahmezustand als Normalfall. Kühe werden krank, Maschinen gehen kaputt, Mitarbeiter erscheinen nicht zur Arbeit. Das Wetter tut nie, was es soll, und wenn sonst nichts schiefgeht, kommt jemand vom Arbeitsschutz, vom Naturschutz oder von der Bio-Kontrolle und beanstandet irgendein Detail. Aber was soll’s – wenn ich mich darüber beschweren würde, wäre ich wie ein Arzt, der sich beklagt, dass seine Patienten dauernd krank sind. Ich versuche, an den Herausforderungen zu wachsen. Das Wichtigste sind starke Nerven, Improvisationstalent und eine gute Beziehung zu den Mitarbeitern. Gott sei Dank sind alle drei Faktoren vorhanden. Meine Leute respektieren mich, und mittlerweile sind auch alle vom Bio-Konzept überzeugt. Ich schaffe es, meine Familie zu ernähren – was will man mehr? Mein Mann Basti ist Mechatroniker von Beruf, arbeitet aber nur halbtags wegen der Kinder. Er trägt nicht gerade viel zum Familieneinkommen bei. Das soll sich bald ändern, er besucht die Meisterschule und will nächstes Jahr die Prüfung zum Kfz-Meister ablegen, spezialisiert auf Elektromobilität. Er träumt davon, eine eigene, hochmoderne Werkstatt zu eröffnen. Na ja, das ist Zukunftsmusik. Bis dahin lastet die Existenzsicherung auf meinen Schultern.
Natürlich gibt es auch eine Schattenseite. Rasant steigende Pachtpreise und Energiekosten, verfehlte EU-Subventionen, Politiker, die unsere Probleme nicht verstehen, und Verbraucher, die für ihr Essen nichts zahlen wollen. Manchmal könnte man daran verzweifeln. Aber wir lieben unseren Betrieb und haben das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun. Das ist am Ende wichtiger als ein störungsfreier Arbeitsalltag. Ich stelle immer wieder fest, wie sehr ich das Leben hier schätze. Vor allem die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Klar, als Zwanzigjährige bin ich aus dem Dorf geflohen. Alles war zu eng, zu beschränkt, zu langweilig. Hier kann man mit niemandem über Literatur oder Weltpolitik reden. Aber dafür stehen die Leute mit beiden Beinen auf dem Boden, und wenn du Hilfe brauchst, ist immer jemand da.
Nachdem meine Mutter zu ihrer Schwester an die Ostsee gezogen ist, haben Basti und ich das Haus komplett saniert. In meinem alten Kinderzimmer habe ich mir ein kleines Büro eingerichtet, in dem ich manchmal spätabends noch Papierkram erledige. Der Blick aus dem Fenster ist noch genau wie früher. Ich sehe ein Stück Dorfkirche, und, wenn ich mich nach rechts beuge, eine Ecke vom Friedhof mit den Gräbern von Hugo Stechow und Familie Zille. Auf der linken Seite sehe ich das Haus von Willy, das immer noch »das Haus von Willy« heißt, obwohl inzwischen eine junge Familie dort wohnt, deren Namen ich nicht kenne.
Seit der Sanierung ist bei uns im Haus alles hell und modern, mit abgeschliffenen Kieferndielen und schicken Deckenbalken und, ja, auch einem offenen Kamin. Basti hat vieles selbst gemacht, er ist handwerklich sehr geschickt. Meiner Meinung nach hätte er auch Innenarchitekt werden können. Er hat ein gutes Auge und einen Sinn für Stil. Aber bei der Vorstellung, seinen Astralkörper auf den Klappsitz eines Uni-Hörsaals zu falten, bekommt er einen Lachkrampf. Im Keller hat er sich einen Fitnessraum eingerichtet, in dem er täglich Hanteln stemmt, damit der Umfang seiner Oberarme nicht unter vierzig Zentimeter sinkt. Ich habe nichts dagegen. Er sieht ein bisschen aus wie eine 45-jährige Version von »Ken«. Schade, dass ich keine Zeit habe, an meinen Barbie-Qualitäten zu arbeiten.
Vielleicht kommst du eines Tages mal vorbei und schaust es dir selbst an (den Hof, nicht Basti). Auch wenn Schütte nicht gerade ein Tourismuszentrum ist. Achtzig Kilometer westlich von Berlin, 451 Einwohner, 28 Prozent AfD. Dünn besiedelt, sozial schwach, ziemlich vergessen von der Welt. Flache Landschaft, unfruchtbare Sandböden, trockene Kiefernwälder. Einkaufszentren und Windparks. So ziemlich das Gegenteil von Hamburg und der Außenalster. Dafür jede Menge Beinfreiheit. Spätestens seit der Corona-Zeit mache ich jeden Tag drei Kreuze, weil ich hier draußen und nicht in der Stadt wohne. Für Jonas und Phil ist es auch besser, obwohl der Schulweg ziemlich lang ist. Sie gehen auf die Grundschule vier Dörfer weiter, der Bus hält an jeder Milchkanne und braucht vierzig Minuten für den Weg. Aber wenn wir mal in Berlin sind, schauen sie mit großen Augen aus dem Autofenster und sagen: »Oh Gott, Mama, die armen Menschen, die hier leben.«
So, jetzt muss ich mal wieder an die Arbeit. Britta kam schon zweimal rein und hat gefragt, seit wann ich in einem solchen Tempo Subventionsanträge tippe.
LG Theresa
Samstag, 8. Januar
15:32 Uhr, Stefan per E-Mail:
Liebe Theresa,
danke für diese anschauliche Desillusionierung. Es ist verrückt – jetzt bekomme ich plötzlich mit zwanzig Jahren Verspätung Einblick in dein neues, aufregendes, seltsames Leben. Einen Playmobil-Hof hatte ich mir zwar nicht vorgestellt, aber dass du als Bäuerin über eine Sekretärin in einem Container verfügst und deine Kühe Transponder besitzen (eine Gemeinsamkeit – ich öffne damit im Verlagshaus sämtliche Türen), wäre mir im Traum nicht eingefallen. Dass bei euch 28 Prozent rechtsradikal wählen, ist natürlich eine Katastrophe. Kann mir gar nicht vorstellen, wie du das aushältst. In Münster waren wir noch gemeinsam auf AStA- und Juso-Demos. Vermutlich spielt Politik in einem landwirtschaftlichen Betrieb einfach keine Rolle, und man muss jede Arbeitskraft nehmen, die man kriegen kann. Ich käme damit trotzdem nicht klar.
Wenn du magst, erzähle ich dir im Gegenzug etwas von meinem Job. Der ist zwar in der Regel deutlich weniger katastrophisch als deiner, aber trotzdem nicht ganz unkompliziert. Im Grunde sind wir mit unseren 237 Kolleg*innen so etwas wie eine Bundesrepublik in der Nussschale – und je größer die Krisen im Land ausfallen, desto turbulenter geht es auch bei uns zu.
Die Konflikte in der Redaktion rühren nicht zuletzt daher, dass sich gerade ein Generationenwechsel vollzieht. Es gibt beimBOTEN immer mehr junge Kolleg*innen, die Dinge neu denken, sich mit den alten Antworten nicht mehr zufriedengeben und mit einem ganz anderen Fokus auf die Fragen der Zeit blicken. Das ist gut so, führt aber zu Streit mit der alten Garde. In letzter Zeit kracht es immer häufiger. Als ich vor achtzehn Jahren (Tessa, wir sind alt!) hier angefangen habe, gab es immer wieder Diskussionen um die Notwendigkeit einer Verjüngung (HEFTIG war so ein Versuch) und entsprechend auch Konflikte um Themensetzungen und -gewichtungen. Aber rückblickend betrachtet waren das niedliche Diskussiönchen. Die jungen Journalist*innen von heute sind auf eine andere Weise selbstbewusst, als wir es damals waren. Sie begreifen sich als Avantgarde, und das bezieht sich nicht nur auf ihre Arbeit, sondern auch auf den Grad ihrer politischen Aufklärung. Das Establishment bei uns im Haus – 65 Prozent Männer, alle fünfzig plus – belächelt und fürchtet diese Entwicklung gleichermaßen. Ich stehe altersmäßig eher dazwischen, aber mein journalistisches Herz schlägt definitiv auf der jungen Seite. Die Themen sind zu wichtig, um einfach weiterzumachen wie bisher.
Die Kampfabstimmung zur Klima-Beilage hat gezeigt, dass die Älteren den Jungen zahlenmäßig noch immer überlegen sind. Aber natürlich weiß jede/r, dass die Zeit für die Jüngeren spielt. Und genau diese Erkenntnis scheint einige der Alten regelrecht zu verbittern. Manche Kolleg*innen reden gar nicht mehr miteinander, sondern nur noch übereinander. Beim Mittagessen in der Kantine gibt es jetzt zwei Lager. Die eine Seite auf dem Linoleum des alten Pressehauses, die andere auf dem Granitboden des neuen Wintergartens, der vor acht Jahren angebaut wurde. In den kalten Monaten ist der gesamte Bereich chronisch überheizt, und die Fenster lassen sich aus Brandschutzgründen nicht öffnen, weshalb die Kantine bei uns »das Treibhaus« heißt. Es scheint, als würden Haltungen, Meinungen und Konflikte in dieser Atmosphäre noch schneller gedeihen als irgendwo sonst. Wir scherzen regelmäßig darüber, wann es an dieser innerredaktionellen Grenze erste Handgreiflichkeiten gibt, aber dieser Witz wird mit der Zeit immer unlustiger, weil ihm die Realität manchmal bedrohlich nahekommt.
Die Jüngeren haben also den Wintergarten inklusive Salatbuffet besetzt, in Reichweite des Espresso-Tresens (wie sollte es anders sein). Den Älteren gehört der Altbauteil mit Empore, auf der man ein bisschen gedrängt sitzt, dafür aber den Überblick hat. Tatsächlich kann man die Vergangenheit dort oben sogar riechen. Die Ausdünstungen des Linoleums, kalter Zigarettenrauch, Rasierwasser – so hat früher der ganze BOTE gerochen. Jetzt ist es nur noch ein Reservat von hundert Quadratmetern.
Ein paar der Älteren haben sich inzwischen für die Salat-Seite entschieden und sind ganz vorn mit dabei, terminologisch, thematisch, vegetarisch und von der Lautstärke her sowieso. Wer seinen Sitzplatz wählt, wählt seine Seite. Ich glaube, manch eine/r der Älteren verzichtet seit Wochen auf Rohkost, weil sie/er keine Lust hat, sich unter den Blicken der Jungen geraspelte Möhren, Rucola und hartgekochte Eier auf den Teller zu laden. Wenn Flori Sota mal in der Kantine auftaucht, thront er auf der Empore wie ein König. Essen tut er selten etwas. Ich bin meistens beim Salat zu finden, versuche aber regelmäßig zu pendeln.
Bei den Jungen diskutieren wir über Critical Race Theory, intersektionellen Feminismus, Klimawandel, White Supremacy, Gendersprache und die Bekämpfung der AfD. Wir entwickeln hier die besten Ideen, wie neulich den Vorschlag, zum Rosenmontag eine Themen-Doppelseite »Blackfacing« zu machen, um die Leser*innen dafür zu sensibilisieren, wie sehr ein dunkel geschminktes Gesicht schwarze Menschen verletzt. Ich sage dir: Im Wintergarten passiert etwas! Hier sind die Energie und die Zukunft. Wer bei uns sitzt, ist aufgewacht, am Puls der Zeit, er oder sie weiß, was relevant ist, was die Leute beschäftigt.
Auf der Empore besprechen die Älteren die soziale Frage wie zu Willy Brandts Zeiten, ohne das Wort »Identität« auch nur einmal zu benutzen. Die Altliberalen sehen ständig die Freiheit in Gefahr, die Altlinken wettern gegen die Macht multinationaler Konzerne. Ab und zu geht es auch mal um die Bundesliga, Sauvignon blanc, Immobilienpreise, Porsche-Youngtimer und den Thermomix. Immer mal wieder erinnert jemand an die guten alten Zeiten, als man in der Kantine noch rauchen durfte, und erntet zustimmende Blicke. Manchmal glaube ich, die halten einen Cis-Mann für einen Musiker.
So ist das bei uns – aber die gute Nachricht lautet: Die Dinge entwickeln sich in die richtige Richtung, wenn auch viel zu langsam. Aber so ist es ja immer. Erst gibt es viel Geschrei, und dann kann sich eines Tages keine/r mehr daran erinnern, dass es einmal anders war. Die verbliebenen Unbelehrbaren sterben einfach aus. Schon weil ein Großteil von ihnen immer noch raucht.
Stefan
Montag, 10. Januar
15:11 Uhr, Stefan per WhatsApp: Du meldest dich gar nicht. Findest du die Berichte aus dem Zeitungsdschungel etwa nicht hochspannend? Schreist du nicht nach Fortsetzung?
16:22 Uhr, Theresa per WhatsApp: Nee. Finde ich alles ziemlich pipifax.
16:28 Uhr, Stefan per WhatsApp: Musste laut lachen. Du bist unbezahlbar! Wir reden hier über die Existenzfragen unserer Epoche, und du hältst das für Pipifax. Stark.
17:05 Uhr, Theresa per WhatsApp: Ich glaube, ihr redet vor allem über euch selbst. Aber ich schreibe dir trotzdem wieder. Hab nur diese Woche viel zu tun.
17:10 Uhr, Stefan per WhatsApp: Ich freue mich auf Nachrichten aus dem Kuhstall!
Donnerstag, 13. Januar
20:31 Uhr, Theresa per E-Mail:
Lieber Stefan,
okay, ich gebe es zu: Ein bisschen spannend finde ich es schon, was du aus deiner BOTE-Welt erzählst. Vielleicht komme ich mir sogar ein wenig langweilig und provinziell vor, weil ich selbst nur vom Melken und Traktorfahren berichten kann. Die geteilte Kantine – serientauglich! Wir essen hier mittags aus der Stullenbüchse. Für mich sind deine Schilderungen Nachrichten aus einer fremden Welt. Dispatches from elsewhere. Ob du es glaubst oder nicht – ich musste nicht nur »White Supremacy« googeln, sondern auch »Thermomix«. Hatte keine Ahnung, dass es Küchengeräte zum Preis eines Gebrauchtwagens gibt. Aber so schillernd das alles klingt – irgendwie spielt ihr in eurer kleinen Blase doch ein Spiel, das nur euch selbst betrifft, und verwechselt es mit der Wirklichkeit. Als würdet ihr in Platons Höhle sitzen und euch über die Schatten an der Wand in die Haare kriegen. Wobei ich deine Idee mit der Klima-Beilage wirklich gut finde. Es wäre toll, mal ein paar unbequeme Fragen zu stellen. Zum Beispiel, ob Elektromobilität wirklich dem Klima nützt oder vielleicht eher der Autoindustrie, wenn der Strom dafür zu großen Teilen aus Kohle- und Atomkraftwerken kommt und die Batterien aus China. Nichts gegen die Autoindustrie. Aber in Sachen Klimawandel müsste bald mal etwas Richtiges getan werden. Wenn das so weitergeht mit der Dürre jeden Sommer, kann die Landwirtschaft einpacken. Aber über echte Dinge schreibt ihr wahrscheinlich nicht.
Hilfe, stopp, ich fange wieder an, dich zu ärgern. Tut mir leid. Irgendetwas an dir und deiner Arbeit provoziert mich. Vielleicht bin ich auch nur neidisch, weil du weiterhin in dieser Reden-Schreiben-Lesen-Welt lebst, aus der ich damals abgehauen bin. Ich lese nicht einmal eure Zeitung, geschweige denn einen Roman. Die Arbeit, die Kinder, der Haushalt … Meistens bin ich abends so müde, dass ich neben Basti vor dem Fernseher einschlafe. Aber ich fahre halt auch nicht gemütlich um zehn Uhr ins Büro und sitze erst mal mit einem Caffè Latte im Konferenzraum. Stattdessen muss ich spätestens um sechs raus, Kinder fertig machen für den Schulbus, danach mit dem Fahrrad zur Kuh & Co. Zurzeit im Stockdunkeln und bei drei Grad unter null. Gefütterte Gummistiefel und Daunenparka.
Auch wenn das frühe Aufstehen gerade im Winter ziemlich hart sein kann – im Grunde liebe ich es, den Tag auf diese Weise zu beginnen. Auf dem Hof führt mich mein erster Weg in den Stall, ganz egal, wie viel Arbeit am Schreibtisch auf mich wartet. Immer erst mal zu den Kühen. So habe ich es schon als Kind gemacht, wenn ich meinen Vater in der LPG besuchte. Die großen, warmen Körper, die freundlichen Augen, der intensive Geruch … Bei den Tieren herrscht ein ganz besonderer Frieden. Alle warten vertrauensvoll darauf, was als Nächstes passiert. Um sieben haben meine Leute das Melken beendet, und ich helfe meistens dabei, die Kühe auf den Winterauslauf zu treiben, wo sie sich die Beine vertreten und Heu vom Wagen fressen können. Zu diesem Zweck müssen wir die Landstraße sperren und einen Korridor abstecken, durch den wir zweihundert Tiere auf die andere Seite trotten lassen, während die Autofahrer beim Warten den Motor abstellen wie an einem Bahnübergang. Danach müssen die Fahrbahnen gesäubert werden, bevor wir die Straße wieder freigeben. Nachmittags beim Zurücktreiben das gleiche Spiel. Das macht eine Menge Arbeit, aber die Tiere lieben es, draußen zu sein. Wenn es ihnen gut geht, geht es mir auch gut.
Weißt du, als mein Vater starb, ist hier alles aus den Fugen geraten. Es kam total überraschend. Er hatte einen Herzinfarkt draußen auf dem Feld. Natürlich besaß er kein Handy, und selbst wenn er eins gehabt hätte – die Funklöcher bedecken heute noch den halben Landkreis. Als man ihn fand und endlich der Hubschrauber kam, war es zu spät. Meine Mutter war immer eine starke Frau. Aber Papas plötzlicher Tod war zu viel für sie. Die meiste Zeit lag sie apathisch auf dem Wohnzimmersofa und war kaum in der Lage, den Haushalt zu führen. Dass sie den Betrieb übernehmen könnte, stand völlig außer Frage. Also war der Hof plötzlich ohne Chef. Eine Zeitlang konnten Christian und Britta einspringen, aber das war keine Dauerlösung. Früher oder später hätte meine Mutter verkaufen müssen, und die Kuh & Co. wäre von irgendeinem Agrarinvestor zerschlagen worden. Christian, Britta, die Melker, die Traktoristen – sie wären alle arbeitslos geworden. Das Dorf Schütte hätte sein Herz verloren.
Zuerst war mir trotzdem nicht klar, was mich das anging. Ich wohnte bei meiner Mutter, pflegte sie, kümmerte mich um die Beerdigung und tausend Formalitäten. Als sich das schlimmste Chaos lichtete, bin ich irgendwann frühmorgens auf den Hof gefahren, um die Kühe zu besuchen. Da standen sie, zweihundert große Tiere, und blickten mir treu entgegen. Ich ging zu ihnen hinein, legte die Hände auf ihre mächtigen Körper und kraulte sie zwischen den Ohren. Ich spürte ihre warme, atmende Masse, ihre geballte Lebendigkeit, dazu die Freundlichkeit, mit der sie mir entgegenkamen, obwohl sie mich jederzeit hätten zertrampeln können. Bei einer Auflösung des Hofs hätte man sie alle geschlachtet. Man hätte ihre Masse, ihre Wärme und ihre Freundlichkeit restlos ausgelöscht. Das Land und die Maschinen wären verhökert worden. Alles unrentabel nach modernen Kriterien. Du musst dir vorstellen, es gibt hier Betriebe mit dreitausend Kühen und Melk-Karussellen mit hundert Plätzen. Die produzieren im industriellen Maßstab. Da kann eine kleine Genossenschaft nicht mithalten. Schon gar nicht, wenn man sich für das Wohl der Tiere interessiert. Zweihundert Augenpaare richteten sich erwartungsvoll auf mich. Und plötzlich wusste ich, was ich zu tun hatte.
Ich bin einfach geblieben. Ich habe den Hof übernommen, auf Öko-Wirtschaft umgestellt, die Betriebsabläufe modernisiert und eine kleine Biogasanlage gebaut, in der wir Gülle, Stalldung und Futterreste vergären. Wir haben immer noch zu viele Schulden, zu wenig Eigenkapital und vor allem zu wenig Land. Aber immerhin gibt es uns noch. Meine Entscheidung habe ich nicht bereut. Der Dauerkampf mit Störfällen, Ausfällen und allen denkbaren Absurditäten ist frustrierend. Aber wenn ich morgens in den dunklen, warmen Stall trete – dann weiß ich verdammt noch mal, warum ich das hier mache.
Was sich wirklich ändern muss, ist die Politik. Sie lässt uns nicht nur im Stich, sie legt uns Steine in den Weg. Heute Nachmittag hatte ich mal wieder ein Treffen mit einem Vertreter der BVVG. Das ist die Nachfolgeorganisation der Treuhand, die hier noch immer die ehemals volkseigenen Flächen verwaltet. Statt uns das Land, das wir bewirtschaften, zu einem vernünftigen Preis zu verkaufen, veranstaltet die BVVG Auktionen, bei denen der Meistbietende gewinnt. Das sind nicht wir, sondern Investoren aus dem Westen, die inzwischen riesige Flächen bewirtschaften. Die Pachtpreise gehen durch die Decke. Dazu die absurde Bürokratie. Wenn man heutzutage als Landwirt Blasen an den Fingern bekommt, dann nicht vom Sensen, sondern vom Ausfüllen irgendwelcher Formulare. Britta thront wie die Königin der Leitz-Ordner in ihrem kleinen Reich, aber die Verantwortung hängt letztendlich immer an mir. An manchen Tagen machen wir kaum etwas anderes, als die passenden Unterlagen für Anträge, Rückvergütungen und Dokumentationen zu suchen, zu bearbeiten, fristgerecht einzureichen und abzuheften. Wenn dann noch der Sadist vom Arbeitsschutz vorbeikommt und nichts Besseres zu tun hat, als das geknickte Kabel einer Flex oder den TÜV irgendeines Kompressors zu beanstanden – dann denkst du nur noch: Deutschland ist verrückt geworden. Als ich vor zwei Jahren den Stall ausbauen wollte, um die Haltungsbedingungen weiter zu verbessern, bin ich gegen eine Wand aus widersprüchlichen Verordnungen gerannt, bis ich schließlich aufgeben musste.
Danach habe ich beschlossen, dass Jammern nichts nützt und dass es so nicht weitergehen kann. Ich bin der »Zukunftskommission Agrar« beigetreten, die Thorsten Rüther, ein engagierter Großbauer aus Frankfurt/Oder, ins Leben gerufen hat. Da sitze ich jetzt einmal im Monat in Potsdam als Repräsentantin der mittelständischen Öko-Höfe, zusammen mit Vertretern vom Bauernverband sowie von Umwelt-, Verbraucher- und Wirtschaftsverbänden. Wir reden über die Zukunft der Landwirtschaft. Meistens geht es ziemlich hoch her. Die Bauernschaft ist ein gemischter Haufen – vom Großindustriellen mit Sitz im Gemeinderat bis zum Schafe züchtenden Ex-Sinologen, der erfolgreich Produkte aus Wollfilz vertreibt. Manche haben Agrarwissenschaft studiert, andere Biochemie oder BWL. Der eine reist in die USA, um dort etwas über modernste computergestützte Technik zu lernen. Der andere ist Großstadtflüchtling und verkauft handgeschleuderten Honig und Zwerghuhn-Eier im Hofladen. Der Nächste hat schon als Kind auf dem Familienhof geholfen und versucht, alles so weiterzumachen wie Vater und Großvater. Anders als in eurem Treibhaus kämpfen in der Kommission nicht zwei, sondern eher zwanzig Seiten gegeneinander. Und wenn du die Leute vom Bauernverband kennen würdest (kennst du überhaupt jemanden, der nicht Journalist, Politiker oder Kulturschaffender ist?), wüsstest du, wie schwer es wirklich sein kann, über Veränderungen zu sprechen. Oder überhaupt miteinander zu sprechen.
Am Anfang dachte ich, die Sache sei reine Zeitverschwendung. Aber dann zeigten sich Schnittmengen, erst kleine, dann immer größere. Es bildete sich eine Gesprächskultur heraus, die Leute haben sich kennengelernt und Vertrauen zueinander gefasst. Und schließlich haben wir es tatsächlich geschafft, ein gemeinsames Papier zu erarbeiten: »Empfehlungen für die Zukunft der Landwirtschaft«, ein fünfzigseitiges Konzept, das den möglichen Transformationsprozess beschreibt. Weniger Fleischkonsum, weniger Tiere in den Ställen, nachhaltige und umweltfreundliche Produktionsweise, Stabilisierung der Lebensmittelpreise auf höherem Niveau. Reform der flächengebundenen Direktzahlungen. Bürokratieabbau. Unser Tenor lautet: Das Agrar- und Ernährungssystem muss so angelegt sein, dass positive Ziele wie Klima, Umwelt, Biodiversität, Tierwohl und menschliche Gesundheit im unternehmerischen Interesse liegen. Wir haben um einen Termin mit dem Landwirtschaftsminister gebeten und fahren demnächst nach Berlin, um ihm unsere Arbeit zu übergeben. Das wird spannend. Es fühlt sich gut an, etwas zu tun.
Jetzt habe ich geredet wie ein Wasserfall. Für meine Verhältnisse. Es kommt kaum noch vor, dass ich so ausführlich über mich selbst spreche. Basti kennt den Agrar-Talk hoch und runter, der durchschnittliche Brandenburger schätzt eher den Vier-Wörter-Satz, und außerdem ist zum langen Palavern meistens keine Zeit. Gott sei Dank ist es momentan ein bisschen ruhiger bei uns. Der Boden ist fertig, die Saat ist drin. Während der Erntezeit gehe ich an vielen Abenden nicht vor 22 Uhr nach Hause.
Irgendwie freue ich mich noch immer, dass wir uns wiedergetroffen haben. Ich denke jetzt so viel an früher, an die tolle Zeit, die wir in Münster hatten. Drei Jahre lang warst du wie eine Familie für mich. Meine eigene wollte ich ja nicht mehr. Und jetzt bist du auf einmal wieder da. Seltsam.
Ich mache Schluss und fahre nach Hause. Wenn ich mich beeile, kann ich Jonas und Phil noch vorlesen, bevor sie ins Bett gehen.
Deine Theresa
21:27 Uhr, Stefan per WhatsApp: Danke schon mal für deine Mail! Sitze gerade im Schauspielhaus in einem Stück namens Die Weltherrschaft der Kröten und kann sagen: Unser Abend an der Außenalster war aufregender … Melde mich! S.
Freitag, 14. Januar
07:58 Uhr, Stefan per E-Mail:
Hallo Theresa,
ich bin der Erste in der Redaktion (konnte ab fünf Uhr nicht mehr schlafen – du bist nicht die einzige Frühaufsteherin!) und dachte gerade, wie schön es wäre, wenn du jetzt hier sein könntest und wir zusammen frühstücken würden. Ich habe mir am Baumwall ein Franzbrötchen geholt und es gerade geschafft, dem neuen Vollautomaten der Kulturredaktion einen Kaffee zu entlocken – ich bin also erwiesenermaßen kein Waschlappen, sondern ein verdammter Held. Diese Höllenmaschine produziert tatsächlich acht sogenannte Kaffee-Spezialitäten, die alle exakt gleich schmecken und exakt gleich aussehen. Genial.
Jetzt sitze ich mit einem Cappuccino Grande aus Fair-Trade-Bohnen und Biohafermilch am Schreibtisch, unter mir liegt der Hafen in der Morgensonne, die Elbphilharmonie glänzt wie eine Krone, die man der Speicherstadt aufgesetzt hat, ohne sie zu fragen. Ein paar Leute spazieren über die Promenade zur Arbeit, kein/e Einzige/r ohne Coffee-to-go-Becher, viele mit Hund. Die Containerkräne am Steinwerder ragen wie die Hälse von Metallschwänen in die Höhe. Eigentlich ist diese Aussicht purer Fototapeten-Kitsch, aber ich genieße den morgendlichen Blick durch die riesigen Fenster, auch wenn ich weiß, wie trügerisch er ist. Dieser friedliche Hafen, der stoisch und exakt funktioniert und so tut, als ob er von Lieferkettenproblemen nichts wüsste … Manchmal wirkt unsere wohlgeordnete, bequeme Welt auf mich völlig surreal angesichts der fatalen Bedrohungen, die uns umgeben. Klimawandel, Pandemien, Demokratieverfall, und jetzt auch noch Putins Manöver an den Grenzen der Ukraine … Versteh mich nicht falsch, ich glaube nicht, dass Russland angreifen wird und wir uns demnächst einem europäischen Krieg gegenübersehen. Putin ist gewiss ein sehr schlechter Mensch, aber kein schlechter Stratege. Trotzdem habe ich beim Anblick von großer Schönheit manchmal apokalyptische Bilder im Kopf. Wie schnell man das alles auslöschen könnte. Wie zerbrechlich unsere Welt in Wahrheit ist. Solche Gedanken muss ich beiseitewischen, um in den Tag starten zu können.
Noch ist es vollkommen ruhig, aber gleich strömen die Kolleg*innen ins Gebäude. Dann feiern die Rechner mit ihren gedämpft optimistischen Hochfahrchorälen den Beginn der Tagesarbeit, und wenig später klingeln wie auf Knopfdruck sämtliche Telefone. Die wenigen verbliebenen Drucker (wir werden papierlos!) verbreiten ihren seltsam elektronischen Geruch, gemischt mit Kaffeeduft, Eau de Toilette und Zwiebeln. (Mein Kollege Martin liebt leider Mettbrötchen zum Frühstück.) Im ganzen Gebäude herrscht striktes Rauchverbot, trotzdem zieht manchmal subversiver Zigarettengeruch durch die Flure. Auf einem Flatscreen läuft den ganzen Tag lautlos n-tv, der Ton wird nur bei wichtigen Live-Berichterstattungen oder Pressekonferenzen eingeschaltet. Weil wir mit der Zeit gehen, arbeiten alle im Workspace aka Großraumbüro; der ultimative Beweis dafür, dass Fortschritt auch Rückschritt sein kann. Anne aus der Kultur stellt ihren Handywecker immer auf zehn Minuten vor Beginn der Konferenzen, und dann lässt sie ihr Handy liegen und ist nicht da, wenn der Wecker losgeht.
Dispatches from elsewhere: Wie nahe unsere Leben einander einmal waren und wie Lichtjahre weit entfernt sie nun voneinander sind! Ich wusste nicht einmal, dass es in Deutschland noch Melker gibt. Melker klingt für mich so zeitgemäß wie Laternenanzünder oder Raubritter. Während ihr Kühe melkt, laufen hier alle mit ihren französischen Bulldoggen herum, die kaum durch ihre platt gezüchteten Nasen atmen können. Ein wenig beneide ich dich um dein Leben, aber natürlich weiß ich, dass das nur Großstädter*innenromantik ist, die von Ferien auf dem Bauernhof träumt und Natur mit Naturzustand verwechselt. Es ist krass, was du leistest. Wie stark du sein musst und offenbar auch bist.
Also, bitte: Klär mich weiter auf, beleuchte für mich die Unterseite der Republik! Ich möchte desillusioniert werden. Als Journalist brauche ich das.
Freue mich schon auf deine nächsten Abenteuer!
Stefan
Samstag, 15. Januar
08:38 Uhr, Theresa per E-Mail:
Lieber Stefan,
bleibt uns denn etwas anderes übrig? Als stark sein, meine ich. Jeder nach seinen Möglichkeiten, jeder in seinem Bereich. Ich kann mir nicht helfen, aber ich halte diese ganze neue Kultur der Schwäche für einen Irrweg. Verletzlichkeit, Empfindlichkeit, Opferstolz – ich frage mich, wo das hinführen soll. Das hätte doch nur Sinn, wenn es eine Macht gäbe, die für ausgleichende Gerechtigkeit sorgt. Wenn wir quasi alle Kinder wären und uns beim Übervater beschweren könnten. Da es den aber nicht gibt (jedenfalls nicht in Ostdeutschland), bleibt doch nichts anderes übrig, als anzupacken, damit der Laden läuft. Der eigene Laden im Kleinen und der große Laden im Ganzen.
Meinen Vater habe ich immer als schwach erlebt, und das fand ich fürchterlich, schon als Kind. Mein Großvater hatte noch vergeblich versucht, gegen die Kollektivierung zu kämpfen (es gab schlichtweg keine Gewinner), und daraus leitete mein Vater später seinen Lieblingssatz ab: »Da kann man eh nichts machen.« Mich hat dieser Satz zur Weißglut getrieben. Kennst du den Ekel, den man empfindet, wenn ein Käfer auf dem Rücken liegt und nicht allein in der Lage ist, sich umzudrehen? Klar, man könnte ihm helfen, aber eigentlich hat man mehr Lust, ihn zu zertreten. Wobei mein Vater zu DDR-Zeiten nicht auf dem Rücken lag, im Gegenteil. Mit seiner angepassten Haltung ist er Vorsitzender der LPG Schütte geworden, und das war die schönste Zeit seines Lebens, auch wenn er das im Nachhinein nicht mehr zugegeben hätte. Ich glaube, die Wende war der eigentliche Horror für ihn. Wenn meine Mutter ihn nicht gedrängt hätte, als Wiedereinrichter das Land unserer Familie weiter zu bewirtschaften, hätte er wahrscheinlich sofort kapituliert. Ihm war das alles zuwider, die Anstrengung, der Kampf, die unbequemen Entscheidungen. Er hat immer nach dem Weg des geringsten Widerstands gesucht. Statt die LPG in eine GmbH umzuwandeln, die wirklich handlungsfähig gewesen wäre, hat er den Konflikt mit den Anteilseignern gescheut und ist lieber beim Genossenschaftsmodell geblieben. Deshalb gibt es hier immer noch Leute wie Annette, die einen Haufen Anteile von ihrem Vater geerbt hat, als Traktoristin ein festes Gehalt von der Kuh & Co. bezieht, aber eher zum Quatschen als zum Arbeiten auf den Hof kommt. Ich kann ihr nicht kündigen, weil die Firma nicht genug Kapital besitzt, um Anteile auszuzahlen. Noch schlimmer ist, dass mein Vater es versäumt hat, ausreichend Land aufzukaufen, als die Preise noch erschwinglich waren. Er hat nichts investiert, nichts reformiert und immer geglaubt, die neue Zeit irgendwie ignorieren und unter dem Radar weiterwurschteln zu können. Gleichzeitig war er ein wundervoller Mensch mit einem großen Herzen. Als einmal unsere Katze krank war, hat er die ganze Nacht neben ihr auf dem Sofa gesessen und sie gestreichelt, bis am nächsten Morgen die Tierärztin kam. Mir liegt das Wohl meiner Leute und meiner Tiere genauso am Herzen. Aber niemandem ist gedient, wenn der Betrieb pleitegeht. Man muss anpacken und, wenn nötig, auch kämpfen. Und sei es gegen die Absurdität der Verhältnisse.
Die Kuh & Co. manövriert noch immer am Rand des finanziellen Abgrunds. Aber ich gebe nicht auf. Schließlich mache ich genau das, was die Gegenwart von mir verlangt – Bio, Öko, Nachhaltigkeit! Das muss jetzt nur noch die Politik kapieren. Wenn der Landwirtschaftsminister persönlich den Bericht unserer Kommission entgegennimmt, ist ein erster Schritt geschafft. Dann stelle ich mich aufs Feld, schaue in die Wolken und rufe: Siehst du, Papa, geht doch!
Liebe Grüße, Theresa
Sonntag, 16. Januar
14:28 Uhr, Stefan per E-Mail:
Liebe Theresa,
was für dich die neue Kultur der Schwäche ist, würde ich eher als erfreulichen Zuwachs an Sensibilität bezeichnen. Unsere Gesellschaft ist endlich so weit entwickelt, dass sie Verletzungen und Verletztheit artikulieren kann. Dadurch wird eine historische Aussöhnung in Gang gesetzt. Die versteinerten Rollen zerbersten, bislang verstummte Minderheiten erheben die Stimme. Das ist kein »Opferstolz«, sondern die überfällige Beseitigung von Ungerechtigkeit. Wie schon in der literaturhistorischen Empfindsamkeit ab Mitte des 18. Jahrhunderts (du erinnerst dich sicher, drittes Semester bei Prof. Dr. Bücker) geht es hier auch wieder um eine zutiefst aufklärerische Strömung. Gefühlsregungen sind kein Makel, sondern die Grundlage von Empathie und Verständigung.
Aber ich will hier keinen Feuilletonartikel verfassen. Was du über deinen Vater geschrieben hast, hat mich fasziniert, es hat mich aber auch betroffen gemacht. Wie sehr die politischen Bedingungen eure Familiengeschichte mitbestimmt haben, das finde ich tragisch. Mein Vater lebt noch, er ist gewissermaßen eine Art Gegenmodell zu deinem. Hätte er einen Signature-Satz, würde er lauten: »Ich kann alles, was gekonnt werden muss.« Otto Alfred Jordan ist das fleischgewordene Wirtschaftswunder der alten BRD (aktuell rund 130 Kilo) und ein prototypischer Self-Made-Unternehmer des heiligen deutschen Mittelstands. Ein Riese in jeder Hinsicht. Das hat mir als Kind unendlich imponiert; beachtlich finde ich es bis heute. In den Sechzigerjahren hat er mit nichts als einem Realschulabschluss und einer Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann in einem Stahlunternehmen in Essen angefangen. Er hatte ein gutes Auge für Missstände: Mangelhafte Bleche und Brammen wurden damals nicht gerichtet, sondern entsorgt. Ökologisch wie ökonomisch völlig unsinnig. Obwohl mein Vater weder Ingenieur noch Maschinenbauer war, wollte er sich damit nicht abfinden, also ließ er Richtanlagen, Band- und Steinschleifmaschinen nach seinen Plänen konstruieren. Zwanzig Jahre später hatte er in Bochum über vierzig Angestellte und hielt zwölf Patente. Krummer Stahl wurde begradigt und teuer verkauft. Vielleicht hat mich mein Vater mehr inspiriert, als ich wahrhaben will. Auch ich verspüre in meinem Job den Drang, die Dinge »gerade zu biegen«. Ist das genetisch bedingte Berufung oder nur ein albernes Wortspiel?
Komisch, dass wir einander jetzt unsere Familiengeschichten erzählen. Vielleicht liegt es am Älterwerden. Damals in Münster haben wir so gut wie gar nicht über unsere Herkunft gesprochen. Herkunft war das, was man hinter sich lassen wollte. Vielleicht haben wir uns so eng zusammengeschlossen, weil wir die ideale Familie füreinander waren: keine Erwartungen, kein schlechtes Gewissen, keine Versagensängste. Dein Vater zu schwach, meiner zu stark. Meiner fand es schrecklich, dass ich die Firma nicht übernehmen wollte und stattdessen »Laberwissenschaften« studierte. In einem anderen Jahrhundert hätte er mich vermutlich aus dem Haus gejagt und enterbt. Mir ging es immer am besten, solange ich nicht an ihn dachte. Als ich ihn Weihnachten zuletzt gesehen habe, thronte er in einem Ledersessel, hielt ein mehrere hundert Euro teures Ibérico-Schinkenbein zwischen den Knien und säbelte glückselig eine Scheibe nach der anderen ab. Eine lächelnde Aufschnittmaschine.
So, genug Väter-Talk für heute. Du weißt ohnehin schon viel zu viel über mich. Ich wäre jetzt gern bei dir im Stall, umgeben von Kuhduft, mit einem kühlen Bier aus einer regionalen Brauerei, schweigend. Stattdessen muss ich eine Kollegin vertreten und zu einem Poetry-Slam gehen.
Dein Stefan
19:04 Uhr, Theresa per WhatsApp: Wenn du hier wärest, stünden wir nicht im Stall, sondern säßen wir frisch geduscht mit einem guten Rotwein am Kamin. Wir würden auch nicht schweigen, sondern reden, reden, reden, über die Frage, ob Ehen in Philippsburg (du) oder Ein fliehendes Pferd (ich) das beste Buch aller Zeiten ist. Stundenlang! Reden! Trinken! Duften! Oder wenigstens normal riechen!
22:39 Uhr, Stefan per WhatsApp: Das wäre ein guter Abend! Stattdessen dieser bekloppte Poetry-Slam. Komm, wir feiern Arschgeweihnachten! hat gewonnen. Hey, Dick, zeig mir deinen Selfiestick! hat den zweiten Platz gemacht. Was bringt junge Frauen dazu, sich mit sexistischen Flachwitzen beim Patriarchat einzuschleimen, statt ein modernes Geschlechterbewusstsein zu entwickeln? Gruselig.
22:42 Uhr, Theresa per WhatsApp: Vielleicht sind sie einfach selbstbewusst genug für Selbstironie? Weißt du noch, wir sind damals total auf Germanisten-Witze abgefahren. Haben ganze Abende damit verbracht, immer neue zu erfinden.
22:46 Uhr, Stefan per WhatsApp: Das war etwas ganz anderes. In einer ganz anderen Zeit.
22:51 Uhr, Theresa per WhatsApp: Wie viele Germanisten braucht man, um eine Glühbirne auszuwechseln? Ich glaube, wir waren bei weit über zwanzig … Zuerst einen Goethe-Experten, der den Schaden feststellt: Mehr Licht!
22:53 Uhr, Stefan per WhatsApp: Klar, das hatte schon etwas … Einen Derrida-Kenner, der die Glühbirne fachgerecht dekonstruiert.
22:58 Uhr, Theresa per WhatsApp: Einen Rhetoriker, der die Überreste mit einem schlagenden Argument aus der Fassung bringt.
23:05 Uhr, Stefan per WhatsApp: Einen Strukturalisten, der die Anzahl verbrannter Staubkörner auf der alten Glühbirne in sinnvolle Relation zur Halbwertszeit des verglühten Drahts bringt. Einen Philologen, der eine möglichst authentische Ersatzbirne auswählt. Was noch?
23:20 Uhr, Theresa per WhatsApp: Einen Linguisten, der den ganzen Vorgang pragmatisch unterstützt! Einen Dadaisten, der den Prozess lyrisch illustriert: Glühdji beri drahta gwindidi schraubi schraubi schraubi …
23:22 Uhr, Stefan per WhatsApp: Und einen Komparatisten, der erklärt, warum andere Glühbirnen nicht unbedingt besser, aber schon ziemlich anders sind.
23:29 Uhr, Theresa per WhatsApp: Genug! Ich heule schon vor Lachen. War eine tolle Zeit in Münster. Wir waren uns so nahe. Wie Geschwister.
23:34 Uhr, Stefan per WhatsApp: Warum eigentlich? Hast du dich das auch manchmal gefragt? Warum waren wir nur wie Geschwister?
23:35 Uhr, Theresa per WhatsApp: Wieso »nur«?
23:36 Uhr, Stefan per WhatsApp: Ich meine, warum ist nicht mehr aus uns geworden? Warum waren wir kein Liebespaar? Immerhin haben wir auf engstem Raum gewohnt und uns bestens verstanden.
23:36 Uhr, Theresa per WhatsApp: Ich fand dich halt nicht sexy.
23:38 Uhr, Stefan per WhatsApp: Autsch.
23:42 Uhr, Theresa per WhatsApp: Ich muss jetzt Schluss machen. Basti sagt, er kann nicht schlafen, wenn ich die ganze Zeit tippe.
23:44 Uhr, Stefan per WhatsApp: Ich fand dich schon sexy.
23:46 Uhr, Theresa per WhatsApp: Du fandest alles sexy, was Rock trug. Ich sage nur: Julia aus der Kulturwissenschaft. Oder Frederike vom Lehrstuhl Günthner.
23:50 Uhr, Stefan per WhatsApp: Die hieß Felicitas. Und dein komischer Arne war auch nicht besser. Der saß morgens in Feinripp-Unterhose mit Eingriff am Küchentisch und kratzte sich sein bestes Stück. Währenddessen baumelten seine Kronjuwelen schon halb an der frischen Luft. Frühstückseier mal anders.
23:53 Uhr, Theresa per WhatsApp: Mein Gott! Erinnere mich bloß nicht an den!
23:57 Uhr, Stefan per WhatsApp: Ich glaube, wir sind einfach irgendwann Richtung Freundschaft abgebogen und haben uns daran gewöhnt. Auch wenn es nicht immer leicht war. Jedenfalls nicht für mich.
Montag, 17. Januar
00:10 Uhr, Theresa per WhatsApp: Na ja, ich bin bei dir eingezogen, weil ich ein Zimmer brauchte und du eins frei hattest. Don’t hook up with your flatmate. Wenn wir eine Affäre begonnen hätten, wären wir wahrscheinlich nach ein paar Wochen zerstritten gewesen und hätten die WG aufgelöst. Stattdessen hatten wir geniale drei Jahre und haben heute noch miteinander zu tun. Das ist doch nicht schlecht.
00:14 Uhr, Stefan per WhatsApp: Nach einer ziemlich langen Pause.
00:18 Uhr, Theresa per WhatsApp: Ich muss jetzt echt aufhören, sonst schmeißt mich Basti aus dem Schlafzimmer. Außerdem muss ich im Gegensatz zu dir verdammt früh raus.
00:22 Uhr, Stefan per WhatsApp: Du weißt schon, dass ich ganz schön zusammengebrochen bin, als du plötzlich weg warst, oder? Erst der Zettel auf dem Küchentisch: Vater tot, muss nach Hause. Das habe ich ja noch verstanden – ich dachte, du kommst nach zwei Wochen zurück. Aber dann: nichts. Kein Anruf. Kein Lebenszeichen. Handy nicht erreichbar. Schließlich irgendwann der Brief: Habe eine Entscheidung getroffen, komme nicht zurück, meine Sachen werden abgeholt. Kannst du dir vorstellen, wie sich das anfühlte? Nach allem, was war? Ich habe mich gefragt, ob ich dir etwas angetan hatte. Ohne es zu merken. Ob du sauer auf mich warst, ob du wegwolltest, ob das ein Notausgang war. Ich war ziemlich am Ende damals.
00:28 Uhr, Theresa per WhatsApp: Mann, Stevie, lass doch mal dein Ego los! Es geht nicht immer nur um dich. Mein Vater war gestorben, ich hab den Hof übernommen. Und hier gearbeitet wie eine Blöde, ab Minute eins.
00:31 Uhr, Stefan per WhatsApp: Und deshalb musste unsere Freundschaft weg? Warum hast du nicht mit mir gesprochen? Ich hätte dich besuchen können. Ich hätte dir helfen können.
00:44 Uhr, Stefan per WhatsApp: Theresa?
02:52 Uhr, Stefan per E-Mail:
Sorry, ich noch mal.
Konnte nicht schlafen und hab mich an den Rechner gesetzt. Wahrscheinlich liegt es an unserem Gespräch über Väter, dass ich die ganze Zeit an Flori Sota denken muss. Wahrscheinlich habe ich, nachdem du mich verstoßen hattest (Scherz!), beim BOTEN eine Art neue Familie gefunden. Vielleicht ist das auch die Erklärung dafür, warum mich Floris Verhalten in Bezug auf die Klima-Beilage so stark getroffen hat. Dass wir uns mal nicht einig sind – geschenkt. Aber bei dieser Sache habe ich den Eindruck, dass wir uns ernsthaft voneinander entfremden. Das erschreckt mich. Vielleicht klingt das absurd, aber Flori Sota ist mir in vieler Hinsicht näher als mein echter Vater. Wahrscheinlich hat mich (außer dir!) kein anderer Mensch so stark geprägt wie er.
Du kennst Flori ja aus diversen Talkshows. Im Fernsehen wirkt er größer, als er in Wirklichkeit ist. Wenn er neben mir steht, reicht mir sein Kopf nur knapp bis zur Schulter. Trotzdem habe ich immer das Gefühl, zu ihm aufzusehen. Seine schlanke Figur (und das als Kulinariker mit Anfang sechzig!), der angegraute Zehn-Tage-Bart, die klassische Nickelbrille, obwohl er gar nicht kurzsichtig ist – das alles steht ihm verdammt gut und ist natürlich Konzept. Der modisch zeitlose Mann von Welt, dem man auf den ersten Blick ansehen soll, dass er keinem Trend hinterherläuft. Meistens erscheint er im schwarzen Steve-Jobs-Rollkragenpullover in der Redaktion, auch im Sommer, und das, ohne zu schwitzen. Ahnungslose Praktikant*innen haben ihn schon für einen Modedesigner gehalten, der bei uns ein Interview geben will. Flori kommt aus Albanien und ist erst mit zwölf nach Deutschland emigriert. Wenn er sich aufregt – was selten passiert –, schüttelt er den Kopf, wenn er »ja« meint. In diesen Augenblicken mag ich ihn besonders. Als käme der kleine Junge aus Saranda plötzlich durch. Auf Fotos hat er immer eine Hand in der Tasche, weil sein rechter Arm ein Stück kürzer ist als der linke und er auf diese Weise den »Defekt« kaschiert. Dafür trägt er am anderen Handgelenk eine ziemlich protzige Rolex, eine Submariner, die eigentlich gar nicht zu ihm passt. Irgendwann hat er mir den Grund dafür erklärt. Die Rolex Submariner ist eine universell anerkannte Währung, mit der man sich im Zweifel weltweit Hilfe kaufen kann. Im Fall eines Schiffbruchs in der Karibik, eines Bergunglücks in Nepal oder einer Entführung in Jordanien würde sie ihm unter Umständen das Leben retten. Ich glaube, das ist ziemlich typisch für Flori. Er betrachtet das Leben als Achterbahnfahrt, bei der man jederzeit aus der Kurve fliegen kann. Und genau deshalb denkt er gern zwei Schritte voraus. Ansonsten hat er viel Humor, und in seinem Schädel sitzt ein Hochleistungsgehirn. Eine ziemlich bestechende Mischung.
Ich war schon ein paar Wochen Volontär beim BOTEN