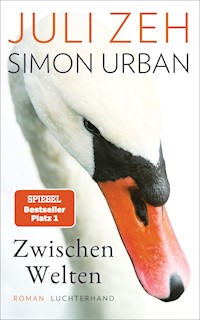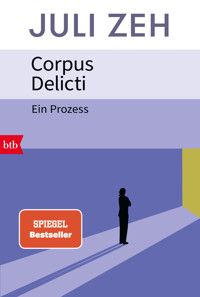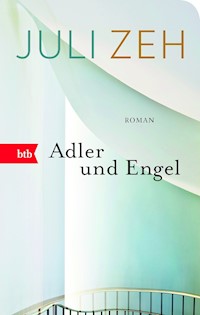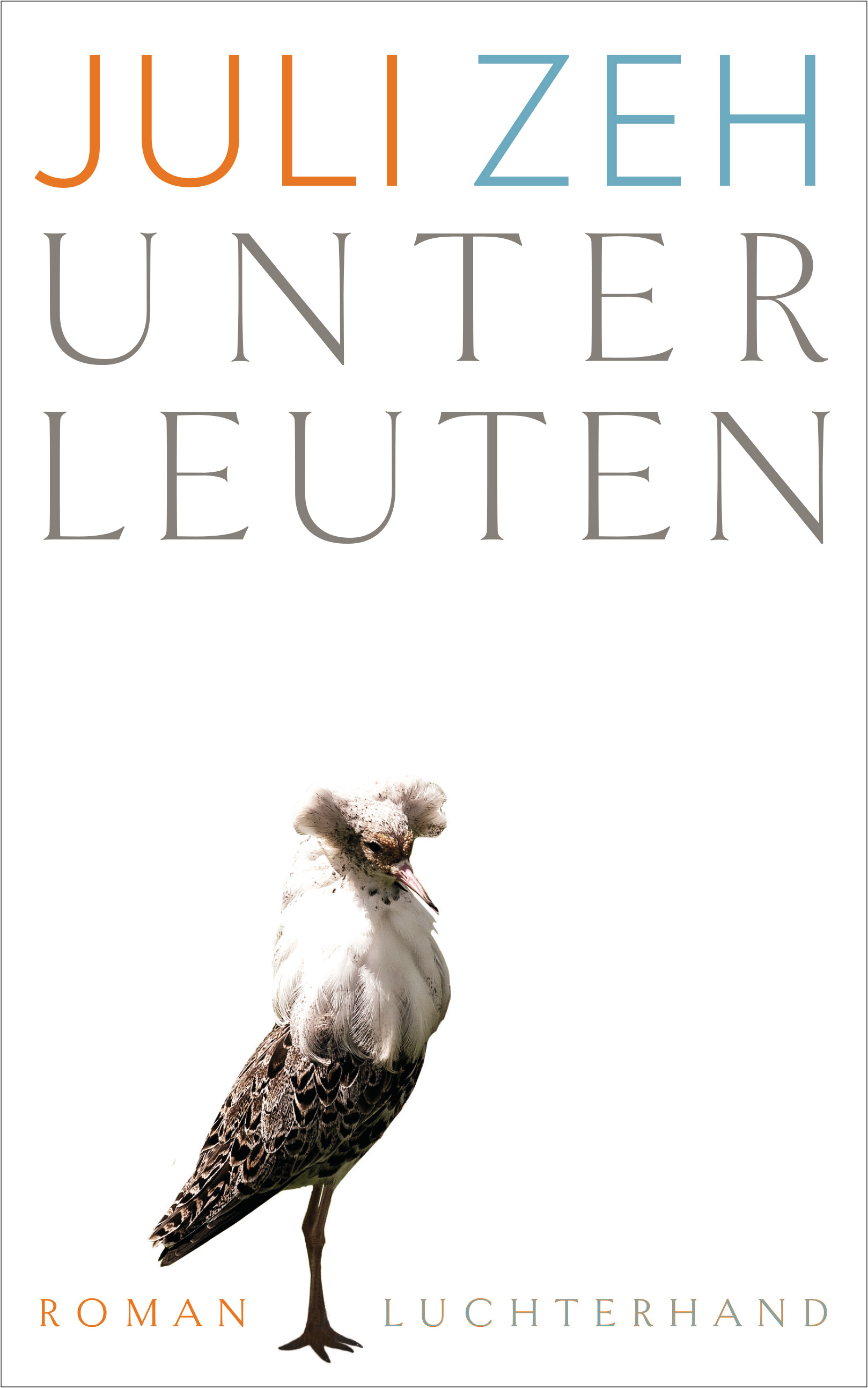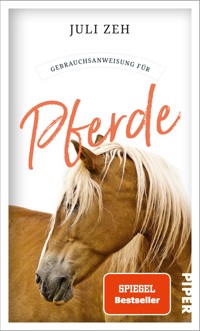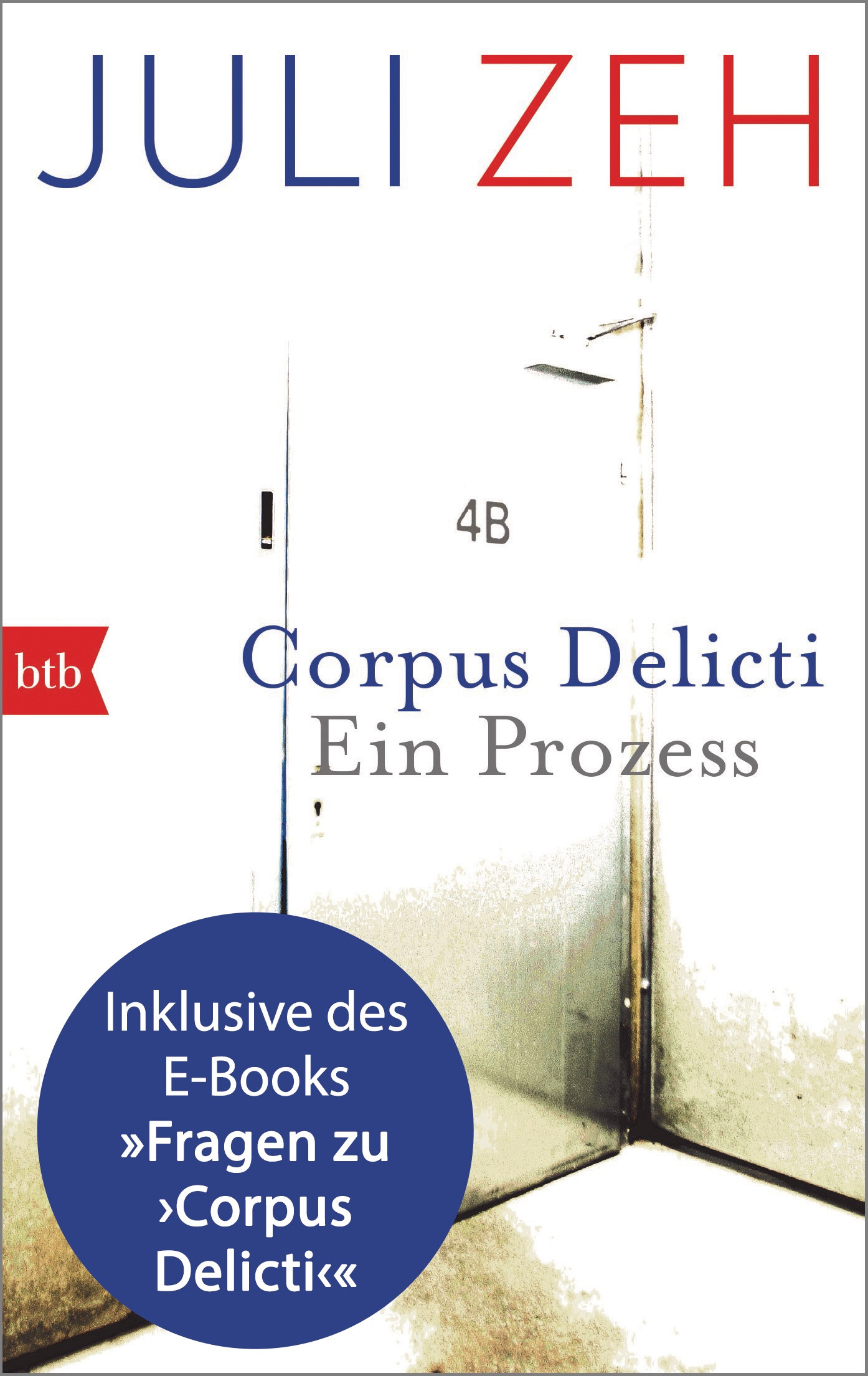
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Juli Zehs Erfolgsroman »Corpus Delicti«. Inklusive des E-Books »Fragen zu ›Corpus Delicti‹«
Der Roman »Corpus Delicti«: Jung, attraktiv, begabt und unabhängig: Das ist Mia Holl, eine Frau von dreißig Jahren, die sich vor einem Schwurgericht verantworten muss. Zur Last gelegt wird ihr ein Zuviel an Liebe (zu ihrem Bruder), ein Zuviel an Verstand (sie denkt naturwissenschaftlich) und ein Übermaß an geistiger Unabhängigkeit. In einer Gesellschaft, in der die Sorge um den Körper alle geistigen Werte verdrängt hat, reicht dies aus, um als gefährliches Subjekt eingestuft zu werden. Juli Zeh entwirft in Corpus Delicti das spannende Science-Fiction-Szenario einer Gesundheitsdiktatur irgendwann im 21. Jahrhundert, in der Gesundheit zur höchsten Bürgerpflicht geworden ist.
Das Begleitbuch »Fragen zu ›Corpus Delicti‹«: Seit ihr Roman »Corpus Delicti« 2009 erschienen ist, erreichen Juli Zeh immer wieder E-Mails von Lesern mit Fragen zum Text. Zur Entstehungsgeschichte, zur Handlung, zu Figuren und Interpretation. Wegen seiner gesellschaftspolitischen Relevanz hat »Corpus Delicti« einen großen Kreis von Lesern erreicht, in vielen Bundesländern steht der Roman auf dem Lehrplan für den Deutschunterricht und gehört zum Abiturstoff. In diesem Buch geht Juli Zeh in Form eines fiktiven Interviews den Fragen von Schülern und Lesern nach, nicht selten geht sie auch darüber hinaus. Im Zentrum steht die Beschäftigung mit Themen des Romans, die zum Verständnis unserer heutigen Gesellschaft beitragen. Was für ein Menschenbild pflegen wir, wohin bewegt sich unsere Gesellschaft, wie wollen wir zusammenleben und welche Werte sind bedeutsam für uns? »Fragen zu Corpus Delicti« ist nicht nur eine profunde Auseinandersetzung der Autorin mit ihrem bislang politischsten Roman, sondern auch eine Betrachtung der Bedingungen und Mentalitäten, die unser Leben heute bestimmen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 461
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Juli Zeh
Corpus Delicti
Roman
und
Fragen zu »Corpus Delicti«
btb
Corpus Delicti:
Jung, attraktiv, begabt und unabhängig: Das ist Mia Holl, eine Frau von dreißig Jahren, die sich vor einem Schwurgericht verantworten muss. Zur Last gelegt wird ihr ein Zuviel an Liebe (zu ihrem Bruder), ein Zuviel an Verstand (sie denkt naturwissenschaftlich) und ein Übermaß an geistiger Unabhängigkeit. In einer Gesellschaft, in der die Sorge um den Körper alle geistigen Werte verdrängt hat, reicht dies aus, um als gefährliches Subjekt eingestuft zu werden. Juli Zeh entwirft in Corpus Delicti das spannende Science-Fiction-Szenario einer Gesundheitsdiktatur irgendwann im 21. Jahrhundert, in der Gesundheit zur höchsten Bürgerpflicht geworden ist.
Fragen zu »Corpus Delicti«:
Seit ihr Roman »Corpus Delicti« 2009 erschienen ist, erreichen Juli Zeh immer wieder E-Mails von Lesern mit Fragen zum Text. Zur Entstehungsgeschichte, zur Handlung, zu Figuren und Interpretation. Wegen seiner gesellschaftspolitischen Relevanz hat »Corpus Delicti« einen großen Kreis von Lesern erreicht, in vielen Bundesländern steht der Roman auf dem Lehrplan für den Deutschunterricht und gehört zum Abiturstoff.
In diesem Buch geht Juli Zeh in Form eines fiktiven Interviews den Fragen von Schülern und Lesern nach, nicht selten geht sie auch darüber hinaus. Im Zentrum steht die Beschäftigung mit Themen des Romans, die zum Verständnis unserer heutigen Gesellschaft beitragen. Was für ein Menschenbild pflegen wir, wohin bewegt sich unsere Gesellschaft, wie wollen wir zusammenleben und welche Werte sind bedeutsam für uns? »Fragen zu Corpus Delicti« ist nicht nur eine profunde Auseinandersetzung der Autorin mit ihrem bislang politischsten Roman, sondern auch eine Betrachtung der Bedingungen und Mentalitäten, die unser Leben heute bestimmen.
Die Autorin:
Juli Zeh, 1974 in Bonn geboren, Jurastudium in Passau und Leipzig, Studium des Europa- und Völkerrechts, Promotion. Längere Aufenthalte in New York und Krakau. Schon ihr Debütroman »Adler und Engel« (2001) wurde zu einem Welterfolg, inzwischen sind ihre Romane in 35 Sprachen übersetzt. Juli Zeh wurde für ihr Werk vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Rauriser Literaturpreis (2002), dem Hölderlin-Förderpreis (2003), dem Ernst-Toller-Preis (2003), dem Carl-Amery-Literaturpreis (2009), dem Thomas-Mann-Preis (2013), dem Hildegard-von-Bingen-Preis (2015), und dem Bruno-Kreisky-Preis (2017) sowie dem Heinrich-Böll-Preis der Stadt Köln (2019). 2018 wurde sie mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Im selben Jahr wurde sie zur Richterin am Verfassungsgericht des Landes Brandenburg gewählt.
Mehr unter www.juli-zeh.de
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
»Corpus Delicti«:
Genehmigte Ausgabe September 2010 by btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright © der Originalausgabe Luchterhand Literaturverlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe
Lizenzausgabe mit freundlicher Genehmigung
»Fragen zu ›Corpus Delicti‹«:
Originalausgabe Juli 2020 by btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: semper smile, München unter Verwendung eines Fotos von © David Fink
Satz: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-26991-3V002
www.btb-verlag.de
Corpus Delicti
Für Ben
Das Vorwort
Gesundheit ist ein Zustand des vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens – und nicht die bloße Abwesenheit von Krankheit.
Gesundheit könnte man als den störungsfreien Lebensfluss in allen Körperteilen, Organen und Zellen definieren, als einen Zustand geistiger und körperlicher Harmonie, als ungehinderte Entfaltung des biologischen Energiepotentials. Ein gesunder Organismus steht in funktionierender Wechselwirkung mit seiner Umwelt. Der gesunde Mensch fühlt sich frisch und leistungsfähig. Er besitzt optimistisches Rüstungsvertrauen, geistige Kraft und ein stabiles Seelenleben.
Gesundheit ist nichts Starres, sondern ein dynamisches Verhältnis des Menschen zu sich selbst. Gesundheit will täglich erhalten und gesteigert sein, über Jahre und Jahrzehnte hinweg, bis ins höchste Alter. Gesundheit ist nicht Durchschnitt, sondern gesteigerte Norm und individuelle Höchstleistung. Sie ist sichtbar gewordener Wille, ein Ausdruck von Willensstärke in Dauerhaftigkeit. Gesundheit führt über die Vollendung des Einzelnen zur Vollkommenheit des gesellschaftlichen Zusammenseins. Gesundheit ist das Ziel des natürlichen Lebenswillens und deshalb natürliches Ziel von Gesellschaft, Recht und Politik. Ein Mensch, der nicht nach Gesundheit strebt, wird nicht krank, sondern ist es schon.
(Aus dem Vorwort zu: Heinrich Kramer, »Gesundheit als Prinzip staatlicher Legitimation«, Berlin, München, Stuttgart, 25. Auflage)
Das Urteil
IM NAMEN DER METHODE!URTEILIN DER STRAFSACHE GEGEN
Mia Holl, deutsche Staatsangehörige, Biologin
wegen methodenfeindlicher Umtriebe
hat die 2. Strafkammer des Schwurgerichts in öffentlicher Sitzung, an der teilgenommen haben:
1. Vorsitzender Richter am Schwurgericht Dr. Ernest Hutschneider als Vorsitzender,
2. Richter am Schwurgericht Dr. Hager und Richterin Stock als Beisitzer,
3. die Schöffen a) Irmgard Gehling, Hausfrau,b) Max Maring, Kaufmann,
4. Staatsanwalt Bell als Vertreter der Anklagebehörde,
5. Rechtsanwalt Dr. Lutz Rosentreter als Verteidiger,
6. Justizassistent Danner als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle,
für Recht erkannt:
I. Die Angeklagte ist schuldig der methodenfeindlichen Umtriebe in Tateinheit mit der Vorbereitung eines terroristischen Krieges, sachlich zusammentreffend mit einer Gefährdung des Staatsfriedens, Umgang mit toxischen Substanzen und vorsätzlicher Verweigerung obligatorischer Untersuchungen zu Lasten des allgemeinen Wohls.
II. Sie wird deshalb zum Einfrieren auf unbestimmte Zeit verurteilt.
III. Die Angeklagte hat die Kosten des Verfahrens und ihre notwendigen Auslagen zu tragen.
Aus den folgenden Gründen …
Mitten am Tag, in der Mitte des Jahrhunderts
Rings um zusammengewachsene Städte bedeckt Wald die Hügelketten. Sendetürme zielen auf weiche Wolken, deren Bäuche schon lange nicht mehr grau sind vom schlechten Atem einer Zivilisation, die einst glaubte, ihre Anwesenheit auf diesem Planeten vor allem durch den Ausstoß gewaltiger Schmutzmengen beweisen zu müssen. Hier und da schaut das große Auge eines Sees, bewimpert von Schilfbewuchs, in den Himmel – stillgelegte Kies- und Kohlegruben, vor Jahrzehnten geflutet. Unweit der Seen beherbergen stillgelegte Fabriken Kulturzentren; ein Stück stillgelegter Autobahn gehört gemeinsam mit den Glockentürmen einiger stillgelegter Kirchen zu einem malerischen, wenn auch selten besuchten Freilichtmuseum.
Hier stinkt nichts mehr. Hier wird nicht mehr gegraben, gerußt, aufgerissen und verbrannt; hier hat eine zur Ruhe gekommene Menschheit aufgehört, die Natur und damit sich selbst zu bekämpfen. Kleine Würfelhäuser mit weiß verputzten Fassaden sprenkeln die Hänge, ballen sich zusammen und wachsen schließlich zu terrassenförmig gestuften Wohnkomplexen an. Die Flachdächer bilden eine schier endlose Landschaft, dehnen sich bis zu den Horizonten und gleichen, das Himmelsblau spiegelnd, einem erstarrten Ozean: Solarzellen, eng beieinander und in Millionenzahl.
Von allen Seiten durchziehen Magnetbahn-Trassen in schnurgeraden Schneisen den Wald. Dort, wo sie sich treffen, irgendwo inmitten des reflektierenden Dächermeers, also mitten in der Stadt, mitten am Tag und in der Mitte des einundzwanzigsten Jahrhunderts – dort beginnt unsere Geschichte.
Unter dem besonders lang gezogenen Flachdach des Amtsgerichts geht Justitia ihren Routinegeschäften nach. Die Luft im Raum 20/09, in dem die Güteverhandlungen zu den Buchstaben F bis H stattfinden, ist auf exakt 19,5 Grad klimatisiert, weil der Mensch bei dieser Temperatur am besten denken kann. Sophie kommt niemals ohne ihre Strickjacke zur Arbeit, die sie bei Strafgerichtsverhandlungen sogar unter der Robe trägt. Rechts von ihr liegt ein Aktenstapel, den sie bereits erledigt hat; linker Hand verbleibt ein kleinerer Haufen, den es noch zu bearbeiten gilt. Ihr blondes Haar hat die Richterin zu einem hochsitzenden Pferdeschwanz gebunden, mit dem sie immer noch aussieht wie jene eifrige Studentin in den Hörsälen der juristischen Fakultät, die sie einmal gewesen ist. Sie kaut auf dem Bleistift, während sie auf die Projektionswand schaut. Als sie den Augen des öffentlichen Interessenvertreters begegnet, nimmt sie den Stift aus dem Mund. Sie hat mit Bell zusammen studiert, und er konnte schon vor acht Jahren in der Mensa nervtötende Vorträge über Rachenrauminfektionen halten, die durch den oralen Kontakt mit verkeimten Fremdkörpern verursacht werden. Als ob es in irgendeinem öffentlichen Raum im Land Keime gäbe!
Bell sitzt ihr in einiger Entfernung gegenüber und nimmt mit seinen Unterlagen einen Großteil der Tischplatte ein, während sich der Vertreter des privaten Interesses an die kurze Seite des gemeinsamen Pults zurückgezogen hat. Um die allgemeine Übereinstimmung zu unterstreichen, teilen sich das öffentliche und das private Interesse einen Tisch, was für beide Unterhändler ziemlich unbequem, aber nichtsdestoweniger eine schöne Rechtstradition ist. Wenn Bell den rechten Zeigefinger hebt, wechselt die Projektion an der Wand. Momentan zeigt sie das Bild eines jungen Mannes.
»Bagatelldelikt«, sagt Sophie. »Oder gibt’s Vorbelastungen? Vorstrafen?«
»Keine«, beeilt sich der Vertreter des privaten Interesses zu versichern. Rosentreter ist ein netter Junge. Wenn er in Verlegenheit gerät, fährt er sich mit einer Hand in die Frisur und versucht anschließend, die ausgerissenen Haare möglichst unauffällig zu Boden schweben zu lassen.
»Also einmaliges Überschreiten der Blutwerte im Bereich Koffein«, sagt Sophie. »Schriftliche Verwarnung, und das war’s. Einverstanden?«
»Unbedingt.« Rosentreter wendet den Kopf, um den Vertreter des öffentlichen Interesses zu taxieren. Dieser nickt. Sophie legt eine weitere Akte vom linken Stapel auf den rechten.
»So, Leute«, sagt Bell. »Der nächste Fall ist leider nicht ganz so einfach. Vor allem dich wird’s nicht freuen, Sophie.«
»Eine Kindersache?«
Bell hebt den Finger, an der Wand wechselt die Projektion. Es erscheint die Photographie eines Mannes in mittlerem Alter. Ganzkörper, nackt. Von vorn und hinten. Von außen und innen. Röntgenbilder, Ultraschall, Kernspintomographie des Gehirns.
»Das ist der Vater«, sagt Bell. »Bereits mehrfach vorbestraft wegen Missbrauchs toxischer Substanzen im Bereich Nikotin und Ethanol. Heute bei uns wegen Verstoßes gegen das Gesetz über Krankheitsfrüherkennung bei Säuglingen.«
Sophie macht ein bekümmertes Gesicht.
»Wie alt ist denn das Kleine?«
»Achtzehn Monate. Ein Mädchen. Der Vater hat die Untersuchungspflichten auf den Stufen G2 und G5 bis G7 vernachlässigt. Was noch dramatischer ist: Das Screening des Kindes ist unterblieben. Zerebrale Störungen nicht ausgeschlossen, allergische Sensibilität nicht abgeprüft.«
»So eine Schlamperei! Wie konnte das passieren?«
»Der zuständige Amtsarzt hat den Beschuldigten mehrfach auf seine Verpflichtungen hingewiesen und schließlich einen Betreuer bestellt. Und jetzt kommt’s: Als sich der Betreuer Zutritt zur Wohnung verschaffte, war das arme Ding völlig verwahrlost. Unterernährt, nervöser Brechdurchfall. Es lag buchstäblich im eigenen Kot. Noch ein paar Tage, und es wäre vielleicht zu spät gewesen.«
»Wie furchtbar. So ein Winzling kann sich doch nicht selbst helfen!«
»Der Mann hat private Probleme«, wirft Rosentreter ein. »Er ist alleinerziehend, und …«
»Das verstehe ich. Aber trotzdem. Das eigene Kind!«
Mit einer resignierten Handbewegung zeigt Rosentreter an, dass er im Grunde Sophies Meinung ist. Er hat die Geste gerade zu Ende gebracht, als sich die Tür des Sitzungsraums öffnet. Der Eintretende hat nicht angeklopft und scheint nicht bemüht, unnötigen Lärm zu vermeiden. Er bewegt sich mit der Selbstverständlichkeit eines Mannes, der überall Zutritt hat. Sein Anzug sitzt vorbildlich mit jenem wohldosierten Schuss Unachtsamkeit, ohne den wahre Eleganz nicht auskommen kann. Die Haare sind dunkel, die Augen schwarz, die Glieder lang, aber ohne Schlaksigkeit. Seine Bewegungsabläufe erinnern an die trügerische Gelassenheit einer Raubkatze, die, eben noch mit halb geschlossenen Lidern in der Sonne dösend, im nächsten Augenblick zum Angriff übergehen kann. Nur wer Heinrich Kramer besser kennt, weiß, dass er unruhige Finger hat, deren Zittern er gern verbirgt, indem er die Hände in die Hosentaschen schiebt. Auf der Straße trägt er weiße Handschuhe, die er jetzt auszieht.
»Santé, die Herrschaften.«
Er legt seine Aktentasche auf einen der Besuchertische und rückt sich den Stuhl zurecht.
»Santé, Herr Kramer!«, ruft Bell. »Wieder auf der Jagd nach spannenden Geschichten?«
»Das Auge der vierten Gewalt schläft nie.«
Bell lacht und hört wieder damit auf, als ihm klar wird, dass Kramer keinen Witz gemacht hat. Dieser beugt sich vor, runzelt die Stirn und mustert den Vertreter des privaten Interesses, als könne er ihn nicht genau erkennen.
»Santé, Rosentreter«, sagt er, jede Silbe einzeln betonend.
Der Angesprochene grüßt flüchtig und versteckt den Blick in seinen Unterlagen. Kramer zupft seine Bügelfalten zurecht, schlägt die Beine übereinander, legt einen Finger an die Wange und übt sich in der Pose eines unauffälligen Zuhörers, was bei einem Mann seines Formats ein aussichtsloses Unterfangen ist.
»Zurück zum Fall«, sagt Sophie in demonstrativer Geschäftsmäßigkeit. »Was schlägt der Vertreter des öffentlichen Interesses vor?«
»Drei Jahre.«
»Das ist ein bisschen hoch gegriffen«, sagt Rosentreter.
»Finde ich nicht. Wir müssen dem Kerl klarmachen, dass er das Leben seiner Tochter gefährdet hat.«
»Kompromiss«, sagt Sophie schnell. »Zwei Jahre offener Maßregelvollzug, den er zu Hause ableisten kann. Einsetzung eines medizinischen Vormunds für das kleine Mädchen, medizinische und hygienische Fortbildung für den Vater. So wird sichergestellt, dass dem Kind nichts passiert, und die Familie bekommt noch eine Chance. Was meint ihr?«
»Genau das wollte ich auch beantragen«, sagt Rosentreter.
»Wunderbar«, lächelt Sophie, und zu Bell: »Ihre Begründung?«
»Eine Vernachlässigung der medizinischen und hygienischen Vorsorge gefährdet das Wohl des Kindes. Das Elternrecht beinhaltet nicht die Erlaubnis, dem Kind Schaden zuzufügen. Vor dem Gesetz steht das bewusste Zulassen einer Gefährdung dem absichtlichen Zufügen von Leid gleich. Das Strafmaß orientiert sich deshalb an der schweren Körperverletzung.«
Sophie macht eine Notiz.
»Bewilligt«, sagt sie und legt die Akte zur Seite. »Hoffen wir mal, dass die Sache damit im besten Sinn erledigt ist.«
Kramer kreuzt die Beine andersherum und sitzt wieder still.
»Also weiter.« Bell hebt den Zeigefinger. »Mia Holl.«
Die Frau auf der Präsentationswand könnte ebenso gut vierzig wie zwanzig Jahre alt sein. Das Geburtsdatum beweist, dass die Wahrheit wie so oft in der Mitte liegt. Ihr Gesicht strahlt jene besondere Anmutung von Sauberkeit aus, die wir auch an den Anwesenden beobachten können und die allen Mienen etwas Unberührtes, Altersloses, fast Kindliches gibt: den Ausdruck von Menschen, die ein Leben lang von Schmerz verschont geblieben sind. Zutraulich blickt Mia den Betrachter an. Ihr nackter Körper ist schmal und zeigt dennoch eine drahtige Konstitution von hoher Widerstandskraft. Kramer richtet sich auf.
»Wohl wieder ein Bagatelldelikt.« Sophie blickt in die neue Akte und unterdrückt ein Gähnen.
»Wiederholen Sie den Namen.« Das war Kramer. Obwohl er nicht laut gesprochen hat, bringt seine Stimme jeden beliebigen Vorgang im Raum sofort zum Erliegen. Überrascht schauen die drei Juristen auf.
»Mia Holl«, sagt Sophie.
Mit einer Bewegung, als wolle er Fliegen verscheuchen, bedeutet Kramer der Richterin, die Güteverhandlung fortzusetzen. Gleichzeitig zieht er einen elektronischen Kalender aus der Tasche und beginnt, sich Notizen zu machen. Sophie und Rosentreter wechseln einen schnellen Blick.
»Was liegt vor?«, fragt Sophie.
»Vernachlässigung der Meldepflichten«, sagt Bell. »Schlafbericht und Ernährungsbericht wurden im laufenden Monat nicht eingereicht. Plötzlicher Einbruch im sportlichen Leistungsprofil. Häusliche Blutdruckmessung und Urintest nicht durchgeführt.«
»Zeigen Sie mir die allgemeinen Daten.«
Auf einen Wink von Bell laufen lange Listen über die Präsentationsfläche. Blutwerte, Informationen zu Kalorienverbrauch und Stoffwechselabläufen, dazu einige Diagramme mit Leistungskurven
»Die ist doch gut drauf«, sagt Sophie und gibt Rosentreter damit das Stichwort.
»Keine Vorbelastungen. Erfolgreiche Biologin mit Idealbiographie. Keine Anzeichen von physischen oder sozialen Störungen.«
»Hat sie die ZPV in Anspruch genommen?«
»Bis jetzt liegt kein Antrag bei der Zentralen Partnerschaftsvermittlung vor.«
»Eine schwierige Phase. Nicht wahr, Jungs?« Die Richterin lacht über Bells säuerliche und Rosentreters erschrockene Miene. »Ich würde in diesem Fall gern auf eine Verwarnung verzichten und Hilfestellung anbieten. Einladung zum Klärungsgespräch.«
»Meinetwegen.« Bell zuckt die Achseln.
»Eine schwierige Phase.« Lächelnd tippt Kramer auf seinem Display. »So kann man es auch ausdrücken.«
»Kennen Sie die Beschuldigte?«, fragt Sophie freundlich.
»Ich schätze die Zurückhaltung des Gerichts.« Mit charmantem Spott zwinkert Kramer ihr zu. »Auch Sie sind der Beschuldigten schon einmal begegnet, Sophie. Wenn auch unter anderen Umständen.«
Sophie wird nachdenklich. Wäre ihr Teint nicht ohnehin von gesunder Farbe, könnten wir sie erröten sehen. Kramer packt seinen Kalender ein und steht auf.
»Schon fertig?«, fragt Bell.
»Im Gegenteil. Ganz am Anfang.«
Während Kramer zum Abschied winkt und den Raum verlässt, schließt Sophie die Akte und zieht eine neue heran.
»Der Nächste, bitte.«
Pfeffer
Es kam aus dem Kinderzimmer! So!« Lizzie lässt das Treppengeländer los, beugt sich vor und schauspielert ein übertriebenes Niesen. »Haa-tschi! Haa-tschi!«
»Das ist nicht dein Ernst.« Die Pollsche schaut sich um, als hätte soeben ein Geist das Treppenhaus durchquert. »Das klingt doch wie …«
»Sag’s ruhig!«
»Wie ein Niesen.«
»Genau! Aus dem Kinderzimmer! Was glaubt du, wie ich gerannt bin.«
»So ein Quatsch!« Driss ist die Dritte im Bunde, hoch aufgeschossen wie ein junger Baum, mit dem sie die Abwesenheit weiblicher Rundungen teilt. Ein flaches Gesicht balanciert über dem Kragen des weißen Kittels, große Augen spiegeln das jeweilige Gegenüber. Auch ohne Sommersprossen hätte man Schwierigkeiten, einem Mädchen wie ihr die Volljährigkeit zu glauben.
»Was ist Quatsch?«, fragt die Pollsche.
»Erkältung ist seit den zwanziger Jahren ausgestorben.«
»Fräulein Blitzmerker.« Lizzie rollt die Augen.
»Neulich war doch wieder Warnung«, flüstert die Pollsche.
»Siehst du, Driss, die Pollsche liest den GESUNDEN MENSCHENVERSTAND. Ich also das Herz in der Hose und die Tür aufgerissen. Und was seh ich? Am Boden hockt meine Kleine mit dem Bengel von der Ute und steckt das Näschen in die Pfeffertüte. Niest wie eine Weltmeisterin.«
»Arzt haben die gespielt!« Die Pollsche beginnt zu lachen.
»Und deine Kleine war die Patientin.« Jetzt lacht auch Driss.
»Ihr habt’s erfasst, Kinder. Aber wer fast krank geworden ist vor Angst, das war ich.«
Die drei stehen beisammen, als wollten sie nachahmen, wie sie bereits gestern beisammengestanden haben und vorgestern und alle Tage davor. Genauso reicht die Kette aus Wiederholungen des immer gleichen Bilds in die Zukunft: Lizzie stützt sich auf den Schlauch der Desinfektionsmaschine, die Pollsche lehnt am Kasten des Bakteriometers, und Driss hat beide Arme auf das Treppengeländer gelegt. Als die Haustür aufgeht, verstummen alle drei mit einem Schlag. Da ist er wieder: Der Mann im dunklen Anzug. Das Gesicht ist zur Hälfte von einem weißen Tuch verdeckt, aber ein Blick in seine Augen genügt, um zu erkennen, wie schön er ist.
»Santé! Einen guten Tag, die Damen.«
»Ein guter Tag«, sagt Lizzie, stellt eine Hüfte aus und stützt die Hand darauf, »ein guter Tag wäre einer, an dem wir nichts mehr zu tun hätten.«
»Aber, mein Herr, Sie müssen nicht …« Driss zeigt dem Mann mit ausgestrecktem Finger ins Gesicht.
»Sie meint den Mundschutz«, sagt die Pollsche schnell.
»Das ist ein Wächterhaus«, sagt Lizzie. »Sie brauchen hier drin keinen Mundschutz.«
»Wie dumm von mir.« Kramer löst das Band hinter dem Kopf. »Da war doch die Plakette am Eingang.«
Den Mundschutz schiebt er in die Jackentasche. Während des anschließenden Schweigens wäre genug Zeit, ein Referat über Wächterhäuser zu halten. In Wohnkomplexen, deren Hausgemeinschaft sich durch besondere Zuverlässigkeit auszeichnet, können Aufgaben der hygienischen Prophylaxe von den Bewohnern in Eigenregie übernommen werden. Regelmäßige Messungen der Luftwerte gehören ebenso dazu wie Müll- und Abwasserkontrolle und die Desinfizierung aller öffentlich zugänglichen Bereiche. Ein Haus, in dem diese Form der Selbstverwaltung funktioniert, wird mit einer Plakette ausgezeichnet und erhält Rabatte auf Strom und Wasser. Die Wächterhaus-Initiative feiert auf allen Ebenen die größten Erfolge. Der Fiskus spart Geld bei der Gesundheitsvorsorge, und die Menschen entwickeln Gemeinschaftssinn. Wer auch immer in grauer Vergangenheit behauptet hat, das Volk sei zu faul oder zu dumm für eine basisdemokratische Mitwirkung am öffentlichen Leben – er hatte nicht recht. In Wächterhäusern beweisen die Leute, dass sie sehr wohl in der Lage sind, zum allgemeinen Nutzen zusammenzuarbeiten. Sie haben Freude daran. Man trifft sich, man diskutiert, man fällt Entscheidungen. Man hat, im wahrsten Sinne des Wortes, miteinander zu tun.
Heinrich Kramer, der, umringt von den drei Damen in weißen Kitteln, wie ein stolzes Pferd zwischen Ziegen im Treppenhaus steht, war an der Entwicklung der Wächterhaus-Idee maßgeblich beteiligt. Doch berühmt war er vorher schon. Jeder im Land weiß, wer er ist. Darin liegt der Grund für das anhaltende Schweigen, genau wie für das jetzt losbrechende Geschnatter.
»Hol mich der Virus!«
»Das ist doch …«
»Sind Sie nicht?«
»Mensch, Driss, jetzt starr ihn nicht so an, das ist ja peinlich.«
Kramer legt eine Hand ans Brustbein und verbeugt sich.
»Verbindlichsten Dank, meine Damen. Sagen Sie, wohnt hier bei Ihnen eine Frau Holl?«
»Die Mia!«, ruft Driss und klatscht in die Hände. Bei einem Ratespiel hätte sie richtig darauf getippt, dass Heinrich Kramer unter allen Nachbarn nach Mia Holl fragen wird. Auch wenn Driss das nicht erklären könnte: Für sie ist die Mia etwas Besonderes.
»Frau Holl wohnt ganz oben. Terrasse nach hinten.«
»Tolle Wohnung«, sagt die Pollsche. »Mit der Biologie verdient man nicht schlecht.«
»Zu Recht«, sagt Lizzie streng.
»Schön«, sagt Kramer. »Und ist Frau Holl zu Hause?«
»Immer!«, ruft Driss. »Zur Zeit, mein ich.« Sie beugt sich zu Kramer, als wolle sie ihm ein Geheimnis verraten. »Man sieht die Mia gar nicht mehr.«
»Frau Mia Holl«, korrigiert Lizzie, »geht derzeit nicht arbeiten.«
»Dann hat sie Urlaub?«
»Ach was!«, platzt die Pollsche heraus. »So ein hübsches Kind und immer allein! Die guckt Angebote durch.«
»Wir glauben«, sagt Lizzie vertraulich zu Kramer, »dass Frau Holl einen Partner sucht.«
Kramer nickt. »Dann will ich mal.«
»Die Mia ist eine Anständige.«
»Das versteht sich doch von selbst, Driss.«
»In einem Haus wie diesem.«
»Danke.« Kramer nickt in die Runde, während er den Kreis der Nachbarinnen durchbricht. »Sie haben mir sehr geholfen. Und meinen Glückwunsch zu diesem schönen Haus.«
Die Münder bleiben offen, aber stumm, während man Kramer und seinen Beinen und seiner ganzen elastischen Gestalt beim Treppensteigen zusieht.
Die ideale Geliebte
Weil das Leben so sinnlos ist«, sagt Mia, »und man es trotzdem irgendwie aushalten muss, bekomme ich manchmal Lust, Kupferrohre beliebig miteinander zu verschweißen. Bis sie vielleicht einem Kranich ähneln. Oder einfach nur ineinandergewickelt sind wie ein Nest aus Würmern. Dann würde ich das Gebilde auf einen Sockel montieren und ihm einen Namen geben: Fliegende Bauten, oder auch: Die ideale Geliebte.«
Während Mia mit dem Rücken zum Zimmer am Schreibtisch sitzt, vor sich ein paar Zettel, auf denen sie gelegentlich etwas notiert, liegt die ideale Geliebte auf der Couch, gekleidet in ihr eigenes Haar und das Licht der Nachmittagssonne. Durch keine Regung verrät die Schöne, ob sie versteht, was Mia spricht. Wir könnten uns fragen, ob sie Mia überhaupt wahrnimmt. Oder ob sie vielmehr in einer anderen Dimension existiert und dort ins Leere schaut, indes sich Mia bloß zufällig vor ihren Augen befindet, an einem Kreuzungspunkt zwischen den Welten. Der Blick der idealen Geliebten gleicht dem Starren eines Wassertiers, das keine Augenlider besitzt.
»Nur, damit etwas bleibt«, sagt Mia. »Um etwas Zweckloses zu schaffen. Alles, was einen Zweck hat, erfüllt ihn eines Tages und ist damit verbraucht. Selbst Gott besaß den Zweck, die Menschen zu trösten, und siehe da: Mit seiner Ewigkeit war es nicht allzu weit her. Verstehst du?«
In der Wohnung herrscht Chaos. Es sieht aus, als hätte hier seit Wochen niemand aufgeräumt, gelüftet oder geputzt.
»Natürlich verstehst du das. Es ist von Moritz. Er sagte: Wer Ewigkeit will, darf nicht einmal den Zweck des eigenen Überlebens verfolgen.«
Weil die ideale Geliebte nicht reagiert, dreht sich Mia mit dem Stuhl herum.
»Wenn er mich ärgern wollte, sagte er, ich hätte Künstlerin werden sollen. Seiner Meinung nach hat mich das naturwissenschaftliche Denken verdorben. Wie, fragte er, soll man einen Gegenstand oder gar ein geliebtes Wesen betrachten, wenn man ständig daran denken muss, dass nicht nur das Betrachtete, sondern auch man selbst nur ein Teil des gigantischen Atomwirbels ist, aus dem alles besteht? Wie soll man es ertragen, dass sich das Gehirn, unser einziges Instrument des Sehens und Verstehens, aus den gleichen Bausteinen zusammensetzt wie das Gesehene und Verstandene? Was, rief Moritz dann, soll das sein: Materie, die sich selbst anglotzt?«
Die ideale Geliebte hat mit Materie wenig gemeinsam. Vielleicht tut es Mia deshalb gut, mit ihr zu sprechen.
»Erst hat die naturwissenschaftliche Erkenntnis das göttliche Weltbild zerstört und den Menschen ins Zentrum des Geschehens gerückt. Dann hat sie ihn dort stehen lassen, ohne Antworten, in einer Lage, die nichts weiter als lächerlich ist. Das hat Moritz oft gesagt, und in diesem Punkt gab ich ihm recht. So verschieden haben wir gar nicht gedacht. Nur unsere Schlussfolgerungen waren nicht dieselben.«
Mit dem Stift zeigt Mia auf die ideale Geliebte, als gebe es einen Grund, sie anzuklagen.
»Er wollte für die Liebe leben, und wenn man ihm zuhörte, konnte man auf die Idee kommen, dass Liebe schlicht ein anderes Wort war für alles, was ihm gefiel. Liebe war Natur, Freiheit, Frauen, Fische fangen, Unruhe stiften. Anders sein. Noch mehr Unruhe stiften. Das alles hieß bei ihm Liebe.«
Mia wendet sich wieder dem Schreibtisch zu und macht Notizen, während sie weiterspricht.
»Ich muss das aufschreiben. Ich muss ihn aufschreiben. Das menschliche Gedächtnis sortiert 96 Prozent aller Informationen nach wenigen Tagen aus. Vier Prozent Moritz sind nicht genug. Mit vier Prozent Moritz kann ich nicht weiterleben.«
Eine Weile schreibt sie verbissen, dann hebt sie den Kopf.
»Wenn wir über Liebe sprachen, wurde er beleidigend. Du, sagte er zu mir, bist Naturwissenschaftlerin. Deine Freunde und Feinde siehst du nur unter dem Elektronenmikroskop. Wenn du das Wort Liebe sagst, muss sich das anfühlen, als hättest du einen Fremdkörper im Mund. Deine Stimme klingt anders bei diesem Wort. Liebe. Eine halbe Oktave höher. Dein Kehlkopf zieht sich zusammen, Mia, ein schriller Ton, Liebe. Als Kind hast du es sogar vor dem Spiegel geübt. Liebe. Du hast dir dabei selbst in die Augen gesehen und nach dem Grund gesucht, der dieses Wort so schwierig macht: Liebe. Es ist einfach so, Mia, dass du diesen Begriff nicht richtig aussprechen kannst. Für dich gehört er zu einer fremden Sprache, die nach einer unnatürlichen Gaumenstellung verlangt. Sag mal, ich liebe dich, Mia! Sag: Das Wichtigste im Leben ist die Liebe. Mein Lieber, Liebster. Liebst du mich? – Schon wendest du dich ab, Mia! Du gibst auf!«
Ein weiteres Mal dreht sie sich mit dem Schreibtischsessel herum, diesmal in einer ungestümen Bewegung.
»Und was war sein letzter Satz? ›Das Leben ist ein Angebot, das man auch ablehnen kann.‹ Wo war sie da, seine Liebe? Es gibt Sätze, die prägen das Gehirn wie eine Metallstanze, so dass man fortan nur noch in diesen Bahnen denken kann. Wie soll ich das vergessen? Wie soll ich das nicht vergessen? Du hast ihn gekannt, wahrscheinlich besser als ich. Keine Ahnung, ob er wusste, wie sehr ich ihn liebte. Ich weiß nicht einmal«, ruft Mia, »ob ich in der Lage bin, ihn angemessen zu vermissen!«
»Red keinen Scheiß«, sagt die ideale Geliebte. »Wir machen doch nichts anderes, bei Tag und bei Nacht. Wir vermissen ihn. Gemeinsam. Komm her.«
Als Mia aufsteht und den ausgestreckten Armen der idealen Geliebten entgegengeht, klingelt es an der Tür.
Eine hübsche Geste
Es gibt Momente, in denen die Zeit stehenbleibt. Zwei Menschen sehen einander in die Augen: Materie, die sich selbst anglotzt. Um die entstandene Blickachse, die sich hinter den Köpfen ins Unendliche verlängern lässt, dreht sich für ein paar Sekunden die ganze Welt. Zur Vermeidung von Missverständnissen sei darauf hingewiesen, dass hier nicht von Liebe auf den ersten Blick die Rede ist. Eher würden wir das, was gerade zwischen Mia und Kramer geschieht, das stumme Getöse am Anfang einer Geschichte nennen.
Mia hat ihm die Tür geöffnet, und für eine Weile spricht niemand ein Wort. Was Kramer denkt, ist schwer zu erraten; vermutlich wartet er einfach darauf, dass Mia die Gastgeberin in sich entdeckt. Er ist ein geduldiger Mann. Vielleicht nimmt er Rücksicht, verharrt respektvoll auf der Schwelle und will ihr Zeit geben, weil er versteht, in welch merkwürdiger Situation sie sich befindet. Schließlich erlebt man es nicht alle Tage, dass ein Mensch, den man im Geiste schon so viele Male und auf so unterschiedliche Arten zu Tode gequält hat, plötzlich leibhaftig vor einem steht.
»Seltsam«, sagt Mia, als sie die Sprache wiederfindet. »Ich habe das Fernsehen gar nicht angeschaltet. Und trotzdem sehe ich Sie.«
Darauf lächelt Kramer ein bezauberndes, offenherziges Lächeln, das ihm niemand zutrauen würde, der ihn nur aus den Medien kennt. Es ist ein Privatlächeln. Das Lächeln eines Menschen, der trotz großer Berühmtheit ganz der Alte geblieben ist.
»Santé«, sagt er, zieht den rechten Handschuh aus und streckt Mia die nackte Hand hin. Sie betrachtet diese Hand wie ein exotisches Insekt, bevor sie zögernd ihre Finger in seine legt.
»Eine hübsche Geste, wie aus einem alten Film«, sagt sie. »Scheint mir nicht recht zu Ihnen zu passen. Haben Sie keine Angst vor meinem Infektionspotential?«
»Das Wichtigste im Leben ist Stil, Mia Holl. Und Hysterie ist die schlimmste Feindin des guten Stils.«
»Ihr Gesicht«, sagt Mia nachdenklich, »ist wohl eine Art Etikett. Man kann es auf die unterschiedlichsten Ansichten kleben.«
»Darf ich reinkommen?«
»Sie verlangen, dass ich dem Mörder meines Bruders etwas zu trinken anbiete?«
»Durchaus nicht. Für eine so plumpe Einschätzung sind Sie zu intelligent. Aber etwas zu trinken hätte ich tatsächlich gern. Eine Tasse heißes Wasser.«
Kramer geht an Mia vorbei in die Wohnung und steuert das Sofa an, auf dem die ideale Geliebte schnell zur Seite rutscht. Kaum hat Kramer sich hingesetzt, wirkt das Sofa wie für ihn gemacht. Den angewiderten Blick der idealen Geliebten bemerkt er nicht, was ausnahmsweise weniger an seiner Selbstsicherheit liegt als an der Tatsache, dass er die ideale Geliebte nicht sehen kann.
»Nur der Vollständigkeit halber: Ich habe Ihren Bruder nicht ermordet. Wir sollten vielleicht eher fragen, woher er im Gefängnis die Angelschnur hatte, um sich aufzuhängen.«
Mia steht mitten im Raum, hat die Arme gekreuzt und die Finger ins Fleisch der Oberarme gekrallt, als wolle sie sich am eigenen Körper festhalten – oder verhindern, dass ihre Hände sich selbständig machen, um Heinrich Kramer zu erwürgen.
»Sie …«, stößt Mia hervor, »Sie bemühen sich nicht gerade, meinen Hass zu entschärfen.«
Kramer kann auch geschmeichelt lächeln; dazu streicht er sich übers Haar.
»Hassen Sie nur«, sagt er. »Ich bin hier, um mit Ihnen zu reden. Sie sollen mich nicht heiraten.«
»Dem stünden hoffentlich unsere Immunsysteme entgegen.«
»Interessanterweise«, Kramer legt einen Finger an die Nase, »wären wir immunologisch kompatibel.«
»Interessanterweise«, sagt die ideale Geliebte und legt ebenfalls einen Finger an die Nase, »sind Sie ein noch größeres Arschloch, als wir dachten.«
»Versuchen wir es mit Logik.« Mia hat ihre Stimme wieder unter Kontrolle. »Wenn Sie und Ihr Schwadron aus dreckigen Kläffern nicht diese Kampagne gegen Moritz gefahren hätten, wäre er vielleicht nicht verurteilt worden. Und ohne Verurteilung hätte er sich nicht umgebracht.«
»So gefallen Sie mir schon besser.« Kramer hat den rechten Ellbogen auf die Rückenlehne der Couch gelegt, als ob er die ideale Geliebte in den Arm nehmen wollte. »Logisches Denken liegt Ihnen, genau wie mir. Deshalb werden Sie mühelos Ihren Denkfehler erkennen. Kausalität ist keineswegs identisch mit Schuld. Sonst müssten Sie auch den Urknall für den Tod Ihres Bruders verantwortlich machen.«
»Vielleicht tue ich das.« Die Erde gerät auf ihrer Umlaufbahn in ein Schlagloch, Mia schwankt, will sich auf den Schreibtisch stützen und greift ins Leere. »Ich verurteile den Urknall. Ich verurteile das Universum. Ich verurteile unsere Eltern, weil sie Moritz und mich zur Welt gebracht haben. Ich verurteile alles und jeden, der ursächlich ist für seinen Tod!«
»Kommen Sie. Ich helfe Ihnen.«
Kramer erhebt sich, hilft Mia, die auf die Knie gesunken ist, beim Aufstehen und führt sie zum Sofa. Behutsam streicht er ihr das Haar aus der Stirn.
»Fass sie nicht an!«, zischt die ideale Geliebte.
»Ich geh uns mal eine Tasse heißes Wasser machen.« Kramer verschwindet in der Küche.
Genetischer Fingerabdruck
Der Vorfall, von dem hier gesprochen wird, liegt nicht lang zurück. Ein Blick auf die Fakten zeigt ein verblüffend simples Geschehen. Moritz Holl, 27 Jahre alt, ein zugleich sanfter und hartnäckiger Mann, der von seinen Eltern »Träumer«, von Freunden »Freidenker« und von seiner Schwester Mia meistens »Spinner« genannt wurde, meldete in einer gewöhnlichen Samstagnacht einen schrecklichen Fund bei der Polizei. Eine junge Frau namens Sibylle, mit der er sich nach eigenen Angaben zu einem Blind Date an der Südbrücke verabredet hatte, war bei seinem Eintreffen weder sympathisch noch unsympathisch, sondern tot. Man nahm die Zeugenaussage des völlig verstörten Moritz zu Protokoll und schickte ihn nach Hause. Zwei Tage später saß er in Untersuchungshaft. Man hatte sein Sperma im Körper der Vergewaltigten gefunden.
Der DNA-Test beendete das Ermittlungsverfahren. Jeder normale Mensch weiß, dass der genetische Fingerabdruck unverwechselbar ist. Nicht einmal Zwillinge besitzen dasselbe Erbmaterial, und Moritz hatte lediglich eine gewöhnliche Schwester, die als Naturwissenschaftlerin selbst am besten wusste, was genetische Unverwechselbarkeit bedeutet. Eine Verurteilung aufgrund eines solchen Beweises ist juristische Routine. Mörder legen in solchen Fällen ein Geständnis ab. Sie tun es früher oder später, aber sie gestehen auf jeden Fall. Vielleicht erleichtert es ihr Gewissen; vielleicht bitten sie auf diese Weise die öffentliche Meinung um Absolution. Aber Moritz ignorierte die Fakten. Er bestand darauf, Sibylle weder vergewaltigt noch getötet zu haben. Während das Publikum vor dem Nachmittagsprogramm saß und ein schnelles Verfahren erwartete, beteuerte Moritz seine Unschuld, mit weit geöffneten, blauen Augen, das blasse Gesicht gehärtet von der eigenen Überzeugung. Bei jeder Gelegenheit wiederholte er einen Satz, der ins Ohr ging wie ein Schlagerrefrain: »Ihr opfert mich auf dem Altar eurer Verblendung.«
Kein Mörder der jüngeren Rechtsgeschichte hatte sich jemals so verhalten. Die Bürger eines gut funktionierenden Staates sind daran gewöhnt, dass öffentliches und persönliches Wohl zur Deckung gebracht werden, auch und gerade in den finstersten Winkeln der menschlichen Existenz. Moritz’ Auftritte vor Gericht verursachten einen Presseskandal. Stimmen wurden laut, die mit seiner Konsequenz sympathisierten und einen Aufschub der Urteilsvollstreckung forderten. Andere begannen ihn umso mehr zu verabscheuen, nicht nur für die Bluttat, sondern vor allem für seine Uneinsichtigkeit.
Inmitten des allgemeinen Geredes stand Mia, deren Verwandtschaft mit Moritz plötzlich zu einem dunklen Geheimnis geworden war, das die Justizbehörden schützen mussten. Tagsüber ging sie zur Arbeit und erfüllte ihre Leibesertüchtigungspflichten, abends fuhr sie heimlich ins Gefängnis. Statt zu schlafen, kotzte sie bei Nacht in eine Schüssel, die sie anschließend auf der Straße in einen Gully leerte, damit die Sensoren in der Toilette keine erhöhte Konzentration von Magensäure im Abwasser messen konnten. Kramers Berichterstattung machte selbstverständlich einen wichtigen, wenn nicht den wichtigstenTeil des medialen Diskurses aus. Er sagte und schrieb nichts anderes als das, was ein nüchterner Positivist und überzeugter Verteidiger der METHODE sagen und schreiben musste – und was er jetzt, in der Küche hantierend, für Mia wiederholt.
Keine verstiegenen Ideologien
Unsere Gesellschaft ist am Ziel«, sagt Kramer, während er den Wasserkocher befüllt. »Im Gegensatz zu allen Systemen der Vergangenheit gehorchen wir weder dem Markt noch einer Religion. Wir brauchen keine verstiegenen Ideologien. Wir brauchen nicht einmal den bigotten Glauben an eine Volksherrschaft, um unser System zu legitimieren. Wir gehorchen allein der Vernunft, indem wir uns auf eine Tatsache berufen, die sich unmittelbar aus der Existenz von biologischem Leben ergibt. Denn ein Merkmal ist jedem lebenden Wesen zu eigen. Es zeichnet jedes Tier und jede Pflanze und erst recht den Menschen aus: Der unbedingte, individuelle und kollektive Überlebenswille. Ihn erheben wir zur Grundlage der großen Übereinkunft, auf die sich unsere Gesellschaft stützt. Wir haben eine METHODE entwickelt, die darauf abzielt, jedem Einzelnen ein möglichst langes, störungsfreies, das heißt, gesundes und glückliches Leben zu garantieren. Frei von Schmerz und Leid. Zu diesem Zweck haben wir unseren Staat hochkomplex organisiert, komplexer als jeden anderen vor ihm. Unsere Gesetze funktionieren in filigraner Feinabstimmung, vergleichbar dem Nervensystem eines Organismus. Unser System ist perfekt, auf wundersame Weise lebensfähig und stark wie ein Körper – allerdings ebenso anfällig. Ein simpler Verstoß gegen eine der Grundregeln kann diesen Organismus schwer verletzen oder sogar töten. Zitrone?«
Mia nimmt gern einen Spritzer Zitrone, und das heiße Wasser, das Kramer ihr reicht, tut gut. Er lässt sich ihr gegenüber im Sessel nieder und pustet in seine Tasse.
»Wissen Sie, was ich damit sagen will?«
»Dass es keine rationale Möglichkeit gibt, die Glaubwürdigkeit eines DNA-Tests in Frage zu stellen«, erwidert Mia leise.
Kramer nickt.
»Der DNA-Test ist unfehlbar. Unfehlbarkeit ist ein Grundpfeiler der METHODE. Wie sollten wir den Menschen im Land die Existenz einer Regel erklären, wenn diese Regel nicht vernünftig und in allen Fällen gültig, mit anderen Worten, unfehlbar wäre? Unfehlbarkeit verlangt Konsequenz, auf die uns der gesunde Menschenverstand verpflichtet.«
»Mia«, sagt die ideale Geliebte, »der Mann spricht in Formeln. Der Mann ist eine Maschine!«
»Kann sein.«
»Gesunder Menschenverstand«, ruft die ideale Geliebte, »ist, wenn einer recht haben will und nicht begründen kann, warum!«
»Warte einen Moment.«
»Wie bitte?«, fragt Kramer.
»Was«, fragt Mia, sich ihm zuwendend, »bedeutet Unfehlbarkeit im Angesicht des Menschlichen?«
»Ich weiß, worauf Sie hinauswollen.«
»Wie«, fragt Mia, »sollen denn Regeln, Maßnahmen, Verfahren unfehlbar sein, wenn das alles doch immer nur von Menschen ersonnen wurde? Von Menschen, die alle paar Jahrzehnte ihre Überzeugungen, ihre wissenschaftlichen Ansichten, ihre gesamte Wahrheit austauschen? Haben Sie sich nie gefragt, ob mein Bruder nicht trotz allem unschuldig sein könnte?«
»Nein«, sagt Kramer.
»Warum nicht?«, fragt die ideale Geliebte.
»Warum nicht?«, fragt Mia.
»Wohin sollte diese Frage führen?« Kramer stellt seine Tasse ab und beugt sich vor. »Zu Einzelfallentscheidungen? Zu einer Willkürherrschaft des Herzens, wie sie ein König ausüben würde, der nach Belieben gnädig und streng sein kann? Wessen Herz sollte entscheiden? Meines? Ihres? Welches Recht stünde dahinter? Die Macht einer übernatürlichen Gerechtigkeit? Glauben Sie an Gott, Frau Holl?«
»Ich glaube nicht an ihn und er nicht an mich. Das beruht auf Gegenseitigkeit.«
»Und auf was will der Herr Kramer sich berufen?«, fragt die ideale Geliebte. »Auf eine rationale Objektivität, an die er selbst nicht glaubt? Und sie nicht an ihn?«
»Na ja«, sagt Mia. »Das Gefühl ist jedenfalls ein schlechter Berater. Es besitzt per definitionem keine Allgemeingültigkeit.«
»Und der Verstand ist eine Illusion«, erwidert die ideale Geliebte schnell. »Nichts weiter als ein Kostüm, in das der Mensch die Summe seiner Gefühle steckt.«
»Du sprichst in romantischen Anachronismen!«, ruft Mia.
»Und du in jenen intellektuellen Sophistereien, an denen Moritz zugrunde gegangen ist!«
»Frau Holl!« Kramer winkt mit einer wohlgeformten Hand, als vertreibe er Nebelschwaden. »Hören Sie auf, mit sich selbst zu reden. Sie haben einen Menschen verloren. Nicht aber Ihre Überzeugung.«
»Eine Überzeugung, die Moritz zeit seines Lebens verachtet hat«, sagt die ideale Geliebte.
Mia wirft ihr einen warnenden Blick zu und steht auf, um ans Fenster zu treten. Es ist ein schöner Tag, ein Tag wie aus einer Werbung für eiweißhaltige Fitnessprodukte. Nur mit Mühe widersteht Mia dem Wunsch, die Vorhänge zuzuziehen. Die Sonne entdeckt halb leere Essenskartons vom Lieferservice, abgeworfene Kleidungsstücke und Staubflusen in allen Ecken. Es riecht nach zwanzigstem Jahrhundert. Mit jeder Minute scheint das helle Licht die Unordnung im Zimmer zu vergrößern.
»Ich blicke auf eine Kreuzung zwischen zwei Wegen«, sagt Mia. »Der eine Weg heißt Unglück, der andere Verderben. Entweder ich verfluche ein System, zu dessen METHODE es keine vernünftige Alternative gibt. Oder ich verrate die Liebe zu meinem Bruder, an dessen Unschuld ich ebenso fest glaube wie an meine Existenz. Verstehen Sie?« Mit einer heftigen Bewegung dreht sie sich um. »Ich weiß, dass er es nicht getan hat. Was soll ich jetzt machen? Wie mich entscheiden? Für den Sturz oder den Fall? Die Hölle oder das Fegefeuer?«
»Weder – noch«, sagt Kramer. »Es gibt Situationen, in denen nicht die eine oder die andere Möglichkeit, sondern die Entscheidung selbst der Fehler wäre.«
»Soll das heißen … Sie, ausgerechnet Sie bekennen sich zu Lücken im System?«
»Selbstverständlich.« Jetzt ist sein Lächeln entwaffnend. Vom Sessel aus sieht er zu ihr auf. »Das System ist menschlich, das haben Sie eben selbst festgestellt. Natürlich weist es Lücken auf. Das Menschliche ist ein nachtschwarzer Raum, in dem wir herumkriechen, blind und taub wie Neugeborene. Man kann nicht mehr tun, als dafür zu sorgen, dass wir uns beim Kriechen möglichst selten die Köpfe stoßen. Das ist alles.«
»Die Köpfe stoßen? Mein Kopf ist bereits zerschmettert.«
»Das sehe ich anders, und zwar mit eigenen Augen.« Kramer streckt einen Arm aus und deutet genau in die Mitte von Mias Stirn. »Es gilt, sich über all das zu erheben. Trauern Sie um Ihren Bruder, Mia. Trauern Sie nach Kräften. Und währenddessen kehren Sie zur Normalität zurück. Sie sind den Behörden auffällig geworden wegen gewisser Versäumnisse.«
»Es gibt Situationen, in denen …«, beginnt Mia, aber Kramer winkt ab.
»Sparen Sie sich die Rechtfertigungen, das haben Sie gar nicht nötig. Man wird Sie zu einem klärenden Gespräch einladen, nichts weiter. Nehmen Sie das Angebot an. Räumen Sie auf. Putzen Sie wenigstens die äußeren Zeichen der Hoffnungslosigkeit aus Ihrem Leben. Es ist immer noch Ihr Leben. Nehmen Sie es in die Hand.«
»Nichts anderes habe ich vor«, sagt Mia leise.
»Das freut mich sehr.« Kramer springt mit einem Elan aus dem Sessel, als wolle er sich eigenhändig an die Aufräumarbeiten machen. Mia sieht ihn misstrauisch an.
»Und Sie haben gleich einen Besen mitgebracht? Zum Zusammenkehren der Hoffnungslosigkeit?«
Sofort korrigiert Kramer seine Haltung und schiebt die Hände in die Hosentaschen.
»Was mich auf eine interessante Frage bringt«, sagt Mia. »Sie sind ein viel beschäftigter Mann. Ich glaube kaum, dass es Ihnen an kompetenten Gesprächspartnern fehlt. Planen Sie, mich zu adoptieren?«
»Mit anderen Worten«, sagt die ideale Geliebte, »was zum Teufel willst du hier?«
»Ich bin hier, um Ihnen einen Vorschlag zu machen.«
Kramer beginnt, durchs Zimmer zu schlendern, und verzichtet nicht darauf, die Fehlstandsanzeige an Mias Hometrainer abzulesen.
»Alles, was wir soeben besprochen haben, geht nicht nur Sie etwas an, sondern das ganze Land. Es wird nicht lange dauern, bis die ersten Doktorarbeiten zum Fall Ihres Bruders erscheinen – auf dem Gebiet der Rechtswissenschaft, der Soziologie, Psychologie, Politologie. Die causa Moritz Holl wird zu einer wahren Königin der Fußnoten avancieren. Wie kann es sein, dass die METHODE die Schuld eines Angeklagten zweifelsfrei feststellt und dieser sich trotzdem für unschuldig hält? Warum klaffen allgemeines und persönliches Wohl in einem solchen Fall auseinander? Das sind Grundfragen unseres Zusammenlebens. Grundfragen der METHODE, die immer wieder neu gestellt und behandelt werden müssen.«
Mia folgt seinem Weg mit verwundertem Blick.
»Gestellt? Behandelt? Wollen Sie mich etwa für ein – kritisches Interview?«
»Für ein differenziertes Gespräch. Ich würde Sie gern porträtieren, Mia. Für den GESUNDEN MENSCHENVERSTAND. Der Journalismus ist schon lange kein Wanderzirkus mehr, der weiterzieht, wenn das Spektakel vorbei ist.«
»Gleich lache ich laut«, sagt die ideale Geliebte. »Obwohl ich das gar nicht kann.«
»Wir könnten zeigen, welche Tragödien und Widersprüche selbst hinter einem sauberen System wie der METHODE stecken. Und warum es trotzdem notwendig ist, sich immer wieder zum Weg der Vernunft zu bekennen. Ein guter Bürger ist nicht einer, der wie ein Schaf mit der Herde trottet. Ein guter Bürger durchleidet Krisen und Zweifel, um danach nur noch fester zur gemeinsamen Sache zu stehen. Das könnten Sie den Menschen zeigen, Mia Holl. Denken Sie darüber nach. Es wäre nicht zu Ihrem Nachteil.«
»Wenn du das machst«, sagt die ideale Geliebte, »verlasse ich dich.«
»Das kannst du auch nicht«, sagt Mia. »Moritz hat dich mir geschenkt.«
Kramer hält inne.
»Beinahe können Sie einem Angst einjagen, Frau Holl.«
Durch Plexiglas
Ich wünschte, wir hätten wenigstens das noch geschafft«, sagt Mia.
Wenn wir durch das Gewebe der Zeit hindurchschauen, als wäre es ein halbtransparentes Gewand auf dem Körper des Ewigen, sehen wir Mia und Moritz, vor nicht mehr als vier Wochen, in einem kahlen Raum des Untersuchungsgefängnisses. Sie betrachten einander prüfend, als sähen sie sich zum ersten Mal.
»Was geschafft?«, fragt Moritz.
»Dir eine Frau zu suchen.«
Sie werden durch eine Plexiglasscheibe getrennt, deren Mitte ein Stern aus kleinen Löchern ziert. Durch diese Löcher können sie sich hören und, wenn sie die Gesichter der Scheibe nähern, so nah, dass gleich eine Ermahnung des Sicherheitswächters folgt, sogar riechen.
»Das macht nichts«, sagt der inzwischen vergangene Moritz. »Ich habe mir eine erfunden.«
»Eine was?«
»Eine ideale Geliebte. Sie ist ein bisschen launisch, aber im Großen und Ganzen kommen wir gut miteinander aus. Ich bin nicht einsam.«
Wenn Moritz sich bewegt, raschelt der weiße Papieranzug, der ihm seit sechs Monaten die Kleidung ersetzt. Er legt zwei Finger an die Scheibe, Mia berührt die Stelle von ihrer Seite. So viel lässt man ihnen durchgehen, seit Mia Koffeinpulver in kleinen Plastiksäckchen aus dem Labor mitbringt, um der Sicherheitswacht eine Freude zu bereiten. Mia und Moritz lächeln sich an. Sie haben gelernt zu lächeln, wenn sie eigentlich schreien, etwas zerschlagen oder einfach nur weinen wollen.
»Weißt du was«, sagt Moritz. »Ich leih sie dir aus. Nimm sie mit.«
»Ich soll deine imaginäre Geliebte zu mir nehmen?«
»Fänd’ ich gut. Dann wäre es leichter zu glauben, dass wir uns bald wiedersehen. Die ideale Geliebte wird dich zu mir zurückführen. Kann mir nicht vorstellen, dass sie es lange bei dir aushält.«
»Für solche Spielchen fehlt mir die Einbildungskraft.«
Moritz runzelt die Stirn, wie es seine Angewohnheit ist. Dabei scheint sich das ganze Gesicht um einen Punkt zwischen den Augen auftürmen zu wollen.
»Du hast mehr als genug davon«, sagt er. »Wir sind uns ein Leben lang im Reich der Phantasie begegnet.«
»Das war dein Reich.«
»Es war unser Reich. Es ist unser Reich. Es wird für immer unser gemeinsames Zuhause sein. Vergiss das nicht.«
Eine Weile starren sie sich an wie Feinde, Cowboys auf einer Landstraße, denen der Wind das Haar in eine Richtung drückt. Ein kurzer Kampf. Mia spürt sich nachgeben. Eigentlich hat sie von Anfang an nicht mit ganzer Kraft dagegengehalten.
»Okay«, sagt sie. »Ich nehme dein weibliches Hirngespinst mit, verdammt noch mal.«
Seine Stirn glättet sich mühelos; der Geist dahinter ist gewöhnt, seinen Willen zu bekommen.
»Sie wird in deiner Wohnung auf dich warten«, flüstert er. »Du wirst dieses Geschenk noch schätzen lernen. Und jetzt … jetzt bitte ich um die Gegenleistung.«
Zwischen Mias Fingern befindet sich eine durchsichtige Schnur, die sie durch eins der Löcher fädelt. Mit kleinen Bewegungen von Daumen und Zeigefinger zieht Moritz die Schnur zu sich herüber. Das dauert eine Weile. Der Mann von der Sicherheitswacht betrachtet seine Fingernägel und gähnt. Als die Schnur auf der anderen Seite ist, stehen Mia und Moritz auf.
»Das Leben«, sagt Moritz leise, »ist ein Angebot, das man auch ablehnen kann.«
Sie stellen sich vor, einander zu umarmen, einen winzigen Abstand wahrend, gerade so, dass Brustbeine und Bäuche sich nicht berühren.
»Tschüs«, sagt Mia.
Eine besondere Begabung zum Schmerz
Sie hat es versucht. Sie hat gebrauchtes Geschirr und leere Gläser von Schränken und Regalen gesammelt und dann doch in einem Stapel auf dem Schreibtisch stehen lassen. Sie hat das Besteck zur Entnahme von Blutproben bereitgelegt, die Becher für den Urin im Bad aufgereiht und vergessen. Sie hat eine Ecke des Teppichs gesaugt und den Staubsauger hingeworfen. Sie wollte Fenster putzen und hat stattdessen eine Scheibe behaucht und mit der Fingerspitze einen Stern aus Löchern in das Kondenswasser getupft. Sie hat zwei Finger gegen das Glas gelegt und gelächelt, obwohl sie eigentlich schreien, etwas zerschlagen oder einfach nur weinen wollte. Jetzt ist das Chaos in der Wohnung größer als zuvor, und Mia liegt auf dem Sofa in den Armen der idealen Geliebten, die Augen geschlossen, als schlafe sie.
»Ich erkenne diese Wohnung nicht mehr«, sagt Mia. »Sie kommt mir fremd vor wie ein Wort, das man so lange wiederholt, bis es jeden Sinn verliert und zu einer bloßen Abfolge von Lauten wird. Auch das Vergehen der Tage ist mir fremd geworden. Ich erkenne mein Leben nicht mehr, eine bloße Abfolge von Handlungen. Alles ohne Bedeutung. Ohne Zweck.«
»Dieser Kramer ist ein Fanatiker«, sagt die ideale Geliebte und wiegt Mia wie eine Mutter.
»Ich bin eine Frau mit einem Penthouse über den Dächern der Stadt und einer besonderen Begabung zum Schmerz. Ich bin seit vier Wochen nicht mehr aus dem Haus gegangen. Das ist alles, was man über mich wissen kann. Wenn ich den Blick in mich hinein richte und horche, ob sich dort etwas regt, ein leises Knistern oder Wispern, durch das sich die Anwesenheit meiner Persönlichkeit verrät, finde ich nichts. Ich bin ein Wort, das man so lange wiederholt hat, bis es keinen Sinn mehr ergibt.«
»Er zieht Lust aus unbedingtem Gehorsam«, sagt die ideale Geliebte. »Aus unbedingter Hingabe an das Prinzip.«
»Er hat vernünftig gesprochen.«
»Er ist ein geschickter Fanatiker.« Die ideale Geliebte hebt beide Hände und schüttelt sie dicht beieinander in der Luft, als wolle sie einen badenden Vogel nachahmen. Das ist ihre Art zu lachen.
Bohnendose
Zwei Sicherheitswächter in grauen Uniformen haben sie hereingebracht, sich in aller Höflichkeit für die Unannehmlichkeiten entschuldigt und beim Verlassen des Raums leise die Tür geschlossen.
Jetzt sitzt Mia mit nacktem Oberkörper und leerem Blick im Untersuchungsstuhl. Von Handgelenken, Rücken und Schläfen hängen Kabel. Ihre Herztöne, das Rauschen des Bluts in den Adern, die elektrischen Impulse der Synapsen sind zu hören – ein Orchester von Wahnsinnigen, das die Instrumente stimmt. Der Amtsarzt ist ein gutmütiger Herr mit gepflegten Fingernägeln. Er streicht Mia mit einem Scanner über den Oberarm, als wäre sie eine Bohnendose auf dem Kassenband im Supermarkt. Auf der Präsentationswand erscheint ihr Photo, gefolgt von einer langen Reihe medizinischer Informationen.
»Sehen Sie, Frau Holl, ist doch wunderbar, Frau Holl. Alles in schönster Ordnung. Kein Grund zur Veranlassung, wie ich gern sage.«
Mia schaut auf.
»Sie haben wohl geglaubt, ich sei krank? Und würde meine Untersuchungsergebnisse nicht abgeben, weil ich etwas zu verbergen habe? Sehe ich aus wie eine Kriminelle?«
Der Arzt macht sich daran, die Kabel von ihrem Körper zu entfernen.
»Alles schon vorgekommen, Frau Holl. Wahr, aber traurig, wie ich gern sage.«
Hastig zieht Mia ihren Pullover über den Kopf.
»Guten schönen Tag noch, Frau Holl!«, ruft der Arzt.
Saftpresse
Sophies Studentinnenzopf hüpft fröhlich auf und ab, während sie beim Überfliegen des medizinischen Gutachtens vor sich hin nickt. Sie ist gut gelaunt, ohne besonderen Grund. Gute Laune ist eine Angewohnheit von Sophie, so wie nervöse Menschen an den Nägeln kauen. Sophie hat Jura studiert, weil sie das Recht liebt, und daraus ist ein Beruf geworden, in dem sie etwas Sinnvolles tun kann. Die Menschen danken es ihr. Mit wenigen Ausnahmen. Mia Holl, das spürt sie genau, gehört nicht zu diesen Ausnahmen. Die hellen Augen und das intelligente Gesicht der Beschuldigten haben ihr gleich beim Eintreten gefallen. Vielleicht ist Mias Nase ein wenig zu groß. Zu große Nasen sprechen für einen sturen Charakter, aber das wird durch den weichen Mund, der unentwegt stumm um Frieden bittet, voll und ganz ausgeglichen. Sophie hält große Stücke auf ihre Menschenkenntnis.
»Prima«, sagt sie, klappt den Untersuchungsbericht zu und schiebt ihn beiseite. »Ganz prima.«
Es rührt Sophie, wie die Beschuldigte die Unterlippe zwischen die Zähne saugt. Mia ist ein paar Jahre älter als sie selbst und sitzt trotzdem da wie ein hilfloses Kind.
»Schön, Sie zu sehen, Frau Holl. Weniger schön, dass ich Sie vorladen musste. Sie hätten freiwillig zum Klärungsgespräch kommen sollen. Jetzt ist es eine Anhörung, und ich muss Sie über Ihre Rechte belehren. Nach Paragraph 50 Gesundheitsprozessordnung haben Sie das Recht zu schweigen. Aber ich gehe fest davon aus, dass wir uns unterhalten wollen. So ist es doch?«
Auch Sophie kann gucken wie ein Kind, und zwar wie eines, das sich versöhnen will. Vor diesem Blick können Beschuldigte gar nicht anders, als zu nicken. Das gilt auch für Mia.
»Gut«, lächelt Sophie. »Dann erzählen Sie mal, Frau Holl. Was verbinden Sie mit dem Begriff Gesundheit?«
»Der Mensch«, sagt Mia zu ihren Fingerspitzen, »ist verblüffend unpraktisch konstruiert. Im Gegensatz zum Menschen lässt sich jede Saftpresse aufklappen und in ihre Einzelteile zerlegen. Säubern, reparieren und wieder zusammenbauen.«
»Dann verstehen Sie, warum sich die öffentliche Vorsorge nicht um Saftpressen, sondern um Menschen bemüht?«
»Ja, Euer Ehren.«
»Wie kommt es dann, dass Sie sich seit Wochen sämtlichen obligatorischen Kontrollen entziehen?«
»Es tut mir leid«, sagt Mia. »In gewisser Weise.«
»In gewisser Weise?« Sophie lehnt sich zurück und zupft ihren Pferdeschwanz zurecht. »Frau Holl, Sie werden sich nicht an mich erinnern, aber ich kenne Sie. Ich war Berichterstatterin im Prozess gegen … ich meine, wegen Moritz Holl. Die Details der Angelegenheit sind mir vertraut. Ich weiß, was Sie durchmachen.«
Eine Weile sieht Mia der Richterin starr in die Augen, dann senkt sie den Blick.
»Was passiert ist, lässt sich nicht ungeschehen machen«, sagt Sophie. »Aber die Gesundheitsordnung bietet eine Reihe von Möglichkeiten, Ihnen zu helfen. Ich kann Ihnen einen medizinischen Betreuer bestellen. Auch ein Kuraufenthalt wäre denkbar. Wir können einen schönen Ort aussuchen, in den Bergen oder am Meer. Man wird Sie dabei unterstützen, mit Ihrer Lage fertig zu werden. Anschließend werden Sie bei der Wiedereingliederung in Beruf und Alltag …«
»Nein, danke«, sagt Mia.
»Was soll das heißen – nein, danke?«
Mia schweigt. Die Richterin hat sich geirrt, als sie glaubte, dass die Beschuldigte sich nicht an sie erinnern könne. Mias Gedächtnis zeigt Sophie als eine von vielen schwarz gekleideten Puppen in den Kulissen einer Geisterbahn, ganz hinten im Windschatten des Schwurgerichts sitzend, halb verborgen vom vorsitzenden Richter, den Beisitzern und Protokollanten. Hübsch, jung, blond bezopft und gerade deshalb eine perfekte Horrorvision, wie sie mit großen Augen und betroffener Miene auf den Angeklagten herabsieht, der seine ehemalige Körpergröße eingebüßt hat und eingefallen vor den schwarzen Puppen kauert. Die Blonde ist eine Gute, hat Moritz gesagt. Die will nichts Böses. Wahrscheinlich wollen sie alle nichts Böses. Wie würdest du entscheiden, gerade du, wenn du da oben säßest und ich nicht dein Bruder wäre?
»Frau Holl«, sagt Sophie und rümpft ihre niedliche Nase. »Sie sind organisch völlig gesund. Aber Ihre Seele leidet. Sind wir uns insoweit einig?«
»Ja.«
»Warum wollen Sie sich dann nicht helfen lassen?«
»Ich hielt meinen Schmerz für eine Privatangelegenheit.«
»Privatangelegenheit?«, fragt Sophie erstaunt.
»Hören Sie.«
Plötzlich greift Mia nach der Hand der Richterin, was einen Regelverstoß darstellt. Sophie zuckt zusammen und sieht sich um, bevor sie der Beschuldigten zögernd ihre Finger überlässt.
»Niemand«, sagt Mia, »kann nachvollziehen, was ich durchmache. Nicht einmal ich selbst. Wäre ich ein Hund – ich würde mich ankläffen, damit ich nicht näher komme.«
Nicht dafür gemacht, verstanden zu werden
Mias Stimme ist leise geworden, weil sie weiß, dass Sätze wie der vom kläffenden Hund nicht dafür gemacht sind, verstanden zu werden. Was sie eigentlich ausdrücken will, lässt sich schwer in Worte fassen, und angesichts der Gegenwart einer Richterin ist es gut, dass sie es nicht weiter probiert. Wenn wir es an Mias Stelle versuchen wollten, müssten wir uns ausmalen, wie sie bei Nacht die Decke vom Körper strampelt und aufsteht. Draußen verwässert erstes Morgenlicht das satte Nachtschwarz des Himmels. Es ist der Moment, in dem Gestern zu Morgen wird und es für eine kurze Zeit kein Heute gibt. Jener Moment, den alle Schlaflosen fürchten. Mia steckt in der eigenen Haut wie in einem Fangnetz. Auch im Gesicht ist es ihr zu eng geworden; mit den Fingerspitzen ertastet sie eine Miene, die sie nicht wiedererkennt, ein hässliches halbes Grinsen, nur ein Mundwinkel nach oben gezogen, es gehört nicht zu ihr.
Als sie das Schlafzimmer verlässt, bleibt sie kurz mit der Schulter am Türrahmen hängen. Wir sehen sie den Flur durchqueren und das Wohnzimmer betreten, mit der Fernbedienung die Musikanlage in Gang setzen und die Lautstärke hochfahren. Wir hören ihren Schrei nicht, sehen nur den geöffneten Mund und wie Mia stolpert, dass wir schon meinen, sie müsste stürzen. Stattdessen läuft sie zum Fenster, lässt die erhobenen Hände mit Wucht gegen die Scheibe fallen, prallt zurück und nimmt erneut Anlauf, schlägt beide Handflächen gegen das Glas. Die Musik ist so laut, dass wir auch das Splittern des Fensters nicht hören. Vom eigenen Schwung vorangetrieben, fährt Mia mit beiden Armen durch die brechende Scheibe, greift ins Leere, kippt nach vorn und hat sich gefangen, bevor ihre Brust die aufragenden Glaszacken berührt, die noch im Rahmen stecken. Sie greift in die Splitter und ballt die Fäuste, mit geschlossenen Augen, wir sehen ihre Lippen zittern und wie sie den Blick unter geschlossenen Lidern nach oben richtet. Wir sehen ihre Fingerknöchel weiß werden und das Blut zwischen den Fingern hervorrinnen, als zerdrücke sie etwas Weiches, Rotes in den Fäusten. Dann öffnet sie die Hände, schüttelt beide Arme, ein paar Glassplitter fallen zu Boden. Das Blut läuft zu den Ellbogen hinunter, als sie die aneinandergelegten Hände hebt. »Nehmt es von mir«, lesen wir von ihren Lippen, »nehmt es doch von mir!«, und sie stöhnt, als gehe es um eine gewaltige Last, die wir ihr abnehmen sollen. Immer wieder hebt sie bittend die Hände, und für eine Schrecksekunde könnten wir tatsächlich glauben, sie spräche zu uns.
Wenn wir uns nun noch vorstellen, dass Mia sich in dieser und in allen ähnlichen Nächten eben nicht von der Decke frei strampelt, nicht aufsteht und ans Fenster tritt, kein Glas zerschlägt, sondern einfach liegen bleibt, schlaflos in der Haltung einer Schlafenden – dann wissen wir in etwa, was sie durchmacht.
Privatangelegenheit
F