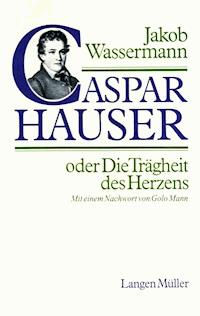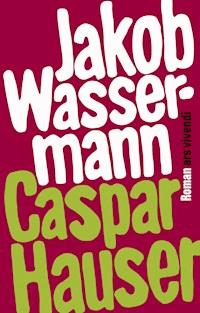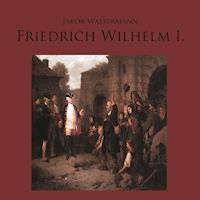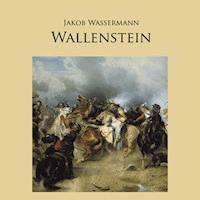Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Antiquitätenhändler Mylius hält seine Familie in Schach. Bloß keine unnötigen Ausgaben für irgendwelchen Firlefanz. Alles duckt sich vor seinen Wutausbrüchen. Aber Christine Mylius, die stumm die tyrannische Herrschaft ihres Mannes erträgt, hat doch heimlich eine Ausnahme gemacht. Sie überrascht ihre jüngste Tochter Josephe, ihr stilles Lieblingskind, mit einer Karte für "Hoffmanns Erzählungen". Beinahe wäre alles gutgegangen, aber plötzlich bricht Feuer im Ringtheater aus. Mit Todesängsten läuft Frau Mylius zum Theater und findet ihre Tochter in den Armen einer jungen Frau. Ulrike Woytich kümmert sich rührend um das Mädchen. Auch in den nächsten Tagen kommt sie zu Besuch und wird schnell zum geschätzten Gast der Familie. Doch hinter ihrer Anteilnahme steckt ein eiskalter Plan. Unbemerkt erschleicht sie sich erst das Vertrauen und dann absolute Macht über die Familie. Bald, nach ihrem Einzug, hat sie auch den alten Mylius in der Hand. Ihr Aufstieg und der Untergang der Familie beginnen.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 742
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jakob Wassermann
Ulrike Woytich
Roman
Saga
Ebook-Kolophon
Jakob Wassermann: Ulrike Woytich. © 1923 Jakob Wassermann. Originaltitel: Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2015 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen 2015. All rights reserved.
ISBN: 9788711488355
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com - a part of Egmont, www.egmont.com.
Zum Dritten Wendekreis
Die von den Jahren 1870 und 1920 umschlossene Geschichtsepoche bietet ein ungeheures Gemälde deutschen Daseins und bürgerlicher Welt. Aufstieg und Fall, Glück und Zerstörung, Verwirrung und Schuld, Sieg, Übermut und Niederlage. Das Auge ist erschreckt von der Verschlungenheit und Breite des Geschehens, und die Hand, die es formen will, erschlafft mutlos, denn welche Figur immer sie zu greifen, welches Gesicht immer sie sich anschickt festzuhalten, es bleibt beim Einzelnen und Zufälligen. Das gültige Zeugnis, der aufschliessende Sinn des Verlaufes scheint hier wie nirgends in den Zusammenhängen zu liegen, eben in der Wirrsäligkeit der Schicksale und gedrängten Vielfältigkeit der Bilder.
Vielleicht zu keiner Zeit sind Menschen so wissend und zugleich so ahnungslos, so zweckbeladen und so entherzt, so von Täuschungen umgittert und ohne Stern den Lebensweg entlang gerast wie die zwei oder drei Generationen dieses halben Jahrhunderts. Es ist, als stürmten sie mit Anspannung aller Nerven- und Geisteskraft, in erbittertem Wettlauf steil gegen einen Gipfel hinauf, und oben, von der wütenden Bewegung weitergetrieben, obgleich sie den tödlichen Abgrund vor den Füssen erblicken, gibt es kein Halten mehr: die Vordersten schaudern noch, die entfesselte Menge hinter ihnen hört nicht einmal den Angst- und Warnungsschrei, und alles stürzt in die Tiefe.
Wer zurückschaut von den Überlebenden, dem erstarrt das Blut in den Adern. Noch bindet ihn die Nähe, das Echo zittert noch, aus dem Todeskessel steigen Seufzer auf, er will die Fügung ergründen, um jeden Preis, er möchte seine unsterbliche Seele hingeben für einen Augenblick der Erleuchtung, es ist wie ein flehendes Hinauflangen zu Gott, seine Lippen flüstern das ewige unbeantwortbare Warum.
Der Chronist, über seinen Dokumenten grübelnd und entschlossen sich demütig zu beugen vor der Unerforschlichkeit der Rätsel, die die Gesamtheit der menschlichen Dinge darbietet, um so einschüchternder, wenn sie in seinen Tag und seine Gegenwart spielen und er den Leidensweg selbst gegangen ist, auf den er den besinnenden Blick zurückwendet, glaubte sich durch eine Erscheinung von jener deutenden Art begnadet. Es erschien ihm eine Gestalt, in der er etwas wie einen Kronzeugen sah oder spürte. Sie zog ihn an und er folgte ihr besessen; zuerst nur trüber Schatten, kaum unterschieden von Tausenden, gewöhnlich, niedrig, dumpf und höchst erdenhaft, strahlte sie plötzlich in einer Glut, die die ganze Sphäre erhellte, den Gang der Begebenheiten verständlich und geheime Verkettungen offenbar machte. Sie selbst erklärte nichts; das ist nicht die Art solcher Gebilde; sie verharren auch als weisende Geister in ihrem einmal für immer angewiesenen Lebenskreis; sie entfalten sich nur durch ihr Tun und Sein.
Ein Seltsames lag in der Verkündigung dadurch, dass es ein zweigeteilter Spiegel war, in dem sie dem Beschauer sich und ihr Schicksal und ihre Zeit und ihre Welt zeigte; im einen Spiegelteil die Jugend, im andern unvermittelt und ohne Zwischenbilder das Alter. Eine Brücke in der Finsternis verband die beiden; dreieinhalb Jahrzehnte waren wie ein Hauch; dieselbe Sonne stand noch am Himmel, derselbe Leib wandelte noch, aber das Geschick erfüllte sich.
Erster teil
Ulrike tritt auf den Plan
Der grosse Brand des Ringtheaters in der Dezembernacht des Jahres 1881 erschien vielen Bewohnern Wiens als ein düsteres Menetekel. Es mangelte nicht an Propheten, die das Ereignis als Vorspiel weit unheilvollerer Katastrophen betrachteten, und Wochen hindurch herrschte in der ganzen Stadt und in allen Schichten der Bevölkerung eine traurige, ja schuldbewusste Verzagtheit.
Nur mit Mühe war es Frau Christine Mylius gelungen, für die Erstaufführung von Hoffmanns Erzählungen ein Sperrsitzbillett zu bekommen. Auf alle ihre Erkundigungen hatte es geheissen, der Andrang sei so stürmisch, dass hunderte von Bewerbern abgewiesen werden müssten. Da es sich aber um eine Überraschung und ein Geburtstagsgeschenk für ihre Tochter Josephe handelte, den ersten Theaterbesuch der nun Fünfzehnjährigen, hatte sie weder Gänge noch Unkosten gescheut und wirklich hatte ihr am Morgen des unglücklichen Tages der beauftragte Zwischenhändler eine Karte gebracht, um sie ihr unter wichtigtuerischen Berichten und wortreichen Klagen über die Schwierigkeit der Beschaffung zu einem frech übertriebenen Preis zu verkaufen.
Christine hatte ihre Anstalten heimlich und allein betreiben müssen, denn nicht bloss Josephe sollten sie verborgen bleiben, da es doch ein Unerwartetes für sie sein sollte, sondern auch der Vater, die beiden älteren Schwestern und der Bruder durften es zunächst nicht erfahren; ersterer, weil er solche verschwenderischen Ausgaben nicht mit günstigen Augen betrachtete; die Geschwister, weil sie der von der Mutter bevorzugten Josephe gegenüber von eifersüchtigen Regungen nie frei waren und durch stumme Unzufriedenheit Christine das Vergnügen des Schenkens leicht hätten trüben können.
Ungewiss war freilich, ob sich Josephe freuen würde. Das in sich gezogene Wesen des Mädchens, seine scheue Abseitigkeit und Menschenflucht liessen befürchten, dass ein festlicher Theaterabend gar nicht im Bereich seines Wünschens lag, ja dass es eher zu meiden als zu erlangen suchte, was andern Genuss und Erholung war. Eben deshalb war aber Christine auf ihren Plan verfallen; sie wollte das Kind, für einige Stunden wenigstens, aus der gewohnten Umgebung entfernen, damit sich sein Gemüt aufhelle und sein Geist beschwingter werde. Nur gegen sie allein war Josephe aufgeschlossen; gegen alle andern verhielt sie sich schweigsam und vorsichtig abwartend.
Doch wurde sie angenehm enttäuscht. Als nach Tisch der Vater fortgegangen war, Esther und Aimée ihr Zimmer aufgesucht hatten, der siebzehnjährige Lothar von seinem Freund und Mitschüler Robert Elmenreich, der im selben Haus wohnte, zum gemeinsamen Weg ins Gymnasium abgeholt worden war, nahm sie Josephe bei der Hand, führte sie zu einer Konsole zwischen den Fenstern, auf der ein eichenes Kästchen stand, und gebot ihr, den Deckel zu öffnen. Das tat Josephe; im Kästchen lag ein Briefumschlag mit der Aufschrift: Zu Josephes Geburtstag, das Kuvert enthielt die Theaterkarte. Josephe lächelte glücklich; sogar die Augen unter den dichten Brauen lächelten; sie küsste die Hand der Mutter.
„Freust du dich?“ fragte Christine.
„Ja, ich freue mich sehr“, war die Antwort.
Christine empfahl ihr Schweigen. Das Geheimnis sollte bis zum Abend gewahrt bleiben; bei Tisch, wenn Josephe im Theater war, wollte sie es den andern mitteilen, da waren keine Einwände mehr zu befürchten. Lothar würde sie um zehn Uhr vom Theater abholen, hingehen könne sie allein. Gegen sechs begann sie sich im Zimmer der Mutter, damit die Schwestern nicht unversehens dazukommen könnten, zu frisieren und umzukleiden. Christine half ihr, zog die Falten und Bänder des neuen weissen Kleides zurecht, das auch ein Geschenk zum heutigen Tag war, und eins, zu dem Christine ihren Mann mit herzlicher Plage überredet hatte, nähte noch an einem Saum, wischte die seidenen Schuhe ab, strich den Sammetmantel glatt, musterte die plötzlich hübsch Gewordene, Errötende abermals, versicherte sich, dass in den Nebenzimmern kein Lauscher und Spion war, und entliess Josephe sodann mit einem zärtlichen Kuss auf die Stirn.
Ein paar Minuten nach halb acht, niemand war zu Hause, sie sass im Wohnzimmer bei der Lampe und stickte auf ein im Rahmen befestigtes Linnentaschentuch die Namensinitialen ihres Mannes, H. O. M., Helmut Otto Mylius, da hörte sie den Schall der Feuertrompete auf der Strasse. Widriger Ton; sie hob den Kopf und runzelte die Stirn. Rasche Pferdehufe knatterten über das Pflaster, Räder rollten eilig; sie stand auf und trat ans Fenster. Spritzenwagen rasten vorbei, um die wehenden Lichterbüschel der Fackeln funkelten die Helme der Feuerwehrleute, Menschen gestikulierten erregt und rannten in die Richtung, in welcher die Wagen fuhren. Auf einmal wurde die Tür aufgerissen, die Magd stürzte herein und rief: „Das Ringtheater brennt.“
Wie sie in den Mantel geschlüpft war, den Schal über den Kopf gezogen hatte, die Treppen heruntergekommen war, wusste Christine nicht; auch nicht, durch was für Gassen sie lief, ob sie im Vorüberhasten Leute fragte und was die antworteten. In der Nähe des Ringes angelangt, drängte sie sich mit den Zeichen des äussersten Entsetzens durch die bereits dicht gestaute Menge, deren erschrocken-bleiche Gesichter von den aus den Fenstern des Gebäudes brechenden Flammen grell bestrahlt wurden. Ihre Züge waren zerrissen, ihre Augen sinnlos, das Haar flatterte um die Stirn, die Kraft, mit der sie sich durch den Menschenblock schob und die ihr den Weg Versperrenden zur Seite stiess, war die einer Irren, verworrenes Gestammel, atemlose Seufzer kamen von ihren Lippen: „Um Gottes willen, ihr Leute, um Gottes-Christi willen, gute Menschen, lasst mich durch, meine Tochter, erbarmt euch, meine Tochter.“ So flehte sie, röchelte sie, schuf sich Bahn, fühlte, dass ihr der Mantel abgestreift wurde, dass das Kleid an den Ärmeln riss, der Rocksaum weggetreten wurde, zwängte sich mit entfesselter Energie zu einer der Nebenpforten des Theaters hin, aus der wurmig und übelriechend schwarzer Rauch quoll, indes links und rechts Leichen getragen wurden, Erstickte, Verkohlte, Ohnmächtige, und sich über die Treppe innen schreiende, jammernde, ineinandergekeilte, aneinandergekrampfte Körper wälzten.
Verstört starrte sie um sich; das Bewusstsein wollte schwinden; die Hitze versengte die Haut; der Qualm vermauerte den Blick; plötzlich stiess sie einen gellenden Schrei aus: Josephe! Wie eine Erscheinung war das Gesicht des Kindes vor ihr aufgetaucht und wieder verschwunden. Aber Josephe hatte den Ruf gehört; sie hob die Arme; sie wurde von einer jungen Person halb getragen, halb geschleppt; ihr Kopf lag mit geschlossenen Augen auf deren Schulter; Christine zerteilte, mit Wut fast, den Menschenstrom, der sich in der Sekunde wieder um sie gebildet hatte, folgte, ungewiss, ob sie weinen oder jubeln sollte, den aufgehobenen Armen, hatte dann das Kind umfasst, das ihr schluchzend an die Brust fiel, umklammerte leidenschaftlich mit den Fingern das geliebte Haupt, und so wurden sie von Vorwärtsstürmenden, panisch Flüchtenden aus dem Kreis gedreht, hatten wieder Raum und Luft, und die junge Person, der, wie sich bald herausstellte, Josephe ihre Rettung zu verdanken hatte, erbot sich, einen Wagen zu besorgen. Der Himmel glühte purpurn, die Atmosphäre war wie ein schwarzes Antlitz von einem beweglichen Funkenschleier verhängt.
Josephes Gewand hing in Fetzen, auch die Unterkleider waren nicht verschont geblieben; ein weiter Riss klaffte vom Hals bis zur Hüfte und liess die weisse Haut des Busens durchschimmern. Den Mantel hatte sie eingebüsst, und um sich gegen die Kälte zu schützen, presste sie die klaffenden Stoffenden an den Körper. Die Retterin hatte sich entfernt und ihnen eingeschärft, an derselben Stelle zu warten, bis sie den Wagen brächte; erschöpft und schaudernd schmiegte sich Josephe an die Mutter. Diese hatte sich gegen die Mauer eines Hauses gelehnt, gleichfalls schaudernd, streichelte ihr die Wangen und flüsterte wirre Zärtlichkeiten. Nach Verlauf einer Viertelstunde hielt ein Fiaker am Trottoir, die junge Person sprang flink heraus, bedeutete den beiden, dass sie einsteigen möchten, liess sich vom Kutscher Decken reichen, umhüllte ihnen die Beine und fragte, ob sie sie nach Hause begleiten dürfe, sie tue es gern und sei durch nichts behindert. Josephe berichtete nun in Hast, wie das Fräulein sie im ärgsten Tumult auf der Treppe, als sie schon keinen Atem mehr gehabt und nahe daran gewesen, niederzusinken und zerstampft zu werden, umschlungen, vor den grässlich drängenden schreienden und brüllenden Männern und Weibern beschützt und mit unbegreiflicher Kraft und Geschicklichkeit zum Ausgang gezerrt habe; ohne ihre Hilfe wäre sie verloren gewesen.
Christine, der Rede nicht mächtig, fasste nach den Händen der Retterin und drückte sie innig. In ihrem Blick lag die stumme Bitte und Aufforderung, dass sie mitkommen möge, und überschwenglicher Dank. Während der Fahrt stammelte sie: „Eine solche Schuld lässt sich ja im Leben nicht begleichen“, und da die Unbekannte, die schlank und ruhig ihr gegenübersass, wunderlicherweise fast ohne jede äussere Beschädigung, ohne merkliche Erregung auch, bescheiden abwehrte, fragte sie sie um den Namen. Sie nannte ihn; sie heisse Ulrike Woytich, sagte sie, sei erst seit kurzer Zeit hier und wohne bei ihrem Onkel, dem pensionierten Hofrat Klemens Woytich. Das alles kam rasch und beiläufig von ihren Lippen, als seien ihre persönlichen Verhältnisse nicht vom mindesten Belang. Um auch gleich davon abzulenken, erkundigte sie sich, ob die gnädige Frau aus dem Reich sei, und als Christine bejahte, nickte sie befriedigt und sagte, man höre es am Dialekt, liess auch den Einwand, dass die Familie bereits zwanzig Jahre in der Stadt ansässig sei, nicht gelten und behauptete, dergleichen Eigentümlichkeit bleibe unter allen Umständen haften, und ihr Ohr sei durch einen Aufenthalt im Ausland dafür geschärft; sie habe zwei Jahre in England und ein Jahr in Belgien zugebracht.
Sie erzählte nun, dass sie vor Beginn des Stückes von der ersten Galeriereihe aus mit dem Opernglas die Leute im Parkett gemustert habe, und da sei ihr unter allen Gesichtern dasjenige Josephes aufgefallen; deshalb sei es ihr wie eine Fügung erschienen, als sie das Fräulein dann auf der engen Treppe unter der gefährlichen Menschenlawine erblickt, und der Entschluss, ihr beizustehen, sei ganz instinktiv gewesen. „Sie haben aber doch einige Minuten, bevor überhaupt jemand im Theater eine Ahnung von dem Unglück hatte, Ihren Platz verlassen?“ wandte sie sich an Josephe, „warum denn?“ Diese musste es bestätigen und wunderte sich, ebenso wie ihre Mutter, über den Zufall, dass Ulrike Woytich von Anfang an ihr Augenmerk so bestimmt auf sie gerichtet hatte. Sie sagte, sie sei jählings von einem unerträglichen Herzklopfen befallen worden, derart wie sie es noch nie verspürt. Das Orchester hatte eben begonnen zu spielen, aber die verführerischen Klänge der Offenbachschen Musik konnten sie durchaus nicht beruhigen, im Gegenteil, sie fürchtete die Besinnung zu verlieren, und so eilte sie, so schnell sie es vermochte, in den Wandelgang hinaus. Während sie dort auf und ab ging, vernahm sie auf einmal ein Geräusch wie wenn ein Kieselsteinregen auf ein Glasdach schmettert. Im Nu brachen aus allen Türen schreiende Menschen, im Nu war sie mitten unter ihnen, aber wäre das Herzklopfen nicht gewesen, so wäre sie im Zuschauerraum zermalmt worden, denn drinnen, unter den Rasenden eingepfercht, hätte es für sie kein Entrinnen gegeben.
„So hast du also einen guten Engel in dir und einen ausser dir gehabt,“ sagte Christine; „es ist wunderbar, Josephe, bei all dem Schrecklichen sonst.“
Josephe lächelte etwas beengt und sah Fräulein Woytich unablässig mit gross aufmerksamen Augen an.
Der Wagen hielt am Hause. In Christine war eine Fülle von Besorgnissen entstanden. Zuvörderst hatte sie kein Geld bei sich, um die Fahrt zu bezahlen; der Kutscher würde gewiss nicht mässig in seiner Forderung sein und wie immer bei solchen Gelegenheiten seine Dienste mit dem öffentlichen Unglück multiplizieren. Sie wusste nicht einmal, ob sie die notwendige Summe oben im Schrank hatte; Helmut Otto war ihr noch das Wochengeld schuldig; er gab immer im letzten Augenblick; sie musste ihn demnach um die fünf oder sechs Gulden bitten, was eine missliche Sache war. Ausserdem war es ungewiss, ob er schon zu Hause war. Sie schaute hinauf; im Wohnzimmer war Licht, aber es brannte wahrscheinlich seit ihrem Fortgehen noch; alle Leute waren zum Feuer geeilt, in den Strassen im Umkreis standen sie Kopf an Kopf; es war anzunehmen, dass auch er hingegangen war. Schlimmer noch, wenn er oben wartete; dann musste sie ihm in der Bedrängnis und Hast gestehen, dass Josephe im Theater gewesen war; Fragen, Erörterungen, Vorwürfe waren zu gewärtigen, wenn sie das Geld für den Wagen verlangte; die ewige, jetzt durch die Sorge um Josephe vermehrte Bemühung, solche Szenen vor den Kindern zu verbergen. In Josephes blassem Gesicht zuckte die innere Erregung unverkennbar, so dass es am besten schien, sie gleich zu Bett zu bringen und jedes Zusammensein mit Vater und Geschwistern zu verhindern.
Indem sie dies alles überdachte und vor dem Wagen stehend beklommen in das beleuchtete Haustor schaute, erriet Ulrike Woytich ihre Verlegenheit und verschaffte sich durch drei, vier geschickte Fragen Aufschluss. Sie zog ihre Börse, kramte mit komisch geschäftigen Fingern darin, und es erwies sich, dass sie gerade soviel Geld bei sich hatte, um den Kutscher entlohnen zu können. Sodann hob sie Josephe von ihrem Sitz, umfasste sie, führte sie ins Haus und bestätigte Christines Angst, indem sie sie bat, voranzugehen und Anstalten zu treffen, dass Josephe ohne Störung und Aufenthalt zur Ruhe gebracht würde; sie habe heisse Hände und scheine zu fiebern.
Christine lief die Stiegen hinauf und Ulrike Woytich folgte mit Josephe langsam nach. Unterwegs schaute sie sich alles interessiert an, das Geländer, den Flur, die Mauern, die Türen und achtete trotzdem sorgfältig auf ihren Schützling. Mylius war zu Hause. Er wusste bereits alles, als Ulrike mit Josephe oben ankam. Christine war nicht die Frau, die eine ihr drohende Unannehmlichkeit hinausschieben konnte, schon gar in der Verfassung nicht, in der sie war. Sie hatte ihren Mann mit wenigen Worten unterrichtet und ihn auch gleich um das Geld ersucht. Er war nicht bei dem brennenden Theater gewesen, sondern hatte sich an den aufgeregten Erzählungen genügen lassen, die er auf der Gasse gehört; jetzt wartete er seit einer Stunde auf das Abendessen und war wegen der Verzögerung in übler Laune. Christines Mitteilung, die Art, wie sie ins Zimmer stürmte, ihr abgerissener und beschmutzter Anzug bestürzten ihn; zugleich konnte er den Ärger über die Heimlichkeit nicht unterdrücken, durch die Josephes Theaterbesuch ermöglicht worden war. Hieran knüpfte sich der Groll über die Geldausgabe; trotzdem das tyrannische Regiment, das er führte, den Seinen keinerlei freie Bewegung erlaubte, quälte ihn nicht selten das Misstrauen, dass man hinter seinem Rücken allerlei Verschwendung treibe, kleine und unschuldige Verschwendung allerdings, aber doch zu fürchtende, da ja alles Böse eine unscheinbare Wurzel hat.
Als nun Christine das von Ulrike Woytich ausgelegte Fahrgeld forderte, denn dieser Verpflichtung wollte sie sich zunächst entledigen, zauderte er, wand sich, zuckte die Achseln, schüttelte den Kopf, wollte den Betrag zu hoch finden, tauchte aber dann doch, bezwungen durch den verzweifelt flehenden Blick seiner Frau, die Hand in die Rockbrust und holte die Brieftasche hervor. Christine, von Ungeduld übermannt, entriss ihm den Schein mit einem Seufzer, in dem tausend seit Jahren zurückgehaltene Klagen vibrierten, eilte mit ungestümen Schritten in Josephes Zimmer (es hatte sich durch des Mädchens Anlage und das Verhältnis zu den Schwestern so gefügt, dass sie einen Raum allein bewohnte, während jene sich in eine grössere Kammer teilten), rief Therese, die alte Magd, befahl ihr, heisses Wasser zu bereiten, Universalmedizin in ihren Augen, zündete die Lampe an, liess die Vorhänge herab, öffnete das Bett, und als Ulrike und Josephe kamen, half sie der Tochter beim Entkleiden, indes Ulrike, die das Notwendige stets auf den ersten Blick erkannte, vor dem Ofen kniete und Feuer schürte.
Sie war noch damit beschäftigt, als die Tür aufging und Esther und Aimée eintraten. Ängstlich wegen der Verspätung, aber zum Bersten voll von geheimer Freude am aufregenden Geschehen, waren sie, wie auch Lothar, eben nach Hause gekommen. Die Freude steigerte sich zwar, als sie die Erlebnisse der Mutter und Josephes erfuhren, doch zugleich rief es ihren Verdruss hervor, dass Josephe hatte ins Theater gehen dürfen, wobei die Tatsache, dass sie dem Tod um Haaresbreite nah gewesen, auch jetzt noch Anlass zur Besorgnis gab, keinen sonderlichen Eindruck auf sie zu machen schien.
Lothar stand in der offenen Tür, ein verwundertes Lächeln in dem hübschen Knabengesicht. „Wie wars, Josephe?“ fragte er die mit geschlossenen Augen Liegende; „erzähl doch; es muss ja furchtbar interessant gewesen sein.“ Josephe antwortete nicht, Ulrike tat es an ihrer Stelle. „Machen Sie sich lieber nützlich, junger Mann,“ sagte sie kurz angebunden, aber nicht unfreundlich, indem sie sich von den Knien erhob und ihm den leeren Kohleneimer reichte; „gehen Sie in die Küche und füllen Sie mir den Eimer, wir müssen warm bekommen.“ Lothar schaute sie verdutzt an, schüttelte unmutig den Wald kastanienbrauner Locken, der sein Gesicht kokett umrahmte, nahm jedoch unter ihrem funkelnden Blick die Hände aus den Hosentaschen und gehorchte.
Auch Esther und Aimée sahen verwundert diese Fremde an, die so unbefangen und nachdrücklich in Gegenwart der Mutter hantierte und dem Bruder Befehle erteilte. Christine klärte sie mit einigen hastigen Worten auf, die gedrängt von leidenschaftlicher Dankbarkeit waren. Die jungen Mädchen staunten noch mehr. Sie hatten sich beide in die Fensternische geschmiegt, Unzertrennliche aus Gewohnheit und dumpfer Seelenstimmung. Das blasse sommersprossige Gesicht mit den messinggelben Zöpfen der zweiundzwanzigjährigen Esther dicht an dem dunkleren, obwohl ziemlich blutlosen, mit dem geflochtenen, kupfrig schimmernden Kranz um die Stirn der neunzehnjährigen Aimée gab einen Zusammenklang, der Ulrikes Aufmerksamkeit nicht entging und sie neugierig machte. Das gedrückte Wesen, der furchtsame Blick, die frierende Haltung, das eigentümlich Horchende in den Mienen, das alles gab ihr zu denken und zwang ihren raschen Geist zu Kombinationen. Dass sie auf der richtigen Spur war, erwies sich ihr beim Eintritt des Vaters. Beider Gesicht bekam sofort etwas Starres und Untertäniges, das den Ausdruck puppenhaft machte; auch Lothar, der den gefüllten Eimer hereinschleppte und unter überflüssigem Lärm beim Ofen verstaute, zuckte zusammen, als er den Vater im Zimmer gewahrte, und sah auf einmal aus, als könne er nicht bis drei zählen. Gute Zucht jedenfalls, sagte Ulrike zu sich selbst.
Mylius war eine Weile im Korridor auf und ab gegangen. Er wusste nicht recht, wie er sich benehmen sollte; ob das Befinden Josephes ihm erlaubte, wegen des noch immer nicht aufgetragenen Abendessens zu schmälen, oder ob es rätlicher war, sich zu gedulden, bis sich das fremde Fräulein verabschiedet haben würde. Besser dünkte es ihn zu schweigen und so zu tun, als habe er die Mahlzeit bereits hinter sich, da konnte sie keine Erwartung hegen, eingeladen zu werden. Nichts war ihm so verhasst wie Tischgäste. Er trat also ein, zeigte eine teilnehmende Miene, die seinem fahlen glattrasierten und auffallend kleinen Gesicht etwas Sauersüsses verlieh, verbeugte sich gegen Ulrike und reichte ihr mit unverständlichem Murmeln die Hand. Dann ging er zum Bett, blickte stirnrunzelnd auf Josephe nieder und sah fragend seine Frau an.
Christine fand, der Andrang in der engen Kammer sei zu gross; sie trieb alle hinaus und bedeutete ihnen, sie sollten sich einstweilen zu Tisch setzen, sie käme mit Fräulein Woytich später. Mylius räusperte sich; das Gefürchtete war also nicht mehr abzuwenden. Esther und Aimée kannten den Ton und erschraken; sie bewunderten die Kühnheit der Mutter. Als es endlich still war, beugte sich Christine zu Josephe und fragte, ob sie allein sein wolle. Josephe bejahte es, indem sie die Hand der Mutter an die Lippen zog. Da gingen auch Ulrike und Christine hinaus.
Ein Bild wollte nicht aus Josephes Sinnen weichen. Während sie im Wandelgang des Theaters gestanden und die erste Panik der aus dem Zuschauerraum Flüchtenden gegen sie angeprallt war, hatte sie etwas erlebt, das tieferen Eindruck auf sie gemacht hatte als die wüstesten Szenen nachher und ihre eigene Lebensgefahr dazu. Unter den Vordersten, die auf sie losstürmten, weil sie in der Nähe der Ausgangstüre war, befand sich ein Mann, der die Fäuste in die Luft gestreckt hielt, mit weitoffenem, doch nicht schreiendem Mund und vor Angst und Wut verglasten Augen nur danach trachtete, den andern zuvorzukommen; ein Mann mit weissem Bart und weissen Haaren, gut gekleidet, offenbar ein Angehöriger der oberen Stände. Er trug eine goldene Kette auf der schneeweissen Weste und eine Brillantnadel im Schlips. Man sah genau, dass das Gesicht sonst den Ausdruck der Ehrwürdigkeit hatte, dass die Augen gütig und wohlwollend zu blicken pflegten und dass ihm eine ruhige, imponierende Haltung eigen war. Davon war keine Spur mehr vorhanden. Statt dessen die raubtierartige Gier, allen zuvorzukommen, ein offener, verzerrter, von gelben Zahnstümpfen besetzter Mund, die aufgerissenen Augen eines Tollen, die gebogenen Entsetzensrunen auf der Stirn. Und diese Wut, diese unbegreifliche Wut, als hätte er die, die mit ihm im Laufe wetteiferten, mit den Fäusten niederschmettern mögen. Alles das vermochte Josephe noch mitzufühlen, bedauernd zwar und wie von einer Ferne; aber nun geschah es, dass er den Weg zur Treppe durch die sich stauenden Körper gänzlich verrammelt fand, dass er in seiner rasenden Angst die Brieftasche herausriss, einen Pack Geldnoten mit zitternden Fingern ergriff und im hochemporgereckten Arm nach allen Seiten hin mit schmeichelnden, winselnden Würgetönen anbot. Das war das Grässliche; Geld in diesem Augenblick! Es dünkte Josephe furchtbarer als alles andere, ein Äusserstes von Makel und Verworfenheit, neben dem die physische Not, die sie selbst bedrohte, kaum mehr in Betracht kam. Die siebzig Jahre, die der Greis vielleicht zählte, wurden zur Lüge in Josephes Augen; weisses Haar und die Würde, die es gab, Lüge; Freundlichkeit und Lächeln Lüge. Geld, wo eine Menschheit in Qual verging! Dass einer denken konnte, sich vom allgemeinen Jammer mit seinem Gelde loszukaufen! Es war die Hölle. Sie erinnerte sich, dass sie sich unter der Wucht dieses Bildes gegen den Gedanken an Rettung aufgelehnt und sich, mitten im Grauen kalt und schmerzlich besonnen, gesagt hatte: wozu soll mir noch das Leben dienen, wenn ein alter Mann im weissen Bart zum leibhaftigen Satan wird, nur um es zu behalten?
Die Trauer darüber verging nicht. Ihr war, als habe sie zu tief in den Abgrund des Lebens geschaut und könne nun nicht mehr ganz froh werden. Ein Zug von Gestalten wandelte in der Luft und alle schleppten sich leidvoll mit schweren Packen Geldes; Fahnen hingen starr, die aus riesigen Geldscheinen bestanden; die Blätter an den Bäumen klapperten wie Münzen; die Tapeten an der Wand sahen aus wie schmutzige Zehnguldennoten. Indem sie sich aus diesen Vorstellungen zu lösen und in der Finsternis der Seele ein Gebet zu formen suchte, öffnete sich lautlos die Tür und das heitere, jugendliche, wohlgebildete Gesicht ihrer Retterin zeigte sich. Ulrike wollte sich vergewissern, ob sie schlief oder einen Wunsch habe; sie steckte nur den Kopf herein und die glänzenden schwarzen Augen spähten gegen Josephes Lager.
Zuerst erschrak Josephe, und ihr Herz begann noch stärker zu pochen als unter dem Einfluss der peinigenden Fieberbilder; dann aber atmete sie befreit auf und nickte Ulrike Woytich dankbar lächelnd zu. Ulrike näherte sich ihr und hauchte einen schwesterlichen Kuss auf ihre Stirn.
Augen und Ohren, die guten Diener
Als Ulrike wieder ins Esszimmer kam, hatte Herr Mylius eben zu allem übrigen noch erfahren, dass sowohl Christines als auch Josephes Mantel bei dem Unglück in Verlust geraten seien. Da konnte er nicht mehr an sich halten und brach ungeachtet der Anwesenheit des fremden Gastes in lebhafte Verwünschungen des Leichtsinns aus, dessen sich Christine schuldig gemacht. Er erhob sich, warf die Serviette auf den Stuhl und seine kleinen farblosen Augen blitzten erbost.
Mit schriller Stimme stellte er die Frage, ob man glaube, dass er Millionär sei? Stumm ergebene Blicke; niemand war so verwegen, es zu glauben. Ob man der Meinung sei, dass er sein Geld auf dem Strassenpflaster finde oder in der Lotterie gewinne? Niemand war dieser Meinung. Ermahne er nicht zur Sparsamkeit Tag für Tag; drehe er nicht, wenn sichs um seine Person handle, jeden Kreuzer zehnmal um und bedenke, ob es wirklich unerlässlich sei, ihn auszugeben? Es konnte nicht geleugnet werden, das allgemeine Schweigen bestätigte es. Sei das Leben etwa so leicht zu verdienen? erarbeite sich so mir nichts dir nichts, was sechs Menschen und leider auch noch ein dienstbarer Geist an Kost, Wohnung und Kleidung beanspruchten? Gewiss nicht, man sah es sündenbeladen ein. Drei erwachsene Töchter! Wohin mit ihnen? Wer werde sie ausstatten? Welcher verrückte Idealist werde sich herbeilassen, sie ohne Mitgift zu heiraten? Denn er könne ihnen keine geben, er nicht, soweit habe ers noch nicht gebracht und werde es voraussichtlich kaum bringen. Esther und Aimée senkten traurig die Köpfe; sie begriffen die Hoffnungslosigkeit ihrer Lage. Ein Sohn, der den Ernst des Lebens durchaus noch nicht erfasst habe und dem die Lehrer das schlechteste Prognostikon stellten: wieviel geschlagene Jahre werde er dem Vater noch zur Last fallen? Lothar blickte ratlos in die trübe Zukunft und schwor sich Besserung.
Da das harte Strafgericht ohne ein Zeichen des Widerspruchs oder der Auflehnung hingenommen wurde, legte sich Mylius’ Entrüstung allmählich. Er sei für alle und für alles verantwortlich, fügte er resümierend hinzu, er müsse es schaffen und sich plagen und müsse daher auf die geringe Erkenntlichkeit rechnen, dass man der Verschwendungslust nicht die Zügel schiessen lasse. Hierbei traf ein strenger Blick Christine. Das heutige Ereignis sei ein Fingerzeig des Schicksals. Gott habe sie warnen wollen, den schlimmen Gelüsten nicht nachzugeben; man möge sichs für künftige Fälle merken.
So predigend stapfte er mit seinen kurzen Beinen um den Tisch herum. Christine bat ihn sanft, sich zu beruhigen und zu setzen, das Fleisch auf seinem Teller werde kalt. (Er allein hatte Fleisch, für die übrigen war nur Gemüse gekocht.) Das Geschehene sei als eine Ausnahme zu betrachten, und sie verspreche, dass es nicht mehr vorkommen solle. Sie war bleich geworden und ihre Finger glitten nervös an der Kette des Schlüsselbundes entlang. Dass sie mit ihren mehr als fünfzig Jahren, als Mutter von vier Kindern und angesichts der Kinder, angesichts auch einer Fremden, die ein höchst begründetes Recht auf Rücksicht hatte, sich musste abkanzeln lassen wie ein Schulmädchen, war bitter. Sie empfand es zum erstenmal mit solcher Bitterkeit; vielleicht der Fremden wegen. Aber es musste ertragen werden; Abwehr hätte den unerquicklichen Hader nur verlängert. Niemals hatte sie sich verteidigt, niemals hatte sie aufgemuckt, niemals in den Kindern, durch Blick, Miene oder Stirnrunzeln nur, die bedingungslose Ehrfurcht, den schweigenden Gehorsam gegen den Vater zu ihren eigenen Gunsten zu beeinflussen versucht.
Indessen schien es, als erinnere sich Mylius der Gegenwart Ulrike Woytichs mit einiger Betretenheit. Er hielt in seinem Rundgang neben ihrem Stuhl inne und sagte mit dem sauersüssen Schmunzeln, das sein Gesicht in Momenten annahm, wo er liebenswürdig sein wollte: „Ich bitte um Vergebung, mein sehr geschätztes Fräulein; Sie werden es einem geplagten Familienvater gewiss nicht verübeln, dass er sich in Hitze redet, wo es sich ums Wohl und Wehe der Seinen handelt. Und um Ordnung, um Genauigkeit, um Disziplin und darum, dass nicht gedankenlos verschleudert wird, was er in siebenundzwanzig Fronjahren durch seiner Hände Arbeit erworben hat. Ich bin heute zweiundsechzig, mein verehrtes Kind; mit fünfunddreissig war ich noch ein armer Schlucker in einem hessischen Provinznest, der nie wusste, womit er am nächsten Tag seinen Hunger stillen sollte. Vor Hunger brauchen wir uns heute nicht mehr zu fürchten, aber um die Existenz gehts trotzdem in jeder Stunde, denn es ist eine tückische Zeit, und eh man sich besinnt, hat einen das Verhängnis in der Klaue, die Armut, die Not. So stehen die Dinge.“
„Ich gebe Ihnen ganz recht, Herr Mylius,“ antwortete Ulrike Woytich mit offen zu ihm erhobenem Blick, „wenn ich auch nicht gerade glaube, dass der liebe Gott das Ringtheater nur deswegen hat abbrennen lassen, um Ihre Familie vor Fehltritten zu bewahren. Aber sonst pflicht ich Ihnen von Herzen bei. Mein Onkel, der Hofrat, hat mir schon als Kind eingeschärft, dass nichts am Menschen so verdammlich ist, als wenn er achtlos mit Geld umspringt. Ausgeben, das kann jeder, erwerben, das ist schwer. Und etwas besitzen ist schliesslich doch das beste. Wer nichts besitzt, der mag sich lieber gleich begraben lassen; ein Hund wird mehr ästimiert als er.“
Mylius nickte anerkennend. „So ist es,“ sagte er; „Sie sind nicht auf den Kopf gefallen, mein schönes Fräulein. Etwas besitzen ist das beste. Man kann es nicht bündiger ausdrücken; es klingt wie die Legende auf einem alten Wappen.“ Er kicherte und zündete in erwachender guter Laune eine seiner übelduftenden Zigarren an.
„Die Verschwender wissen sich meistens nicht zu lassen vor Geringschätzung gegen die Sparer,“ fuhr Ulrike eifrig fort, „aber wenns ihnen dann schlecht geht, wenn ihnen das Wasser an den Hals steigt, vor wem kriechen sie, vor wem winseln sie, wem singen sie ihre Elogen, wem versprechen sie das Blaue vom Himmel? Dem verachteten Sparer. Der ist nun der Herr, und sie müssen sich noch für den Fusstritt bedanken, den er ihnen verabreicht.“
„So ist es, so ist es“, sagte Mylius entzückt, und Ulrike lachte.
Esther, Aimée und Lothar hatten sie ängstlich betrachtet, während sie redete. Des Vaters schweres Joch waren sie zu tragen gewohnt; dawider zu murren wäre ihnen vermessen erschienen; es abzuwerfen gab es keine Möglichkeit für sie; auch lag der Gedanke fern; zu befestigt war die Autorität, zu unnahbar die Person, zu mächtig der Wille, der sie seit ihrer Geburt regierte. Dass aber eine Fremde kam, um hinterrücks, ohne Fug und Grund noch an den Riemen zu ziehen, die ihnen die Brust umschnürten, erregte ihr Missfallen und ihre Besorgnis.
Plötzlich aber wurden sie auf etwas Seltsames aufmerksam, und zwar alle drei zugleich, von dem gleichen Instinkt geleitet. Da war ein Klang von freier Überlegenheit, ein Unterton von Spott und Schalkhaftigkeit, der sie veranlasste, genauer hinzuhorchen, genauer in das kluge muntere Gesicht zu schauen. Und sie empfingen einen Antwortblick, der sie erschreckte, weil er Ungeheures zu verheissen schien, einen Blick, der deutlich sagte: ich gehöre zu euch, ich schliesse ein Bündnis mit euch, lasst mich nur machen, ich verstehe diese Sache gründlich und kann euch gründlich helfen.
Ungläubig starrten sie und suchten zu begreifen und schlugen wie geblendet die Augen nieder.
Christine blieb davon unberührt. Sie hatte den schmerzlichen Eindruck, Ulrike sei durch Mylius gegen sie gestimmt worden, und als sie einige Minuten später, von Ulrike mit stummem Wink aufgefordert, mit ihr das Zimmer verliess, um zu Josephe zu gehen, legte sie, kaum dass sich die Tür hinter ihnen geschlossen hatte, ihre Hand auf den Arm des jungen Mädchens und sagte hastig: „Sie werden doch nicht glauben, dass ich leichtfertig bin? Für so eine schlechte Mutter und Hausfrau werden Sie mich doch nicht halten, wie er mich im Zorn hingestellt hat? Es ist ja auch nicht seine wirkliche Meinung, kann ich Sie versichern. Er ist gerecht und über Unbotmässigkeit kann er sich nicht beklagen.“
Ulrike erwiderte leise: „Gnädige Frau, über Sie zu urteilen, steht mir nicht im geringsten zu. Aber vielleicht darf ich Ihnen sagen, dass Sie mir vom ersten Augenblick an eine Sympathie eingeflösst haben wie noch kein weibliches Wesen; ich habe nämlich im allgemeinen für Frauen nicht viel übrig, und dass ich Sie verehre. Ich wünsche mir nichts Lieberes als dass Sie mir erlauben, Sie möglichst oft zu besuchen.“
„Ich danke Ihnen,“ sagte Christine; „das war ein gutes Wort. Gute Worte hör ich selten. Kommen Sie nur. Kommen Sie jeden Tag, so oft Sie können. Ich freue mich darauf.“
Sie gingen ein Stück über den Flur, an dessen Wänden Etageren mit Zinnfiguren angebracht waren. „Etwas müssen Sie gleich erfahren“, begann Christine wieder mit vorsichtig gedämpfter Stimme, „sonst könnten Sie am Ende doch der Ansicht sein, dass Mylius das Opfer seiner Familie ist: so sind die Verhältnisse nicht, wie er sie in seinem Pessimismus schildert, das kann Ihnen jeder Mensch in der Stadt bekräftigen. Sein Antiquitätengeschäft ist in ganz Europa bekannt, H. O. Mylius, erkundigen Sie sich, bei wem Sie wollen. Ich weiss natürlich nicht, ob Vermögen da ist und wieviel; darüber spricht mein Mann nicht mit mir, das geht gegen seine Grundsätze, die ich zu respektieren habe. Ich weiss nicht, ob er grosse Gewinne hat oder nicht, ich frage ihn nicht. Nur soviel weiss ich, dass er mich und die Kinder über das Gebührliche knapp hält. Solche Auftritte wie heute kommen ja selten vor, aber ganz zu vermeiden sind sie nicht. Er kann nicht anders, der arme Mann, es ist stärker als er, und ich sage es Ihnen nur, weil es leider nicht zu verhehlen ist und weil Sie noch manches davon erleben werden, wenn Sie nun trotzdem noch Lust haben sollten, zu uns zu kommen.“
„Das wär noch schöner, wollt ich mich durch so was abschrecken lassen,“ sagte Ulrike mit ihrer tiefen, Zutrauen erweckenden Stimme; „im Gegenteil, mir scheint, ich kann Ihnen da in vieler Beziehung nützlich sein. Erstens bin ich selber nicht auf Eiderdaunen gebettet; zweitens bin ich der geborene Blitzableiter; drittens bin ich entschlossen, für Sie durchs Feuer zu gehen, wenn Sie mich ein bisschen liebhaben wollen.“
Christine griff gerührt nach ihrer Hand, und sie betraten auf Zehen das Zimmer der schlafenden Josephe.
Es hätte der schüchternen Aufklärung Christines nicht bedurft. Ulrike hatte ihre Zeit nicht verloren. Ihre Beobachtungen hatten ihr die Gewissheit verschafft, dass sie sich nicht bei armen Leuten, nicht in einem wirtschaftlich sinkenden Wesen befand. Des Herrn Mylius Standrede konnte sie nicht irreführen; in dem Punkt besass sie untrügliche Witterung.
Zuerst allerdings hatte ihr die Wohnung den Eindruck der Kleinbürgerlichkeit gemacht. Wäre es dabei verblieben, so hätte sie die Flucht ergriffen; Kleinbürgertum war eben das, was sie zu meiden gesonnen war. Da stand und lag alles so eng und so dicht und so gezählt; die Räume dumpf und niedrig; es fehlte Bequemlichkeit, Freiheit, generöse Absicht. Zier und Behänge waren da, weil sie da sein mussten, nicht weil man sie schätzte oder hütete. Etwas Liebloses lastete über den Dingen.
Aber Ulrike sah, dass die Möbel, ohne gerade prunkvoll zu sein, solid und stattlich waren; keine Dutzendstücke, keine Vorstadterzeugnisse; die Teppiche: echtes Material; das Linnen: feinste Qualität; das Tischbesteck: massives Silber; die goldgerahmten Gemälde an den Wänden: Originale von Künstlern und alt. Sie sah da und dort Gegenstände von unbezweifelbarer Kostbarkeit: eine Nippesfigur, eine Bronze, einen Leuchter, eine Kristallschale, eine chinesische Vase. Freilich konnte sie der Alte aus seinem Laden hergeschleppt haben, um sie allenfalls hier feilzubieten und so auf billige Manier zu einer Ausschmückung zu gelangen, die dann wieder wandern musste. Doch den Gedanken verwarf Ulrike; er dünkte ihr nicht vereinbar mit dem Charakter des Mannes; der lieh nicht, auch sich selber nicht; der mogelte nicht; bei dem war alles unverfälscht und an der richtigen Stelle.
Täuschung war kaum möglich: hier war Wohlhabenheit, jene Gediegenheit des Besitzes, die man bei bescheidener äusserer Gebarung nur selten antrifft.
Nichts entging ihrem spähenden Auge, dessen Ausdruck sie jedoch so zu beherrschen wusste, dass niemand seine unermüdliche Wachsamkeit auch nur ahnen konnte. Sie verglich die Dinge mit den Menschen; sie riet den Dingen die Gewohnheiten der Menschen ab, Eigenschaften und Art. Sie betrachtete die beiden stillen jungen Mädchen, denen sie nur wenige Jahre im Alter voraus war; betrachtete sie in ihren unscheinbaren, fast ärmlichen Gewändern und wie geduckt sie waren, wie man spürte, dass sie um ihre gewürgte Jugend trauerten und sich ergeben durch die Tage schleppten ohne die leiseste Regung von Rebellion; den Sohn mit dem Gesicht eines reizenden Galgenstricks, voll Begehrlichkeit und heimlicher Gelüste, während ihn die Furcht vor dem Vater in Bann hielt und auf den vorgeschriebenen Weg zwang; die jüngste mit den glühend-fragenden Augen einer Schwärmerin; die Mutter, zarte, schüchterne Gestalt, beschwichtigend, versöhnend, verschleiernd, vermittelnd zwischen Mann und Kindern, dabei selbst geknechtet, mit einem Schein von Ratlosigkeit in den schönen Augen; zuletzt den Alten mit seinem pfiffigen Schmunzeln, das er sich wahrscheinlich im Beruf angewöhnt hatte, wenn er Käufer und Verkäufer beschwatzte, seinen vogelhaften Kopfbewegungen, seinem Tyrannengebaren und beständigen Gerüstetsein gegen Lebensdrang und Lebenslust und der verräterischen Angst, die dahinter flimmerte.
Mit dem Alten ist etwas los, sagte sich Ulrike kampflustig, der Alte hat ein Geheimnis; von welcher Beschaffenheit es ist, darauf zu kommen wird vielleicht nicht schwer sein, aber es ihm zu entreissen und Nutzen daraus zu ziehen, bedarf der Schlauheit und Geduld. Möglich dass sich die Mühe lohnt, überlegte sie weiter; es wäre ein Ziel für mich, endlich einmal was, das einem Spass machen könnte. Wer weiss, wohin es führt und welche Überraschungen einem da bevorstehen. Offenbar betrügt er die ganze Familie und spielt den armen Teufel nur, um sie nicht merken zu lassen, was für Reichtümer er in alter Stille zusammengescharrt hat; dergleichen wäre ihm wohl zuzutrauen; sie müssen darben und vor ihm zittern, indes er auf der gefüllten Geldtruhe hockt und sich ins Fäustchen lacht. Verhält es sich so, mein Guter, dann werd ich dir heimleuchten, dann hat dein Stündlein geschlagen.
Sie lächelte vor sich hin, in einen Plan verliebt, der sich, ungreifbar noch aber verlockend, in ihr formte.
In den nächsten Tagen horchte sie viel herum. Das Myliussche Geschäft war in der Himmelpfortgasse; bei gelegentlichen kleinen Einkäufen brachte sie geschickt einige Ladeninhaber in der Nähe über das, was sie von Mylius wissen konnten, zum Reden. Hierbei kamen ihr ihre guten Manieren zustatten, ihre gewinnende Herzlichkeit und Unbefangenheit, vor allem die humorige Art, womit sie insbesondere Leute aus dem Volk zu fassen verstand.
Eine andere Nachrichtenquelle war ein mit der Familie Mylius seit zwanzig Jahren im selben Haus wohnendes altes Fräulein, von dem sie zufällig erfahren hatte, dass es vorzeiten mit ihrem Onkel, dem Hofrat, bekannt gewesen war; der Bruder dieses Fräuleins von Elmenreich nämlich und der Hofrat waren in den fünfziger Jahren einmal in der gleichen Hofkanzlei gesessen; jetzt lebte der Sohn des verstorbenen Bruders bei ihr, Schulkamerad und Intimus von Lothar Mylius. Ulrike machte Fräulein von Elmenreich einen Besuch, nachdem sie sie am Tag vorher auf der Treppe so freudig begrüsst hatte, als wäre sie seit langem von der Sehnsucht verzehrt gewesen, ihr zu begegnen. Die Anknüpfung war leicht, der Hinweis auf den Hofrat entzückte die einsame Alte, die sofort ihre Erinnerungen auskramte, und da sie sich auch sonst äusserst mitteilsam zeigte, verhehlte sie ihrem jungen Gast nichts, was zu ihrer Kenntnis gelangt war.
Das erste Ergebnis von Ulrikes Kundschaftertätigkeit war ungefähr dies. Mylius wie auch seine Frau stammten aus dem Rheinhessischen. Er war der Sohn eines protestantischen Pastors, hatte Theologie studiert und dann Kunstgeschichte. Es war ihm nämlich eine kleine Erbschaft zugefallen, die ihm neben der Möglichkeit umzusatteln auch die bot, nach Italien zu reisen und einige Zeit in Rom zu leben. Dort hatte er dann abermals den Beruf gewechselt und war Kunsthändler geworden. In die Heimat zurückgekehrt, liess er sich in Frankfurt nieder und heiratete alsbald. Christine war aus einer alten, obschon verarmten Patrizierfamilie, eine geborene Vollprecht; ihr Vater war vor der Märzrevolution grossherzoglicher Staatsminister gewesen, ein Mann von Bildung und Geist. Als er starb, reichte die Hinterlassenschaft nicht einmal hin, um die Schulden zu tilgen, und Christine durfte sich nicht lang besinnen, als Mylius um ihre Hand anhielt. Doch mit der jungen Wirtschaft wollte es nicht vorwärts gehen, Mylius entschloss sich, die Gegend zu verlassen, und verlegte seinen Wohnsitz nach Wien. Er verzichtete auf den ausschliesslichen Handel mit Bildern und warf sich auf das Antiquitätengeschäft. Das war zu Anfang der sechziger Jahre. Zuerst schien es ihm auch in dem neuen Domizil nicht recht zu glücken, aber eines Tages hatte er den spekulativen Einfall, den ganzen beweglichen Besitz eines unlängst verstorbenen Grafen Zierotin, der der Letzte seines Geschlechtes war, zu erwerben; es gelang ihm unter günstigen Bedingungen, und seitdem hatte er sich langsam und stetig emporgearbeitet. Bei den vornehmen Herrschaften stand er allgemein in hoher Gunst; man schätzte seinen Geschmack, hielt sein Urteil in Zweifelsfällen für massgebend, wandte sich bei diskreten Verkäufen vor allem an ihn und rühmte seine geschäftliche Sauberkeit. Mit Hilfe dieser auserlesenen Klientel hatte er sich auch Absatzgebiete zu erschliessen vermocht, die nur wenig andern zugänglich waren; sein Name hatte bei der Aristokratie Englands und Frankreichs wie auch bei den reichen amerikanischen Sammlern einen guten Klang, und mit ziemlicher Regelmässigkeit schickte er grosse Sendungen von oft unermesslichem Wert ins Ausland.
Die Frage, ob er als vermöglicher Mann gelten dürfe, wurde von verschiedenen verschieden beantwortet. Die einen bejahten sie unbedingt. Sie sagten, er werde so seine Viertelmillion in Sicherheit gebracht haben. Gulden? eine Viertelmillion Gulden? Natürlich, warum denn nicht? Eine Viertelmillion Gulden. Andere bestritten dies und nannten eine weit geringere Summe, siebzig- oder achtzigtausend. Wieder andere, zum Beispiel der Handschuhfabrikant Schlitteis, der sein Gewölbe gegenüber dem Myliusschen hatte, verstieg sich zu schlechthin phantastischen Zahlen und behauptete, er müsse, niedrig veranschlagt, vier- bis fünfmalhunderttausend Gulden besitzen. Doch diesem lachte Ulrike ins Gesicht und sagte, er sei vielleicht ein begabter Märchenerzähler, an seinen geschäftlichen Blick hingegen glaube sie nicht; ein Mann von derartigem Reichtum werde was Besseres anzufangen wissen, als Tag für Tag in einem düstern Loch zu lauern und Bric-à-bracs zu verschachern; solche Verdrehtheit traue sie einem sonst leidlich vernünftigen Menschen nicht zu.
Fräulein von Elmenreich war der Ansicht, dass er nach bürgerlichen Begriffen allerdings wohlhabend zu nennen sei, dass aber bei der Besonderheit des Handels, den er treibe, sein Barvermögen kaum zu bestimmen wäre. Der Wert der Dinge sei schwankend; er müsse sie bisweilen unter dem Preis losschlagen; Berechnungen gingen oft fehl, Erwartungen würden getäuscht. Freilich käme es vor, dass gewisse Objekte ganz ausserordentlich im Preise stiegen; so habe sie selbst anno dreiundsiebzig, im Jahr des grossen Krachs, einen Gobelin um zweihundert Gulden verkauft, der heute unter Brüdern das Sechsfache wert sei. So oft sie daran denke, sei ihr das Weinen nah.
„Die Wahrheit zu gestehen, geh ich nie ohne Bangigkeit an Mylius vorüber,“ sagte das alte Fräulein; „hie und da treff’ ich ihn, etwa in der Dämmerung im Hausflur. Er grüsst, ich danke, das ist alles. Aber solche finstern Geldnaturen strömen einen bösen Zauber aus. Sie lieben den Fetisch in ihren Kassen, wie ein Mensch von Herz das Lebendige liebt, mit derselben Hingebung, derselben Leidenschaft. Von dieser gottlosen Liebe wird ihr Blut dick und schwarz und man spürt förmlich, wie sich die Seele in Ängsten windet. Da geht er dann hin, geht die Stiege hinauf, still wie ein Gespenst. Was er hat, macht ihn zittern, was er nicht hat, macht ihn zittern.“
„Ganz richtig,“ entgegnete Ulrike Woytich, „aber vor Gespenstern fürcht ich mich nicht. Gespenster nehm ich nicht an. Werden sie zudringlich, so rückt man ihnen an den dürren Leib und ruft: ‚Gelobt sei Jesus Christus.‘ Das halten sie nicht aus und verduften. Gruseln kenn ich nicht, das muss ich erst lernen wie der im Märchen, der extra dazu auszog.“
Wie sich Ulrike bald überzeugen konnte, genoss Mylius allenthalben den Ruf eines Mannes von Verlass und streng rechtlichen Grundsätzen. Anfangs hatte er es nicht eben leicht gehabt in der Stadt der Leichtherzigkeit, als protestantischer Zuzügling. Man war den Leuten seines Schlages und seiner Herkunft nicht grün. Verspottete man nicht ihre Genauigkeit, so beargwöhnte man ihren Fleiss; erregten sie nicht Anstoss durch die schroffe Absage an das mittuerische Wesen, so ärgerte man sich über die korrekte Führung. Doch mit der ihm eigenen Zähigkeit hatte er sich festgesetzt und Boden gewonnen.
Eigentliche Freunde hatte er nicht, vertrauten Umgang keinen. Das Familienleben galt als musterhaft und man rühmte die Artigkeit und Wohlerzogenheit der Kinder, die bescheidene Führung und das gefällige Wesen der Frau. Viele bedauerten freilich die Töchter. Sie durften auf keinen Ball gehen, keine Einladungen annehmen, Ausflüge nur machen, wenn sie nichts kosteten. Selbst die kleinste Eisenbahnfahrt musste erfeilscht und erbettelt werden. Josephe war die einzige, für die es keine Entbehrung war. In frühen Jahren schon wurde über ihre Frömmigkeit gesprochen und man wunderte sich darüber. Manche wollten nicht begreifen, wie eine Protestantin es überhaupt anstelle, fromm zu sein; Protestantismus, erklärten sie, sei doch gar kein Glauben, sondern Ketzerei und Leugnung, da seien die Juden noch besser dran. Aus den ersten Gesprächen mit Christine erfuhr Ulrike, dass das junge Kind auch die Mutter zu seinen Anschauungen bekehrt hatte; eine Zeitlang hatte Christine sie bei jedem Kirchgang begleitet, und sie gestand, dass es ihr selbst merkwürdig genug gewesen sei, da sie in aufklärerischen Tendenzen erzogen worden war und eine ganz andere Jugend gelebt hatte. Ihr Grossvater hatte Merck noch gekannt, den Freund Goethes; die Mutter hatte als junges Mädchen im Brentanoschen Kreise verkehrt und war mit Arnim, Görres und Friedrich Schlegel in einem Briefwechsel gestanden, der zu den gehüteten Schätzen des Familienarchivs gehörte; eines Besuches von Wilhelm von Humboldt bei ihren Eltern entsann sie sich mit Stolz.
Ihre geistige Verfassung, sie suchte es mit ihren Worten zu umschreiben, war Produkt und Nachklang jener innerlich bewegten Romantik, die dann plötzlich wie von einem Eissturm von der deutschen Erde fortgeweht war und einst ein anderes Deutschland hatte ahnen lassen als das unter Kanonendonner vor den Mauern von Paris erstandene. Aber diese Grundfarbe war längst verblasst in ihr; das ehemals lebendig Gewesene war keine Wirklichkeit mehr, nur Phantasiespiel, aus dem sie bei seltenen Anlässen den Mut schöpfte, sich zur Fürsprecherin ihrer Kinder zu machen, wenn es galt, ihnen eine Freude zu bereiten und dem Mann die Erfüllung eines Wunsches abzuschmeicheln. In allem übrigen herrschte eine grosse Stille in ihrem Dasein, eine schläfrige und unfrohe Stille; und so war es auch mit den Kindern, Josephe vielleicht ausgenommen, die ihr eigenes, verschlossenes und oft schwer erratbares Leben hatte; schläfrige und unfrohe Stille lagerte über ihnen. Wenn man am Morgen die Fenster in der Wohnung öffnete, wunderte man sich immer, dass unten auf der Gasse Menschen gingen, dass da draussen eine Welt war. Nach und nach nahm diese Welt den Charakter gefährlicher und feindseliger Fremdheit an. Mylius unterliess es auch bei keiner schicklichen Gelegenheit, vor ihr zu warnen, vor ihren Verführungen, ihrer Verderbtheit, ihrer Hohlheit und ihrer Mitleidlosigkeit. Es klang glaubhaft genug, und so war noch mehr Grund, sich ganz, ganz stille zu verhalten.
Alles das nahm Ulrike begierig zur Kenntnis. Ausbeute und Hinweis in Fülle. Das Feld lag offen da. Zunächst war, um die Hauptschwierigkeit aus dem Weg zu räumen, eine Auseinandersetzung mit Onkel Klemens nötig, dem Hofrat, der ihrer als Logiergast überdrüssig war, obgleich sie von den in England gemachten Ersparnissen lebte und in seinem Haus nur eine greuliche Mansarde bewohnte, in der die Mäuse rumorten und durch deren Fensterfugen der Sturmwind pfiff. Er hatte ihr Empfehlungen für Paris verschafft, sie sollte ehestens fort, nach seinem Willen möglichst weit fort, und nun musste sie ihn vertrösten und etwas ersinnen, um ihn nicht als Dränger hinter sich zu haben, bis ihr Plan eine taugliche Form gewonnen hatte.
Dabei ist die Frage noch nicht beantwortet: worin bestand eigentlich ihr Plan? was lockte sie? was trieb sie, ihre Kräfte zu sammeln, um in der einen vorgesetzten Richtung zu wirken? Wollte sie sich einnisten in dem friedlichen Bürgerquartier und mit Halbgefangenen eine magere Kost teilen? So gross war ihr Hunger nicht und so klein ihr Ehrgeiz nicht. Folgte sie einer Neigung, einer Herzenslaune, einer mitfühlenden Regung, einer neugierigen bloss? Es war ganz und gar nicht ihre Art, denn sie gab sich nicht für Geringes her, und es fiel ihr nicht im Traum ein, sentimentalen Anwandlungen zuliebe ihre Zeit und ihre Aussichten zu opfern.
Also hatte ihr unvergleichlicher Spürsinn in dieser bresthaft engen Welt Möglichkeiten des Gelingens und Emporkommens entdeckt, die den Augen minder scharfblickender Leute, wie du, Leser, und ich, Berichterstatter, es sind, sich entziehen? Ohne Zweifel war es so, denn darauf dürfen wir uns verlassen, dass Ulrike Woytich immer dort zu finden ist, wo es um die Hauptsache geht.
Zunder im trockenen Holz
Sie sagte sich, dass es unklug wäre, wenn sie gleich anfangs ihre neuen Freunde in zu rascher Folge besuchte. Sie liess sich jedesmal bitten, schob den Termin hinaus, beteuerte, sie wolle nicht aufdringlich sein, war bestürzt, als sich Christine darüber verstimmt zeigte, kam am versprochenen Tag doch nicht, liess sich wieder bitten, behauptete, Josephe vertrüge noch keine Gesellschaft, Esther und Aimée gingen ihr aus dem Weg, musste eines bessern belehrt werden und wurde endlich zur Zwanglosigkeit überredet. Es war vortrefflich abgestuft; sie warb keinen Augenblick, sie war die Umworbene, und da sie sich so spröd erwies, stieg sie natürlich im Wert.
Sich um Josephe zu bemühen, erkannte sie als das Wichtigste. Den Liebling Christines musste sie vor allem für sich einnehmen. Aber gerade bei ihr achtete sie sorgfältig darauf, sich keine Blösse zu geben, wartete ziemlich lange, ehe sie einen vertraulicheren Ton anschlug, und vermied beinahe zartsinnig, was das empfindliche Kind an eine Dankesschuld gemahnen konnte. Die seelische und körperliche Erschütterung, die Josephe bei dem Brand erlitten hatte, war nachhaltiger als man geglaubt; sie war noch scheuer geworden, noch in sich gekehrter, noch unzugänglicher. Ihrer Retterin mit Herzlichkeit zu begegnen, war ihr aufrichtiges Bestreben, aber Worte standen ihr nicht zu Gebot, wenigstens nicht in dieser Zeit, und dass ihre Stummheit missdeutet werden könne, verursachte ihr Pein.
Ulrike erriet den Zustand und besänftigte ihn. Sie hatte eine Art, dem Partner im Gespräch das Stich- und Gegenwort zu erlassen und es ihm anzudichten, die diesem die Illusion gab, er trage das beste Teil zur Unterhaltung bei, und damit verpflichtete und schmeichelte sie aufs feinste. Sie brachte Josephe Blumen mit. Sie verstand es, in der Küche in fünf Minuten exquisite kleine Leckerbissen zu bereiten, mit nichts, einem Löffel Mehl, einem Eidotter, einer Hühnerleber und ein paar Gewürzen, und servierte das Erzeugnis mit dem listigen Stolz eines italienischen Garkochs. Es war herzbezwingend. Solche Wohlgerüche hatten die Myliusschen Gemächer noch nie durchflutet. Therese schüttelte den Kopf, Lothar schnupperte und sog gierig den nahrhaften Dampf in die Nase; aber dann musste Luftzug veranstaltet werden, um die Spuren der kulinarischen Ausschweifung zu verwischen, bevor Mylius nach Hause kam.
Auch zu regelmässigen kleinen Spaziergängen suchte sie Josephe zu bewegen, doch vermochte sie sie nur ein- oder zweimal dazu, denn Spazierengehen war nach den Myliusschen Anschauungen ein Luxus, den sich nur Aristokraten und Komödianten gestatten durften, und Josephe wünschte sich an das Gesetz zu halten, welches das innere Leben der Familie bestimmte. Lieber wollte sie auf die angenehme Zerstreuung verzichten, die ihr Ulrikes munteres Geplauder bot. Oft horchte sie staunend; denn durch diese oder jene Bemerkung, ein hingeworfenes Wort bloss, gewann sie Einblick in Dinge, in Verhältnisse, die ihr völlig unbekannt waren und ihre Phantasie lebhaft beunruhigten.
„Sie verwöhnen mir das Kind, liebe Ulrike“, sagte Christine, und man sah ihr an, dass sie glücklich darüber war.
Ulrike antwortete, solch ein Geschöpf könne gar nicht genug verwöhnt werden; Josephe brauche Liebe, Wärme und Sorgfalt wie eine Blume im Winter; gern würde sie mit Josephe ein paar Tage ins Gebirge reisen, wenn sichs machen liesse; es wäre für ihre Gesundheit wie für ihren Gemütszustand gleich heilsam und besonders kostspielig wäre das Unternehmen ja nicht. Christine ergriff den Gedanken mit zaghafter Freude, aber sie konnte sich nicht entschliessen, mit Mylius darüber zu sprechen; es war leicht vorauszusehen, dass ein so verwegenes und die Ordnung durchbrechendes Projekt seinen heftigsten Unwillen herausfordern musste. Ulrike konnte sich nicht enthalten, ihr Vorwürfe über diese Schwäche und Feigheit zu machen, aber Christine erwiderte ernst, darin bestünde nun einmal ihr Leben; ihre Aufgabe sei es, Reibungen zu verhindern, Unfrieden zu ersticken und zu sorgen, dass sich nirgends Zündstoff bilde. „Es ist eine schwere Aufgabe, und ich spüre sie in allen Gliedern“, fügte sie hinzu.
„Ganz gewiss; die personifizierte Schutzvorrichtung; ob aber auch eine dankbare, wird die Zukunft lehren“, sagte Ulrike trocken.
„Kinder müssen an ihren Vater glauben wie Untertanen an ihren Fürsten und wie die Frommen an ihren Gott,“ fuhr Christine fort, „gerät der Glaube einmal ins Wanken, dann geht alles drunter und drüber.“
„Das wollen wir nicht hoffen,“ erwiderte Ulrike scheinbar erschrocken, „malen Sie nur nicht gleich den Teufel an die Wand. Also wird es nichts mit der kleinen Reise ins Gebirge?“
„Es kann leider nicht sein,“ sagte Christine, „vorläufig nicht. Übrigens hab ich mit Josephe selbst schon davon gesprochen und sie will absolut nichts davon hören. Sie weiss, dass es Schwierigkeiten und Kämpfe gäbe, und es wäre ihr unerträglich, sich als die Veranlassung dazu zu wissen.“
Von dem letzten Teil dieses Gespräches, das in Christines Zimmer stattfand, wurde Esther zufällig Zeugin und lauschte stumm, mit grossen Augen. Ulrike begab sich zu Josephe, der sie etwas vorzulesen versprochen hatte, und Josephe erwartete sie bereits. Sie sass mit einer Stickerei am Fenster und lächelte ihr freundlich entgegen. Es war zwölf Uhr vorüber, als sie begann, und mit Kraft und Verständnis las sie Stellen aus Amaranth, aus Stifters Hochwald, aus Hamerlings König von Sion; dann legte sie die Bücher beiseite und rezitierte auswendig, in englischer Sprache, zwei lange Gedichte von Tennyson und die Abschiedsstanzen aus Byrons Childe Harold.
Nach den letzten Versen erscholl beifälliges Händeklatschen, und sie fuhr bestürzt herum, wie wenn sie den Eintretenden nicht gehört hätte; sie hatte ihn aber wohl gehört: es war Mylius, der nun bedächtig den Kopf wiegte und mit bewundernd emporgezogenen Brauen sagte, ein solches Talent sei alles Lobes würdig; ob sie ausser der englischen noch eine andere Sprache beherrsche? Zu dienen, erwiderte sie leichthin, Französisch und Italienisch fliessend, Polnisch und Spanisch zur Not. Wann sie denn Zeit und Gelegenheit gehabt, das alles zu lernen? Da müsse sie doch unendlichen Fleiss drangesetzt haben? O nein, sagte sie; in den sechs Jahren, seit sie aus dem Elternhaus fort sei, habe sie mit so vielen Leuten aus aller Herren Länder zu tun gehabt, dass sie sich die Sprachen spielend angeeignet habe. Wenn man mit betrügerischen Agenten oder einer hochmütigen und schlechtgelaunten Lady oder Vicomtesse beständig um den letzten Schilling raufen müsse, flögen einem die Vokabeln schnell auf die Zunge und Syntax und Grammatik gäben sich von selber. Natürlich habe sie auch gelernt, aber der beste Lehrmeister sei das Schicksal.
„Also eine Perle“, meinte Mylius schmunzelnd.
„Eine Perle? möglich,“ versetzte sie lachend, „doch leider ohne Fassung und noch nicht mal aus der Muschel.“
„Immerhin, mein Kompliment,“ sagte Mylius; „eine junge Person wie Sie scheint mir berufen, in der Welt ihr Glück zu machen.“
Da Ulrike scharmant zu erröten wusste, schmeichelte die Anerkennung dem, der sie spendete, und erhielt ihn zugleich tributpflichtig. „Was sagen Sie zu Ihrem Vater?“ wandte sich Ulrike an Josephe, als Mylius das Zimmer verlassen hatte; „er ist ja gar nicht der Wauwau, für den man ihn ausgibt. Ein vollendeter Kavalier.“
„Wauwau? davon weiss ich nichts,“ erwiderte Josephe stirnrunzelnd; „dass er sich zu benehmen versteht, ist mir nichts Neues.“
Ulrike biss sich auf die Lippen.
Als sie am andern Nachmittag kam, war Christine mit Josephe ausgegangen. Esther und Aimée sassen am Tisch im Wohnzimmer und hatten einen abgegriffenen Schmöker aus der Leihbibliothek vor sich liegen, in den sie gemeinsam versunken waren. Wer früher mit der Seite fertig war, musste auf die andre warten. Sie erwiderten mürrisch, ohne emporzublicken, Ulrikes heiteren Gruss, und Lothar, der mit lächerlich grossen Schritten, die Hände auf dem Rücken, durch das Zimmer marschierte, schielte von Zeit zu Zeit grimmig nach ihr hin. Ulrike streifte die Handschuhe ab, musterte von ihrer schlanken Höhe herab alle drei erstaunt und fragte mit emporgezogenen Brauen: „Was ist los mit euch?“
„Nichts Besonderes“, fauchte der Knabe mit zänkischer, doch unsicher stotternder Stimme und pflanzte sich vor ihr auf, „wir wollens uns bloss nicht mehr gefallen lassen, dass Josephe alles haben soll und wir gar nichts. Sie ist ohnehin schon Mutters Schosskind, und jetzt wollen Sie auch noch eine Erholungsreise mit ihr machen. Wozu denn? Was mischen Sie sich denn in unsere Familienangelegenheiten? Wir erlauben das einfach nicht, verstehen Sie?“
Weiter kam er nicht; es gab einen Klatsch, und er hatte eine schallende Ohrfeige sitzen. Ulrike sagte gleichmütig: „Wenn sich die andre Backe beschwert, dass sie nichts gekriegt hat, kann sie auch was haben.“
Die Verblüffung des jungen Menschen war masslos. Er rieb die geschlagene Wange mit den Fingerspitzen und starrte Ulrike zornig und entsetzt an. Aber unter ihrem kühnen, spöttischen Blick wurde er von Sekunde zu Sekunde befangener, endlich schlug er die Augen nieder, schob die Hände in die Taschen und zuckte verlegen die Achseln.
Jetzt begann Ulrikes Kunststück. Ihn unterm Arm nehmend, fragte sie lachend, obs weh getan habe. Er nickte. „Das ist gescheit“, lachte sie. Errötend suchte er sich ihr zu entwinden, aber sie hielt ihn fest und neckte ihn mit seinem männlich-entschlossenen Auftreten, das ihr nur deshalb nicht imponiert habe, weil sie selber ein halbes Mannsbild sei und sich allerwegen habe ihrer Haut wehren müssen. Und sie erzählte im kollegialsten Ton ein paar lustige Episoden aus ihrem bewegten Wanderleben. Da wurde Lothar zahm. Er lauschte vergnügt und mit bewundernder Miene. Sie gingen dabei im Zimmer auf und ab, und Esther und Aimée, die ihren Augen nicht trauen wollten, vergassen weiterzulesen und blickten entgeistert drein, mit den Köpfen automatenhaft ihrem Auf- und Abschreiten folgend. Aus ihrem düsteren Staunen über die rasche Abtrünnigkeit des Bruders schloss Ulrike heimlich belustigt auf den Umfang der Verschwörung.