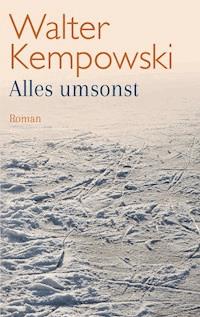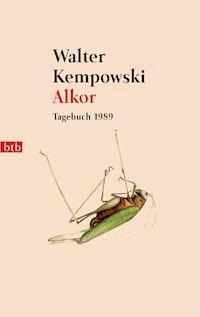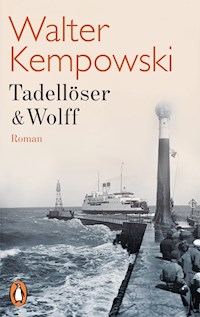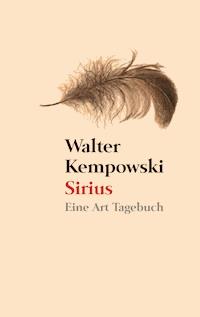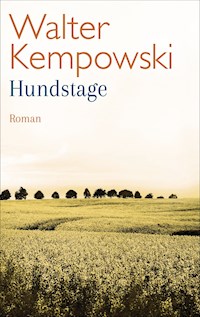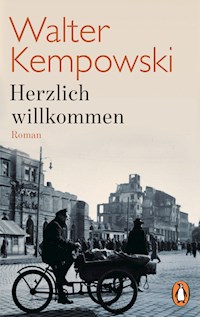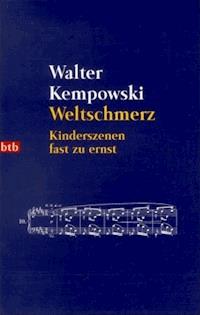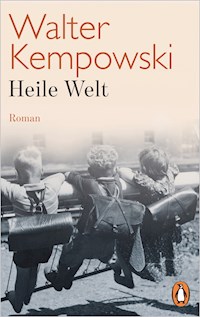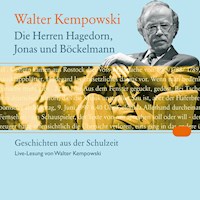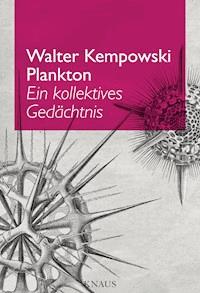8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaus
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Klare Sache und damit hopp« – Schriftstellerporträts aus dem Nachlass Walter Kempowskis
Von Goethe zu Thomas Bernhard, von Adalbert Stifter zu Johannes Mario Simmel: Walter Kempowski war ein passionierter Leser und beschäftigte sich gerne mit seinen »Konkurrenten«. Seine »Kollegenporträts« bestechen durch ihre radikale Subjektivität und ihre Mischung aus Bewunderung und Respektlosigkeit. Ein ungemein anregendes Buch und ein origineller Streifzug durch die Welt der Literaten.
Walter Kempowski macht auch dann aus seinem Herzen keine Mördergrube, wenn er über seine Schriftstellerkollegen schreibt. Er lässt recht unverhüllt erkennen, wem seine Sympathie gilt und wem nicht. Nichts liegt ihm ferner als eine »objektive« Würdigung. Ihn interessieren Macken und Marotten, Haar- und Barttracht, Eß- und Trinkgewohnheiten, Kleidervorlieben, Missgeschicke und Todesarten. Die Porträts sind mit sicherer Hand hingeworfene Skizzen, »Schnappschüsse« aus dem ganz persönlichen Blickwinkel des Autors. Das macht sie so lebendig, amüsant und anregend. Das Buch enthält ein Vorwort von Kempowskis langjährigem Lektor Karl Heinz Bittel.
Anregende und amüsante Streifzüge durch die Welt der Literaten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editorische Notiz
Die in diesem Buch versammelten Texte entstanden im Rahmen einer Auftragsarbeit für die »Welt am Sonntag« und wurden dort zwischen 1997 und 1999 veröffentlicht. Im Jahr 2002 hat Walter Kempowski das Manuskript für eine geplante Buchpublikation überarbeitet und eine Auswahl getroffen.
Inhaltsverzeichnis
Karl Heinz Bittel
Unsereiner heißt bloß Walter
Es wäre ein Irrtum zu glauben, daß Dichter, diese als sensibel geltenden Wesen, besonders zartfühlend miteinander umgehen. Neid, Eifersucht, Ranküne sind ihnen ebenso wenig fremd wie anderen Berufsgruppen. (Warum bekommt ausgerechnet dieser Kollege einen Preis, und ich bin – wieder einmal – übergangen worden?) Nein, sieht und hört man nur genau hin, so wird deutlich, daß es auf diesem verminten Terrain von verdeckten Schmähungen, vergiftetem Lob bis hin zur offenen Beleidigung nur so wimmelt. Wobei die Lage nicht dadurch übersichtlicher wird, daß sich auch Heerscharen von Kritikern und Rezensenten auf diesem Feld tummeln. Bei all dem Treiben geht es um Positionen im Literaturbetrieb, die es zu erringen oder zu behaupten gilt, um das ranking, die knapp bemessenen Güter von Prestige und Aufmerksamkeit. Allemal ist es deshalb interessant und aufschlußreich, wenn Schriftsteller sich in gebündelter, öffentlicher Form über ihre Kollegen, lebende wie tote, äußern. In solchen Fällen verrät der Betreffende, indem er seine Vorlieben und Abneigungen offenbart, vielleicht mehr, als ihm bewußt (und lieb) ist, über sich selbst als über die von ihm Porträtierten.
»Umgang mit Größen« nannte Walter Kempowski seine kleine Galerie von Autorenporträts. Ein beziehungsreicher Titel – denn »Umgang«, das kann schließlich gute wie schlechte Gesellschaft bedeuten, und bei »Größen« ist der ironische Unterton wohl nur schwer überhörbar. Wonach bemißt sich Größe? Nach der Höhe der Auflagen? Nach der Anzahl der Preise? Nach der internationalen Verbreitung, dem weltweiten Ruhm? Neben den Klassikern früherer Jahrhunderte (zum Beispiel Sterne, Goethe, Flaubert) und der Moderne (Proust, Kafka, Joyce) finden sich in dieser Sammlung auch Auflagenkönige der Unterhaltungsliteratur wie etwa Karl May, Edgar Wallace, Agatha Christie und, ja – Simmel und Konsalik. Die literarische Landschaft ist ein weites Feld, auf dem sehr Unterschiedliches sprießt.
Kempowski macht aus seinem Herzen keine Mördergrube, läßt recht unverhüllt erkennen, wem seine Sympathien gelten und wem nicht. Es fällt ihm sichtlich nicht leicht, seine ästhetische und politische Reizbarkeit (Feuchtwanger!) im Zaum zu halten. Einen Bonus erhält, wer Tagebuch geführt hat. Nichts liegt Kempowski ferner als eine »objektive« Würdigung der schreibenden Kollegen, ihn interessieren deren Macken und Marotten, Haar- und Barttracht, Eß- und Trinkgewohnheiten, Einkommensverhältnisse, Kleidervorlieben, Mißgeschicke, Schicksalsschläge, Pathologisches, Todesarten. Und bei seinen Zeitgenossen notiert er, wie sie ihm begegnet sind: am Rand von Jurysitzungen, auf der Frankfurter Buchmesse, auf Tagungen oder zufällig im Hotel. Daß Thomas Bernhard (mit »nagelneuer Cordhose«) sich erhob, als Kempowski im Frankfurter Hof an dessen Tisch trat, hat er als »völlig in Vergessenheit geratene Höflichkeitsbezeigung« registriert, und daß Günter Grass, mit dem ihn wenig verbindet, ihn einmal »Kempi« genannt hat, nahm er ihm gut. In Bargfeld mußte er erfahren, daß mit Arno Schmidt, den er verehrte, nicht gut Kirschenessen war. (»Gott, wie hat er mich abfahren lassen, und ich wollte ihm doch nur etwas Freundliches sagen.«) Und an Uwe Johnson (»schwarze Lederjacke, schwarzer Lederschlips«), dem Pommer, fürchtete er dessen Grobianismus: »Bloß kein falsches Wort sagen, dachte ich, sonst haut er dir noch einen an den Ballon.«
Nahezu durchgängig wird protokolliert, welche Preise die jeweilige »Größe« erjagt hat oder – mit einer gewissen Schadenfreude – an welchen Autoren der Literaturnobelpreis mal wieder haarscharf vorbeigegangen ist. Im Fall von Martin Walser zählt Kempowski mit masochistischem Behagen die lange Liste von Preisen, Ehrendoktorwürden, Verdienstkreuzen, Orden und Gastdozenturen auf. (»… auf Platz sieben der fünfhundert wichtigsten Deutschen des Jahres. Dann kann er doch so ganz falsch nicht liegen.«) Hier wird (wieder einmal) spürbar, daß Kempowski zu Zeiten sich zurückgesetzt, zu kurz gekommen, vom Literaturbetrieb schlecht behandelt fühlte. Obwohl sich seine eigene Bilanz, genau betrachtet, doch sehr ansehnlich ausnimmt. Mehrere USA-Aufenthalte, Ehrungen in großer Zahl, eine lange Liste von Preisen. Wohl wahr, der Büchner-Preis ging an ihm vorbei (und das hat an ihm genagt), aber wer hat den in den letzten zwanzig Jahren nicht alles bekommen. So hätte er das auch betrachten können. Vielleicht war er ein Stück weit verliebt in sein Ressentiment, das aber immer wieder und glücklicherweise durch Selbstironie gemildert wurde. Im Text über Herman Melville erwähnt er dessen Sohn, der den in unseren Ohren ausgefallen klingenden Namen Stanwix trug. »Unsereiner heißt bloß Walter«, so Kempowskis Kommentar. Von abgründiger Komik ist auch eine Bemerkung zu Faulkner: »William Faulkner hat ein Gesicht, das mich an jemanden erinnert. Ich weiß bloß nicht, an wen.«
Die hier versammelten Porträts sind knappe, mit sicherer Hand hingeworfene Skizzen, »Schnappschüsse«, aus dem ganz persönlichen, individuellen Blickwinkel Kempowskis. Das macht sie lebendig, amüsant und anregend. Sie wecken Lust, mehr zu erfahren über den jeweiligen Autor und sein Werk. Wer einmal den langen Büchergang im Haus Kreienhoop abgeschritten hat, der weiß um das lebensinnige Verhältnis Walter Kempowskis zu den Büchern und den Menschen, die sie verfaßt haben. Im Zuchthaus von Bautzen hat er mit Blick auf seine damals noch imaginäre Bibliothek und auf die darin geborgenen »Größen« ein kleines Gedicht geschrieben:
In meinem Aquarium hängen die Fische seltsam starr und stumm.Doch – wenn ich die Scheiben wische, fahren sie plötzlich herum.
Hans Christian Andersen
H.C. Andersen, auch einer der Dichter, deren Vornamen man in Abkürzungen zu zitieren pflegt, war ständig auf Reisen. Durch halb Europa bis nach Spanien ist er gefahren, alles in der Postkutsche, in einem Jahr war er zweimal in Paris, und Rom hat er viermal gesehen. Er zog in Deutschland umher, ließ sich am Weimarer Hof feiern, traf Liszt und Grillparzer in Wien und freundete sich in Olmütz mit Walter von Goethe, dem Enkel Johann Wolfgangs, an.
Der dänische Dichter, der uns mit so einzigartigen Märchen beschenkt hat wie »Das häßliche Entlein«, »Der standhafte Zinnsoldat« und »Die kleine Meerjungfrau«, wuchs in Armut auf. Er besuchte nur unregelmäßig eine Schule. Sein Vater war Schuster in Odense, die Mutter konnte kaum lesen und schreiben (der spätere Briefwechsel mit ihrem Sohn wurde über Dritte geführt), am Ende war sie dem Alkohol verfallen. Als ihr Sohn gerade zum erstenmal in Rom weilte, starb sie in einem Armenhaus.
Mittellos, ungebildet und von unvorteilhaftem Äußeren war er im Alter von vierzehn Jahren nach Kopenhagen gekommen. Ein Vierteljahrhundert später wurde er dann als blendender Unterhalter vom dänischen König nach Föhr eingeladen, las seine Märchen vor, jeden Abend zwei, und trank mit der Königin Schokolade. Schließlich wurde er sogar zum Etats- und Konferenzrat ernannt.
Andersen war nie verheiratet. Einen »Distanzliebhaber« hat man ihn genannt. Seiner ersten Liebe erklärte er sich schriftlich, ihren Antwortbrief fand man nach seinem Tod in einem Lederbeutel um seinen Hals. Er wurde weisungsgemäß ungelesen verbrannt. Eine seiner großen Leidenschaften, Jenny Lind, gab ihm nur Freundschaft, und noch in seinen letzten Lebensjahren hat er im Tagebuch unablässig von Frauen phantasiert.
Immer hat er Geschichten erzählt, den Mitreisenden in der Kutsche oder den Umsitzenden während der Pause im Königlichen Theater, seine eigene (gleich drei Autobiographien hat er verfaßt) und eben die Märchen, die ihn weltberühmt machten. Zwischen 1835 und 1872 wurden an die zweihundert in mehreren Serien und Fortsetzungen gedruckt: »Eventyr, fortalte for Børn«; »Historier«, »Nye Eventyr og Historier«. Er schöpfte aus deutschen, griechischen, dänischen Quellen, übernahm Sagen und Geschichten aus dem Volksglauben und aus dem Alltagsleben, aus der Welt der neuen technischen Erfindungen.
In über fünfunddreißig Sprachen hat man sie übersetzt. Von Baron Blixen, dem eremitenhaft in den Wäldern Nordamerikas lebenden Vater der Dichterin, ist überliefert, daß er eines Tages in eine verlassene Hütte trat und auf dem Tisch ein aufgeschlagenes Exemplar der Märchen vorfand. Andersen hat auch drei Romane, Theaterstücke und Gedichte veröffentlicht, das ist in Deutschland unbekannt.
H.C. Andersen gehört zu den wenigen großen Märchenerzählern der europäischen Literatur. Er entwickelte einen eigenen Stil, verband die knappe Form der Grimmschen Märchen mit der philosophischen Phantastik der Romantiker. Seine Märchenwelt drang noch bis vor einer Generation in alle Kinderzimmer, neuerer Zeit blieb es vorbehalten, in ihr komplizierte literarische Gebilde zu sehen voller Anspielungen und Artistik.
Margaret Atwood
Margaret Atwood wurde 1939 in Ottawa geboren und wuchs in den Wäldern von Ontario und Quebec auf, wo ihr Vater, ein Insektenforscher, nach seltenen Raupen jagte. Sie studierte Anglistik an den Universitäten von Toronto und Harvard. Als Dozentin und Writer in Residence lehrte sie später an zahlreichen Universitäten. Sie verbrachte einige Jahre in Boston, Montreal, London, Berlin und Südfrankreich. Zurzeit lebt sie in einer alten Villa in Toronto, mit ihrem Mann, einem Kollegen, dessen Arbeitszimmer ganz oben unter dem Dach liegt, weil er Zigarre raucht.
In den sechziger Jahren veröffentlichte Margaret Atwood zuerst Gedichte, weil die Verleger keine dicken Bücher wollten. Und sie machte sich bald einen Namen. Wann sie sich denn umbringt, fragte sie ein Journalist. Er meinte, das gehöre sich so für seriöse Lyriker, die Männer immer unter Alkohol und die Frauen: Selbstmord.
Margaret Atwood ist die bedeutendste Schriftstellerin Kanadas. Auch wenn sie nur langsam schreibt, an jedem Roman drei bis fünf Jahre arbeitet, so hat sie es inzwischen doch auf mehr als dreißig Bücher gebracht, darunter auch Kinderbücher und Kurzgeschichten. Die Gedichte gehören an amerikanischen Universitäten zur Pflichtlektüre, und ihre Romane sind in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt. Sie war Präsidentin der kanadischen Schriftstellervereinigung und des PEN-Club. Mehr als sechzig Preise hat sie bekommen. Anläßlich einer internationalen PEN-Veranstaltung näherte ich mich ihr schüchtern: Ich habe etwas übrig für Romancièren. Leider sah sie mich nur eben über die Schulter an und ging davon.
Honoré de Balzac
Wenn ich an Honoré de Balzac denke, fällt mir eine der drei Statuen ein, die Rodin geschaffen hat (nicht die nackte!), erst danach jenes bekannte Foto: die fetten Backen und das kleine Bärtchen. Er führte das Leben eines Gesellschaftslöwen mit wechselnden Liebschaften, allesamt mit wundervollen Namen, die Herzogin von Abrantès, Olympe Pélissier, Marie du Fresnay, die Gräfin Hanska. Letztere holte er aus der Ukraine, und als er mit ihr vor seinem Haus vorfuhr, hatte der Diener inzwischen Fenster und Türen verrammelt. Vom Garten mußte er sich einen Weg in seine Villa bahnen. Einen imposanten Spazierstock hatte er, der große goldene Knauf mit Türkisen bestückt.
Balzac arbeitete unausgesetzt, täglich sechzehn Stunden, ein Fall von Workaholic, aber auch, um seinen Verbindlichkeiten nachzukommen. Er schrieb unter falschem Namen Artikel für eine Zeitung der Linksopposition, unter seinem richtigen für ein Blatt der Legitimisten. Er gestaltete in der »Comédie Humaine« ein literarisches Großreich. In der zwölfbändigen Ausgabe, von Ernst Sander herausgegeben, ist der Plan abgedruckt, den Balzac seinen Dichtungen zugrunde legte.
In neuerer Zeit hat Hubert Fichte Ähnliches versucht. Er subsumierte Romane, Interviews, Reisebeschreibungen, Hörspiele und sogar Glossen und Polemiken unter dem Titel »Die Geschichte der Empfindlichkeit«.
Die »Comédie Humaine« ist in ihrem kolossalen Umfang einzigartig geblieben. Nicht weniger als 137 Publikationen waren geplant, immerhin 91 Romane hat Balzac geschrieben, in denen rund 3000 Personen auftreten! Grillparzer sprach abfällig von philosophischen »Hanswurstereien«, Victor Hugo hingegen meinte, daß der Dichter oberhalb der Wolken als Stern seinem Vaterland glänzen würde.
»Nacht für Nacht am Schreibtisch, und ein Band nach dem anderen! Was ich vollbringen möchte, ist so erhebend, so umfassend!« heißt es in einem Brief. Ein repräsentatives Bild der Menschheit am Beispiel der französischen Gesellschaft seiner Zeit sollte entstehen, das »Tausendundeine Nacht des Abendlandes«, wie er es einmal ausdrückte.
Es ist zu fragen: Was wird von all dem noch gelesen? Mir scheint, daß die Frage des Nutzens nur von literaturfremden Lesern gestellt werden kann. Wer wäre denn imstande, alle Bilder Picassos in sich aufzunehmen? Die meisten lagern in Depots und sind den Augen verborgen. Die bloße Existenz der inkommensurablen Sophien-Ausgabe von Goethes Werken ist schon Nutzen genug. Allerdings muß ich gestehen, daß mir das Gesamtwerk des bankrotten Druckereibesitzers und exzessiven Kaffeetrinkers – fünfzig Tassen soll er am Tag zu sich genommen haben – verschlossen bleibt. Ein, zwei Spitzen dieses Massivs müssen für das Ganze stehen. Seinen Roman »Eugénie Grandet« habe ich mit Gewinn gelesen. Er zeigt, wohin Geiz und Geldgier führen können – ein Sujet, das aktuell geblieben ist.
Herman Bang
In der Aufzählung der skandinavischen Autoren (Hamsun, Lagerlöf, Laxness und Strindberg) fehlt in der Regel der große Herman Bang. So, wie man sich in unserem Land angewöhnt hat, »Grass-Lenz-Böll« zu sagen, und damit alle anderen unter den Tisch fallen läßt. Und das ist ungerecht! Gleich nach der Wende erwarb ich die dreibändige Auswahlausgabe seiner Werke aus dem VEB Hinstorff Verlag Rostock für – in Worten – dreizehn Mark.
Herman Bang war der bedeutendste dänische Vertreter des literarischen Impressionismus. Man nannte ihn den »Dichter der Erinnerung« und »Schilderer der stillen Existenzen«, aber auch einen scharfsichtigen Analytiker der Gesellschaft seiner Zeit. Lion Feuchtwanger bezeichnete ihn sogar als einen der größten Erzähler des letzten Jahrhunderts. Thomas Mann schrieb 1902, er lese »jetzt beständig Herman Bang, dem ich mich tief verwandt fühle« (was freilich auch außerliterarische Gründe gehabt haben mag), später dann, er habe alles gelesen und viel gelernt. Wie auch immer, wer sich auf Herman Bang einläßt, ist für ein paar Wochen mit Lektüre wohlversorgt.
1857 wurde er als Sohn eines Pfarrers auf Alsen geboren. Ob sich schon mal jemand mit der kulturspendenden Wirkung von Pfarrhäusern beschäftigt hat? Vermutlich ja. Aufgewachsen ist er in der Provinzstadt Horsens auf Jütland, wo er den Deutsch-Dänischen Krieg miterlebte, Kämpfe vor der Stadt und die preußische Besetzung.
Er begann wie Strindberg seine Karriere als Schauspieler, versuchte auch als Theaterregisseur und Journalist zu reüssieren, bevor er seine erste Novellensammlung 1880 veröffentlichte. Mit Romanen wie »Hoffnungslose Geschlechter« (1880) und »Am Wege« (1886) und »Tine« (1889) wurde er in Europa bekannt.
Bang – ein unermüdlicher Arbeiter – gab sich als exaltierter Dandy mit »Diva-Allüren« (teures Parfüm), nahm Morphium und litt unter Depressionen und Neurosen. Immer ruhelos, immer unterwegs – das halbe Leben verbrachte er in Zügen, in seiner engen Heimat hielt er es nicht aus. Er lebte in Oslo, in Prag, Paris und Wien, reiste nach St. Petersburg und Moskau. Ende 1911 bestieg er in Cuxhaven den Dampfer nach New York, von Bronchitis geplagt und in finanziellen Schwierigkeiten. Auf der Vortragsreise durch die USA erlitt er am 29. Januar 1912 in einem Eisenbahnabteil des Pazifikexpress einen Schlaganfall. In Ogden/Utah ist er im Krankenhaus gestorben.
Harriet Beecher Stowe
»Onkel Toms Hütte« stand in meiner Kinderbibliothek als Geschenk einer alten Tante, die das Buch selbst als Kind geschenkt bekommen hatte. Entsprechend sah es aus. Man konnte dergleichen Ausgaben früher in Antiquariaten kaufen. Jetzt sind sie wie weggeblasen.
In ähnlicher Ausstattung hatte ich »Sigismund Rüstig« und »Münchhausen«. Auf mich wirkte das Altertümliche abstoßend, und ich sah mir wohl nur die Bilder an. Ein Schulfreund erzählte mir von Auspeitschungen, die darin vorkämen, und er tat das irgendwie genüßlich. Bei Heranwachsenden mag das Interesse an solchen Torturen groß sein. Auch die Azteken geben da viel her. Ich zog die »Höhlenkinder« von Sonnleitner vor, da ging es gesitteter zu. Erst viel später griff ich mir eine neue Ausgabe und konnte nachempfinden, wie sensationell das Erscheinen dieses Buches gewirkt haben muß. Wir alle kennen die abstrakt schreckliche Zeichnung des Sklavenschiffs, auf der zu sehen ist, wie man die gefesselten Unglücklichen platzsparend im Laderaum verteilt. Es bedurfte eigentlich nicht des Riesenschinkens »Roots«, um uns nachhaltig zu schockieren.
Heute ist es unbegreiflich, daß die Sklaverei noch weit bis ins vorige Jahrhundert gang und gäbe war und nicht nur in Afrika, auch wenn seit der Aufklärung in ganz Europa immer wieder über die Aufhebung der Sklavenhaltung diskutiert wurde. Hat nicht auch Matthias Claudius ein Gedicht geschrieben: »Der Schwarze in der Zuckerplantage«?1
Andere Länder, andere Epochen zu verurteilen, davor bewahrt uns Ältere die Zeitgenossenschaft zum Holocaust. Neuerdings verlangen ja die afrikanischen Staaten – analog zur Zwangsarbeiterentschädigung – 777 Billionen Dollar von allen an Sklavenhandel und -haltung Beteiligten.
Harriet Beecher Stowe übrigens war Lehrerin und mit einem Theologieprofessor verheiratet. Ihr Roman aus dem Jahre 1852 entstand aus weiblichem Mitgefühl für das Los der Unterdrückten. Onkel Tom, ein überaus christlicher Schwarzer, wird in die Südstaaten verkauft, wo er am Ende brutal zu Tode geprügelt wird. Er hatte ein reales Vorbild, Josiah Hanson, über den Harriet Beecher Stowe einige Jahre später eine Lebensbeschreibung veröffentlichte.
Walter Benjamin
Walter Benjamin: Intensität im Kleinen und gigantisches Raumgreifen im Großen. Hier seine Miniaturen »Moskau«, »Weimar«, »Nordische See«, dort das riesige »Passagen-Werk«, das leider nur als Fragment erhalten ist und von unserer Hochschulgermanistik nicht zur Kenntnis genommen wird. Eine geschichtsphilosophische Arbeit über das 19. Jahrhundert sollte entstehen. Die Literatur der Zukunft sei die Collage, hat Gottfried Benn geschrieben. Benjamin begann 1927. Jahrelang arbeitete er an der Materialsammlung aus Zitaten und Kommentaren. Noch in der Emigration saß er in der Bibliothèque Nationale in Paris und hat mit seinen kurzsichtigen Augen Texte entziffert und seinem Jahrhundertwerk einverleibt, das auch Fotos enthalten sollte.
»Berliner Kindheit um Neunzehnhundert« – braucht es mehr als Ausweis für einzigartige schriftstellerische Qualitäten? Die Beschreibung der Siegessäule in Berlin und deren Fresken setzt uns – ohne viel Worte zu machen – ins Bild über den Krieg 70/71. Autobiographie aus Schlaglichtern der Erinnerung, aus Prosaminiaturen von zwei, drei Seiten Umfang. Wo fände sich heute noch ein Verleger, der sich mit solcher Art »Kurzgeschichten« abgäbe.
Wenn wir an Walter Benjamin denken, erinnern wir uns an eigenartige Begleitumstände: Da ist sein mysteriöser Tod, da ist die Verwandtschaft mit der »blutigen Hilde«2 (die Frau mit der Gretchenfrisur, die aus Haß und Verblendung reihenweise Menschen unglücklich machte und deren Sohn sich jüngst nicht entblödete, den Bau der Mauer 1961 gutzuheißen). Nicht zu vergessen die wohl schofelige Behandlung durch Adorno und Horkheimer, die es nicht fertigbrachten, aus was für Gründen auch immer, ihn ins Ausland zu retten.
Benjamin hatte eine wissenschaftliche Laufbahn einschlagen wollen. Seine Dissertation von 1919 leitete die Wiederentdeckung der deutschen Frühromantik ein, seine Habilitationsschrift über den »Ursprung des deutschen Trauerspiels« aber wurde von der Universität Frankfurt fünf Jahre später aus fadenscheinigen Gründen zurückgewiesen. Erich Kästner war so indiskret, die Umstände in seinem Roman »Fabian« abzuhandeln.
Benjamin war einer der wichtigsten Literaturkritiker der Weimarer Republik, schrieb Essays über Goethe, Proust, den er auch übersetzte, Karl Kraus, arbeitete für Zeitungen und den Rundfunk. Er beschäftigte sich mit dem Marxismus, den er der politischen Konzeption seiner Kunsttheorie zugrunde legte. Es gibt alte Spielfilme, in denen der hupende, lärmende Verkehr am Alexanderplatz für Sekunden zu sehen ist, ob er in einem der Busse saß? Im März 1933 mußte der Gefährdete Deutschland verlassen und emigrierte nach Paris.
Wir sehen ihn, den Herzkranken, den pyrenäischen Ziegenpfad hinaufklimmen (wie zwei Wochen zuvor Heinrich und Golo Mann, zusammen mit Alma Mahler und Franz Werfel) und drüben, gerettet geglaubt, schwer atmend vor spanischen Grenzposten in die Knie gehen. In der Nacht vor der Zurückweisung nahm er Morphium, das KZ vor Augen. Wie ist es zu erklären, daß Geist in unserem Jahrhundert so mißachtet wurde (wird!).
Warum waren die Mansarden unserer Jugend mit Che-Guevara- und Jimi-Hendrix-Postern tapeziert, und niemand kommt auf die Idee, sich ein Porträt von Benjamin, Robert Walser oder Joseph Roth aufzuhängen? Wie heißt es: »Hat hier die Schule versagt?«
Thomas Bernhard
Nun da Minetti tot ist, wird es Zeit, daß wir über Thomas Bernhard reden, dessen dramatisches Werk mit dem großen Schauspieler in ähnlicher Weise verbunden ist wie die Filme von Faßbinder mit Hanna Schygulla. Ich bin ihm einmal im Frankfurter Hof begegnet: narbiges Gesicht und nagelneue Cordhose. Er stand auf, als ich an seinen Tisch trat, eine in heutiger Zeit völlig in Vergessenheit geratene Höflichkeitsbezeigung.
Unehelich geboren, der Vater ein Tischler, der sich nach Berlin verdrückte … Da er von der Mutter »abgeschoben« wurde, kümmerte sich sein Großvater3 um ihn, ein Heimatschriftsteller, der in seinem Enkel jede künstlerische Regung aufspürte und förderte: Singen, Zeichnen, Theaterspielen oder Schreiben. Früh schon erkrankte Thomas Bernhard an einem Lungenleiden, war lange ans Bett gefesselt, und er wurde nur achtundfünfzig Jahre alt: Sein Leben war ein einziges Wundreiben, an seiner Kindheit und an seinem Land. Zunächst sang er noch durchaus heimatverklärende Elogen. Die österreichischen Verhältnisse, für die in unserer Zeit das Grubenunglück von Lassing ein bezeichnendes Beispiel ist, reizten ihn dann aber zu immer neuen Verwünschungen, von Buch zu Buch, von Stück zu Stück. »Die Mimose verletzte gern und zielgenau«, so hat es Ulrich Weinzierl ausgedrückt. Die Österreicher vergalten es ihm mit Haß, mit Skandalen und Prozessen. Der Träger des vaterländischen Staatspreises wurde zum Staatsfeind und Nestbeschmutzer, und während seine Stücke am Burgtheater unter Peymann Triumphe feierten, wurde Bernhard auf der Straße von aufgebrachten Bürgern attackiert.
Wie so manchem seiner Landsleute öffnete sich ihm das deutsche Publikum bereitwilligst. Das Fernsehen verbreitete seine Stücke dankenswerterweise immer wieder bis in die letzte Wohnstube. Zwanzig Jahre lang hat er Dramen geschrieben, wie besessen, unter Produktionszwang, manches Jahr noch einen Roman dazu. Nicht sein geringstes Verdienst ist es, den Konjunktiv, die indirekte Rede wieder literaturfähig gemacht zu haben. Thomas Bernhard, der neben Beckett wohl »düsterste Prophet der Gegenwartsliteratur« (Reinhard Tschapke), nahm eine Sonderstellung ein: Sein immer gegenwärtiger Tod bestimmte die Thematik seiner Werke, aber auch grotesker Humor, kunstvoll entfachter Zorn, eine Prosa der Beschimpfungen. Er war einer Mischung aus »Tod, Musik und Gelächter« (Georg Hensel) verfallen.
Thomas Bernhard, der in seiner Jugend so unbehaust war, kaufte später alte Bauernhöfe und renovierte sie. Es gibt einen Film, in dem man ihn in seinen großen, weißgekalkten Räumen umhergehen sieht. Unheilbar krank, schrieb der Einzelgänger meistens im warmen Süden, in Jugoslawien, Portugal, auf Mallorca, von Helferinnen umsorgt, und neben der Praxis seines Halbbruders, einem Internisten, hatte er eine kleine Wohnung. Ein schwerer Herzanfall schwächte ihn am Ende derart, daß er kaum noch die Zeitung halten konnte. Wenige Stunden nach dem vierzigsten Todestag seines Großvaters ist er gestorben. Bleibt die Erinnerung an ein Fernsehporträt, in Hamburg aufgezeichnet: Er sitzt auf einer weißen Bank unter einem großen Baum. Dort sitzt er heute noch.
Tania Blixen
Am Ende ihres Lebens lag Tania Blixen, die große dänische Schriftstellerin, die nicht nur Hemingway für nobelpreiswürdig hielt, in ihrem Arbeitszimmer auf dem Boden, von großen Schmerzen gepeinigt, und diktierte ihrer Sekretärin letzte Erzählungen. Exzentrisch war sie, in einer Weise, wie das in Deutschland ganz undenkbar wäre. Ganze Tage lag sie ketterauchend im Bett. Mit über siebzig hatte sie noch einen jungen Freund! Im Park ihres Gutes Rungstedlund am Öresund liegt sie unter einer alten Buche begraben, ein Holzkästchen mit afrikanischer Erde im Sarg.
Eigentlich hieß sie Karen Christence Dinesen. Sie war die Tochter eines dänischen Hauptmanns und Schriftstellers, der als junger Mann einige Jahre in Amerika unter Indianern gelebt hatte. Sie studierte an der Kunsthochschule im nahen Kopenhagen Malerei, unternahm Reisen nach Paris und Rom und heiratete den Schlagetot Baron Bror Blixen-Finecke, mit dem sie 1914 nach Kenia ging. In der Nähe von Nairobi betrieben sie eine Kaffeefarm, hundert Meilen südlich des Äquators, »am Fuße der Ngongberge«. Das Herrenleben – befreundet war sie mit dem General von Lettow-Vorbeck – war ganz nach ihrem Geschmack. Man fühle sich auf Safaris, als ob man eine halbe Flasche Champagner getrunken habe, hat sie gesagt. Aber die Fotos von ihr und den Ihren, alle in Weiß mit Tropenhelm – ein Kikuju-Diener wartet sklavisch in der Nähe, das Tablett mit Gläsern in der Hand –, wirken heute doch recht anstößig. Das macht wohl das veränderte Bewußtsein unserer Tage.
Ihr Mann, der berüchtigte Löwenjäger Blixen, der, wie es heißt, einen Schwarzen zu Tode peitschen ließ, weil der sich auf sein Pferd gesetzt hatte, erwies sich als unzuverlässig, besonders in Sachen ehelicher Treue. Er »hurte« herum und holte sich prompt die Syphilis, womit er dann auch seine Frau infizierte. Karen Blixen litt zeitlebens an den Folgen dieser Krankheit. Sie trennte sich von ihm, übernahm die Leitung der Plantage und tröstete sich mit dem englischen Aristokraten Denys Finch Hatton, den sie als »leibhaftiges Ideal« bezeichnete. Gemeinsam hörten sie Schubert-Lieder auf einem alten Grammophon. Im Jahre 1931 kam er zu ihrem Kummer bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Auf ihrem Schreibtisch steht noch heute in silbernem Rahmen eine Fotografie von ihm. Da in der Weltwirtschaftskrise die Kaffeepreise sanken, mußte der Besitz versteigert werden.
Die Baronesse kehrte zu Mutter und Tante nach Rungstedlund zurück. Von ihrem Arbeitszimmer, in dem hundertfünfzig Jahre zuvor der berühmte dänische Lyriker Johannes Ewald gewohnt hatte, blickte sie über die See hin bis zur schwedischen Küste.
Hier schrieb sie – »weil ich nichts gelernt und kein Geld hatte« – an den Erinnerungen weiter, die sie in trostlosen Regenzeiten bereits in Afrika begonnen hatte. Das Buch erschien 1937 unter dem Titel »Out of Africa« zuerst auf Englisch. Die dänische Übersetzung, die sie selbst anfertigte (»Den afrikanske farm«), folgte im selben Jahr. Die erste deutsche Ausgabe trug den Titel »Afrika – dunkel lockende Welt«.