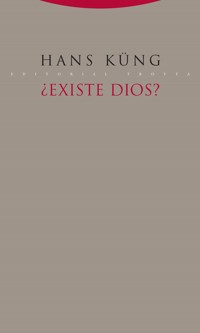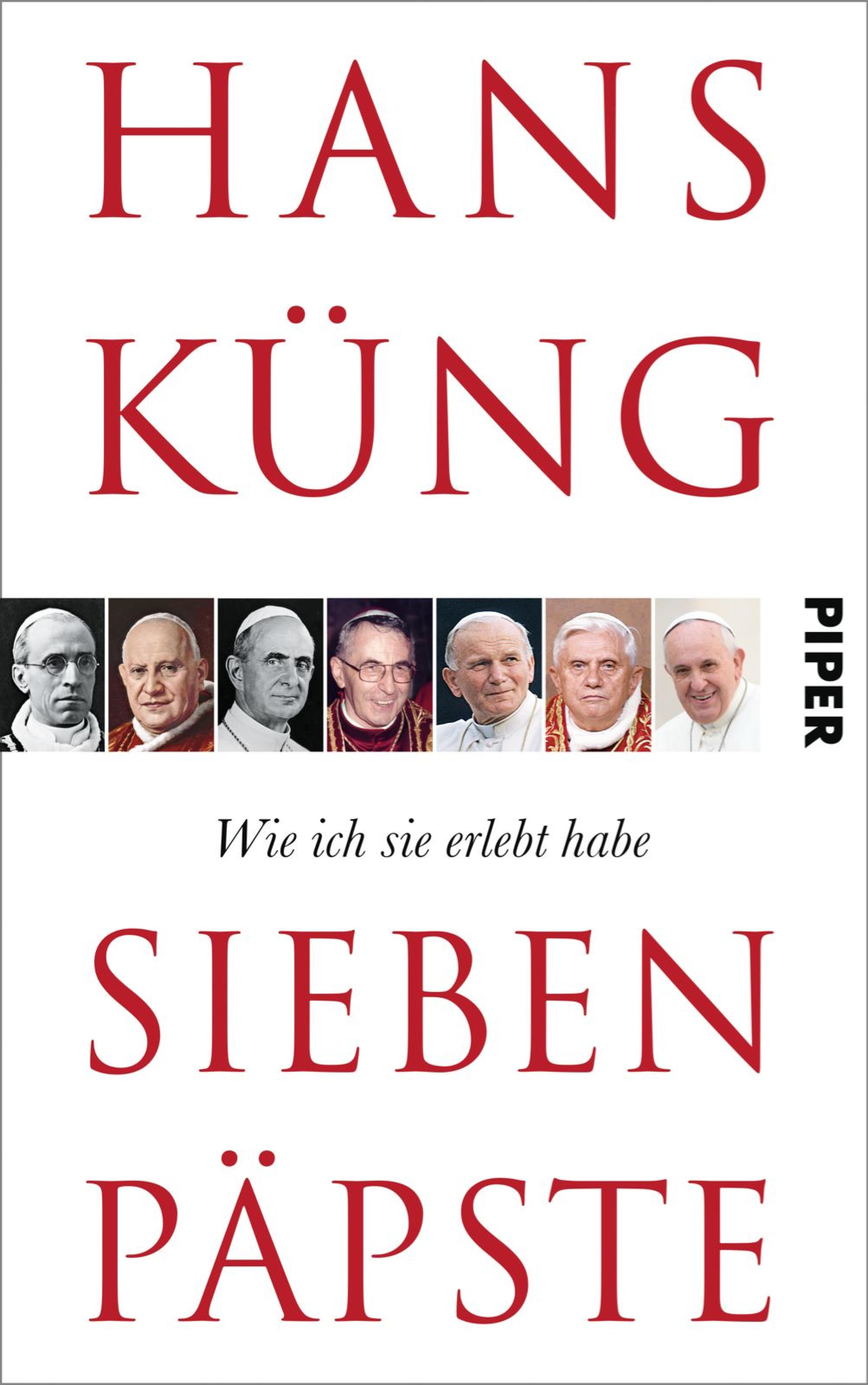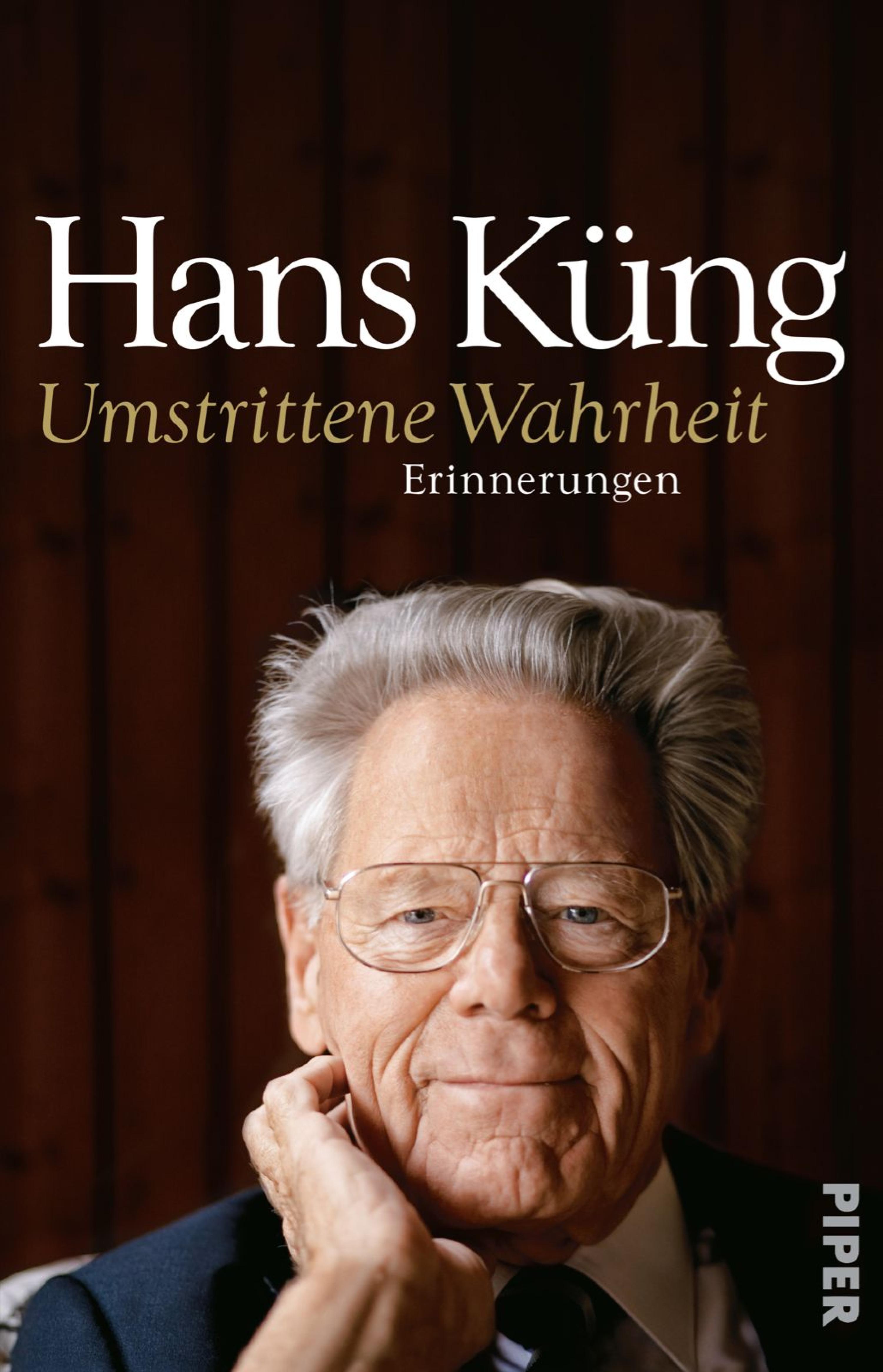
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Anschaulich und leidenschaftlich erzählt Hans Küng von seinem Leben ab dem Umbruchsjahr 1968. Dabei schildert er, wie ihn die dramatischen Veränderungen in Kirche und Gesellschaft geprägt haben und warum er jenen Weg ging, der ihn zum Partner im interreligiösen Dialog, zum Hoffnungsträger für eine erneuerte Kirche und zum meistgelesenen Theologen weltweit gemacht hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
DER UNIVERSITÄT TÜBINGEN MEINER WIRKSTÄTTE DURCH FÜNF JAHRZEHNTE IN GROSSER DANKBARKEIT
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
2. Auflage 2013
ISBN 978-3-492-96698-6
© Piper Verlag GmbH, München 20xx Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München Covermotiv: Maurice Weiss/Ostkreuz Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Prolog
»Wir beide betrachteten dies als rechtmäßige Unterschiede in theologischen Positionen, die zum fruchtbaren Vorangehen des Denkens notwendig sind, und fühlten unsere persönliche Sympathie, unsere Fähigkeit zur Kooperation durch solche Unterschiede durchaus nicht beeinträchtigt.«
Kardinal Joseph Ratzinger 1998 über seine Zusammenarbeit mit seinem damaligen Kollegen Hans Küng in Tübingen1
Es sei mir vergönnt zu erleben, so hatte ich immer gehofft, wer nach Johannes Paul II. der nächste Papst sein würde. Diese Hoffnung hat sich erfüllt, aber völlig anders als ich und alle, die auf einen Papst auf der Linie Johannes’ XXIII. und des Zweiten Vatikanischen Konzils gewartet hatten, es wünschten.
Kein Zweifel, daß die Papstwahl im Jahr 2005 die Bedeutung dieser Lebenserinnerungen, aber auch meine Verantwortung als Autor erheblich erhöht hat. Fast alle meine großen Kampfgefährten für die Erneuerung von Theologie und Kirche seit der Konzilszeit sind tot oder inaktiv, außer einem, und der ist Papst geworden. JOSEPH RATZINGER ist BENEDIKT XVI.
Aus persönlichen wie sachlichen Gründen dürfte ein Vergleich unserer Lebensläufe unter den Bedingungen der zweit en Hälfte des 20. Jahrhunderts höchst aufschlußreiche Analysen bieten von der Entwicklung der katholischen Theol ogie und Kirche, ja der Gesellschaft überhaupt. Es drängt sich mir seit langem die Beobachtung auf, daß unsere sehr verschiedenen Reaktionen auf die »Zeichen der Zeit« etwas Exemplarisches haben für den Kurs von Kirche und Theologie. Dabei wird der Leser nicht selten erstaunt feststellen, wie viele Gemeinsamkeiten sich zeigen, allen Unterschieden zum Trotz. Selbstverständlich will ich nicht den Eindruck erwecken, Joseph Ratzingers und mein Leben seien sozusagen schicks alhaft miteinander verkettet oder ich würde gar mein Leben im Spiegel Ratzingers betrachten. Nein, jeder lebt sein eigenes Leben. Doch ist nicht zu übersehen, daß unsere Lebenswege rund vier Jahrzehnte weithin parallel verlaufen, sich dann intensiv berühren, doch wieder auseinandergehen, um sich immer wieder zu kreuzen.
Wir standen und stehen als katholische Theologen im Dienst der katholischen Kirchengemeinschaft. Aber anders als Joseph Ratzinger habe ich mich in den 60er Jahren entschieden, mich nicht dem hierarchischen römischen System, wie es sich erst im zweiten Jahrtausend institutionell herausbildete, zu verpflichten und in den Dienst einer klerikal-zentralistischen »Weltkirche« zu treten; damit hätte ich mich faktisch auf die Kirchenwelt beschränkt. Vielmehr wollte ich mich gerade als evangelisch gesinnter katholischer Christ und Theologe in den Dienst der Menschen innerhalb und außerhalb der katholischen Kirche stellen und wurde – »hominum confusione Dei providentia – durch der Menschen Verwirrung und Gottes Vorsehung« – befreit und gedrängt, mich intensiv auf die immer wichtigeren Themen der Weltgesellschaft einzulassen. Ohne meine Verwurzelung im christlichen Glauben je aufzugeben, ein Leben in sich erweiternden konzentrischen Kreisen: Einheit der Kirchen, Friede der Religionen, Gemeinschaft der Nationen.
Mehr als »Memoiren«
Mein Lebensweg war freilich keine »organische Entwicklung«, vielmehr ein Weg der ständigen Herausforderungen und Gefährdungen, Krisen und Lösungen, Hoffnungen und Enttäuschungen, Erfolge und Niederlagen. Ich schreibe also eine Kampfgeschichte: wofür ich mich in Wort und Tat eingesetzt habe. Und schreibe zugleich eine Trauergeschichte: was an Reformen nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil möglich gewesen wäre, aber abgewürgt wurde, was sich vorne auf der Bühne und was sich hinter den Kulissen abspielte.
Der Leser verstehe deshalb das Exemplarische dieses Lebens nicht falsch: Ich biete ihm nicht eine Art Bildungs- oder Erziehungsroman, in welchem meine innere Entwicklung oder gar meine Frömmigkeit im Zentrum stehen würde. Also auch nicht das quasi-pietistische Glaubenszeugnis eines Theologen oder einer frommen Seele. Ich möchfe gewiß – auch angesichts der gefährdeten Kontinuität zwischen den Generationen in der Christenheit – bestimmte Lebenserfahrungen weitergeben, in denen sich mancher Leser wiedererkennen möge: Einblick in ein Menschenleben, das dem Leser über Anteilnahme hinaus vielleicht manchmal etwas Lebensweisheit zu vermitteln vermag. Doch ich verarbeite in dieser Autobiographie mehr als nur meine subjektiven Erinnerungen, ich verstehe hier Leben im umfassendsten Sinn. Deshalb sprengt dieses Buch die Dimension von Memoiren. Es verschränkt verschiedene literarische Gattungen und erfordert wegen seiner Vielschichtigkeit auch einen entsprechenden Umfang.
Amerikaner würden ein solches Unternehmen möglicherweise eine »intellectual biography« nennen, in welcher Geschichte der Person und Geschichte der Ideen eng verzahnt sind. Doch geht es in meinen Erinnerungen nicht nur um »Intellektuelles« und »Ideen«, sondern um Existentielles und historische Ereignisse. Lebens-, Kirchen-, Theologie- und Zeitgeschichte fließen so ineinander, ja, auch Werk- und Rezeptionsgeschichte, Chroniken und Reiseberichte.
Sozialgeschichtliche Erkenntnisse helfen, die Zusammenhänge, Prozesse und Strukturen, in denen der einzelne Mensch steht, zu verstehen; sozialhistorische und biographische Methode ergänzen sich. Auch dieser zweite Erinnerungsband wird in Absetzung von einem einseitigen Strukturalismus, der gegenüber Einzelbiographien skeptisch ist, deutlich machen, wie immer wieder einzelne Personen (nicht nur Päpste!) vermögen, auf den Lauf der Dinge steuernden Einfluß auszuüben. Und nicht zuletzt zeigt jede Papstwahl, wie Strukturen und Personen, Institutionen und Mentalitäten dialektisch ineinandergreifen. Der immer wieder neue Blick auf die Entwicklung von Kirche und Gesellschaft hilft mir, die jedem Ich-Erzähler drohende Gefahr narzißtischer Zirkularität zu vermeiden (manche Angaben etwa über meine öffentlichen Auftritte halte ich aus dokumentarischen Gründen für notwendig und verbanne sie bisweilen in den Anmerkungsteil).
In der Tat, Geschichte ist bei allen verlaufsbestimmenden gesellschaftlichen Antriebskräften noch immer das Drama von – keineswegs ständig rational handelnden – Menschen. Vor allem das Drama miterlebter politischer und zeitgeschichtlicher Ereignisse, aber auch das Drama persönlicher Lebens- und Krisenerfahrungen. Nur so lassen sich auch jene harmonisierenden Kirchen-, Theologie- und Konzilsgeschichtsschreiber korrigieren, die Konflikte, die sie nicht miterlebt haben, im nachhinein aus Ignoranz oder Konformismus verharmlosen und Ereignisse und Dokumente allzu einseitig »regierungsfreundlich« interpretieren. Ich werde mich bisweilen kritisch auch über Mitakteure im Drama äußern müssen. Als persönliche »Vendetta« ist das nicht zu verstehen. An Verständnis für andere Optionen und Positionen fehlt es mir nicht. Aber im Entscheidenden geht es nun einmal nicht um irgendwelche persönlichen Empfindlichkeiten, sondern um einen großen Streit um die Wahrheit, der in Freiheit zu führen ist. Und der erfordert oft eine spitze Feder.
Freiheit und Wahrheit sind und bleiben zwei Kernwerte meiner geistigen Existenz. Stets habe ich mich dagegen gewehrt, daß man mir in der großen Auseinandersetzung mit Rom einseitig den Part der Freiheit zuschob, während meinen Gegenspielern der Part der Wahrheit zufallen sollte. Allerdings hat sich gegenüber meinen ersten vier Jahrzehnten in meiner zweiten Lebenshälfte der Akzent immer mehr von der »erkämpften Freiheit« (Bd. I) auf die gerade in der Kirche »umstrittene Wahrheit« (Bd. II) verlagert, die nach meiner Überzeugung in Wahrhaftigkeit verkündet, verteidigt, gelebt werden soll und darf. Nie habe ich mich zu den »Beati possidentes« gezählt, welche die Wahrheit glücklich und stolz zu besitzen meinen. Stets mehr zu den Wahrheitssuchern, die darum wissen, daß gerade Wissenschaftler, Philosophen, Theologen sich unbekümmert um Moden und Trends immer wieder neu um die Wahrheit bemühen sollen und dürfen – mit allen Risiken freilich, die oft mit der Suche nach ihr verbunden sind.
Unser Gedächtnis ist natürlich subjektiv, unsere Erinnerung selektiv. Beide bedürfen stets der Korrektur. Auch in diesem Buch habe ich mir größte Mühe gemacht, Defizite und Verzerrungen möglichst zu vermeiden und, meiner Fehlbarkeit bewußt, in den Quellen zu überprüfen, was zu überprüfen war. Vieles gründet auf unbestreitbaren öffentlichen oder privaten Dokumenten, die, wo nötig, wörtlich zitiert werden. Einzelne Kapitel sind von mehreren Zeitzeugen kritisch gelesen worden. Besonders glücklich bin ich, daß ich in Tübingen einige hochkompetente Freunde um mich habe, die das ganze Manuskript gelesen haben. Ich danke ihnen im Nachwort.
Dankbarkeit bleibt somit die Grundstimmung, in der ich auch diesen zweiten Teil meines Lebensberichts vorlege. Aus dieser Dankbarkeit heraus darf ich meinen Lebensweg vielleicht noch eine kleine Weile in tapferer Heiterkeit weitergehen.
Der welthistorische Horizont
Weltenlauf und Lebenslauf gehen in eins. Wer wie ich im Jahr 1928 geboren ist (oder wie Joseph Ratzinger ein Jahr zuvor), hat in seinem Leben beinahe alle Weltenwenden des Jahrhunderts nach dem Ersten Weltkrieg, mit dem das 19. Jahrhundert faktisch beendet wurde, mitbekommen. Um nur einige Daten der »Weltchronik« zu markieren, die für meine »Lebenschronik« nicht ohne Auswirkung sind:
1928: Mein Geburtsjahr ist das letzte ungestörte Jahr der »Goldenen Zwanziger«, jener Nachkriegsjahre voll der Lebensgier und Vergnügungssucht, der kulturellen Kreativität und Produktivität mit allen Schattenseiten des Elends und der Ausschweifung. Im Jahr daraufjäh unterbrochen durch die »schwarzen Tage der Wallstreet«, die sich zur mehrjährigen Weltwirtschaftskrise auswachsen, die auch Europa trifft, meine Schweizer Heimat und ganz besonders das politisch labile Deutschland. Galoppierende Arbeitslosigkeit und zunehmende soziale Not bilden eine wesentliche Voraussetzung für die Heraufkunft des Nationalsozialismus.
1933: Machtergreifung ADOLF HITLERS, deren unmittelbare Folgen Verhaftungswellen, KZs, antisemitische Zwangsmaßnahmen und die Errichtung einer totalitären Diktatur mit allgemeiner Gleichschaltung sind. in der Schweiz wird die ganz Europa bedrohende nazistische Gewaltherrschaft dramatisch zum Bewußtsein gebracht durch die Radiomeldungen aus unserem Nachbarland Österreich: vom nationalsozialistischen Putsch in Wien und der Ermordung des Bundeskanzlers ENGELBERT DOLLFUSS am 25. Juli 1934, die mich Sechsjährigen zutiefst schockiert. Noch mehr alarmiert uns der dort bejubelte, aber für uns in der Schweiz höchst bedrohliche Einmarsch Hitlers in Österreich am 12. März 1938. Er motiviert mich, sieben Tage vor meinem zehnten Geburtstag, von da an täglich mit leidenschaftlichem Interesse die Zeitung zu lesen, um Bescheid zu wissen, was in der Welt vorgeht. Eine freie Presse – im totalitären Deutschland undenkbar.
1939: Die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs: Deutscher Überfall auf Polen und im folgenden Jahr rasche Besetzung Dänemarks und Norwegens und ein weiterer »Blitzkrieg« gegen Belgien, die Niederlande und Luxemburg und schließlich der Sieg über den »Erzfeind« Frankreich. Höhepunkt der Triumphe Hitlers und der Bedrohung unserer eingekreisten und somit politisch erpressbaren »Insel der Freiheit«. Ich werde zum aktiven Patrioten und einige Zeit später zum jüngsten freiwilligen Ortswehrsoldaten zur Verteidigung der Heimat. Aber Hitler verschont die Schweiz und wagt auch nicht, England anzugreifen. Statt dessen marschiert er 1941 in die UdSSR ein. Japans Überfall auf Pearl Harbor löst die Kriegserklärung der USA an Japan und die Deutschlands an die USA aus. Doch schon das Jahr 1942 bringt die Kriegswende: Stalingrad, Landung der Alliierten in Afrika, später in Sizilien und die Vorbereitung einer englisch-amerikanischen Invasion an der Atlantikküste. In der Schweiz freut man sich schon auf das Kriegsende.
1945: Ende des Zweiten Weltkriegs mit einer Bilanz von etwa 50Millionen Toten und etwa 15Millionen Vertriebenen. Noch vor der Währungsreform 1948 kann ich mit einer Gruppe Luzerner Gymnasiasten auf Einladung der britischen Militärregierung quer durch das weithin zerstörte Deutschland nach Norden fahren, um in einem Zeltlager zwei oder drei Wochen mit deutschen Jugendlichen das Leben zu teilen, ihre Entbehrungen mitzutragen und für Demokratie zu werben. Nazismus und Faschismus sind jetzt erledigt. Doch der Sowjetkommunismus erscheint nach außen stärker denn je, wiewohl er innerlich aufgrund der Politik STALINS politisch, wirtschaftlich, sozial bereits in der Krise steckt. Hoffnungsvolle Ansätze für eine neue Weltordnung: Gründung der Vereinten Nationen in San Francisco, Bretton-Woods-Abkommen zur Neuordnung der Weltwirtschaft und amerikanische Wirtschaftshilfe für den Aufbau Europas – von Stalin für seinen Einflußbereich abgelehnt, was zum Eisernen Vorhang und zur Teilung der Welt in Ost und West führt. 1948 Proklamation der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Im selben Jahr feiere ich meinen 20. Geburtstag, bestehe am Gymnasium in Luzern meine Matura (Abitur) und trete ins Päpstliche Collegium Germanicum in Rom ein, um mich in sieben Jahren Studium in Philosophie und Theologie auf meine seelsorgliche Tätigkeit vorzubereiten.
In Deutschland folgen nach Jahren der Entbehrung in den 1950er und 1960er Jahren Zeiten des Wiederaufbaus, des sozialen Aufstiegs, wachsenden Wohlstands und Konsums. Ab 1960 bin ich Professor in Tübingen und nehme 1962-65 als theologischer Berater (Peritus) am Zweiten Vatikanischen Konzil teil.
1968: Die politisch orientierte Kulturrevolution von Studenten, Intellektuellen und Politikern mit ihren Forderungen nach Emanzipation, Aufklärung, Reform, Transparenz und Toleranz. Bis zu diesem Wendejahr habe ich im ersten Band meiner Lebenserinnerungen meinen Lebenslauf in den großen Linien und im Detail nachgezeichnet. Dies soll nun fortgesetzt werden.
Zeugnisse aus erster Hand: Ratzinger – Küng
Keine Frage ist mir öffentlich und privat vor, während und nach dem Konklave zur Papstwahl 2005 so oft gestellt worden wie diese: Warum sind die Lebensläufe zweier Kollegen und Gesinnungsgenossen bei aller Gemeinsamkeit mit der Zeit so weit auseinandergedriftet? Schon in meinem ersten Memoirenband habe ich auf Parallelität und Divergenz der theologischen Wege von JOSEPH RATZINGER und mir aufmerksam gemacht. Aber die Erfahrungen der allerletzten Jahre und vor allem das genaue Studium von Joseph Ratzingers eigenen knappen, aber inhaltsreichen Erinnerungen »Aus meinem Leben« von 1998 haben mich vieles besser verstehen lassen.
Zwei Lebensläufe sollen in diesem Prolog nur skizziert werden. Sie lassen sich selbstverständlich nur im Kontext übergreifender zeitgeschichtlicher Bewegungen und bestimmter Ereignisse erschließen, gehen aber keineswegs in ihnen auf und sind somit auch nicht nur Produkt einer sozialen Schicht: In beiden Fällen geht es um ein selbst gelebtes und gestaltetes Leben, über das in diesem Prolog authentisch aufgrund der Selbstzeugnisse im Vergleich nachgedacht werden soll. Wer Genaueres wissen will und Belege sucht, lese JOSEPH RATZINGERS Buch »Aus meinem Leben. Erinnerungen (1927-1977)«2. Wer über mein Leben zwischen 1928 und 1968 Genaueres wissen möchte, lese »Erkämpfte Freiheit«, den ersten Band meiner eigenen »Erinnerungen«, auf den ich oft Bezug nehme.
Wie Joseph Ratzingers Erinnerungen sind selbstverständlich auch die meinen subjektiv gefärbt, in etwa parteiisch für die eigene Sicht der Dinge. Jede Geschichte, auch jede Lebensgeschichte, ist gedeutete Geschichte. Doch als Autobiographie, als von uns selbst gedeutete Geschichte, hat sie ihre eigene, durch nichts zu ersetzende Authentizität: Zeugnisse aus erster Hand. Wie Joseph Ratzinger bin ich um größtmögliche Sachlichkeit bemüht, was persönliche Leidenschaftlichkeit – bei ihm verdeckt, bei mir offen – nicht ausschließt. Am 24. September 2005 habe ich meinen alten Tübinger Kollegen nach 22Jahren zum ersten Mal wiedergesehen – dieses Mal als Papst Benedikt XVI. Es dürfte für den Leser wichtig sein zu wissen, daß ich diesen Prolog über die beiden Lebenswege schon lange vor dem Wiedersehen in Castel Gandolfo geplant und verfaßt hatte und er in der ursprünglich erheblich umfangreicheren Fassung wie von selbst zu einer geistigen Vorbereitung auf unser Gespräch wurde.
Auf derselben Wellenlänge?
»Ich hatte in Rom sehr rasch festgestellt, daß wir auf derselben ›Wellenlänge‹ sind, und das ist ja das Entscheidende«, so schrieb ich im Frühjahr 1963 im Hinblick auf meine mögliche Berufung nach Münster/Westfalen an den bereits dort lehrenden JOSEPH RATZINGER. Hatte ich mich geirrt? Nein, das Gemeinsame war damals zweifellos stärker als das Trennende und basierte schon auf strukturell ähnlichen Bedingungen unserer Herkunft. Kein Mensch geht auf in seiner sozialen Zugehörigkeit, und doch ist diese grundlegend für seinen Lebensweg.
Beide stammen wir aus einer konservativ-katholischen Familie und aus einem Alpenland, er aus Bayern, ich aus der Zentralschweiz; wir lieben beide Berge und Seen. Wir sind Alters- und fast Jahrgangsgenossen: Ratzinger ist am 16. April 1927 geboren, ich am 19. März 1928. Aber selbstverständlich wächst ein Beamtensohn in einer Gendarmerie und nach der Pensionierung des Vaters in einem bescheidenen Bauernhaus und schon als Zwölfjähriger in einem klerikalen Knabenseminar anders auf als ein Kaufmannssohn in einem gastfreundlichen Bürgerhaus am Rathausplatz, einem Zentrum für die ganze weitverzweigte Verwandtschaft. Keine wohlbehütet strenge polizeiliche oder geistliche, sondern eine lebendige, weltlich-offene Atmosphäre.
Für uns beide ist humanistische Bildung von Anfang an ein Ideal, und beide besuchen wir ein humanistisches Gymnasium, in dem Latein und Griechisch die Basis des ganzen Unterrichts ist. Aber er führt im Knabenseminar – Vorstufe zum eigentlichen Priesterseminar – ein strikt geregeltes Leben, von dem selbstverständlich alle Mädchen ferngehalten werden. Ich erlebe in den oberen Klassen des relativ liberalen Gymnasiums von Luzern eine durch die (unter Katholiken noch vielfach verpönte) »Koedukation« mit Mädchen höchst positiv veränderte Klassenatmosphäre und Freundschaften fürs Leben. Er bekommt es schon bald mit einer neuen Generation von Lehrern zu tun, entschiedenen Vorkämpfern des Nazismus. Meine Lehrer und Klassenkameraden und -kameradinnen sind allesamt stramm patriotische Nazigegner. Was eine freiheitliche Demokratie ist, lernt er erst viele Jahre später, und sie wird ihm nie so stark Erlebniswelt wie die hierarchische Kirche.
Beide sind wir von der Jugendbewegung geprägt, die für mich kostbare Erinnerungen birgt an eine Jugend mit Bergt ouren, Geländespielen, Wettbewerben und einem freien Leben, das regelmäßiges gemeinsames Gebet und jugendgemäß gestaltete Gottesdienste einschließt: eine von Nazi-Ideen glücklicherweise freie katholiiche Jugendbewegung. Ihm bleibt offensichtlich nichts anderes übrig, als der gleichgeschalteten Staatsjugend, der Hitler-Jugend, beizutreten. Seine schlimmen Erfahrungen der letzten Kriegsmonate in Flugabwehr (Flak), Arbeitsdienst, kurzem Militäreinsatz und amerikanischer Kriegsgefangenschaft entsprechen denen meiner deutschen Mitstudenten aus den Jahrgängen 1927/28 im römischen Collegium Germanicum. Ich verbringe meine ganze Jugend in der Schweiz, einer Insel des Friedens.
Beiden bietet uns in dieser wirren Zeit totalitärer Ideologien die Verwurzelung in der katholischen Kirche eine geistige Heimat, eine weltanschauliche Orientierung und moralische Stütze. Beide sind wir begeisterte Ministranten. Doch die Kirche vor Ort wird für ihn durch den traditionellen Ortspfarrer und den Münchner Erzbischof repräsentiert, für mich durch einen in Auftreten, Kleidung, Mentalität unkonventionellen Jugendpräses, in Wort und Tat überzeugender Verkünder der Frohen Botschaft, ohne den auch ein Dutzend andere nie katholische Priester geworden wären. Meine Kirche ist eine Kirche weniger der Alten als der Jungen. Er hat sich auch ohne einen solchen Jugendpräses zum Priestertum entschlossen, schon von daher ist sein Priesterideal traditioneller, statischer, hierarchischer. Beeindruckt vom Kardinal in Purpur sagt sich der Junge, »sowas« möchte er auch werden.
Beide feiern wir die vorkonziliare Liturgie mit ganzem Herzen mit und kommen schon früh mit den Anfängen der liturgischen Bewegung in Berührung. Aber für ihn ist diese Liturgie voller unergründlicher Geheimnisse, ein verwinkelter Bau, in dem die Orientierung nicht immer leicht zu finden ist, der für ihn aber gerade dadurch wunderbar und eine Heimat ist. Mir erklären die Liturgikvorlesungen an der Gregoriana genau die Geschichte der Liturgie, orientiert an den historischen Forschungen des größten Liturgiewissenschaftlers seiner Zeit, JOSEF ANDREAS JUNGMANN, dessen fundamentales Werk »Missarum solemnia« Ratzinger nie erwähnt. Dieser akkurate Historiker und Anwalt der Volksliturgie hätte ihn aufgeklärt über die ursprüngliche, einfache und verständliche Eucharistiefeier, über all die Verschiebungen in Inhalt und Form, die oft willkürlichen Hinzufügungen, problematischen Neuerungen und nachträglichen Mystifikationen.
Beide studieren wir zunächst Philosophie. Uns beide fesseln gleichermaßen die »Bekenntnisse« des AUGUSTINUS. Doch mit dem rationalen und systematischen Denken des THOMAS VON AQUIN kann er, für den Augustin Leitfigur bleibt, sich weniger anfreunden als ich. Mir imponiert des Aquinaten Wende zum Kreatürlichen und Empiri s chen, zur rationalen Analyse und zur wissenschaftlichen Forschung. Beide lesen wir neben der Philosophie vieles andere: die Romane von Gertrud von Le Fort, Elisabeth Langgässer, Georges Bernanos, Fjodor M. Dostojewski, und im philosophisch-theologischen Bereich Romano Guardini, Josef Pieper, Theodor Häcker, Peter Wust und Theodor Steinbüchel. Aber ich beschäftige mich gleichzeitig intensiv mit der Tiefenpsychologie C. G. Jungs und mit moderner Kunst, dem Marxismus-Leninismus und dem existentialistischen Humanismus JEAN-PAUL SARTRES.
Beide studieren wir anschließend intensiv Theologie, er drei, ich fünf Jahre. Aber er denkt schon zu Beginn seines Universitätsstudiums daran, sich später der wissenschaftlichen Theologie zuzuwenden; er zweifelt an seiner Eignung für die praktische Seelsorge, insbesondere Jugendseelsorge. Ich will in die praktische Seelsorge gehen, womöglich in einer Stadt, und in die Jugendseelsorge, wofür mir freilich von Anfang an eine umfassende zeitgemäße Bildung, mit einem theologischen Doktorat besiegelt, wichtig scheint. Er promoviert 1953 in München über AUGUSTINS Lehre von der Kirche (»Volk und Haus Gottes«); ich 1957 in Paris über meinen berühmten Schweizer Landsmann, den reformierten Theologen KARL BARTH (»Rechtfertigung«). Unter den neueren katholischen Theologen imponiert ihm vor allem de Lubac, mir Yves Congar und Karl Rahner.
Natürlich befassen wir uns beide besonders mit der Exegese des Neuen und Alten Testaments. Aber während ich als Student in Rom vor den rückwärtsgewandten Exegeten der Gregoriana zum Päpstlichen Bibelinstitut nebenan fliehe, wo Professoren es wagen, Dogmen von der Schrift her korrigierend zu interpretieren und dafür später mit Sanktionen des Sanctum Officium bestraft werden, hört auch Ratzinger in München historisch-kritisch arbeitende Exegeten, flieht jedoch vor einer für ihn zu »liberalen« Exegese ins sichere Dogma. Während ich versuche, von der erstarrten neus cholastischen Dogmatik in neuer unmittelbarkeit und Frische den Weg zu der im Neuen Testament bezeugten ursprünglichen christlichen Botschaft zu finden, versucht er gerade umgekehrt, eine kritische Exegese im Gehorsam gegen das Dogma abzufangen. Für mich ist die in neuer Direktheit entdeckte biblische Botschaft, für ihn das Dogma die »gebende Kraft«.
Hier zeichnet sich eine Weggabelung ab, die uns als katholische Theologen in verschiedene Richtungen führt: Für Ratzingers Theologie ist die historische Bibelkritik nur in engen Grenzen willkommen. Sie bleibt für seine dogmatische »Konstruktion« peripher. Für meine systematische Theologie aber wird sie grundlegend; geht es doch um die geschichtliche Wahrheit unseres christlichen Glaubens. Eine Rückkehr zum alten Liberalismus wollten weder er noch ich, allerdings wollte ich auch keine Rückkehr zum alten Dogmatismus. Hier stellt sich für uns beide das theologische Fundamentalproblem nach dem angelegten Maßstab: Bibel oder Dogma? Steht das Dogma unter oder über der Schrift? Ist der Christus des Dogmas vom Jesus der Geschichte her zu verstehen oder umgekehrt?
Zwei Lebensläufe kreuzen sich
Ein merkwürdiges Zusammenfallen: Exakt an demselben 21. Februar 1957, da Ratzinger in München seine Habilitation besteht, absolviere ich in Paris am Institut Catholique, der katholischen Universität, meine »Leęon doctorale« und am Nachmittag die »Soutenance« (Verteidigung) meiner Dissertation über die Rechttertigungslehre KARL BARTHS: »La Justification du pécheur. La doctrine de Karl Barth et une reflexion catholique«. Alles auf Französisch, auch die Diskussion. Gefährlich für mich ist sie (ich habe darüber in Bd.1, Kap. IV: Eine Defensio und eine kleine Lüge, berichtet), weil der auf den jungen Nachwuchswissenschaftler eifersüchtige Barth-Spezialist Professor HENRI BOUILLARD SJ, der aber seine eigene große Barth-Interpretation noch immer nicht abgeschlossen hat, mir seine Forschungen vorenthält und mir bei der Verteidigung, wie ich höre, mehr als ein Dutzend gewichtiger Schwierigkeiten zu machen gedenkt. Ich meinerseits bereite mich ebenfalls peinlich vor, verfüge über einen (für viele Theologen nachher geradezu sensationellen) zustimmenden Geleitbrief von Karl Barth persönlich und führe die muntere Debatte mit dem Florett, so daß Bouillard über seine zweite Objektion nicht hinauskommt. Ein »Drama« war meine Promotion nicht, wohl aber »eine gewonnene Schlacht«.
Joseph Ratzingers »Drama der Habilitation«3 ergab sich daraus, daß der Zweitgutachter, der berühmte Münchner Dogmatikprofessor MICHAEL SCHMAUS, seine Habilitationsschrift wider alles Erwarten ablehnt, da sie »nicht den dabei geltenden wissenschaftlichen Maßstäben genüge«; Ratzinger war »wie vom Donner getroffen« (S.82); seine ganze Zukunftsplanung schien in Frage gestellt. Die von Schmaus in Ratzingers Habilitationsschrift über den mittelalterlichen Kirchenlehrer BONAVENTURA diagnostizierte gefährliche Subjektivierung des Offenbarungsbegriffes ist (und bleibt bis heute) das Fragwürdige an Ratzingers Offenbarungsauffassung.4 In seiner schwierigen Situation kommt dem Habilitanden jedoch die »rettende Idee« (S.87), wie er sich um alle Korrekturen elegant herumdrücken kann: Kurzerhand läßt er die Hauptteile über Bonaventura und die Offenbarung weg und baut dafür den letzten Teil über Bonaventuras Geschichtstheologie, gegen den auch Schmaus nichts einzuwenden hat, zur – nun freilich recht kurz geratenen – Habilitationsschrift aus.
An eine Habilitation denke ich, der ich an Ratzingers Habilitationstag »summa cum laude« zum Doktor der Theologie promoviert werde, nicht, wohl aber an ein Doktorat in Philosophie (»Doctorat ès-lettres«) an der Sorbonne – über die Christotogie des deutschen Philosophen Hegel. Ein Thema, das mich seit Rom fasziniert und für das ich in Paris schon zwei bedeutende Professoren, MAURICE DE GANDILLAC und JEAN WAHL, bei meiner »Soutenance« zusammen mit HANS URS VON BALTHASAR (aus Basel angereist) anwesend, als »Patrons« gewonnen habe. An diesem Sujet arbeite ich seit dem Abschluß der theologischen Dissertation mit höchster Intensität.
Doch zugleich nütze ich das mir von meinem Bischof für die Dissertation von vornherein zugestandene, aber nicht benötigte zweite Jahr für längere Studienaufenthalte in Madrid, London und Amsterdam, um meinen geistigen Horizont und meine Sprachkenntnisse zu erweitern. Nach Deutschland, Italien, Frankreich wollte ich nun auch Spanien und die Niederlande kennenlernen, aber auch generell mein Englisch verbessern. Auch dies ein gewichtiger Unterschied: Während der Bayer Ratzinger fürs Leben gern bayrische Luft atmet und sich seine Karriere in den ersten Jahrzehnten an die (west-)deutschen Grenzen hält, liebe ich, wiewohl in meiner Schweizer Heimat tief verwurzelt, den »Duft der großen weiten Welt«, den »weiten Raum«, um den schönen Titel der Lebenserinnerungen meines evangelischen Kollegen und Freundes JÜRGEN MOLTMANN zu zitieren. »Achte eines jeden Menschen Vaterland, das deine aber liebe«: dieser Spruch des Schweizer Nationaldichters Gottfried Keller ist eines meiner Lieblingsworte. Für viele Deutsche aber ist dies nach Nationalsozialismus, nach Weltkrieg und Holocaust verständlicherweise ein Problem, erst in der Fußballweltmeisterschaft 2006 durch einen frohen, nicht aggressiven Patriotismus relativiert.
Doch vor meinem Philosophiedoktorat an der Sorbonne will ich in die praktische Seelsorge und verlebe 1957-59 fast zwei glückliche Jahre im Herzen der Schweiz. Als Vikar an der Hofkirche zu Luzern arbeite ich in einer Pfarrei, in der die Erneuerung der Liturgie, der Verkündigung, der Seelsorge und der Ökumene in vollem Gang ist und durch die Ankündigung des Konzils mächtig befördert wird. Eine Erfahrung mit Menschen und ihren Nöten, Problemen und Hoffnungen, die Joseph Ratzinger, in seinem Münchner Kaplansjahr 1951/52 in einer traditionellen Pfarrei und schon auf dem Sprung an die Freisinger Hochschule, nicht in gleicher Weise zuteil wird, die meine Theologie jedoch ganz wesentlich bestimmen wird (Bd.1, Kap. V: Bewährung in der Praxis). Ein weiterer gewichtiger Unterschied.
Doch kaum habe ich mich in Luzern eingelebt, erhalte ich von KARL RAHNER die Einladung zum nächsten Treffen der Arbeitsgemeinschaft der deutschsprachigen Dogmatiker und Fundamentaltheologen im Oktober 1957 in Innsbruck. Und dort treffe ich zum ersten Mal nicht nur MICHAEL SCHMAUS, sondern auch meinen Altersgenossen JOSEPH RATZINGER – also nicht erst am Konzil, wie ich im ersten Band meiner Memoiren sage. Er ist jetzt Professor für Dogmatik in Freising und hat bereits eine intelligent sichtende, anerkennende Rezension meiner Dissertation geschrieben: »… für eine solche Gabe verdient Hans Küng den aufrichtigen Dank aller, deren Beten und Arbeiten der Einheit der getrennten Christenheit gilt.« Wir finden uns beide sofort sympathisch, wie sein als Motto über dieses Kapitel gesetzter Text noch 1998 bezeugt. In Innsbruck kommt es jedoch zu keinem längeren Gespräch, denn erst hier bin ich plötzlich mit einer Grundentscheidung bezüglich meiner beruflichen Zukunft konfrontiert: praktische Seelsorge oder Universitätslaufbahn?
Während dieser Theologenkonferenz erklärt mir nämlich Professor HEINRICH FRIES, früher Fundamentaltheologe in Tübingen, jetzt in München, ein philosophisches Doktorat in Paris nach meinem philosophischen Lizentiat sei überflüssig und eine theologische Habilitation in Deutschland unbedingt vorzuziehen. Ich solle mich für das Fach Dogmatik an Schmaus, Rahner oder Volk wenden. Schmaus, nach Rahners Worten von einem »Anbetungsverein« umgeben, kommt für mich nicht in Frage. Rahner selber auch nicht, weil ich mich in Deutschland und nicht in Innsbruck habilitieren möchte. Bleibt HERMANN VOLK, damals hochangesehener Professor der Dogmatik an der seinerzeit größten Katholisch-Theologischen Fakultät Deutschlands in Münster/Westfalen, der später Bischof von Mainz und Kardinal werden sollte. Ihn frage ich und werde angenommen und erhalte zu meinem Unterhalt und theologischen Fortkommen die Stelle eines Wissenschaftlichen Assistenten angeboten. Ich arbeite mein Hegel-Manuskript zu einer Habilitationsschrift aus und meinen Basler Vortrag über »Ecclesia semper reformanda« zu einem Buch für das bevorstehende Konzil.
Gemeinsam am Konzil 1962-65
Auch diese Münsteraner Zeit ist für mich, wie ebenfalls beschrieben, eine glückliche Zeit (Bd.1, Kap. V: Der Weg in die Wissenschaft). Aber nach nicht einmal einem Jahr erhalte ich – ehrenvoll ohne Habilitation wie seinerzeit Karl Barth (dieser sogar ohne Doktorat) aufgrund meiner Dissertation über »Rechtfertigung« und meines 400seitigen Manuskripts über »Menschwerdung Gottes. Die Christologie Hegels« – den Ruf auf den Lehrstuhl für Fundamentaltheologie an der Universität Tübingen. Im Mai 1960, drei Jahre nach meiner Promotion und mit nur kurzer Vorbereitung, trete ich als Ordinarius an. Jetzt darf auch das der Fakultät ebenfalls vortiegende – aus begründeter Sorge vor römischer Intervention gegen meine Berufung zurückgehaltene – programmatische Buch »Konzil und Wiedervereinigung. Erneuerung als Ruf in die Einheit« veröffentlicht werden, das ein Motto des großen Konzilspapstes JOHANNES’ XXIII., für mich bis heute der größte Papst des 20. Jahrhunderts, trägt. Auch Joseph Ratzinger ist 1959 Ordinarius für Fundamentaltheologie an der Universität Bonn geworden.
In Rom sehen wir uns wieder: 1962 fahren wir zwei Professoren der Fundamentaltheologie zum Konzil – er als theologischer Peritus (Berater) des Erzbischofs von Köln, Kardinal Frings, ich als der des Bischofs von Rottenburg (Stuttgart), Carl-Joseph Leiprecht. Wir sind die jüngsten von Papst Johannes XXIII. ernannten Konzilstheologen des Vatikanum II. Profest or Schmaus, ebenfalls Peritus, ärgert sich über diese beiden »Teenager-Theologen«, die hier mehr Gehör fänden als er, und reist ab. Selbst für seine modernere Art Neuscholastik besteht im Konzil kein Bedarf. Über unsere Erfahrungen in diesem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-65) habe ich ausführlich berichtet (Bd.1, Kap. VII-IX).
Ratzingers Tübinger Berufung 1966
Joseph Ratzinger war noch während des Konzils 1963 vom Bonner Lehrstuhl auf den Dogmatik-Lehrstuhl an der Universität Münster in Westfalen hinübergewechselt. Auch ich erhalte 1963, von Ratzinger befürwortet, einen Ruf nach Münster. Doch wegen der mir jetzt in Tübingen zugesagten Gründung eines Instituts für ökumenische Forschung, verbunden mit einem neuen Lehrstuhl für dogmatische und ökumenische Theologie, lehne ich ab und schlage vor, daß Dr. WALTER KASPER, mein vor der Habilitation stehender solider und vielversprechender Assistent, den Lehrstuhl in Münster an meiner Stelle übernehme. Und er erhält ihn auch.
Doch zwei Jahre später engagiere ich mich mit doppelter Kraft – als Dekan und als Inhaber des Parallellehrstuhls für Dogmatik – für die Berufung von Professor JOSEPH RATZINGER nach Tübingen. Inzwischen hat nämlich mein bisheriger Kollege in Dogmatik, LEO SCHEFFCZYK, einen Ruf nach München als Nachfolger seines Lehrers Schmaus angenommen, wo er sich dann als Emeritus nicht zuletzt mit intensiven publizistischen Aktivitäten gegen mich den Kardinalshut verdient hat. Meine Begründung für die Berufung Ratzingers: Er sei der einzige Kandidat im deutschen Sprachraum, der alle von mir angeführten Kriterien für diesen Lehrstuhl für Dogmatik und Dogmengeschichte erfülle; er möge deshalb nicht mit der vorgeschriebenen Dreierliste (»terna«), sondern, wie in Ausnahmefallen möglich, als einziger Kandidat (»unico loco«) Senat und Ministerium vorgeschlagen werden.
Vor meinem außergewöhnlichen Schritt hatte ich, wie im ersten Band meiner Erinnerungen berichtet, mit Ratzinger anläßlich eines Besuches in Münster Anfang Mai 1965 vertraulich über eine Berufung nach Tübingen gesprochen und dann mit verschiedenen Kollegen in Tübingen verhandelt. In einem Brief vom 11. Mai schreibe ich ihm, daß wir den Ruf noch etwas hinausziehen könnten, um ihm den Abschied aus Münster zu erleichtern. Nur müßten wir »in diesem Fall sicher wissen, daß Sie kommen, damit wir nicht schließlich ohne die Taube auf dem Dach und den Spatz in der Hand bleiben«. Darauf antwortete Joseph Ratzinger vier Tage später: Wenn sich die Berufung bis wenigstens Ostern 1966 hinausschieben lasse und wir ihm um seiner Schwester willen eine ordentliche Wohnung bis spätestens Herbst 1966 zusichern könnten, »werde ich mich gerne als Spatz in die Hand der Tübinger Fakultät geben«. Die Fakultät stimmt meinem Antrag nach kurzer Diskussion einstimmig zu, und der Große Senat der Universität bald darauf ebenfalls.
Wie ich zu dieser Zeit von Joseph Ratzinger denke, ergibt sich klar aus dem von mir verfaßten Vorschlag der Fakultät, der mit den Worten schließt: »Das außerordentlich reiche Werk dieses heute 38jährigen Gelehrten, die Spannweite, Gründlichkeit und Ausdauer seines Schaffens, das für die Zukunft noch vieles erwarten läßt, die Eigenständigkeit seiner Forschungsrichtung, welche die Arbeit des zweiten Dogmatikers glücklich ergänzt, aber auch sein großer Lehrerfolg in Bonn und Münster sowie die angenehmen menschlichen Eigenschaften, die eine fruchtbare Zusammenarbeit mit allen Kollegen erwarten lassen, dies alles bildete die Grundlage für die Entscheidung der Fakultät, Joseph Ratzinger dem Großen Senat unico loco für die Besetzung des Lehrstuhles für Dogmatik vorzuschlagen. Seine Berufung nach Tübingen würde auch für die Universität in jeder Hinsicht einen großen Gewinn bedeuten.« Ich kann noch heute zu diesen Worten stehen.
Kollegiale Zusammenarbeit
So wird Ratzinger im Jahr 1966 vom Kultusminister berufen und nimmt den Ruf an. Ich vermittle ihm und seiner Schwester ein schönes Haus mit Garten zur Miete in der Dannemannstraße. Wir arbeiten bestens zusammen. Er liebt das ihm vorgeschlagene Vorlesungssystem: In einem Semester hält er die dogmatische Hauptvorlesung und ich eine Spezialvorlesung, im nächsten Semester ist es umgekehrt. Wir sehen uns regelmäßig in den Fakultätssitzungen, sprechen den Prüfungsstoff ab und prüfen alternativ unsere Studenten – alles ohne Probleme. Wir laden uns auch ab und zu gegenseitig zum Essen ein.
Gelegentlich fährt er, der, nach eigenem Zeugnis technisch unbegabt, keinen Führerschein besitzt und den langen Weg zur Universität statt zu Fuß lieber mit dem Fahrrad macht, in meinem Auto mit. Kein Sportwagen, doch wegen technischer Vorzüge und Sicherheit ein kleiner kompakter Alfa Romeo Giulia, bald ersetzt durch einen entsprechenden BMW! Ein Kontrast, der Journalisten Anlaß zu pseudotiefsinniger Metaphorik bietet. Der Belgier FREDDY DERWAHL fabriziert mit diesem Klischee nach der Papstwahl sogar ein (leider parteiisches und theologisch dürftiges) Buch: »Der mit dem Fahrrad und der mit dem Alfa kam« (München 2006). Solange sich dieser Journalist über meine und Ratzingers Memoiren hermachen kann und über unsere frühen Werke berichtet, ist sein Buch trotz zahlreicher Irrtümer erträglich und bisweilen amüsant. Aber je mehr er aus meinen zentralen Werken das theologische Anliegen herausschälen sollte, um so mehr manifestiert er seine Ignoranz; von den Büchern meiner letzten 25Jahre scheint er keine Ahnung zu haben. Aus dem angekündigten unparteiischen »Doppelportrait« wird zunehmend ein Zerrbild, das den »Fahrradfahrer« idealisiert und den »Alfafahrer« abwertet. Falsche Gegensätze, schiefe Vergleiche, hämische Insinuierung; sogar der Kreuzestod Jesu und der schmerzliche Tod meines mit 23Jahren an einem Gehirntumor gestorbenen armen Bruders müssen für eine haarsträubende Kombination herhalten, um meine Auffassung von Leiden und Sterben von der Ratzingers abzusetzen und herabzusetzen. Des Verfassers Voreingenommenheit verrät schon die Einleitung: Wer in mir von vornherein »einfach den Mann der modernen technischen Intelligenz« sieht, den »die Maschine faszinierte, der explosionsartig sich entwickelnde Fortschritt der Naturwissenschaften«, einen Mann des »Glamour«, hat von mir nichts verstanden. Und wer dagegen die Charaktereigenschaften »spirituell, naturverbunden, musisch« und »intellektuelle Ausstrahlung« exklusiv Ratzinger zuschreiben will, trifft weder ihn noch mich …
Doch sei’s drum: Damals ist der Radfahrer Ratzinger dankbar, daß sein Haus nicht wie meines oben auf einem Tübinger Hügel steht, sondern unten im Tal und er bergauf und längere Strecken hin und wieder in meinem Alfa mitfahren kann. Er und ich wirken drei Jahre kollegial und harmonisch in Tübingen zusammen, wie in seinen »Erinnerungen« und in meinem Memoirenband 1, »Erkämpfte Freiheit«, nachzulesen ist. Nur einen Fall gibt es, in dem er sich nicht nur von mir, sondern von der ganzen Fakultät absetzt: Am 13. Dezember 1968 steht auf der Tagesordnung der Fakultätssitzung die »Angelegenheit Halbfas«. Es liegt ein Antrag der Assistentenschaft vor, uns für den verdienten, aber umstrittenen, ja angefeindeten Religionspädagogen HUBERTUS HALBFAS, der an der Pädagogischen Hochschule unserer Nachbarstadt Reutlingen lehrt, beim Bischof von Rottenburg einzusetzen, damit ihm nicht ohne weitere Überprüfung die kirchliche Lehrbefugnis entzogen wird.
Alle Professoren sprechen sich für ein solches Eintreten aus – außer Joseph Ratzinger, jetzt Dekan. Die Diskussion dauert ungewöhnlich lange, weil er aufjedes Argument eine Antwort weiß, auch wenn diese seine Antworten zueinander oft im Widerspruch stehen. Mich erstaunt seine offensichtlich politisch-dogmatisch bestimmte Opposition gegen ein kollegiales Eintreten. Doch unsere Intervention beim Bischof erweist sich als gegenstandslos, weil der katholische Priester Hubertus Halbfas, zur Erleichterung des Bischöflichen Ordinariats, seine Heirat bekanntgibt; so erfolgt sein Ausscheiden aus dem Lehramt aufgrund der konkordatsrechtlichen Lage quasi automatisch. Doch – dies möchte ich ebenfalls nicht übergehen – in einem weiteren Konfliktfall zeigt Joseph Ratzinger eine andere, erfreulichere seite:
Ratzingers Toleranz
Jeder Professor hat unter seinen Schülern Sorgenkinder, und dies war für mich, aber später auch für Joseph Ratzinger ein bestimmter Doktorand, den ich wegen seines großen Einsatzes im Institut für ökumenische Forschung trotz mittelmäßigen theologischen Abschlußexamens als Doktoranden angenommen hatte: für eine Dissertation über Dogma und Dogmatismus, ein Thema, von ihm gewünscht und für mich aufgrund des theologischen Diskussionsstandes hochaktuell. Er bewährt sich als stets einsatzbereite wissenschaftliche Hilfskraft, so daß ich ihn in jeder Art fördere, ihn auch zur Korrektur meiner Manuskripte heranziehe und zu wissenschaftlichen Kolloquien mitnehme. Er ist stark in Kritik, Polemik, Destruktion des Dogmatismus, hat als »Waffenarsenal« ein ganzes Vokabelheft einschlägiger Hieb- und Stichworte angelegt. Aber ohne solide historische Grundlagen neigt er zu hemmungslosem Spekulieren und Kombinieren von Angelesenem und ist schwach in Konstruktion und kohärenter Ausarbeitung seiner Auffassungen. So hat er denn Mühe, bei aller berechtigten Kritik des Dogmatismus noch eine positive Funktion des Dogmas herauszuarbeiten, das man ja als katholischer Theologe gewiß aus seiner Zeit heraus interpretieren und für unsere Zeit kritisieren soll, aber nicht einfach als von vornherein nutzlos zum alten Eisen werfen sollte.
Nach vergeblichen Anläufen und zahlreichen Korrekturen kommt der Doktorand nach vier Jahren doch zu einem Abschluß. Ich halte seine scharfe Kritik am Dogmatismus für berechtigt und seine Darstellung der grundsätzlichen Bedeutung des Dogmas zumindest für ausreichend. Aber ich kann es meinem Kollegen in der Dogmatik, Joseph Ratzinger, der erwartungsgemäß von der Fakultät zum zweiten Gutachter bestellt wird, nicht verübeln, daß er mir in einem freundlichen Brief vom 3. April 1969 mitteilt, es falle ihm sehr schwer, aber er komme »immer von neuem zu dem Ergebnis, daß ich die Dissertation der Fakultät einfach nicht guten Gewissens zur Annahme empfehlen kann«. Er wolle deshalb das Korreferat zurückgeben.
Kollegial besprechen wir den schwierigen Casus. Ratzinger ist einverstanden, daß unser Pastoraltheologe, Professor GÜNTER BIEMER, den ich darum gebeten hatte, statt seiner das Korreferat übernimmt; er erhält wie ich Ratzingers acht Seiten kritische Einwände. Ich lege in der Folge die Hand für meinen Doktoranden ins Feuer, dieser sei nicht, wie von Ratzinger befürchtet, ein im christlichen Glauben erschütterter Mann. Als erfreulich tolerant empfinde ich in der Folge: Joseph Ratzinger bleibt der entscheidenden Fakultätssitzung fern, um die Mehrheit für meinen Kandidaten nicht zu gefährden. Hier haben sicher seine schmerzlichen Erfahrungen mit der eigenen Habilitation nachgewirkt, die ihn dazu führten, »nicht leicht der Ablehnung von Dissertationen oder Habilitationsarbeiten zuzustimmen, sondern wenn irgend von der Sache her möglich die Partei des Schwächeren zu ergreifen« (»Erinnerungen«, S.89).
So wird denn JOSEF NOLTE, so sein Name, zum Doktor der Theologie promoviert, und ich sorge dafür, daß seine Dissertation unter dem Titel »Dogma in Geschichte« in unserer Reihe »Ökumenische Forschungen« erscheinen darf, mit meinem Vorwort und seinen von beiden Referenten geforderten »Epilegomena« zur Verdeutlichung seiner konstruktiven Intention. Auch so kann Joseph Ratzinger sein. Mit seinen Bedenken hat er übrigens leider nachträglich recht bekommen. Der Doktorand von damals wird ein Jahrzehnt später seinem Doktorvater auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzung mit Rom über die Unfehlbarkeit mit einem »Spiegel«-Essay in den Rücken fallen.
Zwei verschiedene Wege des Katholischseins
Wer weiß, wie es mit Joseph Ratzinger weitergegangen wäre, wenn er Tübingen nicht nach drei erfolgreichen Jahren verlassen hätte. Bisher haben sich unsere Lebensläufe weithin parallel entwickelt: die Lebensläufe zweier Theologen, die aber bei allen Ähnlichkeiten doch von familiärer, kultureller und nationaler Herkunft, aber auch in ihrer psychischen Struktur sehr verschieden sind und schon früh eine recht unterschiedliche Einstellung zu katholischer Liturgie, Theologie und Hierarchie und besonders zu Bibelexegese und Kirchengeschichte, schließlich auch zu Offenbarung und Dogma haben. Die sich aber trotz oder auch wegen der Unterschiede gegenseitig achten und schätzen und einander selbstverständlich als katholische Theologen in ihrer je eigenen Glaubenskraft und Intellektualität anerkennen. Also, wenn man so will, zwei recht unterschiedliche Weisen, Formen, Stile, ja, zwei Wege des Katholischseins.
Dies alles war uns damals natürlich keineswegs so deutlich wie jetzt in der nachträglichen Analyse. Dies hätte auch keineswegs zu einem Bruch führen müssen. Lebten ja doch auch KARL RAHNER und Ratzinger, wie sich ihm im Konzil zeigte, »trotz der Übereinstimmung in vielen Ergebnissen und Wünschen theologisch auf zwei verschiedenen Planeten« (S.131): Rahners spekulativ-philosophische Neuscholastik, im Licht des deutschen Idealismus und Heideggers geprägt, »in der Schrift und Väter letztlich keine große Rolle spielten, in der überhaupt die geschichtliche Dimension von geringer Bedeutung war« (S.131), erschien Ratzinger wie auch mir schon früh überholt.
Rahner gegenüber vertrete ich mit Ratzinger im Prinzip eine »ganz von Schrift und Vätern und einem wesentlich geschichtlichen Denken bestimmte« Theologie (S.131). Allerdings mit dem immer deutlicher werdenden Unterschied: Ratzinger vertritt eine historisch-organische Theologie, welche die Brüche in der Entwicklung und Abweichung vom Ursprung kaum ernst nimmt, die Kritik nur im Rahmen des hellenistischen Dogmas zuläßt und dafür eine »neben der Schrift herlaufende … mündliche Überlieferung« (S.106) als göttliche Offenbarung akzeptiert. Dagegen vertrete ich eine historisch-kritische Theologie, die wie die Bibel so auch die Dogmengeschichte kritisch untersucht und sich an der ursprünglichen Botschaft, Gestalt und Geschick Jesu mißt. Für Ratzinger beginnt das Christentum erst richtig mit dem Zusammentreffen der biblischen Botschaft mit der griechischen Philosophie. Für ihn gehört, wie er als Papst in seiner Regensburger Vorlesung 2006 ausführt, das »kritisch gereinigte griechische Erbe wesentlich zum christlichen Glauben«. Nicht die Kirche des Neuen Testaments interessiert Joseph Ratzinger in erster Linie, sondern immer die »Kirche der Väter« (natürlich ohne Mütter). Sein theologisches Bemühen konzentriert sich nicht – das wird in seinem »Jesus von Nazareth« (2007) überdeutlich – auf den Jesus der Geschichte, von dem her die späteren Dogmen der Kirche für unsere Zeit zu interpretieren sind. Vielmehr auf den Christus der hellenistischen Konzilien, den er überall in die neutestamentlichen Schriften hineininterpretiert.
So werden denn unsere Lebenswege in Zukunft zunehmend auseinandergehen, doch bei wichtigen Gelegenheiten sich wieder kreuzen. Das Jahr 1968 in Tübingen sollte für Joseph Ratzinger, und in anderer Weise auch für mich, zu einem Schicksalsjahr werden. Ein Einschnitt, der mich diesen Prolog beenden läßt, um jetzt zuerst einen Blick auf die Entwicklung der Gesellschaft und der katholischen Kirche nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil zu werfen und dann auf die Ereignisse des Jahres 1968 einzugehen.
I. Römische Provokationen
»Es wird nicht die Autorität des Papstes in Frage gestellt, wohl aber das ›System‹, das ihn gefangenhält … Gewünscht wird die Loslösung – auch des Heiligen Vaters – von diesem System, über das man sich schon seit mehreren Jahrhunderten beklagt, ohne es wirklich fertigzubringen, sich davon zu lösen und es umzugestalten. Denn, wenn auch die Päpste einander ablösen, die Kurie bleibt.«
Kardinal Leon-Joseph Suenens, Primas von Belgien, im April 1969
Was wäre, wenn die drängenden Probleme einer inneren Reform der katholischen Kirche seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-65) statt gestaut gelöst worden wären? Dann könnte ich mir die Mühe sparen, jene Vorgänge minutiös noch einmal zu analysieren, die zu der von zahllosen Gläubigen beklagten gegenwärtigen »Lage der Kirche« geführt haben, die ja auch weitreichende Auswirkungen auf die Gesamtgesellschaft hat. Angesichts des anhaltenden Problemstaus aber fühle ich mich als einer der Zeitzeugen und Mitakteure verpflichtet, für die Nachwelt festzuhalten, welche Prozesse sich nach dem Konzil vollzogen und welche Personen, Kreise, Institutionen die Verantwortung dafür tragen, daß trotz aller Anstrengungen und Erfolge des Vatikanum II dieses »System, das den Papst (und damit auch die Kirche) gefangenhält«, konserviert beziehungsweise restauriert werden konnte. Dies möge als mein bescheidener Beitrag zu einer Erinnerungskultur in meiner Kirche, der katholischen, verstanden werden.
Vorkämpfer konziliarer Erneuerung: Kardinal Suenens
Am 8. Dezember 1965 hatte das Zweite Vatikanische Konzil seine Arbeit nach vier Sessionen (1962-65) abgeschlossen. Jetzt sollten die Dekrete in die Praxis umgesetzt werden. Eine kluge, konstruktive Leitung mit Impulsen nach vorne wie unter Johannes XXIII. hätte die katholische Kirche zusammengehalten und die Polarisierung vermieden. Dies ist meine feste Überzeugung. Doch daran dachte im harten Kern der römischen Kurie niemand. Vielmehr kam es bald schon zu römischen Aktionen, ja Provokationen, welche die Umsetzung des Konzils konterkarieren sollten. Über all dies findet sich in JOSEPH RATZINGERS Erinnerungen kein einziges Wort. Um so deutlicher muß ich davon reden.
Provokationen von Seiten Pauls VI. und der Kurie – in meinem Band »Erkämpfte Freiheit« habe ich davon berichtet – waren schon in der Konzilszeit an der Tagesordnung gewesen. Jeder Teilnehmer am Konzil erinnert sich noch an die päpstlichen Interventionen gegen die Judenerklärung, die Erklärung für die Religionsfreiheit, das bereits approbierte Ökumenismusdekret. Weiter das Verbot jeglicher Diskussion von Zölibat und Geburtenregelung in der Konzilsversammlung sowie die Aufnötigung einer päpstlichen Interpretation (»Nota explicativa«) zur Bestätigung eines unkollegial absolutistisch verstandenen päpstlichen Primats. Schließlich die Proklamation Mariens als »Mutter der Kirche« trotz der Ablehnung durch die Theologische Konzilskommission sowie die der Konzilsversammlung unverfroren vor die Nase gesetzte traditionalistische Eucharistie-Enzyklika »Mysterium fidei« – von all den kurialen Tricks und Intrigen in Geschäftsordnung und Geschäftsführung des Konzils und in den verschiedenen Kommissionen ganz zu schweigen.
Gewiß, nicht wenige Bischöfe gehen als zur Reform wirklich Entschlossene aus dem Konzil in ihre Diözesen zurück. Doch andere versuchen, mit römischer Unterstützung im vorkonziliaren Stil weiterzuregieren. Die bedeutendste Persönlichkeit des Widerstands im Episkopat gegen die kurialen Restaurationsbemühungen ist zweifellos der Primas von Belgien und Erzbischof von Mechelen-Brüssel Kardinal LÉON-JOSEPH SUENENS, der einflußreichste der vier Moderatoren des Konzils. Viele Bischöfe und Theologen hätten diesen klarsichtigen, mutigen und klugen Mann gerne als neuen Kardinalstaatssekretär gesehen, doch Papst Paul VI. will keinen starken Vertreter der konziliaren Erneuerung neben sich.
Suenens ist der bedeutendste Stratege und Rhetor der reformentschlossenen Konzilsmajorität. Das hatte schon seine berühmte Rede gegen Ende der ersten Konzils lession am 4. Dezember 1962 gezeigt, in welcher er ein Gesamtkonzept für das Konzil vorlegte mit der Unterscheidung der Aufgaben der Kirche »ad intra – nach innen« und »ad extra – nach außen«. Suenens ist kein Fachtheologe und kennt seine Grenzen. Doch er verfügt über ein effizientes kleines Expertenteam von der Universität Löwen, das freilich auch verantwortlich ist für den von mir im ersten Band genau analysierten »verhängnisvollen Kompromiß« in der Konstitution über die Kirche aus biblisch orientiertem Communio-Modell (Kap. I-II) und dem trotz aller Konzessionen noch immer mittelalterlich-absolutistischen Pyramiden-Modell (Kap. III).
Während der zweiten Konzilssession, am 15. Oktober 1963, bittet mich Kardinal Suenens zu sich in seine römische Residenz und fragt mich nach Themen für eine Konzilsrede. Er wählt aus meinen drei Vorschlägen entschlossen »Die Charismen in der Kirche« und bittet mich um einen lateinischen Textentwurf. Diesen trägt er, nur geringf ügig verändert, aber verbunden mit der Forderung, auch Frauen zum Konzil einzuladen, dem Konzilsplenum vor und erntet dafür tosenden Beifall. Auf seine Einl adung hin halte ich am 23. Oktober 1963 einen Vortrag im belgischen Kolleg und spreche mit ihm persönlich über die Einführung einer Altersgrenze auch für den Papst (strukturell ein geradezu revolutionärer Schritt), später auch über die Frage der Geburtenregelung mit »künstlichen« Mitteln. Bei einem Mann wie Suenens stoße ich auf Verständnis.
Denn Kardinal Suenens ist – was keineswegs von allen Kardinälen gesagt werden kann – ein Bild von einem Mann. Gegenüber manchen, besonders in ihrer liturgischen Spitzengarnitur »effeminiert«, verweichlicht wirkenden Eminenzen hat der straffe Erzbischof von Mechelen-Brüssel einen aufrechten Gang, kraftvollen Schritt und eine sonore Stimme, die – das Latein mit leicht französischem Akzent – die Konzilsteilnehmer sofort gefangennimmt. Er denkt klar, ist entscheidungsfreudig und beweist im Konzil seine politische Witterung. Er fühlt, was die große Mehrheit denkt, aber nicht zu sagen wagt, und besitzt die Kühnheit, es oft als erster ausgewogen anzusprechen.
Ich darf indes nicht verheimlichen, daß ich ihm gegenüber am Anfang eher mißtrauisch war. Als Professor und Weihbischof hatte er sich vor Jahren für die Legio Mariae engagiert: eine von einem Frank Duff 1921 in Dublin gegründete Laienorganisation im Dienst der Hierarchie, die Selbstheiligung und persönliches Apostolat propagiert auf der Grundlage der »vollkommenen Hingabe an Maria«. Und genau gegen diese forcierte Form von Marienfrömmigkeit hatte ich als Student in Rom, wie berichtet, zunehmend theologische wie praktische Bedenken bekommen (vgl. Bd.1, Kap. III: Mariendogma 1950). Und im Zweiten Vatikanischen Konzil war ja nun bei der großen Mehrheit eine ablehnende Reaktion auf den Marianismus eingetreten, der unter Pius XII. mit der »unfehlbaren« Definition von Mariae Himmelfahrt seinen Höhepunkt erreicht hatte. In einer Kampfabstimmung lehnt das Konzil ein eigenes Konzilsdokument über Maria ab und gestattet nur ein Kapitel in der Konstitution über die Kirche. Kardinal Suenens unterstützt diese Kurskorrektur nachdrücklich. Ihm geht es primär nicht um marianische Frömmigkeit, sondern um praktisches Apostolat, um ein aktives seelsorgliches Bemühen um alle Menschen, vor allem auch die Bedürftigen und Einsamen.1
Mit Kardinal Suenens unterhalte ich auch nach dem Konzil engere Beziehungen. Er ist 24Jahre älter als ich, hat aber großes Vertrauen in meine theologische Sachkompetenz. Verschiedentlich besuche ich ihn in Brüssel. Die Brüsseler Residenz des Primas von Belgien ist – im Vergleich zu seinem Palais am Hauptbischofssitz Mechelen – nicht groß, steht mitten unter anderen hohen Bauten. Ein schönes, lichtes Atrium, auch für Empfänge geeignet, zeigt eine breite freie Treppe, die sich elegant ins erste Stockwerk emporschwingt, wo sich die privaten Räume befinden, alle durch eine offene Galerie verbunden, und wo ich in einem Gastzimmer untergebracht bin. Wir sitzen uns tagsüber in einem der großen Räume im Erdgeschoß bequem gegenüber, er ohne alle hierarchischen Würdenzeichen in einer anthrazitfarbenen Wolljacke. Manchmal spazieren wir in dem rechteckigen Park, der am Rand überdacht ist, um uns vor den Blicken Neugieriger aus den umgebenden hohen Häusern zu schützen, so daß wir in aller Ruhe umhergehen und diskutieren können. Es ist eine Freude, sich mit einem Mann von guter theologischer Bildung, Scharfsinn, Mut und Humor stundenlang bis in die Nacht hinein auszutauschen. Zu allen brennenden Problemen – von der Kurienreform über die im Nachbarland Niederlande besonders aktuelle Zölibatsfrage bis hin zur Fristenlösung bei der Abtreibung – können freimütig die Argumente im Für und Wider erwogen werden.
Kritik am römischen System
Suenens ist einer der wenigen katholischen Bischöfe, welche die im Vatikanum II gängige Kritik am römischen System auch in der nachkonziliaren Zeit aufrechterhalten und aussprechen. Schon 1968 hatte er in einem Buch für »Die Mitverantwortung in der Kirche« geworben.2 Was öffentlich nicht bekannt ist: Mehrfach hatte Suenens versucht, den Papst zu einer Kursänderung zu bewegen, so besonders im Frühling im Blick auf die vorgesehene Enzyklika »Humanae vitae« (sie erscheint trotzdem Ende Juli), dann im Frühling 1969 im Blick auf die Tagesordnung der »außerordentlichen« Bischofssynode (für den Oktober vorgesehen). Alles vergebens. Der Kardinal ist jetzt überzeugt, daß nur eine neue kühne Strategie Erfolg haben wird. Er will vor allem die Bischöfe mobilisieren. Nahestehende Berater warnen ihn vor den Risiken einer öffentlichen antikurialen Intervention jetzt nach dem Konzil. Aber Suenens bleibt bei seiner Überzeugung, daß man nur so die dringend notwendige Kurienreform voranbringen kann.
Wenige Wochen vor dem zweiten Europäischen Bischofssymposion in Chur und nur wenige Monate vor der ersten Außerordentlichen Bischofisynode im Oktober in Rom lanciert Kardinal Suenens am 25. April 1969 sein programmatisches Reformmanifest: ein wohlüberlegtes Interview in den »Informations Catholiques Internationales« und, strategisch geplant, in mehreren bekannten katholischen Zeitschriften der westlichen Welt wie auch der kommunistisch regierten Länder.3 Über viele Seiten hin unterzieht Kardinal Suenens die Regierungs- und Verwaltungspraxis der zentralen Kirchenleitung einer gewiß loyalen, aber erfreulich scharfen, ebenso systematischen wie detaillierten Kritik. Sie ist so aufschlußreich, daß sie in manchen Auszügen auch in der säkularen Presse abgedruckt wird.4
Offen kritisiert der Kardinal das römische System, wie das Motto über diesem meinem zweiten Kapitel zeigt. Er unterscheidet deutlich zwei gegensätzliche Bilder von Kirche. Klarsichtig analysiert und kritisiert er die römische »Blickrichtung vom Zentrum zur Peripherie«: eine mit einem »engen Netz von Einzelvorschriften aufs Zentralisieren angelegte, von Natur juridische, statische, bürokratische und essentialistische Tendenz«, die dazu neigt, »die Ortskirchen als Verwaltungsbezirke anzusehen, die Bischöfe als einfache Delegierte und Ausführungsorgane der Zentralgewalt …«. Dagegen stellt er die Sichtweise von der »Peripherie zum Zentrum«, die er als evangelisch, geistlich und sakramental charakt erisiert: Einheit zu verstehen als brüderliche Gemeinschaft, geregelt durch die Prinzipien der Kollegialität und Subsidiarität, zu der »wesentlich auch die Verschiedenheit gehört«, die »in die Bereiche der Spiritualität, der Liturgie, der Theologie, des Kirchenrechts und der Seelsorge hineingreift«.
Hier sieht Suenens »den Knotenpunkt der Kontroverse«. Ihm zufolge besteht die große Lücke in der Ekklesiologie des Zweiten Vatikanischen Konzils darin, daß die Lehraussagen über die Kollegialität nicht in ihren Folgen für den Papst weiterentwickelt wurden. Mit konkreten Vorschlägen plädiert der Kardinal für eine Aufwertung der nationalen Bischofskonferenzen und ein neues Verständnis der Nuntien (die nicht als Denunzianten tätig sein sollten), für eine aktive Teilnahme von Klerus und Laien an der Bischofswahl, eine weniger autoritäre Ausübung der Autorität, schließlich gegen theologische Repression und römisches Orthodoxie-Monopol für mehr Freiheit in der theologischen Forschung.
Nicht nur Rom, sondern auch die Bischöfe sollen mit dieser grundsätzlichen Stellungnahme des führenden Sprechers der progressiven Konzilsmehrheit auf die nachkonziliare innerkirchliche Vertrauenskrise aufmerksam gemacht werden. Was besonders notwendig ist im Hinblick auf die »Außerordentliche Bischofssynode«, wo die reformfreudigen Bischöte aufgrund der vom Vatikan verordneten tendenziösen Zusammensetzung nur eine Minderheit bilden sollten. Die lateinamerikanischen und afrikanischen Länder, wo die strukturelle Grundproblematik noch nicht in gleichem Maße fühlbar ist, haben seit den Konferenzen von Medellin 1968 und Kampala (für 1970 vorgesehen) eine andere Agenda.
Das öffentliche Echo auf Suenens’ Interview ist höchst positiv, Widerspruch kommt fast nur von Traditionalistengruppen. Diese öffentliche Stellungnahme ist ein historischer Akt im Rahmen einer Gesamtstrategie des Kardinals, die ich voll bejahe. Im Vatikan jedoch ist man so etwas von einem Bischof nicht gewohnt. Wütende öffentliche Reaktionen führender Kurienkardinäle (Felici,Tisserant,Villot und anderer) gegen Suenens sind die Folge. Der Papst selber schweigt zunächst. Natürlich wird Suenens’ Vorstoß besonders im Episkopat aufmerksam beachtet und in der Sache vielfach auch bejaht. Aber: offen sagen dies nur holländische und einige kanadische Bischöfe.5 Besonders verhängnisvoll: Suenens findet unter den einflußreichen deutschen und französischen Bischöfen keine offene Zustimmung. Das opportunistisch-ängstliche Schweigen vieler Bischöfe, ja, die reform- und hollandfeindliche Einstellung gerade der nordwestdeutschen Bischöfe – vor allem Höffner von Köln und Hengsbach von Essen – ist dafür verantwortlich, daß die im Konzil bewährte Erneuerungsvorhut Zentraleuropa schon bald nach dem Konzil auseinanderbricht.6 Wir werden später sehen, wie Papst Paul VI. auf Suenens’ Kritik reagiert und welche Wende der Kardinal selber in nicht allzu ferner Zeit vollzogen hat.
Fortschrittliche Kurienorgane
In einzelnen durch das Konzil entstandenen neuen Organen der Kurie bleibt zunächst der Geist der Erneuerung erhalten. Am effizientesten arbeitet der nachkonziliare Liturgierati der wie schon die konziliare Liturgiekommission von besten Fachleuten besetzt ist, unter der Leitung des kundigen und couragierten Sekretärs Msg. ANNIBALE BUGNINI. Der Liturgierat versteht es, die in Sachen Volkssprache halbherzige Liturgiekonstitution mit Leben zu erfüllen und von Paul VI., der vor dem Konzil nur von einem Wortgottesdienst in der Volkssprache gesprochen hat, die Erlaubnis zu erhalten, daß auch die ganze Mahlfeier samt dem Dankgebet (»Kanon«) in der Muttersprache gefeiert werden darf; vom Schock, den das beim erzkonservativen Stadtpfarrer Laupheimer von Tübingen hervorrief, habe ich im 1. Band berichtet.
Der Liturgierat entrümpelt viele liturgische Texte, eliminiert bestimmte Anachronismen und ungereimtheiten im Ritus, ermöglicht eine verbesserte und erweiterte Ordnung der gottesdienstlichen Schriftlesung und unterstützt die Reform der Sakramentenspendung. Das alles gefällt den kurialen Machthabern (und auch Joseph Ratzinger) gar nicht. Sie erreichen es, daß der hochverdiente Bugnini, unterdessen Sekretär der »Kultuskongregation« geworden, statt zum Kardinal promoviert exiliert wird: Als Inter-Nuntius wird er 1976 von Paul VI. nach Teheran abgeschoben – wie er Freunden gegenüber bemerkt: »hinter dem Schwarzen Meer«, in Anspielung auf Ovid, den gefeiertsten Dichter Roms, der vom Kaiser ans Schwarze Meer verbannt worden war. 1982 stirbt er in Rom. Dabei müßte man doch in der Liturgiereform noch weiter gehen. Denn, wie Kardinal Suenens in seinem zitierten Interview sagt: »Es genügt nicht, einen Text in eine lebende Sprache zu übersetzen, damit er für den Christen von 1969 verständlich wird. Man muß umfunktionieren, von einer Kultur in die andere übertragen usw.«
Konstruktiv arbeitet auch das Einheitssekretariat, jetzt unter der Leitung meines Freundes, des holländischen Kardinals JOHANNES WILLEBRANDS. Er macht große Anstrengungen, um die Verständigung der christlichen Kirchen voranzubringen. »Du möchtest sicher mehr tun, wenn du könntest!«, habe ich ihm schon während des Konzils, zum Mittagessen eingeladen, gesagt. Er dankte mir für mein Verständnis. Aber was konnte er konkret erreichen?
Alle wichtigen Verlautbarungen des Einheitssekretariats müssen mehr denn je vom Heiligen Offizium abgesegnet werden, das sich jetzt »Kongregation für die Glaubenslehre« nennt, aber sich noch immer als die frühere »Suprema Congregatio Inquisitionis« die Oberhoheit in der Lehre zuschreibt. Und was gehört in Rom nicht alles zur »Glaubenslehre«, zur »gesunden Lehre«! Und so wird mein Kardinal Willebrands zwar nicht wie oppositionell gesinnte Bischöfe domestiziert oder wie Msg. Bugnini exiliert, wohl aber wie andere nichtitalienische römische Würdenträger kurialisiert. Drei verschiedene Methoden, habe ich herausgefunden, um konziliare Erneuerer unter kuriale Kontrolle zu bringen: Domestizierung, Exilierung oder Kurialisierung. Aber keine so richtig geeignet, einen unbequemen Tübinger Theologen lahmzulegen; was wird ihnen wohl einfallen?
An schönen Verlautbarungen und zahlreichen ökumenischen Besuchen fehlt es im Einheitssekretariat nicht. Aber in der zentralen ökumenischen Frage der Ämteranerkennung und der Abendmahlsgemeinschaft zwischen den Kirchen geht es keinen Schritt voran. So bin ich froh, daß ich nicht zu dieser oder einer anderen Kommission eingeladen werde; ich gelte nun einmal als »radikal« und »gefährlich«, weil ich es wage, die wirklichen Fragen von der Wurzel (lat.: radix) her anzugehen, sie unzweideutig und klar zu formulieren und mich nicht abwimmeln zu lassen. Doch unter solch autoritärem kurialem Regime Kommissionsarbeit zu leisten ist verlorene Zeit. Immer wieder kommt mir das Wort meines amerikanischen Freundes John Courtney Murray, Inspirator des Konzilsdekrets über die Religionsfreiheit, in den Sinn: »Hans, the world has not been redeemed by a commission«, »die Welt ist nicht durch eine Kommission erlöst worden«. Doch was tun angesichts immer neuer römischer Provokationen?
Provokation I: Zementierung der Machtstruktur
Dies erscheint auch mir als Geburtsfehler des Konzils: Bei allen positiven Impulsen gelingt es ihm nicht, die institutionell-personelle Machtstruktur der zentralistischen Kirchenleitung im Geist der christlichen Botschaft entscheidend zu verändern. Der Papst, die meisten Organe der Kurie und viele Bischöfe geben sich deshalb trotz aller unumgänglicher Wandlungen noch immer weithin vorkonziliar; man scheint aus dem Konzil wenig gelernt zu haben. An den Schalthebeln der Macht in Rom, in den Nuntiaturen und in manchen Kirchengebieten sitzen noch immer Persönlichkeiten, die mehr an der Bewahrung des bequemen Status quo und ihrer Machtposition als an ernsthafter Erneuerung interessiert sind. »Internationalisierung« – eine Forderung des Konzils – nützt da wenig. Manche in die Kurie berufene Deutsche, Franzosen, Lateinamerikaner sind römischer als die Römer, ja manchmal verbissener als sie.
In aller Stille arbeitet im Vatikan auch die Kodex-Kommission, die Kommission zur Reform des kirchlichen Gesetzbuches, des Codex Iuris Canonici. Sie steht unter der Leitung des früheren Generalsekretärs des Konzils, jetzt Kardinal PERICLE FELICI, ein mit allen Wassern gewaschener Kurialer. Wie schon im Konzil sorgt er auch in der Kodex-Kommission dafür, daß nichts beschlossen wird, was den Einfluß der römischen Kurie entscheidend mindern könnte. Bei allen Vereinfachungen und Klärungen bleibt der neue Kodex im Grund der alte: Er dient der Sicherung der bestehenden Machtstruktur. Und dies ganz praktisch: Rom hat das Recht immer auf seiner Seite; das wird für meine künftigen Auseinandersetzungen zu beachten sein. Ein solches Kirchenrecht verhindert, gerade weil es in manchen Ländern vom Staatsrecht (»Staatskirchenrecht«) gestützt wird, daß die kirchliche Erneuerung, wie in weitesten und lebendigsten Kreisen von Volk und Klerus für dringendste Probleme (etwa Priesterehe und Nachwuchs an Priestern) gewollt und angestrebt, zum Durchbruch kommen kann. So läßt sich die vorkonziliare Machtstruktur nicht nur erhalten, sondern nach dem Konzil neu zementieren.
Immer deutlicher wird mir: Dieses Kirchenrecht, das ein mittelalterlich-absolutistisches Kirchenverständnis tradiert, verschafft Rom auch in einem demokratischen Zeitalter den Freiraum, um möglichst ungehindert in allen Kirchen der Welt schalten und walten zu können. Und für die Aufrechterhaltung dieser uneingeschränkten römischen Herrschaft sind vor allem die Bischofsernennungen in aller Welt das entscheidende Instrument. Die durch das Konzil vorgeschriebene Demission der Bischöfe mit 75Jahren wird von der Kurie selbstherrlich höchst selektiv gehandhabt. Die Rücktrittserklärung konziliar gesinnter fortschrittlicher Bischöfe wird sofort angenommen und in einzelnen Fällen gar provoziert, der Rücktritt wichtiger kurial gesinnter Bischöfe aber unter Berufung auf den »besonderen Wunsch des heiligen Vaters« abgelehnt.
Das alte römische System fürstlicher Dispensen und Privilegien und einer sakral verschleierten Günstlingswirtschaft funktioniert also wieder. Denn zugleich werden zuallermeist nur noch mit einem Fragebogen der Nuntiaturen getestete, unbedingt linientreue Bischöfe ernannt und Kardinäle kreiert, die sich in allen umstrittenen Fragen von der Geburtenregelung bis zu Kirchenorganisation und Ökumene auf die römische Linie festgelegt haben oder sich vor der Wahl festlegen lassen. Manche kenne ich: gutwillige Männer, gewiß, aber oft ohne Weitblick und Freimut, jedenfalls gefügige Beamte der römischen Zentrale. Also gerade nicht, wie vom Konzil durch die Betonung der Bischofsweihe als Sakrament gewünscht, eigenständige Leader (»Hirten«), die ihre Diözese, gewiß in Gemeinschaft mit dem Papst, schriftgemäß und zeitgemäß leiten wollen.