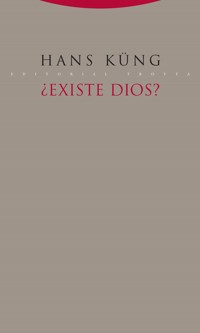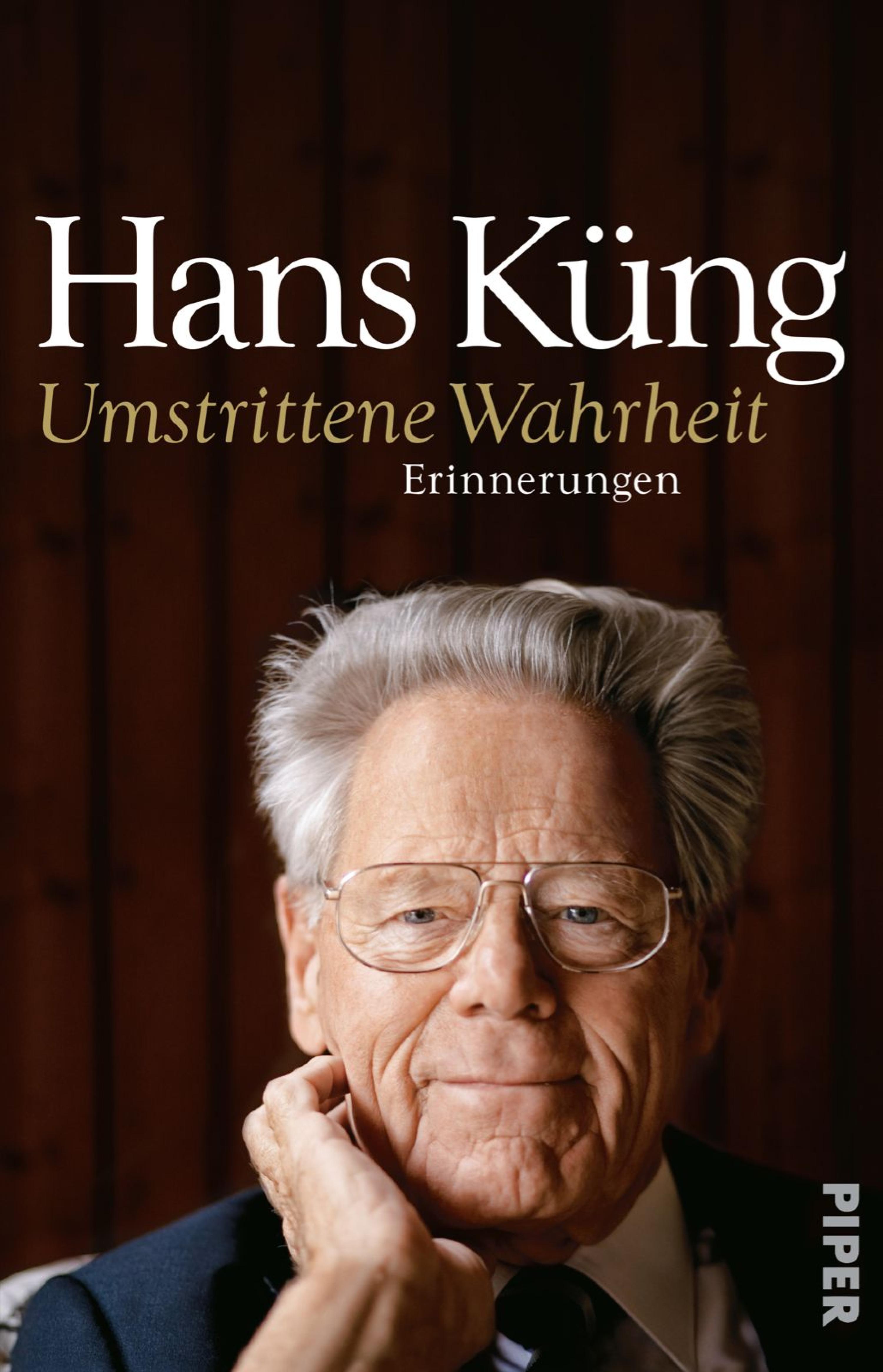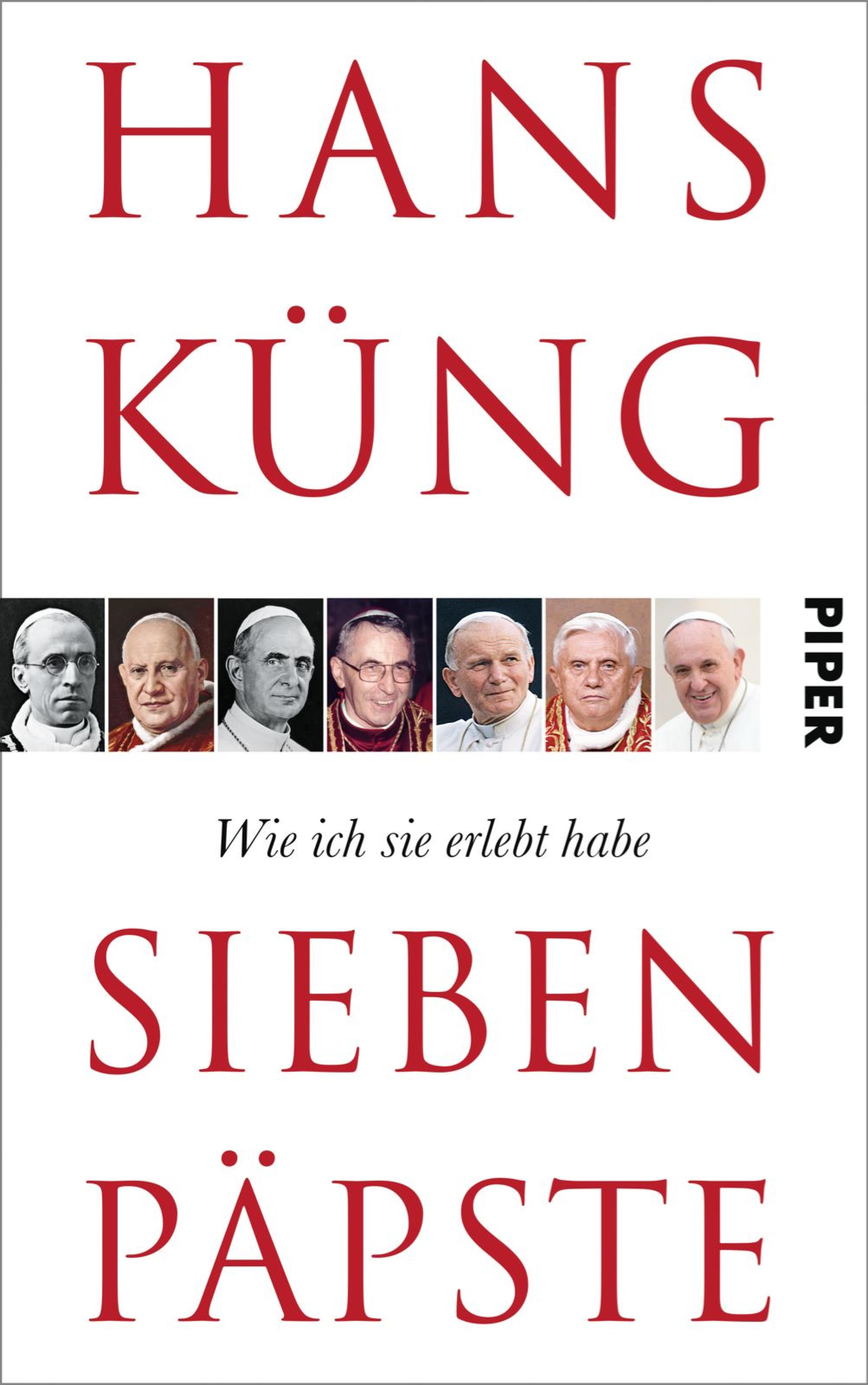14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Mit großer Offenheit erzählt Hans Küng das Leben »meiner letzten drei Jahrzehnte«. Er beschreibt, wie der Versuch der römischen Kirche scheitert, ihren gefährlichsten (weil aus dem Inneren der Kirche stammenden) Kritiker zu isolieren. Die Macht des Papstes reicht auch im ausgehenden 20. Jahrhundert noch weit und könnte das Leben eines Priesters und Professors zerstören. Küng aber wehrt sich – und bleibt Sieger. Er erschließt sich neue Felder, von der Ökumene der Weltreligionen bis hin zum epochalen »Weltethos«, und wird weltweit als einer der großen wegweisenden Denker gesehen. Bunt, spannungsreich, aufregend sei sein Leben gewesen, resümiert Küng, und lässt den Leser teilhaben an Kämpfen und Krisen, an Begegnungen mit den Großen der Erde und seinen eigenen Erkenntnissen über sein Leben. Denn damit schließt das Buch, mit persönlichen Antworten auf die großen Fragen eines jeden Menschen am Ende des Lebens: War es das wert? Wie will ich sterben? Was kommt dann?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2015
ISBN 978-3-492-96370-1
© 2013 Piper Verlag GmbH, München Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München Umschlagmotiv: Paul Swiridoff. Copyright by Archiv/Museum Würth, Künzelsau Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
DEN MENSCHEN, DIE MICH GETRAGEN HABEN,
IN DANKBARKEIT GEWIDMET
Rechenschaft. Meine letzten drei Jahrzehnte
Das Leben geht weiter – aber wie!? So hatte ich mich vor drei Jahrzehnten nach den dunkelsten Wochen meines Lebens selber gefragt. Und kann es heute in einem Wort sagen: besser als damals vorauszusehen!
Der erste Band meiner Lebenserinnerungen, »Erkämpfte Freiheit«, schildert den Zeitraum von 1928 bis 1968 mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil als theologischem und kirchengeschichtlichem Höhepunkt. Der zweite Band unter dem Titel »Umstrittene Wahrheit« stellt die Jahre von 1968 bis 1980 dar und erreicht den Tiefpunkt im Entzug meiner kirchlichen Lehrbefugnis. Wie beim ersten und zweiten handelt es sich auch in meinem dritten und letzten Band, der die Zeit von 1980 bis heute behandelt, nicht einfach um »Memoiren« im üblichen Sinn, sondern um Erzählung und Reflexion zugleich: um Zeit-, Kirchen-, Theologie- und Religionsgeschichte, erlebt von einem Zeitzeugen und Theologen. Erlebte Menschlichkeit mit all ihren Licht- und Schattenseiten.
Aber wie die ungeheure Stofffülle bewältigen und ordnen? Sollte ich chronologisch oder systematisch vorgehen? Ich entschloss mich zu einer thematischen Bündelung in einzelne Kapitel – allerdings auf dem Hintergrund des chronologischen Ablaufs der Ereignisse. So bemühte ich mich, die in Memoiren notwendige Ich-Bezogenheit durch eine starke Sach-Bezogenheit auszugleichen. Ich betreibe kein »Name-dropping«, sondern möglichst umfassende zeitgeschichtliche Dokumentation. Ich befolge den Ratschlag des großen »Homme de Lettres« Walter Jens, meines Freundes, der am 9.Juni 2013 verstorben ist: »Du darfst in deiner Autobiographie über alles schreiben, nur muss es immer einen Bezug zu dir haben«.
Für mich ist es eine erneut spannende, konfliktreiche und ergebnisreiche Geschichte, bei der ich oft, statt breit zu erzählen, zuspitzen, statt Details zu addieren, resümieren muss. Meine persönliche Erinnerungsgeschichte lässt sich nun einmal von der Geschichte der kirchen- und weltpolitischen Kontroversen nicht trennen, und die Darstellung der großen Gedankengänge lässt sich oft an kleinen Abläufen treffend illustrieren. Anekdoten dienen dabei nicht nur der Auflockerung und Erheiterung, sondern oft auch der Erhellung des Grundsätzlichen. Auf diese Weise wird mancher Leser sich darüber freuen, Weltreligionen, Weltgeschichte und Weltpolitik in einem kennenzulernen. Und so hoffe ich denn, dass viele Leser die Ausdauer haben, das notgedrungen umfangreiche Buch ganz zu lesen, auch wenn ich verstehen kann, dass der eine oder andere aus den zwölf Kapiteln zunächst dasjenige auswählt, das ihn oder sie am meisten interessiert.
Der Entzug der kirchlichen Lehrbefugnis unmittelbar vor dem Weihnachtsfest 1979 war für mich eine zutiefst deprimierende Erfahrung. Doch bedeutete sie zugleich den Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Ich konnte eine ganze Reihe neuer Themen in den Blick nehmen, die nicht nur die Kirche, sondern die Menschheit bewegen: Frau und Christentum, Theologie und Literatur, Religion und Musik, Religion und Naturwissenschaft, den Dialog der Religionen und Kulturen, den Beitrag der Religionen für den Weltfrieden und die Notwendigkeit eines gemeinsamen Menschheits- oder Weltethos.
All diese Arbeit konnte selbstverständlich nicht nur am Schreibtisch geleistet werden, so wichtig die akademische und publizistische Tätigkeit in diesem Kontext auch war. Sie führte zu ungezählten Reisen weltweit und zu zahllosen Begegnungen mit bedeutenden und weniger bedeutenden Zeitgenossen aus Religion, Politik, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft und hatte mit Universitäten ebenso zu tun wie mit Einblicken in die konkrete Lebenswelt, mit der UNESCO ebenso wie mit den Vereinten Nationen, mit dem Weltwirtschaftsforum in Davos ebenso wie mit dem Parlament der Weltreligionen in Chicago. Sie fiel in eine Periode, in der sich die Welt in bisweilen dramatischer Weise neu orientierte und ordnete. Und so muss ich beim Erzählen meiner Lebensgeschichte immer auch die welthistorischen Entwicklungen im Auge behalten. Doch bei allen Irrungen und Wirrungen hat sich mein grundsätzlicher Standpunkt, der eines aufgeklärten, ökumenisch offenen und gesellschaftskritischen Christen, nicht geändert. Ich habe diese meine ganzheitliche Weltsicht unterdessen in einer Synthese meiner Spiritualität dargelegt unter dem Titel »Was ich glaube« (2009).
Natürlich wird man sich beim Lesen der Kapitelüberschrift »Rechenschaft« fragen, vor wem ich denn da Rechenschaft ablegen will. Schulde ich denn überhaupt jemandem Rechenschaft? Über mein privates, persönliches Leben jedenfalls nur dem Einen, von dem im Römerbrief des Apostels Paulus die Rede ist: »Es wird also jeder für sich selber Rechenschaft ablegen müssen – vor Gott« (Röm 14,12). Doch habe ich ja nun auch immer als öffentliche Person gelebt und gewirkt, war oft ein »umstrittener« Theologe, wurde von meiner eigenen Kirchenleitung mehrfach zur Rechenschaft gezogen, ja gezwungen und verkörperte für viele einen alternativen Weg des Katholischseins. So habe ich begreiflicherweise ein Interesse daran, dass die amtskirchliche Sicht nicht das Monopol besitzt über die Geschichtsschreibung und die öffentliche Meinung.
Aber letztlich sehe ich meine letzten drei Jahrzehnte in einem durchaus positiven Licht. Ich habe viel Menschlichkeit im wahrsten Sinne des Wortes erfahren und durfte mich, gegen alle Formen von Unmenschlichkeit, einsetzen für mehr Menschlichkeit in der Menschheit: für die Einheit der christlichen Kirchen, für den Frieden der Religionen, für die Gemeinschaft der Nationen. Und es macht mir schlicht Freude zu berichten, wie sehr vieles sich in meinem Leben und Wirken bei allen Kämpfen hoffnungsvoll entwickelt hat. Dass ich diese Rechenschaft über 33 Jahre noch abschließen kann, konnte ich nicht vorhersagen und ist für mich eine unverdiente Gnade.
Doch zur Menschlichkeit gehört auch Sterblichkeit. Auch dieser möchte ich mich in diesem meinem letzten Band, und besonders im Epilog, stellen: auch hier die Wahrheit in Wahrhaftigkeit!
I. Zu neuen Ufern
»Seit Beginn Ihres Pontifikats und besonders seit der Erklärung der Glaubenskongregation vom 18.Dezember 1979 habe ich ja direkt wie indirekt immer wieder dem Wunsch nach einem klärenden Gespräch mit Ihnen Ausdruck verliehen und die Möglichkeit zu lernen wahrhaftig nie ausgeschlossen. Ich bin und bleibe zu einem solchen Gespräch bereit, wann und wo immer Sie es wünschen.«
Handschreiben an Papst Johannes Paul II. aus Sursee/Schweiz vom 25. August 1980
Nach der großen Konfrontation mit Rom und dem deutschen Episkopat vom 18. Dezember 1979 bis zum 10.April 1980 um meine kirchliche Lehrbefugnis, um meinen Lehrstuhl und das Institut für Ökumenische Forschung, drängt sich mir auf: Es wäre sinnlos, täglich Tränen zu vergießen, weil der gegenwärtige Papst mich nicht schätzt und mich nie einer Antwort würdigt. Auch mein »streng persönliches« Handschreiben an den Papst vom 25. August 1980, geschrieben in meinem Schweizer Seehaus, blieb unbeantwortet: Bis zum Tod dieses Papstes im Jahr 2005 wird es nie zu einem persönlichen Briefwechsel oder gar Gespräch kommen – ganze 25 Jahre lang. Doch ein Weiteres kommt hinzu: Meinen Namen in der theologischen Wissenschaft möchte ich keinesfalls auf das Etikett »Unfehlbar?« reduziert wissen; »Papstkritiker« und »Kirchenkritiker« war und wird nicht mein Beruf. Nein, es gilt zu neuen Ufern aufzubrechen! Gewiss, die Verbindung mit der alten Heimat lasse ich nie abreißen. Aber lieber als mich auf die Probleme des römisch-katholischen »Binnengewässers« zu fixieren, will ich mich jetzt noch mehr als früher hinauswagen auf die »Weltmeere« der Religionen und Kulturen.
Kräfte sammeln: ein »Ketzerschicksal«?
Ich setze ein, wo ich im zweiten Band meiner »Erinnerungen« aufgehört hatte: im Jahr 1980. Endlich kann ich einen wohlverdienten Erholungsaufenthalt auf der Insel Kreta antreten – die monatelangen Auseinandersetzungen hatten doch an meinen Kräften gezehrt. Welche Freude: im Monat Mai – nach den Erfahrungen meiner sieben römischen Studienjahre der klimatisch angenehmste Monat: warm, aber nicht heiß! – für drei Wochen auf dieser Insel im Süden des Ägäischen Meeres! Schon am Morgen vor dem Frühstück hinausschwimmen in die Bucht, tagsüber noch mehrmals. Auch Wasserski wieder einmal üben. Vor allem aber an der Sonne in aller Ruhe lesen, was ich will, und nicht, was ich muss. »Nichts Schönres unter der Sonne, als unter der Sonne zu sein« (Ingeborg Bachmann).
Nur wenige Bücher habe ich mitgenommen, darunter auch – doch dies war wohl ein Fehler – ein kenntnisreiches, im Jahr zuvor erschienenes Buch mit dem Titel »Ketzerschicksale. Christliche Denker aus neun Jahrhunderten« (Berlin 1979). Autor ist der hochkompetente, damals bereits 84-jährige Kirchenhistoriker EDUARD WINTER, der selber leidvolle Erfahrungen mit der römischen Machtkirche durchstehen musste. Er hatte mir dieses Buch – gleichsam sein geistiges Testament – zugeschickt. In einem großen Bogen behandelt er darin die Schicksale offen oder verdeckt »ketzerischer« Denker vom 12. bis zum 20.Jahrhundert, die der Wahrheit mehr gehorchten als der kirchlichen und weltlichen Macht und dafür zu leiden hatten: von Joachim von Fiore über Nikolaus von Kues, Kopernikus, Kepler, Pascal und Leibniz bis zu Anton Günther, Franz Brentano und Herman Schell. Für mich zumeist bekannte Gestalten, aber hier speziell gesehen in ihrem Widerspruch zu herrschenden Lehren und Auffassungen.
Ein bewegendes Buch, das mich ermutigen sollte, mich aber oft niederdrückte. Konnte ich doch den Gedanken nicht verscheuchen: Wirst du vielleicht auch noch als »Ketzer« – ursprünglich eine ehrende Selbstbezeichnung der südfranzösischen »Katharer« (griech.: »die Reinen«) – in die Geschichte eingehen? Zuallermeist wollten ja die in diesem Buch behandelten »eigenständigen Denker nicht als Häretiker gelten, zum einen, weil sie sich nicht als Gegner der Kirche fühlten, sondern eine bessere Kirche erstrebten, zum anderen, weil sie wussten, was die Abstempelung als Ketzer für sie zur Folge hatte – Diffamierung, ja physische Vernichtung«, so Eduard Winter in seiner Einleitung. Aber, frage ich mich, stimmt denn das von ihm seinem Buch vorangestellte Wort wirklich: »Das Allerstärkste auf Erden ist eben doch der Gedanke. Ihm die Bahn zu verschließen, gelingt auf die Dauer keiner Gewalt und keiner List!«?
Das Wort stammt von dem an der Schwelle zum 20. Jahrhundert berühmtesten katholischen Theologen Deutschlands, dem Würzburger Dogmatikprofessor HERMAN SCHELL (1850–1906). Er hatte die in vielen Auflagen erschienenen Schriften »Der Katholicismus als Princip des Fortschritts« (1897) und »Die neue Zeit und der alte Glaube« (1898) geschrieben. Programmschriften des deutschen Reformkatholizismus, die schon unmittelbar vor Weihnachten desselben Jahres, am 15. Dezember 1898, von Rom auf den »Index der verbotenen Bücher« gesetzt werden! Und Schell? Er unterwirft sich, um seinen Lehrstuhl zu behalten, bleibt aber vehementen Angriffen römisch gesinnter »Antimodernisten« ausgesetzt. Die Korrespondenz mit seinem Lehrer und Freund, dem Philosophen FRANZ BRENTANO, der wegen des Unfehlbarkeitsdogmas (1870) am Karfreitag 1873 in einer Unterredung mit dem Würzburger Bischof auf geistliches Amt, Professur und Kirchenmitgliedschaft verzichtet hatte, spricht Bände. Und zwar über das schon damals fatale Dilemma vieler Katholiken, zwischen römisch-katholischem Glauben und dem Ethos der Moderne, zwischen Kirchlichkeit und Wissenschaftlichkeit, zwischen kirchlichem Gehorsam und geprüftem Gewissen. Unter dem fanatischen Antimodernistenpapst PIUS X. (bei dessen höchst anfechtbarer Heiligsprechung durch den zusehends ebenfalls antimodernen Pius XII. 1954 in Rom bin ich als Student zugegen) verstärkt sich auch auf Schell der Druck noch einmal massiv. Schon am 6. Dezember 1905 muss er sich zum zweiten Mal vor dem Bischof kategorisch auf den »integralen« Katholizismus, wie ihn Pius X. verstand, verpflichten; seine Erklärung wird zurechtgestutzt und prompt im bischöflichen Amtsblatt veröffentlicht. Schell ist jetzt ein gebrochener Mann. All die persönlichen Anfeindungen und offiziellen Diffamierungen haben seinem Herzen zugesetzt. Am 13. Mai 1906 wird er 56-jährig von seinem Leid durch den Tod erlöst … Das Schicksal eines Reformtheologen, das mich erschüttert. Häretiker sein in dieser Kirche kann lebensgefährlich sein.
Aber, so darf ich mir nun auch sagen: Glücklicherweise leben wir nicht mehr in der Zeit des Bündnisses von Thron und Altar, von Herrscherhaus und Kirche, sondern in einem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, und ich habe in meinen theologischen Positionen nicht nur Bibel und große katholische Tradition, sondern auch das Vatikanum II (1962–65) hinter mir – den Kontrapunkt zum Unfehlbarkeitskonzil Vatikanum I (1869–70). So bleibt denn meine Grundstimmung auch nach der Lektüre all der »Ketzerschicksale« frohgemut. Das letzte Photo meines zweiten Memoirenbandes »Umstrittene Wahrheit« zeigt mich auf Kreta entspannt lächelnd mit dem eben erhaltenen Dokumentationsband »Der Fall Küng« in der Hand. Bildunterschrift: »Überstanden!«
Mein Leben – Labyrinth oder Drachenkampf?
Begleitet von MARIANNE SAUR, die sich in für sie völlig unerwartet schwieriger Zeit in unserem Condominium (Bd. 2, Kap. III: Entscheidungen für Haushalt und Sekretariat) souverän bewährt hatte, und ihrer Freundin HEDE JACOBY treffen wir in der kretischen Hauptstadt Heraklion mit meinem Tübinger Kollegen HERBERT HAAG und seiner Gruppe »Biblische Reisen« zusammen. Haag ist Herausgeber des ersten katholischen historisch-kritischen »Bibellexikons« (1968). Im Artikel »Kreta« habe ich lesen können: »Die wissenschaftliche Erforschung Kretas begann 1900 mit der Ausgrabung von Knossos durch den Engländer J. A. Evans, wodurch der Palast des Minos und eine bisher unbekannte, in Vasen, Wandmalereien und architektonischen Formen sich offenbarende Kultur von hohem Alter und großer Vollkommenheit ans Tageslicht kam.« Schon lange wollte ich diese Insel kennenlernen, deren Kultur im 3./2. Jahrtausend v. Chr. aufgrund der Handelsbeziehungen mit dem Ägäischen Raum und vor allem mit Ägypten einen Schlüssel darstellt zum besseren Verständnis der mir schon vertrauteren ägyptischen und griechisch-römischen Kultur. Und so besuchen auch wir auf Fahrten quer durch die Insel die Ausgrabungen fürstlicher Paläste in Knossos und Phaistos und manches mehr.
Mich interessiert dabei besonders die in die griechische Mythologie eingegangene geheimnisvolle Erzählung von König Minos und dem menschengestaltigen, menschenfressenden Minotaurus (Stier-Mann). Ihm waren die Athener mit dem Opfer von sieben Jünglingen und sieben Jungfrauen tributpflichtig, bis ihn der athenische Held THESEUS tötete. Doch Theseus fand aus dem verwirrenden Labyrinth des Minotaurus nur heraus durch einen Faden, den ihm die Königstochter Ariadne als Wollknäuel zugesteckt hatte. Ist es nicht verständlich, dass mir im römischen Kontext ein »Papst Theseus I.« einfällt? Mit diesem Spottnamen betitelten wir im päpstlichen Collegium Germanicum wegen seiner oft allzu einfachen theologischen »Thesen« den Sozialwissenschaftler Professor Joseph Höffner, einen Germaniker, später Erzbischof von Köln und Kardinal, einer meiner Hauptgegner in der gerade hinter mir liegenden großen Konfrontation.
Als eine Art christliches Gegenbild zu Theseus könnte man den auch auf Kreta hochverehrten heiligen GEORGIOS ansehen, der den Drachen getötet haben soll, dieses Mischwesen aus Vogel, Schlange, Krokodil und Löwe (kein Dinosaurier!). Die historische Forschung hat den Drachen als eine Erfindung aus dem Zweistromland schon des 5. vorchristlichen Jahrtausends entlarvt und den heiligen Georg als einen seit dem 4. Jahrhundert n. Chr. im östlichen Mittelmeer verehrten wundertätigen Offizier, der in Westeuropa zum ersten Mal im 11. Jahrhundert auf dem Siegel des Bamberger Domkapitels zusammen mit einem Drachen erscheint. So ist durch die Jahrhunderte die Legende von jenem Ritter St. Georg entstanden und gewachsen, der den Drachen getötet und so die Stadt und die zum Fraß geforderte Königstochter befreit haben soll.
Also St.Georg ähnlich wie Theseus eine legendäre, mythische Gestalt, was die Liturgiekommission des Vatikanum II veranlasste, das Georgsfest aus dem allgemeinen Festkalender der katholischen Kirche zu streichen. Das hat mir und vermutlich auch meinem Kollegen auf dem Konzil, Joseph Ratzinger, gar nicht gefallen, der ja ebenfalls einen Bruder namens Georg hat; St.Georg ist überdies Stadtpatron meiner Heimatstadt Sursee. Die kleinen Beispiele werfen die grundsätzliche Frage auf, wie heutzutage Mythen behandelt werden sollen. Sie sollten, wo sie für die Menschen eine Bedeutung haben, nicht einfach eliminiert, allerdings auch nicht historisch aufgefasst, sondern vernünftig für unsere Zeit interpretiert werden. Nur so ist ein einfühlsamer Umgang mit dem volkstümlichen, poetischen Erbe der Völker und Religionen und auch mit der Bibel gegeben. Im Prinzip wäre damit wohl auch Joseph Ratzinger einverstanden, nur dass er solche interpretierende »Entmythologisierung« kaum auf die Christologie und erst recht nicht auf das päpstliche und bischöfliche Privileg der Unfehlbarkeit anwenden möchte.
In den Wochen des Übergangs zu einem neuen Lebensabschnitt hatte ich viel Zeit, um über mein Leben nachzudenken. Ich denke zurück an das viele, das mir positiv wie negativ zugestoßen ist und was ich selber angestoßen habe. Und ich versuche vorauszudenken, wie das alles wohl weitergehen wird. Ob ich mich nicht auf den Kampf mit einem Drachen eingelassen habe, den ich nie und nimmer gewinnen kann? Oder habe ich mich schlicht verlaufen in einem Labyrinth, einem Irrgarten, in welchem mir kein Faden einer Ariadne den Ausweg weist? Wie immer: Zur Orientierung hilft mir eine Bilanzierung des ganzen Streits, der inzwischen für die deutsche Öffentlichkeit in einer Retrospektive detailliert und gründlich dokumentiert wurde.
Eine Dokumentation mit Appell an den Papst
HERBERT HAAG und NORBERT GREINACHER, die beiden treuesten Kollegen in meiner früheren Katholisch-Theologischen Fakultät, zeichnen, wie am Ende meines zweiten Memoirenbandes berichtet, als Herausgeber eines 546 Seiten starken Bandes »Der Fall Küng«. Er enthält die Dokumente der Vorgeschichte und des Lehrbefugnisentzugs, die Stellungnahmen von Gruppen und Institutionen, von theologischen Fakultäten und Fachbereichen und wichtigen Einzelpersonen. Ich habe dafür bisher großenteils unveröffentlichte Dokumente und Stellungnahmen, Briefe und Reden samt Kommentar zur Verfügung gestellt. Ich gestehe: In der Phase der Erschöpfung hat mir die Lektüre von Hunderten von Stellungnahmen und all der Briefe zu meiner Unterstützung neue Kraft geschenkt. Ich denke nicht daran, diese Menschen zu enttäuschen – weder durch Revokation noch durch Resignation.
Doch wären die Erstellung dieser Dokumentation, die Übersetzung fremdsprachiger Dokumente und die ganze mühselige Redaktions- und Korrekturarbeit nicht möglich gewesen ohne die intensive Mitarbeit besonders von Dr.KARL-JOSEF KUSCHEL, Dr. URS BAUMANN und Dr. MARGRET GENTNER. Mein Stellvertreter im Institut, der Akademische Rat Dr.HERMANN HÄRING, hatte unterdessen, davon wird noch die Rede sein, einen ehrenvollen Ruf auf den Lehrstuhl für Dogmatik an der Katholischen Fakultät Nijmegen erhalten – zuerst als Kollege, dann als Nachfolger des berühmten flämisch-holländischen Theologen EDWARD SCHILLEBEECKX!
In ihrem Schlusswort zeigen sich die Herausgeber ungewöhnlich beeindruckt von der Zahl der Stimmen zu meinen Gunsten, von der Überzeugungskraft der Argumente und der Gewichtigkeit der Fakten. In einer Art Zwischenbilanz weisen sie auf die verheerenden Folgen des »Falls Küng« hin und machen seine verschiedenen Dimensionen erneut deutlich: die pastorale, die theologische, die ökumenische, die politische, die kirchengeschichtliche und die verfassungsrechtliche Dimension. Dies alles bildet die Grundlage für ihre Schlussfolgerung: »Wer diese Dokumentation von Anfang bis Ende unvoreingenommen studiert, wird um die Feststellung nicht herumkommen: Hans Küng ist durch seine Kirche Unrecht geschehen. Die kirchenrechtlichen Bestimmungen wurden auf flagrante Weise verletzt. Das Vorgehen spricht den Prinzipien der christlichen Brüderlichkeit Hohn. Die von Küng vorgetragenen theologischen Sachfragen wurden entweder nicht erkannt oder besserwisserisch beantwortet.«1 Was da 1980 formuliert wurde, gilt auch noch 30Jahre später.
Aufgrund der dargelegten Fakten und Entwicklungen machen sich die Herausgeber am Ende zu »Sprecher[n] des in diesem Buch und allenthalben artikulierten Protestes« und appellieren direkt an den für den Lehrentzug verantwortlichen Papst JOHANNES PAUL II.: »Heiliger Vater! Greifen Sie den Fall ohne Verzögerung wieder auf! Setzen Sie eine unvoreingenommene Kommission von Bischöfen und Theologen ein, welche die aufgeworfenen theologischen Fragen sachgerecht und ohne Zeitdruck prüft! Wir appellieren an Ihre Verantwortung und an Ihr Gewissen: Machen Sie geschehenes Unrecht wieder gut! Überlassen Sie die Rehabilitierung Küngs nicht der Geschichte! Setzen Sie Ihre persönliche Tat zum Segen für die Kirche!«2
Dieses Nachwort trägt das Datum vom 24. April 1980. Schon am 12. Mai stellen die beiden Herausgeber ihre Dokumentation der Öffentlichkeit vor. Der wie immer höchst effiziente Piper Verlag hat mir vorher schon ein Vorausexemplar nach Kreta geschickt. Es macht mich froh, aber nicht übermütig. Denn:
Keine Illusionen: ein Papstbrief
Die große Konfrontation habe ich durchgestanden, die Auseinandersetzung mit dem römischen System aber keineswegs überstanden. Trotz des Verlusts der kirchlichen Lehrbefugnis habe ich mir Lehrstuhl und Institut für Ökumenische Forschung bewahrt; meine Kaltstellung ist misslungen; die römischen und deutschen Gegner haben meine akademische »Entmachtung« nicht erreicht. Dass aber Papst Wojtyła den Appell der Herausgeber der Dokumentation hören, eine Kommission von Bischöfen und Theologen einsetzen und das mir offensichtlich angetane Unrecht wiedergutmachen würde, halte ich für unwahrscheinlich. Und bald wird deutlich: Dieser Papst, der auf großen kostspieligen Reisen überall Friede, Gerechtigkeit und Menschenrechte verkündigt, mir aber seit seinem Amtsantritt jegliches rechtliche Gehör verweigert, wird auch in Zukunft dieselbe Einstellung praktizieren.
Allerdings fühlt man sich nach Erscheinen der Dokumentation in Rom in der Defensive – vor allem angesichts des kommenden Besuchs des Papstes in Deutschland. Deshalb schickt der Papst schon am 22. Mai 1980 – einen Tag vor meiner Rückkehr aus Kreta – ein ausführliches Schreiben nach Deutschland. Nein, nicht an mich, auch nicht an die Herausgeber der Dokumentation, sondern an meinen Hauptgegner, »Theseus I.«, den Kölner Kardinal JOSEPH HÖFFNER, und an die Deutsche Bischofskonferenz. Ein zweifellos bis ins Detail abgesprochener (vielleicht sogar in Deutschland entworfener) Brief. Er zeigt weder in der Sache noch bezüglich der Revision des Verfahrens Entgegenkommen, sondern versucht – raffiniert oder plump, wie man will – die noch immer nicht überzeugte breitere Öffentlichkeit von der Berechtigung der Inquisitionsmaßnahmen gegen mich zu überzeugen. Der Ton salbungsvoll: des Papstes Brief sei »von der Liebe zu diesem unserem Bruder bestimmt« (ich hatte bisher kaum etwas von dieser Brüderlichkeit und Liebe gemerkt). Er bitte Gott um eine »Begegnung in der Wahrheit« (natürlich wie sie der Papst versteht) »besonders mit jenem Menschen, unserem Bruder, der als katholischer Theologe, der er sein und bleiben möchte, eine besondere Verantwortung für die von der Kirche bezeugte und verkündete Wahrheit mit uns teilen muss«. Ich frage mich nur: Warum bittet der Papst »Gott« und führt diese Begegnung mit mir, seinem »Bruder«, nicht selber herbei?
Doch immerhin – dieser Brief ist ein »Zeichen« des Papstes in meinem Fall. Ignorieren konnte er mich (will sagen: die durch mich vertretene Sache) offenbar nicht. Ich entschließe mich zu einem Zeichen meinerseits: zu dem bereits als Motto zu diesem Kapitel zitierten handgeschriebenen Brief aus meiner Schweizer Heimat vom 25. August 1980. Ich danke dem Papst für seine Worte: »Auch in den vergangenen, für mich sehr schwierigen Monaten habe ich diese besondere Verantwortung stets voll und ganz bejaht. Und allein diese Verantwortung ist es, die meine theologische Arbeit bestimmt und auch für die Zukunft bestimmen soll.« Es habe mich auch außerordentlich bedrückt zu erfahren, »wie sehr durch diesen Konflikt die Spannungen in unserer Kirche zugenommen haben, die ökumenische Verständigung mit den anderen Kirchen belastet wird, das Verhältnis zwischen Theologie und Lehramt sich verschlechtert hat und so in Kirche und Christenheit schwerer Schaden entstanden ist, den sicher keine Seite gewollt hat. Schon aus diesem Grund ist mir an einer Verständigung und Versöhnung gelegen.«
Und da der Papstbrief an die Deutsche Bischofskonferenz »in der Öffentlichkeit als eine Geste der Verständigungsbereitschaft und ein Schritt des Entgegenkommens verstanden worden ist, der zu einem persönlichen Gespräch in brüderlichem Geist führen könne«, würde ich um ein solches Gespräch bitten, wann und wo immer er es wünsche: »Auch wenn eine solche persönliche Begegnung gewiss nicht auf Anhieb alle die von vielen Menschen als bedrückend empfundenen Probleme zu lösen vermag, dürfte es doch Ausdruck der echten Dialogbereitschaft sein. Es würde bestimmt dem gegenseitigen Verstehen und der ›Begegnung in der Wahrheit‹ [dienen], wie sie vom Evangelium selber gefordert und so von der Kirche zu bezeugen und zu verkünden ist.« Und da der Papst so nachdrücklich von der Liebe besonders zu »jenem Menschen, unserem Bruder« redet, mein Appell: »Ein solches Gespräch könnte zugleich zeigen, dass selbst bei ernsten Auseinandersetzungen in unserer Kirche die Liebe Christi Richtmaß bleibt und von daher unnötige Polarisierungen abgebaut werden können.« Der Brief endet mit den Worten: »Für Ihre so wichtige Hirtenaufgabe im Dienst an unserer katholischen Kirche und an der gesamten Christenheit wünsche ich Ihnen von Herzen Gottes Segen.«
Aber auch diesbezüglich mache ich mir keine Illusionen: Wie vermutet will der Papst aus Polen, dem ich in meinem persönlichen Schreiben sogar meine private Telefonnummer in der Schweiz angegeben habe, gar nicht ernsthaft ein Gespräch, und seine schönen Worte waren weniger für »einen Menschen«, seinen »Bruder«, als für die breite Öffentlichkeit bestimmt. So erweist sich denn dieser Papstbrief an den deutschen Episkopat als das, was ich von vornherein vermutet hatte: ein typischer Fall von kurialem »Windowdressing«, auf Deutsch »Schaufensterdekoration«, beziehungsweise »Schönfärberei« zur Beruhigung des deutschen Kirchenvolkes vor dem Papstbesuch, der als große Jubelveranstaltung geplant ist.
Daher bin ich dankbar, dass mich schon zwei Tage nach dem Papstschreiben an die Bischofskonferenz, am 24. Mai, Professor LEONARD SWIDLER, seit meiner ersten US-Vortragsreise 1963 ein Freund, in Tübingen aufsucht, zusammen mit dem jüdischen Gelehrten Professor ZALMAN SCHACHTER (ebenfalls Temple University Philadelphia), der einen Vortrag hält über »Das jüdisch-christliche Gespräch. Der Beitrag eines Kabbalisten«. Wir verbinden damit einen Besuch der berühmten kabbalistischen Lehrtafel in der evangelischen Kirche von Bad Teinach bei Calw.
Leonard Swidler übernimmt mit seiner sprachkundigen Frau Arlene und einem Team die Aufgabe, für den englischsprachigen Raum eine schließlich 627 Seiten zählende Dokumentation herauszugeben, die der große New Yorker Verlag Doubleday, der meine Bücher »Christ sein« und »Existiert Gott?« publiziert hatte, 1981 in die Öffentlichkeit bringt unter dem Titel: »Küng in Conflict«. Diese umfasst nicht nur die von Herbert Haag und Norbert Greinacher, sondern auch die von Walter Jens 1978 veröffentlichte Dokumentation »Um nichts als die Wahrheit. Deutsche Bischofskonferenz contra Hans Küng«. Ein, wie es auf der Umschlagseite heißt, »historischer Insider-Bericht über die 12-jährige Schlacht mit der Kirchenhierarchie, die weltweite Auswirkung hatte«. Eine riesige Übersetzungs- und Editionsarbeit, für die ich Len Swidler und seiner Frau bis heute dankbar bin. Doch – ich erhalte auch von ganz anderer Seite Unterstützung.
Ein Helfer in der Not: Karl Klasen
Oft habe ich das alte deutsche Sprichwort zitiert: »Freunde in der Not gehen Tausend auf ein Lot«: Freunde in der Not sind extrem rar! Jedenfalls habe ich in den vergangenen Auseinandersetzungen im römisch-katholischen Establishment viele Freunde verloren, nicht an der katholischen Basis, aber natürlich unter Kardinälen und Bischöfen, auch unter katholischen Theologen, die mich in Zukunft kaum noch zu zitieren wagen, ja selbst bei manchen evangelischen Kollegen, die sich stillschweigend anpassen und um meinen Namen samt Œuvre einen weiten Bogen machen.
Aber ich habe auch viele Freunde behalten und neue Freunde dazugewonnen. Universitätspräsident ADOLF THEIS hat recht bekommen mit seiner Warnung an meine Gegner in der Katholisch-Theologischen Fakultät vor der entscheidenden Abstimmung: Wenn ihr Kollege auszöge, genösse er dennoch so viel Respekt, dass es ihm auch außerhalb seiner Fakultät an mächtiger Unterstützung nicht mangeln würde. Ein Bluff, dachte ich in diesem Moment höchst skeptisch, wer soll denn in solcher Not schon helfen können – und wollen?
Aber schon mit dem Datum vom 30.April 1980 erhalte ich einen persönlich gehaltenen Brief von einem hoch angesehenen Mann der Bundesrepublik, den ich bisher nur aus den Medien kenne: Dr. KARL KLASEN,1970–77Präsident der Deutschen Bundesbank. Mein Buch »Existiert Gott?«, schreibt er, sei für seine Frau und ihn »ein ganz großer Gewinn« gewesen: »Wenige Bücher haben uns soviel gegeben wie dieses hervorragende Werk. Kaum jemand wird Ihre Ausführungen so gründlich gelesen haben wie ich, denn ich habe sie vorgelesen. Das mussten wir selbstverständlich über einen längeren Zeitraum erstrecken, aber es hat unsere Freude keineswegs beeinträchtigt.«
Hier zeigt sich wieder einmal, was ein einziges Buch bewirken kann. Und wie sehr sie unrecht hatten, jene Medienmanipulatoren, die vor der bischöflichen Nacht- und Nebelaktion des 18. Dezember 1979 »Küng mit eigenen Waffen schlagen« wollten und damit nicht Bücher, sondern einseitige Vorinformationen an die Presse meinten, um so die Öffentlichkeit für sich einzunehmen (Bd. 2, Kap. XI: Die Generalattacke: betrübliche Komplizenschaft). Nein, meine »Waffen«, wenn man schon so militärisch reden will, sind meine Bücher und meine sonstigen wissenschaftlichen Publikationen.
Ab jetzt also wird Dr.Klasen aufgrund der Lektüre von »Existiert Gott?« in manchen Fragen mein Ratgeber und »Türöffner«: für die Volkswagen-Stiftung (Projekt »Frau und Christentum«) und die Bosch-Stiftung (Projekt »Kein Weltfriede ohne Religionsfriede«), wovon noch zu berichten sein wird. Schon am 15. Juni 1980 besuchen mich Dr. Klasen und seine Frau in Tübingen. Und am 17.–19. Juli desselben Jahres mache ich auf der Rückfahrt von den Salzburger Festspielen mit großartigen Aufführungen von Offenbachs »Hoffmanns Erzählungen« (mit Placido Domingo) und Mozarts »Zauberflöte« (unter der Leitung von James Levine und in der Inszenierung von Jean-Pierre Ponnelle) in St. Moritz Station, wo Karl und Ilse Klasen ein Apartment besitzen. Auf Spaziergängen am Silser See oder bei einem Ausflug auf Muottas Muragl über Pontresina haben wir reichlich Gelegenheit, nicht nur über Gott und die Welt, sondern auch über meine Zukunftspläne zu sprechen.
Karl Klasen, lutherischer Konfession, ist gegenüber der katholischen Kirchenleitung kritisch, wie er mir schon in seinem Brief geschrieben hatte: »Die Behandlung, die Sie seitens Ihrer Kirchenoberen erfahren haben, ist uns unverständlich, weil nach unserer Auffassung in letzter Zeit kaum jemand durch literarische Arbeit so wirkungsvoll für den katholischen Glauben geworben hat wie Sie. Ihren Kampf gegen diese Kurzsichtigkeit haben wir mit großem Interesse und Anteilnahme für Sie verfolgt.« Und schon beim ersten Gespräch in Tübingen sagt mir Karl Klasen: »Lassen Sie sich ja nicht beirren, sondern gehen Sie Ihren Weg ruhig weiter. Die Geschichte wird Ihnen recht geben.« Dieser Ratschlag ist zwar nicht immer leicht zu befolgen, denn die Schwierigkeiten bleiben selbstverständlich nicht aus. Im Nachhinein aber lässt sich deutlich erkennen, dass Dr.Klasen recht hatte.
Aber Karl Klasen und seine Frau Ilse werden auch selber aktiv. Sie laden eine handverlesene Gesellschaft in ihr großes Hamburger Haus an der Alster für Samstag, 4. Juli 1981 um 12 Uhr ein, zu einem Vortrag von mir über das Thema »Die Religion in der heutigen Gesellschaft« mit anschließendem Empfang. Und anlässlich des Vortrags findet »im kleinen Kreis« von rund 30 stadtbekannten Persönlichkeiten um 20 Uhr ein festliches Abendessen (»dunkler Anzug, langes Kleid«) statt. So sitze ich denn erstmals neben dem damaligen Bundeskanzler HELMUT SCHMIDT und mir gegenüber neben Dr. Klasen der amerikanische Botschafter und frühere Chef des Federal Reserve Board, ARTHUR BURNS. Auf diese Weise bin ich nun in die Hamburger Society eingeführt.
Und so mache ich zunehmend die Erfahrung, dass der Verlust von Freunden innerhalb der römisch-katholischen Kirchenmauern bei Weitem wettgemacht wird durch Freunde »extra muros«. Allerdings helfen mir auch in der katholischen Theologie viele gewichtige Freunde.
Unterstützung durch loyale Opposition in der Kirche
Vom 27. Mai bis 1. Juni 1980 findet im holländischen Noordwijkerhout die Jahresversammlung unserer Internationalen Zeitschrift für Theologie »Concilium« statt. Am Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils 1965 war sie noch in Rom gestartet worden: aufgrund einer Initiative unseres holländischen Verlegers PAUL BRAND und von Anfang an von KARL RAHNER, EDWARD SCHILLEBEECKX, YVES CONGAR und mir (später die vier theologischen Mitglieder des Stiftungsrates) vorangetrieben. Aber sofort war sie hinter den Kulissen von der römischen Kurie, die ein »Paramagisterium« befürchtete, unter Druck gesetzt worden, sich einer bischöflichen Zensur oder einem Aufpasser des Sanctum Officium zu unterwerfen (»Nur über meine Leiche«, hatte ich erklärt). Aber wir hatten zusammengestanden und uns behaupten können (vgl. Bd. 1, Kap. VIII: Pro und contra »Concilium«).
Inzwischen hat diese Zeitschrift, die damals noch mit zehn Nummern jährlich in sieben Ausgaben (holländisch, deutsch, französisch, englisch, spanisch, portugiesisch, italienisch) erscheint, alle Schwierigkeiten überwunden. Allerdings hatten sich die auf dem Weg in die römische Hierarchie begriffenen Theologen (Joseph Ratzinger, Karl Lehmann, Walter Kasper …) einer nach dem anderen mit verschiedenen Begründungen von uns abgesetzt. HANSURS VON BALTHASAR gründet mit HENRI DE LUBAC und JOSEPH RATZINGER sogar mit »Communio« ein »Concilium« kopierendes Gegenorgan, das von der Hierarchie und der konservativen italienischen Bewegung »Comunione e Liberazione« unterstützt wird. »Concilium« hat dagegen schon früh auch neuen theologischen Strömungen wie der lateinamerikanischen Befreiungstheologie (Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff) und der feministischen Theologie (Elisabeth Schüssler-Fiorenza) eine theologische Heimat gewährt. Allerdings ist aus der Zeitschrift des konziliaren Mainstreams aufgrund der kurialen Restauration des mittelalterlich-gegenreformatorisch-antimodernen Systems faktisch immer mehr eine Zeitschrift der loyalen Opposition in der Kirche geworden.
Im Februar 1980 hatten die Mitglieder des Direktionskomitees von »Concilium« eine Erklärung veröffentlicht: »Wir sehen keinen begründeten Anlass, unseren Kollegen Hans Küng nicht mehr als katholischen Theologen zu betrachten. Wir wollen daher auf eine Revision der Verurteilung drängen. Wir fordern außerdem, dass die kirchliche Verfahrensweise endlich die allgemein geltenden Menschenrechte berücksichtigt.«3
Aber, frage ich mich vor dieser Zusammenkunft in Noordwijk, wie würden mich meine Kollegen nach der großen Konfrontation mit Rom aufnehmen? Die Assoziierung mit meinem Namen konnte ja durchaus vom einen oder anderen in seiner manchmal auch schwierigen Situation als Belastung empfunden werden. Dafür hätte ich durchaus Verständnis. Leider nimmt jetzt sogar ein Karl Rahner aufgrund des Unfehlbarkeitsstreites nicht mehr an unserer Jahresversammlung teil, bleibt aber Mitglied.
Doch ich bin erleichtert und erfreut: Ich werde von allen mit großer Herzlichkeit und Umarmungen aufgenommen. Es werden wie immer die bevorstehenden Nummern diskutiert und geplant. In ungetrübter Gemeinsamkeit machen wir am 31. Mai einen Ausflug nach Haarlem und ins Frans-Hals-Museum und besuchen anschließend Amsterdam.
Schulterschluss mit »politischer Theologie«?
Seitdem ich ihn persönlich kenne, bemühe ich mich um ein gutes Einvernehmen mit JOHANN BAPTIST METZ, der sich jetzt gerne »Vater der politischen Theologie« nennen lässt. Ist er in guter Stimmung, ist die Zusammenarbeit mit ihm angenehm. Ja, wir können oft herzlich miteinander lachen, besonders wenn wir abends zusammensitzen. Er war nun mit meiner ausdrücklichen Unterstützung für den ausgeschiedenen Karl Rahner in den Stiftungsrat von »Concilium« nachgerückt.
Unsere nach dem Tod Pauls VI. im August 1978 in der Weltpresse publizierte Erklärung zur Papstwahl hatte Metz ursprünglich mitgetragen, dann aber freilich zusammen mit Rahner durch eine eigene kurze Erklärung konterkariert (Bd. 2, Kap. X: Welchen Papst brauchen wir?). In Sitzungen kann er manchmal ausgesprochen schwierig sein. Aber was soll’s? Der Schulterschluss gerade mit ihm scheint mir wichtig. Die gesellschaftskritischen Grundintentionen der »politischen Theologie« teile ich und hatte sie schon in »Christ sein« (1974) im Kapitel über »Die gesellschaftliche Relevanz« (Kap. D III,1) gewürdigt, obgleich mir das Etikett »politische Theologie« (vom Hofbischof Kaiser Konstantins, Eusebios, eingeführt und wieder vom Wegbereiter des Nationalsozialismus, Carl Schmitt, gebraucht) missverständlich erscheint und ich auch die Neigungen mancher »politischer« Theologen zum Marxismus nicht teile.
Eine große öffentliche Bewährungsprobe besteht die Zusammenarbeit zwischen Johann Baptist Metz und mir zu meiner großen Freude wenige Tage nach der Jahresversammlung in Holland: auf dem Katholikentag in Berlin (5.-8. Juni 1980). Im überfüllten Auditorium Maximum der Freien Universität, wo 1968 die studentischen Revolutionäre agiert hatten, werden wir beide schon beim Eintritt jubelnd begrüßt. Rund 5000 vor allem junge Zuhörer und Zuhörerinnen, auch in der weiten Eingangshalle, auf den Treppen und Podesten. Für mich ist es der erste große öffentliche Auftritt nach der Konfrontation mit Rom. Auch jetzt liegt wieder so etwas wie revolutionäre Luft im Raum. Viele Christen beider oder auch keiner Konfession haben die römische Willkürherrschaft satt. Aber es ist gar nicht leicht, die höchst verschiedenen Erwartungen zu erfüllen.
Mir geht es in erster Linie darum, die Impulse der rund 20 sehr unterschiedlichen Gruppen und Initiativen der kirchlichen Basis, die sich in den Auseinandersetzungen um Papst und Unfehlbarkeit zu Wort gemeldet hatten, aufzunehmen und den »Katholikentag von unten« und später auch die Initiative »Kirche von unten« theologisch zu unterstützen. Ich muss ein Interesse daran haben, dass sich eine lose organisierte, möglichst effektive, jedenfalls solidarische innerkirchliche Opposition bildet. Ich sehe dafür legitime theologische Grundlagen und kann auf all das zurückgreifen, was ich schon im Buch »Die Kirche« über die charismatische Struktur der Kirche geschrieben habe, die jegliche Ämterstruktur umgreift. In der Kirche des Ursprungs gab es nun einmal keine »Oberkirche«, gab es keine kirchliche »Obrigkeit«, keine »Hierarchie«, »Heilige Herrschaft«. In der Kirche des Ursprungs herrschte die Freiheit der Christenmenschen, mit all ihren verschiedenen Charismen und Diensten, eine grundsätzliche Gleichheit vor Gott und eine Geschwisterlichkeit untereinander.
Auf dieser vom Neuen Testament her begründeten theologischen Basis entwickle ich dann strategische Leitlinien für eine Basiskirche und mache deutlich: Christliche Basisgruppen sind nicht von vornherein gegen Autorität, aber sie erwarten, dass diese Autorität vom Evangelium selber gedeckt ist und nicht nur vom Kirchenrecht oder der traditionellen Praxis des Gemeindeestablishments. Sie sind nicht von vornherein gegen kirchliche Institutionen, aber sie erwarten, dass die Institutionen ihnen den nötigen Freiraum zur eigenen Entfaltung und Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben gewähren. Sie wollen in der Kirche bleiben, aber sie hoffen darauf, dass die Amtskirche flexibel genug ist, um sie zumindest zu tolerieren, wenn sie sie schon nicht fördern will.
Schließlich nehme ich Stellung zum Verhältnis unserer Kirche von unten zur lateinamerikanischen Befreiungstheologie und -praxis. Einerseits dürfte in der Kirche von unten weithin Übereinstimmung darin bestehen, dass das Modell der lateinamerikanischen Basisgemeinden nicht problemlos in die religiöse Landschaft der hochindustrialisierten Staaten des Westens und der Bundesrepublik im Besonderen übernommen werden kann. Andererseits dürfte aber auch weithin Übereinstimmung darüber bestehen, dass gerade von den lateinamerikanischen Basisgemeinden starke Impulse ausgehen, um die »Betreuungskirche« und »Servicekirche« hinter uns zu lassen und das Christsein und Kirchesein entschiedener in die eigene Verantwortung zu nehmen.
Schließlich versäume ich auch nicht, auf die ökumenische Tragweite der Kirche von unten hinzuweisen: Gut evangelisch ist die katholische Leitvorstellung einer Basis-, Initiativ- und Gemeindekirche, in der Freiheit, Partnerschaft, Kollegialität, Solidarität, Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit herrschen sollen. Eine Kirche, in der mehr überzeugt als befohlen, mehr gehandelt als gepredigt, mehr hilfreich miteinander umgegangen als bürokratisch selbstherrlich gegen andere vorgegangen wird: kurz, eine alternative christliche Praxis geübt wird. Nur zwischen Gott und Mensch, Gott und Kirche darf bildhaft von Oben und Unten als unendlicher Differenz geredet werden. Aber in der Kirche selber soll das Oben und Unten durch ein Miteinander und Füreinander ersetzt werden. Es gilt zu arbeiten für eine Kirche des Volkes, in der das Volk nicht mehr Objekt der Bevormundung, sondern Subjekt seiner eigenen Geschichte vor Gott geworden ist.4
Über vier Stunden dauert die ganze Berliner Veranstaltung – ohne Fanatismus, ohne Aggressionen, vielmehr ein großer Konsens zwischen Publikum und Podium. Viele möchten sich engagieren, haben wieder Hoffnung geschöpft … Ich fühle mich gestärkt.
Zersplitterung der Reformkräfte
Leider wird die Einheit der »Initiative Kirche von unten« (IKvu) schon bald infrage gestellt, besonders durch die Gruppe um JOHANN BAPTIST METZ, der den gemeinsamen Brief der Initiative an den Papst anlässlich seines Deutschlandbesuchs nicht unterschreibt, sondern stattdessen eine Erklärung über die katholische Nachrichtenagentur verbreiten lässt, die viele befremdet. Gerne profiliert er sich als »politischer« Theologe durch Herabsetzung der »liberal-bürgerlichen« Theologie, mit der er vorwiegend mich meint. Auf dem Delegiertentreffen der IKvu in Mülheim am 13./14. Februar 1981 kommt es zur Auseinandersetzung, wo ich ihm dies vorhalte. Doch plädiere ich gleichzeitig dafür, die verschiedenen Positionen als unterschiedliche Sichten im gemeinsamen Bemühen um die Reform von Kirche und Gesellschaft zu betrachten. Ich gebe auch zu, dass es durchaus revolutionäre Ausnahmesituationen geben kann wie in Nicaragua, wo man sich gegen eine blutige Diktatur wie die der Somoza-Familie mit der Waffe zur Wehr setzen darf.
Einige Monate später hält KARL-JOSEFKUSCHEL ganz in meinem Sinn ein eindringliches Plädoyer gegen falsche Flügelkämpfe in der Kirche von unten: »Keine falschen Fronten!« (»Publik-Forum« vom 21. 8. 1981). Wir bleiben dabei: Wir unterstützen die berechtigten Anliegen der Befreiungstheologie und der politischen Theologie. Aber wir klagen gleichzeitig die Christenrechte in der Kirche ein und bekennen uns zu den neuen theologischen Reformanstößen.
Denn die Lage der katholischen Kirche ist erheblich kritischer, als dies von außen den Anschein hat. Sie hat sich seit meiner Analyse von 1972 (Bd. 2, Kap. VI: Hat die Kirche ihre Seele verloren?) eher verschlimmert als verbessert. Rom konnte jeden Reformfortschritt verhindern, sodass man weltweit die innerkirchlich drängenden Probleme vor sich herschiebt: Geburtenregelung und Ehemoral, Zölibatsfrage, Mischehe, Abendmahlsgemeinschaft, Neuordnung der Bischofs- und der Papstwahl. Die Folgen der Reformverschleppung aber sind erschreckend: Auszug Zehntausender Priester aus dem kirchlichen Dienst und katastrophaler Nachwuchsmangel; zugleich abnehmende Teilnahme am Sonntagsgottesdienst, Krise der katholischen Schulen, Zeitschriften, Verlage, Vereine; überhaupt Mangel an Inspiration und Phantasie zur konstruktiven Lösung der gegenwärtigen Probleme. Und hinter alldem ein grundlegender Mangel an konstruktiver geistlicher Führung in Rom (»spiritual leadership« – das Gegenteil von »geistlicher Diktatur«). Das Resultat ist eine betrübliche Einbuße an öffentlicher Glaubwürdigkeit.
Johann Baptist Metz aber ist zu meinem großen Bedauern im Begriff, die Reformanliegen in der Kirche aufzugeben – zugunsten einer recht einseitigen Fixierung auf eine »Theologie des Leidens«. Seine Neue Politische Theologie, wie er sie inzwischen nennt, tritt auf der Stelle. Und seine Distanzierung von der Reformbewegung wird schließlich Jahre später auch äußerlich besiegelt durch das Kommen des Präfekten der Inquisitionsbehörde, Kardinal Ratzinger, zu Metz’ 70. Geburtstag (1998) in Münster – unter der Bedingung, dass nur von Gott und nicht von der Reform der Kirche geredet werden dürfe! Das hat dort selbst Anhänger von Metz zum Protest herausgefordert. Tatsächlich macht sich eine solche politische Theologie unglaubwürdig. Und der christliche Marxismus, der sich an Lateinamerika und Kuba orientiert, sollte mit dem Fall der Berliner Mauer 1989 ein Ende finden.
Im Jahr 1980 war mir übrigens ein Einreisevisum in die Philippinen, wo ich Vorträge zu Grundfragen des christlichen Glaubens halten sollte, versagt worden aufgrund einer Intervention des Kardinals von Manila, JAIME SIN, beziehungsweise des päpstlichen Nuntius. Wiewohl kein »politischer Theologe«, bin ich offensichtlich »politisch gefährlich« – für das römische System. Nun ist es für mich keine Frage: Die katholische Kirche ist eine multinationale Organisation, und die Auseinandersetzung um die Reform dieser Kirche entwickelt sich seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil weltweit. Und insofern ist es verständlich, dass in den päpstlichen Nuntiaturen (schon auf dem Konzil »Denunziaturen« genannt), die über das römische System wachen, die roten Lampen aufleuchten, wo immer ich auftauche. Man kann freilich meine Vorträge außer in raren Fällen wie eben in der philippinischen Diktatur von Präsident Ferdinand Marcos oder später in Mexiko nicht verhindern. Aber überall wissen die Bischöfe, dass ich im Vatikan nicht »persona grata« bin und sie sich im Gegensatz zur Konzilszeit meine Vorträge besser nicht anhören.
Akzeptanz an der Basis
Über mangelnde Akzeptanz an der katholischen, ja ökumenischen Basis hatte ich mich nie zu beklagen. Dass die Vortragssäle normalerweise voll sind, verdanke ich freilich nicht, wie kollegialer Neid bisweilen verlauten lässt, den Kontroversen mit Rom; dies erlebte ich schon als junger Doktor und Professor der Theologie vor dem Konzil. Grundlage dafür bilden vielmehr meine Theologie und die konsequente Aufnahme vieler Anliegen des Kirchenvolkes, doch ohne dies gegenüber dem Evangelium zum absoluten Kriterium zu machen. Gegen Populismus und Opportunismus in Politik, Kirche und Gesellschaft habe ich eine ausgesprochene Abneigung. Aber dem Populus Dei, dem Volk Gottes im weitesten Sinn des Wortes, fühle ich mich in meiner Arbeit verpflichtet.
Besonders gefreut hat mich die Solidarität von Künstlern. Rund ein Dutzend Luzerner stellen 1980 ihre Werke im Rathaus Sursee aus. Anlässlich der Vernissage am 24. Juni überreicht mir der Maler GODI HIRSCHI, der die Aktion begründet hatte, eine Mappe ihrer Werke. Auch das Radio berichtet von ermutigenden Anlässen wie diesem: Die der Freiheit der Kunst Verpflichteten setzen sich hörbar und sichtbar für die Freiheit eines Theologen ein.
Ebenfalls im Juni 1980 wird an der Paulus-Akademie in Zürich, wo man freier ist als in den katholischen Akademien Deutschlands, eine Tagung abgehalten zum Thema »Theologie und Kirche – vom Konflikt zum Dialog«. Der katholische Luzerner Professor DIETRICH WIEDERKEHR und der evangelische Zürcher Professor HANS GEISSER ziehen Konsequenzen aus dem »Fall Küng«. Die Tagungsteilnehmer berichten in einzelnen Beiträgen, »wie sie am Fall Küng Kirche erlebt« haben. Dabei wird immer deutlicher, dass die Kirche das Monopol auf Religion verloren hat. Mein Mitbruder aus dem Collegium Germanicum, Dr. ANTON CADOTSCH, jetzt Sekretär der Schweizerischen Bischofskonferenz, bemüht sich um Vermittlung.
Meinen Publikationen haben die Verurteilungen durch das kirchliche Lehramt jedenfalls in keiner Weise geschadet, im Gegenteil. Der Piper Verlag nutzt die Gunst der Stunde und wirbt im großen Stil mit Photo: »Bilden Sie sich selbst ein Urteil: jetzt Hans Küng lesen!« In einem Kommentar zum »Rollenwandel des religiösen Buches« in der Herder-Korrespondenz liest man: »Die Kooperation zwischen dem Piper Verlag und Hans Küng macht fast schon Kirchengeschichte.«5 Sicher ist, dass ich meine Bücher in einem katholischen Verlag, selbst im mächtigen Herder Verlag, auf keinen Fall hätte neu herausgeben können. Rechtzeitig hatte ich, wie berichtet (Bd.2, Kap. VIII), den Verlag gewechselt. Neun Monate stand »Christ sein« auf der Bestsellerliste des »Spiegel«, 19 Wochen an zweiter oder dritter Stelle unmittelbar hinter Solschenizyns »Archipel Gulag«. Nicht erfolgreich war nur eine gekürzte Ausgabe von »Christ sein«, die gegenüber der gleichzeitig erscheinenden Taschenbuchausgabe des ungekürzten Buches keine Chance hatte. Doch wie steht es mit meinen Vorlesungen?
Neubegründung des Studium generale
Natürlich ist es etwas völlig anderes, für einen Einzelvortrag ein volles Haus zu bekommen, als an der eigenen Universität auf Dauer einen großen Hörsaal zu füllen. Und dies natürlich besonders jetzt, da ich, in keine Fakultät mehr eingebunden, keine Pflichthörer mehr habe, die bei mir Examen machen müssen. Ja, mir fehlen auch die selbstverständlichen Kommunikationsmittel einer Fakultät: Ankündigung im Vorle-sungsverzeichnis, Anschlag am Schwarzen Brett, Vorlesungskommentar der studentischen Fachschaft.
Doch es kommt zu einer Entwicklung, die an der Universität Tübingen Geschichte machen wird: Am Ende des Sommersemesters 1980 kündigen Professor WALTER JENS und ich zusammen mit Universitätspräsident ADOLF THEIS in einer Pressekonferenz die Wiederbelebung des Studium generale – Vorlesungen für Hörer aller Fakultäten und ein allgemeines Publikum – im Wintersemester 1980/81 an. Walter Jens hatte unmittelbar zuvor die Berufung auf eine Lessing-Professur in seiner Vaterstadt Hamburg abgelehnt, nachdem es dort großes politisches Gerangel um diese Entscheidung gegeben hatte. In Tübingen Jubel: »Dank des hanseatischen Debakels die Chance für Tübingen: Jens und Küng schlagen Bresche: Auferstehung des Studium generale«. So die Schlagzeilen des »Schwäbischen Tagblatts« vom 23.Juli 1980, und die ganze deutsche Presse berichtet von diesen erfreulichen neuen Entwicklungen.
Doch soll ich im Wintersemester zunächst allein beginnen. Walter Jens wird erst im folgenden Semester mitmachen können, und andere Kollegen werden folgen. Meine Sorge: es könnte ja durchaus sein, dass in der ersten Vorlesung das Auditorium Maximum voll wird, schon weil manche aus Neugier den Vielgequälten sozusagen »besichtigen« oder auch »einfach einmal hören« möchten. Und es könnte sich dann die Hörerschaft wie in vielen Vorlesungen ausdünnen. Das Kalkül der Gegenseite könnte dann doch noch aufgehen und die römische Inquisitionsmaßnahme ihr Ziel erreichen, dass ich nämlich mit wenigen Hörern als »graue Universitätsmaus« mein akademisches Leben zu fristen hätte.
Solche Perspektiven lassen mich freilich nicht resignieren, wohl aber meine Kräfte anstrengen, mit meinem Team reiflich über die notwendigen Maßnahmen nachdenken und entsprechend tätig werden – Neuerungen, die Schule machen:
– Bei der stets verständnisvollen und hilfsbereiten Universitätsverwaltung erreichen wir zum großen Ärger der Katholisch-Theologischen Fakultät, dass unser Institut für Ökumenische Forschung mit Personal und Lehrveranstaltungen im offiziellen Vorlesungsverzeichnis der Universität aufgeführt wird, und zwar nicht etwa als Appendix zur Katholisch-Theologischen Fakultät, sondern als fakultätsunabhängiges Universitätsinstitut auf eigenen Seiten mit ebenso großem Titel wie die Fakultäten.
– Um mit anderen Vorlesungen nicht zu kollidieren, führe ich, bisher nicht üblich, eine regelmäßige Abendvorlesung von 20.15Uhr bis 21.45Uhr ein; den Pedellen der Universität bin ich dankbar für ihr Entgegenkommen.
– Auch will ich das Thema jeder einzelnen Vorlesung schon vor Semesterbeginn bekanntgeben, damit den Hörern die Gesamtkonzeption von vornherein klar ist und sie wissen, was sie zu erwarten haben.
– Damit diese Vorlesungsreihe auch bekannt wird, lassen wir das ganze Programm (und das ist erst recht ungewöhnlich) auf große gelbe Plakate drucken, die an verschiedenen Stellen der Universität und auch in einzelnen Pfarreien ausgehängt werden.
Dies alles trägt dazu bei, dass das vorgesehene Auditorium Maximum nicht nur voll ist, sondern überfüllt. Es kommen rund 1000 Zuhörer und Zuhörerinnen. Die Vorlesung muss in den Festsaal gegenüber verlegt werden. Der gute Zuspruch wird die 13 Vorlesungen hindurch anhalten, und die Lokalzeitung wird regelmäßig sachlich darüber berichten. Mit diesen öffentlichen Vorlesungen ist das Studium generale an der Universität Tübingen neu begründet. Es hat sich auch bereits eine Arbeitsgruppe aus Professoren für die weitere Planung gebildet, die für ihr Brainstorming auch Wein und belegte Brote serviert bekommen – dieses Privileg hatte ich zur Auflockerung der Atmosphäre gewünscht und ist der Gruppe bis auf den heutigen Tag erhalten geblieben. Das Studium generale soll Themen von allgemeiner Bedeutung für Mensch und Gesellschaft fachübergreifend zur Sprache bringen oder – wie es der Mitbegründer Walter Jens formuliert – Fragen der Wissenschaft in verbindlich-verständlicher Form als Fragen des Lebens darstellen.
Aber worüber soll ich nun gerade als Theologe reden? Der Titel meiner neuen Vorlesungsreihe ist nüchtern: »Ökumenische Theologie. Perspektiven für einen Konsens der Zukunft«. Aber dahinter verbirgt sich eine Vision, die sich im nächsten Jahrzehnt ständig verdeutlichen und verdichten und schließlich mit »Projekt Weltethos« einen eigenen Namen bekommen wird. Behutsam lasse ich mich auf neue Themen ein.
Kampf um die öffentliche Meinung
Die breit angelegte päpstlich-bischöfliche Inquisitionsaktion gegen mich – Höhepunkt jenes »Kanzelwort« der deutschen Bischöfe vom 7. Januar 1980 mit einer Auflage von 3,5 Millionen, in allen Kirchen Deutschlands zu verlesen – sollte mich nicht nur an der Universität marginalisieren und in katholischer Kirche und Ökumene isolieren, sondern sollte mich auch in der Öffentlichkeit überhaupt »unschädlich« machen. Ich musste deshalb alles tun, um auch in der breiteren Öffentlichkeit diese mein Wirken gefährdende Diskreditierung zu konterkarieren.
1980/81 halte ich an verschiedenen deutschen Universitäten große öffentliche Vorträge.6 Aber politisch für mich wichtiger – angesichts meiner anhaltenden Ausgrenzung durch die kirchliche Hierarchie des Bistums Rottenburg-Stuttgart – ist ein großer Auftritt in der alten Reichsstadt Reutlingen, dem Wirtschaftszentrum unserer Region. Schon längst vor der großen Konfrontation mit Rom hatte mich der Präsident der Industrie- und Handelskammer Reutlingen, Dr. EBERHARD BENZ, mein rotarischer Freund, gefragt, ob ich für das 125-jährige Jubiläum der Kammer die Festrede halten wolle. Ich habe sofort zugesagt und bin nun gespannt, ob er nach all den öffentlichen Diskussionen um meine Position mich nicht doch bitten wird, aus Opportunitätsgründen auf diesen »Galaauftritt« zu verzichten. Aber erfreulicherweise war davon selbst in den schwierigsten Wochen keine Rede. Ein Lob der Zivilcourage!
Und so trete ich am 22. Oktober 1980 in der großen Friedrich-List-Halle der Stadt Reutlingen nach all den Grußworten und Klängen des Symphonieorchesters vor der rund 600köpfigen Prominenz aus Wirtschaft und Politik ans Rednerpult und spreche über das ungewöhnliche Thema »Ökonomie und Gottesfrage«7. Ein ganzes Jahrzehnt vor der Globalisierungsdebatte habe ich dabei, ausgehend von der Situation der Wirtschaft, für die Anwendung ethischer Werte auch in der Wirtschaft geworben. Die buchstäblich »enorme«, weil alle bisherigen Normen übersteigende Aufgabe, »vor der die Menschheit heute und mit ihr wir alle stehen«, sei es, sage ich, »eine gerechtere, friedlichere, freiere, kurz: humanere Welt heraufzuführen«. Dabei sei davon auszugehen, dass schon hinsichtlich der Marktwirtschaft heutzutage »Glaubenszweifel weit verbreitet« seien. Und dies nicht zu Unrecht, denn wenn das ganze System überhaupt funktionieren solle, scheine der Glaubenssatz vom Markt dringend ergänzungsbedürftig zu sein durch einen zweiten, einschränkenden: »Wer nur an den Markt glaubt, ist abergläubisch!« Der Markt sei um des Menschen willen da, nicht umgekehrt. Und eines sei er gewiss nicht: unfehlbar! Es sei ein gewaltiger Irrtum zu meinen, die Ursachen für die Mängel der gegenwärtigen gesellschaftlichen Ordnung seien nur technischer Art: »Wer die Weltprobleme allein von einem wirtschaftlichen Standpunkt betrachtet, der wird die heutige Krise nicht überwinden helfen. Er verschärft sie! Geht es doch nicht nur um eine ökonomisch-technologische, sondern zugleich um eine ideologische, besser: geistige Krise.« Bei der Bewältigung dieser Krise könne man von der »ethisch-religiösen Dimension« nicht absehen. Dies habe sich nicht nur in Iran und in Polen, sondern auch in westlichen Industrieländern gezeigt, wo man allzu leicht meinte, die Religion durch Wirtschaft und Wissenschaft ersetzen zu können.
Ohne moralisierende Schwärmerei oder ideologische Verkrampftheit will ich so den Festgästen diese theologisch-politischen Zusammenhänge mittels fünf praktikablen Stichworten verdeutlichen: Menschlichkeit, Brüderlichkeit, Wahrhaftigkeit, Zukunftsorientiertheit und Sinnhaftigkeit. Wenn es einen Gott gibt, so meine These, lassen sich diese Maximen unwiderleglich begründen, dann lässt sich etwa als »kategorischer Imperativ« vertreten, dass nicht nur die Politiker, sondern auch die Industrie- und Gewerkschaftsführer dem Volk nicht heuchlerische Versprechungen machen dürfen.
Es ist für mich im Kampf um die öffentliche Meinung wichtig, dass diese Rede, in der die katholische Hierarchie durch sichtbare Abwesenheit glänzt, mit großem Beifall aufgenommen wird und ein weites positives Presseecho hat. Denn von Seiten der Amtskirche tut man weiterhin alles, um mir den Weg zu kirchlichen Institutionen zu versperren. Katholische Akademien dürfen mich nicht mehr einladen. Katholische Kirchengemeinden machen sich unbeliebt, wenn sie mich zu einem Vortrag bitten. Und doch ist die katholische Stadtpfarrkirche von Ulm an der Donau übervoll, als ich dort auf Einladung eines mutigen Pfarrers und Pfarrgemeinderates am 1. Adventssonntag 1980 die Eucharistie feiere und über den Anfang des Markusevangeliums predige. Aber sonst: lieber die Gefahr leerer Kirchen als die Gefahr kirchlicher »Irrlehren«!?
Und ein zweites für diese Zeit typisches Ereignis: Im selben Dezember 1980 laden mich das katholische und evangelische Bildungswerk der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart zu einem Vortrag im großen »Hospitalhof« ein. Doch der katholische Veranstalter muss seine Einladung rückgängig machen, auf Weisung jenes Bischofs Georg Moser von Rottenburg, der sich ständig mit dem lauten oder stillen Vorwurf konfrontiert sieht, warum er sich von Rom zum Entzug meiner kirchlichen Lehrbefugnis drängen ließ, und der sich gerne vom Täter zum Opfer macht. Doch ist auch dieser Saal in Stuttgart trotz allem übervoll, und ich werde oft durch Beifall unterbrochen.8
Unterdessen nimmt das Wintersemester 1980/81 in Tübingen seinen Lauf. Trotz der Propaganda von Seiten der Amtskirche ist mein Seminar gut besucht. Anhand von bekannten katholischen und evangelischen Autoren behandeln wir in ökumenischer Gemeinsamkeit die Bedeutung des Neuen Testaments für die heutige systematische Theologie. Ich selber aber beschäftige mich innerlich schon längst nicht mehr in erster Linie mit Kirchenfragen.
Konfrontiert mit der wieder ständig wachsenden römischen Verengung bin ich froh, dass ich mich an der Problematik der römisch-katholischen Kirche und ihres Systems mit einem angeblich unfehlbaren Papst nicht festgebissen habe. Vielmehr kann ich jetzt, auf die neue Phase gut vorbereitet, meinen ökumenischen Wirkungskreis ständig vertiefen und ausweiten. Zu den ewig selben Problemen Roms habe ich ja in aller Ausführlichkeit und Wissenschaftlichkeit gesagt, was ich zu sagen hatte; sie langweilen mich, weil eine praktische Realisierung der dringend notwendigen Reformen von Rom mit allen Mitteln blockiert und die Ökumene bewusst verhindert wird. Intellektuell herausfordernd, geistig faszinierend und zukunftsträchtig sind für mich ganz andere, neue Probleme, die direkt anzugehen ich jetzt, gut vorbereitet, die Zeit und Kraft habe. Der neue Horizont nicht nur von Weltökonomie, sondern auch von Weltpolitik fesselt mich mehr und mehr.
Der neue welthistorische Horizont
Ich spreche bewusst nicht nur von einem weltpolitischen, sondern von einem welthistorischen Horizont. Von Herkunft und Erziehung bin ich gewohnt, die historische Dimension in allen Bereichen nicht, wie ich es besonders in Amerika erlebte, zu vernachlässigen, sondern zu reflektieren und so die Einsicht in die Vergangenheit für die Bewältigung der Gegenwart fruchtbar zu machen. In diesem Zusammenhang faszinieren mich zwei Staatsmänner, mit denen ich später auch persönlich zu tun bekomme und die in den 1970er- und 80er-Jahren für zwei verschiedene weltpolitische Konzepte stehen. Da ist der »Realpolitiker« HENRY KISSINGER, von 1969 bis 1977 Sicherheitsberater und Außenminister unter den US-Präsidenten Nixon und Ford und Friedensnobelpreisträger für das Friedensabkommen in Vietnam 1973. Und als Gegenpol der »Idealist« JIMMY CARTER, Präsident der Vereinigten Staaten von 1977 bis 1981, 2002 für seine internationale Vermittlungstätigkeit mit dem Friedensnobelpreis geehrt. Ich werde auf die beiden Persönlichkeiten und Konzeptionen zurückkommen.
In den 1980er-Jahren war es nicht mehr zu übersehen, dass die Welt in eine neue Epoche, eine neue Gesamtkonstellation, ein neues »Paradigma«, wie ich zu sagen pflege, eingetreten ist. Und zwar nicht erst mit dem Jahr 1968, dem »Jahr der Entscheidungen« (ich habe es im zweiten Band meiner Erinnerungen ausführlich beschrieben und analysiert), sondern, mit mehr historischer Tiefenschärfe gesehen, schon ab 1914: der Erste Weltkrieg als das Ende der bisher so optimistischen europäischen Moderne.
Bekanntlich hatte die Menschheit in der europäischen Neuzeit eine Fülle verschiedener Erfahrungen gemacht, die unser Verständnis von Mensch, Gesellschaft, Kosmos und auch Gott von Grund auf verändert haben. Im Zeichen der Leitideen Vernunft, Fortschritt und Nation war es zu vier folgenreichen revolutionären Entwicklungen gekommen: im 17./18. Jahrhundert zuerst die naturwissenschaftliche und philosophische Revolution, dann die Kulturrevolution der Aufklärung, die politisch kulminierte in der Amerikanischen und Französischen Revolution, und schließlich im 19. Jahrhundert die industrielle Revolution. Alles in allem hatte sich ein aufgeklärt-modernes Paradigma durchgesetzt, das sich grundlegend unterschied sowohl vom mittelalterlichen römisch-katholischen als auch vom darauffolgenden reformatorisch-protestantischen Paradigma des 16./17. Jahrhunderts.
Es war für mich seit Langem klar, dass die Errungenschaften der Moderne auch in der neuen nach-modernen Weltepoche nach dem Zweiten Weltkrieg nicht rückgängig gemacht werden können und dürfen. Auch Theologie, Kirche, Religion haben – bei aller berechtigten Kritik an Rationalismus, Nationalismus, Liberalismus und Sozialismus – die modernen Errungenschaften zu akzeptieren: Dies gilt für die bleibenden Ergebnisse der modernen Naturwissenschaft, Philosophie und der modernen Demokratie ebenso wie die der Human- und Sozialwissenschaften, und schließlich auch die der modernen Religionskritik, Bibelauslegung und Geschichtsforschung.
Doch andererseits lässt sich nicht übersehen, dass die Menschheit sich seit dem gesamtkulturellen Umbruch im Zusammenhang der beiden Weltkriege mitten im Übergang zu einer neuen Gesamtkonstellation befindet, die sich von der typisch modernen unterscheidet und die ich zunächst einmal das »postmoderne«, dann aber (um nicht mit der Ideologie des damals modischen »Postmodernismus« verwechselt zu werden) das »nach-moderne« Paradigma nenne. Zu Beginn der 1980er-Jahre kann ich dieses zeitgenössische Paradigma wie folgt knapp skizzieren:
– Verglichen mit 1918 und erst recht 1945 hat sich die weltpolitische Konstellation völlig verändert: Das eurozentrische Zeitalter des Kolonialismus und Imperialismus wurde abgelöst durch eine polyzentrische Welt.
– Die modernen Freiheitsbewegungen, die sich bereits im 19. Jahrhundert ankündigten und zwischen den Kriegen erstarkten, sind nach dem Zweiten Weltkrieg auf breiter Basis durchgebrochen: Der Kampf richtet sich nicht nur gegen Kolonialismus und Imperialismus, sondern auch gegen Rassismus, Sexismus und ungerechte soziale Strukturen, um so Frauen, Farbigen und der Dritten Welt mehr Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.
– Die Mächte der Neuzeit – Wissenschaft, Technologie und Industrie – sind wegen zahlloser verheerender Folgen vielfach fragwürdig geworden. Um der Menschlichkeit des Menschen willen und um der Bewohnbarkeit der Erde willen müssen sie sich neu in Verantwortung an ethischen Maßstäben ausrichten.
– Manche alternative Bewegungen – von der Umweltbewegung bis zur Friedensbewegung – scheinen in mancher Hinsicht eine weniger materialistische und mehr holistische, gesamtheitliche Weltsicht anzukündigen.
– Der von vielen verehrte große Gott der Moderne, »Fortschritt« genannt, wurde als falscher Gott entlarvt, seine Doppelgesichtigkeit wurde angesichts katastrophaler negativer »Nebeneffekte« offenbar, und der Ruf nach dem wahren Gott ist wieder laut geworden, und dies nicht nur im Christentum, sondern auch im Islam.
Die neue welthistorische Konstellation stellt für jede Theologie eine ungeheure Herausforderung dar, besonders aber für die römische, die heutzutage noch nicht einmal die Desiderate der Moderne (Naturwissenschaft, Demokratie, Menschenrechte, Toleranz …) voll integriert hat und jetzt auch noch den Anforderungen des neuen nach-modernen Paradigmas genügen sollte. Die kritischen Desiderate der Moderne dürfen gerade in der Theologie keinesfalls übergangen werden: Allzu gerne (und wenig ehrlich) reichen manchmal Vertreter des mittelalterlich-gegenreformatorisch-antimodernistischen Paradigmas in ihrer Vernunft- und Aufklärungskritik den Vertretern des nach-modernen Paradigmas die Hand! Doch die »Aufklärung« darf nicht rückgängig gemacht beziehungsweise übersprungen werden. Sie muss vielmehr vollendet werden: durch eine über ihre Leistungsfähigkeit und Grenzen aufgeklärte Aufklärung, welche Religion nicht mehr wie in der Moderne zunehmend ignoriert, verdrängt oder gar unterdrückt, sondern auf neue Weise kritisch integriert.
Wenn nicht alles täuscht, stehen wir seit den 80er-Jahren mitten im Prozess der Wiederentdeckung von Religion weltweit – nicht zu verwechseln mit dem politischen Konservatismus eines Präsident Reagan oder einer Premierministerin Thatcher, die in den 80er-Jahren den wuchernden Sozialstaat zugunsten der individuellen Initiative zurückdrängen wollten, die aber zugleich jene verhängnisvolle Deregulierung der Bankenwelt einleiteten, die in unseren Tagen beinahe zum Kollaps des Weltfinanzsystems geführt hat. Es geht dabei nicht nur um die Rolle des Staates und der individuellen Freiheit, sondern um die Frage nach der Qualität des Lebens überhaupt, welche die Ökonomie übersteigt und zu tun hat mit einem sozialen Erwachen: der Emanzipation der Frauen, der Stärkung der Nachbarschaftlichkeit, des zivilen sozialen Engagements, der Gemeinschaft. Religion hatte sich ja in den oft widersprüchlichen Entwicklungen der Moderne als resistenter erwiesen, als Kulturdiagnostiker aller religionskritischen Schattierungen wahrhaben wollten. Die Theologie aber hat in der neuen geistesgeschichtlichen Situation nur dann eine Chance, wenn sie für die neue Welt-Zeit eine zeitgemäße realistische Vision entwickelt, die besonders von der jungen Generation, welche viele traditionelle Dogmen, Moralgebote, Strukturen nicht mehr kennt oder nicht mehr anerkennt, verstanden werden kann.
So mache ich denn als Theologe unter erschwerten Bedingungen weiter, sogar mit gesteigerter Energie. Aber was treibt mich eigentlich an?
Was mich antreibt
So werde ich vor allem von Journalisten gefragt. Ja, was treibt mich an, immer wieder in Neuland vorzustoßen? Ich sage dann immer: Ich habe »die Träume meiner Jugend nicht verraten« (Schiller). Seit Jahrzehnten bin ich nun schon an der Universität, habe jedoch nie Wissenschaft im »Elfenbeinturm« getrieben, sondern immer Menschen im Blick gehabt, für die ich arbeite: meine Studenten zuerst, aber auch meine Leser und Zuhörer in der Nähe und in der Ferne. Als ich schon früh mich aufgrund meiner christlichen Glaubensüberzeugung zum Studium der Theologie entschloss, standen mir vor allem junge Menschen vor Augen. Dieser seelsorgliche, »pastorale« Impuls einer »Theologie für die Menschen« (Bd. 1, Kap. IX: Bei Paul VI.) bleibt Hauptmotivation meines Schaffens.
Natürlich ist ein solcher Impuls auch anderen Theologen eigen. Mit der weiteren Ausdehnung meines christlichen Interesses und Wirkkreises weit über die Kirchen hinaus war allerdings wie von selbst ein weiterer hinzugekommen, was ich etwas hochgestochen als »humanitären« Impuls bezeichnen könnte. Ich meine damit: Ohne je meine christliche Grundüberzeugung aufzugeben, ließ ich mich zunehmend auf die großen Anliegen der »Menschheit« mit ihren verschiedenen Religionen und Kulturen ein, dabei immer deutlicher »Menschlichkeit« als Ziel und Norm.
Doch kommt bei alldem ein wichtiger »psychologischer« Impuls hinzu, der mir hilft, so viele Jahrzehnte durchzuhalten. Es bereitet mir einfach Freude, immer weitere Bereiche und Felder, Länder, Religionen und Kulturen kennenzulernen. Aber auch ihre Heiligen Schriften und ihre Denker, um Meisterdenker in Person und Werk miteinander ins Gespräch zu bringen. Nicht nur die großen Theologen: von Origenes und Thomas von Aquin über Luther und Calvin bis zu Schleiermacher und Karl Barth, sondern auch die großen Philosophen insbesondere der Neuzeit: von Descartes und Pascal über Hegel, Feuerbach und Marx bis zu Nietzsche, Freud, Sartre und Popper. Schließlich immer mehr auch die bedeutenden geistigen Repräsentanten anderer Religionen wie Moses Maimonides oder Moses Mendelssohn im Judentum, al-Gazzali oder Ibn Haldun im Islam, oder später im Hinduismus Shankara oder im Buddhismus Nagarjuna …