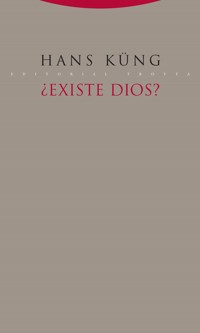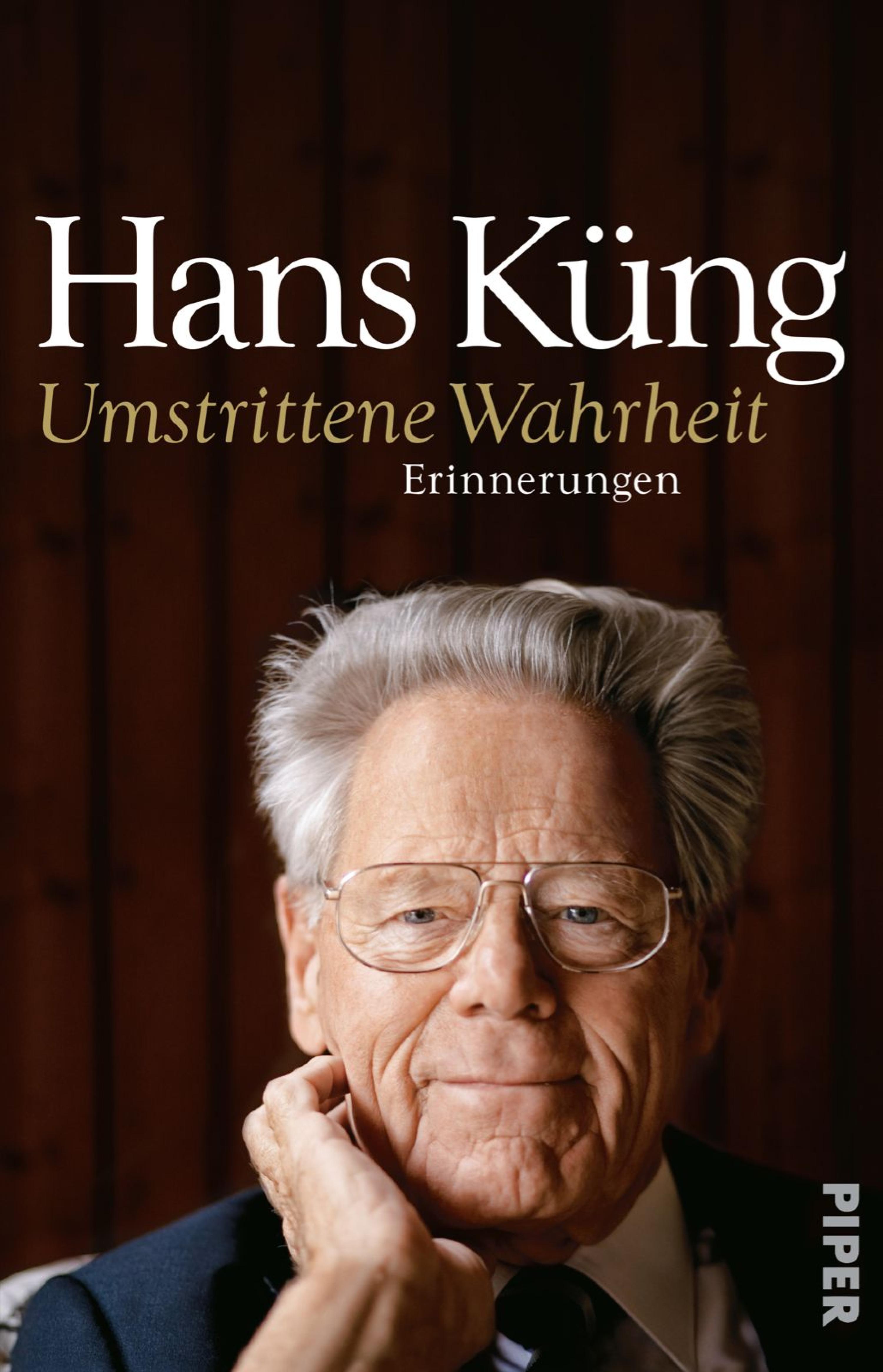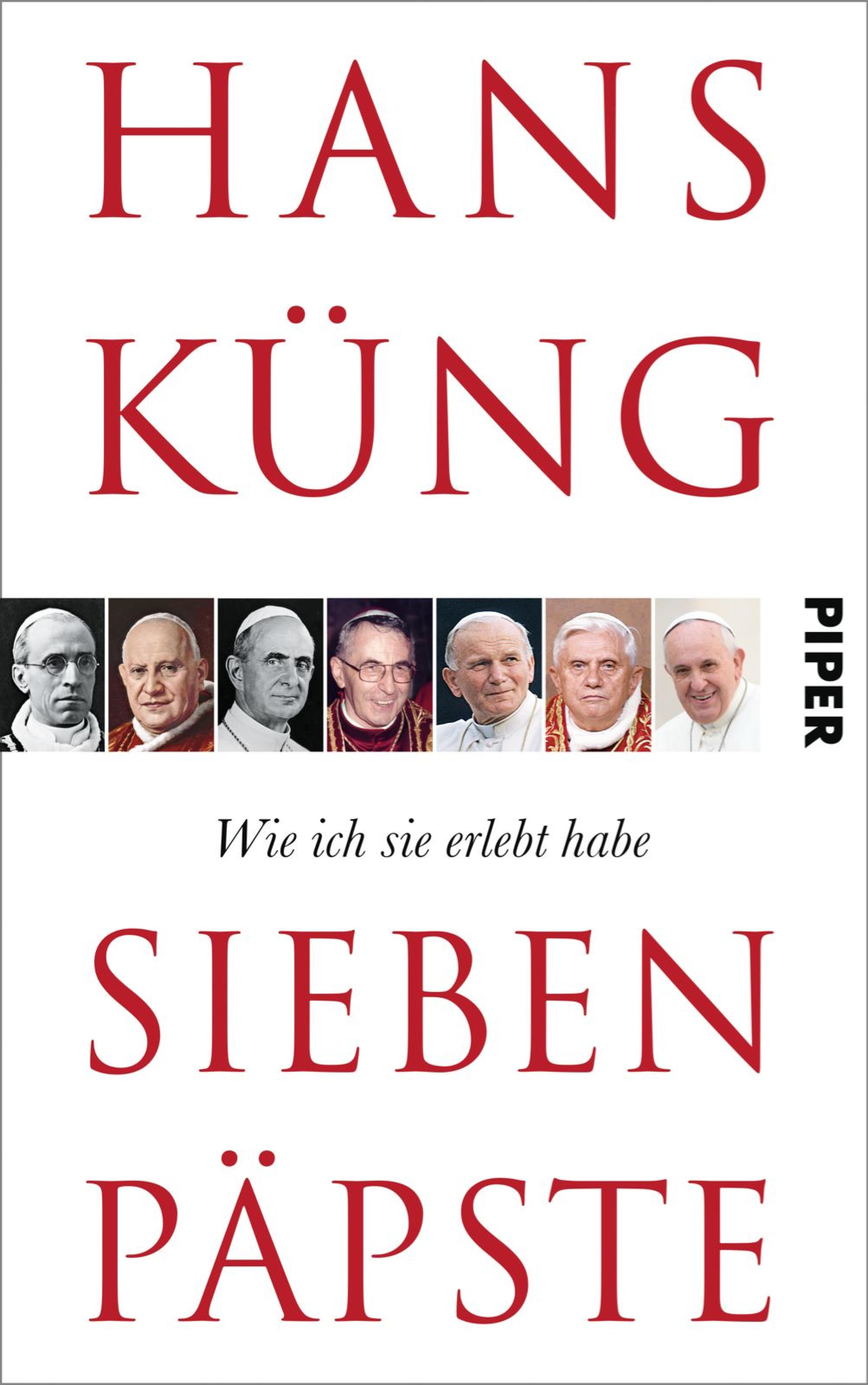9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Wer könnte diese drängende Frage besser beantworten als Hans Küng? Seit er 1990 ein gemeinsames Weltethos vorgeschlagen hat (die Übersetzung liegt in 22 Sprachen vor), beschäftigt er sich mit dem Problem des gerechten Wirtschaftens. Der Sozialismus ist abgewirtschaftet, der Kapitalismus steckt in einer Krise – gibt es einen dritten Weg? So einfach ist es nicht, sagt Hans Küng. Er fragt nach den Grundlagen der Globalisierung ebenso wie nach der moralischen Begründung des Gewinns und den wahren Kosten der Marktwirtschaft. So plädiert er für einen Wertekanon, der dem Einzelnen wie der Gesellschaft insgesamt sagen kann, was »anständig« ist in der Wirtschaft – und was nicht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Titelei
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienen Buchausgabe
1. Auflage 2010
ISBN 978-3-492-95128-9
© Piper Verlag GmbH, München 2010
Umschlaggestaltung: www.buero-jorge-schmidt.de
Umschlagfoto: www.peterrigaud.com
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Plädoyer für Menschenanstand
Dieses Buch ist kein publizistischer »Schnellschuss«. Es war seit langem in Arbeit. Unter der Parole »Anständig wirtschaften« präzisiere, konkretisiere und aktualisiere ich eine Botschaft, die ich schon vor mehr als zwei Jahrzehnten zum ersten Mal formulierte, die aber in all den Jahren ständig an Dringlichkeit und Akzeptanz gewann und durch die Weltwirtschaftskrise seit 2008 aktueller denn je geworden ist.
Im Jahr 1990, als das Sowjetimperium implodierte und die Globalisierung sich so auf dem ganzen Globus ausdehnen konnte, hielt ich vor dem Plenum des Weltwirtschaftsforums in Davos den Vortrag »Warum brauchen wir globale ethische Standards um zu überleben?«. Noch im selben Jahr veröffentlichte ich das programmatische Buch »Projekt Weltethos« und schrieb es später fort in der Studie »Weltethos für Weltpolitik und Weltwirtschaft« (1997). Meine dort formulierten Analysen und Thesen konnte ich verschiedentlich testen, vor allem in einem Vortrag vor der International Confederation of Stock Exchanges in Kuala Lumpur 1998 (»Ethical Standards for International Financial Transactions«) und auf einem hochkarätigen Symposion der Stiftung Weltethos in Baden-Baden 2001 über »Globale Unternehmen und globales Ethos« (»Der globale Markt erfordert neue Standards und eine globale Rahmenordnung«). All diese Studien und die Erfahrungen ungezählter Begegnungen und Diskussionen weltweit auf Kongressen und Expertentreffen in den Folgejahren brachte ich ein in den Prozess für ein Manifest »Weltethos – Konsequenzen für globales Wirtschaften«. Es wurde in den Jahren 2008/09 von einer Expertengruppe der Stiftung Weltethos unter Federführung des Konstanzer Wirtschaftsethikers Prof. Josef Wieland erarbeitet.
So habe ich all die Jahre hindurch versucht hinzuzulernen, um die hochkomplexe Welt der Wirtschaft zu verstehen. Doch bin ich mir meiner Grenzen stets bewusst geblieben:
Ich kenne mich selbstverständlich in der nationalen und internationalen Finanzwelt nicht aus wie ein Finanzminister, stehe aber auch nicht unter dem Zwang, eine in vielem anfechtbare Wirtschaftspolitik in einem Buch rechtfertigen zu müssen.
Ich bin kein Ökonom – diese Spezialisten wissen auf ihren jeweiligen Fachgebieten unendlich viel mehr als ich –, darf mir allerdings gestatten, aus einer breiteren historischen, philosophischen, theologischen Perspektive kritische Fragen auch an die Wirtschaftswissenschaft zu stellen.
Ich bin kein Banker, der sich in all den »strukturierten Finanzprodukten«, in Hedgefonds und Derivaten auskennen würde, muss freilich auch nicht die Legitimität neuerer Geschäftsmodelle der Finanzbranche verteidigen, welche die Weltwirtschaft in eine Krise gestürzt haben.
Und ich bin auch kein Unternehmer oder Manager, der in den oft komplexen Entscheidungen seines Berufsalltags die Verantwortung für Hunderte oder Tausende Arbeitsplätze trägt. Wohl aber sorge ich mich mit vielen Zeitgenossen um den Zustand unserer Welt und bemühe mich durch umfassende Lektüre und immer neue persönliche Gespräche um ein differenziertes Verständnis auch der Wirtschaftswelt.
Damit ist schon der Horizont aufgezeigt, vor dem ich für ein »anständig Wirtschaften« werben möchte. Man kann dieses Programmwort als Indikativ verstehen, als rein sachliche Aussage, aber auch als Imperativ mit Ausrufezeichen, als dringend gebotene Forderung.
Doch was verstehe ich unter »anständig«? Die heutige Wirtschaftssprache liebt Anglizismen und verharmlosende Euphemismen: »downsizing«, »outsourcing«, »sub-prime« (jetzt toxisch), »structured products« (verbriefte Sammelsurien), »financial industry« (keine bodenständige wertschaffende Industrie). Dagegen habe ich absichtlich das schlichte, beinahe altmodische Wort »anständig« gewählt.
»Anständig« hat noch immer einen guten Klang und weist zudem drei verschiedene Bedeutungsschichten auf:
–»Anständig« kann als umgangssprachliches Synonym für »kräftig, beträchtlich, stark« verstanden werden (»Letzte Nacht war es aber anständig kalt!«). Im Sinn von »nachdrücklich, engagiert« kann es auch auf ein »anständiges« Wirtschaften angewandt werden.
–»Anständig« kann vom äußeren Anstand oder Umgang her verstanden werden und meint dann »zufriedenstellend, durchaus genügend, ordentlich«. Zum Beispiel: »Dieser Geschäftsmann oder Angestellte hat stets anständige Arbeit geleistet.« Anständiges Wirtschaften meint hier ein korrektes, solides, legales wirtschaftliches Handeln.
–»Anständig« kann vom inneren Anstand oder Charakter her verstanden werden und meint dann »sittlich einwandfrei, rechtschaffen, honorig, redlich«. Zum Beispiel: »Mein Wettbewerber ist ein höchst anständiger Mann, eine sehr anständige Firma.« Anständiges Wirtschaften meint dann nicht nur ein äußerlich korrektes, im Rahmen der Gesetze sich bewegendes Benehmen, das vielleicht nur auf äußerer Gewöhnung oder Umgang beruht, sondern ein von innerer sittlicher Grundhaltung getragenes, ethisches Verhalten, das rechtlich nicht erzwingbar und doch geschuldet ist. Moral kann durch Gesetze nicht erzwungen und erst recht nicht ersetzt, mangelnder Anstand nicht durch Vorschriften behoben werden.
Ich plädiere für Anstand in der Wirtschaft in diesem umfassenden Sinn, für »Menschenanstand«. Der deutsche Nobelpreisträger für Literatur Thomas Mann hat nach den Verbrechen des Nationalsozialismus dieses Wort für die Zehn Gebote gebraucht: sie seien »ein ABC des Menschenbenehmens«, ja »Grundweisung und Fels des Menschenanstands«. Wahrhaftig, die Zehn Gebote stellen den substantiellsten, markantesten Beitrag der Religion oder Kultur zu einem gemeinsamen Menschheitsethos dar. Thomas Manns Worte zitierte ich zum Abschluss meines Fernsehfilms »Spurensuche« über das Judentum (Erstsendung 1999) in Tel Aviv an der Stelle, wo 1995 der israelische Ministerpräsident Itzhak Rabin seinen Einsatz für Frieden und Versöhnung, niedergestreckt von einem fanatischen Israeli, mit dem Leben bezahlen musste. Meine Worte zum Gedenken: »Dieses ABC des Menschenbenehmens muss in der Zeit der Globalisierung gerade auch für Weltpolitik und Weltwirtschaft gelten … Natürlich hat auch die Weltwirtschaft sich zu richten nach bestimmten ökonomischen Gesetzlichkeiten und nach der Durchsetzbarkeit von all dem, was sie nun einmal zu leisten hat. Aber das heißt auch wieder nicht, dass der Profit, und sei er noch so gerechtfertigt, alle Mittel heiligt, auch Vertrauensbruch, auch unermessliche Raffgier und soziale Ausbeutung.«
Heute zu formulieren, worauf es in der Wirtschaft ankommt, heißt nicht, dass ich mich zum »Schiedsrichter« aufwerfen möchte für die zahllosen diffizilen Fragen des alltäglichen Wirtschaftens oder gar die Ökonomen Ökonomie lehren möchte; ich kenne meine Grenzen. Wohl aber beabsichtige ich einen bescheidenen Beitrag zu leisten zu einer Wiederentdeckung und Neubewertung des Ethos in der Wirtschaft; ich kenne auch meine Verantwortung. Dringend gefordert ist ein Umdenken in Richtung auf ein wieder anständigeres, von ethischen Prinzipien getragenes Wirtschaften.
Natürlich könnte man auch von der »Moral« in der Wirtschaft reden, wenn Moral als sittliche Haltung oder Normensystem und nicht als »Moralismus« oder »moralisieren« verstanden wird. Denn »moralisieren« oder »Moralismus« ist eine Überbewertung, Überforderung, Verabsolutierung der Moral, welche die Eigenständigkeit unterschiedlicher Lebensbereiche wie Wirtschaft, Politik, Recht und Kunst missachtet. Sie will die Moral zum alleinigen Maßstab menschlichen Handelns machen und fixiert sich oft auf bestimmte Lebensbereiche (in der katholischen Hierarchie besonders die Sexualmoral).
Ich bin kein Moralprediger. Statt zu moralisieren möchte ich argumentieren, nicht von oben, sondern von innen und von unten, von der Empirie her, soweit wie mir möglich im Dialog mit der zuständigen Fachwissenschaft. So hoffe ich vermitteln zu können, dass es immanente und kohärente ethische Grundlinien gibt, und so Ökonomen, Politiker und alle Teilhaber am Wirtschaftsprozess zu überzeugen, dass die Sache der Wirtschaft und die Sache des Ethos nicht getrennt werden können.
Längst vor der Weltfinanz- und Wirtschaftskrise also ging es mir um das Ethos in der Wirtschaft und besonders in der Weltwirtschaft, die, wie die neuesten Erfahrungen bestätigen, ohne ein gemeinsames elementares Menschheitsethos womöglich in eine Katastrophe führen kann. Nein, ich behaupte nicht, dass ein Weltethos uns aus der weltweiten Krise herausführt, wohl aber, dass es ohne ein Weltethos keinen nachhaltigen Weg aus der Krise gibt.
Dazu soll auch das von der Stiftung Weltethos vorgelegte Manifest für ein Globales Wirtschaftsethos (»Global Economic Ethic – Consequences for Global Businesses«) helfen, auf das dieses Buch hinausläuft. Alle, die dieses Manifest vertreten, sind überzeugt, dass es dabei nicht um eine weltfremde »Utopie« geht, um ein Nirgendwo. Es geht vielmehr um eine sich langsam realisierende, also realistische Zukunftsvision, die sich unterscheidet von den buchstäblich heruntergewirtschafteten Fortschrittsideologien sozialistischer oder kapitalistischer Prägung, die im vergangenen Jahrhundert lange als »wissenschaftliche« Totalerklärungen und attraktive, »fortschrittliche« Pseudoreligionen dienten. Und ich glaube ebensowenig an eine »Erneuerung« des realen Sozialismus wie an eine »Erneuerung« des realen Kapitalismus.
Alles was in diesem Buch über die Problematik der Wirtschaft und Wirtschaftsgeschichte geschrieben ist, dient nicht einem rein wissenschaftlich-akademischen Zweck, sondern einem praktisch-politischen Ziel. Ich bin mir bewusst, dass ich für manche Betroffene ein sehr unbequemes Buch verfasst habe. Aber auch sie mögen mir glauben, dass ich alles ohne Eigeninteresse nach bestem Wissen und Gewissen im Dienst des Gemeinwohls geschrieben habe. Das Buch will einen fairen Beitrag leisten zu einem notwendigen ehrlichen und nachhaltigen Umdenken, das in einem komplexen, langfristigen und langwierigen Bewusstseinswandel bereits in Gang gekommen ist. Kaum noch jemand, sei er eher konservativ oder eher progressiv eingestellt, denkt heute noch so wie vor fünfzig Jahren über Probleme wie Krieg und Abrüstung, Ökonomie und Ökologie oder die Partnerschaft von Mann und Frau. Alles im Grunde auch schon ethische Fragen, die nach einer umfassenden Neubesinnung auf das uns gemeinsame Menschheitsethos überhaupt rufen.
Deshalb keine Sonntagspredigt für oder gegen Marktwirtschaft, kein rein theoretischer Appell für Moralität, sondern ein mit Analysen und Argumenten verschiedenster Art fundiertes Plädoyer für ein anständiges, ethisches Wirtschaften. Wie die gesamtwirtschaftliche Lage freilich nach Drucklegung des Buches aussehen wird, ist in diesen Zeiten dramatischer Konjunkturschwankungen nicht absehbar.
Tübingen, 15. Juli 2010
Hans Küng
I.Krise der Weltwirtschaft: Globalisierung im Zwielicht
Die globale Finanzmarktkrise, die Mitte 2007 mit dem Zusammenbruch von Banken infolge der Subprime-Krise ausgebrochen war, wurde am 15.September 2008 zur globalen Wirtschaftskrise: Die Wallstreet, die bisher die Finanzwelt dominierte, bat an diesem Tag die US-Regierung um Hilfe! Ein Tag ähnlich dem »Schwarzen Freitag« von 1929. Am 23.Oktober 2008 musste Alan Greenspan, während 19Jahren Präsident der US-Notenbank, also der einflussreichste Zentralbanker der Welt, im US-Kongress vor dem Komitee des Repräsentantenhauses für »Oversight and Government Reform« erscheinen und zugeben, dass die auch von Washington und Wallstreet geteilte »Weltsicht« oder »Ideologie«, die Finanzmärkte würden es stets besser wissen und sich selber regulieren, falsch war.
Genau drei Wochen später war ich in New York und hielt am 13.November 2008 im Earth Institute der Columbia University einen Vortrag über Globalisierung und Globales Ethos. Begrüßt wurde ich vom angesehenen Ökonomen Jeffrey Sachs zustimmend mit einem längeren Zitat, das ich mehr als zehn Jahre zuvor formuliert hatte: »Schon die kleinste Bemerkung etwa des Präsidenten der amerikanischen Notenbank, Alan Greenspan, Anfang Dezember 1996, ein ›irrationaler Überschwang‹ (›irrational exuberance‹) hätte zu einer Überbewertung der Finanzmärkte geführt, reichte aus, um die nervösen Investoren auf den hochfliegenden Aktienmärkten Asiens, Europas und Amerikas in einen Kurssturz und zu Panikverkäufen zu treiben. Dies zeigt auch, dass Krisen bei Globalisierung sich nicht von vornherein auspendeln, sondern sich vielleicht aufschaukeln. Da fühlt man sich doch mit seiner Vermutung bestätigt, die Chaostheorie fände auch in der Ökonomie Anwendung. Und auch unter Ökonomen und Experten des internationalen Rechts, welche die Wiederkehr der Weltwirtschaftskrise und des Zusammenbruchs der Wirtschaftsordnungen von 1929–33 für heute ausschließen möchten, geht die Angst um, ›mit dem Prozess der Internationalisierung werde eine Entwicklung in Gang gesetzt, welche die nationalen Volkswirtschaften mit erhöhten Stabilitätsrisiken bei gleichzeitiger Reduktion staatlicher Handlungsmöglichkeiten konfrontiere‹«. So 1997 in »Weltethos für Weltpolitik und Weltwirtschaft«, S.292.
Die Ursprünge der 2008 ausgebrochenen Wirtschaftskrise liegen Jahrzehnte zurück. Und wenn ich, anders als manche Mainstream-Ökonomen, schon lange mit einer solchen Krise rechnete, dann weil ich Entwicklungen, die in diese Krise führten, in jenem Buch genau analysiert hatte. Darauf kann ich nun, ständig auf kritische Ökonomen hörend, zurückgreifen und die dortigen Ausführungen auf die gegenwärtige Situation zuspitzen. Selbstverständlich kann ich nicht die seit 1997 erschienene, kaum übersehbare Literatur aufarbeiten. Doch an den vier Charakteristika der Globalisierung, wie ich sie damals darlegte, möchte ich festhalten, da sie in der gegenwärtigen Weltwirtschaftskrise Basis für einen vernünftigen minimalen Konsens sein können zwischen Globalisierungsbefürwortern und Globalisierungskritikern.
1.Die Globalisierung war unvermeidbar
Nach einer Definition der OECD ist »Globalisierung« der Wirtschaft jener Prozess, durch den Märkte und Produktion in verschiedenen Ländern immer mehr voneinander abhängig werden aufgrund der Dynamik des Handels mit Gütern und Dienstleistungen und durch die Bewegungen von Kapital und Technologie. Die Globalisierung der Ökonomie ist also von einer Globalisierung der Technologie und damit der Kommunikation begleitet. Globalisierung ist in ihrem Ursprung keine Verschwörung der Amerikaner oder Japaner, der Banker oder Politiker oder irgendwelcher finsterer Mächte. Sie ist vielmehr Ergebnis der technologisch-ökonomischen Entwicklung der modernen Welt, die schon vor Jahrhunderten begann.
Übergang von der National- zur Globalökonomie
Aufgrund der Erschließung neuer Handelswege nach Amerika und Asien im 16.Jahrhundert hatte bereits mit der Industrialisierung des 18.Jahrhunderts eine internationale Arbeitsteilung eingesetzt. Für alle Welt sichtbar aber hat die Globalisierung von Wirtschaft und Verkehr im Europa des 19.Jahrhunderts begonnen, und zwar in doppelter Hinsicht: einerseits durch den liberalisierten Außenhandel aufgrund des Prinzips der Meistbegünstigung (britisch-französischer Cobden-Vertrag 1860) und der Goldwährung, die einheitliche Regeln für Geld- und Finanzpolitik ermöglichte. Andererseits durch die sich stetig entwickelnde ungeheuere Beschleunigung von Verkehr und weltweiter Kommunikation mit Dampfschiffen, Eisenbahnen und Telegraphen.
Nach einer vorübergehenden Phase des nationalstaatlichen Isolationismus vor und während des Ersten Weltkriegs setzte sich die Globalisierung nach dem Krieg im nunmehr polyzentrisch expandierenden Weltwirtschaftssystem durch: mit Luftverkehr, Telefon und modernem Finanzsystem. Sie erreicht – nach der Unterbrechung durch den Zweiten Weltkrieg – im digitalen Zeitalter unmittelbar vor der Jahrtausendwende ihren beinahe schwindelerregenden Höhepunkt.
Warum spricht man heute geradezu von einer weltwirtschaftlichen Strukturrevolution? Telefax, Satellitenkommunikation, globaler Datenfluss, WorldWideWeb und elektronische Welt-Börse sowie die immense Verbilligung des Transports von Informationen, Waren und Menschen zeigen: Der Übergang von der Nationalökonomie zur Globalökonomie hat durch weltweite Vernetzung der wirtschaftlich-technologischen Prozesse ein noch nie dagewesenes rasantes Tempo angenommen. Markt und Produktion, Kapital und Technologie kennen immer weniger nationale Grenzen. Nicht nur der Handel, auch die Unternehmen und ihre Produktion werden zunehmend global. Bisher unbekannte Konkurrenz meldet sich oft beinahe gleichzeitig mit günstigen Angeboten über das Internet und trägt zur Transparenz, zum intensiveren Wettbewerb, aber auch zur Turbulenz der Märkte bei. Es bildet sich, mitbedingt durch Internet, Logistik und allgemeine Vernetzung, ein globales Bewusstsein. Und zugleich bauen sich neue Spannungen auf.
Neue wirtschaftlich-politische Machtverteilung
Diese revolutionäre Transformation anzuhalten oder gar rückgängig zu machen, wäre einvergebliches Unterfangen. Kein neuer Isolationismus in den Vereinigten Staaten, keine Opposition gegenüber einer Freihandelszone in Mexiko, keine Aversionen gegen den Kapitalismus im früheren Sowjetblock, keine totalitäre Parteiideologie in China und auch keine sozialistischen Nostalgien in Europa ließen es zu, sich aus diesem Prozess der Globalisierung einfach auszuklinken und ohne Liberalisierung der Finanzmärkte und Zollabbau stur wieder den eigenen nationalen Weg zu gehen. Es zeigt sich rasch: Wer hier nicht mitmacht, degradiert sich von vornherein zu einer drittklassigen Wirtschaftsmacht.
Die Globalisierung wird als neue große Herausforderung empfunden, insbesondere in Europa und Nordamerika, wo man sich aufgrund neuer Wettbewerber aus den Schwellen- und Entwicklungsländern plötzlich in die Verteidigung seiner Marktpositionen gedrängt sieht. Es geht somit um einen inneren Strukturwandel der Industrienationen, aber zugleich auch nach außen um eine neue wirtschaftliche und politische Machtverteilung auf unserem Globus, bei der es für keine Volkswirtschaft garantierte Besitzstände gibt.
Auch die Entwicklungsländer und besonders die industriellen Schwellenländer wünschen verständlicherweise die Globalisierung herbei. Kann man es ihnen verbieten? Sie möchten einen ähnlichen Entwicklungsstand wie die entwickelten Nationen erreichen. Und nach Japan und den asiatischen »vier Tigern« (Südkorea, Hongkong, Taiwan und Singapur) zeigen es immer mehr China, Indien und südostasiatische Länder, ja, nahezu alle anderen Staaten dieser Region der Welt, dass wir aufgrund dieser Entwicklung in allernächster Zukunft mit drei einigermaßen gleichgewichtigen (im Inneren aber höchst ungleichgewichtigen!) Wirtschaftsräumen zu rechnen haben: Europa (mit »Werkbank« Osteuropa), Nordamerika und Ostasien, wobei zweifellos auch Südasien (Indien) und Lateinamerika (Brasilien) erstarken werden. Im Schatten dieser Wirtschaftsräume bleibt Afrika trotz der Fußballweltmeisterschaft 2010 der große Problemkontinent. Doch schon diese teilweise sehr unterschiedliche Entwicklung der Kontinente lässt ahnen:
2.Die Globalisierung erwies sich als ambivalent
Auch Pessimisten können es nicht übersehen: Wir alle in den Industrieländern genießen tagtäglich die Früchte der Globalisierung der Technologie, der Güter, der Dienstleistungen und auch des Kapitals. Und so vieles vom Faxen und Mailen bis zum Fliegen und Tourismus ist im Zuge dieser Entwicklung billiger und damit auch für riesige Massen von Menschen erschwinglicher geworden. Und eben auch rascher: Binnen eines Tages lässt sich der Globus vom Menschen umreisen, und Satelliten umkreisen ihn in einer Stunde.
Neue Chancen: billiger, effektiver, innovativer, wohlstandsmehrend
Nicht nur die Industrienationen, auch die Entwicklungsländer, und besonders die Schwellenländer, haben hier ganz neue Chancen. Als kostengünstige Anbieter (mit oft gut ausgebildeten Arbeitskräften) kommen sie auf die Weltmärkte und gefährden die alten Industrieländer, in denen Arbeitsplätze verloren gehen. Die vier Länder der BRIC-Gruppe (Brasilien, Russland, Indien, China) tragen, berücksichtigt man Kaufkraftparitäten, 2010 schon mehr als ein Viertel zur Weltwirtschaftsleistung bei; die OECD-Länder nur noch etwas mehr als die Hälfte der gesamten Wirtschaftsleistung.
Ist also eine grenzenlose, globale Wirtschaft nicht ein Fortschritt gegenüber der national beschränkten Wirtschaft, ähnlich wie früher die nationale Ökonomie gegenüber der lokalen oder regionalen? Und sollte zweitens nicht auch eine transnationale, globale Wissenschaft, die Personen, Ausstattung und Finanzierung aus mehreren Ländern einbezieht, billiger, effektiver und sinnvoller funktionieren können, etwa bei Großprojekten der Natur- und Biowissenschaften von der Raumfahrttechnik über die Teilchenphysik zur Genomforschung? Und sollte drittens nicht auch eine international vernetzte, globale Information, die Nachrichten und Bilder fast zeitgleich an jedem Ort unserer Erde zugänglich macht, dem Dialog der Kulturen und der weltweiten Demokratiebewegung helfen können? Diktatorische Regime haben es heutzutage zunehmend schwer, ihre Völker von der Außenwelt abzuschotten.
Der revolutionäre weltwirtschaftliche Strukturwandel ist nicht mehr zu übersehen: Nicht nur Arbeit und Produktion, sondern auch Wissenschaft und Medien lösen sich zunehmend von nationalen Standorten. Diese neue Freiheit und Freizügigkeit schafft völlig neue Möglichkeiten, aber auch – besonders für eine bislang nationale Wirtschafts-, Sozial- und Umweltpolitik – völlig neue Schwierigkeiten.
Neue Risiken: menschenrechtsverachtend, ausbeuterisch, umweltzerstörend
Neben allen positiven Konsequenzen können selbst begeisterte Anhänger und Förderer der Globalisierung, können besonders Wirtschaftswissenschaftler und Wirtschaftsführer die zunehmend negativen Folgen für die Beschäftigung, den Lebensstandard und die Umwelt in vielen betroffenen Ländern nicht mehr übersehen. Sie beunruhigen heute viele. Nur wenige Fakten seien vermerkt:
–Die globale Vernetzung der Welt betrifft nur bestimmte Lebensbereiche und Bevölkerungsschichten, andere nicht. National wie im Weltmaßstab gibt es Globalisierungsgewinner und Globalisierungsverlierer.
–Die Ausnützung von billigen Arbeitskräften in Entwicklungsländern (so sehr das natürlich für diese Staaten eine nicht zu verachtende Startchance bedeutet) zeigte in vielen Fällen wegen des Fehlens einer flankierenden Wirtschaftspolitik bisher keinen nachhaltigen Entwicklungseffekt. Im Exportsektor wurden gewiss neue Arbeitsplätze geschaffen, oft aber gingen in traditionellen Sektoren so viele verloren, dass die Arbeitsplatzbilanz unter Experten höchst umstritten ist.
–Der industrialisierte und politisch gesteuerte Agrarexport etwa der EU oder der USA zerstört, so hilfreich er sein kann, leider oft die traditionelle, auf Selbsterhaltung ausgerichtete Agrarwirtschaft der Entwicklungsländer. Die Neuinvestitionen der Industrieländer haben dort zwar mehr Konsumgüter, aber oft auch den Ruin lokaler Manufakturen zur Folge. Zudem verstärken sie die Abhängigkeit der Entwicklungsländer von ausländischen Großkonzernen.
–Die transnationalen »Global Players« im Finanzsektor bedrohen vielfach die nationale Autonomie. Sie erscheinen häufig einflussreicher als die nationalen Regierungen: Investmentbanker und Devisenspekulanten (»Traders« oder kurzfristig orientierte Anleger) nehmen zwar in Anspruch, durchaus rationale Akteure zu sein, und funktionieren zugleich als die großen Egoisten und als Sozialreparateure des Finanzmarktes. Aber sie agieren fast nur vom Markt »kontrolliert« und sind mitverantwortlich für gefährliche »Börsenneurosen« und Währungsturbulenzen, mit denen selbst Zentralbanken als Hüterinnen des internationalen Währungssystems nur schwer fertig werden. Und dies nicht erst im Zusammenhang mit Griechenland. Schon 1992 trugen sie wesentlich bei zum beschleunigten Ausscheiden der freilich überbewerteten britischen Währung aus dem Europäischen Währungssystem. Der Primat der Politik hat sich mehr und mehr zu einem Primat der Wirtschaft hin verschoben.
–Die oft durch das Verhalten der Tarifpartner, der Sozialpolitik und des Staates veranlasste, doch aufgrund der Globalisierung vielfach vorangetriebene Verschlankung (»downsizing«) von Unternehmen und Auslagerung (»outsourcing«) von Arbeitsplätzen in Billiglohnländer hatte die Entlassung Zigtausender einheimischer Arbeitskräfte zur Folge, die nicht von produktivitätsstärkeren Branchen aufgefangen werden konnten. Von den 212 Millionen Menschen, die 2009 weltweit arbeitslos waren (Schätzung der Internationalen Arbeitsorganisation ILO), befinden sich viele Millionen in den Industrieländern, beinahe vier Millionen in Deutschland. In den Industrieländern stieg die Zahl der Arbeitslosen allein 2009 um 12Millionen an.
–Die global agierenden Unternehmen entzogen sich immer wieder der Kontrolle der Nationalstaaten, vor allem wenn eine industriefeindliche Politik zu erwarten war oder unverhältnismäßig hohe Steuern erhoben wurden. So bezogen sie in ihrem europäischen Stammland oft hohe Staatssubventionen, bezahlten aber immer weniger Steuern und trugen mit anderen Faktoren bei zur Gefährdung der ohnehin überforderten sozialen Sicherungssysteme.
–Die Globalisierung von Ökonomie und Technologie brachte in manchen Bereichen fast notwendig eine globale Ausweitung ökologischer Probleme mit sich: katastrophale Schäden in der Natur von der Verschmutzung der Meere und Flüsse bis zur Vergiftung und Erwärmung der Atmosphäre, zum Ozonloch, zur Ölkatastrophe und zum Klimawandel überhaupt.
–Schließlich hatte die ökonomisch-technologische Globalisierung auch eine Globalisierung des organisierten Verbrechens (Mafia) zur Folge. Beispiele dafür sind der Drogenhandel und die Wettbetrügerei im Sport, weiter der Frauenhandel und Kindermissbrauch mit Hilfe des Internet.
Angesichts der durchaus ambivalenten Folgen dieser Globalisierung von Ökonomie, Technologie und Ökologie ist es nicht erstaunlich, dass die Prognosen und Bewertungen der Globalisierung schon früh recht verschieden ausfielen:
–Die einen wollten in dem rasanten weltwirtschaftlichen Strukturwandel eine einmalige Chance erkennen: Neue Märkte mit großer Wachstumsdynamik könnten mit einer Politik des Bewahrens und der Verteidigung bisheriger Positionen nicht genutzt werden. Wirtschaft und Politik müssten radikal umdenken und sich der Herausforderung des weltweiten Wettbewerbs stellen. Es brauche einen Mentalitätswandel und eine Steigerung der Leistungsbereitschaft aller, wenn wir nicht drastische Wohlstandsverluste in Kauf nehmen wollen. Also »Mut zum Aufbruch«1.
–Die anderen wollten in der Globalisierung einen »Angriff auf Demokratie und Wohlstand«2 sehen. Bei der Verteilung des so erzeugten Reichtums arbeite die globale Wirtschaftsmaschine mangels staatlicher Eingriffe alles andere als effizient, die Zahl der Verlierer übersteige die der Gewinner bei weitem. Die Schere zwischen Arm und Reich, sowohl im Weltmaßstab zwischen Nord- und Südhemisphäre als auch innerhalb der einzelnen Länder, öffne sich durch die Globalisierung immer weiter.
Heute dürfte indes über eines Konsens bestehen: Die Globalisierung hat als intensivierter Wettbewerb ohne Zweifel vorteilhafte und zugleich nachteilige Effekte. Doch ist schwer abzusehen, welche in Zukunft dominieren werden. Dazu eine dritte Überlegung:
3.Die Globalisierung bleibt unberechenbar
In den vergangenen Jahrzehnten wurden wir mit Statistiken und ökonomischen Voraussagen überhäuft. Aber was die Globalisierung nicht nur an beabsichtigten Haupteffekten, sondern auch an nicht gewollten Nebeneffekten hervorbringen würde, ließ und lässt sich kaum exakt vorhersagen. Im nachhinein sehen sich die Skeptiker bestätigt:
Unsichere Prognosen
Je längerfristig eine Prognose, um so riskanter. Längerfristige Wirtschaftsprognosen im Sinn »bedingter Vorausberechnungen« sind zweifellos »präziser« als bedingt vorausberechnete längerfristige Wetterprognosen (Ökonomen mögen mir den gewagten Vergleich verzeihen). Aber sie hängen ganz von der Konstanz der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und politischen Rahmendaten ab. Wirtschaften ist ein offener Prozess, sagen die Ökonomen ja selber: Die Wirtschaft ist das Ergebnis ständigen menschlichen Handelns und nicht das Ergebnis eines einmaligen menschlichen Entwurfs.
So kann man denn kaum ganz ausschließen, dass die »Chaostheorie« nicht nur den Meteorologen, sondern auch den Ökonomen etwas zu sagen hat: dass kleine, zunächst kaum beachtete Störungen des Systems (der berühmte Schmetterling in der Karibik) mit der Zeit zu dramatischen Veränderungen (einem Wirbelsturm an der amerikanischen Ostküste) führen können. Ein warnendes Beispiel war seinerzeit schon die – außer für kritische Beobachter der Wechselkurspolitik – völlig unerwartete dramatische Finanzkrise Mexikos im Januar 1995, die leicht zu einer Krise des gesamten Weltfinanzsystems hätte führen können; nur durch internationale Kreditzusagen in Höhe von über 50Milliarden Dollar konnte sie im letzten Moment gemeistert werden. Doch weitere Finanzkrisen, die Börsenauguren wussten es schon damals, würden folgen. Aber ob sie immer so leicht bewältigt werden könnten, war keineswegs sicher. Es wurde immer deutlicher: Die Prognostiker arbeiten, ob eingestanden oder nicht, mit vielen »Wenn-dann«-Schlüssen. »Bedingte Prognosen« aber (über begrenzte Zusammenhänge) helfen in der Praxis auch nur bedingt.
Unvorhersehbare politisch-wirtschaftliche Entwicklungen
Unvorhersehbare politische und wirtschaftliche Entwicklungen können alle für plausibel gehaltenen Erwartungen jederzeit über den Haufen werfen. Schon vor der intensivierten Globalisierung hatte etwa der Ölschock 1973 alle mit unendlich viel statistischem Material errechneten ökonomischen Extrapolationen sozusagen über Nacht Makulatur werden lassen.
Kein realistisch denkender Ökonom wagt deshalb heute noch mit Sicherheit vorauszusagen, welche Länder und Wirtschaftsbranchen auf Dauer erfolgreich sein werden und welche nicht, und welche Unternehmen auf lange Sicht überleben werden und welche nicht. Kein kritisch-selbstkritisch reflektierender Ökonom wagt auch nur, längerfristige Prognosen bezüglich des Dollars, bisher die Weltleitwährung, zu machen – oder bezüglich Euro, Yen oder Yuan. Alle Welt rechnete immer wieder mit steigenden Kursen. Ein dramatischer Verlust an Volksvermögen, gefährlich für das Bankensystem und für die Wirtschaft insgesamt, war aber bei unerwartet fallenden Kursen nie auszuschließen. Doch nur wenige Ökonomen warnten, dass der Yen oder das Pfund, der Dow Jones oder der Dax überhöht seien: Börsenanalytiker lieferten vielmehr ständig Gründe (oft gegen besseres Wissen), warum Dow und Dax noch weiter steigen könnten.
Einzelergebnisse im Zug der Globalisierung lassen sich natürlich berechnen, und trotzdem ist die Gesamtentwicklung nicht prognostizierbar. »Wenn schon bei einem vergleichsweise kleinen Ausschnitt wie den Sozialabgaben trotz einschränkender Annahmen viele, fast gleich wahrscheinliche Entwicklungen möglich sind«, ließ mich damals einer der kenntnisreichsten und erfahrensten Wirtschaftswissenschaftler Deutschlands, Professor Norbert Kloten (Tübingen), wissen, »so muss offenbar die Menge denkbarer Entwicklungen in einer Volkswirtschaft oder gar Weltwirtschaft kaum mehr übersehbar und schon gar nicht prognostizierbar sein.«3
Was sollte man also von Voraussagen halten, die aufgrund der Globalisierung stolz einen ökonomischen Boom für die nächsten dreißig Jahre verkündeten? Durfte man jenen Optimisten glauben, die am Horizont schon internationale ökonomische Superhighways sahen, welche die nationalen Ökonomien in noch nie dagewesener Weise in die globale Ökonomie integrieren würden? Musste man nicht eher den Pessimisten trauen, die neben der Möglichkeit einer atomaren Verseuchung großer Gebiete oder anderer Ökokatastrophen auch einen neuen Crash (»Schwarzer Freitag«) im Weltfinanzsystem befürchteten und daran zweifelten, dass dieser Globalisierungsprozess schließlich das Geschick der Menschheit wesentlich verbessern würde, wo doch offenkundig schon jetzt so viel Arbeitslosigkeit und persönliches wie familiäres Unglück damit verbunden seien? Ja, wer verfügte denn je über die Gewissheit, dass in den Industrieländern die Trends zum freien Handel, zur Reduktion des Staatsdefizits, zur Harmonie zwischen den früheren Feinden im Kalten Krieg und zur Zusammenarbeit mit den heraufkommenden asiatischen Mächten – lauter Voraussetzungen für einen gemäßigten Optimismus – anhalten würden? Trotzdem schien mir wichtig:
4.Die Globalisierung ist steuerbar
Angesichts der unbestreitbaren fundamentalen Unsicherheiten hätte man gut daran getan, den ganzen Prozess der Globalisierung nicht zu sehr sich selbst zu überlassen. Die Globalisierung ist ja kein Naturphänomen wie eine heraufziehende Gewitterfront, der man machtlos gegenübersteht.
Internationale Regulierungen dringend notwendig
Da ja selbst der mittelalterliche Glaube an die »unsichtbare Hand der göttlichen Vorsehung« menschliches Versagen nie ausschloss, hätte man dem unter Ökonomen weitverbreiteten modernen Glaubensdogma von der »unsichtbaren Hand des Wettbewerbs«, das Weltwirtschaftskrisen nicht auszuschließen vermochte, mit mehr Skepsis begegnen müssen. Selbstkritische Ökonomen konnten es ja nicht ausschließen: Der Markt kann als Steuerungsinstrument versagen, daher sind überall die Politik und ihre Ordnungsfunktion gefordert.
Nationale Regierungen, Zentralbanken und Wirtschaftsgemeinschaften wie die EU hatten zweifellos immer erhebliche Spielräume. Und wenn selbst der bekannteste Hedgefonds-Manager und spätere Philanthrop George Soros4, der 1992 das britische Pfund zur Abwertung gezwungen hatte, schon vor Jahren von den Regierungen dringend internationale Regulierungen besonders der Finanzmärkte »gegen übermäßige Spekulation« forderte, die täglich Hunderte Milliarden Dollar hin- und herbewegt, so hätten gerade Ökonomen rechtzeitig mehr praktische Vorschläge machen sollen bezüglich der Steuerung und Besteuerung der »von Gier und Angst besessenen« und deshalb gar nicht rational, sondern »emotional« reagierenden Märkte. In einem Gespräch beim Weltwirtschaftsforum in Davos bestätigte mir George Soros: »Wenn ein Mann wie ich das britische Pfund erschüttern kann, dann stimmt doch etwas am ›System‹ nicht.« Darauf ich: »Da müsste also etwas am System geändert werden, aber wann?« Soros: »Möglichst bald. Aber zumeist lernt die Menschheit nur durch Leiden.« Es sollte noch ein paar Jahre dauern, bis die globale Finanz- und Wirtschaftskrise ausbrach und die Leiden vieler Menschen übergroß wurden, durch das, was George Soros dann das Platzen einer »Super-Blase« nennen sollte.
Man musste also schon sehr früh fürchten, dass das globalisierte Weltfinanzsystem nach einer Phase, in der die Kurse von Rekordhoch zu Rekordhoch strebten, einmal aufgrund einer Kettenreaktion wegen einer Naturkatastrophe, eines politischen Erdbebens oder eben einer Bankenkrise zusammenbrechen könnte … Und so meinte ich schon in den 1990er-Jahren mahnen zu müssen: Sollte sich beim gegenwärtigen Globalisierungsprozess das Gewinnstreben als oberstes und alleiniges Kriterium durchsetzen, muss man sich auf schwere soziale Konflikte und Krisen gefasst machen; die gegenwärtige Stärke des Kapitals und relative Schwäche der Gewerkschaften sollten nicht darüber hinwegtäuschen. Es warnun einmalnicht anzunehmen, dass die Gesellschaft als ganze einen Rückfall in den Liberalismus des 19.Jahrhunderts und in einen zügellosen Kapitalismus widerstandslos hinnehmen würde.
Doch ich gehöre selbst in der heutigen Finanz- und Wirtschaftskrise nicht zu jenen Journalisten und Theologen, die eine apokalyptische Redeweise lieben und ständig das kommende Weltende ankündigen. Andererseits merkte ich schon an, dass ich auch die euphemistisch verharmlosende Sprache wenig schätze, wie sie manche Ökonomen und Geschäftsleute lieben. Man weiß doch, was sich oft an menschlichem Elend für die Betroffenen verbirgt hinter so wohlklingenden Worten wie »Outsourcing« (»Auslagerung«) und »Downsizing« (»Verschlankung«). Dieses letztere Wort wurde in den 1970er-Jahren für kleinere Autos und erst seit den 1980er-Jahren auch für Menschen gebraucht: »downsized«, »separated«, »unassigned« people. Doch ob einer 1980 hörte »You are fired« (»Sie sind gefeuert«) oder 1985 »You are laid off« (»freigesetzt«) oder 1990 »You are downsized« (»wegrationalisiert«) oder 1995 »You are rightsized« (»ausgemessen«): für den Betroffenen läuft es letztlich auf dasselbe Elend hinaus! Man kann sich nicht einfach damit abfinden.
Globalisierung auch des Ethos erforderlich
Globalisierung bleibt für viele Menschen, gerade in Entwicklungs- und Schwellenländern, eine große Hoffnung, für viele Arbeitnehmer in Industrieländern aber ist sie immer mehr eine beängstigende Misere. Es wird weiter gelten: Die Wirtschaft der Welt ist im Umbruch, wächst zusammen, vernetzt sich. Weltweit entstehen riesige neue Märkte, Waren- und Arbeitsangebote, Kommunikationsmöglichkeiten, aber eben auch härtere Konkurrenz und steigende Arbeitslosigkeit, gerade in den Industrienationen. Keine Frage: Der epochale Paradigmenwechsel, der sich schon nach dem Ersten Weltkrieg und dem Aufstieg der neuen Wirtschaftsgroßmächte USA und UdSSR auch für die Wirtschaft abzeichnete – weg von der eurozentrischen zur polyzentrischen Weltwirtschaft –, hat nach dem Einbezug Asiens (ASEAN und China) und dem Zusammenbruch des Sowjetblocks mit den Globalisierungsprozessen der 1990er-Jahre den definitiven Durchbruch erzielt.
Was aber wird geschehen, fragen sich viele Menschen, wenn die Weltwirtschaft, nicht nur ihr Kapitalfluss, sondern auch ihr Arbeitsmarkt, noch mehr ohne nationale Grenzen funktioniert, wirklich global sein wird? Wer wird im grenzenlosen Wettbewerb der Unternehmen, der Regionen und Standorte Gewinner sein und wer Verlierer? Wird das nicht eine »ökonomisierte«, vermarktete und so möglicherweise unfreundliche, undemokratische, ja inhumane Welt sein, in der wir durch Globalisierung zwar eine höhere Produktivität und Rentabilität, aber keine gerechtere Güterverteilung erreicht haben?
Spätestens jetzt müsste man bedenken, dass es bei all diesen Phänomenen keineswegs um naturnotwendige Prozesse (wie Marx meinte), sondern um im Prinzip und in gewissen Grenzen steuerbare und international zu regulierende Entwicklungen geht. Aber auch, dass es sich dabei nicht nur um Fragen der Ökonomie handelt, sondern um gesamtgesellschaftliche, um hochpolitische und letztlich auch ethische Fragen. Drehen sich doch auch manche Geschäftsentscheidungen weniger um Globalisierung an sich als um die praktische Frage, ob Profit, also das grundsätzlich berechtigte Gewinnstreben, der einzige Zweck eines Unternehmens sein soll.
Gerade das Phänomen der ökonomischen Globalisierung macht also deutlich, dass es auch im Ethischen um Globalisierung gehen muss. Wie kann eine Welt friedlich und gerecht werden, in der in verschiedenen Gebieten widersprüchliche ethische Normen und Rahmenordnungen gelten? Eine Besinnung auf das notwendige gemeinsame Minimum an elementaren ethischen Werten, Maßstäben und Grundhaltungen tut not, auf das sich alle Nationen und alle Interessengruppen, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, verpflichten können. So wie eine neue Rahmenordnung für die Finanzmärkte (ähnlich wie seinerzeit das Bretton-Woods-Abkommen) global durchgesetzt werden müsste, damit die Teilnehmer bei Einschränkungen nicht einfach in andere Märkte fliehen, so müsste auch ein ethischer Grundkonsens global gelten, damit ein einigermaßen friedliches Zusammenleben auf unserem Globus gewährleistet ist. Dies soll in den folgenden Kapiteln in Diskussion mit der Wirtschaftswissenschaft entwickelt werden. Aus diesem Einleitungskapitel ergibt sich dafür folgende Programmatik:
•Die Globalisierung von Wirtschaft und Technologie verlangt nach globaler Steuerung durch eine globale Politik.
•Globale Wirtschaft, Technologie und Politik aber bedürfen der Fundierung durch ein globales Ethos.
•Weltpolitik und Weltwirtschaft verlangen nach einem Weltethos.
Es sollen nun zunächst zwei einander entgegengesetzte wirtschaftspolitische und sozialphilosophische Konzepte für eine Wirtschaftsordnung einer kritischen Prüfung unterzogen werden: Neokapitalismus und Wohlfahrtsstaat. Über beide gibt es eine seit Jahrzehnten anhaltende wirtschaftswissenschaftliche Diskussion, in die ich hier – um angesichts vielfacher Geschichtsvergessenheit die Hintergründe der heutigen Weltwirtschaftskrise zu verstehen – eintreten muss, ohne mich freilich in Details der komplexen Wirtschaftswissenschaft zu verlieren. Es soll – dies ist mein bescheidenes Ziel – nur deutlich werden, welches wirtschaftspolitische Globalkonzept der hier vorgetragenen ethisch bestimmten Gesamtschau am besten entspricht.
5.Welches wirtschaftspolitische Konzept?
Eine kritische Reflexion ist angesichts der in den letzten beiden Jahrzehnten sich weltweit rasant durchsetzenden Marktwirtschaft besonders dringlich. Hier zuerst eine genaue Bestimmung des Status quaestionis, des gegenwärtigen historisch-systematischen Fragestandes:
Keine Rückkehr zum Manchester-Liberalismus
Ein kurzer historischer Rückblick: Der Altliberalismus (A. Rüstow: »Paläoliberalismus«) des frühen 19.Jahrhunderts hatte als treibende Kraft in Wirtschaft und Gesellschaft den Eigennutz des Einzelnen erkannt und deshalb das freie Spiel der wirtschaftlichen Kräfte – bei möglichst geringen staatlichen Eingriffen – als Grundprinzip propagiert. Besonders im industriell führenden Großbritannien wurde dies realisiert: Für die binnenwirtschaftliche Ordnung das Prinzip (ursprünglich der französischen Physiokraten) »Laissez faire« und gleichzeitig für die außenwirtschaftliche Ordnung das Prinzip des internationalen Freihandels und der freien Schiffahrt: »Laissez passer« (die Waren über die Grenzen lassen).
Doch geriet dieser Wirtschaftsliberalismus schon im 19. Jahrhundert mit der »sozialen Frage« und im frühen 20.Jahrhundert mit dem Ersten Weltkrieg in Misskredit. Ja, mit der ersten Weltwirtschaftskrise (»Große Depression«) Anfang der 1930er-Jahre brach er zusammen. Seither pflegt man sich zu distanzieren vom »Manchester-Liberalismus« – ursprünglich eine Kampfvokabel des konservativen britischen Politikers Benjamin Disraeli gegen seinen handelsliberalen und sozial engagierten Gegner Richard Cobden aus Manchester. Unbestreitbar wies dieser Liberalismus anfänglich ungeheure industrielle Erfolge auf: in Manchester schon 1789 die erste Dampfmaschine für Baumwollspinnerei, dann Industriekanal und Eisenbahnlinie und 1889 erster Industriepark Großbritanniens. Aber der Liberalismus hatte zugleich ein soziales Elend zur Folge, das auch politisch unerträglich wurde: in Manchester bei einem Bevölkerungsanstieg um das 32fache von 17.000 im Jahre 1760 auf 544.000 im Jahre 1901.
Keine Rückkehr zur sozialistischen Planwirtschaft
Als Gegenkonzept war in der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts unter Impulsen besonders des utopischen Sozialismus die sozialistische Planwirtschaft erdacht worden. Aber erst nach der russischen Oktoberrevolution (1917) wurde sie realisiert. Sie hatte anfangs vor allem politische Erfolge: bei den betroffenen Arbeitnehmern, ihren politisch-sozialen Organisationen und den sich mit ihnen solidarisierenden Intellektuellen. Aber die sowjetische Staatswirtschaft erwies sich als immer weniger effizient – ohne Chance, wie beansprucht die kapitalistische Marktwirtschaft zu überholen.
Am Ende des 20.Jahrhunderts erlebte die sozialistische Planwirtschaft mit der Implosion des Sowjetimperiums den schon lange sich abzeichnenden epochalen Zusammenbruch von der Elbe bis zum Gelben Meer. In Theorie und Praxis findet sie sich widerlegt. Weltpolitisch von besonderem Gewicht ist, dass die Volksrepublik China sich dem westlichen marktwirtschaftlichen System geöffnet hat, ohne bis heute zum eigenen Nachteil auch die westliche Demokratie zu übernehmen.
Seither liegen nicht mehr zwei extrem verschiedene sozialphilosophisch-wirtschaftspolitische Konzepte im Widerstreit, Marktwirtschaft oder Planwirtschaft. Es blieb faktisch nur eines übrig: Die Marktwirtschaft hatte gesiegt, und die meisten führenden Ökonomen sind heute »Neoliberale«. Doch die andauernde Diskussion dreht sich um die Frage:
Marktwirtschaft – aber welche?
Hinter dem scheinbar klaren generellen Begriff »neoliberal« verstecken sich heute zwei einander entgegengesetzte wirtschaftspolitische Konzepte5:
–Einerseits eine prädikatlose Marktwirtschaft oder Marktwirtschaft pur (»ohne Wenn und Aber«): Sie wurde theoretisch von den Wirtschaftswissenschaftlern Ludwig von Mises, Friedrich August von Hayek und Milton Friedman entwickelt, die man präziser (für einen Neokapitalismus eintretende) Ultraliberale nennen kann. Praktisch wurde sie von Wirtschaftspolitikern der »Reaganomics« und des »Thatcherismus« zu realisieren versucht.
–Andererseits eine sozialverpflichtete Marktwirtschaft oder Soziale Marktwirtschaft: Sie wurde theoretisch von den Wirtschaftswissenschaftlern Eucken, Müller-Armack, Rüstow, Röpke und dem Juristen Böhm entwickelt, die man, ebenfalls verkürzend, (für eine staatliche Rahmenordnung eintretende) Ordoliberale nennen kann. Praktisch wurde sie schon nach dem Zweiten Weltkrieg in exemplarischer Weise in der Bundesrepublik Deutschland von Ludwig Erhard realisiert.
Nach den verheerenden Erfahrungen der gegenwärtigen Weltfinanz- und Wirtschaftskrise dürfte es schwer sein, Menschen heute von der »Marktwirtschaft pur« zu überzeugen. Reaganomics und Thatcherismus haben rascher abgewirtschaftet als erwartet. Auch alle Bemühungen in den USA, von der Gesundheitsreform bis zu den Veränderungen an der Wallstreet, konzentrieren sich zur Zeit darauf, eine sozial verpflichtende Marktwirtschaft zu etablieren.
Aufschlussreich sind in diesem Zusammenhang zwei im Jahr 2009 erschienene Bücher von »Frühstartern« in der Beurteilung der gegenwärtigen Weltwirtschaftskrise, die in vielem übereinstimmen, aber doch eine unterschiedliche Frontstellung verraten:
Da ist einerseits der frühere linksliberale ZEIT-Chefredakteur Roger de Weck, der in seinem ebenso kompakten wie differenzierten Buch »Nach der Krise«6 für einen erneuerten Kapitalismus plädiert, dabei aber das Modell der Sozialen Marktwirtschaft völlig unerwähnt lässt. Erst im letzten Satz seines Buches nennt er unvermittelt als sein Ideal »die öko-soziale Marktwirtschaft«. Die ethische Problematik aber blitzt bei ihm nur am Rande auf. Den »vom Theologen Hans Küng vertretenen Gedanken eines solidarischen Weltethos«, den angeblich »die Globalisierung« hervorgebracht haben soll, erwähnt er, diskutiert ihn aber mit keinem Wort.
Und da ist auf der anderen Seite der rechtsliberale frühere IBM-Manager und langjährige Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Hans-Olaf Henkel, der in seinem interessant berichtenden Buch »Die Abwracker« erzählt, »wie Zocker und Politiker unsere Zukunft verspielen«7. Er greift auf das Modell der Sozialen Marktwirtschaft zurück für die Überwindung dessen, was er den »Neo-Sozialismus« nennt. Die ethische Problematik freilich wird von Henkel oberflächlich abgehandelt. Viele seiner Reformvorschläge für Nachhaltigkeit in der Arbeitsmarkt-, Sozial- und Finanzpolitik sind vernünftig, aber weniger vernünftig, eher ressentiment- und emotionsgeladen sind manche seiner Aussagen zur »Moral«. Immerhin erkennt er inzwischen deutlicher als in seinem früheren Buch »Die Ethik des Erfolgs« die negativen Seiten der Globalisierung und scheint von der naiven Überzeugung abgerückt, dass die Globalisierung »das einzige Mittel« sei, »das der Gerechtigkeit, der Fairness und der Mitmenschlichkeit zum Durchbruch verhelfen kann« und schon »längst tut, was Küng nur fordert«.8 Einen »moralischen Generalverdacht gegen die Globalisierung« hätte er mir in jenem früheren Buch wirklich nicht unterstellen und auch das Weltethos nicht mit »von der Kanzel herab verkündeten Moralweisheiten« verwechseln dürfen. Vielleicht hat ja die Wirtschaftskrise Henkel eines Besseren belehrt.
Beide hier kurz vorgestellten Bücher bestätigen mich in meiner Auffassung, dass es notwendig ist für einen gesicherten Weg in eine bessere Zukunft, auf die beiden großen Konzepte von Marktwirtschaft zurückzukommen und sie in den folgenden Kapiteln exakt zu analysieren und eingehend zu diskutieren: Marktwirtschaft pur oder Marktwirtschaft sozial?
II.Marktwirtschaft pur?
Bevor wir uns der Sozialen Marktwirtschaft zuwenden, gehören der so lange erfolgreiche Ultraliberalismus und seine heutigen Hauptrepräsentanten auf den Prüfstand1: Wie ist er aus ethischer Sicht zu bewerten?
1.Der ökonomische Ultraliberalismus
Der ökonomische Liberalismus, würden manche seiner Vertreter antworten, sei aus sich selbst moralisch. Doch an dieser Behauptung kommen ernsthafte Zweifel auf. Gewisse Parallelen zwischen dem politischen »Realismus« und seinem Machtmanagement, über dessen verhängnisvolle Auswirkungen ich an anderer Stelle geschrieben habe2, und dem ökonomischen Liberalismus und seinem Marktmanagement drängen sich auf. Ist dies reiner Zufall? An derselben University of Chicago, an welcher der Politikwissenschaftler Hans Morgenthau den Begriff des Interesses des souveränen Staates in den Mittelpunkt seiner Macht-Theorie gestellt hatte, entwickelte zur selben Zeit der Wirtschaftswissenschaftler Milton Friedman seine ebenso »realistische« Markt-Theorie, die das Interesse des freien Individuums zur Grundlage aller binnen- und außenwirtschaftlichen Ordnung macht. Ähnlich also
–betreibt diese »realistische« Politikwissenschaft die Analyse der Mechanismen der Machtpolitik: die Konkurrenz und (als Ideal) das Gleichgewicht der politischen Kräfte, und
–betreibt diese »realistische« Wirtschaftswissenschaft die Analyse der Marktmechanismen: die Konkurrenz und (als Ideal) der freie Wettbewerb der wirtschaftlichen Kräfte. Wie bei Morgenthaus Politiktheorie liegen jedoch auch die Ursprünge der ultraliberalen Wirtschaftstheorie in Europa, wieder vor allem im deutschen Sprachraum.
Vorkämpfer des Ultraliberalismus: L.v.Mises, F.A.v.Hayek
Der klassische ökonomische Liberalismus hatte in den 1920er-Jahren in seinem Stammland Großbritannien alle Ausstrahlungskraft verloren. Er wurde schließlich innerhalb weniger Jahre in einer Art Paradigmenwechsel fast vollständig durch die »Keynessche Revolution« abgelöst. Auf dem europäischen Kontinent erfolgten dagegen radikale Weiterentwicklungen liberaler Wirtschaftstheorien vor allem in der von Carl Menger (1840–1921) gegründeten »Österreichischen Schule«: dort in erster Linie durch den in Lemberg geborenen österreichischen Volkswirtschaftler Ludwig von Mises (1881–1973). Nach zwanzigjähriger Lehrtätigkeit in Wien emigrierte er 1938 – im Jahr des »Anschlusses« Österreichs an Nazi-Deutschland – zunächst nach Genf und 1940 nach New York. Als Vertreter der »Austrian Economics« (Grenznutzenschule) unterzog er jede Planwirtschaft und allen staatlichen Interventionismus einer radikalen wissenschaftlichen Kritik.3
Aber noch mehr Einfluss übte sein Schüler Friedrich August von Hayek (1899–1992) aus. In Wien geboren und promoviert, übersiedelte er 1931 nach London, lehrte an der University of London und der London School of Economics und wurde im österreichischen Schicksalsjahr 1938 britischer Staatsbürger. Von 1950 bis 1962 war auch er an der University of Chicago als Professor für Sozial- und Moralwissenschaft tätig. Erst nach seiner Emeritierung nahm er, jetzt hoch geschätzt, einen Lehrstuhl in Freiburg/Breisgau an, wo er 1992 im Alter von 93 Jahren verstarb.
Hayek hatte schon 1944 in seinem antietatistischen Werk »Der Weg zur Knechtschaft«4 (ironisch »den Sozialisten in allen Parteien gewidmet«) die Stückwerkreformen und staatlichen Wirtschaftsmanipulationen in der Weimarer Republik dargestellt als Weg zur Wirtschaftsdepression (1929–33), zum innenpolitischen Desaster und zur totalitären Machtübernahme durch Hitler. Er war und blieb davon überzeugt, dass jegliche staatliche Lenkung und Kontrolle des freien Marktes ökonomisch nur negative Folgen zeitigen könne: Inflation, Arbeitslosigkeit, Rezession oder gar Depression. Er hatte nichts dagegen, dass wie die Preise so auch die Löhne je nach Nachfrage steigen oder sinken – für jede Gewerkschaft eine grauenhafte Vorstellung.
Man erkennt: Hayek war in seinem ganzen Ansatz zutiefst individualistisch, an der sittlichen Autonomie und folglich an einer »atomistischen« Gesellschaftsauffassung orientiert. Seine Allergie gegen das Wort »sozial«, in dem er das Einfallstor antiliberaler Ideen sah, schlug in offene Ablehnung um, als seine Freunde in Deutschland den Begriff der Marktwirtschaft mit dem Attribut »sozial« versahen. Kein Wunder, dass Friedrich von Hayek in England zum heftigsten Kritiker des damals einflussreichsten Wirtschaftsheoretikers und Vertreters des Wohlfahrtsstaates wurde:
Vorkämpfer des Sozialstaates: John Maynard Keynes
Der Cambridge-Professor John Maynard Keynes(1883–1946) war schon 1919 Leiter der Delegation des britischen Schatzamtes auf der Friedenskonferenz von Versailles. Klar und gerecht denkend, trat er wegen der volkswirtschaftlich unsinnigen alliierten Reparationsforderungen zurück und forderte 1920 mutig eine Revision des Versailler Vertrags.5 Später wurde er wieder Berater der britischen Regierung und wenige Jahre vor seinem Tod zum Lord ernannt (1942). Den Kapitalismus definierte er ironisch als den außergewöhnlichen Glauben, dass die widerwärtigsten Männer aufgrund der widerwärtigsten Motive irgendwie für den Nutzen aller arbeiten.
Doch der entscheidende Punkt: Schon drei Jahre vor der Weltwirtschaftskrise hatte er »The End of laissez-faire« (1926) proklamiert.6 Damit hatte Keynes das Zentraldogma der klassisch-liberalen Nationalökonomie in Frage gestellt: bei freier Konkurrenz führe ein sich einspielendes Preis-, Lohn- und Zinsniveau automatisch zur Vollbeschäftigung. Keynes’ makroökonomischer Theorie vom Wirtschaftskreislauf zufolge verläuft die Konjunktur in Zyklen. Diese aber sind durch Variation der Staatsausgaben und Steuersätze geplant zu lenken. Bei abflauender Konjunktur seien Wachstum und Beschäftigung durch erhöhte Ausgaben (»deficit spending«) und Billig-Geld-Politik zu sichern. In dieser »rationalen Wirtschaftspolitik« spielt der Staat neben privaten Haushalten und Unternehmen offensichtlich eine zentrale Rolle.7
Diese wirtschaftspolitische Legitimation der Staatsverschuldung hatte gewaltige Auswirkungen weit über Großbritannien hinaus. Keynes wurde der dominierende Ökonom des 20.Jahrhunderts. Erst mit der Zeit erfuhr man in der wirtschaftspolitischen Praxis die Schwachpunkte der Keynesschen Theorie. Und der »Keynesianismus« geriet in die Krise, als zweierlei offenkundig wurde: Erstens, wie gering die Bereitschaft der Politiker war, bei Konjunkturaufschwung – wie Keynes’ Theorie verlangte – die Staatsausgaben auch wieder zu kürzen und Schulden abzutragen. Und zweitens, wie groß andererseits das Informationsdefizit der Politik war, um eine wirksame Feinsteuerung des Wirtschaftsablaufes zu garantieren.
Den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften, den es zu Lebzeiten von Keynes noch nicht gab und den das Nobelpreiskomitee offensichtlich keinem Vertreter der erfolgreichsten Nachkriegs-Ökonomik, der Sozialen Marktwirtschaft, geben wollte (ich werde noch an Röpke, Rüstow, Müller-Armack erinnern), erhielten zwei bedeutende Keynesianer: der Amerikaner Paul Samuelson 1970 und der Brite John Hicks 1972. Ausgezeichnet aber wurde 1974 F.A. von Hayek; denn unterdessen hatten die Zeiten sich wieder einmal geändert: In den 1970er-Jahren trat nämlich aufgrund überhitzter Konjunktur immer mehr das Inflationsproblem in den Vordergrund, und damit wurden auch die Grenzen der staatlichen Defizitfinanzierung und Zinsbelastung sichtbar. Gegen diese ökonomischen Übel aber schienen Hayek und die Neoliberalen die besseren Rezepte zu haben. Mehrere Monographien wurden gerade in den 1990er-Jahren dem bedeutenden Œuvre Hayeks gewidmet.
Der Inspirator von Reagonomics und Thatcherismus: Milton Friedman
Ende der Leseprobe