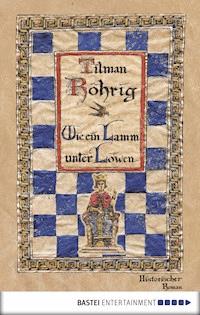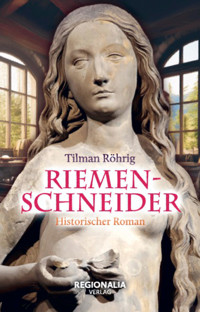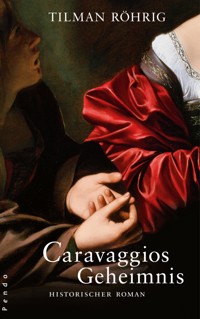9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In seiner ebenso fundierten wie fesselnden Romanbiographie »Und morgen eine neue Welt« fächert Bestsellerautor Tilman Röhrig (u.a. »Riemenschneider«, »Die Könige von Köln«, »Der Sonnenfürst« und »Caravaggios Geheimnis«) die entscheidenden Jahre im Leben Friedrich Engels auf, dessen Geburtstag sich im Jahr 2020 zum 200. Mal jährt. Zeitlebens ist Friedrich Engels ein Mann voller Widersprüche. Er ist Gelehrter und Revolutionär, Frauenheld und Fabrikant. Erfolgreich führt er die Fabrik seines Vaters in England und ist dennoch einer der großen Vordenker des Kommunismus. Für Karl Marx war er nicht nur enger Freund und Impulsgeber für dessen Werk, sondern auch unverzichtbarer Mäzen. Durch die Irin Mary Burns lernt Friedrich Engels das elende Leben der Arbeiter kennen – und findet in ihr die Liebe seines Lebens. »Geschickt vermischt Tilman Röhrig auf anschauliche und ungemein lebenspralle Art Dichtung und Wahrheit.« Aachener Zeitung (über »Die Könige von Köln«) »Abermals ein strahlend-unterhaltsamer Historienroman. Die Mischung aus historisch fundiertem Hintergrund und kurzweiliger Phantasie macht den Roman zu einer niveauvollen Lektüre. Und dass Tilman Röhrig zudem ein Meister des geschliffenen Wortes und der präzisen Formulierung ist, steigert das Lesevergnügen zudem sehr nachhaltig.« Westfalenpost (über »Der Sonnenfürst«)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 635
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.pendo.de
© Pendo Verlag in der Piper Verlag GmbH, München 2019Die Veröffentlichung dieses Werkes erfolgt auf Vermittlung der Autoren- und Verlagsagentur Peter Molden, KölnRedaktion: Dr. Rainer BrandCovergestaltung: zero- u1 berlin / Patrizia Di StefanoCovermotiv: xavierarnau / Getty Images und Lee Avison / Arcangel
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Berlin Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Cover & Impressum
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
1. Kapitel
Brüssel, Rue de l’Alliance 5Ende April 1845
Die Haustüre war nur angelehnt? Helene zögerte, betätigte den Klopfer erneut. Mit leisem Scharren schwang die Tür weiter nach innen. Sie blickte über die Schulter zu den beiden Herren auf der andern Straßenseite, wollte nachfragen. Gleich wandten die sich ab, verbargen ihre Gesichter in den hochgestellten Mantelkragen und schlenderten die schmale Rue de l’Alliance hinunter. Seltsam, dachte Helene, als ich mich vorhin nach dem Haus der Familie Marx erkundigte, sahen sie mich nicht an, sondern deuteten nur mit dem Daumen hier auf die Nummer 5.
Und diese Nummer hatte sie auch auf dem Zettel stehen, dazu stimmte die Straße, also musste sie an der richtigen Adresse sein. Aber nichts rührt sich im Haus. Vielleicht sind die Herrschaften kurz weggegangen?
Ich könnte auch drinnen warten. Helene fasste die Henkel ihrer Reisetasche fester, trat ein und lehnte die Haustüre hinter sich nur an. Säuerlich schaler Geruch stand im halbdunklen Flur. Ihr Fuß stieß an etwas Weiches. Sie beugte sich vor. Ein Mantel? Ohne Zögern setzte Helene die Tasche ab, hob das Kleidungsstück vom Boden, schlug es aus und hängte es zu den übrigen Jacken an die Garderobe. Weiter vorn entdeckte sie einen Zylinder, daneben eine Stoffpuppe, beides nahm sie auf, säuberte den Hut flüchtig mit dem Ärmel und stülpte ihn über den Haken. Die Puppe behielt sie in der Hand, zupfte an den verknoteten Haaren aus Wollfäden. Was ist hier geschehen?
Langsam ging Helene weiter. Nahe der Treppe ins erste Stockwerk stand rechts eine Tür halb offen. Vorsichtig spähte sie in den Raum. Kalter Tabakqualm verschlimmerte den Gestank. War das die Wohnstube? Stühle und Sessel kreuz und quer, auf dem großen ovalen Tisch lagen Brot- und Käsereste zwischen Gläsern und umgelegten Flaschen. In den übervollen Aschenbechern steckten Zigarrenstümpfe. Kerzen waren niedergebrannt, die Wachsstraßen zerlaufen und eingetrocknet. Ein Gelage, Helene rümpfte die Nase, deshalb stinkt es hier so.
In der hinteren Ecke entdeckte sie den Laufstall, sah den lockigen Kopf, das Mädchen kaute an einem weißlichen Holzstück. Da ist Klein Jenny. Aber wieso allein? Sie trat ins Zimmer und ging in Richtung der vergitterten Spielecke. »Na, meine Süße. Hab keine Angst vor mir!«
Unvermittelt wurde ihre Hand gepackt. »Halt!« Aus dem Sessel neben Helene wuchs ein Kopf, wirres dunkelblondes Haar, die hellen Augen stierten sie glasig an. »Angst kenn ich nicht.« Die schwere Zunge hatte Mühe, die Worte zu formen. »Aber du … du Schöne. Wie kommst du hierher? Du weißt, unsere Baronesse will das nicht.« Der rötliche Randbart vom linken Ohr entlang des Kinns bis hin zum rechten Ohr verstärkte das Grinsen. »Meine Schöne.«
Helene spürte seine Finger unter ihrem Rock, zielstrebig strich die Hand den Schenkel hinauf, ehe sie es fasste, wurde ihr Po mit kräftigem Zugreifen betastet. »Was für ein Hintern.«
»Herr!« Helene gab ihm eine schallende Ohrfeige. »Unterstehen Sie sich!«
Darüber lachte er, griff noch fester zu. »Was für stramme Backen!«
»Wagen Sie es nicht …« Nun hieb sie ihm rechts und links ins Gesicht. »Was erlauben Sie sich.« Die Stimme wurde lauter. »Unverschämt, ich werde Frau Jenny …«
»Still.« Er zog die Hand zurück, raffte sich halb aus dem Sessel. »Nur still. Wecke die Baronesse nicht auf.« Er nestelte vom offenen Hemdkragen die Knopfleiste hinunter bis zur Weste und klaubte ein Geldstück aus der Tasche. »Hier. Besser, du verschwindest. Warte nebenan …« Die Münze entglitt den Fingern, und er sank zurück. Erneut überkam ihn der Rausch. »Du weißt, ich wohne im Nachbarhaus. Da … da wartest du.« Er schlief. Mit zitternden Lippen richtete Helene ihr Kleid. Dieser versoffene Schnösel. Behandelt mich wie eine Hure. So etwas ist mir …
Lautes Kreischen. Das Mädchen im Laufställchen brüllte. Es hatte seine Beißwurzel verloren. Beide Ärmchen streckte es zwischen den Holzstäben hinaus, zu kurz, die Köstlichkeit lag zu weit weg.
»Ich helfe dir.« Helene hob das schreiende Kind auf, schaukelte es, zeigte die Puppe, das Unglück aber war zu groß. Erst die klebrige Kauwurzel konnte das Mädchen beruhigen. Helene spürte, wie ihr Ärmel feucht wurde, und roch an der Windel. »Jesses, du bist ja noch gar nicht versorgt. Das wird höchste Zeit. Erst aber suchen wir nach deinen Eltern.« Mit der Kleinen auf dem Arm verließ sie, ohne den Kerl im Sessel noch eines Blickes zu würdigen, das Wohnzimmer. »Wir werden oben nachschauen.«
Aus dem Toilettenverschlag auf dem ersten Treppenabsatz roch es bedenklich. Helene schüttelte den Kopf. Da muss mit Soda geputzt werden.
»Wer ist denn da?«, rief eine Stimme von oben.
»Ich bin es. Helene … Helene Demuth.«
Das Atemholen war deutlich zu hören. »Lenchen?« Oben erschien eine Frau, dunkle Augen in einem schmalen Gesicht, die offenen Haare wellten sich über den Kragen des Nachthemdes, reichten bis zum Busen. »Aber Lene! Heute schon? Ich dachte, erst morgen …«
»Aber Frau Jenny? Die Baronin, Ihre Mutter, hat Ihnen doch geschrieben.«
»Ist gleich. Dann habe ich den Tag verwechselt.« Jenny Marx kam barfuß die Stufen hinunter, ihr Lächeln leuchtete. »Ich freue mich. Und sei herzlich willkommen. Ach, Liebchen, wie schön. Und Klein Jenny hast du auch schon entdeckt.«
»Unten in der Stube. Da saß das Kind allein.«
»Weil Püppchen quengelte, habe ich es heute früh rasch runtergebracht. Sonst hätte sie mir meinen Mohr noch geweckt. Ich habe mich noch mal hingelegt und muss wohl wieder eingenickt sein.« Frau Marx gähnte. »Ich bin zwar gestern vor allen anderen ins Bett, aber es war für mich doch schon sehr spät. Ich weiß gar nicht, wann die Männer gegangen sind.«
»Einer von denen liegt noch unten im Sessel.« Die Falte auf Helenes Stirn verschärfte sich. »Und die anderen haben vergessen, die Haustür zu schließen.« Sie stopfte die Puppe in ihre Manteltasche, behutsam strich sie dem Kind über die Locken. »Und Klein Jenny. Niemand hat sich um dich gekümmert.«
Frau Marx hob den Finger. »Sei nicht so streng mit mir. Weißt du eigentlich, dass ich wieder schwanger bin?«
Großer Gott, dachte Helene, das eine Kind übersteigt doch schon die Kräfte, sagte aber: »Welch ein Glück. Da hat mich Frau Baronin gerade zur rechten Zeit geschickt.«
»Ein größeres Geschenk hätte mir Mutter im Augenblick nicht machen können.«
Nachdem Doktor Karl Marx über Nacht Paris wegen angeblicher politischer Hetze gegen das mit Frankreich befreundete Preußen verlassen musste und die junge Familie versuchte, in Brüssel Fuß zu fassen, hatte Baronin Caroline von Westphalen dem jungen Paar ihre Dienstmagd Helene Demuth zur Unterstützung für den Haushalt überlassen. Mit ihren vierundzwanzig Jahren war Helene sechs Jahre jünger als Baronesse Jenny. Ihre Tatkraft, ihre Umsicht sollten dazu beitragen, in dem, wie die alte Dame sich ausdrückte, unsoliden Lebenswandel der Familie Marx etwas mehr Ordnung und Beständigkeit zu schaffen.
Helene tastete sich vor. »So fertig eingerichtet scheint mir das Wohnzimmer noch nicht?« Ein verständnisvolles Lächeln. »Aber Sie sind ja auch gerade erst eingezogen.«
Da ballte Frau Marx die Faust und drohte in Richtung Südwesten. »Diese Franzosen. Halsabschneider!« Nach der überstürzten Ausweisung ihres Mannes Anfang Februar 1845 war sie noch in Paris geblieben, hatte versucht, die Möbel und einen Teil der Wäsche zu verkaufen, um das Geld für die Reise nach Brüssel zu beschaffen. Außerdem sollte noch genug für eine neue Einrichtung übrig bleiben. »Nicht einmal für die Postkutsche hat es ganz gereicht. Bei Freunden musste ich mir den fehlenden Betrag erbetteln.« Sie deutete nach unten. »Was da im Wohnzimmer steht, haben uns die anderen deutschen Flüchtlinge aus unserer Straße geliehen.«
Wenn alle so sind wie der Kerl da vorhin, dann sind wir ja von feinen Leuten umgeben. Helene bezwang den Zorn. »Also schnarcht der Gast da unten in seinem eigenen Sessel?«
Jenny lachte hell auf. »Du meinst Fritz? Er und mein Mohr trinken am schnellsten, vertragen am wenigsten und wissen nie, wann sie genug haben.« Sie ging schon die Treppe hinab. »Komm, ich stell dich vor!«
»Nein danke. Nicht nötig.« Helene eilte ihr nach. »Erst das Kind. So wartet doch. Wo kann ich es wickeln?« Die Hausherrin war nicht aufzuhalten, schon halb im Wohnzimmer deutete sie kurz auf die Tür am Ende des Flurs. »Da vorn ist die Küche. Da findest du alles.«
Helene hatte eine Decke über den Tisch gebreitet. Vergnügt strampelte Klein Jenny mit den nackten Beinchen, als ihr der Po abgewischt wurde. Die Baronesse brachte den Gast in die Küche. »Dies hier, lieber Fritz, ist die tüchtigste Helferin im Haushalt meiner Mutter. Ach, was sage ich, es gibt, nein, es gab keine bessere in ganz Trier. Denn ab sofort wird sie der gute Geist in unsrem Hause sein.«
Langsam drehte sich Helene mit der durchnässten und verschmierten Windel zwischen den Fingern um. Betont respektvoll fuhr Frau Jenny mit der Vorstellung fort: »Und dies hier ist unser Freund und Nachbar Friedrich Engels.«
In dem bartumrandeten verkaterten Gesicht arbeitete es, die Erinnerung weitete die graublauen Augen. »Sehr … ich bin sehr erfreut.« Engels streckte die Hand zum Gruß.
Nur einen Schritt kam Helene näher, ehe er begriff, drückte sie ihm die schmutzige Windel in die Hand. »Gott zum Gruß.« Gleich tat sie erschrocken. »Oh, verzeihen Sie! Das Kind … ich war in Gedanken. Bitte stecken Sie die Schweinerei da zu den anderen in den Windeleimer.«
Ohne ein empörtes Wort, ohne die Miene zu verziehen, gehorchte Engels. Nachdem er sich die Finger gewaschen hatte, verneigte er sich sogar leicht. »Ich bin sicher, die Familie Marx ist bei dir in besten Händen.«
Ihr Blick sagte ihm, dass die Partie ausgeglichen war und keine Beschwerde nach sich ziehen würde. »Ich wünsche dir einen guten Start hier bei uns in Brüssel.«
Frau Jenny führte den Gast hinaus, und Helene lächelte, während sie dem Kind die frischen Windeln anlegte.
2. Kapitel
Brüssel, Ministerium des Inneren, Rue de la Loi 4Mai 1845
Ein Platzregen ging über Brüssel nieder. Vor der Nebenpforte des Ministeriums des Inneren drängte sich die Schlange der Wartenden enger ans Mauerwerk. Der Dachvorsprung hoch oben bot nur wenig Schutz, dennoch verließ keiner seinen Platz. Seit dem frühen Morgen harrten die Menschen aus, und quälend langsam schob sich die Schlange, beaufsichtigt von zwei bewaffneten Posten, ins weiße Gebäude hinein. Jeder Reisende musste sich hier im Büro für Passangelegenheiten sein Dokument ausstellen lassen, und bereits um drei Uhr nachmittags schloss sich die Pforte.
Etwas weiter oben standen auf der anderen Straßenseite die beiden Männer im Halbdunkel der offenen Säulenvorhalle des Parktheaters. Von hier aus überprüften sie durch ihre handlichen Stecher Gesicht nach Gesicht. »Einer auffällig?«, fragte der Kleinere.
»Unbekannt.« Der Hagere sog den Speichel durch die Zahnlücke. »Keiner von unsren Verdächtigen dabei.«
So unvermittelt, wie er begonnen hatte, brach der Regen ab. Das Pflaster glänzte in der Sonne. Beide Herren verließen ihre Deckung, den Zylinder tief in der Stirn, den Mantelkragen hochgestellt, querten sie in langen Schritten die Straße. Ohne auf den empörten Protest zu achten, gingen sie an der Schlange vorbei direkt zum Eingang. Sofort fassten die Wächter die Gewehre mit beiden Händen.
Ein kurzes Geflüster entspann sich, erst nachdem die Herren eine metallene Marke vorgewiesen hatten, durften sie passieren.
Im Passbüro wollte der Beamte auffahren, auch ihn beschwichtigte die verstohlen vorgezeigte Plakette mit dem preußischen Adler. »Zweiter Stock«, raunte er hinter vorgehaltener Hand. »Linker Flur, letztes Zimmer.«
Vor der gesuchten Tür nahmen beide Männer den Zylinder ab, beide räusperten sich, noch ein gegenseitiges Nicken, und der Hagere pochte viermal kurz hintereinander.
Er wartete zwei Atemzüge, dann wiederholte er das Klopfzeichen. Stille. Endlich wurde von drinnen aufgeschlossen.
»Du zuerst. Und vergiss nicht zu fragen!« Der Kleinere öffnete dem Kollegen, ließ ihn eintreten und drückte die Tür hinter sich zu.
Ein ausladender Schreibtisch beherrschte den Raum, auf der mit grünem Leder bespannten Platte lagen sorgfältig gereihte Papierstapel, daneben stand das Tintenfass, die weiße Schreibfeder war an der Seite zurechtgestutzt. Und aufgerichtet hinter dem Ordnungstisch saß der Vorgesetzte, die Haare mittig gescheitelt, geölt und eng an die Schädelseiten gekämmt.
Der Hagere nahm Haltung an. »Offizier Han…«
»Untersteh dich, Kerl! Keine privaten Namen. Du und dein Kollege, ihr seid hier als geheime Agenten für unser geliebtes Preußen eingesetzt. Ich habe euch Decknamen zugeteilt.« Die Faust schlug auf die Platte. »Also: Schulz und Müller melden sich heute und jetzt zum Rapport! Verstanden?« Ein bedeutungsvoller Blick nach rechts. Dort saß ein Herr, das Gesicht zum Fenster gewandt, er hatte den Zylinder nicht abgenommen, die linke Hand ruhte auf dem Silberknauf seines Stocks.
»Wir haben hohen Besuch aus Berlin.« Der Vorgesetzte schmeckte das Wort vor, ehe er es aussprach: »Diplomatie. Ihr verdanken wir es, dass wir hier im neutralen Belgien ein Büro unterhalten dürfen und die hiesige Polizeibehörde mit uns zusammenarbeitet.«
»Zur Sache!« Der Stock stieß einmal hart auf den Boden. »Meine Zeit ist knapp. Ich verlange Informationen über die kommunistischen Rädelsführer.«
Gleich gab der Vorgesetzte die Rüge nach unten weiter. »Was zögert ihr?«
»Mit wem sollen wir anfangen?« Der hagere Schulz ließ den Zylinderrand Stück für Stück durch die Finger wandern. »Da oben in der Rue de l’Alliance braut sich was zusammen …«
»Mit Marx. Beginnt mit diesem Umstürzler Karl Marx. Aus Paris konnte er verjagt werden. Hier in Brüssel darf er sich nur aufhalten, solange er jede politische Aktivität unterlässt. Und hält er sich daran?«
»Nein, da sind wir ganz sicher. Drei, vier Spelunken haben wir unter Beobachtung. Da verkehren die deutschen Exilanten, und zwar regelmäßig, ebenso unsere Zielpersonen. Im Hinterzimmer trifft sich Marx mit deutschen Handwerkern. Vielleicht sind wir da einer Geheimgesellschaft auf der Spur.«
»Sehr gut. Dranbleiben, dranbleiben!«
Der untersetzte Müller trat einen Schritt vor. »Wie mein Kollege schon erwähnte. In der Rue de l’Alliance hat sich ein Schlangennest gebildet. Der Marx allein wäre noch zu bändigen, aber jetzt ist der aus Köln verjagte Moses Hess dazugezogen, und es kommt schlimmer: Im April hat sich dieser Friedrich Engels aus Barmen dort eingenistet. Haus an Haus wohnen …«
Das harte Aufstoßen des Stocks unterbrach. Ohne das Gesicht zu wenden, verlangte der Besucher aus Berlin: »Engels? Was weiß man über ihn?«
Der Vorgesetzte griff nach einem Papierstapel, nahm ein Blatt und tippte mit dem Finger darauf. »Laut Polizeiakte ist sein Vater ein ehrbarer, zuverlässiger Geschäftsmann aus dem Tal der Wupper. In Barmen und in Engelskirchen hat er große Garnfabriken. Einer seiner Söhne, dieser Friedrich, ist ein verfluchter Kommunist, der sich als Literat herumtreibt. Geboren 1820, also heute im fünfundzwanzigsten Jahr. Statur: groß, schlank und kräftig. Er ist uns bereits in Paris aufgefallen. An der Seite des Karl Marx. Im Übrigen sind beide fast gleichen Alters. Wobei Marx zwei Jahre mehr zählt.«
Agent Müller nickte. »Und jetzt wohnen sie Tür an Tür. Besonders auffällig bei Engels ist zu vermerken: Bei ihm gehen die Weiber ein und aus … Wohlgemerkt, er ist unverheiratet.«
»Freie Liebe?« Der Vorgesetzte fuhr mit der Fingerkuppe die Spur seines Scheitels nach. »Das möchte ich näher erläutert haben. Grundsätzlich gibt es gegen Frauenspersonen nichts einzuwenden, dennoch könnten sie zur Gefahr werden.« Er gab ein kurzes Lachgemecker von sich. »Was man so hört, halten diese Kommunisten nicht viel von der Ehe.«
Das Pochen des Stocks ermahnte ihn, sein Grinsen erstarb. »Informationen?«
Agent Schulz senkte die Stimme. »Uns fiel auf, dass nicht nur Friedrich Engels …« Das Schnalzen durch die Zahnlücke ergänzte den Satz deutlicher als Worte. »Nein, vor gut drei Wochen ist auch bei Karl Marx eine zweite Frau eingezogen.«
»Beschreibung?«
»Nicht sehr groß. Keine Schönheit, eher bieder mit Haarknoten, auch nicht schlank. Unscheinbar eben.«
»Gefährlich. Haltet diese Person im Auge. Gerade von den Unscheinbaren geht Gefahr aus. Und nun wieder an die Arbeit. Hinaus mit euch!«
Die Agenten dienerten, gingen zur Tür. Da stieß Müller dem Kollegen in die Seite. »Du wolltest fragen«, zischte er.
Schulz zögerte, ein zweiter Stoß half nach. Er wandte sich um. »Verzeiht. Es ist nötig. Wir sind viel gelaufen, das Pflaster hier in Brüssel ist nicht gut, außerdem müssen wir bergauf und bergab. Dann der Regen und die Pfützen.«
»Klarheit!« Der Vorgesetzte straffte den Rücken. »Agent Schulz, worum geht es?«
»Um das Sohlengeld.«
Sein Kollege pflichtete ihm bei: »Wir benötigen dringend neue Stiefel.«
»Schon wieder? Ich verlange den Beweis.«
Sie schürzten die Hosenbeine, der eine zeigte den abgenutzten linken, der andere den rechten Stiefel. Halb erhob sich der Vorgesetzte aus dem Stuhl, zwängte das Monokel ans Auge und beäugte die großen Löcher in den Sohlen. »Fatal. In der Tat.« Er ließ sich nieder, nahm zwei Formulare, beschriftete sie mit geübter Hand und schob die Blätter den Agenten hin. »Keine neuen Stiefel. Die gibt es laut Vorschrift nur einmal im Jahr.« Er entnahm der Lade unter dem Schreibtisch zwei Münzen. »Sucht einen günstigen Schuster! Das Geld sollte für neue Sohlen ausreichen.«
»Aber …«
»Keine Diskussion. Unterschreibt, und dann zurück an die Arbeit!«
Gehorsam und mit gesenkten Köpfen verließen die Agenten den Raum.
Die Tür fiel ins Schloss.
»Um Vergebung, Herr Geheimrat.« Die Hände glätteten die geölten Haare an den Schädelseiten nach. »Es sind eben nur einfache Beamte. Gerne hätte ich besseres Personal.«
Der Besucher aus Berlin erhob sich, leicht tippte er die Stockspitze auf den Sims des Fensters. »Gar nicht so übel, mein Freund.« Er wandte sich um. Ein bleiches Gesicht, scharfe kleine Augen hinter den Brillengläsern. »Unsere Zielpersonen werden längst diese beiden Männer und deren Kollegen entdeckt haben. Und dies ist gut so. Die Verdächtigen sollen wissen, dass wir ihnen auf Schritt und Tritt folgen.« Er trat näher zum Tisch. »Mit diesen Spitzeln binden wir ihre Aufmerksamkeit, lenken sie ab. Und inzwischen platzieren wir eine zweite Riege.« Von oberster Stelle im preußischen Innenministerium war geplant, etliche Informanten direkt in die Gruppe der Exilanten einzuschleusen. Sie sollten stichhaltige Beweise für die geheimen umstürzlerischen Pläne sammeln und stets mit Berlin und Wien in Kontakt stehen. »Das braucht Zeit. Aber …« Der Stock pfiff einmal scharf durch die Luft. »Ob nun Gefängnis oder Galgen. Bald schon werden wir diesen Kommunisten den Garaus gemacht haben.«
3. Kapitel
Brüssel, Gasthaus BohèmeMai 1845
»Papperlapapp!« Mit der Hand wischte Karl Marx durch die Luft und hätte beinah den Weinkrug vom Tisch gefegt. »Scharlatanerie!« Nun stieß er den Finger in Richtung Heinzen. »Wer so denkt, sollte das Stroh in seinem Schädel selbst anzünden!«
»Unterstehe dich, so unflätig über mich …«
»Der Mensch macht die Religion. Die Religion macht nicht den Menschen. Merke es dir, hämmere es dir in deinen kleinen Kopf!« Karl lachte, der schwarze struppige Bart wippte dazu, er tauschte mit Friedrich Engels neben sich einen Blick. Weil dessen Miene ernst blieb, lachte er umso lauter bis in einen Husten hinein, Tabakqualm und Hitze im Hinterzimmer des Gasthauses Bohème verstärkten den Anfall. Marx keuchte und spuckte ins Taschentuch. Ruhig schob ihm Friedrich den Weinbecher hin. Erst große Schlucke beruhigten ihn wieder. Er überging Heinzen und sprach zu Moses Hess und den drei anderen am Tisch. »Freunde, Religion ist nicht mehr als das Gemüt einer herzlosen Welt, der Geist geistloser Zustände.«
Heinzen erhob sich halb, wollte widersprechen, ehe er ansetzen konnte, donnerte ihm Marx entgegen: »Religion ist Opium des Volkes!«
»Was hat das mit mir zu tun?«, gelang es Heinzen zu fragen. Der große, stark gebaute Mann bebte vor Zorn. »Ich bin ebenso Demokrat, ebenso Revolutionär wie du oder dein neuer Genosse, dieser saubere Friedrich.« Marx bohrte sich mit dem Finger im Ohr, als wäre es verstopft und er hätte deshalb nicht recht verstanden. »Hörte ich da Revolutionär? Oder gar Kommunist?« Spott glitzerte in den kleinen Augen. »Dazu braucht es nicht Dummheit und Muskeln, dazu benötigt es vor allem Verstand.«
Heinzen ließ sich auf den Stuhl zurückfallen, er blickte in die Runde, suchte Unterstützung. Die Freunde, auch Moses Hess, tranken hastig, niemand wollte sich einmischen. Da wagte es Heinzen allein. »Meine Kritik an der preußischen Bürokratie …«
»Ein Fliegenschiss. Mehr nicht.« Marx nahm die kleine Glocke und bimmelte, übertönte dabei den unterdrückten Fluch des Geschmähten, er bimmelte, bis die Kellnerin erschien. »Bring uns noch zwei Krüge. Und Zigarren!«
Als die Becher wieder gefüllt waren, blickte er übermilde zu Heinzen hinüber. »Nimm es nicht so schwer. Lass uns trinken und den Abend genießen.«
Eine Weile hielt der Frieden. Das Thema betraf jetzt die geheimen Versammlungen der aus Preußen geflohenen Handwerker. Friedrich Engels erkundigte sich genau nach dem Treffpunkt und schlug vor, an einer dieser Versammlungen teilzunehmen. Derweil spannte Heinzen die Lippen, das Lächeln gelang ihm nicht. Unentwegt schob er den Becher in der Faust auf dem Tisch hin und her. »Weißt du«, unterbrach er das Gespräch über den Geheimbund und beugte sich in Richtung Marx. »Weißt du, wie ich als Freund zu dir stehe? Damals in Köln, als wir noch gemeinsam in der Zeitungsredaktion saßen, da habe ich eine Zeit lang zu dir aufgeschaut. Bis ich dich richtig kennengelernt habe. Und heute? Ich gebe dir zwar immer noch die Hand. Mit der anderen aber würde ich dir am liebsten hinter die Ohren schlagen.«
»Was?« Karl Marx sprang auf. Auch Heinzen erhob sich wieder, er überragte den Spötter um einen Kopf, einen großen Kopf. Einen Augenblick lang starrten sich die beiden nur an. Marx streckte den Finger. »Mich ohrfeigen? Dann steche ich dir ein Messer in den Wanst.«
Nun verzog Heinzen das Gesicht. »Wenn du kleiner Mann so läppisch bist, dann eben keine Ohrfeige, sondern nur ein kräftiger Tritt.« Damit kam er um den Tisch herum, gleich wich Marx einen Schritt zurück. Da lachte Heinzen, schnippte mit den Fingern. »Keine Angst, ich geh nur mein Wasser wegschütten.«
Moses Hess schob den Stuhl zurück. »Ich komme gleich mit.« Der schmächtige Mann beeilte sich, durch die Tür zu schlüpfen, ehe sie zuschlug.
»Was für ein vergnüglicher Abend.« Marx rieb sich die Hände. »Dieser kleine Disput hebt die Stimmung, dazu Tabak und genug vom Roten.«
Er nahm eine von den Zigarren, leckte sie vorn, ehe er das andere Ende zwischen die Zähne steckte und ankaute. Eilfertig hielt ihm einer der Tischgenossen den brennenden Fidibus hin. Auch Friedrich rauchte.
Während Marx mit den übrigen drei Exilanten überlegte, ob ein Fuchs die Gans tötet und frisst oder ob er ihr den Hals durchbeißt, sich am Blut satt trinkt und das Fleisch liegen lässt, starrte Friedrich zur Tür. Die zwei? Wo bleiben sie? Freund Moses wird sich doch nicht mit dem groben Kerl verbünden? Unser kleiner Rabbi hat zwar gute Kontakte zu den Verlegern, aber leider ein weiches Rückgrat. Langsam erhob sich Friedrich, der Freund beachtete ihn beim Hinausgehen nicht, wie ein Schulmeister wollte er von den Exilanten wissen, wer in der menschlichen Gesellschaft mit dem Fuchs zu vergleichen sei.
Der Flur war nur schwach von zwei Öllampen beleuchtet. Aus der Küche roch es nach Gebratenem und Suppe, je näher Friedrich aber der geöffneten Hintertür kam, umso ärger mischte sich scharfer Gestank von Fäulnis und Kot in die Essensgerüche. Gleich neben dem Ausgang zum Hof hing eine Lampe. Ihr Schein fiel auf die beiden Bretterbuden, die Verschläge waren halb geöffnet. Daneben standen die beiden Männer an der blechernen Pissrinne. Ihre Notdurft schien längst verrichtet. Der lange Heinzen sprach auf Hess ein, dabei unterstrich er seine Worte mit großen Armbewegungen. »Wie ich schon sagte, wir, der Marx und ich hatten an dem Abend schon mehrere Flaschen Wein getrunken.«
»Das war noch in Köln?«, vergewisserte sich Hess. »Und da soll er dich berührt …?«
»Ja, Köln. Sag ich doch. Herrgott, hör doch zu!« Heinzen packte den schmächtigen Mann am Gehrock und rückte ihn direkt vor sich. »Was ich dir jetzt über diesen Wichtigtuer erzähle, ist die reine Wahrheit.«
Friedrich Engels ging nicht weiter. Also habe ich recht. Dieser dumme Rüpel sucht einen Verbündeten. Er trat in den Schatten der Hintertür und lehnte sich an die Wand.
»Marx verträgt nicht viel, wie du weißt. Also habe ich ihn nach Hause gebracht. Es dauerte, bis er mit dem langen Schlüssel die Haustür geöffnet bekam. Und dann flüsterte er mir zu: Komm mit rein. Ich muss dir etwas Wichtiges mitteilen. Sobald ich im Haus war, verschloss er die Tür, und ehe ich es mitbekam, hatte er den Schlüssel versteckt. Du bist jetzt mein Gefangener, kicherte er. Komm mit nach oben!« Heinzen stemmte die Fäuste in die Hüften. »Ich wollte nur wissen, was dieser komische Kauz vorhatte, und bin mit ihm die Stiege hinauf.« Dort habe er sich aufs Kanapee gesetzt und abgewartet. Nach einer Weile sei Marx hinter ihn getreten und habe immer wieder gekichert und halb gesungen: »Du bist jetzt in meiner Gewalt. Gehörst mir. Du bist jetzt in meiner Gewalt.«
Moses Hess schüttelte den Kopf. »Was sollte solch ein Verhalten?«
»Warte, es kommt noch schlimmer.« Heinzen beugte sich zu dem jüdischen Gelehrten hinunter. »Ins Hemd ist er mir gefahren. Erst die Brust, als er tiefer wollte, hab ich mich gedreht und die Hand rausgezogen. Aber er hat nur gekichert.« Marx habe ihm gedroht, wenn er sich weiter wehren würde, so könne er ihm die Position bei der Zeitung nicht mehr garantieren. »Und schon fasste er mich erneut an. Da hab ich ihn gewarnt, ihm gesagt, dass ich so was widerwärtig finde, und wenn er nicht damit aufhört, dass ich ihm das mit Gewalt klarmachen würde. Und über meinen Posten hätte er sowieso nicht zu entscheiden.«
Im Schatten der Hintertür griff sich Engels ans bärtige Kinn. Was für ein Schwätzer, dachte er. Eine infame Verleumdung.
»Halt, hab ich ihn gewarnt.« Die Stimme an der Pissrinne wurde lauter. »Er wollte mir den Teufel vormachen, wie er mich an sich reißt, mir die Kleider zerfetzt. Nun ja.« Heinzen richtete sich wieder auf. »Mir blieb nichts anderes übrig. Ein Schlag, und er taumelte rückwärts, lag in der Zimmerecke.«
»Allmächtiger!« Moses hob beide Hände. »So ein kluger, studierter Mann.«
»Gerade die …« Heinzen schnippte mit den Fingern. »Sauber sind da nur wenige.«
»Hat er sich entschuldigt?«
Ein kurzer Lacher. »Der große Karl Marx entschuldigt sich nie. Im Gegenteil.« Heinzen habe nach dem Schlüssel gefragt, sein Wächter aber hätte aus dem Faust gesungen:
»Drinnen gefangen ist einer!
Bleibet draußen, folg ihm keiner!
Wie im Eisen der Fuchs,
Zagt ein alter Höllenluchs …«
Kurz entschlossen sei Heinzen die Stiege hinunter. Mit gewaltigem Ruck habe er die Haustür aus dem Schloss gerissen und von der Straße zu Marx hinaufgerufen, er solle sein Haus besser verschließen, damit keine Diebe eindrängen. »Er aber lag nur im Fenster, sagte kein Wort, stierte mir nur mit seinen kleinen Augen nach wie ein begossener Kobold.«
Moses Hess fiel nicht ins Gelächter von Heinzen mit ein. »Ich kann es kaum glauben. Aber wenn du es selbst erlebt hast …«
»Marx war betrunken.« Der große Mann führte Moses an der Schulter zur Hintertür.
Rasch trat Engels noch tiefer ins Dunkel der Hauswand. Die beiden bemerkten ihn nicht, als sie vorbeigingen. Aus dem Flur vernahm Friedrich noch: »Und glaub es mir, gerade in solch einem Zustand zeigt sich die nackte Wahrheit.«
Dieser gemeine, dumme Rüpel. Friedrich ging zur Rinne, vor Zorn hatte er Mühe, die Hose aufzuknöpfen. Neid und Missgunst, sonst nichts. Dieser Flegel! Alles frei erfunden. Sicher verlief der Abend völlig harmlos. Ich werde dafür sorgen, dass diese Geschichte nicht in Umlauf gerät. Von jetzt an werde ich Heinzen und auch Moses genau beobachten. Und sollte einer von ihnen versuchen, daraus Kapital zu schlagen, so wird er mich von meiner schlimmsten Seite kennenlernen.
Friedrich kehrte ins Gasthaus zurück. Als er die Tür zur Hinterstube öffnete, stand Marx vor Heinzen, ein Stuhl lag umgestürzt neben ihnen. »Du bist kein Atheist. So begreife doch …«
»Hör auf, mich zu beleidigen. Wir alle hier sind reine Atheisten, kämpfen für eine neue Politik. Die Fessel des Christentums und der Kirche haben wir längst abgeworfen. Frei sind wir …«
»Papperlapapp!« Die Zigarre in der Linken stieß Marx ihm den Mittelfinger der Rechten gegen die Brust. »Idee! An Ideen für einen Umsturz glaubt ihr jetzt. Das ist eure neue heilige Religion. Und damit seid ihr keine Atheisten.«
Mit einer heftigen Bewegung wischte Heinzen den Finger beiseite. »Wir kämpfen für das unterdrückte Volk, es soll endlich aufstehen.«
»Warum? Was habt ihr den Armen denn anzubieten? Ihr versprecht Besserung, ohne zu wissen, wie sie durchgeführt werden soll, ihr weckt Hoffnungen, von denen keiner weiß, wie sie erfüllt werden können. Das ist Betrug!«
»Halt’s Maul, Kerl! Nenn mich nicht Betrüger.«
Als Friedrich sah, wie Heinzen die Fäuste ballte, öffnete und wieder ballte, ging er zum Tisch und griff nach einem leeren Becher, schlug ihn probeweise mit dem Boden voran in die Handfläche. Die Gesichter der Genossen waren angespannt. Moses Hess flüsterte Engels zu: »Friede. Versuche doch, die beiden auseinanderzubringen.«
»Dann lernt keiner was«, lächelte Friedrich dünn. »Ich sorge nur dafür, dass sie sich nicht totschlagen.«
Marx nahm einen Zug aus der Zigarre und blies Heinzen den Qualm ins Gesicht. »So benebelt bist du, genauso wie deine Freunde. Jetzt das Volk in blutige Aufstände zu hetzen ist gewissenlos. Weil erst ans Grundübel herangegangen werden muss.«
»Und nur der schlaue Dr. Marx in seiner Studierstube weiß, wie es gemacht wird«, höhnte Heinzen.
»So ist es, mein Freund. Das Privateigentum muss abgeschafft werden. Es ist das Grundübel.«
»Wer hier das Übel für unsere Bewegung ist, zeig ich dir. Du schwarz behaarter Affe, selbst aus den Löchern deines Drecksknorren wuchert dir das Fell.«
»Fällt dir das Denken so schwer? Kaum hast du keine Argumente mehr, musst du mich beleidigen. Versuche dein bisschen Hirn zu sammeln.«
»Mir reicht’s!« Heinzen stieß dem Gegner vor die Brust, der wankte, stolperte über den Stuhl und schlug rücklings zu Boden. Gleich kniete Friedrich bei dem Freund. »Geht es?«
Marx nickte, unter Ächzen raffte er sich halb hoch und lehnte den Rücken an die Wand. »Meine Zigarre?« Er entdeckte sie an einem Tischbein. »Gib sie mir!« Engels steckte ihm das zerkaute Ende zwischen die Zähne, ließ ihn einige Züge paffen, ehe er ihm ganz aufhalf.
Heinzen stand an der Tür, den Zylinder in der Hand. »So weit musste es nicht kommen.«
»Ist das eine Entschuldigung?«, wollte Marx mit spitzer Stimme wissen.
»Herrgott, nein.« Heinzen schlug die Tür hinter sich zu. Die Stimmung war verdorben, rasch brachen auch die übrigen Genossen auf. Moses Hess bot noch seine Hilfe an, dafür dankte ihm Friedrich, und der kleine Mann verließ mit eingezogenem Kopf die Hinterstube des Bohème.
»Erklimmen wir den Berg!« Die Stimme gehorchte Marx nicht mehr ganz. »Hinauf zu unsrem Schloss.« Er legte den Arm um die Schulter des Freundes. »Aber erst müssen wir noch die leidige Zeche begleichen. Könntest du …? Ich habe ein Weib und ein Kind zu versorgen. Nein, bald sind es schon zwei. Du weißt, meine Jenny …« Er beschrieb eine Wölbung vor dem Bauch. »Unterstütze also bitte den geplagten Familienvorstand!«
Und Friedrich bezahlte.
Brüssel schlief schon. Wankend querten die Angetrunkenen den Opernplatz. Die Gassen hinauf zur Kathedrale Saints-Michel-et-Gudule raubte ihnen den Atem. Unterhalb des Hauptportals zog Marx den Freund auf eine Bank. »Warte, sonst erlebe ich den Gipfel nicht, und die Welt wäre um ein Genie ärmer.« Beide lachten in sich hinein. Marx hob den Finger. »Was sage ich? Ein Genie? Um das einzig große Genie.« Er lehnte den Kopf an Friedrichs Schulter. »Im Ernst: Wir müssen das Grundübel noch besser erforschen. Das Privateigentum ist ein Raubtier. Es geht umher und frisst sich an den Armen satt. Wir wissen noch viel zu wenig über dieses Ungeheuer, seine grausame Jagdtechnik. Also, wie genau funktioniert das Privateigentum?« Er boxte Engels leicht in die Seite. »Wenn du es weißt, heraus damit!«
Friedrich fasste nach der Faust und hielt sie fest. »Ich bin unsicher. Aber ich weiß aus meiner Zeit in Manchester, dass man sich in England schon lange mit der Ökonomie beschäftigt. Die Bibliotheken da sind bestens ausgestattet, da finden wir alles, was neu erschienen ist.« Während seiner zweijährigen Lehrzeit bei Ermen & Engels, einer englischen Filiale der Spinnereifabriken seines Vaters, hatte er das Elend der Arbeiterklasse hautnah kennengelernt, selbst darüber ein Buch geschrieben und gerade fertiggestellt. Marx kicherte vor sich hin. »Mein Kapitalist mit dem Herz für Arme.«
»Und du? Der Mann einer Adeligen, der Kommunist sein will.«
»Da sei der Teufel vor.« Marx streckte beide Hände in den nächtlichen Himmel. »Kommunismus? Ich denke nur darüber nach.« Er setzte sich auf, wischte mit dem Ärmel über die Stirn, kämmte mit den Fingern durch den zottigen Bart, die Trunkenheit wich aus der Stimme. »Sagtest du Manchester? Wir sollten hinfahren und uns durch die Bücher fressen. Erst wenn wir exakt wissen, was die anderen über die Nationalökonomie geschrieben haben, können wir mit unserer Arbeit loslegen.«
Gleich stieg Friedrich ein: »Und ich kenne jede Bibliothek. Besonders Chetham’s Library wird dir gefallen …«
»Ach, was träumen wir.« Marx blies den Atem aus, sank wieder in sich zurück. »Der schnöde Mammon. Woher das Reisegeld nehmen? Es langt ja nicht einmal für ordentliche Möbelstücke.« Er wies mit dem Finger über die Schulter zur Kathedrale hinauf. »Vom heiligen Michael haben wir als Atheisten keine Hilfe zu erwarten.«
»Nicht so voreilig!« Friedrich strich sich den Schnauzbart. »Sorge dich nicht ums Geld. Mir wird da schon etwas einfallen.«
4. Kapitel
Brüssel, Rue de l’Alliance 5Anfang Juni 1845
Jenny Marx ließ Stoff und Nadel in den Schoß sinken. Mit ihrem Kleidärmel wischte sie sich über die Stirn. »Mir wird so eng«, sagte sie halblaut zu Helene am Küchentisch hinüber.
»Regt sich das Kind?« Helene warf den Lappen auf das Tafelbesteck und wischte sich die Hände an der Schürze ab. »Müssen Sie sich hinlegen?«
»Nein, das Kind ist ruhig.« Die Hausherrin erhob sich, rückte den Stuhl näher ans Fenster und schob es auf. Tief atmete sie einige Male die frische Luft ein. »Es geht schon etwas besser.« Mit gequältem Lächeln nahm sie wieder Platz. »Wenn dieser beißende Geruch hier nicht auch noch so süßlich wär. Davon wird mir leicht übel.«
»Tut mir leid. Aber ich muss ordentlich Spiritus dazumischen. Mit was anderem bekomme ich das Silber nicht mehr sauber.« Helene rührte im Brei aus Schlämmkreide und Ethanol, tunkte den Tuchballen hinein und rieb weiter am Griff einer doppelzinkigen Vorlegegabel. Neben ihr lag ein Haufen schwarz angelaufener Besteckstücke, und hinter der Spülschüssel reihten sich die wie neu silber blinkenden Gabeln, Messer und Löffel. »Möchte nur wissen, wann das Zeug zum letzten Mal geputzt wurde.«
Jenny überhörte den Vorwurf, spitzte die Lippen. »Das ist leicht nachzurechnen. Jetzt haben wir Juni. Vor fast genau zwei Jahren habe ich geheiratet. Mutter hat mir das Silber zur Hochzeit geschenkt. Vielleicht zum Trost, weil ich an dem Tag von heut auf morgen vom adeligen in den bürgerlichen Stand gewechselt bin.« Jenny lachte und wedelte mit dem fast fertig genähten weißen Kinderkleidchen. »Nein, nur Spaß. Die Heirat mit meinem Mohr habe ich nie bereut. Aber das Besteck hat schon viel mitgemacht, Paris, Köln und jetzt Brüssel, kein Wunder, dass es schwarz ist.«
Helene seufzte und dachte: Dann war ich es wohl, die es zuletzt in Trier im Auftrag der Frau Baronin für die Hochzeit poliert hat. »Vielleicht sollten wir öfter ans Putzen denken«, schlug sie vor. »Dann macht das verdammte Zeug nicht so viel Arbeit.«
»Nicht fluchen! Immerhin sind es wertvolle Erbstücke.«
Helene drohte mit dem hölzernen Wattestab. »Auf jedem Teil kann ich die Kronen auskratzen. Und von diesen elenden verschnörkelten Buchstaben da drunter ganz zu schweigen. Auch noch zwei. Einer hätte genügt.«
»Bitte rede nicht so abfällig über meine Vorfahren. Immerhin entstammen sie dem schottischen Hochadel. Es sind die Earls und Dukes von Campbell und Argyll.«
»Ich weiß. Ihre Frau Mutter, die Baronin, hat mir schöne Schauergeschichten von diesen Herren erzählt.« Nur mühsam ließ sich der schwarze Belag aus den Zacken der Krone pulen. »Einmal ging es um dieses furchtbare Massaker an der Sippe der MacDonalds.«
»Sei still!«
Doch Helene wollte zanken. »Tja, schlimm, schlimm. Frauen, Kinder und fast vierzig Männer haben die Campbells an einem Tag hinterrücks erschlagen.«
»Du Klatschweib.« Jenny drohte halb im Ernst mit der Nadel. »Der Vorfall ist nie ganz bewiesen worden und im Übrigen schon über hundertfünfzig Jahre her. Es gibt viel mehr Gutes als Schlechtes über die alten Campbells und Argylls zu berichten. Als meine Großmutter Jeanie dann das Silberbesteck mit in die Ehe brachte …«
Die Türglocke schlug an. Beide Frauen hoben den Kopf. Jenny runzelte die Stirn. »Jetzt, am frühen Vormittag?«
»Erwarten wir jemanden?«
»Nein. Alle, die wir kennen, schlafen um diese Zeit noch.«
Heftiger läutete es im Flur. Langsam band sich Helene die Schürze ab. Bei wem haben wir Schulden? Bäcker und Metzger können es nicht sein, die habe ich letzte Woche bezahlt. Egal, wer es ist. Noch ein Lächeln für die Hausherrin, und entschlossenen Schritts ging sie hinaus.
Kaum hatte sie die Haustür geöffnet, wurde diese weiter aufgestoßen, gebreitete Arme, in jeder Hand eine Flasche und in der Mitte ein strahlendes Lachen im bärtigen Gesicht. »Lene! Die Sonne ist aufgegangen! Rufe das Volk zusammen!« Friedrich Engels stürmte an ihr vorbei, blieb gleich wieder stehen. »Wo sind sie?«
Helene fasste sich. »Frau Baronesse sitzt in der Küche. Der Herr ist noch oben. Klein Jenny schläft in der Stube.« Sie hob den Finger. »Also bitte nicht so laut.«
Leicht schlug Friedrich die Flaschen aneinander. »Im Gegenteil, du strenger Hausgeist. Klingen soll es in allen Ohren. Wir haben Grund zu feiern.« Er ging zur Treppe und rief hinauf: »Karl! Ich bin’s, Karl!«
Auf das unwillige Gebrummel setzte er im Befehlston hinzu: »Runter mit dir! Es gibt Neuigkeiten. Also Beeilung!« Damit betrat er die Küche. Helene drängte hinter ihm her. »Verzeiht, Herrin. Aber ich glaube, nun ist Herr Fritz ganz vom Wahnsinn erwischt worden.«
Friedrich ging bis zum Fenster, vollführte einen tiefen Bückling, dabei schwang er die Flaschen nach hinten. »Baronesse, der Morgen wird erst richtig schön bei Eurem Anblick.«
»Danke, mein Bester.« Bei ihrer höfischen Antwort bemühte sich Jenny um adelige Hochnäsigkeit. »Ich glaube, unser gutes Lenchen hat recht. Wir sollten nach dem Arzt schicken.« Nun musste sie doch lachen. Erst nach einer Weile sprach sie im gewohnt bürgerlichen Ton weiter: »Guten Morgen, Fritz. Was bringst du uns?«
Friedrich stellte beide Flaschen neben das Silberbesteck auf den Küchentisch. »Champagner. Der schmeckt zu jeder Tageszeit.«
»Was höre ich da?« Karl Marx kam herein, barfuß, nur bekleidet mit einem knielangen grauen Nachthemd, die schwarzen Brusthaare zeigten sich im offenen Halsausschnitt. Er begrüßte den Freund mit einem leichten Schlag auf die Schulter. »Champagner? Das prickelnde Wasser des Proletariats.«
»Wo sind die Gläser?« Friedrich nahm sich eines der geputzten Messer. Im ersten Moment wollte Helene es ihm verbieten, unterließ es und stellte vier Tonbecher auf den Tisch. »Die Kristallkelche der Herrschaft sind wohl noch eingepackt«, spottete sie.
»Also dann.« Friedrich durchschnitt die Kordeln am Flaschenhals, nur ein leichter Daumendruck, und mit einem Knall schoss der Korken zur Decke. Rasch fing er die übersprudelnde Köstlichkeit in einem der Becher auf, bis der Druck nachließ und er die übrigen drei vollschenken und verteilen konnte. »Trinken wir auf mein Väterchen.«
Nach dem ersten Schluck erkundigte sich Karl besorgt: »Väterchen? Ist über Nacht aus dem schwarzen Teufelsbock der Familie ein weißes Lamm geworden?«
»Im Gegenteil.« Friedrich trank genüsslich, dem Freund dauerte es zu lange. »Nun spann uns nicht auf die Folter. Was, bei allen Propheten, versetzt dich so in Stimmung?«
»Ich habe diesem pietistischen Geizkragen zweihundert Extrataler aus dem Leib gesaugt.« Sein Klagebrief hatte Vater Engels überzeugt. Nur in den Bibliotheken Manchesters gebe es die nötige Literatur für das künftige Werk des Sohnes über die englische Sozialgeschichte. Friedrich strahlte den Freund an. »Der Alte hat es geglaubt. Damit steht uns nichts mehr im Wege. Das Geld ist da. Wir fahren nach Manchester.«
»Was bitte?« Jenny stellte mit Nachdruck ihren Becher auf den Fenstersims. »Manchester? Eine Reise?« Sie starrte zu ihrem Mann hinüber. »Wer hat sie geplant?«
Langsam setzte nun auch Friedrich das Tongefäß ab. »Karl? Hast du …?«
»Noch nicht. Ich wollte … ich dachte, es wäre besser zu warten. Nicht vorher schon Unruhe stiften.«
»Ich bin schwanger, erleide bald schmerzvolle Qualen, und du willst derweil ins Amüsement reisen?« Jenny erhob sich, warf das Nähzeug auf den Stuhlsitz, ohne Friedrich zu beachten, blieb sie vor ihrem Mann stehen. »Darf ich dich einen Moment allein sprechen? Bitte!« Sie ging voraus, und Marx folgte ihr, dabei kratzte er sich heftig durch die schwarze Lockenmähne.
Friedrich starrte den beiden nach. »Da habe ich was angerichtet.«
Mit einem Seufzer schob Helene ihren Becher hinter die Spülschüssel und stocherte weiter im Schwarz des Monogramms der Campbells und Argylls. Er kam zu ihr, tippte den Finger neben dem Besteckhaufen auf die Tischplatte. »Das konnte ich nicht ahnen, glaub mir. Ich war überzeugt, Karl hätte längst mit ihr darüber gesprochen.«
Helene dachte, so viel ihr Männer hier auch redet, wollt die Welt verbessern, richtig Mut scheint ihr nicht zu haben. Wenigstens nicht Herr Karl, wenn es um unsere Baronesse geht.
»Nun sag doch was«, verlangte Friedrich. »An dem Streit bin ich unschuldig.«
Sie sah ihn an, unvermittelt schmunzelte sie. »Wenn ich es mir so richtig überlege, muss es gar nicht zu einem Streit kommen.«
»Da draußen braut er sich gerade zusammen«, unterbrach Friedrich düster.
»Nun warten Sie mit dem Gejammer«, fuhr Helene auf. »Ich habe euch Männer oft davon reden hören, dass alles gerecht verteilt werden soll.«
»So einfach kann man es nicht …«
»Es ist ganz einfach.« In drei Sätzen unterbreitete Helene ihm einen Plan, zum Abschluss warf sie die geputzte Vorlegegabel ins Spülwasser. »Und gut so.«
»Du bist …« Friedrich staunte, setzte nach einer Weile hinzu: »Diese Idee hätte von mir sein können.« Er wollte nachschenken, da wurde die Tür aufgestoßen, und Jenny stürmte in die Küche. »Nein, ich bin nicht damit einverstanden.« Hinter ihr rang Karl die Hände. »Es ist doch nur für ein paar Wochen.«
»Wartet!« Der scharfe Befehlston ließ beide zusammenfahren. Friedrich griff den Freund am Arm und bat Jenny: »Bitte, hab nur einen kleinen Moment Geduld. Ich denke, es gibt eine Lösung.«
»Frieden gibt es nur, wenn es keine Englandreise gibt.«
»Oder wir schaffen Gerechtigkeit.« Bei dem Wort horchten beide auf. Friedrich griff in die Innentasche seines Gehrocks und zückte einige Geldscheine. »Auf dem Weg zu einer gerechten Gesellschaft müssen wir mit gutem Beispiel vorangehen.« Er sprach wie ein Zauberkünstler zu seinem Publikum. Wenn Karl und er nach England fahren wollten, so sollte Frau Jenny auch verreisen dürfen. Und zwar nach Trier zur Mutter, in Begleitung von Helene und Klein Jenny. Der Künstler fächerte die Geldscheine vor dem Gesicht auf und schlug sie wieder zum Bündel in die Hand. »Die Baronin freut sich, wir freuen uns. Und gut so.«
Jennys Gesicht hellte sich auf, ein langer Blick für den Ehemann, dann nahm sie ruhig ihr Nähzeug vom Stuhl und setzte sich. »Wann soll die Fahrt nach England beginnen?«
Noch ungläubig sagte Karl: »Im Juli.«
»Also, Lenchen«, Jenny nickte ihrer Haushälterin zu, »wir packen und reisen im Juli nach Trier.« Nun hob sie den Blick zu Friedrich. »Danke für den Friedensplan. Du sprachst außerdem von der gerechten Verteilung des Kapitals?«
Er vollführte wieder einen Bückling und übergab ihr einige Scheine. »Es ist mir eine Freude, als Bourgeois dem Adel helfen zu dürfen.«
Jetzt strahlte auch der Hausherr. »Champagner! Auf die schönste Frau. Auf Väterchen Geizkragen, auf meinen treuen Freund.«
Sie stießen miteinander an. Ehe Friedrich den Becher zum Mund führte, setzte er hinzu: »Vor allem auf unser Lenchen.« Sie sah ihn an, nickte unmerklich und nahm einen großen Schluck.
5. Kapitel
Zugfahrt Birmingham nach ManchesterJuli 1845
Langsam bewegte sich der Galgenarm vom mächtigen Wasserturm weg. »Ich muss dabei sein.« Karl Marx beschleunigte den Schritt, zog den Freund am Mantelärmel mit sich entlang des Bahnsteigs von Birmingham. Trotz ihrer Eile wurden sie überholt von drei Jungen, die mit Gejohle an den Waggons vorbeirannten, nach vorn zur Spitze des Zuges. »Bisher ist es mir nie gelungen.«
Friedrich sah ihn von der Seite an. »Wir führen uns auf wie diese Knaben.«
»So? Meinst du?« Nun steigerte Marx das Tempo, begann zu laufen. Mühelos blieb Friedrich an seiner Seite. »Das nenne ich praxisnahe Wissbegierde«, lachte er. »Wenigstens könnten wir auf die Nachfrage verwunderter Mitreisender unser Verhalten so erklären.«
»Was schert mich das Volk?«
»Nur gut, dass dich keiner hört.« Friedrich blickte über die Schulter zu den weiter hinten wartenden Passagieren und wäre beinah gestolpert. Aus der Gruppe hatten sich zwei Männer gelöst, die Zylinder in der Hand, die Mäntel über dem Arm liefen sie hinter ihm und Marx her. Friedrich beeilte sich, den Freund wieder einzuholen. »Ratten! Sie haben ihr Loch verlassen. Zu zweit verfolgen sie uns.«
Marx stieß einen Lacher aus. »Dieselben vom Schiff?«
»Der Größe nach könnten sie es sein.«
»Solange diese Spitzellumpen uns nur begaffen, sind sie mir scheißegal.« Marx blieb neben der Lokomotive stehen. »Das dort oben interessiert mich.«
Der waagerechte Arm des Wasserkrans kam über dem Kessel zum Stillstand, keine Korrektur der Position war nötig, auf ein Handzeichen des Lokführers hin stürzte der Schwall aus dem gebogenen Ausfluss und ergoss sich unter mächtigem Rauschen in den Kessel der Maschine. Die Jungen standen mit offenen Mündern da. Auch den beiden Herren neben ihnen war das Staunen deutlich anzumerken. Nach wenigen Minuten war das Befüllen des Kessels abgeschlossen. Auf dem Weg zurück zu ihrem Abteil nickte Marx vor sich hin. »Nichts ist starr, alles befindet sich in Bewegung, entwickelt sich. Hier ganz besonders deutlich zu erkennen.«
Friedrich öffnete den Schlag. »Durch Erhitzen wird Wasser zu Dampf, der Dampf wird zur Kraft, und die Kraft treibt unsere Lokomotive und so fort.« Er stieg ein und ließ sich auf die gepolsterte Bank fallen. »Diese Erkenntnis ist längst nicht mehr neu.«
Marx nahm ihm gegenüber Platz. »Mich würde interessieren, wie groß das Fassungsvermögen des Kessels ist, wie viel Wasser die Lokomotive auf der Strecke zwischen London und Birmingham und weiter bis nach Manchester verbraucht.«
Großer Gott, dachte Friedrich, bewahre uns vor Abwegen, und sagte: »Haben wir uns nicht wichtigere Themen vorgenommen?« Er sprang erneut hoch und lehnte sich halb aus dem offenen Schlag. Nach wenigen Augenblicken kehrte er auf seinen Platz zurück. »Die Spitzel sind ins dritte Abteil hinter uns gestiegen. Würde jedes einzelne Gehäuse noch als Kutsche von Pferden gezogen, hätten wir jetzt eine aufregende Wettfahrt bis Manchester vor uns. Aber so werden uns die Kerle zwar auf den Fersen bleiben, uns aber nie einholen.«
»Die Eisenbahn hat den Fortschritt …«
Ein verschlossener Weidenkorb wurde vom Bahnsteig ins Abteil gehoben. Gleich erschien daneben ein schmales Gesicht, hübsch behütet von einer grünen Schute, die Bänder waren unter dem Kinn mit einer großen Schleife gebunden. »Excuse me, gentlemen. Könnten Sie mir behilflich sein?«
Friedrich war schon zur Stelle, setzte den Korb auf die Bank und reichte der Lady die Hand. Sie lehnte ab und half stattdessen einem schmächtigen, wohl achtjährigen Mädchen in den Fond. Bleiche Wangen ließen die dunklen Augen größer erscheinen. Beim Anblick des Kindes erlosch Friedrichs Eifer, und die Dame stieg ohne seine Hilfe ins Abteil.
»Guten Tag. Ich bin Patsy Roseleaf.« Sie zupfte am Häubchen der Kleinen. »Ich bin das Kindermädchen meiner süßen Caroline.«
Die Freunde lüfteten ihre Hüte und nickten. Friedrich erwiderte den Gruß in perfektem Englisch, während Marx sich zu einem deutlich klaren »Guten Tag, Fräulein« entschied, doch gleich ein »Bonjour« nachsetzte. Dies ließ sie die Stirn krausen. »German? French? Or English?«
Friedrich löste das Rätsel, und Miss Roseleaf rückte den Korb neben ihn auf die Bank, setzte das Mädchen dazu. Sorgsam schloss sie die Kabinentür und ließ sich in deutlichem Abstand von Marx mit einem kleinen Seufzer auf dessen Seite nieder.
Ein starker Ruck erschütterte die Kabine. Angst ließ das Mädchen aufwimmern, gleich legte es beschützend die Hände über den Weidenkorb. Vor dem Fenster glitten die Gebäude vorbei. Rucke folgten schneller aufeinander, milderten sich ab. »Keine Angst, mein Kleines.« Miss Roseleaf beugte sich vor und strich dem Kind übers Knie. »Der Zug fährt an. Und schon rollen wir.«
»Aber mein Kätzchen …«
»Sorge dich nicht! Alles ist gut.«
Dunkle Dampfwolken waberten gegen die Fenster, vernebelten die Sicht nach draußen, gleichmäßiger wurde das Lärmen der Räder.
Karl nickte zufrieden. »Keine Kutsche kann uns solchen Komfort bieten.« Er nahm zwei Zigarren aus der Holzschachtel und bot Friedrich eine von ihnen an. Mit dem Entzünden des Streichholzes erfüllte scharfer Geruch nach Schwefel den kleinen Raum. Das Mädchen hüstelte.
Beide Männer pafften mehrmals rasch hintereinander, bis die Zigarren aufglühten. Friedrich blies den Rauch zur Decke. »Zu unseren Themen.«
»Kritik der Politik und Nationalökonomie.« Karl schmeckte jedem Wort nach. »Ein guter, braver Titel. Er allein hat mir eintausendfünfhundert Franc Vorschuss eingebracht.« Im Frühjahr, noch in Paris, hatte Karl Marx einen Vertrag über das geplante zweibändige Werk abgeschlossen. Dafür war der Verleger Leske extra aus Darmstadt an die Seine gereist. Karl rundete die Lippen und stieß rasch nacheinander mit Gefauch einer Lokomotive gräuliche Rauchkringel aus. »Nun gilt es, die leeren Seiten noch mit Inhalt zu füllen.«
Das Mädchen hustete. Miss Roseleaf strich ihm über die Stirn und wagte einen vorwurfsvollen Blick auf die Zigarren.
»Sei unbesorgt, mein Freund.« Friedrich stippte die Asche von der Glutspitze. »Für deine Idee, in das Werk die Schriften der führenden englischen Sozialisten und Kommunisten als Übersetzung mit aufzunehmen, wirst du in Manchester die besten Grundlagen vorfinden. Ich kenne jede Bibliothek.«
»Kann es kaum glauben, dass wir dort ohne Empfehlung oder Gebühr Zutritt haben sollen.«
»Deshalb meiden wir die teure Nationalbibliothek in London.« Beide Herren machten tiefe Züge, und ihr Qualmausstoß war gewaltig.
Neben Engels rang Caroline mit einem Hustenanfall, der nicht enden wollte, auch ihre Nurse atmete kürzer und tupfte sich mit einem Tüchlein erste Tränen aus den Augenwinkeln. Ihre Not blieb unbemerkt.
»In der Chetham’s Library finden wir alle Werke. Du für deine Arbeit und ich für meine Geschichte der englischen Gesellschaft. Oben im Lesesaal werden wir uns einnisten.« Beim Abstreifen der Zigarre fiel die Glut mit in den Aschenbecher, gleich riss Friedrich ein zweites Zündholz an, und noch mehr Rauch verbreitete sich in der engen Kabine. »Außerdem werde ich dir Orte in der Stadt zeigen, die der gewöhnliche Besucher nie zu sehen bekommt.« Er schwieg, lächelte vor sich hin. Erst nach einer Weile setzte er hinzu: »Und wenn die Götter mir wohlwollen, so werde ich dich sogar mit einer Überraschung in Staunen versetzen.«
Weil das Mädchen sich nun halb über den Weidenkorb legte, der kleine Rücken vom Husten geschüttelt wurde, erhob sich Miss Roseleaf und zog das Türfenster nach unten. »Komm hierher, Liebling. Nun komm!« Sie hielt ihren Schützling sicher, während Caroline das Gesicht hinausstreckte, atmete. Nur eine kurze Weile, dann zog sie den Kopf zurück. »Und jetzt auch mein Kätzchen.«
»Um Gottes willen. Nein!« Die Nanny musste sich setzen. Nase, Wangen und Mund des Kindes waren vom Ruß gezeichnet, das vorher weiße Häubchen nun schwarz gekräuselt. Miss Roseleaf ballte beide Fäuste, so wandte sie sich den plaudernden Herren zu. »Gentlemen. Ich bitte Sie …« Sie hob etwas die Stimme. »Bitte!«
Die Herren unterbrachen das Gespräch, sahen sie verwundert an.
»Hören Sie auf zu rauchen. Sonst sterben wir. Das Kind, die Katze und auch ich selbst.«
Marx richtete sich auf. »Aber natürlich. Warum haben Sie sich nicht schon früher gemeldet?« Er nahm gleich ein kurzes Messer aus der Tasche und schnitt die Glut in den Aschenbecher, den Zigarrenstumpf legte er in die kleine Kiste zurück. Friedrich lächelte gewinnend. »Leben und leben lassen. So wollen wir doch das Reisen genießen.«
6. Kapitel
Manchester, Chetham’s LibraryJuli 1845
Hinauf in den ersten Stock verlangsamte Friedrich Stufe für Stufe den Schritt. Jedes Mal beim Betreten einer Bibliothek verspürte er dieses Gefühl der Reinigung, nirgendwo aber empfand er es so stark wie hier in der Chetham’s Library von Manchester. Die Stadt, der Trubel, sie fielen von ihm ab wie Hut und Mantel, die unten an der Garderobe abgegeben werden mussten, Blick und Geist wurden frei. Am Beginn des langen Flurs sog er tief den Atem ein. »Riechst du sie?«, erkundigte er sich über die Schulter.
Marx rieb sich die Nase. »Wen meinst du?«
»Bücher.« Friedrich fächelte im Vorbeigehen dem Freund von den mit Folianten bis zur Decke vollgestellten Regalen etwas Luft zu. »Dieser Geruch reizt mich auf ganz eigene Weise.«
»Ach? Was da alles in dir steckt? Wir sitzen seit drei Tagen in dieser Bibliothek nebeneinander. Und du genießt …«
»Schon gut, du Spötter.« Friedrich winkte ab. »Der Geruch verursacht bei mir keinesfalls solche Wirkung, wie es dem Parfüm einer Midinette gelingt.«
Übertrieben schnüffelte Karl. »Ich rieche Lederrücken, Staub, Buchläuse und Wachs, mit dem die Eichenmöbel gepflegt werden. Sehr anregend.« Er deutete auf das Regal mit angeketteten Bänden. »Es scheint, als hätte man sich auf uns vorbereitet.«
»Karl, wir stehlen keine Bücher.«
»Manche wären es schon wert«, murmelte Marx.
Vor dem Eingang zum Lesesaal hob Friedrich den Blick zur Büste des Homer über der Tür, bewies kurz seine Ehrfurcht mit militärischer Haltung. Während Marx dem marmornen Dichter locker zuwedelte und ihm ein »Kollege« als Gruß hinaufrief.
Beim Eintritt der beiden blickten einige Leser am großen runden Tisch von ihrer Lektüre auf. Die Mienen verdüsterten sich, das Kopfnicken war nicht mehr als gequälte Höflichkeit. Die Freunde gingen zu ihren Plätzen nahe des Kamins. Ihre Bücher von gestern lagen sorgfältig ausgerichtet da, auf jedem Deckel befand sich ein mit großen Lettern beschriebenes Blatt: Silence please! Das Ausrufezeichen war mit rotem Stift noch verstärkt worden.
Marx öffnete seine Ledertasche, räumte geräuschvoll Tintenfass, Feder und Schreibheft auf den Tisch und ließ sich mit sattem Stöhnen auf dem lederbezogenen Stuhl nieder. Erschreckt hob ihm gegenüber der Herr den Kopf, die Brillengläser auf dem schmalen Nasenhöcker vergrößerten das Hellblau der Augen. Marx lächelte. »Guten Morgen«, raunte er ihm zu, »da sind wir wieder.«
Das Gesicht des Gegenübers verlor an Farbe, rasch blickte der zu den benachbarten Lesern rechts und links, erntete hochgezogene Brauen und zuckende Mundwinkel als Unterstützung seiner Empörung und beugte sich erneut über sein Buch.
Auch Friedrich hatte inzwischen die Schreibutensilien zurechtgelegt. Er blätterte im Werk von Frederick Morton Eden bis zur Stelle, an der er gestern das Studium abgebrochen hatte. Kurz überflog er die letzten Exzerpte in seinem Heft.
The State of the Poor war eine peinlich gründliche Beschreibung von Hunger, Ausbeutung und Elend der Armen während der vergangenen Jahrhunderte in England. Seite für Seite hatte Friedrich gelesen und Wichtiges herausgeschrieben. Er stockte an der Stelle über die Ernährung der Armen: »Die Arbeiter des 15. Jahrhunderts aßen in schlechten Zeiten Brot aus Bohnen, Erbsen und Hafer« Weiter blätterte er in seinem Heft. »Arbeitszwang … Wer zwischen 12 und 60 Jahren, Weiber unverheiratet zwischen 12 und 40 Jahren, keinen Unterhalt habe, soll von den Friedensrichtern gezwungen werden, im Ackerbau Arbeit zu suchen.« Weiter: »Bettler ohne Lizenz und über 14 sollten heftig ausgepeitscht und am linken Ohrlappen gebrannt werden. Wenn sie keine Arbeit annahmen und über 18 waren, sollten sie wie Schwerverbrecher hingerichtet werden.« Friedrich glättete mit dem Finger den Schnurrbart zur Oberlippe. Auspeitschen und mit glühenden Eisen brennen? Und welcher Dienstherr nimmt solch einen armen Kerl, der schon das Brandzeichen am Ohr trägt?
Neben ihm grummelte der Freund vor sich hin, während er las und gleichzeitig, ohne hinzuschauen, ganze Passagen des Textes in sein Heft notierte. Friedrich beugte sich leicht hinüber. Keine wirklichen Buchstaben, dachte er, eher ein Geschmier, aus dem nur ein Schriftexperte Worte zu entziffern vermochte.
»Kommst du gut weiter?«, flüsterte er Marx zu.
»Dieser Petty versteht was von Zahlen, Statistik und Logik. Gar nicht schlecht, was er über die wirtschaftliche Zukunft von London denkt.« Marx zückte seine Taschenuhr, legte sie auf den Tisch und tippte mit dem Finger darauf. »An diesem Beispiel zeigt Petty den Fortschritt. Keine kleine Werkstatt mehr. Nicht einer allein soll das ganze Produkt herstellen. Eine große, gut organisierte Manufaktur muss her. Mehr und sogar bessere Uhren gibt es, wenn ein Mann die Zahnräder, ein anderer die Feder, der nächste das Zifferblatt und der andere das Gehäuse herstellt und so weiter. Ein kluger Kopf, dieser Petty. Ich werde ihn überprüfen.« Marx steckte die Uhr zurück und klaubte dafür das Zigarrenetui aus der Tasche. Die Rauchwolke waberte über den Tisch, und sein Gegenüber versuchte sich mit Wedeln vor dem Qualm zu schützen. Auch seine Nachbarn ließen die Bücher vor den Gesichtern wippen.
Stille. Nur das Gebrummel von Marx war zu hören, hin und wieder unterbrochen vom Geschmatze an der Zigarre.
Friedrich gelangte in seiner Lektüre zu einer Abhandlung über die Vermehrung der Armut. Erst Zahlen und radikale Vorschläge, wie die Bedürftigen und vor allem deren Kinder zur Arbeit gezwungen werden könnten. Dann aber … Er putzte seine Brillengläser und las den Absatz erneut. Kein Zweifel. Mit dem Ellbogen stupste er Marx in die Seite. »Hier«, er neigte sich zum Ohr des Freundes. »Dieser Kerl glaubt, dass die Verdrängung der Reitpferde durch die Reisekutschen der Hauptgrund für die Zunahme der Armut ist.«
Karl Marx benötigte einen Moment, er nahm den Zigarrenstummel aus dem Mund. »Was? Weil die Kutschen die Pferde vertrieben haben? Von solch einer Theorie hab ich noch nie was gehört.« Er zog sich das Buch heran und las selbst die Stelle. Schallend lachte er auf. Das Entsetzen der Umsitzenden nahm er nicht wahr. Erst Friedrich konnte ihn durch heftiges Zerren am Ärmel wieder zur Ruhe bringen.
Immer noch vergnügt wisperte Karl: »Nicht schlecht, nicht schlecht.« Und während er weiter flüsterte, notierte er zum Beweis die Zahlen auf einem Zettel mit. »Also früher hatte jeder Reisende, der mit einem Pferd unterwegs war, mindestens einen Bediensteten, wenn nicht gar zwei in seiner Begleitung, beide auch zu Pferde.« Eine Kutsche aber benötigte nur vier Gäule und könnte sechs Passagiere befördern. Also leisteten vierzig Pferde die Arbeit, die früher von fünfhundert getan werden musste. »Was sage ich? Die Zahl ist noch viel höher, weil ja jeder Bedienstete ebenfalls einen Sattel unter dem Hintern haben musste.« Karl patschte mit der Hand auf die Seite. »Und rechne ich weiter, dann hat die Abnahme an Reitpferden noch Auswirkung auf die ehemals benötigten Stallburschen, Sattler bis hin zu den Bauern, die ihr Heu nicht mehr verkaufen können. Diese Theorie sollten wir weiter überprüfen.«
»Warum?« Friedrich griff nach seinem Buch. Aus dem Augenwinkel nahm er wahr, wie der Herr gegenüber den Platz verließ und hinauseilte, es kümmerte ihn nicht. »Ich halte diesen Schreiber für überspannt und seine These an den Haaren herbeigezogen. Warum sich länger mit ihm aufhalten?«
Der Oberlehrer tippte ihn mit dem Finger an den Oberarm. »Du liest etwas und urteilst gleich, ohne weiter zu prüfen, zu vergleichen und dann erst zu einem gültigen Schluss zu kommen. Das ist nicht wissenschaftlich.«
Eine Ermahnung? Friedrich spürte Ärger aufsteigen. »Dafür verzettele ich mich nicht, gelange recht bald zu einem Resultat.«
»Ach, was bedeutet schon Bauchgefühl im Vergleich zu schlüssigen Beweisen.«
»Du willst mir unterstellen …?« Zu laut, erschreckt schloss Friedrich den Mund, nickte entschuldigend in die Leserrunde.
Mit Wieselschritten kehrte der Herr zurück, die Brille wippte auf dem Nasenhöcker, das Blau der Augen leuchtete heller noch, dazu schnappte der Atem. Betont setzte er sich wieder auf seinen Platz, blätterte feierlich im Buch zur nächsten Seite.