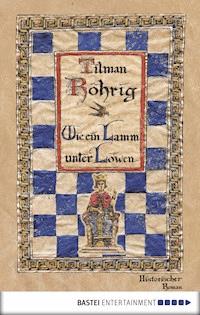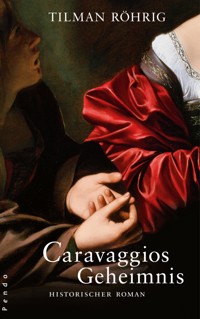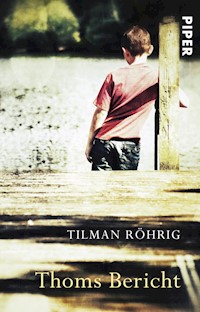7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Wir sind das Salz von Florenz", sagt Lorenzo de' Medici zu seinem Bruder Guiliano, als beide auf der Höhe ihrer Jugend und Macht über den Domplatz gehen und die Huldigung des Volkes entgegennehmen. Aber Girolamo Savonarola, der finstere Prediger von San Marco, ist überzeugt, dass das Heil der Welt in der Abkehr von allem liegt, was Freude bringt.
Nur die junge Laodomia Strozzi lässt sich von ihm nicht täuschen. Trotz Willkür und Glaubenswahn sucht sie mit ihren Freundinnen, der Magd Petruschka und der lebenshungrigen Fioretta, unbeirrt ihren eigenen Weg.
Der prächtige Fürst, der fanatische Mönch und die schöne Patrizierin - durch ihre Augen öffnet sich der Blick auf die dramatische Zeit der Renaissance.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1369
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Erstes Bild – DIE EITELKEIT
Zweites Bild – DIE UNKEUSCHHEIT
Drittes Bild – DER ZORN
Viertes Bild – DER NEID
Fünftes Bild – DER GEIZ
Sechstes Bild – DIE UNMÄSSIGKEIT
Siebtes Bild – DIE TRÄGHEIT DES GLAUBENS
ANHANG
PERSONEN
Karte
TILMAN RÖHRIG
HISTORISCHER ROMAN
Illustrationen von Tina Dreher
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Copyright © 2002/2014 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Helmut W. Pesch
Umschlaggestaltung: Guido Klütsch, Köln,
unter Verwendung eines Ausschnitts aus
»Die Auferweckung des Sohnes des Theophilus«
von Masaccio (1425 /28) und Filippino Lippi (1481 /83),
S.Maria del Carmine, Florenz
Foto: akg-images / Erich Lessing
Illustrationen: Tina Dreher, Alfeld /Leine
E-Book-Produktion: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-0345-2
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Sturzbäche waren in den frühen Morgenstunden über Florenz niedergegangen. Dann, wie auf ein unsichtbares Zeichen hin, hatte der Regen jäh aufgehört. Gewaschen glänzten die Pflasterquader auf der weiten Piazza della Signoria, da und dort spiegelten noch Pfützen. Der Tag roch frisch.
Kaum näherte sich Hufschlag, huschten Ratten unter dem Balkenpodest am Fuß des Galgens vor und flohen hinüber zum Palast, in dessen Kellern sie hausten, dessen Stockwerke und Säle sie bis hinauf zu den Zinnen und dem lohfarbenen, in den Himmel ragenden Turm bei Tag den Regierenden der Stadt überlassen hatten. Eine stille Übereinkunft, an die niemand rührte.
Aus der letzten Gassenschlucht zwischen den Prachthäusern am Nordrand drängte ein Trupp der Stadtwache auf den Platz, trabte an der Richtstätte vorbei, und erst vor der offenen Säulenhalle rechts des Steinkolosses ließ der Hauptmann anhalten. Seine Befehle schlugen von der hohen Loggiawand zurück. »Ordnung will ich!«, schloss er und warnte: »Gebt kein Pardon! Für jeden Zwischenfall ziehe ich euch persönlich zur Verantwortung. Habt ihr mich verstanden?« In Vierergruppen schwärmten die Reiter aus, Brustharnisch und Helm blinkten, die blauen Umhänge bauschten sich, und wenig später war jede Straße, jede Gassenmündung abgeriegelt. Stille.
Als die Domglocke schlug, das Morgengeläut von Santa Croce, von Santa Maria Novella und das anderer nah und weiter entfernter Kirchen herüberklang, sammelten sich mehr und mehr Menschen vor den Reitersperren. Bunte Hauben, Schleier, Hüte und Samtmützen, die Mienen heiter, es wurde gelacht und gescherzt. Einige Hausfrauen trugen mit Tüchern bedeckte Picknickkörbe unter dem Arm. Eine Hinrichtung nahmen die Florentiner ebenso dankbar als Gabe der Mächtigen an wie ein Turnier oder andere Belustigungen. »Hoch lebe Seine Magnifizenz Lorenzo de’ Medici, unser Wohltäter!« Selbst der Frühlingswind schien dem Namen Respekt zu erweisen und vertrieb die letzten Wolkenballen. Sonne und blauer Himmel stimmten mit ein: »Hoch lebe Lorenzo!«
Die Verschwörung in Prato auf den nahen Hügeln nordwestlich der Hauptstadt war zerschlagen, die Rädelsführer und deren Gefolgsleute waren gleich dort geköpft oder gehenkt worden, mehr als vierzig an der Zahl. Nur einen von ihnen hatte der Hohe Rat herbringen lassen, er sollte vor den Augen des Volkes hingerichtet werden: den heimlichen Unruhestiftern zur Abschreckung, den Rechtschaffenen zur Erbauung. Nach seinem Namen fragten die Bürger nicht. Warum auch? Lorenzo, der neue Herr des mächtigen Bankhauses, hatte bereits wenige Monate nach dem Tod des Vaters bewiesen, dass er sich tatkräftig um das Wohl von Stadt und Republik kümmerte. Dies allein zählte; und die Hinrichtung heute sollte ein Zeichen sein, wie eng die Medici nach wie vor mit der Signoria, dem Kollegium der höchsten Staatsmänner von Florenz, verbunden waren.
Die Wachen lenkten ihre Pferde zur Seite, und einzeln durften die Bürger passieren und sich im Halbrund um den Galgen die besten Plätze sichern, nur Frauen, Männer und Familien mit ihren sittsam gekleideten Söhnen und Töchtern. Die zerlumpten Halbwüchsigen wurden zurückgehalten. »Ihr wartet!«
Empörte Rufe, Flüche, die jungen Kerle drohten den Wachen, schwangen ihre mitgeführten schweren Leinenbeutel, vergeblich, an den gesenkten Speerspitzen gab es kein Vorbei. Jäh ließen einige der Älteren kleine Holzrasseln ums Handgelenk wirbeln, andere setzten Stummelflöten an die Lippen. Schnarren und schrilles Pfeifen teilte die Horden vor den Sperren. »Sammeln!« Durch enge Brandgassen zwischen den Häusern hetzten die Jungen und vereinigten sich in zwei Straßen. Die Schnarrer versuchten von der Via Calzaioli, die Pfeifer gegenüber von der Via Condoni die Sperren zu durchbrechen. Ohne Vorwarnung ritten je zwei der Wachen gegen sie an. Da wie dort trafen Hufe die Anführer. Ins Schnarren und Pfeifen mischte sich das Geheul der Verletzten. »Ihr wartet!«, schrien die Berittenen. »Gebt Ruhe! Wartet, bis unsere Herren ihre Plätze eingenommen haben! Gebt Ruhe!« Im Lärm verhallten die Befehle, doch keine Meute wagte erneut einen Angriff.
Selbst mit roher Gewalt war den herumstreunenden Jungen der Stadt kaum beizukommen, meist Söhne der Lohndiener und Arbeiter in den Tuchfabriken. Sie hatten sich zu Banden zusammengerottet; an den Grenzen ihrer Bezirke bekämpften sie sich gegenseitig, stahlen in Kirchen, plünderten Warenlager und bedrohten Geschäftsleute; sie führten ihr eigenes Leben auf der Straße. Die Brigata war ihr wahres Zuhause. Sie kannten jeden Winkel der Stadt, jedes Hurenhaus, jede verschwiegene Taverne der Spieler; sie wussten, wo in der Dämmerung die ehrbaren Handwerker, Vornehmen und Mönche der Stadt schlenderten, um sich einen Knaben zu kaufen. Möglichst jung musste das gesuchte Wild sein, eifrig die Zunge und weich das Fleisch. So unterwies ein Sechzehnjähriger auch den neunjährigen Bruder und dessen Freund, wurde ihr Beschützer und bot sie der lüsternen Kundschaft neben dem eigenen Körper als zusätzliche Köstlichkeit an. Im Schatten eines Torbogens oder hinter einem Treppenaufgang war die Lust für die Herren schnell und billig zu befriedigen. Den Lohn teilten die Kleinen dann mit ihrem Beschützer. Oft genug aber mussten alle drei den Verdienst daheim abliefern, damit genügend Brot und Fisch für die Familie auf den Tisch kam.
Die Menschentrauben an den Reitersperren waren spärlicher geworden. Jetzt wogte ein unruhiges buntes Meer auf der Piazza, schwappte bis ans Podest der Richtstätte. Streng hatte der Hauptmann für freies Sichtfeld zwischen Säulenhalle und Galgen gesorgt.
Stadtmusikanten verließen im Gleichschritt den Palast und säumten farbenprächtig die Terrasse vor dem Portal und die Stufen der Freitreppe. Ihr Erscheinen dämpfte das ausgelassene Geschwätz auf dem Platz. Umso deutlicher war der Lärm zu hören, den Schnarrer und Pfeifer verursachten. Kaum jemand aber nahm Anstoß; diese Banden waren ein Übel, mit dem sich die Florentiner abgefunden hatten.
Ein Signal der Wachen drüben von der Nordseite! Sofort straffte der Hauptmann nahe der Säulenloggia den Rücken. Sein Handzeichen galt den Spielleuten. Fanfarenstöße und Trommelwirbel! Alle Köpfe wandten sich zur schmalen Einmündung der Via dei Cerchi, ohne Befehl wich das Volk auseinander, gab eine Gasse frei, und dort kam er, Lorenzo, große federnde Schritte, gefolgt von seinem jüngeren Bruder Giuliano und einigen Künstlern und Gelehrten aus dem engsten Freundeskreis. »Hoch!« – »Dank sei Lorenzo!« Hände streckten sich ihm entgegen. »Gott schütze Euch!«
Das einundzwanzigjährige Oberhaupt der mächtigen Medici-Familie nickte lächelnd nach rechts und links, dabei verschlang seine Unterlippe beinah ganz die zu schmale obere Lippe und vertiefte die scharfen Falten um die Mundwinkel. Gelb und fleckig spannte sich die Haut über hohen Wangenknochen; von der aufgestülpten, platten Nasenspitze wuchs ein klobiger Rücken bis zwischen die weit auseinander stehenden braunen Augen. Unter der Samtkappe quoll schwarzes Haar vor, sorgfältig in der Mitte gescheitelt, und zwei gekämmte Strähnenvorhänge fielen bis zum Stirnwulst über den Brauen. Das schwarze, lange Gewand war hoch geschlossen und ließ am Hals nur einen weißen Stegrand seines Hemdes erkennen. Schön war Lorenzo nicht. Selbst das Lächeln half ihm heute wenig, den Anblick zu mildern, denn sein Bruder Giuliano schritt hinter ihm, farbenfroh gekleidet; trotz der übernächtigten, blassen Miene strahlte der Siebzehnjährige jungenhaften Charme und Eleganz aus. Er zog die schwärmerischen Blicke der Damen und Mädchen auf sich und nahm sie mit, auch den Gelehrten und Künstlern wurde keine Beachtung geschenkt.
»He, Giulio.«
Bei dem verhaltenen Ruf wandte der junge Medici den Kopf nach links, sein Blick suchte in der vordersten Reihe der Wartenden.
»Hier bin ich.« Wenige Schritte vor ihm hob eine Frau die Hand, unter dem bis weit in die Stirn gezogenen, nachtblauen Kopftuch brannten dunkle Augen, die vollen Lippen waren halb geöffnet. Kaum hatte Giuliano sie entdeckt, schmunzelte er kurz und blickte wieder geradeaus. Als er auf ihrer Höhe war, forderte sie mit verhaltener Stimme: »Sei jetzt kein Feigling, du hast es versprochen.«
Besorgt sah er auf den breiten Rücken seines Bruders, seufzte und schnippte die Finger. »Also gut, Fioretta«, raunte er, »aber bleib dicht hinter mir.« Schnell trat die Frau vor und reihte sich ein. Über die Schulter bat der junge Medici: »Sandro, nimm sie an deine Seite, bitte. Sie gehört zu dir, wenn Lorenzo fragt.«
»Was meinst du?« Sandro Botticelli rieb die Speckfalte unter dem Kinn, aus grauen Augen starrte er verwundert auf die Gestalt, deren geschlossener Umhang die Brüste und Rundungen nur erahnen ließ. »Ich kenn sie doch gar nicht.«
Sein Nachbar, der schmächtige Luigi Pulci, rümpfte die Nase. »Streng deinen Kopf nicht an, Sandro«, und setzte hinzu: »Das überlasse anderen, mein Fässchen. Gehorche einfach.« Damit ließ er Platz und zog die Schöne zwischen sich und den schwergewichtigen Maler.
Sobald die Gruppe aus der Menschenmenge herausgetreten war, salutierte der Hauptmann und geleitete sie weiter bis zur Säulenhalle. Vor der untersten Stufe wandte sich Lorenzo um, er grüßte mit erhobener Hand die Florentiner, dabei fiel sein Blick auf die Fremde. Eine steile Falte wuchs von der Nasenwurzel in die Stirn, doch er sagte nichts. Erst als die Herren in den Schatten getreten waren und sich anschickten, zwischen den hohen Säulen ihre Plätze zu suchen, tippte Lorenzo dem Maler auf die Schulter. »Lieber Freund, ich wusste gar nicht, dass dir die Damen nachlaufen.«
»Denke nicht falsch von mir.«
»Wer ist diese Person? Als wir losgingen, habe ich sie nicht gesehen.«
Sofort deckten Giuliano und Luigi die Frau ab. Botticelli blies die Lippen. »Tja, also …«, mehr wusste er nicht zu antworten. Neben ihm lachte Luigi leise. »Ein Modell für sein nächstes Bild. Trotz aller Verbote der Sittenwächter will er sie nackt darstellen. Eine dringende Auftragsarbeit.«
Hastig pflichtete ihm Giuliano bei. »Unser Sandro ist so verträumt, dass er sogar den Namen vergessen hat.«
Lorenzo sah den Bruder scharf an. »Ich verstehe. Du schon wieder.« Er senkte die Stimme. »Bei Gott, Giulio, gib Acht auf deinen Umgang. Die letzte Nacht steht dir noch im Gesicht. Wie kommst du dazu, diese Hure mitzubringen?«
»Fioretta ist keine Hure. Sie ist die Gemahlin von …«
»Schweig. Ich will den Namen der Familie nicht wissen. Warum hast du sie hierher eingeladen?«
Giuliano hielt dem Blick stand. »Ich habe es ihr versprochen. Es soll eine Probe sein.«
»Was redest du da?«
Entwaffnend lächelte der Jüngere und schob sich dicht an den Bruder. »Nun, sie behauptet, beim Zusehen einer Hinrichtung besondere Lustgefühle zu erleben. Falls du verstehst … Und davon muss sie mich überzeugen. Bei mir ist es reine Wissbegierde.«
»Unfasslich. Wieso wirst du nicht rot vor Scham?« Für einen Augenblick zuckten die Mundwinkel. Gleich wieder ernst, sagte Lorenzo: »Halte sie möglichst im Hintergrund. Ein Skandal ist das Letzte, was wir uns an diesem Tag leisten können.« Im Weggehen warf er noch einen Blick auf die Frau, schüttelte den Kopf und nahm neben seinem engsten Freund Angelo Poliziano, der ihn an Hässlichkeit noch übertraf, und seinem tüchtigen Berater Soderini unter dem mittleren Säulenbogen Aufstellung.
Ein Wink des Hauptmanns zu den breiten, sich gegenüberliegenden Straßenmündungen. Gleichzeitig wurden die Sperren aufgehoben, und flankiert von den Reitern stürmten die Banden auf den Platz. Wie Wespennester scharten sie sich hinter der Volksmenge zusammen, setzten ihre Leinenbeutel ab, die Kleineren kletterten auf die Schultern der Größeren. Kein Geschrei, kein Schnarren und Pfeifen mehr, ihre Zeit würde kommen, das wussten sie und schwiegen.
Nach einem Trommelwirbel traten nun die neun Mitglieder des Hohen Rates aus dem Palast und blieben nach wenigen Schritten auf der Veranda stehen. Wieder wirbelten die Trommelstöcke.
Der Beichtvater schritt voran. Am Strick zerrten zwei Blutsknechte den Verschwörer hinaus; er schrie und fluchte, drohte mit der Faust zu den Vornehmen in der Säulenloggia. »Lorenzo! Du Ausbeuter!«
Neben ihm ging der Scharfrichter, gleichmütig, die Arme vor der Brust verschränkt. Den Schluss bildeten zwei Richter.
»Tyrann! Blutsauger!«
Ein harter, blitzschneller Hieb ließ den Gefangenen straucheln und zu Boden stürzen, sein kurzes Hemd verrutschte nach oben und entblößte ihn bis zum Nabel. Als wäre nichts geschehen, verschränkte der Henker wieder die Arme. Das »Ah!« und »Bravo!« der Menge nahm er ohne Regung hin. Seine Knechte rissen den Mann wieder hoch. Er schwieg jetzt und taumelte willenlos zur Galgenstätte.
»Ist dieser Mann nach Gesetz und Recht verurteilt?«, wandte sich der Henker an einen der Richter. Die vorgeschriebene Frage- und Antwortzeremonie war rasch beendet. Tod durch den Strick wegen Aufruhrs und Verschwörung gegen die Republik Florenz.
Während der Priester dem Weinenden noch letzten kirchlichen Trost spendete, blickte sich Giuliano in der Säulenloggia nach seiner Gespielin um. Fioretta trat einen Schritt vor, der Busen drückte sich gegen seinen Rücken. Leicht fasste sie die rechte Hand des Medici und führte die Finger durch den Schlitz des Umhangs und weiter durch eine Falte ihres Kleides. Kaum ertastete Giuliano das gekräuselte Haar, flackerte ein Leuchten in seinen Augen, doch er zwang es sofort nieder, die Miene wurde starr und ernst, so wie es der Augenblick vom Bruder des mächtigsten Herrn der Stadt verlangte.
Auf dem Balkenpodest lehnten die Knechte zwei Leitern an den Galgenbaum und übergaben ihrem Meister den Halsstrick. Der Henker erklomm einige Sprossen. Doch sein Kunde weigerte sich, ihm auf der anderen Leiter zu folgen. Geübt schlang der Scharfrichter das Seilende ums Handgelenk und zog, während die Knechte mit kleinen Messerstichen ins Gesäß des Verurteilten nachhalfen. Schreiend und heulend kletterte er jetzt hinauf. Als er die halbe Höhe erklommen hatte, verdrehten die Gaffer in der vordersten Reihe den Kopf. Jeder wollte möglichst früh einen Blick unter das Hemd werfen.
»Wie sieht er aus?«, fragten Neugierige von hinten. »Nun sagt schon.«
»Noch hängt er schlaff!«, kam die Antwort. Gleich setzte eine Frau genüsslich hinzu: »Er lässt Wasser ab.« Urin floss die nackten Beine herunter und troff von den Leiterholmen. Da ging ein Raunen durch die Menge, das Schauspiel nahm einen guten Verlauf.
Sobald der Henker unter dem Galgenarm die Schlinge um den Hals seines Kunden knüpfte, brandeten Spott und Hohn für den Verurteilten hinauf.
In der Säulenloggia sah Lorenzo mit den Vornehmen zu, keine Miene regte sich. Giuliano spürte im Nacken den Hauch kurzer Atemstöße; und tiefer wühlten sich seine Fingerkuppen.
Der Scharfrichter stieß den Mann von der Sprosse. Ein Ruck fing den Fall auf. Weil aber die Schlinge zur Freude der Gaffer nicht fest genug saß, zappelte der Körper heftig, und der nackte Unterleib baumelte über ihnen hin und her. Das Johlen der Menge nahm zu, während sich der Darm entleerte und das Geschlechtsteil sich im Todeskampf versteifte. Endlich hörte das Zucken auf, die Augen waren dem Mann vorgequollen, seine Zunge hing blau und lang heraus wie ein letzter, verächtlicher Gruß an die Lebenden von Florenz.
Giuliano vernahm hinter sich unterdrücktes Keuchen, spürte das Beben und fühlte, wie Wärme seine Fingerkuppen nässte. Unmerklich wandte er den Kopf und flüsterte: »Erstaunlich, cara mia. Du hast Wort gehalten.« Halblaut setzte er hinzu: »Ich bewundere deine Fähigkeiten.«
Neben ihm runzelte Botticelli die Brauen. »Sehr freundlich, mein Freund. Aber vielleicht ersparst du mir in Zukunft solche Peinlichkeit.«
Gleich ging Giuliano darauf ein. »Es soll nicht wieder vorkommen.« Verstohlen zog er seine Rechte aus den Kleidern der Schönen. »Mehr noch, Sandro, du hast mir einen Gefallen getan, und ein Medici vergisst dies nicht, das weißt du. Vielleicht erhältst du von meinem Bruder schon bald einen neuen Auftrag. In unserm Palast gibt es noch viele Wände, die auf Gemälde von der Hand eines Meisters warten, wie du es bist. Götter und Göttinnen …«
Diese Aussicht beschäftigte den Maler sofort: »Pallas Athene. Ja, ich sehe sie vor mir. Sie steht auf einem brennenden Schild.«
»Wunderbar, Sandro. Sogar mit wenigen Worten zauberst du ein Bild in mir.«
»Lebensgroß werde ich sie malen …«
Giuliano überließ Botticelli seinen Plänen, denn unter dem mittleren Arkadenbogen löste sich Lorenzo aus der Reihe der Edlen und gab den Freunden einen Wink, ihm zu folgen. Der offizielle Teil des Hinrichtungs-Schauspiels war beendet. Ein letztes Mal erklangen Fanfarenstöße, wirbelten die Trommelstöcke.
Gelassen näherte sich Lorenzo nur wenige Schritte dem Palast. Dann blieb er stehen. Diese Geste war Befehl. Die Ratsherren auf der Terrasse vor dem Portal rafften ihre Roben und eilten über die Freitreppe zu ihm. Den Moment nutzte der junge Medici. Geschickt hatte er es eingerichtet, hinter Botticelli als Letzter mit seiner Gespielin noch im Schatten der Säulen zu bleiben. »Du musst dich jetzt entfernen, cara mia. Möglichst unauffällig.«
Fioretta hob den Kopf nur so weit, dass er ihre Augen sah. »Na, hat es dir gefallen?«
»Mehr als das.« Giuliano fächerte sich den Duft seiner rechten Hand zu. »Solange dein Gatte auf Reisen ist, will ich noch viel mehr davon. Warte heute Abend auf mich. Den Zeitpunkt wird dir der Diener ausrichten.« Damit folgte er dem Maler ins Freie; rasch holte er ihn ein, und gemeinsam gesellten sie sich zur Gruppe der Vornehmen.
Sie lachte dunkel und zog den Schleier tiefer in die Stirn. »Ich geb dich nicht mehr her, Giulio«, flüsterte sie. »Mit immer neuen Spielen werde ich dich zu mir locken.«
Das Volk hatte inzwischen auch den freien Raum zwischen Loggia und Richtstätte belagert, und niemand schenkte Fioretta Beachtung, als sie entlang der Säulenhalle in Richtung Neuer Markt davonschlenderte. Alle Augen blickten erwartungsvoll zum Galgen. Noch stand der Scharfrichter oben auf der Leiter, noch hing unter ihm reglos der Verurteilte.
Schnarren und Pfeifen!
Überhastet wichen die Florentiner zur Seite, und durch eine breite Schneise stürmten die Banden in Richtung Galgen. Zu spät, nur der Form halber brüllte der Hauptmann seine Befehle, und den Stadtreitern war es unmöglich, die Horden aufzuhalten; sie wollten es auch nicht. Was nun folgte, war kein Zwischenfall, der später von ihrem Vorgesetzten geahndet würde. Jetzt begann der zweite Teil des Schauspiels, und wehe dem, der wagte, ihn zu verhindern!
Noch im Lauf öffneten die Kerle ihre Leinenbeutel. Als sie das gezimmerte Podest erreichten, hatten sie Steine in den Fäusten. »Henker! Schneid ihn ab!« – »Gib ihn uns!« In wildem Tanz vereinten sich die Banden, jede Feindschaft untereinander war vergessen, die zottigen Haare flogen, und Gier ließ die verdreckten Gesichter aufleuchten. »Runter mit ihm! Gib ihn her!« Mit dem Rhythmus der Schreie drehte sich der Ring gefährlich langsam um die Richtstätte. »Schneid ihn ab!« Zu lange widerstand der Henker. Die Meute löste den Kreis auf und scharte sich an einer der Ecken des Balkenpodests zusammen. Der erste Stein, er traf den Bauch des Gehenkten. Jetzt rissen alle Halbwüchsigen die Arme zurück, und ein Kieselhagel gegen den Galgen setzte ein. Fluchtartig brachten sich die Gaffer auf der gegenüberliegenden Seite in Sicherheit, gaben Raum, um nicht von herunterschlagenden Geschossen getroffen zu werden. »Schneid ihn ab! Henker!« Eine Weile noch zielten die Halbwüchsigen genau, wenn ein Stein gegen den Kopf des Leichnams schlug, dann johlten sie und johlten lauter, als mehr und mehr Rufe aus der Menge sie anfeuerten, doch schließlich verloren sie die Geduld. Nun richteten sie ihre Geschosse auch auf den Scharfrichter. Getroffen an Rücken und Beinen, fügte er sich der Gewalt. »Wartet! Ihr sollt ihn haben!« Zum Beweis zückte er den langen Dolch. Sofort brach das Schreien und Toben unter ihm ab. Auch der Pöbel hielt den Atem an. In der Stille glaubte jeder das Schaben der Klinge zu hören.
Der Henker wusste seinen Part gut zu spielen. So langsam wie möglich zertrennte er den Strang direkt unter dem Galgenarm. Die letzte Faser hingegen überließ er dem Gewicht seines Kunden. Ein Windstoß oder eine Berührung würden nun ausreichen. Hastig nutzte er das gespannte Warten, glitt an den Leiterholmen hinunter, und ohne Halt zog er mit seinen Knechten in Richtung Stadtgefängnis davon.
Wann riss der Strick? Die Ungewissheit wurde zur Lust. Fahrig nahmen Hausfrauen die Tücher von den Picknickkörben, verteilten Brot und Würste an Mann und Kind, einige Familien ließen sich auf den sonnenwarmen Pflasterquadern nieder, und während sich die Mäuler füllten, blieben alle Blicke unverwandt bei dem Gehenkten.
Wie hungrige Hunde hechelten Schnarrer und Pfeifer nach oben. Zum Vergnügen der Umstehenden bliesen die Kleineren von ihnen vereint hinauf, allein der Erfolg blieb aus. Da sprang einer der Anführer aufs Podest, schwang seinen noch halb gefüllten Steinbeutel und schleuderte ihn hoch. Er traf den Unterleib. Der Strick riss. Der Gehängte stürzte hinunter. Ein Aufschrei ging durch die Zuschauer. In sinnloser Wut fielen die Halbwüchsigen über ihr Opfer her, zerschlugen das Gesicht, brachen die Knochen und trampelten auf dem Körper herum. Als der erste Rausch sich legte, packten zwei Anführer das Strickende und schleiften den Zerschundenen hinter sich her über den Platz zur Via Calimala. Johlend umringten sie die Brigatas. Am Ufer des Arno, nahe dem Ponte Vecchio, würde das rohe Spiel weitergehen.
Ohne Notiz vom Geschehen drüben auf der Platzmitte zu nehmen, hatte Lorenzo noch einmal den Dank der Signoria über sich ergehen lassen. Sein hartes, schnelles Durchgreifen gegen die Rebellion fand einhellige Anerkennung. Damit war im Frühjahr des Jahres 1470 die erste Probe seiner Verbundenheit mit den gewählten Regierenden bestanden.
Er, Lorenzo de’ Medici, auch wenn er keinen anderen Titel trug als Gonfaloniere, Bannerträger der Gerechtigkeit, galt nun als Oberhaupt der Republik Florenz. In nächster Zukunft würde er unverzüglich mit jedweder militärischen Unterstützung rechnen können, wenn es galt, gegen Feinde von Stadt und Land anzugehen, und nicht zuletzt auch, wenn Neider und Verschwörer seine Familie oder das Bankimperium bedrohten. Dies wollte er mit dem heutigen Tag erreichen, und es war gelungen. »Ich bin nur ein Diener unter den Dienern unseres geliebten Florenz«, beendete Seine Magnifizenz die Unterredung vor dem Palast. »Der Dank für die rasche Beendigung des Aufstands gebührt Euch allen.«
Zufrieden strebten die Ratsherren zum Steinkoloss der Macht hinüber, dessen Glockenturm dem Himmelsblau trotzte. Lorenzo wartete, bis sie die Freitreppe erstiegen, dann erst löste sich seine Miene. Mit der Fingerkuppe rieb er leicht über die platte Spitze seiner Nase. »Nach solch einem Auftritt sehnt es mich nach geistiger Erbauung.« Heiter wandte er sich an seinen Freund Poliziano. »Was meinst du, Angelo? Wir sollten uns am Abend mit den Brüdern des Zirkels treffen, in meinem Studio zusammen speisen und uns bei gutem Wein mit dem Denken der antiken Philosophen beschäftigen. Auch Gäste sind mir heute willkommen.«
Der Dichter hob die Achseln. »Das nächste Treffen der Plato-Akademie ist erst für nächste Woche anberaumt. Abgesehen von den hier Anwesenden weiß ich nicht, wie viele Mitglieder ich so schnell benachrichtigen kann. Ich fürchte, einige werden den Abend bereits anderweitig …«
Ein kühles Lächeln unterbrach ihn. »Sag ihnen, es sei mein Wunsch. Luigi wird dich unterstützen.« Lorenzo nickte dem graubärtigen Gelehrten Marsilio Ficino zu. »Und du, werter Freund, wirst uns ein Thema zur Diskussion stellen. Ich freue mich.« Sein Ton erlaubte keinen Widerspruch mehr.
Mit einem Mal nahm Lorenzo das kurzatmige Schnaufen des Malers neben sich wahr und lachte: »Nein, nein, fürchte nichts, Sandro. Du bist als Gast entschuldigt. Ich möchte deine Fantasie nicht durch klare, nüchterne Gedanken lähmen. Da fällt mir ein, wo ist überhaupt deine neue Errungenschaft, das Nacktmodell?«
»Spottet nicht, Magnifizenz.«
»Schon gut. Wie dumm von mir.«
Um das ausgelassene Gewühle auf dem Platz nicht zu stören, führte der Medici mit leicht federndem Gang die Gruppe dicht an der Säulenhalle entlang. Kaum hatten sie in einem weiten Bogen wieder die Via dei Cerchi erreicht, legte er seinem Bruder den Arm um die Schulter. »Na, was ist mit dir heute Abend? Ein wenig Bildung würde deine Anziehungskraft noch heben.«
»Danke, sie genügt mir bereits«, wehrte Giuliano schnell ab, »und anderen auch. Um allen Angeboten gerecht zu werden, müsste ich mich jetzt schon mehrmals teilen können. Außerdem ziehe ich die praktische Übung der trockenen Disputation vor. Der Frühling ist da. Also entschuldige mich heute Abend bei deinen Grüblern.«
Lorenzo stieß ihm spielerisch in die Seite. »Vielleicht meint es die Natur gut mit uns. Du liebst das Vergnügen, und es sei dir von Herzen gegönnt. Ich hingegen empfinde mehr Lust an der Verantwortung.«
»He, Bruder, nicht so bescheiden. So rein und unschuldig, wie du vorgibst, bist du nun auch nicht. Gerade frisch verheiratet, und doch hängt dein Rock nicht nur in einem Schlafgemach …«
»Schweig.« Lorenzo gab den Bruder frei. Vertraut gingen sie nebeneinander her, zwei Brüder, beide von ähnlich kräftiger Statur, die bei den Turnieren und Spielen in der Stadt erfolgreich mit stritten, und was der jüngere an Liebenswürdigkeit und schönem Äußeren bot, ersetzte der andere durch scharfen Verstand und Entschlossenheit.
Längst hatten sie den Domplatz hinter sich gelassen, als Lorenzo unvermittelt die Hand des Bruders drückte: »Wir Medici sind das Salz von Florenz. Wer weiß, wie lange noch. Eins aber ist gewiss, zwischen uns wird es keinen Zank um Macht und Geschäfte geben, und dafür liebe ich dich.«
Einige Tagesreisen von Florenz in Richtung Norden führte die Straße an Bologna vorbei. Längst gab es keine Hügel mehr, und bald schon verlor sich der Blick unter der sommerlichen Dunsthaube der Po-Ebene in Feldern, Wiesen und ausgedehnten Wäldern, bis er endlich die Mauern und Türme der wohlhabenden Stadt Ferrara erreicht hatte. Beherrscht wurde die Stadtmitte vom trutzigen Kastell des Herzogs d’Este; tiefe Wassergräben schützten den Fürstenbau selbst vor den eigenen Bürgern.
Unweit der Universität, im Patrizierhaus des Roberto Strozzi, stand Laodomia hinter der Mutter. Aus Vorsicht hatte sie die Beine verschränkt und schabte mit dem linken Stoffschuh die rechte Wade. Ihr waren die täglichen Unterweisungen langweilig, den Vorratskeller aber hasste sie. In diesem düsteren Gewölbe nahm ihr das Gemisch aus Gerüchen nach Öl, Käse und Schinken, nach Fisch und Butter fast den Atem. Mehr aber noch fürchtete sie die Mäuse; wenn nun eins dieser lautlosen Biester ihr plötzlich ans Knie sprang und die Schenkel hinaufgekrabbelt kam …?
»Vor allem achte auf stets gefüllte Regale, mein Kind. Auch genügend Honig und Töpfe mit Früchtemus sollen vorhanden sein. Männer lieben …«
»Ja, Mutter, ja. Das sagst du mir jede Woche. Seit Monaten schon. Ich bin doch nicht blöde, verdammt!«
Der Kopf fuhr herum, Signora Strozzi hob die Laterne und leuchtete ins zornige Gesicht des Mädchens. »Untersteh dich. Keine Gassensprache mehr. Die unbeschwerte Zeit mit deinen Brüdern ist endgültig für dich vorbei. Und außerdem gewöhne dir diesen Ton ab. Wenn du einmal verheiratet bist, wird er dir nur Schwierigkeiten bereiten.«
»Wenn, wenn.« Laodomia krauste die Nase. »Jetzt bin ich schon vierzehn, und Ihr habt noch nicht einmal angefangen, nach einem Bräutigam für mich zu suchen.«
»Du bist eben nur deines Vaters Tochter, schlimm genug. Trotz der Schmach habe ich dich angenommen und liebe dich wie mein eigenes Kind. Dennoch ist es schwierig, hier in Ferrara für dich eine lohnende Partie zu finden. Aber Geduld. Wir haben Pläne für dich. Gute Pläne. Eins darf ich dir schon verraten: Ein Brief nach Florenz ist unterwegs.«
Die grünen Augen unter den sanft geschwungenen Brauen glitzerten auf. »Florenz? Tante Alessandra?« Stürmisch fasste Laodomia die Hand ihrer Mutter. »Ist das wahr?« Heftig schwankte die Laterne hin und her, Laodomia versuchte ein Unglück zu verhindern, griff zu und verbrannte sich die Finger an den heißen Stäben. Vor Schreck stieß das Mädchen hart gegen die Lampe, sie entglitt Signora Strozzi, fiel zu Boden und erlosch.
»Ungeschicktes Balg!« Dank der Finsternis streifte der Schlag nur das Ohr. »Wie sollst du später deine Mägde anlernen, wenn du selbst ein Trampel bist?«
»Verzeih, Mutter«, stammelte Laodomia. »Ich wollte nicht … es war nur. Weil ich mich gefreut habe. Es tut mir Leid.«
»Schon gut.« Die Hausherrin hatte sich wieder gefasst. »Dieses Temperament hast du in keinem Fall von deinem Vater. Für heute brechen wir den Unterricht in der Haushaltsführung ab. Geh voraus. Aber hüte dich, noch etwas umzustoßen.«
Mit Blick auf die helle Öffnung der Gewölbetür gewöhnten sich Laodomias Augen etwas an die Dunkelheit, und behutsam schlängelte sie sich zwischen Pökelfässern und Getreidetonnen hindurch. Schließlich unbeschadet wieder draußen, bestimmte Signora Strozzi am Fuß der Kellertreppe: »Geh in deine Kammer, und kleide dich um. Dort wartest du. Sobald die Tanzlehrerin eintrifft, wirst du gerufen. Vorher will ich dich nicht mehr im Hause sehen.«
»Danke, Mutter.«
Laodomia nahm gleich zwei Stufen auf einmal. Gleich folgte ihr die Ermahnung, »Geh gesittet, Mädchen«, und langsamer erstieg sie das kühle Treppenhaus. Erst auf der Höhe des vierten Stockwerks, als die Wärme von draußen mehr und mehr zu spüren war, glaubte sich Laodomia vor dem strengen Blick in Sicherheit und hastete die enge Holzstiege ins Dachgeschoss hinauf. Mit einem Knall warf sie die Kammertür hinter sich zu.
»Florenz!« Durch die Querspalten der Klappläden vor dem geschlossenen Fenster drang streifig Sonnenlicht ins Zimmer. Laodomia riss das gewickelte Tuch vom Kopf, löste ihr hochgebundenes Haar und schüttelte es, bis die schwarzen Locken ihr weich um Hals und Schultern fielen. »Weg aus Ferrara!« Sie ließ sich rücklings aufs Bett fallen und strampelte mit den Beinen in der Luft. Endlich, jubelte ihr Herz, weg aus der Enge und hinein ins schöne Leben!
Seit ihr der Busen wuchs, die Hüften sich leicht rundeten und monatlich für einige Tage eine lästige Tuchbinde vonnöten war, hatte sich der Alltag zum Schlechten verändert. Kein gemeinsames Lernen in der Schule mehr, keine ausgelassenen Spiele mehr mit den Brüdern auf der Straße oder mit Freundinnen im Garten. Wie jede heiratsfähige Tochter einer vornehmen Familie durfte Laodomia das Haus nicht mehr verlassen, höchstens noch mit den Eltern zum Kirchgang oder wenn der Besuch bei Verwandten auf dem Lande angesagt war, und dies auch nur eingehüllt in viel Stoff und mit einem Schleier vor dem Gesicht. Wie ein kostbares Gut wurden die jungen Frauen vor neugierigen Blicken der Brautvermittler versteckt. Diese Heimlichkeit half den Wert einer Tochter zu steigern.
In der ersten Woche hatte Laodomia gewagt, sich dagegen aufzulehnen, doch hart war sie von der Mutter zurechtgewiesen worden: »Füge dich! Du bist ein Mädchen. Gleich nach deiner Geburt musste der Vater sparen, um eine Mitgift für dich zurückzulegen, und das zu einer Zeit, in der die Geschäfte noch schlechter gingen als heute. Auch deine Aufzucht und die Ausbildung kosteten. Jetzt, da du reif bist, naht der Moment, wo der hohe Einsatz sich lohnen könnte. Und dies nur, wenn es gelingt, dir einen Bräutigam zu verschaffen, der aus einer wohlhabenden und vor allem einflussreichen Familie stammt.«
Laodomia war in Tränen ausgebrochen. »Aber ich bin doch kein Zuchtkalb, das zum Kauf angeboten wird.«
»So darfst du dich nicht sehen«, hatte die Mutter versucht abzumildern und erklärt: »Ein Sohn hält den Wohlstand in der Familie, eine Tochter aber trägt ein Teil des Erbes aus dem Haus. Als Entschädigung muss deshalb ihre Heirat neue Verbindungen fürs Geschäft und den beruflichen Aufstieg der Brüder knüpfen. So einfach ist das.« Weil die Tränen noch nicht versiegt waren, hatte Signora Strozzi hinzugesetzt: »Bei mir war es damals ebenso, und deinen Freundinnen ergeht es nicht besser. Sei froh, dass dich die Natur recht ansehnlich ausgestattet hat und überdies dein Vater sogar in der Lage ist, dir neben der Mitgift noch etwas Geld und Aussteuer mitzugeben.« Der Finger war hochgeschnellt. »Denn bleibst du ohne Mann, so musst du ins Kloster, oder du wirst bis zu deinem Tode in unserm Haus eine Magd unter Mägden sein. Willst du das?«
Laodomia hatte nur den Kopf schütteln können.
»Also, füge dich. Wir wollen dein Bestes.«
Das war vor einem Jahr gewesen, seitdem hatte Laodomia ihr Leben eingerichtet. Unten im Haus lernte sie spinnen und nähen, nach und nach jede Arbeit in der Küche, bald wusste sie, wie Vorräte versorgt werden mussten, und sie erlernte durch Tanz und Gesang wie auch durch artiges Plaudern über Malerei und Gedichte die Kunst zu gefallen.
Hier oben in ihrer spärlich ausgestatteten Kammer – da war ein Bett; unter dem Hocker befanden sich Waschschüssel und Kanne; der Nachttopf stand bei Tag hinter der Kleidertruhe; und an der Wand zum Flur hing neben dem Bild des Erzengels Raphael ihr schmaler hoher Silberspiegel, beides ein Geburtstagsgeschenk des Vaters; mehr gab es nicht –, hier oben träumte Laodomia ihr freies Leben herbei: ein großes Haus, nein, ein Palazzo, umgeben von Gärten; schöne Kleider und Feste; auch Kinder, und jedes musste eine eigene Amme haben. Das einzige Tor aus der Enge hinaus hieß Heirat. Und nun sollte in Florenz vielleicht der Schlüssel auf sie warten.
Laodomia setzte sich auf. Sie lächelte und nagte an der Unterlippe. Abgesehen von ihren Träumen hatte sie sich noch eine leicht erfüllbare Abwechslung geschaffen; sooft sie wollte, vertrieb ihr dieses Spiel seit Monaten die Zeit.
In wenigen Schritten stand sie am Fenster und spähte durch die Rippen des Klappladens auf das Nachbargebäude. Unten durch eine enge Gasse getrennt, lehnten das Haus der Strozzis und das der Savonarolas mit den oberen Stockwerken fast aneinander. Zum Greifen nah war drüben das geöffnete Fenster. Und dort im Zimmer sah sie das rote Haar. Halb abgewandt von ihr stand Girolamo über sein Lesepult gebeugt.
Laodomia kicherte leise. Mit dieser riesigen, grässlich knochigen Nase kann er bestimmt die Buchseiten umblättern. Gleich übertrumpfte sie das Bild. Und wenn er die Spitze in Tinte taucht, kann er auch damit schreiben, und wenn’s falsch ist, dann wischt er mit seinen dicken Lippen das Wort wieder weg. Ganz praktisch, überlegte sie, um zu studieren, braucht er seine Hände nicht. Die kann er für was anderes nutzen. Mal sehen, wie schnell ich ihn heute dazu bringe. Sie öffnete ihr Fenster und drückte langsam die Flügel der Schlagläden nur so weit auseinander, dass die Sicht von anderen Fenstern des Nachbarhauses in ihr Zimmer versperrt blieb. Heiß strömte der Atem des Sommers herein.
Noch hatte der Medizinstudent das Mädchen nicht bemerkt, zu sehr war er in sein Buch vertieft. Laodomia drehte sich um. Vergnügt summte sie eine Melodie, ein Gassenlied, bei dessen Text die Mutter und vor allem die steife Tanz- und Gesangslehrerin blass geworden wären. Laodomia tänzelte durch die kleine Kammer, schwang im Rhythmus ihre Hüften, griff ins Haar und ließ die Locken durch die Finger gleiten. Den blanken Wandspiegel hatte sie seit langem schon ein Stück näher an ihren Engel mit dem Wanderstab gehängt. So konnte sie stets, ohne sich umzuwenden, das Zimmer des Siebzehnjährigen beobachten. Lauter summte sie, und endlich hob er den Kopf.
Kein freundlicher Gruß. Girolamo schob sich seitlich an die Fensterbrüstung. Obgleich er halb im Mauerschatten blieb, erkannte Laodomia deutlich den hellen Stoff des Hemdes und das Weiß seiner Augäpfel. Auch die Nase kann er vor mir nicht verstecken, dachte sie und wartete tänzelnd, bis er die Handflächen unter dem Kinn zusammenpresste. Sie spürte, wie sein Blick sich an ihr festsaugte. Das Spiel konnte beginnen.
Mit dem Rücken zu ihm bewegte sich Laodomia so unbefangen, als gäbe es den Studenten nicht. Sie legte den Stoffgürtel ab, löste die Halsschleife ihres groben Arbeitskittels und streifte ihn langsam über den Kopf. Im Spiegel begutachtete sie ihren Körper. Die runden Brüste reckten sich hoch. Auf der weißen Haut schimmerten rosig die beiden Knospen. Mit den Fingerkuppen umkreiste sie ihren Nabel, fuhr über den kleinen Bauch hinunter in den schwarzen Flaum. Noch verbarg er nicht ganz das weiche Hügeldreieck. Nicht schlecht, stellte sie fest und schwang abwechselnd ein Bein langsam vor und zurück, doch, ich gefalle mir.
Um durch den Spiegel freie Sicht ins Zimmer gegenüber zu haben, trat Laodomia seitwärts einen Schritt zurück. Ihr heimlicher Zuschauer stand immer noch unbeweglich an der gleichen Stelle. »Nein, ich hab dich nicht vergessen«, flüsterte sie. »Weil ich mich freue, sollst auch du heute ein besonderes Fest haben.«
Ohne nach draußen zu sehen, ging sie durch die Kammer. Dabei trocknete sie mit dem Unterarm die Stirn, wischte mit beiden Handflächen vom Hals hinunter über beide Brüste. Er sollte wissen, wie heiß es ihr war. Laodomia bückte sich nach dem Hocker und trug ihn vor den Spiegel, kehrte um, füllte Wasser in die Schüssel und brachte sie auf den Schemel. Erst beugte sie sich tief über das Gefäß und kühlte ihr Gesicht, dann nässte sie einen Lappen. Sie wusch gründlich ihren hochgereckten linken Arm, den anderen, rieb Achseln und Körper ab, hielt sich lange mit ihren schlanken Beinen auf und vergaß auch nicht die Pobacken.
Den Erfolg sah sie im Spiegel. Ihr Beobachter war etwas aus dem Schatten getreten. Er hatte die Hände sinken lassen, und sein linker Arm bewegte sich langsam vor dem Leib. Laodomia wusste warum; oft genug hatte sie ihre älteren Brüder zufällig bei solchem Spiel überrascht und war gleich davongejagt worden. Wie gerne hätte sie einmal genau zugeschaut, was Girolamo dort unten, verdeckt von der Fensterbrüstung, wirklich mit sich trieb. In jedem Fall benötigt er meinen Anblick dazu, dachte sie und setzte die Schüssel auf den Boden. Langsam stieg Laodomia selbst auf den Hocker und reckte sich nach dem Bild des Erzengels, mit einem Finger putzte sie Staub vom Rahmen und wölbte dabei den Po nach hinten. Der Spiegel neben ihr zeigte den Studenten, heftiger bewegte sich der Arm. Auf einmal warf er den Kopf nach hinten, sein Oberkörper zuckte, und gleich darauf war Girolamo aus der Fensteröffnung verschwunden.
Das war mein Teil, schmunzelte sie und trug Hocker und Waschgeschirr zurück an ihren Platz. Jetzt dauerte es noch eine kleine Weile. Sobald sie angekleidet war und sich offen am Fenster zeigte, würde er ihr wieder ein Lied singen. Laodomia nahm seine Darbietung als Lohn für das gewährte Vergnügen gerne an. Mochte Girolamo auch noch so hässlich aussehen, seinen Fleiß bewunderte sie. Und neben all den Studien dichtete er sogar und zupfte die Laute, nicht schwungvoll, aber da er hier oben nur für sie spielte, fühlte sie sich geschmeichelt.
Hartes Klopfen. »Laodomia?« Vom Treppensteigen atemlos keuchte die Stimme der Magd. »Deine Tanzstunde beginnt.« Schon bewegte sich die Tür. Das Mädchen sprang hinzu und hielt den Riegel fest. »Gleich. Ich bin noch nicht fertig.«
»Wieso lässt du mich nicht ins Zimmer?«
»Weil ich … Ich war auf dem Topf, deshalb.«
»Beeil dich. Die Herrin wird böse, wenn du zu spät kommst.«
»Sag, ich bin sofort unten.«
Ängstlich horchte Laodomia. Die Schritte entfernten sich. Im Nu war sie an der Truhe, riss ein grünes Kleid heraus und streifte es über. Fahrig nestelte sie an den Schlaufen des eng geschnittenen Oberteils. Von drüben setzte Lautenspiel ein. Nicht jetzt, flehte sie stumm. Dafür hab ich keine Zeit mehr. Sie warf den Rock hoch, hockte sich auf den Boden, schnürte die Leinenschuhe und war wieder auf den Beinen. Noch das Haar, der Kamm hakte im Lockengewirr. Egal, sie überprüfte kurz ihr Spiegelbild, der gerade Rand des Ausschnitts bedeckte die Brüste, zeigte nur den Ansatz der Wölbungen, und der weite Rock war nicht verknautscht. Gut, die Mutter würde nichts beanstanden können.
Halb war Laodomia schon zur Tür hinaus, da hielten sie die Lautenklänge auf. Schnell kehrte sie um und hastete ans Fenster. Von Girolamo war nichts zu sehen. »Ich kann jetzt nicht!«, rief sie hinüber. »Warte. Bald bin ich wieder da«, und schon stürmte sie in den Flur, sprang die Stiege hinunter. Erst als das Treppenhaus breit und großzügig wurde, richtete sie den Oberkörper gerade und ließ die Füße leicht über die Stufen gleiten, wie es der Anstand einer wohlerzogenen Tochter vorschrieb.
»Und tan-ta-ta-ta-tam … Die Hände in die Taille stützen, Kindchen, kleine Schritte vorwärts, nicht so frivol den Hüftschwung, und drehen, den linken Arm über dem Kopf anwinkeln, und ein Hüpfer zurück, jetzt den anderen Arm, nicht so schnell, mehr Grazie, Kindchen, und lächeln. Und ta-tam, tam-ta-tam … Was sind das für unschickliche Grimassen, du sollst lächeln. Und jetzt wieder kleine Schritte im Kreis, und tam, ta-tata-tatata-tan-ta-tan und ta, tan-ta-tam …«
Laodomia war erleichtert, als die Tanzlehrerin von ihr abließ. Auch das süße Gebäck lehnte sie ab, denn die Köstlichkeit wäre mit einem höflichen Geplauder verbunden gewesen, und eine Stunde bei der Mutter und dieser steifen Jungfer zu sitzen dauerte länger als ein ganzer Tag. »Ich bin froh, wieder etwas gelernt zu haben«, dankte sie und schlug die Augen nieder. »Darf ich mich entfernen?«
»Ja, weil du artig darum bittest.« Anerkennend nickte Signora Strozzi. »Ruh dich etwas aus. Heute beim Nachtmahl wirst du zusammen mit den Mägden auftischen. Der Vater hat Gäste eingeladen. Eine gute Gelegenheit für dich, zu üben.«
»Ich freue mich darauf.« Laodomia unterdrückte einen Seufzer. »Du bist so gut zu mir.« Sie schwebte quer durch den Saal, an der Flügeltür hörte sie noch die Mutter sagen: »Das Kind macht Fortschritte. Findest du nicht auch, meine Liebe?«
Erst im vierten Stockwerk zerrte Laodomia an ihren Locken. »Tanzen nennt diese vertrocknete Zitrone das.« Sie tippte den rechten Schuh auf die nächste Stufenkante, zog ihn zurück und wechselte gleichzeitig den Platz für die linke Fußspitze, und wieder der rechte Fuß, schneller folgte der hüpfende Wechsel. Laodomia lachte grimmig: »Bei so was würde die sich bestimmt das Bein brechen«, und lief weiter die Holzstiege hinauf.
In der Kammer war es kühler geworden, die Sonnenstrahlen trafen jetzt das gegenüberliegende Haus und erhellten Girolamos Zimmer. Er stand wieder an seinem Lesepult. Laodomia schlenderte zum Fenster und beugte sich hinaus. Tief unter ihr spielten zwei Jungen, der eine warf den Holzball gegen die Wand der Savonarolas, der andere musste ihn fangen und gleich wieder werfen. Fiel der Ball zu Boden, lachte der Gegner und zählte laut für sich einen Punkt. Das durfte ich früher auch mit den Brüdern spielen, dachte sie, und der Gewinner bekam später beim Essen den Nachtisch. Einmal hab ich ihn sogar von allen vieren bekommen; mir war so schlecht, dass ich mich nachher übergeben musste. Sie blies eine Haarsträhne aus der Stirn und blickte hinüber. Girolamo war von seinem Pult verschwunden. Na endlich. Das Kinn in beide Hände gestützt, wartete Laodomia.
Lautengezupfe. Sie vernahm heftiges Räuspern, und gleich setzte seine kantige Stimme ein:
»Wenn es nicht Liebe ist, was ist’s dann, das ich fühle?Doch wenn es Liebe ist, bei Gott, was ist und wie ist das?Ist es ein Gut, wie kann es einen so tödlich treffen?Ist es ein Übel, warum sind dann die Qualen so süß?«
Versonnen strich Laodomia mit dem kleinen Finger die Unterlippe. Dieses Lied hatte sie noch nie von ihm gehört, schön war es, auch der Text gefiel ihr besser als sonst.
»Wenn ich freiwillig glühe, warum beklage ich mich dann?Geschieht es wider Willen, was nützt dann das Klagen?O lebendiger Tod, o Unheil voller Segen,was verfügst du über mich, meinem Willen entgegen?«
Das Lautenspiel brach ab. »Nicht aufhören«, bat Laodomia in die Stille. »Hast du noch eine Strophe?«
Nach gründlichem Räuspern sang er weiter:
»Wenn ich es aber will, beschwere ich zu Unrecht mich.Bei widrigen Winden treibe ich auf hoher SeeIn einer morschen Barke, ohne Steuer,So leicht an Wissen und so schwer an Irrtum,dass ich nicht weiß, was ich mir wünschen soll;ich fröstele im Sommer und glühe im Winter!«
Noch ein paar Zupfer, es folgte keine Strophe mehr. Sein Lied war zu Ende.
Eine Weile träumte Laodomia den Worten nach, dann klatschte sie langsam, bis der Student an der Fensteröffnung erschien. Im schmalen Gesicht glühten rotfleckig die Mitesser; Girolamo hatte seine wulstigen Lippen zusammengepresst und starrte vor sich auf den Fenstersims.
»He, Freund! Das war bis jetzt das schönste Lied, was du gedichtet hast. Glaub mir. Ich hab die Worte richtig gespürt. So innen drin.«
»Wirklich?«, murmelte er. »Wärst du enttäuscht, wenn es nicht von mir stammt? Petrarca. Francesco Petrarca, so heißt der Dichter.« Anders als Laodomia es von ihm gewohnt war, schleppte er heute an den Worten. »Du kennst ihn nicht, er ist längst tot, doch ich lese seine Gedichte immer wieder. Zur Erholung für den Geist.«
»Ach so.« Nach einer Pause ermunterte sie ihn. »Nein, das ist mir gleich. Aber die Melodie war auch gut.«
Er wrang die langen Finger ineinander. »Du schmeichelst nur. Mein Spiel ist schlecht, auch meine Stimme reicht nicht aus, um dem Text wirklich die ihm gebührende Geltung zu verschaffen.«
»Warum sagst du so was? Mir hat es gefallen. Fühlst du dich heute nicht wohl?« Ohne die Antwort abzuwarten, winkte ihm Laodomia, als könne er näher kommen. »Ein Geheimnis. Ich verrate es dir, aber behalte es für dich. Der Vater hat einen Brief nach Florenz …«
»Warte bitte«, unterbrach er sie. »Ich wollte, nein, ich muss dir etwas sagen.« Ein Schnauber fuhr durch die höckrige Nase, gründlich räusperte er sich. »Es ist so …« Endlich hob er den Kopf, zu üppig und viel zu weit zogen sich die roten Brauen über den eng beieinander stehenden blaugrauen Augen. Sein Blick streifte ihr Gesicht und heftete sich auf die Simsecke neben ihrem Ellbogen. »Wir kennen uns schon lange. So von hier nach drüben. Wir sprechen manchmal über dies oder das.«
Weil er wieder innehielt, nickte Laodomia gelangweilt und dachte: Na, geredet haben wir nicht viel. Du meinst wohl eher, du guckst mir zu und singst mir später ein Lied. »Nun rede schon.«
»Ich, ich wollte dich fragen …« Er riss die verknoteten Finger auseinander. »Es muss heraus. Willst du meine Frau werden?«
»Davon wollte ich dir doch gerade erzählen, der Vater …« Laodomia schlug die Hand vor den Mund. »Was? Was hast du gesagt?«
Er wagte sie anzusehen. »Willst du mit mir das Leben teilen, meine Frau werden? Weil ich dich liebe.«
Ihr geträumter Palazzo, umgeben von Gärten, erbebte, Laodomia sah das Dach einstürzen. Sie konnte nicht antworten, wie von fern hörte sie ihn weiter sprechen. »Nein, erschrecke nicht. Sitte und Brauch sollen natürlich eingehalten werden, deshalb unterbreite ich meinen Entschluss noch heute meinen Eltern. Sie achten mich und respektieren sicher unsern Herzenswunsch.«
Verfaultes fiel aus den geborstenen Decken in die geschmückten Säle. Schaler Gestank breitete sich aus. Laodomia rümpfte angeekelt die Nase und begriff jäh seine Worte. »Du …« Sie bog den Oberkörper zurück. Dass er ihre Nacktheit sah, dass er Lust dabei empfand, hatte ihr geschmeichelt, auch seine Gedichte, auch das kleine Geplauder hin und wieder. Doch jetzt fühlte sie sich beschmutzt; mehr noch, sie empfand Schmerz, als wäre er über die Schlucht zwischen den Fenstern herübergekommen und hätte sie mit seinen langen Fingern unsittlich berührt.
»So antworte doch, Liebste.«
»Du wagst es?« Mit Wuttränen in den Augen schrie sie: »Nenn mich nicht Liebste! Nie wieder, hast du mich verstanden!«
Er versuchte mit den Händen zu beschwichtigen, doch die Geste rief nur Verachtung und Hohn in ihr wach. »Was bildest du dir ein?« Sie lachte spöttisch. »Ich soll den Sohn eines Geldwechslers heiraten? Nur ein Idiot kann auf solch einen Gedanken kommen. Glaubst du etwa im Ernst, das vornehme Blut der Strozzi würde sich zu einer Verbindung mit dem Hause Savonarola herablassen?«
Er ballte die rechte Hand, bis die Fingerknöchel weiß glänzten. »Ich … ich dachte … ich wollte …« Mit einem Mal hieb er die Faust auf den Fenstersims. »Wer bist du denn? Mein Großvater war Leibarzt des Fürsten, mein Vater ist nicht Geldwechsler, sondern Wollfabrikant, und meine Geschwister und ich sind rechtmäßige Nachkommen dieses Ehrenmannes. Und du? Nur eine Bastardin, wer weiß mit wem gezeugt!«
»Halts Maul, du roter Zwerg!«
»Danken solltest du mir!« Vor innerer Erregung überschlug sich seine Stimme. »Meinst du, es wäre leicht, die Eltern zu überreden? Das Haus Savonarola genießt großes Ansehen in Ferrara. Warum sollten die Eltern einem ihrer hoffnungsvollen Söhne ausgerechnet einen Bankert wie dich zur Frau geben?«
Laodomia zerrte an ihren Locken. »Nein, du bist kein Idiot, du bist wahnsinnig. Ein magerer Zwerg will mich zur Frau!« Das Lachen drängte einfach hinaus, und ohne weiter zu überlegen, hastete sie zur hinteren Wand und kam mit dem Spiegel ans Fenster. »Bis jetzt hast du nur mich gesehen. Es wird höchste Zeit, dass du dich selbst anguckst.« Hart setzte sie den Spiegel vor sich ab. »Na? Wie gefällst du dir mit solch einer Nase? Und erst die vielen Pickel. Wie viele drückst du am Tag aus? Ja, auch deine Lippen findet jede Frau gewiss anziehend. Nichts, da passt auch gar nichts in deinem Gesicht zueinander.« Laodomia warf den Spiegel aufs Bett. Ihre Augen loderten. »Und was da unten unter deinem Hemd ist, das will ich erst gar nicht wissen.«
Bis auf die roten Flecken war der Student blass geworden. »Du bist nicht besser als … als eine schamlose Dirne!«
»Und du?« Sie zeigte mit dem Finger auf ihn. »Ja, ja, der gesittete Student. Aber du arbeitest nicht nur fleißig in deinen Medizinbüchern.« Jetzt rieb sie mit der anderen Hand den gestreckten Finger. »Sondern auch besonders eifrig dabei.«
Kaum hatte sie ausgesprochen, tastete er rechts und links der Fensteröffnung nach den Schlagläden und klappte sie leise zu.
»Das kann ich besser«, höhnte Laodomia. Sie packte gleichzeitig in die Rippen der beiden Holzflügel und schloss sie mit einem gewaltigen Knall.
Kühl ist es. Sein nackter Körper liegt eingezwängt zwischen Felsbrocken in der Schlucht. Beide Füße stecken unter Geröll, seine Arme sind weit auseinander gerissen, und dicke Steine beschweren die offenen Handflächen. So viel Kraft ihm die Verzweiflung auch verleiht, Girolamo vermag sich nicht zu befreien. Angstverzerrt starrt er hinauf. Der Bergvorsprung hat die Form eines schwarzen Sensenblatts, und dort über der Kante schwankt eine hohe Wasserwand. Ihre Mitte wölbt sich vor und zieht sich zurück, mit jedem Atemzug bläht sich der bläuliche Bauch weiter nach vorn. Der Wogennabel zerplatzt. Girolamo schreit. Aus dem Riss spritzt ein breiter Strahl und stürzt auf ihn nieder. Eiskalt werden Kopfhaut und Gesicht, das Wasser dringt in Nase und Mund; Atemnot, Husten, Spucken; und härter wird der eisige Strahl, jetzt überspült er den Körper, erstarrt Leib und Glieder; und mehr und immer mehr Wasser stürzt herab …
»Mein Junge.« Beim Klang der fernen Stimme rollen die Steine von den Handflächen. »Mein Junge, wach auf.« Girolamo spürt, wie sich das Geröll von seinen Füßen hebt.
Ein wärmender Hauch berührte seinen Kopf. Langsam öffnete er die Lider und sah über sich das Gesicht der Mutter. Sie strich ihm das verschwitzte Haar. »Ich habe dich schreien hören, Junge.«
»Nein, sorge dich nicht«, murmelte er, »ein Traum, sonst nichts«, und setzte sich auf. »Wie spät ist es?« Er blickte zum Fenster, schwach schimmerten graue Streifen durch die Ritzen der Schlagläden.
»Früh. Noch vor dem Morgenläuten.« Elena Savonarola brachte ein Tuch zum Bett und trocknete seinen nackten, nassen Rücken. »Du bist krank. Ich werde später doch nach dem Arzt rufen.«
»Nicht nötig, Mutter. Glaube mir.«
»Aber du siehst elend aus.« Sie unterbrach das gleichmäßige Reiben. »Was sind das für lange Kratzer?«
Hastig drehte er den Rücken zur Wand. »Nichts, sie bedeuten gar nichts.«
»Girolamo!« Der Ton der Mutter wurde streng. »Seit zwölf Tagen hast du dieses Zimmer nicht mehr verlassen. Du wimmerst und weinst im Schlaf, rührst den Teller nicht an, den ich dir bringe. Dein Vater und ich sind ernstlich besorgt. Auch deine Brüder und Schwestern fragen schon. Wenn du also nicht krank bist, dann haben wir wenigstens das Recht zu erfahren, warum du dich hier oben vergräbst.«
Entschlossen schritt sie zum Fenster. »Und jetzt will ich mir diese Kratzer bei Helligkeit ansehen.« Schon hatte sie den Riegel der Klappläden angehoben.
»Nein!«, schrie er vom Bett her. »Nicht öffnen! Ich verbiete es!«
Signora Savonarola wandte sich verwundert nach ihm um. »Aber Sohn! Die kühle Morgenluft wird dich erfrischen.«
»Nie mehr!« Abwehrend, fast beschwörend streckte er die verkrallten Hände in Richtung Fenster. »Nie mehr dürfen diese Holzläden geöffnet werden!« Heftig ging sein Atem, erst nach einer Weile setzte er gefasster hinzu: »Verzeih, ich … ich wollte sagen, solange ich im Zimmer bin, möchte ich diese Läden geschlossen halten. Durch die Streben dringt genügend Luft, auch reicht mir das Licht zum Schreiben und für das Lesen in den Büchern.« Er versuchte, leichthin zu sprechen. »Und falls nicht, so helfe ich mir mit der Lampe.«
Seine Mutter hatte die Arme unter dem Busen verschränkt. Die sonst so weichen Stirnfalten vertieften sich. Ihre Sorge stritt mit jäh erwachtem Misstrauen. Wie unbeabsichtigt warf sie einen Blick zum Lesepult. Kein Lehrbuch von Avicenna, Galen oder Aristoteles, dort lag aufgeschlagen die Heilige Schrift. Elena trat näher, drehte den Docht der Lampe höher, bis der Schein den Text erhellte. Ein Abschnitt war angestrichen. Obwohl ihre Kenntnis der lateinischen Sprache unvollkommen war, stachen ihr einzelne Worte ins Auge. »Züchtigung? … Gott straft … ?« Sie starrte zu ihrem Sohn hinüber. »Beschäftigst du dich nicht mehr mit der Medizin? Was sagt diese Stelle?«
Girolamo presste die Handflächen unter dem Kinn zusammen. »Die Welt ist schlecht, Mutter«, flüsterte er.
»Weiche nicht aus.« Mit dem Öllicht kehrte sie ans Bett zurück. »Welch eine banale Feststellung. Nur gut, dass dein Großvater sie nicht mehr hören musste.« Da Girolamo den Vorwurf unbeteiligt hinnahm, steigerte sich die Erregung der Mutter. »Dank ihm hast du das Grundstudium der Philosophie so glänzend abgeschlossen. Und jetzt sagst du mir: Die Welt ist schlecht. Um das zu erfahren, mussten wir nicht erst das hohe Schulgeld bezahlen. Es sind noch keine zwei Jahre her, als du nach dem Tod des Großvaters deinem Vater versprachst, ein Medizinstudium aufzunehmen und damit seinen Herzenswunsch zu erfüllen.«
Girolamo seufzte: »Daran halte ich auch fest. Versteh doch, Mutter, es gibt mit einem Mal neue Fragen in mir.« Sein Blick streifte die Bibel. »Und die Antwort finde ich nicht in den medizinischen Lehrbüchern.«
»Auch ist dies keine überraschende Erkenntnis. Aber genug davon«, lenkte Signora Savonarola ein. »Es geht mir mehr um deine Gesundheit. Nur eins noch, wie lautet der Text, den du dort angestrichen hast?«
Girolamo verschränkte die Finger. »›Siehe, selig ist der Mensch, den Gott straft; darum verweigere dich nicht der Züchtigung des Allmächtigen.‹ Nur ein Vers aus dem Buche Hiob.«
Das Licht in Elenas Hand zitterte. »Steh auf. Lass mich deinen Rücken ansehen«, verlangte sie bedrohlich leise. »Zeige ihn. Sofort.«
Diesem Ton wagte sich der Sohn nicht zu widersetzen. Sie hob die Lampe und fand rot geschwollene breite Striemen auf der Haut, an einigen Stellen entdeckte sie getrocknetes Blut. »Haben wir dich vernachlässigt, Junge?«, flüsterte sie. »Fühlst du dich zurückgesetzt vor deinen Geschwistern?«
»Nichts von alledem.« Er schnaubte heftig und wandte sich zu ihr um. »Ich bin dankbar für alle Liebe, die ihr mir gewährt.«
»Warum fügst du dir solche Schläge zu? Wie … wie ein Büßer …«
Er lächelte dünn. »Aus Wissbegierde«, und erklärte: »Als Medizinstudent muss ich doch selbst erfahren, wie schnell solche Wunden heilen.«
»Dummes Gerede!« Die Mutter hatte sich wieder gefasst. »Schluss damit. Dieses Grübeln allein hier oben schadet dir. Ja, fleißig studieren sollst du, aber ich werde auf die Stunden achten. Und von heute an sitzt du bei den Mahlzeiten wieder unten am Tisch. Sieh dich doch an! Abgemagert bist du. Es wird ab jetzt tüchtig gegessen, Sohn. Auch verlange ich, dass du täglich einen Spaziergang unternimmst. Wo ist dieser Gürtel?« Ehe er ihn zeigen konnte, hatte sie ihn schon entdeckt. »Nägel. Ach, Junge. Schämen solltest du dich.« Sie steckte den gespickten Riemen in die Rocktasche. »Von der Magd lasse ich dir ein frisches Hemd und die Tunika bringen. Sei pünktlich zum Morgenmahl unten.« Signora Savonarola hatte die Tür fast erreicht, als sie stockte und sich wieder umwandte. »Du, du spielst doch nicht etwa mit dem Gedanken, ins Kloster zu gehen? Ein Mönch, einer dieser Nichtstuer zu werden, der auf Kosten der Gläubigen ein faules Leben führt?«
»Nein, sorge dich nicht.« Jetzt lachte er bitter auf. »Die Kleriker heutzutage sind noch verderbter als die Fürsten. Nein, nichts zieht mich in ein Kloster.«
Durchdringend sah sie ihn an. »Ich möchte dir gerne glauben. Du weißt, dein Vater, aber auch ich selbst, wir würden solch einen Schritt niemals erlauben.« Damit verließ Signora Savonarola hocherhobenen Hauptes das Zimmer.
Girolamo räusperte sich und schlich zum Fenster. In alter Gewohnheit beugte er sich vor und spähte durch einen Spalt des Klappladens. Wie ertappt wich er zurück. »Nie wieder«, flüsterte er. »Sei stark! Besiege das Fleisch! Der Traum hat dir dein Herz für immer erfroren. Und so ist es gut.«
Skizzenblätter
FLORENZ
BESUCHKOSTET GELD
Trotz Fastenzeit schmückt sich Florenz im Frühjahr 1472. Hohe Gäste aus Mailand nahen, und sie sollen würdig empfangen und bewirtet werden, darin sind sich Kaufleute und Ratsherren einig, schließlich gilt es den Ruf der eigenen Stadt zu wahren. Beim Einzug des Herzogs und seiner Gemahlin aber stockt selbst Lorenzo de’ Medici der Atem. Dem Paar folgen zwölf mit Goldbrokat ausstaffierte Sänften, drinnen lehnen die Schönen des Hofes und winken. Edelsteinbesetzte Goldketten zieren die Brust aller Berater, Vasallen und Höflinge. Fünfzig Kriegspferde ziehen vorbei; und das Auge der Leute am Straßenrand kann dieses Gepränge kaum fassen: Sättel bezogen mit Goldbrokat, die Steigbügel vergoldet, Zaumzeug und Zügel mit bestickter Seide ummantelt. Nicht enden will der Prunk. Hundert Ritter in blitzendem Brustharnisch, dahinter zieht ein Heer Fußvolk, es führt zweitausend Rösser und zweihundert beladene Maulesel durch die Straßen. Nüchtern rechnen die Bankherren von Florenz und veranschlagen den Wert dieses mailändischen Prunkzuges auf 200 000 Goldflorin.
Boten hasten zwischen der Signoria und Lorenzo hin und her. »Wir dürfen uns nicht beschämen lassen!« Wenn’s auch den Säckel schmerzt, der gesamte Hofstaat wird auf Kosten des Hohen Rates beherbergt. Das Oberhaupt der Medici-Familie selbst lädt das herzögliche Paar in seinen Palazzo in der Via Larga ein. Hier, umgeben von Gemälden und Skulpturen, von Marmor und Mosaiken, von Gemmen, Vasen, seltenen Handschriften und antiken Büsten, müssen die Gäste neidvoll eingestehen: »In Mailand findet sich kein Haus mit solch erlesenen Schätzen.« Der verwöhnte junge Herzog Galeazzo Sforza seufzt und setzt hinzu: »Verglichen mit dieser Schönheit ist all mein Gold und Silber nur ein Haufen Mist.«
Den Gästen im Palazzo wie auch dem Hofstaat in den Stadtquartieren wird Fleisch aufgetischt. Braten und Weingelage während der Fastenzeit! Nicht nur die Kleriker, auch einfache Bürger empören sich. Lorenzo will die Geschockten besänftigen und lässt fromme Schauspiele gleich in drei Kirchen aufführen. Er selbst besucht mit dem herzöglichen Paar die ›Ausgießung des Heiligen Geistes‹ in Santo Spirito. Mit echtem Feuer wird das Wunder dargestellt. Eine Ungeschicklichkeit lässt brennendes Öl über die Schüsselränder fließen. »Feuer!« Zum Entsetzen aller Anwesenden lodern in kurzer Zeit die Teppiche, der gewebte Wandschmuck; die Flammen schlagen hinauf ins Gebälk und fackeln das Gotteshaus bis auf die Grundmauern ab. »Eine Strafe des Himmels!« In panischem Tumult fliehen Vornehme und Bürger.
SANFTER TODNACHMÜHEVOLLEM LEBEN
Während bei den Medici in der Via Larga die Musikanten am selben Abend erneut zum Festmahl aufspielen, wacht einige Straßen weiter Filippo Strozzi am Sterbelager seiner Mutter. Allessandra Strozzi ist eingeschlafen. Während jahrelanger Verbannung aller männlichen Mitglieder der Strozzi-Sippe hat sie unerschütterlich für ihre eigenen Söhne die Rückkehr nach Florenz vorbereitet und schließlich durchgesetzt. In den alten Stadtpalast ist längst das Leben wieder eingekehrt. Bis zum heutigen Tage war sie Mutter, dann auch Großmutter gewesen und vor allem stets die treibende Kraft und Ratgeberin ihrer Söhne. Nun darf Alessandra im Alter von dreiundsechzig Jahren loslassen, und der Tod legt sanft den Mantel um sie.
GRIFFINDIE ZÜGELDER MACHT
Lorenzo de’ Medici weiß, wie sehr es unter der schillernden Oberfläche in Florenz brodelt. Bestechung und Betrug, Gier und Vetternwirtschaft beherrschen den ›Rat der Einhundert‹, wie auch den ›Großen Rat der Zweihundert‹. Mit jeder Neuwahl besteht aufs Neue die Gefahr, eine andere Familie könnte den größeren Einfluss in der Stadt erlangen. Momentan erstrahlt der Medici-Stern so hell wie noch nie, und Lorenzo nutzt die Gunst der Stunde. Er ändert die Verfassung! Im Sommer 1471 wird ein Kontrollgremium eingesetzt. Es soll künftig alle Kandidaten für die wichtigsten öffentlichen Ämter prüfen und entweder ablehnen oder auf fünf Jahre bestätigen. Dieses Gremium setzt sich mehrheitlich aus verlässlichen Medicianhängern zusammen. Der ›Rat der Einhundert‹ und der ›Große Rat der Zweihundert‹ gehorchen nun Lorenzos Anweisungen. Nur um den Anschein einer Republik zu wahren, dürfen sich die alten, vom Volk gewählten Vertreter die niederen Posten in der Verwaltung teilen. Außerdem gelingt es dem heimlichen Diktator, die ›Acht Wächter‹ mit mehr juristischer Macht auszustatten. Auch dieses oberste Berufungsgericht setzt sich aus Medicigetreuen zusammen. Damit hat Lorenzo seine Macht vollends abgesichert. Sehr zum Neid und Ärger der reichen Bankiers aus der Pazzi-Familie. Sie murren hinter vorgehaltener Hand, noch wagen sie nicht aufzubegehren.
ROM
HABEMUS PAPAM!
Die weiße Rauchsäule steigt über dem Lateranpalast auf. Nach dem Tode des verschwenderischen Papstes Paul II. wird im Jahre 1471 Francesco della Rovere vom Konklave der Kardinäle auf den Heiligen Stuhl gehoben, der Sohn eines armen Fischers, kränkelnd in der Jugend, aufgezogen bei den Franziskanern, später selbst Lehrer an den Universiäten. Der Siebenundfünfzigjährige gibt sich den Namen Sixtus IV. Er ist ein gebildeter, großmütiger Mann, doch besessen von krankhaftem Ehrgeiz.