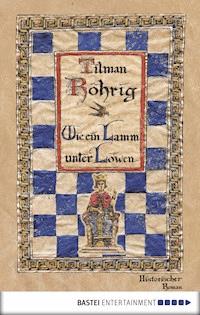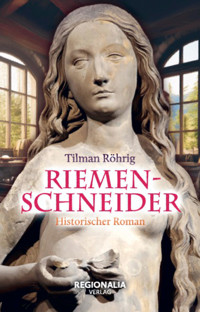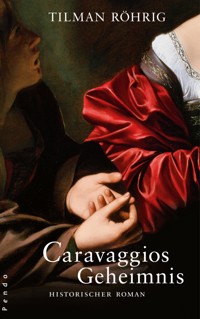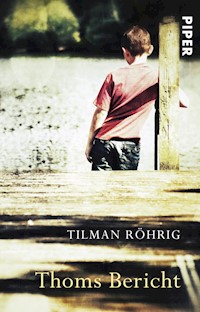
15,73 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Thom ist gerade vierzehn, als er eine weitreichende Entscheidung trifft. Ein für alle Mal will er sich lossagen von seiner Familie. Von dem tyrannischen Vater, einem autoritären Kirchenmann, der Gott liebt, aber seine eigenen Kinder straft. In seinem schonungslosen Bericht deckt Thom die Lügen und die Scheinmoral der Erwachsenen auf. Ein wertvolles und zeitloses Buch, in dem Tilman Röhrig die seelischen Nöte eines Jugendlichen kunstvoll in authentische Worte kleidet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2012
ISBN 978-3-492-95738-0
Piper Verlag GmbH, München 2012
© 1976 Ravensburger Buchverlag
Otto Maier GmbH
Erstausgabe: Anrich Verlag, Weinheim 1973
Umschlaggestaltung: Cornelia Niere
Umschlagmotiv: Nikki Smith / plainpicture / Arcangel
Datenkonvertierung E-Book: Kösel, Krugzell
Vielleicht wäre alles anders
gekommen, wenn ich keine roten Haare hätte. Dabei haben weder meine Mutter noch mein Vater solche Haare. Auch keins meiner vier Geschwister hat so einen roten Pelz auf dem Kopf. Kaum jemand – der nicht selbst darunter leidet – kann sich vorstellen, was es bedeutet, rote Haare zu haben und keine reichen Eltern: Also nichts, womit man Eindruck schinden kann. Man ist dem Spott und der Hänselei der ganzen Umgebung ausgesetzt. Soll man dabei nicht anders werden als andere Kinder?
Von den Jahren vor dem ersten Schultag gibt es eigentlich wenig zu erzählen. Nein, vielleicht doch so zwei oder drei Begebenheiten, die ich für wichtig halte.
Wir wohnten in einem Dorf im Hunsrück. Thalfang heißt es. Mein Vater war damals Dorfpfarrer. Er hat im Krieg seinen rechten Arm verloren, aber es scheint ihm nichts auszumachen. – Ich bin also zu allem Überfluss auch noch Pfarrerssohn! Wenn die Leute mich auf der Straße sahen, sagten sie immer: »Pfarrers Kinder, Müllers Vieh, geraten selten oder nie!« Meist sagten sie das, wenn ich mal so ein bisschen laut herumtobte. Ich fand das doof. Was kann ich dafür, dass mein Vater so einen Beruf hat?
Eines Tages schenkte mir ein Junge aus der Nachbarschaft eine Stahlgabel, um eine Steinschleuder zu bauen. Wir nannten das »Fletsche«. Ich hatte mir zwei Gummiriemen aus einem alten Autoschlauch geschnitten. Ein gutes Stück Leder dazu zu besorgen, war schwierig, aber bald kam mir die rettende Idee: Meine Lederhose hatte einen umklappbaren Rand, den ich sowieso nicht brauchte. Also schnitt ich mir aus dem Lederhosenrand ein schönes Stück heraus, um meine Schleuder fertig zu bauen. Nach zwei Stunden hatte ich eine richtige, weit schießende Fletsche.
Damals verstand ich nicht, warum mein Vater mich deshalb verhauen hat. Schließlich war es meine Lederhose und ich musste sie ja anziehen. Eitel war ich damals überhaupt noch nicht. Aber ich glaube sowieso, dass die Erwachsenen nicht immer so genau wissen, warum sie uns bestrafen. Sie tun es manchmal einfach deshalb, weil ihnen danach zumute ist. Ich aber hatte eine Fletsche und stieg damit im Ansehen der Kinder auf der Straße. Ich fühlte mich als Jäger! Erst schossen wir auf Büchsen, dann machten wir Wettschießen auf Zeitungsbilder, und bald schon schossen wir auf Vögel. Wir stellten uns vor, den Adler im Flug zu treffen, während wir versuchten, Spatzen zu erwischen. Ich fand das ganz in Ordnung, schließlich war ich Jäger. Einmal habe ich einen Spatzen getroffen, oder – beinahe fast. Er saß in einem Holunderstrauch, ich schlich mich nach allen Regeln der Kunst an, schoss, und er flog erschreckt weg. Heute denke ich mir, dass ich ganz haarscharf daneben getroffen hatte, aber damals war ich sicher, ihn voll getroffen zu haben, und ich fühlte so richtig den Triumph des Jägers.
Dann, ein paar Tage später, passierte es: Wir – das heißt, noch zwei Jungen und ich – hatten ein Schwalbennest entdeckt! Es hing unter der Dachrinne einer hohen Scheune. Das war ein Ziel! Wir schossen unermüdlich. Endlich traf einer von uns: Oben im Nest hörte man klägliches Gepiepse. Ich bekam so ein komisches Gefühl im Bauch. Die anderen sicher auch, aber wir schossen weiter, weil wir uns ja nicht voreinander blamieren wollten. Endlich fiel das Nest herunter. Drei kleine, noch ganz nackte Schwälbchen lagen tot und fast platt auf dem Boden. – Mir war richtig schlecht. Dann lachte einer von den Jungen. Vielleicht nur, weil ihm auch schlecht war. Da nahm ich meine Schleuder und schoss ihn an den Kopf! Nicht fest, aber er hat geblutet. Er schrie, als ob man ihn aufgespießt hätte. Jetzt tat er mir Leid, und ich wollte es wieder gutmachen. Er hörte mir nicht zu, er lief nach Hause und sagte es seiner Mutter, die ging zu meinem Vater.
Die Schläge, die ich bekam, waren nicht so schlimm, an die hatte ich mich schon gewöhnt. Nein, das Schlimmste war die Predigt, die mein Vater mir hielt. Ich sei verroht und schlimmer als die Kinder von irgend so einem grausamen Mann in der Bibel. Ich musste früh ins Bett und bekam kein Abendessen. Das war grässlich, denn es gab Dampfnudeln ...
Am nächsten Tag tauschte ich die Fletsche gegen zwanzig Glasmurmeln ein und verlegte mich aufs Spielen. Ich gewann so viele Glasmurmeln, dass am Abend schon wieder eine Mutter bei meinem Vater auftauchte. Sie behauptete, ich hätte ihrem Sohn alle Glasmurmeln gestohlen. – Also gab ich meinen ganzen Gewinn wieder her, denn ich glaubte, dass es keinen Zweck haben würde, einem Erwachsenen etwas zu erklären, wenn er es nicht glauben will. Irgendwie war manches, was ich tat, in den Augen der Erwachsenen schlimm und bestrafenswert, ohne dass ich wusste warum. So sammelte ich einmal über vierzig Marienkäfer und nahm sie heimlich mit ins Bett. Dort strich ich die Decke ganz glatt, setzte die Marienkäfer alle in eine Reihe und spielte Marienkäferwettrennen. Es war richtig spannend. Einige krabbelten gleich los, andere wollten nicht. Da hauchte ich sie ganz vorsichtig an, und schon wachten sie auf und liefen hinter den anderen her. Am Deckenrand angekommen, den ich etwas hochgebaut hatte, breiteten sie ihre Flügel aus und flogen im Schlafzimmer herum. Ich kam mir vor wie der Manager einer Pferderennbahn und auch wie der liebe Gott: Schließlich brachte ich vierzig Marienkäfer zum Fliegen! Leider hatte jedes der kleinen Viecher eine gelbe Spur auf der Decke hinterlassen. Meine Mutter ärgerte sich darüber, und schon wieder wurde ich bestraft. Das fand ich ungerecht! Der Dreck, den meine Käfer hinterlassen hatten, war längst nicht so schlimm wie das schmutzige Laken meines kleinen Bruders, wenn er wieder einmal ins Bett gemacht hatte. Aber er wurde nie ausgeschimpft.
So langsam wurde mir klar, dass die Erwachsenen mir nichts Gutes wollten, und ich wurde so hart, wie ein Fünfjähriger nur werden kann. Es ging nicht anders, ich musste Leuten, die immer an mir herummeckerten, die Zunge rausstrecken und ihnen manchmal Steine nachwerfen – wenn ich sicher war, dass sie mich nicht entdecken konnten.
Bevor ich nun von dem wichtigsten
Erlebnis berichte, das ich hatte, bevor ich in die Schule kam, muss ich mich erst einmal vorstellen: Also ich heiße Thom – aber mit einem »h« nach dem »T«, darauf lege ich Wert – und bin jetzt vierzehn Jahre alt. Das genügt schon.
Es war ein heißer, sehr schwüler Sommertag. Ich spielte mit Gottfried, einem Nachbarjungen. Er war nicht so nach meinem Geschmack – so ein richtiges Mamasöhnchen –, aber er besaß sehr viele und schöne Glasmurmeln, und ich wollte sie haben. So bohrten wir eine Kuhle in die Erde, machten eine glatte Murmelbahn und fingen an. Schon nach einer Stunde hatte ich bestimmt zwanzig seiner Murmeln gewonnen.
Plötzlich wurde es dunkel. Ja, wirklich, obwohl es Mittag war, wurde es dunkel! Ich sagte sofort: »Jetzt geht die Welt unter!« Ich sagte das nicht ängstlich, nein, ich freute mich sogar! Ich wünschte mir damals schon, dass in meinem Leben nur außergewöhnliche Dinge passieren sollten, und ein Weltuntergang wäre ein guter Anfang gewesen. Es wurde noch dunkler, und schwarze Rauchwolken zogen dicht über die Häuser unserer Straße. Langsam wurde mir klar, dass die Welt doch nicht untergehen würde, denn es roch verbrannt. Gottfried heulte gleich los und rannte nach Hause. Der Dummkopf vergaß in seiner Angst, die Murmeln mitzunehmen. Bevor ich in die Richtung lief, in die plötzlich alle Leute liefen, nahm ich erst einmal die Hälfte von Gottfrieds Glaskugeln. Ich hätte sie sowieso gewonnen, und deshalb fand ich es nicht schlimm. Dann rannte ich auch los.
An der nächsten Ecke sah ich schon, was passiert war: Das Haus vom Metzger brannte! Es brannte unheimlich schön! In sicherem Abstand hatte sich das ganze Dorf versammelt. Die Gesichter der Erwachsenen sahen gleichzeitig ängstlich und befriedigt aus. Vielleicht haben sie auch so ausgesehen, wenn im Krieg die Bomben nicht auf ihr Haus, sondern auf das der Nachbarn gefallen waren.
Ich versetzte mich in diese Zeit, die ich nicht erlebt hatte, und sah mich den Brand großmütig löschen, in der einen Hand die MP – falls der Feind noch einmal zurückkäme –, in der anderen hielt ich lässig den schweren Wasserschlauch und löschte bewundernswert. Auch heute träume ich gerne noch von Situationen, in denen ich der Held bin.
In meiner Fantasie war ich gerade dabei, zwei hilflose Frauen den Flammen zu entreißen, als ich plötzlich die umstehenden Männer lachen hörte.
Einer sagte gerade: »Wer hat da wohl Feuer gelegt?« Ein anderer: »Na, wer wohl?!« – Jetzt guckten mich fünf grinsende Männergesichter an. – Dann ein Dritter: »Das kann doch nur der Rotfuchs vom Pfarrer gewesen sein!« Sie lachten weiter und redeten auch weiter, aber ich verstand nichts mehr.
Ich bekam richtig Angst. Ich starrte die Männer ängstlich an, jeden Moment bereit wegzulaufen. Dann fühlte ich mich für einen Augenblick tatsächlich schuldig! Ich genoss ganz kurz ein Verbrecherdasein und die Erkenntnis, geschnappt worden zu sein. Innerlich stellte ich mir vor, wie sie mich brutal greifen, schlagen und mich dann am nächsten Baum aufhängen würden. Da ich mir dabei wirkliche Schmerzen nicht vorstellte, kam ich mir sehr großartig vor. Plötzlich riss mich jemand von hinten am Hemd, noch halb in meinem Traum drehte ich mich um. Es war der blöde Gottfried! Er guckte mich mit wütenden Augen an, sicher, weil er so viele Glasmurmeln verloren hatte, und schrie: »Klar, das warst du, du Brandstifter!« Andere Kinder kamen dazu. Sie riefen durcheinander:
»Der ist ein Teufel!«
»Rote Haare, Sommersprossen sind des Teufels Volksgenossen!«
Sobald ich diesen ekligen Vers hörte, schlug ich dem Gottfried, so fest ich konnte, auf die Nase – obwohl seine Mutter dabeistand – und lief weg. Aber ältere Jungens rannten mir nach, fingen mich, und ich bekam Prügel. Es war fürchterlich! Als sie keine Lust mehr hatten, blutete mir die Nase, mein Schienbein tat weh, und ein Schneidezahn wackelte. Heulend und ganz verzweifelt schlich ich mich weg.
Als die Schmerzen nachließen, fing ich erst richtig an zu leiden. Ich stellte mir vor, wie viel ich doch für alle schon getan haben wollte, wenn ich nur gekonnt hätte. – Und nun diese Prügel! Ich tat mir so Leid, dass ich in der Nase bohrte, bis sie wieder blutete. Ich schmierte mir das Blut über das ganze Gesicht, über die Hände und auf das Hemd, damit meine Mutter auch etwas von meinem Leid sehen konnte, wenn ich wieder nach Hause käme. Wenn ich wieder nach Hause käme? – So sicher war mir das gar nicht! Ich ging aus dem Dorf und kletterte auf den »Schock«. Der »Schock« ist ein bewachsener Felsen, obendrauf steht ein Kriegerdenkmal. Von dort aus kann man auf Thalfang heruntergucken. Ich stand also da, das erste Mal von meinen Freunden ausgeschlossen und vertrieben. Im Dorf sah ich noch die Rauchschwaden des brennenden Hauses. Auf der anderen Seite konnte ich die halb abgemähten Kornfelder sehen. Es war ganz still. Ich war blutverschmiert und ganz allein. Plötzlich hasste ich das ganze Dorf. Ja, ich hasste alles, was ich sehen konnte. Die Umgebung, die Ernte und alle Menschen. Ich wurde ganz groß in meinem Hass. Da breitete ich die Arme aus und fluchte. Ich verfluchte die Menschen in Thalfang, verfluchte das Vieh – wie in der Bibel – und die Ernte. Ich beschwor Schwärme von Heuschrecken. Ich wünschte ihnen die Pest. Ich sah mich weggehen wie der einzige Überlebende von Sodom und Gomorrha.
Dann war mir besser. Ich ging nach Hause. Meine Mutter war entsetzt, als sie mich sah. Um ihr noch einen größeren Schrecken einzujagen, heulte ich ganz jämmerlich; vielleicht auch, weil mich endlich jemand bedauerte. Die Pfannkuchen, die ich zum Trost bekam, aß ich schon ganz zufrieden, und abends im Bett hatte ich meine Heldenform wieder gefunden. Vielleicht war es keine echte Heldenform, wie ich es mir damals einbildete. Vielleicht war ich nur glücklich, doch nicht ganz ausgestoßen zu sein.
Das waren nun die
wichtigsten Ereignisse meiner Vorschulzeit. Ich musste sie berichten, damit man die Bedeutung meines ersten Schultages verstehen kann.
Am Vortag bekam ich ein neues Hemd geschenkt. Von einer alten Gemeindeschwester. Sie hatte es selbst genäht. Es war bunt kariert. Aus den Stoffresten hatte sie noch zwei Taschentücher gemacht. Am ersten Schultag zog ich das neue Hemd an, steckte je ein Taschentuch in die rechte und linke Tasche meiner Lederhose und zog den Ranzen über die Schulter.
Von meiner Mutter ließ ich mich zur Schule bringen. Sie machte an diesem Tag ein ganz feierliches Gesicht und mahnte mich auf dem Weg ständig, an die Worte meines Vaters zu denken, der mir hatte klarmachen wollen, dass sich nun alles in meinem Leben ändern würde. Ich weiß noch: Er predigte mir am Vorabend von einem »Lebensabschnitt«, der nun beginnen würde.
»Thomas«, sagte er, »ab morgen bist du kein Kind mehr. Der Ernst des Lebens beginnt dann. Du wirst natürlich nicht mehr so viel Zeit haben, dich auf der Straße herumzutreiben. Auch wirst du, und das ist das oberste Gesetz, nicht nur deinen Eltern gehorchen müssen, sondern auch deinen Lehrern. Es ist etwas Herrliches, lernen zu dürfen. Stell dir vor, in vielen Teilen der Welt haben die Menschen kaum Schulen, und manche lernen nie Schreiben und Lesen. Du aber hast die Möglichkeit, wenn du schön fleißig bist, später zu studieren und sogar Professor zu werden.« Mein Vater schaute ganz sehnsuchtsvoll zum Fenster raus und blickte mich dann ernst an. Ich war ergriffen und bedauerte ihn insgeheim, dass er diesen »Schritt ins Leben« nicht selbst machen durfte, da er anscheinend viel mehr damit anzufangen wusste als ich.
Erst als ich Gottfried sah, merkte ich, dass ich keine Schultüte bekommen hatte. Er kam mit einer glänzenden roten Tüte an, die fast größer war als er selbst. Seine Mutter guckte so eingebildet wie Gottfried, sie war mächtig stolz, dass ihr einziges Kind nun in die Schule kam. Ich ärgerte mich sehr, dass ich keine Schultüte hatte. »Typisch mein Vater«, dachte ich, »eine Predigt hat er mir gehalten über den Schulanfang, aber das Wichtigste, eine Schultüte, hat er vergessen.« Dann aber sah ich, dass die Mutter von Gottfried meine Mutter ganz verächtlich anschaute. Sicher weil sie glaubte, wir wären zu arm, um eine Schultüte zu kaufen.
Gleich ergriff ich innerlich die Partei meiner Mutter, schließlich war ich schon ihr drittes Kind, das sie zum ersten Schultag brachte! Sicher hatten mein großer Bruder und meine große Schwester eine riesige Schultüte gehabt, bestimmt doppelt so groß wie die von Gottfried! Meine Mutter war doch besser als die von Gottfried, die hatte ja nur ein Kind.
»Die soll bloß nicht so angeben«, dachte ich und fühlte mich über die ganze »Erster-Schultag-Feierlichkeit« erhaben. Die frechsten Kinder aus unserer Nachbarschaft kamen an und machten Gesichter, als hätten sie gerade den Osterhasen gesehen. Leider hatten sie alle Schultüten, nur ich hatte eben keine. Ich schaute meine Mutter an und bemerkte, dass sie das auch feststellte. Ich glaube, sie schämte sich ein wenig. Da bekam ich das erste Mal richtig Mitleid mit ihr.
Weil wir alle noch auf dem Schulhof standen, ging ich zu Gottfried und seiner Mutter. Er grinste mich schadenfroh an, mit seiner Schultüte im Arm. Da konnte ich ihm nur ganz lässig sagen, dass unsere Familie den ganzen Kram mit so einer Tüte nicht nötig hätte. »Meine Mutter hat fünf Kinder«, sagte ich, »und nicht bloß eins. Deine Mutter soll bloß nicht so angeben!« Die Mutter von Gottfried hatte es gehört, wurde rot und gab mir eine Ohrfeige. Ehe ich mich versah, gab mir meine Mutter auch eins hinter die Ohren, aber nicht so fest. Die anderen Mütter sahen mich an und redeten ganz aufgeregt.
Da erst erinnerte ich mich, dass ja der Vater von Gottfried gestorben war und seine Mutter deshalb keine Kinder mehr bekommen hatte. Na ja, ich wusste jetzt, dass ich was Verkehrtes gesagt hatte, fand es aber gar nicht so schlimm.
Gottfried guckte beleidigt und seine Mutter ganz unglücklich.
Ende der Leseprobe