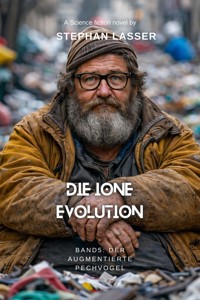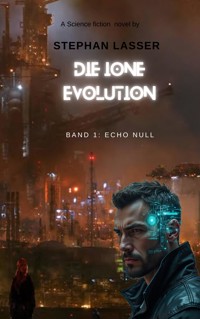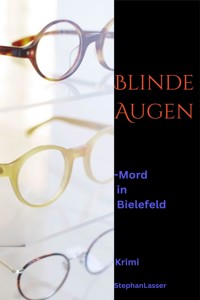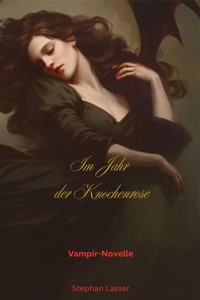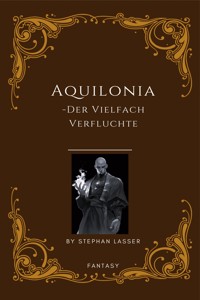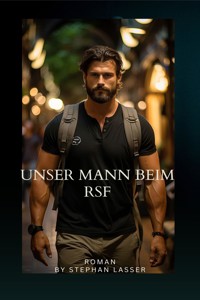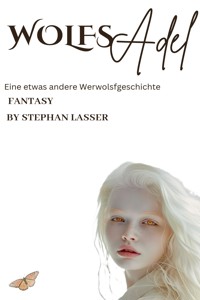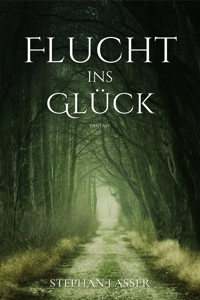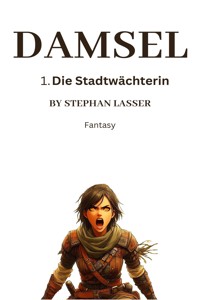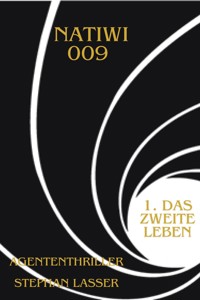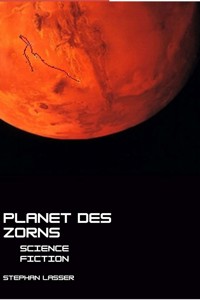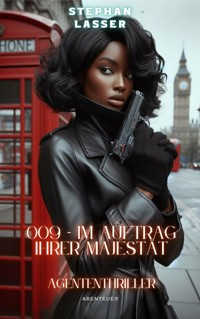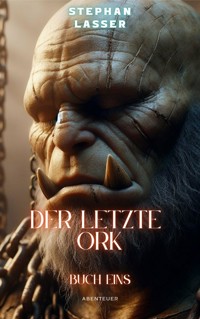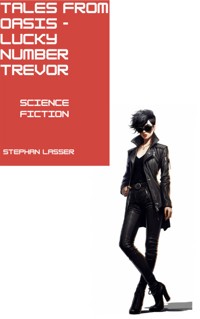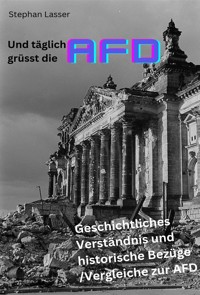
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Europawahl am 09.Juni 2024 hat gezeigt, dass sich Geschichte "vielleicht" auch wiederholen kann: Mit reißerischen Behauptungen erreicht die AfD in den sozialen Medien dreimal so viele junge Menschen wie alle anderen Parteien zusammen. Doch was plant die AfD eigentlich für die EU und was steht in ihrem Wahlprogramm? Der Autor bemüht Quellen aus der Politik- und Geschichtswissenschaft, bezieht sich auf Interviewausschnitte und stellt die Methoden der AfD in einen historischen Kontext.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Und täglich grüßt die AFD
Geschichtliches Verständnis und historische Bezüge/Vergleiche zur AFD
Stephan Lasser
Copyright © 2024 Stephan Lasser
Alle Rechte vorbehalten.
"Der Nationalsozialismus ist eine Pest, die Generationen überspringt."
"In diesem Land war man immer auf dem rechten Auge blind."
_________
(Johannes Mario Simmel, österreichischer Schriftsteller)
Inhalt
1. Einleitung
2. Der lange Weg zum Fall
2.1 Die Republik im Glanz und Elend
2.2 Im Griff der Depression
2.3 Bankenkrise
2.4 Adolf Hitler
2.5 Ziele und Vorstellungen der NSDAP
2.6 Nach der Wahl
2.7 Die Wirtschaft in der NS-Zeit
2.8 Die Geschichte eines Konzerns: Krupp
2.8.1 Personalpolitik und Ideologie
2.8.2 Zum Thema Zwangsarbeit
2.9 Das Frauenbild der NS-Zeit
2.10 Religion und Staat
2.11 Die Judenfrage
2.12 Die Konzentrationslager
2.13 Röhm-Putsch
2.14 Noch mehr Terror
2.15 Der Zweite Weltkrieg bis zum Untergang
3. Begriffsdefinition
3.1. Zum Begriff Nation
3.2 Der Ursprung
3.3 Hobsbawm Standpunkt zum Thema
3.4 Der Gedanke heute
3.5 Die Bedeutung der Erinnerung
3.6 Kultur des Erinnerns
3.7 Die deutsche Erinnerungskultur
3.8 Die Wichtigkeit des Vergessens
4. Die AFD und ihre Vorgeschichte
4.1 Geschichtliches Verständnis und historische Bezüge/Vergleiche - Alexander Gauland
4.2 Geschichtliches Verständnis und historische Bezüge/Vergleiche - Björn Höcke
4.3 Zur aktuellen Debatte um Björn Höcke
4.4 Die AFD und das Volk
4.5 Frankreich und ein ähnliches Problem: über das Schweigen der französischen Bosse über die RN (Rassenblement National)
5. Fazit
6. Literatur- und Quellenverzeichnis
1. Einleitung
2023 hat es mehr Fälle von Antisemitismus gegeben als in den Jahren davor. Die Zahlen hat der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen, RIAS, aus elf Bundesländern zusammengetragen. Demnach wurden 4782 antisemitische Vorfälle gemeldet1. Mehr als die Hälfte davon ereignete sich nach dem 7.Oktober, an dem die Hamas Israel überfallen hatte. Der Antisemitismus-Beauftragte Klein sprach von „katastrophalen Zahlen“. Grund zur Sorge gibt es auch an anderen Stellen: Immer mehr Menschen in Deutschland berichten von Benachteiligungen in Beruf und Alltag. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes verzeichnete 2023 mehr als 10.700 Fälle, in denen Betroffene Beratung suchten. Die zuständige Beauftragte Ataman spricht von einem alarmierenden Trend, zumal nicht jeder Vorfall gemeldet wird. Dass sich die Beratungsanfragen binnen fünf Jahren verdoppelten, zeigt: immer mehr Menschen wollen sich gegen Diskriminierung wehren. Das ist ein gutes Zeichen – aber nicht so gut ist, was uns Diskriminierungserfahrungen über die Jahre zeigen. Menschen erleben Rassismus und Antisemitismus, Queer-Feindlichkeit, Verachtung für Menschen mit Behinderung, Herabwürdigung von Frauen und andere Diskriminierung offener, direkter und härter. Die Hemmschwellen scheinen zu fallen. Der Jahresbericht zeigt auch, dass Rassismus die am meisten gemeldete Form der Diskriminierung ist. Die Zahl der Fälle hat sich in den letzten fünf Jahren fast verdreifacht – auf 3.429. Ist Islam gleich Islamismus? Kann man arabischen Großfamilien mit Kleinkriminalität gleichsetzen? Der aktuelle Rechtsruck in Europa kann einem Angst machen und man darf schockiert sein, dass es immer noch Anfeindungen gibt. Was würde passieren, wenn wieder eine rechtspopulistische Partei an die Macht kommt?
Hatten wir „so etwas“ nicht schon mal? „Das war mal! Das kommt nie wieder!“ pflegte meine Oma zu sagen. Es scheint unmöglich die Geschichtsschreibung über das 20. Jahrhundert zu kennen, nicht einmal diejenige, die in einer einzigen führenden Sprache niedergeschrieben worden ist – etwa so, wie der Historiker der klassischen Antike oder des Byzantinischen Reichs über alles Bescheid wissen kann, was während dieser lange Periode geschrieben wurde. Das Zeitalter des totalen Krieges beinhaltet die Industrialisierung; ohne sie versteht man nicht den Ersten Weltkrieg, dann die Weimarer Republik und dann den Zweiten Weltkrieg, so dass Historiker gerne sehr früh anfangen um dem geneigten Zuhörer/Leser das Verständnis zu erwecken, wie was passierte und warum. Es ist aber nicht Zweck dieses Buches, die gesamte Geschichte „von Beginn an“ zu erzählen, sondern zu vermitteln was damals war und was sich auf keinen Fall wiederholen darf. Fast an jedem Ort in Deutschland gibt es eine heimatgeschichtliche Darstellung der NS-Zeit oder zumindest ein Archiv. Es gibt viele Zeugnisse wirklicher Menschen aus dieser Zeit. Ich persönlich empfehle an dieser Stelle Gerhard L. Durlauchers „Ertrinken – Eine Kindheit im Dritten Reich“. Erschienen 1987 (eva) auf Niederländisch, 1993 auf Deutsch. Zum besseren Verständnis werden Porträts aus der Zeit belichtet, die den Alltag in der Zeit aufzeigen. Die Zerstörung der Vergangenheit, oder vielmehr die jenes sozialen Mechanismus, der die Gegenwartserfahrung mit derjenigen früherer Generationen verknüpft, ist eines der charakteristischsten und unheimlichsten Phänomene unseres Jahrhunderts.
Die meisten jungen Menschen am Ende dieses Jahrhunderts wachsen in einer Art permanenter Gegenwart auf, der jegliche organische Verbindung zur deren Aufgabe es ist, in Erinnerung zu rufen, was andere vergessen haben. Ich selbst bin ein Kind der 70er Jahre: in Frieden und Harmonie durfte ich als Kind eine unbeschwerte Zeit erleben und empfand es als selbstverständlich in einem Land aufzuwachsen, in der meine Rechte gewahrt werden. Das es auch Kinder in meinem Alter „unter Adolf“ gab, die ganz andere Zeiten als ich erlebten… „Wie konnte es jemals so weit kommen“ ist praktisch ein Satz, den ich mir selbst mehr als nur einmal stellte (und immer noch stelle). Sei es in den Vorlesungen oder auch in Bergen Belsen – früheres KZ, heutiges Museum. Zu was ist der Mensch fähig? Und bei all dem Erlebten ist es doch unmöglich, fast schon kriminell, wieder diesen Weg zu beschreiten, oder?
Dieses Buch ruht also auf den Wunsch den geneigten Leser einen Ausblick auf die Zeit zu schenken, in der die Menschlichkeit ad absurdum geführt wurde. In der ein Volk sich selbst über alle anderen erhob und unsägliche Gräueltaten ausübte – aufgrund eines Traums, der weder christlich noch logisch aufgebaut ist. Wenn ein Historiker aus diesem Jahrhundert überhaupt schon sinnvolle Schlüsse ziehen kann, dann zum gut Teil dank seiner Beobachtungen und seiner Fähigkeit zum Zuhören. Ich hoffe, es wird mir gelingen, dem Leser zu vermitteln, was ich auf diese Weise gelernt habe.
Am Anfang meiner Arbeit wird eine kurze Übersicht darüber gegeben, wie die Ausgangslage noch vor dem Ersten Weltkrieg war, welche Rahmenbedingungen in der Weimarer Zeit herrschten und was sich im Einzelnen im Deutschen Reich ereignete – vom Röhm-Putsch zum April-Boykott und darüber hinaus. Wie die Wirtschaft in der NS-Zeit funktionierte, welche Pläne die NSDAP für die Zukunft hatte und welche Auswirkungen dies auf die Menschen hatte. Was ist Nationalismus eigentlich und welche Lehren kann man in der aktuellen Debatte daraus ziehen? Ist eben alles vergangen und vergessen, oder lassen sich heute noch bekannte Muster aufzeigen, die schlimmstenfalls zu einer Wiederholung führen? Was ist so wichtig am Erinnern und an dem Vergessen? Der vierte Abschnitt stellt die Verbindung zwischen dem theoretischen Teil der Arbeit und der exemplarischen Betrachtung eines geschichts- und erinnerungskulturellen Verständnis, dem der Alternative für Deutschland, dar. Das Fazit soll diese Frage noch einmal aufgreifen, soweit möglich beantworten und so das Thema abschließen.
Ich wünsche diesem Buch viele Leserinnen und Leser, die bereit sind zu dieser Auseinandersetzung, die sich einlassen auf Erinnerung und Gedenken und die besonnen und mutig handeln, wo es erforderlich ist.
2. Der lange Weg zum Fall
Die Argumentation dieses Buches beginnt früh vor dem Ersten Weltkrieg, der den Zusammenbruch der (westlichen) Zivilisation des 19. Jahrhunderts markiert. Diese in ihren rechtlichen und konstitutionellen Strukturen, bürgerlich in den Erscheinungsformen ihrer charakteristischen herrschenden Klasse und stolz im Glauben an die Wissenschaft und den materiellen wie moralischen Fortschritt. Man begriff sich als Geburtsstätte von Revolutionen und Wissenschaften, Künsten, politischen und industriellen Entwicklungen.
Wie sah die Welt der achtzehnhundertneunziger Jahre aus? Sie war von fünf bis sechs Milliarden Menschen bevölkert, etwa dreimal so viel, wie beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Eine neuere Schätzung der „Megatode“ dieses Jahrhunderts beläuft sich auf 187 Millionen2 und die meisten von ihnen waren besser ernährt als ihre leiblichen Eltern. Die Welt war unvergleichlich reicher als jemals zuvor – durch das herrschende Ausmaß an Waren- und Dienstleistungsproduktion – aber auch reicher in ihrer grenzenlosen Vielfalt. Noch nie zuvor konnten so viele Menschen bereits Lesen und Schreiben (wobei die Zahl der Analphabeten noch immer drastisch hoch war!). Warum endete das 19. Jahrhundert nicht mit einer Jubelfeier angesichts der vielen beispiellosen und wunderbare Fortschritts, sondern in einer Stimmung des Unbehagens?
Hobsbawm beschreibt es so: „Man kann aber die historische Buchhaltung von Soll und Haben im Weltgeschehen am Ende des Kurzen 20. Jahrhunderts nicht mit der vergleichen, die an seinem Anfang stand. Denn die Welt an seinem Ende unterschied sich qualitativ in zumindest dreierlei Ansichten[..] Sie war nicht eurozentriert[..]. Das globale Dorf war geboren[..] und drittens lösten sich die alten Sozial- und Beziehungsstrukturen auf“3. Eine neue Gesellschaft war geboren, die aus Egozentrikern bestand, die der Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse nachjagten – sei es aus Profitzwecken oder aus Vergnügen. Marx prangerte in seinem Manifest das Bürgertum an, indem er das Fehlen von natürlichen Vorgesetzten anmahnte und den nackten Eigennutz anprangerte.
Es muss hervorgehoben werden, dass es in der Zeit vor 1914 keine Kriege seit 1871 gab. Der längste Krieg war bis dato der Krimkrieg (1853- 1856) bei Sewastopol. Der Erste Weltkrieg (1914-1918), der von vielen so sehnlichst herbeigewünscht wurde, begann mit einem Gefühl der eigenen, großen Stärke heraus. Längst ging es nicht mehr um einen störenden Nachbarn oder den Zugewinn von Land und Bevölkerung, sondern um endliche Ziele: die Weltherrschaft4. Ein großer Krieg, der alle Probleme lösen sollte und ein dominierendes System, das ein für alle Mal klarstellen sollte, was Sache war. Die Welt war kleiner geworden, überschaubarer. England und Frankreich schweißten die vielen Konflikte zusammen (Entente), die sich auch mit Russland gut verstanden. Dagegen standen das Bündnis Deutsches Kaiserreich und Österreich-Ungarn. Das Wettrüsten begann und zum ersten Mal wurden Maschinengewehre und Granaten am Fließband hergestellt, was nicht besonders schlimm war, denn Aufrüstung kann auch zur Abschreckung dienen (man schaue nur zum Konflikt des Kalten Krieges [1945 -1991] wo es zum Glück nicht zu einem Dritten Weltkrieg kam). Hier fühlten sich die zwei Bündnisse von den anderen bedroht, und man nahm Krieg nicht mehr als die schlimmste Sache war, sondern als Lösungsansatz um „ein für alle Mal reinen Tisch zu machen“. Ein ungelöster Konflikt schwelte auf dem Balkan. Lange Zeit herrschte hier das Osmanische Reich, und als Griechenland, Rumänien, Bulgarien und Serbien selbstständig werden wollten, wurde Österreich-Ungarn aktiv indem er Bosnien-Herzegowina mit der Hauptstadt Sarajewo sich einverleibte. Allerdings hätte gern auch Serbien zugegriffen, denn dort lebten viele Slawen. Serbien wollte alle Länder, in denen Slawen lebten, in einem serbischen Großreich vereinen. Unterstützt wurde Serbien von Russland – Serbien war sozusagen der verlängerte Arm des Zaren, und so wurde der Balkan zum „Pulverfass“. Aus einem kleinen, örtlich begrenzten Krieg konnte so ein Weltkrieg werden. Das Attentat von Sarajewo löste den Konflikt aus, den wir heute als den schlimmsten Krieg der Menschheitsgeschichte kennen. Der Erste Weltkrieg war der erste "totale" und industriell geführte Krieg der Menschheitsgeschichte und wurde in Europa, Afrika, im Nahen Osten und Asien geführt. Etwa 17 Millionen Menschen verloren durch ihn ihr Leben. Am 11. November 1918 endete der 1914 ausgebrochene Erste Weltkrieg. 18. Januar 1919: Die Pariser Friedenskonferenz begann in Versailles. Im gleichnamigen Vertrag wurde Deutschland als Kriegsschuldiger benannt. Aber damit war nicht Schluss…
2.1 Die Republik im Glanz und Elend
Die Jahrzehnte von Ausbruch des Krieges (1914) bis zu den Nachwirkungen des Zweiten Weltkrieges (1945-) waren ein Zeitalter der Katastrophen für diese Gesellschaft. Zwei Weltkriege bewirkten durch ihre Wellen weltweit Rebellionen und Revolutionen, was für die Kolonialreiche ein Zusammenbruch bedeutete. Die gesamte Geschichte des modernen Imperialismus sollte nur eine Lebensspanne dauern – etwa so lange, wie das Leben von Winston Churchill (1874-1963) währte.
Meuternde Matrosen gaben im Herbst 1918 das Fanal zur Revolution, die binnen weniger Tage die Monarchie hinwegfegte. Zunächst übernahmen Arbeiter- und Soldatenräte die Macht. Am 9.November rief der SPD-Politiker Philipp Scheidemann die Republik aus, die aber schon von den Linken und Rechten extrem bekämpft wurde. Die einen wollten die Revolution nach bolschewistischen Vorbild, um eine kommunistische Räteherrschaft zu errichten. Die anderen forderten die Restauration des wilhelminischen Staates oder eine konservative Diktatur. Die Demokratie, wie wir sie heute kennen, war nichts als ein heiß umkämpfter Traum, der letztendlich platzen musste. Die Weimarer Republik hatte es nicht leicht.
Zwischen 1919 und 1933 wurden Deutsche mit insgesamt 17 Nobelpreisen ausgezeichnet, so die Physiker Albert Einstein und Werner Heisenberg, der Mediziner Otto Warburg und der Chroniker Carl Bosch, der Schriftsteller Thomas Mann und der Politiker Gustav Stresemann. Berlin stieg zu jener Zeit zur internationalen Kulturkapitale auf. Die Reichshauptstadt wurde zu einem Zentrum von Expressionismus und Dada, von „Neuer Sachlichkeit“ und Agitprop. Fritz Lang drehte sein „Metropolis“, das Telefon, das Auto und das Radio setzten sich in den Zwanziger Jahren durch und beschleunigte den Takt des Lebens. Raketenwagen lösten einen Temporausch aus, der auch zur Konstruktion der ersten Passagierflugzeuge führte, zu minutengenauen Putzplänen für die moderne Hausfrau und zur Einführung des Fließbandes. Was für eine ambitionierte Zeit!
Aber auch Massenarbeitslosigkeit, die vielen politischen Tragödien, die sich in Berlin abspielten, zeugten von einer unruhigen Zeit: im Chaos der Revolutionen kam die Weimarer Republik nie wirklich zur Ruhe. Bürgerkrieg, Ruhrbesetzung, Inflation, Massenelend. Vielmehr war fast immer die Maximalforderung stärker als die Bereitschaft zum Kompromiss; das Extreme setzte sich immer stärker durch.
Nach der Revolution bestimmten Armut, Hunger und Wohnungsnot den Alltag der jungen Republik. 1923 traf die Menschen eine dramatische Geldentwertung, doch das „Wunder der Rentenmark“ schaffte auf einen Schlag Stabilität und ermöglichte Deutschland einen wirtschaftlichen Aufschwung. 1924 setzte eine anhaltende Konjunktur ein, es begann eine Zeit der Innovation. Im August 1929 startete im Friedrichshafen der Zeppelin „LZ 127“ zu einer Fahrt um die Welt auf und brauchte dafür nur 21 Tage. Die Goldenen Zwanziger waren bestimmt durch tragische Ereignisse, aber auch eines ausschweifenden Nachtlebens und der Avantgarde. 20 Zeitungen erschienen allein in der Hauptstadt Berlin gleich mehrmals täglich, nirgendwo gab es mehr Telefone und binnen weniger Jahre verneunfachte sich die Zahl der Automobile. Doch etwas belastete die Weimarer Demokratie sehr: der Versailler Friedensvertrag von 1919. Die im Weltkrieg siegreichen Alliierten hatten dem Deutschen Reich eine stark verkleinerte Armee ohne moderne Waffen sowie erhebliche Gebietsabtretungen und Reparationen diktiert. Den harten Frieden nutzten die Gegner der Republik, um den Staat zu schwächen. Sie diffamierten die Politiker, die den Vertrag notgedrungen unterschrieben hatten, als Verräter.
2.2 Im Griff der Depression
Am 25. Oktober 1929 brach die New Yorker Börse zusammen, was das von Krieg und Reparationen geschwächte Deutschland besonders hart traf. „Der Schwarze Freitag“ geht als jener Tag in die Geschichte ein, an dem die Weltwirtschaftskrise ihren Anfang genommen hatte. Eine Aktienblase platzte. Schon im Sommer 1929 gab es Anzeichen, dass die seit 1922 andauernde Hochkonjunktur in den USA eine Delle bekommen würde. Doch die Spekulation an der Börse hatte den Herbst über angehalten, weil die Anleger glaubten, die Kurse würden wie all die Jahre zuvor dennoch weiter steigen. Von der vorherrschenden Euphorie hatten sich viele Menschen bis hin zur sprichwörtlichen Lieschen Müller hinreißen lassen, Aktien auf Kredit zu kaufen – im Glauben, mit den Kursgewinnen die Kredite leicht zurückzahlen zu können. Als der Aktienboom im September 1929 aber abbrach und die Kurse zu fallen begannen, und zwar drastisch am jenem, 24. Oktober, funktionierte das nicht mehr. Die verschuldeten Anleger mussten ihre Aktien verkaufen. Angesichts der immer schneller fallenden Kurse warfen jetzt mehr und mehr Leute ihre Aktien auf den Markt. Damit brach das Ganze mit Krediten aufgebaute Kartenhaus in sich zusammen. An den Immobilienmärkten kann es zu ähnlichen Übertreibungen. Diese Blase platzte ungefähr zu gleichen Zeit5.
Die gesamte Weltwirtschaft wurde mit in den Abgrund gezogen, weil die USA in den 20ern Jahren in großem Umfang Kapital exportiert hatte, vor allem nach Europa. Nach dem Crash floss nun kein Kapital mehr. Im Gegenteil: es wurde abgezogen, weil die Amerikaner es selbst brauchten6. Damit entwickelte sich die nationale Börsen- zu einer globalen Wirtschaftskrise. Und insbesondere das Deutsche Reich wurde davon hart getroffen.
Zum einen war das Deutsche Reich das größte Aufnahmeland für amerikanisches Kapital. Denn nach der Hyperinflation von 1923 hatte die Reichsbank als Anreiz für ausländische Anleger ein etwa doppelt so hohes Zinsniveau wie in den USA hergestellt. Zum anderen brauchte Deutschland ausländisches Kapital, um die jährlich 2,5 Milliarden Reichsmark an Reparationen zahlen zu können, die die Siegermächte des Ersten Weltkrieges Deutschland mit dem sogenannten Daws-Plan von 1924 auferlegt hatten. Und drittens war es eine hoch entwickelte Industriewirtschaft – die zweitgrößte der Welt -und damit auf Kapitaleinsatz besonders angewiesen. Allerdings setzte in Deutschland bereits seit 1928 ein konjunktureller Abschwung ein.
Als Erstes traf es die Exportgeschäfte: hochwertige, aber nicht lebensnotwendige Artikel wie Nürnberger Spielzeug oder Solinger Messer fanden auf dem globalen Markt keine Käufer mehr. Das Baugewerbe, weil private und auch staatliche Investitionen wegfielen, keine Straßen, Kranken- und Wohnhäuser wurden mehr in Auftrag gegeben. Die Zahl der beschäftigten Bauarbeiter sank von etwa zwei Millionen 1928 auf 775.000 im Jahr 1932.
Auch die Landbevölkerung blieb davon nicht verschont: selbst die kleinsten Bauern produzierten vor allem für den Markt. Während des Ersten Weltkrieges waren Länder wie Australien oder Kanada groß in Agrarproduktion eingestiegen. Viele Landwirte konnten ihre Hypothekenschulden nicht mehr bezahlen. Erst im Frühjahr 1931 schien sich die Wirtschaft langsam zu erholen…
2.3 Bankenkrise
Nach dem Bankrott der österreichischen Creditanstalt im Mai 1931 kamen auch Deutschland Gerüchte über die mangelnde Liquidität eines führenden Geldinstituts auf, der Darmstädter und Nationalbank. Die Gerüchte sorgten dafür, dass die Sparer ihr Geld abholten. Da das Geld nicht als Bargeld in der Kasse lag, sondern gegen Zins verliehen wurde, mussten die Schalter schließen. Eine Einlagensicherung gab es zu der Zeit noch nicht.
Unter Reichskanzler Heinrich Brüning wurde am 30. März 1930 versucht den stark defizitären Staatshaushalt auszugleichen. Da die Einnahmen zurückgingen, mussten die Ausgaben entsprechend gekürzt werden. Also wurden alle staatlichen Ausgaben für den Bausektor und die Subventionen für den Wohnungsbau eingestellt, was zur Erhöhung der Arbeitslosenzahlen führte. Löhne und Gehälter wurden drastisch gesenkt – man sagte zu der Zeit, der Gürtel müsse enger geschnallt werden. Im Grunde wollte Brüning beweisen, dass Deutschland selbst mit der rigorosesten Haushaltspolitik in der Lage sein würde, die Reparationen aufzubringen. Zwar hatte Brüning insofern Erfolg, da die Alliierten am 9.Juli 1932 der Streichung gegen eine Abschlagszahlung von drei Milliarden Reichsmark zustimmten, aber die Weltwirtschaftskrise dauerte an. Der Sparkurs trotz der Wirtschaftskrise war Gift für die Binnenwirtschaft.
Sechs Millionen Menschen waren ohne Arbeit; die Dunkelziffer lag wahrscheinlich um eine Million höher. Und nur jeder zehnte Erwerbslose erhielt Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung – für maximal sechs Wochen. Die anderen waren auf die Wohlfahrtsunterstützung angewiesen. Mehr als eine Million Arbeitslose bekamen überhaupt keine Zuwendungen mehr. Viele Menschen hungerten; die Selbstmordquote lag in Deutschland so hoch wie nirgends sonst auf der Welt: von der wirtschaftlichen Not zermürbt, nahmen sich 1932 fast 17.000 Menschen das Leben. Im September kostete ein Brot drei Millionen Mark, ein Dollar war knapp hundert Millionen wert. Und hier schwoll die NSDAP auf fast mehr als 50.000 Mitglieder an.
Eine vorzügliche Startposition für die NSDAP. Seit jeher war bekannt, dass Rollkommandos der NSDAP Veranstaltungen politischer Gegner störten und gingen sogar in Saalschlachten und Straßenkämpfen über. Schießereien, Morde: vom politischen Hass zerfressen, stand Deutschland am Rande eines Bürgerkrieges.
Die Weltwirtschaftskrise von bis dahin unbekannten Ausmaß zwang selbst die stärksten kapitalistischen Wirtschaftssysteme in die Knie. Und während die Wirtschaft taumelte, verschwanden zwischen 1917 und 1942 tatsächlich alle liberalen demokratischen Institutionen, wohingegen der Faschismus und seine autoritären Regime auf den Vormarsch waren.
Eine Wirtschaftskrise hatte Millionen Menschen ins Elend gestürzt, die regierenden Parteien verschärften die Not, Krawalle auf den Straßen häuften sich. Und so sahen viele Bürger in dem rechtsradikalen Vorsitzenden der NSDAP einen Heilsbringer: Adolf Hitler, so glaubten sie, werde die Nation in eine bessere Zukunft führen.