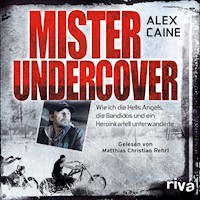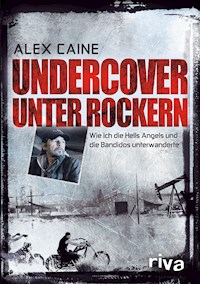
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Riva
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Jetzt der dritte Teil der Bestsellerserie **Falscher Engel** und **Racheengel** Die Hells Angels, die Bandidos, asiatische Dealerbanden, russische Gangster und sogar den Ku-Klux-Klan - Undercover-Agent Alex Caine hat sie alle infiltriert. Über 25 Jahre lang war der Frankokanadier als Informant für die kanadischen und US-amerikanischen Behörden tätig und schleuste sich dafür in kriminelle Gangs ein. Für jeden Job zog er um, wechselte seine Identität und manchmal seinen Namen. Er gab sich als Biker, Fotograf oder Eventveranstalter aus, kaufte große Mengen an Drogen und Waffen und führte ein aufregendes, gefährliches Leben als V-Mann unter Gangstern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 549
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
ALEX CAINE
Wie ich die Hells Angels, Bandidos, ein Heroinkartell und den Ku-Klux-Klan unterwanderte
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
2. Auflage 2014
© 2011 by riva Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Nymphenburger Straße 86
D-80636 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Die englische Originalausgabe erschien 2008 bei Random House Canada, a division of Random House of Canada Limited, Toronto, Kanada, unter dem Titel Befriend and Betray. Infiltrating the Hells Angels, Bandidos and Other Criminal Brotherhoods. © 2008 by Alex Caine und Aranteli Productions. All rights reserved.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Übersetzung: Martin Rometsch
Lektorat: Caroline Kazianka
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, unter Verwendung von Thinkstock und einem Autorenfoto von © Alain Roberge
Layout und Satz: HJR – Manfred Zech, Landsberg
Druck: GGP Media GmbH, Pößneck
Printed in Germany
ISBN Print 978-3-86883-131-3
ISBN E-Book (PDF) 978-3-86413-046-5
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-86413-058-8
Weitere Infos zum Thema
www.rivaverlag.de
Gern übersenden wir Ihnen unser aktuelles Verlagsprogramm.
Für meine Kinder, die unter meinem Beruf leiden mussten und mich dennoch lieben.
--------
Die Namen einiger Personen in diesem Buch wurden geändert, um Unschuldige zu schützen.
Vorwort
Autobahn 8, Anfang Mai 2002, unterwegs von San Diego nach Osten.
Seitdem ich angefangen hatte, gegen die Dago Hells Angels zu ermitteln, hatten mir Leute, denen ich vertraute, immer wieder geraten, meine Koffer zu packen und Südkalifornien zu verlassen. Das könne nur böse enden, hatten sie gesagt. Jetzt, zwei Jahre danach, befolgte ich endlich ihren Rat, und zwar ziemlich schnell.
Ich hielt mich nicht einmal groß mit Packen auf. Ich schmiss einfach ein paar Kleider, einige Papiere, meinen Computer und ein paar CDs für die Fahrt in meinen Nissan-Pick-up, rief meinen Hund und fuhr nach Osten in die Wüste.
Der Abschied von meinen Betreuern bei der Polizei war kurz gewesen. Sie hatten mich gebeten, noch eine Nacht in der Gegend von San Diego zu verbringen, damit wir ein Abschiedsessen veranstalten konnten. Ich ließ sie daher für mich ein Zimmer in einem Motel buchen, aber als ich dann in meinem Auto saß und unterwegs war, hatte ich keine Lust mehr auf einen Zwischenstopp.
Der Abschied von meinen Bikerkumpels war noch abrupter gewesen: Ich hatte sie mit kreischenden Reifen und in einer Wolke aus verbranntem Gummi verlassen, nachdem Bobby Perez, das unberechenbarste und bösartigste Mitglied der San Diego – oder Dago – Hells Angels, mir gezeigt hatte, dass die Dinge einen unangenehmen Verlauf nehmen würden.
Einige Tag zuvor hatte er mich gebeten, seine Waffe – eine kleine Bersa.380 – von Laughlin in Nevada nach El Cajon in Kalifornien zu bringen, nachdem drei Biker in einem Kasino erschossen worden waren. Ich wusste nicht, ob die Bersa bei der Schießerei benutzt worden war oder ob Bobby sie nur nicht selbst über die Staatsgrenze bringen wollte. Immerhin war er auf Bewährung frei und hätte Kalifornien eigentlich nicht einmal verlassen dürfen, geschweige denn mit Kriminellen Kontakt haben. Seine Bitte, die Waffe ins heimische Revier der Dago Hells Angels zurückzubringen, war auf jeden Fall ein enormer Vertrauensbeweis. Doch als meine Kontaktleute bei der Polizei die Waffe beschlagnahmten und erklärten, dass sie mir nicht erlauben könnten, sie einem verurteilten Straftäter zurückzugeben, vermasselten sie mir jede Möglichkeit, noch tiefer ins Allerheiligste der Gang einzudringen. »Sagen Sie Bobby, dass Sie das Ding vergraben mussten«, rieten sie mir. »Oder dass Sie es verloren haben. Egal was, denken Sie sich etwas aus.«
Etwas Dümmeres hätten sie nicht tun können, zumal die kleine Waffe Bobby offenbar sehr wichtig war. Als er mich bei einem Treffen spätabends auf einem Parkplatz in El Cajon danach fragte, vertröstete ich ihn mit der Behauptung, ich hätte sie ganz unten im Motor meines Autos versteckt und noch keine Zeit gehabt, sie herauszuholen. Bobby sah mich wütend an und befahl mir dann: »Bring sie morgen um zehn Uhr in die Bar!«
Am nächsten Morgen sollte eine Gedenkfahrt stattfinden, denn einige Tage zuvor war ein Biker umgekommen. Christian Tate, ein Mitglied der Dago Hells Angels, war auf seinem Motorrad von hinten erschossen worden, als er von Laughlin nach Kalifornien gefahren war, etwa eine Stunde vor dem Schusswechsel im Kasino. Und Bobby brauchte die .380 offenbar für diese Fahrt.
Nach der Szene auf dem Parkplatz überlegte ich, ob es nicht besser wäre, den Dago-Fall aufzugeben. Er hatte sich seit einiger Zeit nach Süden ausgeweitet, schon bevor die stümperhafte und streng geheime Polizeiaktion gegen einen Drogentransport der Hells Angels in der Wüste zu wer weiß wie vielen Leichen geführt hatte. Ich hatte vier Biker und zwei Polizisten sterben sehen, bevor man mich schließlich aus diesem Schlamassel herausholte.
In diesem Fall hatte es von Anfang an kein klares Ziel gegeben. Er hatte 1999 mit Ermittlungen gegen einen Quebecer begonnen, der verdächtigt wurde, Kokain von Kolumbien nach Kalifornien und dann mit Unterstützung der Dago Hells Angels nach Kanada zu schmuggeln. Aber der Kerl war einen Tag vor meiner Ankunft in Kalifornien verschwunden. So war aus dem Fall eine Unterwanderung der Dago Angels geworden – wir sammelten Informationen, ohne damit gezielt die Festnahme und Verurteilung von Ganoven zu planen. Um mit der Gang Kontakt aufzunehmen, eröffnete ich ein Fotostudio und spezialisierte mich auf Bewerbungsmappen für Stripperinnen, »Bikepornos« – Bilder von üppig verchromten Harleys vor der untergehenden Sonne – und Ähnliches. Mit der Zeit luden mich immer wieder Gangmitglieder und ihr Umfeld als Fotograf zu Partys und Versammlungen ein. Natürlich durfte ich dabei keinen Biker kompromittieren, ich hütete mich also davor, jemanden zum Beispiel mit der Nase in einem großen Haufen Kokain zu knipsen.
Nach einigen Monaten begann ich dann, von Leuten, die mit der Gang in Verbindung standen, Kokain und Crystal in moderaten Mengen zu kaufen. Außerdem erwarb ich gestohlene Autos und Waffen: vollautomatische Maschinenpistolen, M-16-Gewehre, umgebaute SKS-Karabiner, Handgranaten und so weiter. Ich gab mich als krimineller Mittelsmann aus, der sich für beinahe alles interessierte, was Geld einbrachte. Dank dieser Käufe entwickelte sich unser kleiner Fall weiter, und wir strebten nun Festnahmen und Verurteilungen an.
Trotzdem war das Ziel immer noch nicht genau umrissen, außerdem neigten meine Kontaktleute zu gefährlichen spontanen Entscheidungen. Im Laufe von zwei Jahren sammelte ich Informationen über korrupte Soldaten, die Gewehre verscherbelten, mexikanische Grenzgänger, die Waffen und Menschen schmuggelten, und russische Mafiosi. Nebenbei kümmerte ich mich um die Hells Angels und ihre Verbündeten. Das Problem war, dass wir wegen dieser vielen verschiedenen Einsatzbereiche nie einen Endpunkt bestimmen konnten, einen Punkt, an dem es hieß: »Gut, jetzt wissen wir genug und es ist Zeit aufzuhören.«
Schlimmer noch: Ich hatte schon früh den vagen Verdacht, dass Operation Five Star nicht vertrauenswürdig war. Gemeint ist die Einsatzgruppe, für die ich arbeitete und die aus Leuten aus der Drug Enforcement Administration (DEA; Bundesbehörde zur Drogenbekämpfung), dem Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF; Behörde für die Überwachung von Alkohol, Tabak,Schusswaffen und Sprengstoffen), dem Sheriffbüro von San Diego und der Stadtpolizei von San Diego und El Cajon bestand. Anscheinend sickerten Informationen an die falschen Leute durch. Anfangs war es nur ein Bauchgefühl ohne greifbare Beweise. Aber im Herbst 2001 rief mich ein bekannter FBI-Chef aus San Francisco an, der schon eine Menge Biker festgenommen hatte, und bat mich um eine Unterredung. Wie sich herausstellte, hatte er den gleichen Verdacht.
Das alles hätte mich zusammen mit der Schießerei in der Wüste eigentlich veranlassen sollen, aus diesem Fall auszusteigen, und zwar schon bevor Bobby Perez mir befahl, ihm seine Waffe zurückzugeben. Aber ich führe gerne zu Ende, was ich angefangen habe, und meine Sicherheit war nie ernsthaft bedroht gewesen. Außerdem wurde ich gut bezahlt: 5000 Dollar plus Spesen im Monat, genug, um für meine zweite Frau und meine Tochter ein neues Haus in Kanada zukaufen.
Die Begegnung auf dem Parkplatz überzeugte mich schließlich doch davon, dass der Fall zumindest für mich mit ziemlicher Sicherheit beendet war. Trotzdem nahm ich aus irgendeinem Grund an, dass ich den unvermeidlichen Streit mit Bobby um wenigstens einen oder zwei Tage hinauszögern konnte. Also fuhr ich am nächsten Tag um Punkt zehn Uhr auf das Gelände am El Cajon Boulevard, das praktisch den Hells Angels gehörte. Dort standen ihr Clubhaus, das »Dumont’s«, besser bekannt als »die Bar«, und Stetts Motorradgeschäft.
Als ich vorfuhr, lungerten bereits Hunderte von Bikern auf dem Gehweg vor der Bar herum. Und mittendrin stand Bobby. Ich parkte vor einem Hydranten, ohne den Motor abzustellen.
Schon während ich auf Bobby zuging, merkte ich, dass er heute wohl besonders schlecht gelaunt war.
»Hast du sie mitgebracht?«, fragte er.
»Ich finde sie nicht mehr«, sagte ich. »Sie muss während der Fahrt auf die Straße gefallen sein.«
Bobby begann zu zittern. »Komm mit mir nach hinten«, knurrte er. Ich wusste, was sich dort oft abspielte, und hatte keine Lust, mitzugehen.
»Klar«, antwortete ich und drehte mich um, »aber zuerst muss ich richtig parken und den Motor abstellen. Bin gleich wieder da.« Dann sprang ich schnell in mein Auto und fuhr los.
Bobby schrie einem Typen zu, dass er mich aufhalten solle. Und tatsächlich zog der Kerl an der Tür auf der Beifahrerseite, aber sie war zum Glück abgesperrt. Als ich Vollgas gab, ließ er los. Dann raste ich davon, fuhr in mein Studio, um ein paar wichtige Sachen zu holen, und war wieder unterwegs.
In einem schlechten Roman würde der nächste Satz vielleicht lauten: »Eine Woge der Erleichterung umspülte mich, als ich in die reine, klare Wüstenluft fuhr, weg von der Gefahr und dem Verrat der vergangenen zwei Jahre.« Aber wenn ich überhaupt so etwas wie Erleichterung verspürte, dann war es eher ein Tröpfeln als eine Woge. Natürlich war es ein gutes Gefühl, El Cajon und San Diego zu verlassen und mein Leben wieder selbst bestimmen zu können. Es gab jetzt keine Polizisten oder Hells Angels mehr, die mir sagten, was ich zu tun hatte. Doch das gesamte Gebiet zwischen San Diego in Kalifornien und Phoenix in Arizona, das 480 Kilometer östlich liegt, gehört zum Revier der Hells Angels. Es war durchaus denkbar, dass Bobby vor der Fahrt zu Christian Tates Beerdigung die Hells-Angels-Mitglieder östlich und nördlich von San Diego angerufen hatte, damit sie mich suchten. Andererseits war die Teilnahme an der Gedenkfahrt für ein Mitglied – für jedes Mitglied, selbst wenn es wie Tate ein eher unbedeutendes war – für alle Hells Angels der Umgebung Pflicht und für alle befreundeten Clubs sehr zu empfehlen. Darum hoffte ich, dass sich alle, die mich möglicherweise aufhalten wollten, bereits hinter mir befanden.
Es war auf jeden Fall schon einmal gut, dass niemand in meinem Studio aufgetaucht war, als ich gepackt hatte. Mein Unbehagen flaute daher ein wenig ab, in der Wüste nahm es dann allerdings wieder zu. Während meines Aufenthalts in San Diego hatte ich viele Sonntage in der Wüste verbracht. Ich war oft mit Hund oder allein spazieren oder auf Entdeckungsreise gegangen. Die Ruhe und der Frieden dieser Gegend hatten mir gut getan. Aber jetzt war die Wüste keine stille, erholsame Oase mehr, sondern ich fühlte mich nur sehr verwundbar.
Doch je weiter ich fuhr, je weiter ich das Chaos hinter mir ließ, desto besser fühlte ich mich. An den beiden ersten Tagen schlief ich nur kurz auf Rastplätzen und Lkw-Parkplätzen und fuhr die Nacht durch, um die Entfernung zwischen mir und meinen Problemen zu vergrößern. Später, im Mittleren Westen und weiter östlich, wurde ich dann ruhiger und legte regelmäßige Pausen ein, um Sehenswürdigkeiten zu besichtigen, etwas zu essen oder in einem Motel zu übernachten.
Während der ganzen Zeit dachte ich über diesen Einsatz nach, der eben so spektakulär zu Ende gegangen war, und über meine Karriere als gedungener Agent.
Seit fast 25 Jahren, also beinahe die Hälfte meines Lebens, habe ich für diverse Polizeibehörden gearbeitet – RCMP (Royal Canadian Monted Police); königliche kanadische berittene Polizei), FBI, DEA, ATF, RHKP (Royal Hong Kong Police), RNC (Royal Newfoundland Constabulary; Polizei des früheren Neufundland) – und mich in kriminelle Vereinigungen auf der ganzen Welt eingeschlichen, um der Polizei bei deren Zerschlagung zu helfen. Meine Ziele waren kriminelle Biker, die chinesische Mafia, russische Mafiosi, pakistanische Heroinschmuggler sowie ganz gewöhnliche Drogenbarone, korrupte Polizisten und Militärs, sogar der Ku-Klux-Klan. Die Arbeit war immer lukrativ und aufregend gewesen, und ich hatte immer für die Guten gekämpft, aber was hatte mir das genutzt? Und was hatte es aus mir gemacht? Für jeden Auftrag musste ich mir ein paar Monate oder auch mehrere Jahre lang eine neue Identität zulegen. Manchmal gab ich mich als Verbrecher aus, als Berufskiller oder Drogenhändler. Bisweilen war meine Deckung auch komplexer, dann war ich ein Versicherer, der auf Investmentbetrug und Geldwäsche spezialisiert war, ein Importeur, der auch Drogen und Prostituierte ins Land und gestohlene Luxusautos aus dem Land brachte, oder ein Konzertveranstalter, der an allem interessiert war, was Geld einbrachte.
Ich identifizierte mich immer total mit diesen Personen, lebte mich ganz in sie hinein und schob mein wahres Ich dafür beiseite. Dabei glaubte ich stets, dass ich dieses wahre Ich dann problemlos wiederauferstehen lassen konnte, wenn der Job beendet war. Aber mit der Zeit wurde mir klar, dass mein wahres Ich, wie auch immer es aussehen mochte, mangels Sonnenlicht allmählich verwelkte, mangels Nahrung vertrocknete und mangels Übung verkümmerte.
Sogar zwischen den Jobs – die meist mehrere Monate dauerten – war es schwierig, wieder ich selbst zu werden. Wenn mein Auftrag zu einer Festnahme geführt hatte, dann verbrachte ich diese Zeit oft mit Vorbereitungen auf die Gerichtsverhandlung, oder ich ruhte mich einfach nur aus. In beiden Fällen war es schwer, meine alte Persönlichkeit wieder anzunehmen. Außerdem stand oft schon der nächste Auftrag in Aussicht.
Schon oft hatte ich ans Aussteigen gedacht. Und bis Mitte der achtziger Jahre, als ich mich mit dem Ku-Klux-Klan einließ, hatte ich meine Arbeit nie als echten Beruf angesehen, höchstens als Serie von Jobs, die mir irgendwie zugefallen waren und aus denen ich ebenso plötzlich und ungeplant wieder entlassen worden war. Aber kein Job war so unbefriedigend gewesen wie der in San Diego. Keiner hatte uns unserem Ziel so nahe gebracht und keiner hatte einen so bitteren Nachgeschmack bei mir hinterlassen.
Ich war auch noch nie zuvor so entschlossen, alles hinzuschmeißen, wie auf dieser Autobahnfahrt quer durch den Süden des Mittleren Westens und dann die Ostküste entlang nach Maine. Dort fuhr ich über die Grenze nach New Brunswick und dann Richtung Ostkanada zu meiner Familie. Das Gefühl, endlich wirklich ausgestiegen zu sein, wurde immer stärker. Mein Auftrag hatte sich nicht nur sehr verändert, seitdem ich begonnen hatte, und das nicht zum Besseren, ich spürte auch, dass ich langsam zu alt für solche Jobs wurde, dass mich das Ganze zu sehr mitnahm. All dies führte dazu, dass ich endlich das tat, was die Polizisten, mit denen ich zusammengearbeitet hatte, mir schon oft geraten hatten: Ich setzte mich hin und schrieb meine Geschichte auf.
Kapitel eins
Ein ganz anderes Leben
Viele Leute führennicht das Leben, das ursprünglich von ihnen erwartet wurde. Bauern ziehen Kinder groß, die Künstler werden, Fabrikarbeiter haben Kinder, die Forscher und Universitätsprofessoren werden. Und es gibt Schläger und Verbrecher, die in wohlhabenden Diplomaten-, Anwalts- oder Arztfamilien aufgewachsen sind. Aber es gibt wahrscheinlich nicht viele Äpfel, die so weit vom Stamm fallen wie ich. Ich hätte durchaus in einem ganz anderen Obstgarten landen können.
Ich wurde in einer Arbeiterfamilie in Hull, Quebec, geboren, sozusagen im Schatten des kanadischen Parlaments, das hoch oben auf einem Felsen jenseits des Flusses Ottawa steht und auf uns herabschaute, und doch eine ganze Welt davon entfernt. War das englischsprachige Ottawa nach dem Krieg ein eigenartiger Ort, eine Stadt der Holzhändler, die gerne eine internationale Hauptstadt gewesen wäre, dann litt das französischsprachige Hull nicht an solchen hochmütigen Anwandlungen: Hull war eine Stadt der Holz- und Papierindustrie, in der die katholische Kirche immer noch weitgehend das Sagen hatte, in der es aber dennoch auch Bordelle und Bars gab.
Mein Vater arbeitete nicht in den Fabriken, sondern im Château d’Eau, dem städtischen Wasserwerk, das sowohl das Wasser der Stadt filterte als auch den Strom für die Straßenlampen und öffentlichen Gebäude lieferte. Er hatte die Stelle ein oder zwei Jahre nach seiner Rückkehr aus dem Zweiten Weltkrieg bekommen, kurz bevor ich geboren wurde. Vor dem Krieg war die Musik sein Leben gewesen, und er hatte sich sein Geld als Banjo- und Gitarrenspieler bei zahllosen Hochzeiten und Partys verdient. »Ich habe Frauen und Freibier bekommen, und mehr brauchte ich nicht«, pflegte er zu sagen. Aber aus dem Krieg kam er mit meiner Mutter nach Hause zurück, die er in Halifax, seiner Marinebasis auf dem Weg von und nach Europa, kennengelernt hatte. Daher brauchte er jetzt eine richtige Arbeit. Er bekam den Job durch Vermittlung seines Bruders Alfred, den wir immer »mon’onc Fred« nannten. Fred hatte zusammen mit meinem Vater in der Marine gedient, und beide hatten am D-Day an der Operation Juno Beach, der Landung der Alliierten in der Normandie, teilgenommen. Als er nach Hause kam, ergatterte er eine Stellung als Briefträger.
Es sah ganz so aus, als sei meiner Familie ein Leben im Wohlstand und im Glück der Nachkriegszeit vorbestimmt – feste Arbeitsplätze, Familie, Frieden. Aber es gab ein Problem, vielleicht auch drei: Meine Mutter war halb Irin, halb Indianerin und sprach kein Wort Französisch.
Für die Familie meines Vaters bedeutete Quebec die Welt, und es gab kaum etwas Schlimmeres für sie, als »englisch« zu sein. Die Engländer waren protestantische Eroberer, Besatzer und Schwindler. Sie waren die Bosse und somit auch die Leute, die dafür verantwortlich waren, dass die Franzosen weniger Geld verdienten und keine leitenden Stellungen bekamen. Sie waren die humorlosen, verklemmten, überlegenen Geizhälse, die die Regeln bestimmten und einem den Spaß am Leben verdarben. Meine Großmutter sagte oft: »Un anglais trouverait une roche dans six pieds de neige« – ein Engländer würde einen Stein noch in zwei Meter hohem Schnee finden. Was immer das genau bedeuten mochte.
Aber Irin oder Indianerin – und sogar beides zugleich – zu sein, war noch schlimmer, als Engländerin zu sein. Die Iren galten als Widerlinge, die bereit waren, für einen Hungerlohn zu arbeiten, und den Franzosen die Jobs stahlen. Dass sie katholisch waren, war zwar ein kleiner Pluspunkt, dass ihre Kirche aber drüben in Ottawa war, galt als weiterer Beweis dafür, dass sie Handlanger der Engländer waren. Und auf die Indianer sahen sowieso alle herab, und das aus jedem Grund, der sich irgendwie gerade anbot. Sie waren Trinker, arm oder sprachen einfach nicht Französisch. Und obwohl es viele Katholiken unter ihnen gab, galten sie im Grunde genommen als Heiden.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!