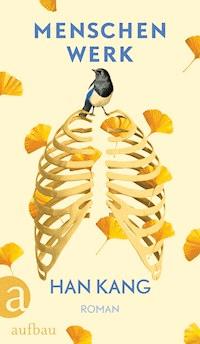18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Nobelpreis für Literatur 2024
Der neue große Roman von Han Kang
»Unmöglicher Abschied« erzählt die Geschichte einer Freundschaft zwischen zwei Frauen und beleuchtet zugleich ein jahrzehntelang verschwiegenes Kapitel koreanischer Geschichte.
Eines Morgens ruft Inseon ihre Freundin Gyeongha zu sich ins Krankenhaus von Seoul. Sie hatte einen Unfall und bittet Gyeongha, ihr Zuhause auf der Insel Jeju aufzusuchen, weil ihr kleiner weißer Vogel sterben wird, wenn ihn niemand füttert. Als Gyeongha auf der Insel ankommt, bricht ein Schneesturm herein. Der Weg zu Inseons Haus wird zu einem Überlebenskampf gegen die Kälte, die mit jedem Schritt mehr in sie eindringt. Noch ahnt sie nicht, was sie dort erwartet: die verschüttete Geschichte von Inseons Familie, die eng verbunden ist mit einem lang verdrängten Kapitel koreanischer Geschichte. Han Kangs neuer Roman ist eine Hymne an die Freundschaft und das Erinnern, die Geschichte einer tiefen Liebe im Angesicht unsäglicher Gewalt – und eine Feier des Lebens, wie zerbrechlich es auch sein mag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 348
Ähnliche
Über das Buch
Eines Morgens ruft Inseon ihre Freundin Gyeongha zu sich ins Krankenhaus von Seoul. Sie hatte einen Unfall und bittet Gyeongha, ihr Zuhause auf der Insel Jeju aufzusuchen, weil ihr kleiner weißer Vogel sterben wird, wenn ihn niemand füttert. Als Gyeongha auf der Insel ankommt, bricht ein Schneesturm herein. Der Weg zu Inseons Haus wird zu einem Überlebenskampf gegen die schreckliche Kälte, die mit jedem Schritt mehr in sie eindringt. Noch ahnt sie nicht, was sie dort erwartet: die verschüttete Geschichte von Inseons Familie, die eng verbunden ist mit einem lang verdrängten Kapitel koreanischer Geschichte. Han Kangs neuer Roman ist eine Hymne an die Freundschaft und das Erinnern, die Geschichte einer tiefen Liebe im Angesicht unsäglicher Gewalt – und eine Feier des Lebens, wie zerbrechlich es auch sein mag.
Über Han Kang
Han Kang wurde 1970 in Gwangju, Südkorea, geboren und ist die wichtigste literarische Stimme Koreas. 1993 debütierte sie als Dichterin, ihr erster Roman erschien 1994. Mit »Die Vegetarierin« wurde sie einem breiten internationalen Publikum bekannt und erhielt gemeinsam mit ihrer Übersetzerin 2016 den Man Booker International Prize. 2024 wurde Han Kang mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Sie lebt in Seoul.
Im Aufbau Verlag sind von Han Kang erschienen: »Die Vegetarierin« (2016), »Menschenwerk« (2017), »Deine kalten Hände« (2019), »Weiß« (2020) und »Griechischstunden« (2024). Mehr zur Autorin unter han-kang.net
Ki-Hyang Lee, geboren 1967 in Seoul, studierte Germanistik in Seoul, Würzburg und München. Sie lebt in München und arbeitet als Lektorin, Übersetzerin und Verlegerin. Für ihre Übersetzungen wurde sie 2024 mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Han Kang
Unmöglicher Abschied
Roman
Aus dem Koreanischen von Ki-Hyang Lee
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Erster Teil — Vogel
Kapitel 1
Kristall
Kapitel 2
Faden
Kapitel 3
Schneesturm
Kapitel 4
Vogel
Kapitel 5
Das letzte Dämmerlicht
Kapitel 6
Bäume
Zweiter Teil — Nacht
Kapitel 1
Unmöglicher Abschied
Kapitel 2
Schatten
Kapitel 3
Wind
Kapitel 4
Stille
Kapitel 5
Schneefall
Kapitel 6
Am Grund des Ozeans
Dritter Teil — Flamme
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
Erster Teil
Vogel
1
Kristall
Es schneite stark.
Ich stand auf einem Acker, an dessen einem Ende sich ein niedriger Berg anschloss. Auf dieser Seite war er vom Fuß bis zur Kuppe mit Tausenden von schwarzen Baumstämmen bestanden, die etwa so dick wie Eisenbahnschwellen und verschieden hoch waren, wie Menschen unterschiedlichen Alters. Zugleich waren sie nicht kerzengerade gewachsen, sondern leicht gebogen oder geneigt und wirkten, als hätte man am Hang Tausende von Männern, Frauen und mageren Kindern im Schnee ausgesetzt, die die Schultern hochzogen.
Ist das hier ein Friedhof?, fragte ich mich.
Sind all diese Baumstümpfe Grabsteine?
Ich wanderte zwischen den dunklen Stämmen, auf denen Schneeflocken wie Salzkristalle lagen, und den jeweils dahinter liegenden Erdhügeln umher. Unvermittelt blieb ich stehen, weil ich seit einer Weile Wasser unter meinen Turnschuhen spürte. Seltsam, ging es mir durch den Kopf, als ich bemerkte, dass mir das Wasser inzwischen bis zu den Knöcheln stand. Ich wandte mich um und traute meinen Augen nicht. Dort, wo ich am Ende des Ackers den Horizont wahrgenommen hatte, befand sich ein Meer. Gerade kam die Flut.
Ohne darüber nachzudenken, stellte ich mir die Frage:
Warum legt man an solch einem Ort einen Friedhof an?
Immer schneller drängte das Wasser heran. Kamen und gingen die Gezeiten jeden Tag auf diese Art und Weise? Waren dadurch nur noch gewölbte Erdhügel von den Gräbern übrig geblieben, und hatte das Meer all die Knochen davongeschwemmt?
Die Zeit wurde knapp. Für die bereits überspülten Gräber kam jede Hilfe zu spät, aber die Gebeine der Toten aus den höher gelegenen Gräbern mussten umgehend an einen anderen Ort umgebettet werden, bevor das Meer weiter vorrückte. Aber wie? Außer mir war weit und breit niemand da. Ich hatte nicht einmal eine Schaufel. Wie aber sollte ich mit all diesen Gräbern verfahren? Ohne zu wissen, was ich tun sollte, pflügte ich inmitten der schwarzen Stümpfe hastig durch das Wasser, das mir inzwischen bis zum Knie reichte.
Als ich meine Augen öffnete, war der Tag noch nicht angebrochen. Ich befand mich in einem dunklen Raum und sah aus dem Fenster. Es gab keinen verschneiten Acker, keine schwarzen Baumstümpfe und auch keinen ansteigenden Meeresspiegel. Ich schloss meine Augen wieder. Während mir klar wurde, dass ich erneut von der Stadt geträumt hatte, bedeckte ich meine Augen mit meinen kalten Händen und lag noch eine Weile reglos da.
*
Ich hatte diesen Traum im Sommer 2014, fast zwei Monate nachdem ich ein Buch über das Massaker in jener Stadt veröffentlicht hatte. In den vier Jahren danach habe ich die Bedeutung des Traums nie hinterfragt, und erst im letzten Sommer kam mir zum ersten Mal der Gedanke, dass ich vielleicht gar nicht von der Stadt geträumt hatte, dass meine vorschnelle, wenn auch naheliegende Schlussfolgerung vielleicht eine Fehldeutung gewesen war oder ich es mir zu einfach damit gemacht hatte. Hinter dem Traum musste noch mehr stecken.
Ungefähr zu dieser Zeit herrschten fast drei Wochen lang tropische Nächte. Ich lag wie üblich im Wohnzimmer unter der kaputten Klimaanlage und versuchte, zu schlafen. Bereits mehrfach hatte ich kalt geduscht, lag aber trotzdem mit dem Rücken auf dem blanken Boden, ohne dass mein verschwitzter Körper Abkühlung erfuhr. Erst gegen fünf Uhr morgens spürte ich, wie die Temperatur leicht sank. Ein kurzer Segen, da die Sonne eine halbe Stunde später wieder aufgehen würde.
Ich glaubte, endlich für eine Weile dahindämmern zu können, da war ich auch schon fast eingeschlafen. In diesem Augenblick schob sich der Acker plötzlich hinter meine geschlossenen Augenlider: der Schneesturm, über Tausenden von schwarzen Baumstümpfen tobend, auf denen sich wie Salz glitzernde Schneeflocken anhäuften. All das war so lebendig wie die Wirklichkeit.
Ich weiß nicht, warum ich in diesem Moment zu zittern begann. Es war dasselbe Beben wie kurz vor einem Heulkrampf, doch weder flossen Tränen, noch stand mir auch nur das Wasser in den Augen. Kann man es Angst nennen? Furcht, Erschaudern, ein plötzlicher Schmerz? Nein, es war eher, als ob man fröstelnd erwacht und mit den Zähnen klappert. Als ob ein riesiges, unsichtbares Schwert – eine schwere, stählerne Klinge, die keine menschliche Kraft zu heben vermochte –, mit der Spitze auf mich weisend, über mir in der Luft schwebte. Es kam mir so vor, als läge ich der Klinge von Angesicht zu Angesicht gegenüber.
Da dachte ich zum ersten Mal, dass das bedrohliche blaue Meer, das herangeflutet war, um die Knochen unter den Grabhügeln hinwegzuspülen, vielleicht nicht für die abgeschlachteten Menschen und die Zeit danach stand. Womöglich war es eine persönliche Prophezeiung. Der Ort, an dem sich die schweigenden Grabsteine und versunkenen Ruhestätten befanden, könnte die Geschichte meines zukünftigen Lebens erzählt haben.
Also des gegenwärtigen.
*
In den vier Jahren seit der Nacht, in der mich der Traum zum ersten Mal heimgesucht hatte, bis zu jenem Sommermorgen habe ich mehrere private Abschiede vollzogen. Manche davon aus freien Stücken, andere hätte ich nie für möglich gehalten und alles darangesetzt, sie abzuwenden. Wenn es irgendwo im Paradies oder im Totenreich so etwas wie einen riesigen Spiegel gibt, der uns auf Schritt und Tritt beobachtet und jede unserer Taten aufzeichnet, wie einige archaische Religionen behaupten, dann erscheint diese Zeit meines Lebens darin wie eine Schnecke, die ihr Gehäuse abstreift und über die Schneide eines Messers gleitet. Ein Körper, der sich ans Leben klammert. Ein Körper mit tiefen Schnitten und Stichwunden. Ein Körper, der sich losreißt und zugleich festkrallt. Ein Körper, am Boden zerstört, bettelnd. Dem ein endloser Strom von Blut, Schlamm oder Tränen entweicht.
Der Frühling war schon fast vorüber, als ich all die kräftezehrenden Angelegenheiten hinter mich gebracht und eine Apartmentwohnung in der Nähe von Seoul bezogen hatte. Ich hatte noch nicht realisiert, dass ich keine Familie mehr hatte, um die ich mich kümmern musste, und keinen Job, den ich ausüben konnte. Lange Zeit hatte ich gearbeitet, um über die Runden zu kommen, und mich gleichzeitig um meine Familie gekümmert. Und weil beides Priorität hatte, verzichtete ich auf Schlaf und schrieb in der heimlichen Hoffnung, mich irgendwann dieser Tätigkeit nach Herzenslust und ohne Zeitdruck widmen zu können. Doch plötzlich war dieser Durst nicht mehr da.
Ich ließ liegen, was die Arbeiter der Umzugsfirma notdürftig ausgepackt hatten, und verbrachte bis Juli die meiste Zeit im Bett, ohne dabei viel zu schlafen. Ich bereitete mir kein Essen zu und verließ die Wohnung nicht. Ich trank Wasser, aß etwas Reis und mildes Kimchi, das ich über das Internet bestellt hatte, und wenn mir die Migräne Magenkrämpfe bescherte, erbrach ich alles, was ich zu mir genommen hatte, in die Toilettenschüssel. Eines Nachts verfasste ich ein Testament in Form eines Briefes. Der Text begann mit dem Satz: »Ich bitte Sie, einige Dinge für mich zu erledigen«, und listete knapp auf, in welchen Schubladen und Kisten sich meine Sparbücher, Versicherungspolicen und der Mietvertrag befanden, wie viel von dem Geld, das ich hinterließ, wofür ausgegeben werden sollte, und wem der Rest zugedacht war. Allein, es fehlte der Empfänger, der mir den Gefallen hätte tun können. Das lag daran, dass ich zweifelte, wem ich so eine Aufgabe aufbürden konnte. Ich fügte Sätze des Dankes und der Entschuldigung an den Betreffenden hinzu, stellte einen konkreten Betrag als Aufwandsentschädigung in Aussicht und brachte es dennoch nicht fertig, einen Namen niederzuschreiben.
Dass ich mich am Ende von meinem Lager erhob, wo ich weder richtig geschlafen hatte noch meinem persönlichen Elend entkommen war, hatte mit meiner Rücksicht dem nicht genannten Adressaten gegenüber zu tun. Ich begann, die Wohnung aufzuräumen, und rief mir die wenigen meiner Bekannten ins Gedächtnis, die ich noch nicht als mögliche Nachlassverwalter in Erwägung gezogen hatte. Ich musste die leeren Mineralwasserflaschen entsorgen, die sich in der Küche stapelten, desgleichen meine Kleidung und die Bettwäsche, die anderen zu hinterlassen eine Zumutung darstellen würde, sowie Aufzeichnungen in Form von Tagebüchern und Kladden. Während ich einen Schwung Müll in den Händen hielt, schlüpfte ich zum ersten Mal seit zwei Monaten in meine Turnschuhe und öffnete die Wohnungstür. Das Licht eines Sommernachmittags strömte in den nach Westen ausgerichteten Flur, als wäre das ein völlig neuer Anblick. Ich nahm den Aufzug und fuhr nach unten. Als ich am Pförtnerhäuschen vorbeigegangen war und den Hof des Wohnkomplexes überquerte, spürte ich, dass ich Teil von etwas war: Von dieser Welt, in der wir leben. Vom Wetter an diesem Tag. Von der Luftfeuchtigkeit und der Schwerkraft.
Zurück im Apartment, ging ich ins Bad, drehte das heiße Wasser in der Dusche auf und setzte mich bekleidet darunter, anstatt weiter die Unordnung im Wohnzimmer zusammenzuklauben und in Säcke zu packen. Ich erinnere mich noch an das Gefühl der Fliesen unter meinen Fußsohlen, und wie mir der Wasserdampf allmählich den Atem nahm, während das weiße Baumwoll‑T-Shirt durchnässt an meinem Rücken klebte und mir der heiße Brausestrahl vom Pony, der beinah meine Augen bedeckte, über das Kinn und die Brust bis zum Bauch lief.
Ich verließ das Bad, zog meine nassen Klamotten aus, durchwühlte den Stapel der Wegwerfwäsche nach etwas Anziehbarem und streifte es über. Dann faltete ich zwei Zehntausend-Won-Scheine, etwa fünfzehn Euro, mehrmals zusammen und steckte sie in meine Hosentasche, bevor ich die Wohnung verließ. Ich ging zu einem Suppenrestaurant hinter der nächstgelegenen S‑Bahn-Haltestelle und bestellte Pinienkernmus, weil es am mildesten aussah. Während ich langsam den übermäßig heißen Brei löffelte, blickte ich durch die Glastür ins Freie und betrachtete die zerbrechlichen Körper der Vorübergehenden. Da erkannte ich, wie fragil das Leben ist. Wie anfällig Fleisch, Organe, Knochen und der Atem für Verfall und Stillstand sind. Alles war nur die Frage einer einzigen Entscheidung.
So bin ich dem Tod entwischt. Wie ein Komet, der drohte, mit der Erde zu kollidieren, und diese dann um wenige Grad Abweichung verfehlt. Mit rasender Geschwindigkeit, ohne Zeit zum Nachdenken oder Innehalten.
*
Ich hatte mich zwar noch nicht mit dem Leben versöhnt, dennoch galt es, weiterzuleben.
Nach zwei Monaten in Abgeschiedenheit bei mangelnder Ernährung stellte ich fest, dass ich beträchtlich an Muskelmasse verloren hatte. Um den Teufelskreis aus Migräne, Magenkrämpfen und der Einnahme von koffeinhaltigen Schmerzmitteln zu durchbrechen, musste ich regelmäßig essen und mich bewegen. Doch bevor ich richtig loslegen konnte, setzte die Hitzewelle ein. Als das Thermometer erstmalig über Körpertemperatur kletterte, schaltete ich die Klimaanlage ein, die mir der Vormieter hinterlassen hatte, aber sie funktionierte nicht. Nach mehrmaligen Versuchen erreichte ich einige Reparaturfirmen, die mir erklärten, sie seien aufgrund der extremen Temperaturen ausgebucht und hätten erst Ende August wieder Termine frei. Ich versuchte, ein neues Gerät zu beschaffen, aber die Situation war die Gleiche.
Es wäre klüger gewesen, an einen klimatisierten Ort zu entfliehen.
Aber in Cafés, Bibliotheken oder Banken, wo viele Menschen zusammenkamen, wollte ich nicht gehen. Mir blieb nichts anderes übrig, als mich auf dem Wohnzimmerboden auszustrecken, um meine Körpertemperatur so niedrig wie möglich zu halten, häufig kalt zu duschen, damit meine verstopften Schweißporen keinen Hitzestau verursachten, und die Wohnung gegen acht Uhr abends zu verlassen, wenn die Glut in den Straßen ein wenig gewichen war, um etwas Reisbrei zu essen, bevor ich nach Hause zurückkehrte. Der klimatisierte Innenraum des Suppenrestaurants war unglaublich angenehm, und durch die Glastür, die aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit und des Temperaturunterschieds zwischen drinnen und draußen beschlagen war wie in einer Winternacht, konnte ich einen Strom von Heimkehrenden beobachten, die sich tragbare Ventilatoren an die Brust hielten. Sie bevölkerten die Straßen der tropischen Nacht, deren Abkühlung in eine ferne Zukunft entrückt schien und in die ich bald wieder eintauchen musste.
Eines Nachts stand ich auf dem Heimweg vom Suppenrestaurant vor einer Ampel, während ein starker Wind über den heißen Asphalt wehte und mir ins Gesicht schlug. Da fiel mir ein, dass ich den Nachlassbrief weiterschreiben sollte. Nein, es galt vielmehr, ihn noch einmal neu zu beginnen. Auf seinen Umschlag hatte ich mit Permanentmarker »Testament« geschrieben, das Empfängerfeld freilassend, unschlüssig, an wen ich ihn adressieren sollte. Alles noch einmal von vorne. Auf ganz andere Art und Weise.
*
Ihn neu zu schreiben, hieß, nachzudenken.
Wo die Dinge begonnen hatten, auseinanderzufallen.
An welcher Abzweigung ich falsch abgebogen war.
Welche Risse und Nähte die Bruchstellen gewesen waren.
Die Erfahrung lehrt uns, dass es Menschen gibt, die beim Abschied ihr schärfstes Messer hervorholen. Um den anderen, den sie so genau kennen, weil sie ihm nahegestanden haben, an der empfindlichsten Stelle zu treffen.
Ich will nicht leben wie du, halb zusammengefallen.
Ich verlasse dich, weil ich leben will.
Weil ich das Leben erfahren möchte, wie es ist.
*
Im Winter 2012 fingen die Alpträume an, während ich das Material für ein neues Buch sichtete. Zuerst waren es Träume von physischer Gewalt. Auf der Flucht vor Luftlandetruppen wurde ich von einem Knüppel an der Schulter getroffen und brach zusammen. Ich kann mich nicht mehr an das Gesicht des Soldaten erinnern, der ein Gewehr mit aufgepflanztem Bajonett in den Händen hielt und mich mit einem Tritt in die Seite auf den Rücken drehte. Alles, was bleibt, ist das angsterfüllte Zittern, als er mir mit aller Kraft in die Brust stach.
Ich wollte meine Familie nicht mit meiner düsteren Stimmung beeinträchtigen – insbesondere nicht meine Tochter –, also mietete ich mir ein Studio, fünfzehn Gehminuten von unserer Wohnung entfernt. Ich hatte vor, nur dort zu schreiben und anschließend wieder in mein Alltagsleben zurückzukehren. Es war ein Einzimmerapartment im ersten Stock eines Backsteinhauses aus den Achtzigern, das drei Jahrzehnte lang kaum instand gehalten worden war. Ich kaufte weiße Wandfarbe, strich die zerkratzte Stahltür und befestigte anstelle von Vorhängen Halstücher mit Reißzwecken an dem alten Fensterrahmen, um die entstandenen Ritzen zu überdecken. Dort sichtete ich das Material und machte mir Notizen, an Vorlesungstagen von neun bis zwölf Uhr, an vorlesungsfreien Tagen bis fünf Uhr nachmittags.
Morgens und abends bereitete ich wie immer das Essen für meine Familie zu, und wir aßen gemeinsam. Ich gab mir Mühe, intensive Gespräche mit meiner Tochter zu führen, die gerade auf die Mittelschule gewechselt war und sich neuen Situationen stellen musste. Doch selbst über diesen persönlichen Momenten lungerte der Schatten des Buches, als würde mein Körper in zwei Hälften gerissen, sogar, wenn ich nach dem Einschalten des Gasherds darauf wartete, dass das Wasser kochte, oder während ich beobachtete, wie gewürfelter Tofu, den ich zuvor in Ei getunkt hatte, in der Bratpfanne auf der Vorder- und Rückseite goldbraun wurde.
Der Weg zum Studio führte an einem Flussufer entlang durch üppige Bewaldung hindurch, die sich auf einem abschüssigen Stück plötzlich lichtete und den Blick in alle Richtungen freigab. Ich musste dieser offenen Strecke etwa dreihundert Meter weit folgen, um eine Freifläche unter einer Brücke zu erreichen, die auch als Rollschuhbahn genutzt wurde. Dieses Wegstück kam mir immer endlos lang vor, denn es gab meinen Körper der Schutzlosigkeit preis. Ich bildete mir ein, dass von den Dächern der Gebäude auf der anderen Seite der Hauptstraße Scharfschützen auf mich zielten, wenngleich ich wusste, wie absurd diese Angst war.
Spät im Frühling 2013 begann ich allmählich immer schlechter zu schlafen und wurde kurzatmig. Einmal fragte mich meine Tochter vorwurfsvoll, warum ich so flach atmete. Ich war gegen ein Uhr in der Nacht aus einem Alptraum erwacht, gab es auf, wieder einzuschlafen, und verließ die Wohnung, um Wasser zu kaufen. Während ich an einer Ampel darauf wartete, dass diese auf Grün sprang, was praktisch bedeutungslos war, da es weit und breit keine Menschen oder Autos gab, blickte ich geistesabwesend hinüber zu dem Spätkauf, der vor einem Apartmentblock auf der anderen Seite der zweispurigen Straße als Einziges noch beleuchtet war. Eine Gruppe von etwa dreißig Männern, die dort schweigend in einer Reihe den Bürgersteig entlangmarschierten, holte mich in die Wirklichkeit zurück. Sie trugen Reservistenuniformen, hatten zumeist lange Haare und gingen, die Gewehre geschultert, langsam und ohne jegliche militärische Disziplin nachlässig hintereinander her, wie müde Kinder am Ende eines Tagesausflugs.
Wer lange Zeit nicht tief geschlafen hat und eine Phase durchläuft, in der Alpträume und Wachzustände miteinander verschmelzen, neigt angesichts einer bizarren Szene vermutlich dazu, an seiner Wahrnehmung zu zweifeln: Ist das, was ich da sehe, real? Ist dieser Moment nicht Teil eines Alptraums? Wie sehr kann ich meinen Sinnen trauen?
Regungslos beobachtete ich, wie ihre in Schweigen gehüllten Rücken, als hätte jemand die Stummschalttaste gedrückt, an einer dunklen Kreuzung um die Ecke bogen und verschwanden. Das war kein Traum. Ich war kein bisschen schläfrig. Ich hatte keinen Tropfen Alkohol getrunken, aber in diesem Augenblick konnte ich kaum glauben, was ich gesehen hatte. Ich überlegte, ob die Männer vielleicht auf dem Übungsgelände der Reservisten in Naegok-dong, jenseits des Berges Umyeon, trainiert hatten und sich auf einem Mitternachtsmarsch befanden. In diesem Fall mussten sie inzwischen etwa zehn Kilometer durch dunkles Bergland gewandert sein. Ich wusste nicht, ob diese Art von Training für Reservisten vorgesehen war. Ich hatte vor, am nächsten Morgen jeden Bekannten, der Militärdienst geleistet hatte, dazu zu befragen, aber ich wollte nicht, dass sie mich für merkwürdig hielten – zumal ich mich auch wirklich merkwürdig fühlte –, und so habe ich bis heute mit niemandem darüber gesprochen.
*
Hand in Hand mit fremden Frauen und ihren Kindern, uns gegenseitig helfend, stieg ich an der Innenwand des Brunnens entlang in die Tiefe. Wir dachten, dort unten sei es sicher, doch plötzlich wurden ohne Vorankündigung von oben aus der Öffnung des Schachts Dutzende von Kugeln auf uns abgefeuert. Frauen schlangen die Arme um ihre Kinder, so fest sie konnten, um ihnen darunter Schutz zu bieten. Vom Grund des Brunnens, der eigentlich völlig ausgetrocknet sein sollte, quoll aus Grasbüscheln eine klebrige Pfütze hervor wie geschmolzenes Gummi. Um unser Blut und unsere Schreie zu verschlingen.
*
Ich ging mit einer Gruppe von Menschen, an deren Gesichter ich mich nicht mehr erinnern kann, eine verlassene Straße entlang. Als ein am Straßenrand geparktes schwarzes Auto in unser Blickfeld geriet, sagte jemand: »Er ist da drin.« Sein Name wurde nicht genannt, aber jeder von uns verstand genau, was das bedeutete: Der Mann, der das Massaker in jenem Frühjahr angeordnet hatte, saß in diesem Fahrzeug. Während wir dastanden und hinübersahen, fuhr der Wagen los und verschwand hinter den Mauern eines großen Steingebäudes in der Nähe. Ein anderer aus unserer Gruppe schlug vor: »Lasst uns auch dorthin gehen.« Wir setzten uns in Bewegung. Ich war mir sicher, dass wir zu mehreren losgingen, doch als ich das leere Gebäude betrat, waren wir nur noch zu zweit. Jemand, dessen Züge ich nicht mehr beschreiben könnte, stand schweigend neben mir. Ich ahnte, dass mir der Mann einfach gefolgt war, ohne zu wissen, weshalb. Was konnten er und ich zu zweit schon ausrichten? Aus einem Raum am Ende des schwach beleuchteten Flurs drang Licht. Als wir eintraten, stand der Mörder mit dem Rücken zur Wand. In der Hand hielt er ein brennendes Streichholz. Mir wurde plötzlich klar, dass mein Begleiter und ich ebenfalls Streichhölzer in den Händen hielten. Man darf nur so lange sprechen, bis dieses Streichholz ausbrennt. Niemand sagte es uns, aber wir wussten, dass das die Regel war. Das Streichholz des Mörders war schon fast abgebrannt, und die Flamme drohte gerade seinen Daumen zu berühren. Unser beider Zündhölzer waren noch lang, aber sie brannten schnell herunter. Mörder. Ich dachte, ich muss es aussprechen. Ich öffnete also meinen Mund und sagte:
Mörder.
Aber meine Stimme versagte.
Mörder.
Ich muss lauter sprechen, noch lauter.
Was gedenkst du in Hinblick auf die Menschen zu tun, die du getötet hast?
Es kostete mich enorme Anstrengung, doch ich redete weiter, als mir plötzlich die Frage in den Sinn kam: Sollen wir ihn jetzt töten? Ist das unsere letzte Chance? Aber wie? Wie können wir das bewerkstelligen? Ich blickte zur Seite und sah, wie das dünne Streichholz meines Begleiters, dessen Gesicht und dessen Atemzüge schwach zu erkennen waren, mit einem letzten orangenen Auflodern verlosch. Im Licht des Flämmchens bemerkte ich, wie jung der andere war, ein großes Kind.
*
Nachdem ich das Manuskript im darauffolgenden Januar fertiggestellt hatte, ging ich zum Verlag. Ich wollte darum bitten, es so schnell wie möglich zu veröffentlichen. Törichterweise glaubte ich, die Alpträume würden aufhören, sobald das Buch herauskäme. Der Verleger erklärte, es sei besser, die Veröffentlichung für Mai anzusetzen, den Monat des Gwangju-Aufstands.
»Wäre es nicht schön, durch den idealen Zeitpunkt den einen oder anderen zusätzlichen Leser für das Werk zu gewinnen?«
Mit diesen Worten hatte er mich überredet. Während ich wartete, schrieb ich ein ganzes Kapitel komplett neu und reichte die endgültige Fassung erst auf Drängen des Verlegers im April ein. Das Buch kam ziemlich genau Mitte Mai heraus. Die Alpträume suchten mich natürlich weiterhin heim. Heute wundere ich mich über meine eigene Naivität: Welch nachgerade unverfrorene Hoffnung, jemals den Schmerz abstreifen und alle Spuren tilgen zu können, nachdem ich mich entschlossen hatte, über Folter und Völkermord zu schreiben.
*
Und dann ist da noch die Nacht, in der ich zum ersten Mal von diesen schwarzen Bäumen träumte und erwachte, die kalten Handflächen auf meine Lider gepresst.
Manchmal scheine ich auch nach dem Aufwachen irgendwie weiterzuträumen, wie auch in diesem Fall. Im Traum koche ich Tee, fahre mit dem Bus, gehe mit meinem Kind an der Hand spazieren, packe meinen Koffer und stapfe die endlosen Treppen einer U‑Bahn-Station hinauf, während daneben Schnee auf einen Acker fällt, auf dem ich noch nie gewesen bin. An den abgesägten schwarzen Baumstämmen entstehen und zerfallen glitzernde, sechseckige Kristalle. Ich blicke erschrocken zurück und stehe bis zu den Knöcheln im Wasser. Das Meer, das Meer drängt heran.
Die Szene beschäftigte mich immer wieder in dem Maße, dass ich in jenem Herbst auf die Idee verfiel: Kann ich vielleicht einen geeigneten Platz finden und dort Baumstämme aufstellen? Sollten sich Tausende davon als unrealistisch erweisen, wäre es dann nicht möglich, neunundneunzig Bäume zu setzen – als Symbol für die Unendlichkeit – und sie mit einigen Gleichgesinnten in schwarze Tusche zu kleiden? So sorgfältig, als ummantelte man sie mit einem Gewand aus tiefster Nacht, damit ihr Schlaf nicht für immer zerstiebe. Könnte man schließlich, anstatt auf das Meer, auf Schnee warten, der wie ein weißes Tuch vom Himmel fiele und sie bedeckte?
Ich hatte einer Freundin, einer früheren Fotografin und Dokumentarfilmerin, vorgeschlagen, einen Kurzfilm zu drehen, der diesen Prozess festhalten sollte. Sie hatte freudig zugesagt. Wir vereinbarten, das Projekt gemeinsam umzusetzen, aber vier Jahre verstrichen, ohne dass wir eine gemeinsame Lücke in unseren Zeitplänen gefunden hätten.
*
Und dann bin da noch ich, wie ich, in dieser schwülen Nacht aus der Hitze des Asphalts in die leere Wohnung zurückgekehrt, eine kalte Dusche nehme. Da die Klimaanlagen der Nachbarwohnungen oben, unten und nebenan jede Nacht auf Hochtouren laufen, muss ich alle Fenster und die Balkontür schließen, um zu verhindern, dass die heiße Abluft der Geräte in meine Wohnung bläst. Mein Wohnzimmer gleicht einem hermetisch abgeriegelten römischen Dampfbad, und ich setze mich an den Schreibtisch, bevor die Wirkung der kalten Dusche verpufft. Ich zerreiße das Testament samt Umschlag, der noch ohne Adressat daliegt.
Schreibe es von Grund auf neu.
Das ist eine zeitlos passende Beschwörungsformel.
Ich beginne wieder von vorne. Innerhalb von fünf Minuten rinnt mir der Schweiß herunter. Ich nehme noch eine kalte Dusche und kehre an meinen Schreibtisch zurück. Dann reiße ich das Gekritzel von vorher in Fetzen.
Schreibe es von Grund auf neu.
Einen echten Abschied, aber richtig.
Im zurückliegenden Sommer, als mein Leben gerade anfing, sich aufzulösen wie ein Stück Würfelzucker in einem Glas Wasser, als die echten Abschiede, die folgten, noch Vorboten waren, schrieb ich einen Roman mit dem Titel Abschied. Es war die Geschichte einer Schneefrau, die im Schneeregen schmilzt und verschwindet. Aber das kann nicht wirklich der letzte Abschied sein.
Jedes Mal, wenn mir der von der Stirn rinnende Schweiß in den Augen brannte und ich nicht weitermachen konnte, wusch ich sie mit kaltem Wasser aus. Wenn ich dann zum Schreibtisch zurückkehrte, zerriss ich, was ich zuvor geschrieben hatte. Als ich mich mit klebrigem Körper auf dem Wohnzimmerboden ausstreckte und den Brief, den neu zu schreiben ich mir vorgenommen hatte, Brief sein ließ, war die Sonne bereits dabei, das morgendliche Dämmerlicht blau zu färben. Wie einen Segen empfand ich es, dass die Temperatur ein wenig zurückging. Ich dachte, ich könnte meine Augen für eine Weile schließen, und kaum erfasste mich eine Ahnung von fallendem Schnee, war er auch schon über mich gekommen. Schnee, der seit Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten ununterbrochen zu fallen schien.
*
Ich bin noch unversehrt.
Das dachte ich mit einem Schaudern, als wäre ein großes, wuchtiges Schwert aus dem Nichts aufgetaucht und auf mich gerichtet worden, und riss die Augen auf, ohne davonzulaufen.
Die oberen Baumreihen entlang des abschüssigen Bergrückens waren sicher, denn die Flut konnte nicht so hoch steigen. Auch den Gräbern dahinter drohte keine Gefahr, weil das Meer sie dort oben nicht erreichte. Die weißen Gebeine von Hunderten dort Begrabener blieben sauber und trocken. Denn das Meer konnte sie nicht fortspülen. Die schwarzen Baumstümpfe dort oben, die weder nass noch morsch waren, standen im Schnee. Schnee, der über Jahrzehnte und Jahrhunderte gefallen war.
Da wurde es mir klar.
Ich musste die Knochen, die weiter unten von der Strömung mitgerissen würden, durch knietiefes Wasser watend, auf meinem Rücken bis zum Kamm tragen, bevor es zu spät war. Warte nicht ab, vertraue auf niemandes Hilfe, zögere nicht, bis du an der Spitze des Kamms anlangst! Bis du dort an der höchsten Stelle die weißen Kristalle über den eingegrabenen Stämmen zerfallen siehst.
Weil es keine Zeit gibt.
Weil es keinen anderen Weg gibt,
wenn du weitergehen willst.
Um zu leben.
2
Faden
Aber ich kann noch immer nicht gut schlafen.
Ich kann noch immer nicht richtig essen.
Noch immer bin ich kurzatmig.
Noch immer lebe ich auf eine Weise, die unerträglich für jene war, die mich verlassen haben.
Der Sommer, in dem es mir vorkam, als würde die Welt mich ständig anschreien, ist nun vorbei. Ich muss nicht mehr die ganze Zeit über schwitzen. Ich brauche nicht von Kopf bis Fuß ermattet auf dem Wohnzimmerboden zu liegen. Keine unzähligen kalten Duschen mehr, um dem Hitzschlag vorzubeugen.
Es ist, als ob sich eine kühle Schicht zwischen der Welt und mir gebildet hätte. Ich trage ein langärmliges Hemd und eine Jeans, während ich ohne die Schwüle des heißen Windes die Straße hinunter in ein Restaurant gehe. Ich bin immer noch außerstande, zu kochen. Mehr als eine Mahlzeit kann ich nicht zu mir nehmen, denn es erinnert mich in unerträglicher Weise daran, dass ich für andere gekocht und gemeinsam mit ihnen gegessen habe. Aber die Alltagsrituale kehren allmählich wieder. Ich treffe immer noch keine Leute und gehe nicht ans Telefon, aber ich lese meine E‑Mails und Nachrichten wieder regelmäßig. Jeden Morgen setze ich mich bei Tagesanbruch an den Schreibtisch und verfasse einen Abschiedsbrief an alle. Immer wieder aufs Neue.
Allmählich werden die Nächte länger. Die Temperatur sinkt von Tag zu Tag. Ich betrete Anfang November zum ersten Mal seit dem Umzug die Promenade hinter dem Wohnblock. Die hochgeschossenen Ahornbäume leuchten rot im Sonnenlicht. Es ist wunderschön, aber die Synapsen in mir, die es empfinden könnten, sind tot oder fast zerstört. Eines Morgens bildet sich der erste Reif auf dem Boden, und als ich darübergehe, höre ich es unter meinen Turnschuhsohlen knirschen. Ein heftiger Wind wirbelt herabgefallene, kindergesichtgroße Blätter durch die Luft und weht sie davon, während die plötzlich nackten Platanenäste ihrem koreanischen Namen gerecht werden: Schuppenflechtenbaum.
*
Als ich Ende Dezember eines Morgens eine SMS von Inseon erhalte, verlasse ich gerade den Spazierweg. Fast einen Monat lang lagen die Temperaturen unter null, und kein Laubbaum trägt mehr Blätter.
Gyeongha.
Inseons Nachricht besteht aus meinem Namen, der einsam auf dem Display schwebt.
Ich lernte Inseon im Jahr meines Studienabschlusses kennen. Die Zeitschrift, bei der ich arbeitete, hatte keinen Fotojournalisten, also machten die Redakteure die meisten Aufnahmen selbst, aber wenn es um wichtige Interviews oder Reisereportagen ging, bildeten sie ein Team mit freiberuflichen Fotografen, die sie dafür anheuerten. Inseon ist in meinem Alter, und ich wurde ihr vorgestellt, nachdem ich mich nach Fotoagenturen erkundigt hatte. Ich folgte dem Rat meiner Kollegen, mit einer Frau zusammenzuarbeiten, denn es würde die Dinge vereinfachen, da sich Dienstreisen mitunter drei bis vier Tage hinzogen. In den folgenden drei Jahren war ich jeden Monat mit ihr unterwegs, und wir sind, nachdem ich den Verlag verlassen hatte, befreundet geblieben, so dass ich ihre Gewohnheiten seit zwanzig Jahren kenne. Wenn sie mich mit meinem Vornamen anschreibt, stellt das keinen Gruß dar, sondern leitet eine konkrete und dringende Bitte ein.
Ich ziehe meine Wollhandschuhe aus und schicke eine Nachricht:
Ja, was ist?
Dann warte ich eine Weile auf ihre Antwort. Gerade will ich meine Handschuhe wieder überstreifen, als sie eintrudelt.
Kannst Du schnell zu mir kommen?
Inseon lebt nicht in Seoul. Als einziges Kind einer spätgebärenden Mutter über vierzig war sie früh mit deren Altersgebrechen konfrontiert. Vor acht Jahren kehrte sie in ihren Heimatort zurück, ein einige Hundert Meter über dem Meer gelegenes Bergdorf auf der Insel Jeju, wo sie sich fortan um ihre Mutter kümmerte. Diese starb vier Jahre später, doch Inseon blieb weiter allein in dem Haus. Früher trafen wir uns zu allen erdenklichen Zeiten ganz ungezwungen und redeten beim Essen über sehr private Dinge, aber nach ihrem Umzug wurden unsere Zusammenkünfte allmählich seltener, während jede ihre eigenen Höhen und Tiefen durchlebte. Später vergingen ein, zwei Jahre, ohne dass wir einander zu Gesicht bekamen. Vergangenen Herbst war ich das letzte Mal auf Jeju. Ich verbrachte vier Tage in ihrem Steinhaus, das bescheiden renoviert worden war, indem man die Außentoilette in das Gebäude verlegt hatte. Inseon stellte mir ein Paar winziger weißer Papageien vor, die sie zwei Jahre zuvor auf dem Wochenmarkt gekauft hatte und seither aufzog – einer davon konnte einfache Wörter sprechen. Sie führte mich auch über den Hof zu der Tischlerei, in der sie den größten Teil des Tages verbrachte. Sie zeigte mir Stühle, am Stück aus ganzen Baumstümpfen gefertigt, die sich zu ihrer Überraschung recht erfolgreich verkauften und ihr halfen, den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Dann forderte sie mich auf, darauf Platz zu nehmen, damit ich sähe, wie bequem sie seien. Sie stellte einen Kessel auf den Herd, gab eingefrorene Maulbeeren und Himbeeren dazu, die sie im Sommer zuvor hinter dem Haus im Wald gesammelt hatte, und kochte mir einen sauren, ziemlich faden Tee. Während ich ihn trank und mich über den Geschmack beschwerte, band sie in Jeans und Arbeitsstiefeln ihre Haare zusammen, klemmte sich wie der Schreinermeister aus einer Dokumentation einen Bleistift hinters Ohr, maß ein Holzbrett mit einem Dreieckslineal ab und zeichnete Schnittlinien ein.
Sie meint wohl kaum, dass ich jetzt zu diesem Haus kommen soll. Meine Frage »Wo steckst Du?« wird von ihrer nächsten Mitteilung überholt. Darin steht der Name eines Krankenhauses, von dem ich zum ersten Mal höre. Es folgt dieselbe Bitte wie zuvor.
Kannst Du schnell kommen?
Gleich darauf eine weitere Nachricht:
Bring Deinen Ausweis mit!
Ich denke kurz darüber nach, ob ich zuerst nach Hause gehen soll. Der lange Daunenmantel, in dem ich die Wohnung verlassen habe, ist zwar zwei Nummern zu groß, aber sauber. In meiner Brieftasche stecken eine Kreditkarte, mit der ich auch Bargeld abheben kann, und mein Personalausweis. Auf halbem Weg in Richtung der nächsten S‑Bahn-Station, wo sich ein Taxistand befindet, kommt mir ein leeres Taxi entgegen, und ich winke es heran.
*
Als Erstes fällt mir ein staubiges Banner mit dem schwarzen Schriftzug »Nummer eins in ganz Korea« ins Auge. Ich habe das Taxi bezahlt, und während ich mich dem Eingang des Krankenhauses nähere, überlege ich mir: Es handelt sich offensichtlich um das beste Krankenhaus für Nervenrekonstruktions-OPs in Korea, aber warum ist mir der Name fremd? Als ich durch die Drehtür den düsteren, altmodischen Empfangsbereich mit seinem abgenutzten Interieur betrete, sehe ich zwei Bilder an der Wand, darauf eine Hand und ein Fuß, denen jeweils ein Glied fehlt. Mein Blick bleibt daran haften, obwohl sich meine Augen abwenden wollen. Ich sehe genauer hin, denn vielleicht hinterlässt die flüchtige Wahrnehmung beängstigendere Erinnerungen als die nüchterne Realität. Aber ich täusche mich. Je eingehender man sie betrachtet, desto schmerzhafter erscheinen die Fotos. Ich schwanke leicht, und mein Blick wandert nach rechts, wo zwei weitere Bilder derselben Hand und desselben Fußes nebeneinander hängen, diesmal aber sind Finger und Zeh wieder angenäht. Farbe und Textur der gesunden Haut heben sich deutlich von den Operationsnarben ab.
Wenn Inseon in diesem Krankenhaus liegt, bedeutet das, dass sie in ihrer Holzwerkstatt einen Unfall hatte.
Es gibt diese Art von Menschen, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Sie treffen, ohne zu zögern, schwierige, für andere schwer nachvollziehbare Entscheidungen, verfolgen zielgerichtet ihren Weg und tragen die Konsequenzen ihres Tuns. Das macht sie für ihre Mitmenschen berechenbar, egal, welchen Pfad sie einschlagen. Inseon, die an der Universität Fotografie im Hauptfach studiert hat, interessierte sich seit ihren späten Zwanzigern für Dokumentarfilme und hielt zehn Jahre lang an der Idee fest, ohne die Aussicht, mit dieser Arbeit ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Zwar nahm sie wahllos jedes Projekt an, das ihr ermöglichte, mit dem Filmen Geld zu verdienen, aber sie blieb immer arm, weil sie die Aufträge durch eigene Mittel mitfinanzieren musste. Sie aß wenig, gab kaum etwas aus und arbeitete viel. Sie brachte überallhin eine einfache Brotdose mit, trug keinerlei Make‑up und schnitt sich selbst vor dem Spiegel mit einer Effilierschere die Haare. Sie besaß einen einzigen Baumwollparka und einen einzigen Mantel mit einer eingenähten Strickjacke, um sich warm zu halten. Das Seltsame war, dass diese Kleidungsstücke so natürlich und lässig aussahen, als gehörten sie nicht anders getragen.
Unter den Kurzfilmen, die sie im Zweijahresrhythmus fertigstellte, fand als Erster eine Dokumentation größere Beachtung, die sie in den Dschungeldörfern Vietnams gedreht hatte, wo sie Überlebende von sexueller Gewalt durch das südkoreanische Militär interviewte. Aufgrund der Kraft des Films, dessen überwältigende Bilder von üppigem Tropenwald und warmem Sonnenlicht die Natur in den Mittelpunkt zu rücken schienen, erhielt Inseon für ihren nächsten Film Fördergelder einer privaten Kulturstiftung. Dieses Nachfolgeprojekt wurde mit relativ großzügigem Budget produziert und behandelte den Alltag einer an Demenz erkrankten alten Frau, die in den 1940er Jahren als Unabhängigkeitskämpferin in der Mandschurei aktiv gewesen war. Ich mochte den Film, in dem die leeren Augen und das Schweigen der alten Frau, die, von ihrer Tochter gestützt, mit einem Stock durchs Haus geht, mit der Stille des endlosen Winterwalds in den mandschurischen Weiten verschmelzen. Entgegen der Erwartung aller, dass sie in einem nächsten Projekt wieder Zeuginnen der Geschichte befragen würde, interviewte Inseon stattdessen sich selbst. Eine Frau, von der nur Knie, Hände und ein Schattenriss zu sehen sind, spricht bedächtig. Außer ihren Bekannten, denen die Stimme vertraut war, hätte niemand herauszufinden vermocht, um wen es sich bei der Interviewten handelte. Dem Film, der mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen des Jeju-Aufstands aus dem Jahr 1948 durchwirkt war, fehlte ein stringenter Erzählstrang, der zusätzlich an langen Pausen zwischen den Worten krankte. Schatten und Lichtflecken tauchten die gesamte Zeit über an verputzen Wänden auf und verschwanden wieder, was bei all jenen Verwirrung und Enttäuschung auslöste, die eine Fortführung der kraftvollen Bildsprache früherer Werke erwartet hatten. Ungeachtet der Kritiken plante Inseon, ihren ersten Spielfilm zu drehen, indem sie die drei Kurzfilme, die sie »Triptychon« nannte, miteinander verbinden wollte. Aber aus irgendeinem Grund gab sie das Projekt auf und bewarb sich erfolgreich an einer staatlich geförderten Tischlerschule.
Ich wusste, dass Inseon gerne in die Holzwerkstatt in der Nähe ihrer alten Wohnung ging. Wann immer sie eine Pause zwischen den Aufträgen hatte, verbrachte sie dort Tage damit, Holz zu sägen, Platten zuzuschneiden und ihre eigenen Möbel zu bauen. Aber ich konnte nicht glauben, dass sie wirklich mit dem Filmen aufhören und eine Tischlerlehre beginnen würde. Ebenso wenig nahm ich sie ernst, als sie erklärte, dass sie noch vor Abschluss ihrer einjährigen Schreinerausbildung nach Jeju gehen wolle, um ihre Mutter zu betreuen. Ich nahm an, sie würde sich für eine Weile in ihren Heimatort zurückziehen und dann wieder hinter die Kamera zurückkehren. Doch entgegen meiner Vermutung begann Inseon gleich nach ihrer Ankunft auf Jeju, in dem umgebauten Mandarinenlagerschuppen im Hof Möbel herzustellen, und als sich das Bewusstsein ihrer Mutter so sehr trübte, dass man sie nur noch wenige Augenblicke allein lassen konnte, richtete sie sich eine kleine Werkbank auf dem Beischlag des Haupthauses ein, wo sie Holz mithilfe von Hobel und Beitel zu Alltagsgegenständen wie Schneidebrettern, Tabletts, Löffeln und Schöpfkellen verarbeitete, welche sie abschließend ölte. Erst als ihre Mutter starb, wandte sie sich wieder der Möbelschreinerei zu, nachdem sie die staubige Werkstatt auf Vordermann gebracht hatte.
Es überraschte mich zwar, dass sie Tischlerin wurde, zugleich erschien es mir aber nie gefährlich, denn ich kenne sie seit ihren Zwanzigern und habe gesehen, wie geschickt sie mit ihrer schmächtigen Statur bei knapp über einem Meter siebzig Körpergröße die schwere Filmausrüstung schleppte und handhabte. Allerdings bereiteten mir die häufigen Verletzungen Sorgen. Kurz nach dem Tod ihrer Mutter verfing sich ein Trennschleifer in ihrer Jeans und hinterließ eine fast dreißig Zentimeter lange Narbe auf ihrem Oberschenkel bis zum Knie. »Egal, was ich anstellte, die Hose hatte sich verhakt, und der Schleifer kreischte und fraß sich weiter vor wie ein Monster«, erklärte sie mit einem Lächeln. Vor zwei Jahren brach sie sich den Zeigefinger der linken Hand, als sie versuchte, Holzklötze aufzufangen, die beim Beladen eines Fahrzeugs ins Rutschen geraten waren. Dabei zog sie sich auch einen Bänderriss zu, der über ein halbes Jahr lang medizinisch behandelt werden musste.
So glimpflich ist sie diesmal nicht davongekommen, irgendetwas an ihren Gliedmaßen wurde wohl abgetrennt.
Ich muss zum Informationsschalter und die Nummer von Inseons Krankenzimmer erfragen, aber gerade nimmt dort ein junges Paar ganz aufgelöst Anweisungen für ein vier- bis fünfjähriges Kind mit verbundener Hand entgegen, das die Eltern an sich drücken. Anstatt zügig zum Tresen zu gehen, stehe ich unschlüssig mitten in der Lobby und blicke zur Drehtür hinaus. Es ist noch nicht Mittag, aber so dunkel wie am Abend. Gegenüber dem Krankenhaus kauern massive Betonbauten in der kalten, feuchten Luft unter einem Himmel, der jeden Moment ein Schneegestöber über ihnen auszuspucken droht.
Mir fällt ein, dass ich etwas Bargeld abheben sollte. Während ich zum Automaten am Ende der Lobby schlendere, frage ich mich, wozu ich meinen Ausweis brauche. Hat man die Operation, bei der es auf jede Sekunde angekommen sein dürfte, womöglich ohne Zustimmung eines Angehörigen durchgeführt, und braucht man jetzt jemanden, der für die Kosten des Eingriffs und des Krankenhausaufenthalts bürgt? Denn Inseon hat weder Eltern noch Geschwister und auch keinen Partner.
*
»Inseon.«
Als ich ihren Namen rufe, starrt sie vom hintersten Krankenbett des Sechserzimmers aus ängstlich in Richtung der Glastür, durch die ich gerade getreten bin. Ich bin nicht die Person, auf die sie gewartet hat. Möglicherweise benötigt sie dringend Hilfe, vielleicht von einer Krankenschwester oder einem Arzt. Jetzt kommt sie zu Sinnen und erkennt mich endlich. Ihre ohnehin schon großen Augen weiten sich noch mehr und beginnen zu leuchten, bevor sie sich zu einer Mondsichel verengen und sich feine Fältchen darum bilden.
»Du bist da.« Sie formt die Worte mit dem Mund.
Ich trete an ihr Bett und frage: »Was ist passiert?«
Ihr zartes Schlüsselbein sticht über dem weiten Krankenhaushemd hervor. Nur ihr Gesicht ist etwas geschwollen und sieht daher weniger mager aus als bei unserem Treffen im letzten Jahr.
»Mit der Kreissäge abgeschnitten«, flüstert Inseon, ohne die Stimmbänder zum Schwingen zu bringen, wie jemand, der sich am Hals verletzt hat und nicht an einem Finger.
»Wann?«
»Vorgestern Morgen.« Sie streckt langsam ihre Hand aus und fragt: »Möchtest du es sehen?«