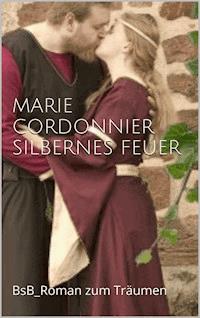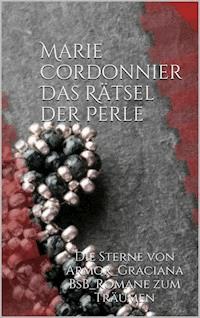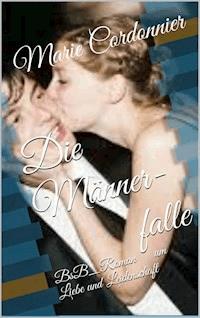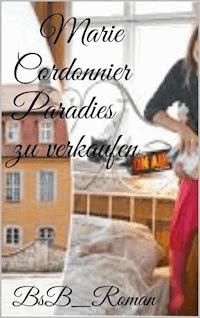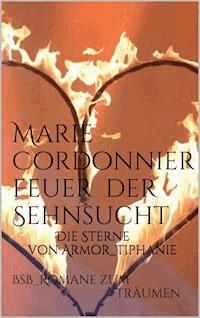Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Best Select Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Frankreich im 15. Jahrhundert – Normandie: 'Du bist nicht mein Kind', flüstert der zerlumpte Bettler und drückt Nadine ein goldenes Medaillon in die Hand, bevor er den letzten Atemzug macht. Schluchzend nimmt sie den Mann in die Arme, den sie stets für ihren Vater hielt. Doch für Trauer bleibt keine Zeit, Colin zieht sie unbarmherzig fort. Keine Sekunde länger dürfen sie in diesem dunklen Kerker bleiben, wenn sie nicht wollen, dass Guy de St. Royes’ Häscher auch sie erwischen. Denn Guy hat geschworen, Nadine zu töten – doch erst, wenn er sein Vergnügen mit ihr gehabt hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table of contents
Prolog
27. Oktober 1415 – Schloss Mesnières
1. Kapitel
April 1430 Bourges
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
Prolog
27. Oktober 1415 – Schloss Mesnières
Der Regen trennte die alte Burg von der übrigen Welt. In dichte, graue Schleier aus Feuchtigkeit eingehüllt, schien sie ihr eigenes Dasein nach eigenen Gesetzen zu führen. Eine verlorene Insel in einem Königreich, das allenthalben aus den Fugen zu geraten drohte. Denn Heinrich V. von England war mit einer Flotte von tausendvierhundert Schiffen und einer Armee von zwölftausend Mann in der Seinemündung bei Harfleur an Land gegangen und der König von Frankreich führte seine tapfersten Ritter in die Schlacht. Die blasse, schweißbedeckte, hochschwangere junge Frau, die an diesem Tage zwischen den kostbaren Samtvorhängen eines Alkovens in Mesnières darum kämpfte, neues Leben zur Welt zu bringen, hatte keinen Sinn für politische Ränke und Machtkämpfe. Sie war am Ende ihrer ohnehin schon geringen Kräfte. Die vierte Schwangerschaft in Folge hatte die zierliche, bezaubernd schöne Melisande de Guînes, die fünf Jahre zuvor den Herrn von Mesnières, den Grafen Richard de St. Doye, geehelicht hatte, in eine erschöpfte Frau verwandelt, die einen hohen Preis für ihre Liebe zahlen musste. Wenn sie sich in den kurzen Pausen des Schmerzes ihren Erinnerungen überließ, schien ihr das Bild der strahlenden Braut, die der Graf von Mesnières auf seine Burg heimgeführt hatte, wie die ferne, bunte Illustration eines Stundenbuches. Schon bald nach der Hochzeit hatte er sie verlassen, im Dienste des Königs zu den Waffen gerufen. Er war davon geritten, im sicheren Bewusstsein, dass alles zum Besten geordnet sei. Sein Bruder, der edle Seigneur Guy de St. Doye, befehligte die Burg, und unter seiner und der Obhut von Dame Angèle de St. Pol, seiner Gemahlin, würde es Melisande an nichts fehlen. Anfangs hatte dies auch Melisande gedacht, aber sie war bald eines Besseren belehrt worden. Ganz abgesehen davon, dass sie sich einsam fühlte, sich nach ihrem geliebten Gatten sehnte und die kalte, unfreundliche Gemahlin seines Bruders verabscheute, stellte sie auch umgehend fest, dass ihr Guy de St. Doye nicht die respektvollen Gefühle entgegenbrachte, die einem Schwager angemessen gewesen wären. Er gestand ihr seine leidenschaftliche Liebe und stellte ihr nach, ohne auf ihre entsetzte Ablehnung zu hören. Er verehrte sie mit der glühenden Besessenheit eines Fanatikers, der keinen Widerspruch und keine Empörung zur Kenntnis nahm. Melisande versuchte sich ihm zu entziehen und ihre erste Schwangerschaft verschaffte ihr eine Atempause. Damals hatte sie nicht ahnen können, dass es nur der Auftakt zu einem sich ständig wiederholenden Tanz der Verzweiflung sein würde. Ihre Versuche, sich ihrem Gemahl anzuvertrauen, wenn er zwischen zwei Schlachten einmal nach Mesnières kam, blieben stets ohne Erfolg. Richard vertraute seinem Bruder und konnte nicht verstehen, warum sie ihn verabscheute. Melisande ihrerseits war zu jung und zu unerfahren, und sie schämte sich zu sehr, um mehr als Andeutungen zu machen. Es widerstrebte ihr, Guys fieberhafte Ergüsse zu wiederholen, sie nahm an, ihr Gatte würde sie auch ohne diese Demütigung verstehen. Allein, er tat es nicht. Er bat sie um mehr Verständnis für seinen Bruder und verschwand zum nächsten Turnier, zur nächsten Schlacht. Natürlich nicht, ohne dafür gesorgt zu haben, dass sie aufs Neue schwanger war, nachdem sie als erstes ein Mädchen zur Welt gebracht hatte. Auf Nadine folgte die kleine Alison und endlich, im dritten Sommer nach ihrer Hochzeit, Gilles, der ersehnte Erbe. Als der schwächliche Säugling nach zwei Monaten die Augen für immer schloss, nahm Melisande an, dass es mehr Leid und Kummer nicht geben konnte. Sie sollte sich täuschen. Guy respektierte weder ihre Trauer noch ihr Leid. Seine Zudringlichkeiten gingen so weit, dass sie ihre Türen vor ihm verriegeln musste und sich ohne Dienerin nicht mehr aus ihren Gemächern wagte. Und dann war da schon wieder dieses neue Leben, das Richard mit unverdrossenem Bemühen in ihren Schoß gepflanzt hatte, im irrigen Glauben, es würde sie über den Verlust von Gilles hinwegtrösten. Jenes Kind, das sie in den vergangenen Monaten über Gebühr belastet und ausgelaugt hatte. Das so viel größer, so viel schwerer und unruhiger als alle anderen zuvor zu sein schien. Ein Junge dieses Mal, darum betete sie mit aller Inbrunst. Wenn nur Richard bei ihr sein könnte! Wenn er ihr doch nur ein einziges Mal in ihren Schmerzen zur Seite stehen könnte. Dabei befand er sich doch ganz in der Nähe. Bei Hesdin sagte man, wolle das Heer König Karls die eingedrungenen Engländer stellen und vernichtend schlagen. Hesdin lag ganz in der Nähe, nördlich von Azincourt. Auf solche Entfernungen mussten die Neuigkeiten doch schnell reisen. Oder hatte die Schlacht schon stattgefunden? Der Regen, der die Straßen in unwegsame Sümpfe und jeden Bach in einen Fluss verwandelte, verhinderte, dass die Boten Mesnières mit der üblichen Schnelligkeit erreichten. Eine neuerliche Flamme der Qual ließ Wirklichkeit und Einbildung für die junge Gräfin miteinander verschwimmen. Ein unerträglicher, nie gefühlter Schmerz drehte sich wie ein Messer in ihrem Körper, und der klagende, dünne Schrei, der über ihre Lippen kam, übertönte die beruhigenden Worte der alten Amme, die ihr in dieser schweren Stunde zur Seite stand. Vor Stunden schon hatte Clemence zu der Hebamme im Dorf gesandt, aber bisher war es ihr allein überlassen geblieben, ihrer armen Herrin zur Seite zu stehen. Auch die Magd, die sie vor dem Mittagsläuten mit demselben Auftrag davongeschickt hatte, war noch nicht wiedergekehrt. Ausgerechnet dieses Mal, bei dem alles für die Gräfin umso vieles schwieriger war als je zuvor! »Heilige Mutter Gottes, hilf!« Die Schwangere bäumte sich auf, aber im selben Moment spürte sie bereits, dass das Kind sich ungestüm seinen Weg ins Freie drängte, während sie selbst in die Kissen sank und darauf wartete, dass die Pein nachließ. Aber es gab kein Ende! Anders als sonst dauerte das Martyrium unverändert weiter. Wehe um Wehe folgte der nächsten. »Beim Leben der heiligen Anna«, stammelte die alte Clemence, die soeben mit zitternden Händen den Säugling abnabelte. »Da ist noch eins! Es sind Zwillinge, Dame Melisande! Ihr bekommt zwei Kinder!« Für ein paar Herzschläge lichtete sich der Nebel aus Leid und Schwäche, und die Gebärende richtete den Blick auf die alte Amme. »Zwei... zwei Kinder?« keuchte sie, ebenso fassungslos wie Clemence. »Kna... Knaben?« Die Frage blieb unbeantwortet. Die knotige Hand der alten Frau strich sanft über den Rücken des quäkenden, winzigen Kindes, das sie in warme Tücher hüllte, ehe sie es in die bereitstehende Wiege legte, um sich dem zweiten Leben zuzuwenden, das nicht minder stürmisch als das erste ans Licht drängte. »Schöne, gesunde Kinder mit geraden Gliedern. Kräftig und groß«, murmelte sie dabei, als könne sie mit diesen Worten den Schicksalsschlag mildern. »Dem Himmel sei Dank, hört Ihr, wie sie schreien?« Das Geschrei des soeben geborenen Duos füllte die Kammer mit so viel Lärm, dass keine der beiden Frauen den Eintritt des Mannes bemerkte, der sich Zugang in die Stube der Wöchnerin verschafft hatte und sich damit in gröbster Weise über Sitte und Anstand hinwegsetzte. Aber Guy de St. Doye war kein Mann, der sich an Sitte und Anstand hielt. Zu groß war der Triumph, der ihn erfüllte, das Bewusstsein des endgültigen Sieges über Melisande, die Gemahlin seines Bruders, die ihn beleidigte und verachtete. Er warf einen Blick auf den zweiten Säugling, den die Amme soeben in Tücher hüllte und riss grob die Umhüllung des ersten, der bereits in der Wiege lag, zur Seite, worauf jener nur noch schriller protestierte, als er es ohnehin schon tat. Dann jedoch trat er an das Bett der ermatteten Frau, deren violette Augen das blasse, eingefallene Gesicht mit den edlen Zügen beherrschten. Augensterne, die ihn verfolgten, die ihm trotzten und ihn missachteten, seit ihr Blick das erste Mal auf ihn gefallen war. »Nun, Dame Melisande«, höhnte er mit dieser raschelnden, tonlosen Stimme, die sie bis in ihre so häufigen Albträume verfolgte. »Mädchen, nichts als Mädchen. Wieder Mädchen. Was ist von einer Hexe auch schon anderes zu erwarten? Aber der Name St. Doye wird nicht durch Euer Blut und Eure Brut beschmutzt, lasst es Euch gesagt sein. Denn mein Sohn wird der nächste Graf von Mesnières!« »Euer Sohn?« Mit nahezu übermenschlicher Anstrengung stützte sich Melisande de St. Doye auf den Unterarm und fixierte ihren Schwager verächtlich. »Ihr habt keinen, Seigneur! Aber um einen zu bekommen, solltet Ihr besser Eurer kalten Frau beiwohnen, statt Euer Begehr auf den Besitz Eures Bruders zu richten. Ihr missachtet die Gebote der heiligen Kirche! Freut Euch nicht zu früh, beim nächsten Mal wird es ein Erbe, dessen könnt Ihr versichert sein!« »O, nein, meine Dame! Dieses Mal täuscht Ihr Euch. Es wird kein nächstes Mal mehr geben. Eure Chance ist vertan. Bei Azincourt hat vor zwei Tagen eine große Schlacht stattgefunden!« Melisande sank zurück. Ihre Ahnungen verdichteten sich zur Gewissheit. Sie hatte nicht einen Moment angenommen, ihr Schwager wäre gekommen, ihr zur Geburt der Zwillinge zu gratulieren. Zwischen ihnen herrschte Krieg, seit sie Guy abgewiesen und damit seinen Stolz verletzt hatte. Sie zwang die Wogen der Schwäche zurück, die ihren Verstand zu lähmen drohten, und schaute ihn auch weiterhin voller Geringschätzung an. »Sagt, was Ihr sagen wollt, und macht Euch von dannen«, erwiderte sie kaum hörbar. »Die englischen Bogenschützen haben das Treffen entschieden«, berichtete Guy genüsslich, als seien die Feinde eher seine Freunde. »Im regennassen Boden versanken die schweren Schlachtrösser der französischen Ritter, und die gepanzerten Reiter hatten keine Chance im Nahkampf. Die Blüte des französischen Adels hat in Azincourt den Tod gefunden, und nur Männer von fürstlichem Blut wurden als Geiseln genommen. Alle anderen Edelmänner wurden getötet. Hört Ihr nicht den Lärm von draußen? Die Bewohner der umliegenden Dörfer fliehen, denn die englischen Truppen sind ihnen dicht auf den Fersen. Ich habe Mesnières in den Verteidigungszustand versetzt, aber ich fürchte, wir sind machtlos, denn die meisten waffenfähigen Männer hat Euer Gatte zu Beginn des Feldzuges mitgenommen.« Melisande wagte nicht die Augen zu schließen. Das Bild des triumphierenden Mannes, der so ungerührt von Tod und Vernichtung sprach, brannte sich in ihre Pupillen. Guy de St. Doye war nur mittelgroß, stämmig und zudem von verkrüppelter Gestalt. Aber nicht von seiner hochgezogenen linken Schulter und dem steifen linken Bein, was ihn beides daran gehindert hatte, wie sein Bruder den ritterlichen Kampf zu suchen, war Melisande abgestoßen worden, als sie ihn kennen lernte. Das wahre Grauen lag in seinen Augen. Farblose, starre Augen, die wie Steine zu beiden Seiten einer scharfen, gewölbten Nase unter buschigen Brauen lagen. Der schöne Mund mit den sinnlich geschwungenen Lippen wirkte seltsam unpassend in diesem Antlitz aus hartem Fels, das durch die hohe Stirn noch größer schien. Ein Kranz aus schütteren mausbraunen Haaren umgab diesen glänzenden Schädel, dessen bläuliche Adern durch die Haut schienen. Meist trug Guy pelzverbrämte Kappen, aber heute hatte er in der Eile darauf verzichtet, sich zu bedecken. »Warum fragt Ihr nicht nach Eurem Gatten, Dame Melisande?« Guys Stimme klang jetzt deutlicher, denn der Amme war es endlich gelungen, die Kinder zum Schweigen zu bringen. Vermutlich weil sie nun beide eng beieinander lagen und jedes die vertraute Wärme des anderen spürte, wie sie es in den vergangenen Monaten gekannt hatten. »Euer Gatte ist tot. Auf dem Schlachtfeld von Azincourt dahingemetzelt.« Er hätte es nicht auszusprechen brauchen, sie hatte es in ihrem Herzen bereits gewusst, aber sie konnte den Aufschrei trotzdem nicht unterdrücken, der die Säuglinge aufs Neue zum Quäken brachte. »Bring die Bälger hinaus!«, wies St. Doye Clemence an, und diese folgte seinem Befehl, wie sie es immer tat, seit sie seine Amme gewesen war und ihn aufgezogen und geliebt hatte. Im Gegensatz zu seiner Mutter, die, entsetzt über seine Entstellung, schon seinen Anblick scheute und bis zu ihrem Tod keine zehn Worte mit ihrem eigenen Sohn gewechselt hatte. »Was ... was ist das für ein Lärm?« Durch die offene Tür glaubte die junge Mutter von ferne Schreie und Waffengeklirr zu hören. »Die Truppen des Feindes greifen an, sagte ich es nicht? Sie verfolgen die zerrütteten Reste unserer Armee.« St. Doye lächelte perfide. »Die Zeit der Rache ist gekommen, du Hexe! Du wirst mich nicht mehr mit deinen Verführungskünsten martern und darüber lachen, dass du mich abgewiesen hast. Niemand lacht ungestraft über mich.« »Ihr seid des Wahnsinns! Ich habe Euch nie verhöhnt!« Melisande versuchte das Bett zu verlassen, sie umklammerte den Pfosten des Baldachins, um nicht zu stürzen. In ihrem durchschwitzten, blutigen Hemd glich sie mehr einem Phantom denn einer lebenden Frau. »Ich habe Euch nichts getan. Ich muss zu meinen Kindern. Ich muss die Kinder in Sicherheit bringen, wenn die Burg angegriffen wird. Nadine, Alison, wo seid ihr?« Guy sah ihr zu, wie er dem Sterben des Verlierers beim Hahnenkampf zusah. Mit dem Gefühl tiefster Befriedigung und einer perversen Neugier darauf, was purer Überlebenswille alles bewirken konnte. »Ihr habt mir das Leben vergällt, Dame!«, antwortete er bitterböse. »Nur eine Hexe kann einem ehrlichen Manne derart ins Blut gehen. Ihn verzaubern und ihn um seinen Verstand bringen. Weißt du, dass ich mich Nacht für Nacht nach deinen weißen Gliedern verzehrt habe? Dass ich bei dir liegen, mich in dich versenken wollte, bis du die Meine bist? Du bist mir Fluch und Hölle zugleich gewesen, aber dieser Tag gibt mir die Gelegenheit, mich ein für alle Male von dir und deiner Brut zu befreien!« Melisande erschauerte vor diesem Abgrund der Bosheit und Begierde, aber sie begriff nur den letzten Satz. »Befreien?«, hauchte sie. »Was habt Ihr mit meinen Töchtern getan? Wo sind sie...« In übermenschlicher Anstrengung gab sie ihren Halt an der geschnitzten Säule auf und taumelte an ihm vorbei, nur von der Sorge aufrecht gehalten, sich um die kleinen Wesen zu kümmern, die doch nur sie auf dieser Welt noch hatten. St. Doye ließ sie gehen, im Bewusstsein, dass sie ihm nicht entkommen konnte, dass seine Stunde geschlagen hatte auf Mesnières! Er musste ihr nur zwei Kammern weiter folgen, wo die aufgeregten, zwitschernden Stimmen der beiden Mädchen verstummten, als die erschreckende Gestalt im Nachtgewand durch die Tür wankte. »Mama! Mama, man kämpft...« Nadine de St. Doye, die ihre Schwester Alison fest an der kleinen Hand hielt, brach ab, als sie den Mann sah, der ihrer Mutter folgte. Sie fürchtete ihn, den finsteren Hinkenden, der ihr und Alison Böses tat, wenn er sie in die Finger bekam. Sie hatte gelernt, ihm aus dem Wege zu gehen, und auch jetzt brachte sie sich hinter Clemence in Sicherheit, welche die beiden Bündel mit ihren neuen Schwestern an ihren Busen drückte. »Es ist aus, Dame Melisande!« schnurrte er bösartig, und Nadine bemerkte entsetzt, dass er den juwelengeschmückten Dolch, den er an seinem Gürtel trug, aus der Schneide zog und prüfend mit dem Daumen über die scharfen Kanten fuhr. »Man wird Euren und den Tod Eurer Bälger bedauern. Englische Marodeure haben Euch auf dem Gewissen, und allenthalben wird man sie verfolgen. Aber das Erbe von Mesnières wird mir und meinem Sohn gehören!« Nadine vermochte sich nicht zu bewegen. Wie gelähmt sah sie ihren Onkel näher kommen. Erst die Hand ihrer Mutter brachte sie zur Besinnung, die heftig an ihrer Schulter rüttelte. »Lauf, Nadine, lauf! Nimm deine Schwester und bring dich vor den Soldaten in Sicherheit! Dort, wo ich es dir gezeigt habe! So lauf doch, Kind...« Von der schluchzenden, verzweifelten Stimme vorangetrieben, wandte sich das kleine Mädchen mit seiner Schwester zu der schmalen Pforte neben der Truhe, die hinter einem gestickten Wandbehang verborgen war. Aber ehe sie in die Dunkelheit schlüpfte, wandte sie sich noch ein letztes Mal um. Sie hätte es besser nicht getan. Die Einzelheiten der Szene gruben sich wie ein glühendes Brandeisen in ihren verstörten, kindlichen Verstand.Ihre Mutter sank taumelnd zu Boden, mit blassen Fingern den juwelenbesetzten Griff des Dolches umklammernd, der nun aus ihrer Brust ragte. Ihr Seufzer ging im Aufschrei der Amme unter. Guy de St. Doye bewegte sich nicht. Er stand da und sah zu, wie Melisande de St. Doye starb. Ein verzerrtes Lächeln geisterte um seine Züge. »Du wirst nicht allein bleiben, Hexe! Warte auf deine Brut, sie wird dir gleich folgen. Sobald ich meinen Dolch aus dir gezogen habe...« Die Welt verschwamm bereits um Melisande, reduzierte sich auf ein paar stechende, aschgraue Augen und einen grinsenden Mund. »Sei verflucht ... Guy de St. Doye! Meine Töchter sollen dir zum Verderben werden!«, keuchte sie mit ihrem letzten Atemzug. »Sei verflucht bis in die Hölle deiner eigenen schwarzen Seele... ich... Ohhh! Lauf, Nadine!« Der letzte Aufschrei ihrer Mutter traf das erstarrte Kind. Es gehorchte endlich und stemmte sich gegen die Pforte, die nach innen aufschwang und einen dunkel gähnenden Abgrund freigab, in den es sich mitsamt seiner weinenden Schwester hineinwarf, die Stufen unter den kleinen Füßen kaum spürend. »Was habt ihr getan?« stammelte Clemence, während der Seigneur de St. Doye seinen Dolch wieder an sich brachte. »Halt den Mund!«, herrschte er sie grob an. »Erstickt die Bälger, sie sind bei der Geburt gestorben. Ich möchte kein Risiko eingehen. Ich kümmere mich um die anderen beiden. Wenn sie bei meiner Rückkehr noch am Leben sind, werfe ich sie selbst von den Zinnen, das schwöre ich. Ich will jede Spur dieser Hexe aus den Mauern von Mesnières tilgen. Niemand soll mehr ihren Namen nennen! Es hat sie nie gegeben!« Ohne sich darum zu kümmern, was die Amme sagte, wandte er sich der Treppe zu, die in den Ostturm hinunterführte, um sein grausiges Werk zu vollenden. Nur so konnte er die Erinnerung an ein Paar sanfte, violette Augen tilgen, die das Entsetzen einer ganzen Welt widerspiegelten, wenn sie ihn ansahen.
1. Kapitel
April 1430 Bourges
Im Licht der flackernden Unschlittkerzen ähnelte die Gaststube der Schenke Zum grünen Hahn mehr einer Höhle denn einer Herberge. Unter den rußigen Balken der tief hängenden Holzdecke drängten sich die Gerbergesellen und die Färberknechte der umliegenden Gassen. Der durchdringende Gestank ihres Handwerkes, der aus ihren Kleidern aufstieg, mischte sich mit dem Dunst von Schweiß, saurem Wein und dem Aroma des schalen, dünnen Eintopfes, den die Mägde des Hauses in tiefen Holzschalen jenen servierten, die danach verlangten. Die Bewohner von Bourges hatten in einem langen, eisigen Winter lernen müssen, sich zu bescheiden. Einem weiteren Winter des Krieges mit den Engländern und deren Verbündeten aus Burgund, der nicht allein an den ehemals üppigen Vorräten, sondern auch an den Hoffnungen der Menschen auf Frieden gezehrt hatte. Es gab kaum mehr Abwechslung und Vergnügen für sie, als einen Schluck sauren Wein in Schenken wie dem Grünen Hahn zu trinken und darüber zu debattieren, wann der König La Pucelle, der kriegerischen Jungfrau erlauben würde, neue Siege zu erringen. Seit Monaten kämpfte sie indes nur eine erfolglose Schlacht gegen Seine Gnaden den Großkämmerer, Georges de la Trémoille, der den König fest in seiner ehrgeizigen Hand hatte und Jeanne d’Arc mit dem Misstrauen eines Mannes begegnete, der keinen Fingerbreit des eigenen Einflusses aufgeben wollte. »Heda, Kleine! Bring uns noch einen Krug von diesem Essig, den der Wirt mit dem Wasser des Auron verdünnt!« Der kräftige Schlag auf das Hinterteil der Magd, der dieser Befehl galt, landete in der Luft, denn das Mädchen hatte sich mit einer graziösen Drehung geschickt außer Reichweite gebracht. »Kommt sofort, Seigneur!«, rief es aus sicherer Entfernung und drängelte sich an den anderen Gästen vorbei ins Nebenzimmer, das ebenso als Küche wie als Hühnerstall, als Dienstbotenkammer wie als Vorratslager diente. Letzteres beanspruchte den geringsten Platz, denn mit Ausnahme der edlen Herren im Schloss musste in diesen Tagen in Bourges ein jeder den Gürtel enger schnallen. Für einen Augenblick verharrte das Mädchen vor dem Weinfass, ehe es den Spund öffnete. Es strich sich mit einer müden Geste ein paar lose Haare aus der Stirn. Ungewöhnliche Haare, die frisch gewaschen im Sonnenlicht wie poliertes Kupfer leuchten konnten. Jetzt hatte der fest geflochtene Zopf den braungrauen Ton von Schmutz und Fett, denn die Magd konnte sich gar nicht mehr daran erinnern, wann sie zum letzten Male ein Badehaus betreten hatte. Ebenso wenig wie daran, wie sich frischer Wind in diesem Haar anfühlte und wie es war, ohne Mauern zu leben. »Faule Trine! Dummes Vagabundenpack! Was stehst du hier herum? Bring den Wein nach draußen, oder ich mache dir mit der Peitsche Beine!« Die scharfe Stimme der Dame Gauberte Chestel, der Wirtin des Grünen Hahns, fuhr dem müden Mädchen wie ein Messer zwischen die Rippen. Fast hätte es auch noch den kostbaren Wein verschüttet, als es nach draußen eilte, dem Befehl nachzukommen. Obwohl so rund und weich wie ein gut gefülltes Federkissen, besaß Gauberte Chestel die Zunge eines scharf geschliffenen Bratenmessers und das Temperament einer wütenden Schlange. Sie misstraute der neuen Magd, seit Maître Chestel sie am ersten Tag des vergangenen Novembers bei sich auf genommen hatte. Sie kannte ihren Gatten und wusste, dass er ein Auge auf die Dirne geworfen hatte, die gemeinsam mit ihrem alten Vater einen Verschlag hinter den Ställen bewohnte und im Grünen Hahn arbeitete, damit sie dort bleiben durften und zu essen bekamen. Auch das Mädchen hatte sehr bald begriffen, was die schmierigen Hände und gierigen Augen des Wirtes zu bedeuten hatten, der ebenso hager und eckig war wie seine Gemahlin rund und weich. Es kannte das Leben, denn es war nicht umsonst auf den Landstraßen zu Hause. Sie hatten ein gutes Auskommen gehabt, solange Hughes der Gaukler noch jung genug für seine akrobatischen Kunststücke und seine Zaubertricks gewesen war. Dann jedoch hatten sich die fortschreitende Gicht und der Krieg im Lande zu einem unheilvollen Gespann vereint. Selbst wenn Hughes noch gesund gewesen wäre, hätten sie in dieser Zeit wohl hungern müssen. Es gab kaum noch Märkte im Land, und das Elend regierte in den Städten und Dörfern, wo früher geerntet und gefeiert worden war. Verbrannte Erde, zerstörte Häuser und bittere Not verdarben den Menschen die Freude an Festen. Im Grunde gratulierte sich das Mädchen dazu, dass Hughes wenigstens in einer Stadt wie Bourges erkrankt war und ihr der Wirt des Grünen Hahns die Möglichkeit gegeben hatte, für Quartier und Essen zu arbeiten. Dass sie jeden Tag als Magd im Grünen Hahn verabscheute, war eine andere Sache. Sie hasste es, sich durch die Männer zu drängen, die Hände voller Krüge und ohne die kleinste Möglichkeit, sich gegen ihre Zoten und unverschämten Berührungen wehren zu können. Sie verabscheute sie alle miteinander, egal ob es nun Soldaten, Handwerker, Gemeine, Knechte oder Lehrburschen waren. Ein jeder von ihnen hielt sie für Freiwild, für eine Dirne, die dankbar sein musste, wenn man ihr einen Sol in den Ausschnitt warf und sie in den Hintern kniff. Sie biss die Zähne aufeinander, wich aus, so gut es ging, und zählte im Dunkel des zugigen Verschlages mit zitternden Händen die wenigen Münzen, die ihre Zukunft sichern sollten. Im Verlaufe des Winters war es trotz aller Mühen ein kleines Häufchen geblieben, denn sie lehnte es ab, wie die beiden anderen Mägde des Grünen Hahns neben dem Wein und dem Eintopf auch noch ihren Körper anzubieten. »Euer Wein«, murmelte sie und knallte den Krug zwischen die Gerber auf den Tisch. »Wohl bekomm's!« »Holla, Täubchen, warum so spröde?«, beschwerte sich ein bleicher Fuhrknecht, der mit den Gerbern würfelte und jenen Wein gewonnen hatte. Unter dem Johlen seiner Zechkumpane bekam er den braunen, fadenscheinigen Rock des Mädchens zu fassen, und eine knirschende Naht ließ dieses von der Flucht Abstand nehmen. Es besaß nur das eine Kleidungsstück, und um es zu retten, ließ es sich mit zusammengebissenen Zähnen auf die knochigen Knie des Mannes ziehen, wobei ihr schmales Gesicht mit den feinen Zügen aus dem Zwielicht tauchte wie eine Blume. »Ist das nicht ein prächtiges Kätzchen? Bleib hier und sei mein Glücksbringer!«, sagte der Blasse erfreut und beugte sich in einer Wolke aus Weindunst und Schlimmerem über sein Opfer, um ihm den Kuss zu rauben, nach dem ihm der Sinn stand. Aber schon im nächsten Augenblick schnalzte er diesen Schmatz lautstark in die Luft, denn die Kleine hatte sich so behände seinem Griff entzogen, dass er gar nicht begreifen konnte, wie dies möglich gewesen war. Vom höhnischen Gelächter seiner Mitspieler verspottet, fluchte er hinter ihr her, während sie sich auf der anderen Seite des Raumes vor ihm in Sicherheit brachte und sich dort für einen Moment in den Schatten der Nische neben dem großen Kamin drückte. Normalerweise drehte sich am Spieß über den Flammen ein Hammel, aber derlei Delikatessen gab es seit Wochen nur noch im Schloss. Mit geschlossenen Augen versuchte das Mädchen seine Wut zu unterdrücken, ehe es seine Arbeit wieder aufnahm. Es stand völlig reglos, um das eigene Temperament im Zaume zu halten, von dessen zorniger Glut niemand im Grünen Hahn etwas ahnte. So ergab es sich, dass es die merkwürdige Stimme in aller Deutlichkeit vernahm. Eine leise, kalte Männerstimme, die befremdlich bei den Kehllauten raschelte, als triebe der Wind getrocknete, abgestorbene Blätter über den Boden. »...natürlich nicht am hellen Tag und mitten in Bourges, du Dummkopf! Aber ich weiß, dass er heute Nacht die Wachen am Stadttor kontrolliert. Er fühlt sich sicher, und er wird keine Eskorte mitnehmen. Es gibt eine Menge Gesindel in dieser Stadt. Niemand wird sich wundern, wenn man Richard mit durchgeschnittener Kehle findet. Aber achte darauf, finden muss man ihn, damit klar ist, dass er dieses Mal auch wirklich tot ist!« Die junge Magd vermochte nicht zu unterscheiden, was sie mehr erschreckte, der Inhalt oder die Art, wie diese Worte gesprochen wurden. Unbeteiligt, befehlsgewohnt, von einer so selbstverständlichen Grausamkeit erfüllt, dass es sie in ihrem Versteck festnagelte. Sie verfügte über ein ungewöhnlich feines Gehör, und die Fähigkeit, in den Nuancen einer Stimme zu lesen, hatte sie auf manch einem Markt dazu befähigt, mit ein wenig Humbug drumherum, die wahrsagende Zigeunerin zu spielen. Aber das hier war kein dummer Streich, hier ging es um ein Menschenleben. Das Blut rauschte in ihren Ohren, und die Antwort des zweiten Mannes entging ihr. Allein, in diesem Moment hatte Maître Chestel, der seine Schenke mit eiserner Hand dirigierte, das herumstehende Mädchen entdeckt. Er fügte den zahllosen blauen Flecken auf ihrem Oberarm einen weiteren hinzu, indem er es dort packte und unaufhaltsam mit sich zerrte. »Du irrst dich, wenn du denkst, dass ich dich fürs Herumstehen bezahle, Kleines!«, sagte er dabei mit jener schmierigfalschen Freundlichkeit, die sie fürchten gelernt hatte. »Mach dich an die Arbeit, dort hinten die Soldaten bekommen zwei Krüge von unserem Roten sowie Brot und Suppe! In die Küche mit dir!« Da er sie gleichzeitig heftig in die Sitzfläche kniff, eilte die Gescholtene davon und blinzelte gegen die Tränen an, die ihr aufgrund dieser Rohheit in die Augen gestiegen waren. Sie weinte nicht, denn sie hatte gelernt, dass Tränen in ihrem Dasein keineswegs weiterhalfen. Dass sie heute nahe daran war, schob sie auf den Schreck, den sie eben erlitten hatte, als sie den bedrohlichen Befehl zum Mord an einem anderen Menschen vernommen hatte. Was sollte sie tun? Es wäre ein Leichtes herauszufinden, wer gesprochen hatte, sie musste nur die Bank auf der anderen Seite des Kamins beobachten. Und dann? Die Schergen des Rates von Bourges alarmieren? Lieber Himmel, wer glaubte schon der Tochter eines Gauklers ? Einer Landstreicherin, einer Schenkenmagd? Was konnte sie sagen? »Verzeiht, Ihr Herren, aber ich habe gehört, dass ein Mann namens Richard getötet werden soll, wenn er die Wachen am Stadttor kontrolliert. Ihr müsst diese Tat verhindern!« Man würde sie auslachen, verhöhnen – im besten Falle. Im schlimmeren an den Pranger stellen und danach aus der Stadt jagen. Eine Komödiantin konnte nicht mit Wohlwollen rechnen. Bourges war froh um jedes Maul, das es nicht stopfen musste. Jeder Versuch, diesen unbekannten Mann zu retten, bedeutete, dass sie die gefährdete Existenz ihres kranken Vaters und die eigene aufs Spiel setzte. Was, bei allen Heiligen, sollte sie tun? Auf jeden Fall keinesfalls länger herumtrödeln, sonst gelang es ihr, die Dame Chestel und ihren widerlichen Gatten endgültig gegen sich aufzubringen. Mit fliegenden Röcken eilte sie, die beiden Krüge Rotwein zu holen, auf die ein wüster Haufen von grölenden Soldaten bereits wartete, während Suzon, die zweite Magd, mit halb offenem Mieder und schrillem Lachen bei ihnen saß. Sie schlug die Augen nieder, um Suzons bloße Brüste nicht sehen zu müssen, während sie die schweren Kannen herbeischleppte. Törichterweise erkannte sie deswegen nicht rechtzeitig, dass ihr blasser Verehrer von eben sein Ziel aufs Neue anvisierte. Ein wenig schwankend erhob er sich und verstellte ihr den Weg. »Lasst mich durch!«, bat sie vergeblich. »Die Männer dort warten auf ihren Wein!« »Und ich warte auf dich, mein Täubchen!«, rief der Betrunkene und packte sie, ohne auf die Krüge zu achten, nach denen Suzon und ihre Landsknechte bereits die Hände ausstreckten. Die in die Enge getriebene Magd versuchte seinem Griff auszuweichen und stolperte dabei über das ausgestreckte Bein eines Gerbergesellen, der sich einen Teufel darum scherte, was um ihn herum vorging. Beim verzweifelten Versuch, wenigstens den Wein zu retten, stürzte das Mädchen seitwärts und landete in einem Regen aus Rotwein im Schoß eines bulligen Mannes, der mit einem wüsten Fluch auf die Beine sprang und sie packte. »Zum Henker, Dirne, bist du toll?«, schrie er und schleuderte sie mit einem harten Stoß so kraftvoll von sich, dass sie einer Lumpenpuppe gleich quer über den Gang flog und sich selbst sowie den Rest des Weines dort über einen anderen Gast goss. Er hatte, das Gesicht unter der Kapuze seines Umhanges halb verborgen, dem Streit bisher keine Aufmerksamkeit geschenkt. Sein heiserer Aufschrei brach mitten im Ton ab, als sein Blick auf das ovale, blasse Antlitz der Magd fiel, die vor ihm auf den Knien lag und sich ein paar Weinspritzer mit dem Handrücken von den Wangen wischte, ehe sie versuchte, wieder auf die Beine zu kommen. Während um sie herum ein Chaos aus wütenden Stimmen und Fluchen herrschte, übertönt vom schrillen Kreischen Suzons und dem energischen Bass Maître Chestels, der versuchte, für Ordnung zu sorgen, fand sich das Mädchen einem so stechenden, farblosen Blick aus einem Paar tief liegender Augen ausgesetzt, dass es wie gelähmt mitten in der mechanischen Bewegung verharrte. »Wer ... wer bist du? Rede!« Schon ehe er den Mund öffnete, hatte sie instinktiv geahnt, dass dies der Mann mit der Stimme war, die wie das trockene Knistern von Herbstblättern klang. Sie passte zu der unerbittlichen Kälte der leblosen Pupillen, wenngleich nicht zu dem überraschend wohl geformten, schönen Mund. Lippen, die den Worten Hohn sprachen, die wie schmerzende Eiskristalle auf die Magd herab prasselten. »Dumme Gans, kannst du nicht sprechen? Bist du stumm? Hast du einen Namen?« »Man nennt mich Nana, Herr...«, flüsterte sie. »Woher kommst du?« »Eine Gauklerin ist sie, Seigneur! Ein wildes Ding, das mit seinem Vater im vergangenen Herbst bei uns gestrandet ist. Verzeiht, dass sie Euch belästigt hat. Ich werde sie verprügeln. Ihr könnt Euch darauf verlassen, dass dergleichen nicht mehr vorkommt. Ich weiß die Ehre zu schätzen, die Ihr meiner bescheidenen Schänke erweist. Darf ich Euch einen neuen Krug Wein bringen lassen? Auf die Rechnung des Hauses versteht sich...« Maître Chestel dienerte einem Hampelmann gleich heran, und Nana spürte den Tritt seiner Holzschuhe in ihren Rippen, ehe sie sich vollends erheben konnte. »Eine Gauklerin sagt Ihr, hm...« Ohne dass er die Stimme hob, vermochte der Fremde mit seinen wenigen Worten dem Mädchen mehr Furcht einzujagen als der Wirt mit einem ganzen Wutanfall. Es versuchte vergeblich sein Zittern zu unterdrücken, aber die Art, wie es seine Finger um die schmutzigen Rockfalten schlang und unbewusst vor ihm zurückwich, verriet, was es fühlte. Eine klauenartige Hand schoss vor und packte Nanas Kinn, um es sehr langsam erst auf die eine und dann auf die andere Seite zu drehen. Es schien, als wolle der Mann das schmale Antlitz mit den riesigen, furchtsamen Augen in allen Einzelheiten studieren. Von den fein geschwungenen dunklen Brauenbögen über die zierliche kleine Nase bis hin zu den bebenden vollen Lippen. Wie weit ihm auffiel, welche Schönheit unter den Schichten von Schmutz und Erschöpfung steckte, war nicht zu sagen. Auch Nana nahm jetzt notgedrungen mehr von seiner Erscheinung wahr, während ihr Herz wie rasend pochte und kalter Schweiß sich unter dem groben Stoff ihrer Bluse sammelte. Die Kapuze war herabgeglitten, und sein kahler Schädel glänzte im Dämmerschein. Ein Totenschädel mit straff gespannter Haut, dem die mausbraunen Haarbüschel über den Ohren das groteske Aussehen eines Harlekins gaben, der sich die Reste einer Perücke angeklebt hatte. Doch die tief eingegrabenen Falten, der scharfe Nasenrücken und die buschigen Brauen über den kalten, leblosen Augen wirkten alles andere als komisch. Erst jetzt bemerkte sie, dass sein Umhang aus feinstem Samt bestand und mit Pelz gefüttert war. Dass er spanische Lederstiefel trug und in seinem Wams Goldfäden glitzerten. Ein reicher Mann. Ein Edelmann vielleicht sogar? Etwas in Nana sträubte sich, das anzunehmen. Edelmänner sahen anders aus. Sie waren nobel, vornehm, tapfer und schön wie zum Beispiel Colin d’Harigny, der gascognische Hauptmann, der an der Seite Jeanne d’Arcs ritt, wenn sie die Stadt verließ. Nana hatte ihn vor wenigen Wochen das erste Mal gesehen, und seitdem trug sie sein Bild im Herzen. Er glich aufs Haar jenen Märchenprinzen, von denen die Geschichtenerzähler auf den Märkten berichteten. Den tapferen Kreuzrittern, die ihr Leben vor Jerusalem riskiert hatten, oder den gepanzerten Helden, die im ritterlichen Zweikampf ihr Leben für eine Dame riskierten. Das Mädchen liebte Geschichten wie diese. Beim Zuhören konnte es vergessen, dass es nur ein vogelfreies Nichts war. Eine Landstreicherin ohne Rechte und Heimat. Eine abhängige Sklavin, die auch die demütigende Musterung durch diesen Mann widerspruchslos über sich ergehen lassen musste, wenn sie essen und schlafen wollte. »Steht sie Euren Gästen zu Diensten?« »Neiin!« Nanas protestierender Aufschrei entlockte ihm ein Lächeln, das ihr noch schändlicher erschien als sein Blick. Ihr Widerstand schien ihn zu amüsieren. »Du gefällst mir, Mädchen«, sagte er trocken. »Du erinnerst mich an eine andere kleine Hexe, die es gewagt hat, mir zu trotzen. Es wird mich amüsieren, ein wenig mit dir zu spielen. Ich nehme sie mit!« Die gelassene Feststellung vertiefte die Röte auf Maître Chestels Stirn, der sich in Gedanken einen Trottel schimpfte. Warum hatte er das Mädchen nicht schon längst genommen? Warum hatte er damit gewartet, bis sie ihm ein anderer vor der Nase wegschnappte? »Seigneur, das geht nicht!«, wagte er zu protestieren. »Nana ist meine Magd. Ich brauche sie. Seht Euch doch um! Wir haben kaum genug Hände, um alle Gäste zu bedienen. Es geht nicht an, dass...« »Hier hast du fünf Livres, dafür kannst du leicht eine neue Magd gewinnen, und außerdem bekommst du diese hier zurück, wenn sie mich langweilt.« Das Klirren der silbernen Münzen, die vor Maître Chestel auf den gestampften Lehmboden fielen, klang in Nanas Ohren wie der Donner von Kanonenschüssen. Sie musste träumen! Sie konnte das nicht in Wirklichkeit erleben. Das war nicht Maître Chestel, der auf den Knien vor ihr kroch, um die Silberstücke einzusammeln, ehe er sich mit einer Reihe von untertänigsten Bücklingen so schnell aus dem Staube machte, dass kein Zweifel daran bestehen konnte, dass er erst einmal seine unverhoffte Beute in Sicherheit bringen wollte. Im Grünen Hahn zahlten die Gäste mit Kupferpfennigen, vielleicht auch einmal mit Sous, wenn es hochkam. Ein richtiges Silberstück hatte Nana unter diesem Dach noch nie gesehen. Das also war sie wert, fünf Silberstücke. Sollte sie sich darüber freuen? Himmel, was für närrische Gedanken sie bewegten! »Komm mit!« Als sich der Mann erhob, erkannte Nana, dass seine linke Schulter höher war als die rechte und dass er beim Gehen schwankte wie ein Schiff im Sturm. Die Angst, die sie vergeblich zu meistern versuchte, überfiel sie aufs Neue. Die schwankende, gedrungene Gestalt rief das Echo namenlosen, unbekannten Entsetzens in ihr wach. Eines Grauens, das sie tief aus ihrem Inneren heraus überfiel und dem sie keinen Namen geben konnte. Das Grausen erstickender Albträume und verzweifelter Schreie, die in ihren Ohren nachhallten, ohne dass sie die Worte verstand. »Ich ... ich kann nicht, Seigneur!«, sagte sie mit all dem Mut, den sie aufbringen konnte. »Mein Vater ist krank. Er braucht mich. Er darf hier nur wohnen, wenn ich dafür arbeite. Er ist ein alter Mann, habt Erbarmen mit uns! Ich... ich bin keine gute Dienerin...« Schon als sie das Wort >Erbarmen< aussprach, wusste sie, dass es umsonst sein würde. Seine vollen Lippen entblößten eine Reihe gelblicher Zähne, als sie die Farce eines Lächelns andeuteten, eines Lächelns, das ihr eine Gänsehaut verursachte. »Dein Vater kümmert mich nicht, und für dich habe ich bezahlt.« »Aber ich... ich bitte Euch...« Nana verstummte. Sie erkannte plötzlich, dass es ihm gefiel, wenn sie sich demütigte, aber dass er keinen Fingerbreit von seinen Plänen abweichen würde. Dieser Fremde verströmte eine so absolute Aura der Gefühllosigkeit, dass ihn die Kälte wie ein zweiter Mantel umgab. »Damit wäre die Angelegenheit wohl geklärt!«, meinte er schließlich, als sie nichts mehr sagte. »Folge mir!« Erst jetzt wurde Nana bewusst, dass die halbe Schänke ihnen zugehört hatte. Viele Blicke folgten ihr, als sie an der Hand des Mannes hinaus stolperte. Die der Männer nachdenklich, mit einem Ausdruck des Bedauerns, die Suzons und der anderen Magd mit einer Mischung aus Neid und Anteilnahme. Sie versuchte, sich an die Worte eines Gebets zu erinnern, aber in ihrem Kopf herrschte in diesem Moment absolute, völlige Leere. Die Kälte der Aprilnacht drang durch die dünnen Lumpen ihrer Kleidung, und sie rutschte mit ihren Holzpantinen auf dem Unrat der Gasse aus. Die Sichel des Mondes spendete diffuses Licht, das sich eine schmale Bahn zwischen den Hausgiebeln suchte, die sich in der Mitte der Straße zueinander neigten. Der Gestank der Gerbereien und Färbereien mischte sich mit dem des herumliegenden Abfalles und legte sich erstickend über jeden Atemzug. Obwohl sie nun schon seit fünf Monaten an diesem Ort lebte, hatte sich Nana noch immer nicht daran gewöhnt. Ihr Husten ging im Geklapper ihrer eiligen Schritte unter. Für einen Moment spielte sie mit dem Gedanken, davonzulaufen. Er würde sie nicht einholen. Aber sie konnte auch nicht fliehen. Die Stadttore waren geschlossen, und ein Mädchen ihres Standes, das nachts allein durch eine Stadt lief, in der es von Soldaten und königlichen Wachen nur so wimmelte, konnte sich ebenso gut gleich von den Wehrgängen der Stadtmauer stürzen. Zudem, wer würde sie schützen? Wen konnte sie um Hilfe bitten? Dieser da sah so aus, als sei er reich und mächtig genug, um jede ihrer Bemühungen zum Scheitern zu bringen. Nana rang in kurzen, heftigen Zügen um Atem. Obwohl durch ein zu kurzes Bein behindert, schritt ihr Begleiter zügig voran, und er lockerte nicht ein einziges Mal den festen, klauenartigen Griff um ihr Handgelenk. »Du wirst sein wie sie, wenn sie dich gewaschen und entsprechend gekleidet haben«, sagte er nun mit seiner unheimlichen Stimme, und Nana schreckte aus ihren Gedanken auf. »Ich liebe es, mich an ihr zu rächen. In ihrem Namen wirst du dafür büßen, dass sie mich abgewiesen, verhöhnt und verspottet hat. Die Hexe ist tot, aber du lebst! Wer hätte gedacht, dass ich in dieser Kaschemme einen solchen Schatz entdecken würde?« Nana schluckte. Sie wusste nicht, wovon er sprach, aber sie verspürte dennoch eine schreckliche Angst, die ihr die Kehle zuschnürte. Sie konnte sich nicht erinnern, jemals in ihrem ganzen unsicheren Leben eine solche Panik und einen so grenzenlosen Horror verspürt zu haben. Sie passierten einen Trupp Wachsoldaten und einen braven , Bürger, der im Schein einer Pechfackel seinem Haus zustrebte. Keiner hatte auch nur einen Blick für sie. Mägde wie Nana gehörten dem Mann, der sie besaß. Und dieser hier hatte fünf Silberstücke für ihr Leben und ihre Freiheit bezahlt. Das war das Ende.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!