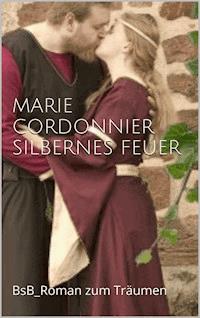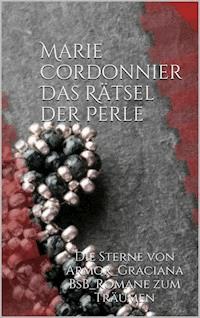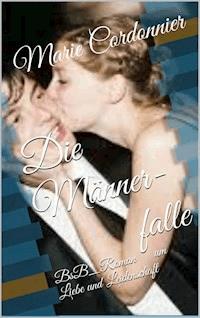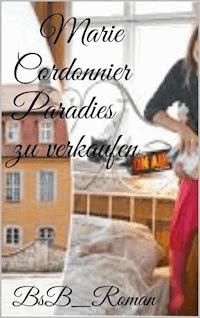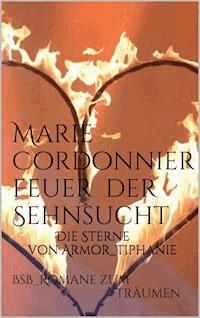ISBN 978-3-86466-217-1
This ebook was created with BackTypo ( http://backtypo.com)
by Simplicissimus Book Farm
© 2014 by BestSelectBook_Digital Publishers
Digitalised by DokuFactory Groß-Umstadt
Table of contents
Burg Glain – Normandie, im Oktober des Jahres 1270
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
Angers – Im März des Jahres 1272
Burg Glain – Normandie, im Oktober des Jahres 1270
Der Nebel kam früh in diesem Jahr. Er hüllte das Land in seine grauen Schleier und milderte die schroffen Konturen der alten Burg. Gnädig verdeckte er die Schwäche ihrer Mauern und den trostlosen Anblick der bröckelnden Steine. Er dämpfte die Farben und Töne, um dann feucht und klamm zwischen die Ritzen und Läden der geSchlossenen Fensterhöhlen zu kriechen. Er verwandelte den stolzen Sitz der Escoudrys in einen tristen, unwohnlichen Ort, an dem weder Wohlbehagen noch Hoffnung zu Hause waren.
Die vier jungen Männer, die wie ein Rudel unzufriedener Wölfe unter diesem Dach lebten, trugen ihr Teil dazu bei, dass auch kein Friede aufkam. Gereizt, ungebärdig und von ausgeprägtem, schwierigem Charakter, empfanden sie die engen Mauern der väterlichen Burg ebenso als Kerker wie die Ausweglosigkeit ihrer Situation. Doch die Macht des Mannes, die sie in dieser Burg festhielt, war groß genug, um sogar dieses aufsässige Quartett zu bändigen und an dem Ort zu halten, den nicht zu verlassen er ihnen befohlen hatte.
Auch dieser beginnende Abend, der sie um das Feuer des verrußten, riesigen Steinkamins in der Halle der Burg sah, schien nur ein weiterer in einer Kette ereignisloser, erbärmlicher Tage zu sein. Die gereizte Stille wurde lediglich vom leisen Knacken der Feuerscheite unterbrochen, vom Rascheln des Ungeziefers und dem Fiepen der Mäuse, die im alten, selten gewechselten Bodenstroh ihre Heimat hatten. In den Küchengewölben kreischte eine Magd, und der ferne Fluch eines Knechtes antwortete darauf. Keiner der jungen Männer kam auf die Idee, das Gesinde zu Zucht und Ordnung anzuhalten.
»Wahrhaftig, ich begreife es nicht«, fuhr jetzt die gebückte Gestalt am Kamin auf, die bislang, den einfachen Holzbecher in der Hand, trübe in das Glimmen der Glut gestarrt hatte. »Wir sollten im Heer des Königs sein! Ich hasse es, wie ein Bauer dahinzuvegetieren, mit keiner anderen Abwechslung als jener von Nebel und Sturm! Ich weigere mich, den Winter so zu verbringen! Es ist eines Edelmannes unwürdig, so zu leben!«
»Du hast die Alternative abgeschlagen, Kleiner!« warf der Älteste mit tiefer, ruhiger Stimme ein, während er gelassen die geschnitzten Figuren auf einem Schachbrett bewegte.
»Verdammt, Mathieu! Warum seid Ihr nicht selbst Pfaffe geworden, wenn Euch das Dasein hinter Klostermauem so erstrebenswert erscheint?«
»Weil ich der Erbe des Falken bin, Kleiner!« Äußerlich behielt der andere seine stoische Ruhe bei, wenngleich es gefährlich in seinen Augen aufflammte. »Es ist von jeher so in dieser Familie, dass der jüngste Sohn der Kirche versprochen wird und ebenso die jüngste Tochter.«
»Zum Henker mit Euren Traditionen«, fuhr der junge Mann am Kamin auf. »Wozu haltet Ihr sie aufrecht? Für diesen verwahrlosten Haufen alter Steine? Um in Armut und Bescheidenheit in die Grube zu sinken?«
»Der Falke wird zurückkommen, und du weißt so gut wie ich, Kleiner, dass der König seinen treuen Kampfgefährten überreich belohnen wird. Hast du noch nie von den Schätzen der Sarazenen gehört? Von Palästen voller Gold und Edelsteinen? Von dem sagenhaften Schatz, den der König und unser Vater bei Damiette gefunden haben sollen?«
»Glaubt Ihr an die Legenden der alten Weiber?« mischte sich in diesem Moment eine spöttische dritte Stimme in das Gespräch.
Es handelte sich um den Partner auf der anderen Seite des Schachbrettes, und obwohl ihn mit den anderen eine gewisse Familienähnlichkeit verband, so wirkte er doch eher wie eine verfeinerte, sensiblere Ausgabe der athletischen Kämpfergestalten seiner Brüder.
»Der Kreuzzug unseres verehrten Souveräns droht ein Fiasko zu werden, davor wird ihn die gründliche Vorbereitung keinesfalls bewahren! Dies sind nicht die Zeiten, sich mit den Fürsten des Morgenlandes anzulegen. Jeder vernünftige Edelmann sollte keine Reichtümer erwarten, sondern im besten Falle eine Niederlage.«
»Bah, Rogier! Es ist typisch für Euch, das Haar in der Suppe zu suchen!« Nun beteiligte sich auch der Vierte am Gespräch, der bisher versucht hatte, sich aus der Diskussion seiner Brüder herauszuhalten. Er war der Zweitälteste der stattlichen Schar, und er besaß die imposanteste Erscheinung. »So christlich die Ziele unseres verehrten Königs auch sein mögen, die meisten seiner Begleiter sind mit ihm über das Mittelmeer gefahren, um neben Ruhm und Ehren auch weltliche Reichtümer zu finden. Wollt Ihr uns weismachen, man würde dort umsonst danach suchen?«
Der mit Rogier angesprochene Schachspieler wandte seinem Bruder das Antlitz mit den ein wenig scharfen, ausgeprägten Zügen zu und zog die schmalen Brauen hoch. »Ihr werdet noch an meine Worte denken, Simon!«
»Ich für meinen Teil hätte der Kirche lieber in diesem Kreuzfahrerheer gedient als auf den durchgeknieten Fliesen der Mönche von Mont Saint Michel«, meldete sich der Jüngste wieder zu Wort, der nun seinen Platz am Kamin aufgegeben hatte und mit den unruhigen Schritten eines gefangenen Raubtieres über die raschelnden Binsen lief. Er trug die einfachen Leinengewänder eines Knechtes, und lediglich der Adel seiner Züge unterschied ihn von den Burschen, die in den Ställen und auf den Feldern arbeiteten.
»Einen Jüngling, der mit Schimpf und Schande aus dem
Kloster nach Hause geschickt wurde, ehe er sein Noviziat überhaupt antreten konnte, würde unser König auch nicht in seinem Heer dulden«, rief ihm Mathieu d'Escoudry seine Verfehlungen in Erinnerung. »Es wird nicht zur Freude unseres Herrn Vaters sein, dass du den Namen d'Escoudry mit der Schande närrischer Streiche und rebellischen Unsinns belastet hast.«
»Ich hatte Euch gewarnt«, erklärte der nervöse junge Mann, der sichtlich Probleme hatte, seine überschüssigen Kräfte zu kontrollieren. »Ich wollte kein Klosterbruder werden, und Ihr habt mir nicht geglaubt. Nun werft mir nicht vor, dass geschehen ist, was geschehen musste.«
»Hört auf, Euch zu streiten«, mahnte Rogier diplomatisch und schob das Schachbrett zurück. »Diese Partie habt Ihr ohnehin verloren, Mathieu! Es bereitet mir kein Vergnügen, Euren mehr oder weniger geschickten Ausweichmanövern zuzusehen.«
Mathieu d'Escoudry bezähmte seinen aufflammenden Zorn nur mit Mühe. Wenngleich er es als seine Pflicht ansah, als Ältester seine Brüder unter Kontrolle zu halten, so fragte doch auch er sich, weshalb sein Vater von ihnen verlangte, Glain nicht zu verlassen.
Er erinnerte sich nur zu gut des Gesprächs, das er mit dem Falken geführt hatte, ehe jener erneut an der Seite des Königs in den Kampf für das Christentum gezogen war. Eines Königs, der ihm mehr zu bedeuten schien als seine Söhne, seine Gemahlin und sein Lehen.
»Es ist an der Zeit, Vater, dass Ihr beim König den Lohn für die langen Jahre Eurer treuen Dienste einfordert«, hatte er zu sagen gewagt. »Ihr seid sein Gefährte, wenn nicht gar sein Freund, aber es scheint ihm egal zu sein, wovon Eure Söhne leben und wie dieses verdammte karge Land voller Salzmarschen sie ernähren soll.«
»Ich diene dem König nicht, um seine Schatzkammer zu leeren, sondern weil meine Ehre und mein Herz es mir befehlen«, hatte der stolze Krieger seinem ehrgeizigen Ältesten geantwortet. »Es wird der Schaden unseres Geschlechtes nicht sein, einem König zu gehorchen, welchen man den edelsten der Christenheit nennt.«
»Und weshalb ist es Euer Wille, dass keiner Eurer Söhne Euch begleitet?«
»Ihr bleibt zum Schutze Eurer Mutter zurück!«
Mathieu schwankte noch jetzt zwischen Bewunderung und wütendem Ärger. Er glaubte einen anderen, triftigeren Grund für die Weigerung des Falken zu kennen: den verhängnisvollen Stolz seines Vaters.
Mathieu d'Escoudry, dessen Erbe er war und dessen Namen er weiter führte, war zwar der berühmteste und tapferste Hauptmann des Königs; dass man ihn landauf, landab den Falken nannte, rührte ebenso von seiner Kampfeskraft und Schnelligkeit her wie auch von dem scharfen Raubvogelprofil und den braunen Haaren, die er seinen vier Söhnen in unterschiedlicher Ausprägung vermacht hatte; gleichzeitig aber war er auch so arm wie ein Bettler.
Er sah vermutlich keine Möglichkeit, drei erwachsene junge Männer so auszustatten, dass sie im Heer des Königs ihren Weg machen konnten. Die Kosten für Rüstungen, Waffen, Pferde und Knappen überstiegen seine Mittel. Und ehe er zuließ, dass die arrogante Clique um den Bruder des Königs, Charles von Anjou, sich über seine Söhne mokierte, verbannte er sie lieber auf seine Burg.
Mathieu hatte sich dem Befehl nur widerstrebend unterworfen, und nun stellte er ihn mehr denn je in Frage. Hinzu kam, dass der letzte Sommer das Leben der zarten, frommen Mutter gekostet hatte, die neben den vier überlebenden Söhnen des Falken weitere acht Kinder zur Welt gebracht hatte, die alle nicht viel älter als ein paar Tage oder Monate geworden waren. Verbraucht und müde, war ihr schon lange vor Jahreswechsel die Führung der Burg aus der Hand geglitten, aber ihr Leiden hatte den Frühling überdauert und erst an einem brütend heißen Augusttag ein Ende gefunden. Es gab keinen Grund mehr für ihn und seine Brüder, auf Burg Glain zu versauern. Freilich, wie sollte man das dem Falken beibringen?
»Ich hasse diese Mauern!« rief der Jüngste wütend. »Steine, nichts als verdammte Steine! Am liebsten würde ich ...«
Seine Brüder sollten nie erfahren, was er als nächstes verkünden wollte, denn in diesem Moment näherte sich dem stellvertretenden Burgherrn ein älterer Mann in braunem, bescheidenem Tuch, der auf der Burg das Amt des Seneschalls ebenso versah wie das des Kellerers und Waffenmeisters, des Herolds und des Leibdieners.
»Zwei Fremde bitten um Einlass, Herr!« wandte er sich an Mathieu, und der verächtliche Tonfall seiner Worte verriet, dass es sich um Menschen handeln musste, deren Armut sogar noch jene überstieg, die auf Glain das Regiment führte.
»Und warum, Cyril, bittest du diese Fremden nicht, sich in der Küche aufzuwärmen?« forschte der junge Burgherr leicht gereizt. »Ich nehme an, es findet sich eine Schale Suppe für die beiden und ein Platz vor dem Feuer. Wir sind arm, aber keine Unmenschen, denn wir kennen die Pflicht der christlichen Nächstenliebe.«
Jaufré d'Escoudry fühlte sich durch diese ruhige Predigt an seine Zeit im Kloster erinnert und verdrehte unwillkürlich die Augen, ehe er den Rest des Apfelweines austrank, der sich in seinem hölzernen Becher befand. Wenigstens die Apfelernte konnte sich sehen lassen auf Burg Glain. Er wollte sich eben wieder seinem Platz am Kamin zuwenden, als die beiden Fremden in die Halle traten, die es offensichtlich für unter ihrer Würde gehalten hatten, draußen auf die Antwort Cyrils zu warten.
Das bizarre Paar verschlug allen die Sprache, und aus schmalen Augen versuchte sich jeder der vier Brüder sein eigenes Bild zu machen. Ein großer, hagerer Krieger mit bräunlichem, vernarbtem Gesicht, der unter seinem nassen Umhang einen beeindruckenden Krummsäbel trug und anstelle eines Helmes oder Hutes auf merkwürdige Weise Stoff um seinen Kopf gewickelt hatte, hielt ein schmales Geschöpf an der Hand, das ihm nicht mal bis an die Schulter reichte. Ganz in einen dunklen Mantel gehüllt, drängte sich das Kind eng an seinen Begleiter, wenngleich unter der großen Kapuze neugierige helle Augen funkelten.
»Mathieu d'Escoudry?« fragte der muselmanische Krieger mit hartem Akzent und wandte sich ohne zu zögern an den Ältesten der Brüder.
»Das bin ich.« Mathieu nickte und erhob sich von seiner Bank, ohne dass ihm bewusst wurde, welche Ehre er dem Fremden damit erwies. Es war etwas in der Haltung und Selbstsicherheit dieses Mannes, das Respekt heischte und den Krieger verriet, auch wenn er im Moment wohl eher den Dienst eines Kindermädchens versah.
»Ich habe eine Botschaft von Eurem Vater für Euch«, erklärte der Mann und reichte Mathieu ein mehrmals gefaltetes Pergament. Dann ergriff er die Hand des Kindes und führte es vor die Flammen des Kamins, wo er es mit sanftem Druck auf den Sitz drückte, den Jaufré noch vor wenigen Minuten eingenommen hatte. Jaufré entging weder das erleichterte Aufatmen der schmalen Gestalt noch die Tatsache, dass ihre Kleider vor Nässe trieften. Wahrhaftig ein klägliches kleines Geschöpfchen!
Er füllte seinen leeren Becher an einem kleinen hölzernen Fass, das neben der Tür auf gebockt war, und reichte dem Kleinen den vollen Becher. Für einen Herzschlag lang verharrte er mitten in der Geste, denn das Kind richtete einen so traurigen, verzweifelten Blick aus silberfarbenen
Augen auf ihn, dass ihn der ganze Jammer der winzigen Gestalt überflutete.
»Hier, trink«, sagte er ungeschickt und rau. »Es ist Apfelwein, er wird dich wärmen, und du siehst mir verdammt danach aus, als hättest du ein wenig Wärme nötig.«
Die eisigen schmalen Finger umspannten den Becher, und ehe Jaufré sein mildtätiges Werk fortführen konnte, lenkte ihn ein verblüffter Aufschrei Mathieus ab, der mit fassungsloser Miene auf das entfaltete Pergament starrte, das zweifelsfrei mit den steifen, ungelenken Schriftzügen des Falken bedeckt war, der zwar schreiben konnte, aber seine Fertigkeit nur selten übte.
»Ich bitte Euch, Mathieu!« ertönte jetzt die missgelaunte Stimme Rogiers. »Hüllt Euch nicht in Geheimnisse, sondern teilt uns mit, was der Falke schreibt. Cyril sorgt dafür, dass der Mann und das Kind in der Küche versorgt werden. Es ist nicht nötig, dass ...«
»lasst!« Mathieu winkte ab. »Ich bin sicher, unser morgenländischer Freund weiß, was in diesem Brief steht und was dieses Kind dort betrifft; es sieht so aus, als könnten wir es überhaupt nicht mehr fortschicken. Unser verehrter Herr Vater teilt uns mit, dass wir ...«
Er warf mit gerunzelter Stirn einen Blick auf die Botschaft, suchte eine bestimmte Stelle und fuhr dann noch wütender fort: »dass wir Roxana wie unsere Schwester behandeln und bei uns aufnehmen sollen. Wie eine Schwester, bei allen Heiligen! Es ist ein Glück, dass unsere Mutter diese Demütigung nicht mehr erleben musste. Bei Gott, ich werde dem Falken ...«
»Es ist die letzte Botschaft Eures Vaters«, fiel ihm der fremde Krieger scharf ins Wort. »Der Falke war unter den Männern des Königs, die vor Tunis ums Leben gekommen sind, wenige Tage, nachdem auch Ludwig von Frankreich seinen Leiden erlegen ist!«
Die doppelte Wucht dieser Todesnachricht verschlug allen vier Brüdern das Wort. Fassungslose Blicke trafen sich, und Jaufré bemerkte als einziger, dass das Kind mit den Tränen kämpfte und die weißen Zähne schmerzvoll in die Unterlippe grub. War sie tatsächlich seine Schwester?
Ein höhnisches Lächeln verzerrte seinen edel geschnittenen Mund, eine Mischung aus Enttäuschung und Verachtung. So war denn auch der Falke den Versuchungen des Fleisches erlegen. Jener Vater, der für seine Söhne den Status eines kriegerischen Gottes gehabt hatte. Doch offensichtlich eines Heiligen mit sehr menschlichen Fehlern, der auf der anderen Seite des Meeres vergessen konnte, dass zu Hause eine Dame geduldig auf ihn wartete.
»Unser Vater ist im Kampf gegen die Ungläubigen gefallen?« Simon d'Escoudry schien es in Worte fassen zu müssen, ehe er es glauben konnte.
»Der König hatte sich einen ungünstigen Zeitpunkt für seine Landung im ehemaligen Karthago erwählt«, beantwortete der fremde Krieger ein wenig umständlich die klare Frage. »Die Hitze, der Durst und der Hunger haben seine Armee gemeinsam mit der Pest zum größten Teil vernichtet. Diejenigen, die wie der König der schwarzen Pest zum Opfer fielen, hatten noch den besseren Teil im Vergleich zu jenen, die wie Euer Vater an der Krankheit starben, die Ihr, glaube ich, Ruhr nennt.«
Die Brüder wechselten einen fassungslosen Blick. Der schmähliche, schmerzvolle Tod, besiegt durch diese schmutzige Krankheit, hatte nichts Heldenhaftes und Glorreiches. Der Kreuzzug des Königs war also gescheitert, und dieser Mann brachte die Nachricht nach Burg Glain.
»Und sonst?« forschte Mathieu und warf den Brief auf den Tisch, als habe er sich daran die Finger schmutzig gemacht. »Sonst schickt uns unser verehrter Herr Vater nichts? Nur das Kind einer orientalischen Hafenschlampe, das wir für unsere Schwester ausgeben sollen? Bei Gott, man möchte meinen, die Hitze habe ihm den Verstand verbrannt!«
»Ich habe den Befehl erhalten, das Kind hierherzubringen«, entgegnete der Krieger stoisch. »Es ist behütet aufgewachsen und an den Komfort eines wohl geordneten Haushalts gewöhnt.«
»Wahrhaftig!« Rogier konnte sein spöttisches Lachen nicht mehr unterdrücken. »Dann ist es dem Bastard unseres Vaters bisher besser gegangen als seinen leiblichen Kindern, mein Freund. Diese zugige Burg ist alles, was wir besitzen, und wenn dein Schützling Komfort verlangt, dann solltest du ihn schleunigst wieder dorthin zurückbringen, wo ihr hergekommen seid. In diesem Haus ist ohnehin kein Platz für Kinder!«
»Ich bleibe!«
Die heisere, mühsam beherrschte Stimme, die diesen Entschluss verkündete, schien kaum zu der winzigen, zarten Gestalt zu passen, die am Feuer saß. Es klang eine Spur von geradezu majestätischem Hochmut in diesen beiden Worten mit, der Jaufré gefiel.
Er lächelte unwillkürlich und war als einziger nicht verwundert, als sie hinzufügte: »Der Falke hat es befohlen, und ich habe ihm mein Wort gegeben. Ich halte mein Wort.«
Mathieu, Rogier und Simon wechselten erneut einen Blick, und ihre Mienen verrieten, dass sie - was sonst eher eine Ausnahme war - in diesem speziellen Falle einer Meinung waren.
Rogier nahm die väterliche Botschaft an sich und überflog nun selbst die Worte. Als er zum Ende gekommen war, umspielte ein sarkastisches Lächeln seine Mundwinkel.
»Das Kind trägt den Namen der Frau Alexanders des Großen, und unser Vater wagt zu versprechen, dass es, unseren Gehorsam in seine Befehle selbstverständlich vorausgesetzt, unser Glück zu fördern vermag.«
»Anscheinend hat der Falke diesen Brief geschrieben, als er nicht mehr ganz im Vollbesitz seiner körperlichen und geistigen Kräfte stand«, vermutete Simon d'Escoudry. »Dieses winzige, nasse Ding dort erhöht im besten Fall die Zahl der hungrigen, nutzlosen Mäuler, die auf Glain gestopft werden müssen. Aber immerhin, für mich entscheidet es eine Frage, die ich mir seit langem gestellt habe. Ich verlasse Glain. Die Dienste eines Ritters werden überall benötigt, und wenn ich mir einen Namen schaffe, kann ich aus eigener Kraft ein Lehen vom König fordern. Selbst wenn unser Vater tatsächlich sagenhafte Schätze nach Hause gebracht hätte, wäre ich immer nur der zweite Sohn geblieben.«
Mathieu nickte. Er verstand sowohl die Motive seines Bruders als auch die Ungeduld, die ihn hinaustrieb. Vermutlich würde auch Rogier, der nun so nachdenklich dreinschaute, in Kürze Glain verlassen. Im Gegensatz zu ihm hielt es sie nicht mehr zwischen diesen alten Mauern, denn hur der lebenslange Respekt vor dem Wort des Vaters hatte sie bis jetzt an diesen Ort gebannt.
Bei ihm würden also nur die Jüngsten bleiben. Der dickköpfige Jaufré, der sich gegen jede Führung aufbäumte und sich standhaft weigerte, in den Kirchendienst zu treten, den die Familie für ihn im Sinn gehabt hatte. Jaufré, ein Edelmann ohne Zukunft. Ein jüngster Sohn ohne Aussichten. Eine Tatsache, die ihm sehr wohl bewusst war und die den Kern seiner Rebellion bildete. Dazu noch der Bastard des Vaters und dessen fremdländischer Begleiter.
Ein schönes Erbe hatte der Falke hinterlassen!
Mathieu d'Escoudry lachte höhnisch auf.
Er ahnte nicht, dass im selben Augenblick ein anderer Mann über die Folgen nachdachte, die der Tod des Königs wie auch der des Falken für ihn heraufbeschworen. Und auch dieser Mann lachte, doch sein Lachen klang gehässig.
Er war eine hochgewachsene stolze Erscheinung im zeremoniellen Trauergewand, der sich nach außen hin den Anschein gab, untröstlich zu sein. Ein Mann von hoher Macht und noch größerem Einfluss, der dennoch an der Persönlichkeit eines Kriegers gescheitert war, der ihm weder an Rang noch an Reichtum gleichkam. Der einen Hass in sich trug, den er bislang hatte bändigen müssen und der mit den Jahren nichts von seiner Intensität verloren hatte.
Der Falke hatte ihm das Ohr seines Bruders genommen, hatte seine Pläne durchkreuzt und ihn um eine Liebe betrogen, die er für selbstverständlich gehalten hatte. Und nun hatte er sich in den Tod geflüchtet, ehe ihn die sorgsam vorbereitete Rache treffen konnte!
Was blieb, waren seine Erben. Die Söhne des Falken! Bei Gott, er würde nicht ruhen, bis der Name d'Escoudry endgültig im Staub der Vergangenheit versank. Bis der letzte seines Blutes mit seinem Tod die Zeche zahlte für Verrat und Tod! Der Falke war tot, und niemand würde seine Brut jetzt schützen. D'Escoudry hatte versucht, sie in der Ferne zu halten und seiner Macht zu entziehen, aber jetzt war der Augenblick zum Zuschlägen gekommen!
Der Tag war da, bei einem Verbündeten eine Schuld einzufordern, die bisher geruht hatte.
1. Kapitel
Domfront, im Oktober des Jahres 1271
Die mächtigen Mauern des Schlosses ragten über dem Städtchen Domfront auf seinem schmalen Felsenkamm auf, hoch über der Schlucht der Varenne, und kündeten sowohl vom Reichtum ihres Besitzers als auch von seiner Verteidigungsbereitschaft. Mauern, Schießscharten, Fallgitter, Pechnasen und Gräben befanden sich in bestem Zustand, und das lebhafte Treiben in den Höfen bewies, dass diese Anlage im schlimmsten Fall auch von einer stattlichen Anzahl Bewaffneter verteidigt werden konnte. Bestickte Banner flatterten im frischen Wind, die Sonne glänzte auf poliertem Stahl und dem bunten Glas der säulengeteilten Fenster.
»Bei allen Heiligen, d'Aubigné ist reich wie König Midas«, murmelte Rogier d'Escoudry beeindruckt und warf seinem Bruder Mathieu einen skeptischen Blick zu. »Was sollte er für einen Grund haben, einen armen Schlucker wie Euch zu empfangen?«
»Meinen Namen«, antwortete Mathieu gelassen. »Es ist das einzig Wertvolle, das der Falke uns hinterlassen hat, und ich gedenke, das bestmögliche Kapital daraus zu schlagen. D'Aubigné hat im Gegensatz zu vielen anderen beim letzten Kreuzzug des Königs jene Schätze nach Hause gebracht, von denen wir umsonst geträumt haben. Doch den Ruf des habgierigen Schurken, der ihm seit jener Zeit anhaftet, kann er nicht loswerden. Er wird den Vorteil sehen, den es ihm bringt, sein einziges Kind einem Mann zu geben, dessen Familie zu den ältesten des Königreiches zählt. Wir sind arm, aber unser Name ist Gold wert!«Rogier dachte einen Moment über die Worte seines Bruders nach, ehe er seinen Kommentar dazu abgab.
»Man sagt auch, dass dieses Kind eine reizlose alte Jungfer ist, die keiner der Freier, die vom Gelde ihr^s Vaters angelockt wurden, am Ende nehmen wollte«, warnte er leise. »Meint Ihr nicht, dass es dafür Gründe gibt, die nicht einmal der Klatsch in allen traurigen Einzelheiten kennt?«
»Ich habe keine andere Wahl«, entgegnete sein älterer Bruder hart. »Ich kann Glain nicht den Rücken kehren, wie es Simon getan hat und meine Kampfkraft verkaufen, und ich gedenke auch nicht, bei Nacht und Nebel wie ein Dieb das Weite zu suchen wie unser jüngster Bruder. Ich bin der Erbe des Falken, und ich stelle mich meiner Verantwortung. Ich werde Glain zu Macht und Ansehen verhelfen, und wenn ich dafür meine Seele verkaufen muss, so soll es sein. Oder ist Euch in den vergangenen zwölf Monaten eine andere Idee gekommen, wie ich unser Lehen retten kann?«
»Nein.« Rogier schüttelte den Kopf und lenkte sein Pferd neben dem des Bruders über die Zugbrücke des Schlosses. Im hohen Gewölbe des Torhauses klapperten die Hufe über die quadratisch gelegten Steine, und unter den aufmerksamen Blicken der Wachposten ritten die beiden jungen Männer in den mauerumsäumten Hof der Vorburg. Erst durch ein weiteres Tor gelangten sie von dort in den eigentlichen Burghof mit dem Palas und dem mächtigen Bergfried, der sich wie ein massiger, steinerner Finger dem Himmel entgegenreckte.
Unter den vielen neugierigen Augenpaaren, die den stattlichen Brüdern folgten, war auch eines von sanftem, goldgetöntem Braun. Seine Besitzerin stand auf dem zinnenbewehrten Umgang der Ringmauer, die Vorburg und Innenhof trennte. Der böige Herbstwind zerrte an ihrem wollenen, schmucklosen Umhang und ließ ihn flattern. Während sie fröstelnd den Stoff enger um sich zog, beugte sie sich leicht hinunter, um sich ein genaueres Bild von den beiden Männern zu machen, die eben vom Pferd stiegen und die Zügel einem herbeieilenden Stallknecht anvertrauten.
Keine bedeutenden Männer, denn sie wurden nicht von Bewaffneten begleitet; kein Herold ritt voraus, um ihre Namen und ihr Begehr zu verkünden. Sie kamen ruhig und bescheiden, wie Handelsleute oder Bittsteller, wenngleich ihre Haltung die Edelleute verriet, ebenso wie die Schwerter, die sie trugen.
Es war genau in diesem Augenblick, dass sich die Sonne erneut zwischen dichten Wolken hervorkämpfte und den größeren, athletischeren der beiden Männer mit klarem, goldenem Licht übergoss. Obwohl sein schlichtes Gewand aus einfachem Tuch war und eher zweckdienlich als elegant wirkte, hielt er die breiten Schultern stolz gestrafft. Seine ganze Erscheinung verriet, dass er nicht viel mehr besaß als seine männliche Stärke und den deutlich zur Schau getragenen Stolz, der ihn wie ein zweiter Mantel umgab.
Es war jedoch weniger die unzweifelhaft beeindruckende Gestalt, die Léonie mitten im Schritt verharren ließ, sondern das Antlitz, das, der Sonne zugewandt, einen Moment lang zu ihr erhoben blieb, so dass sie die Züge in aller Ruhe studieren konnte.
Ein schroffes, sehr männliches Gesicht mit betonten Wangenknochen, das von einer scharfen, leicht gekrümmten Nase beherrscht wurde. Die braunen Haare wellten sich ungebärdig bis auf Kinnhöhe und hätten unter das Messer eines Barbiers gehört. Er sprach mit seinem Begleiter, und für einen Moment huschte der Hauch eines Lächelns um den schön geschwungenen, sinnlichen Mund.
Léonie fand sich außerstande, den Blick von ihm zu wenden. Die wenigsten Gäste, die in das Schloss kamen und die Gastfreundschaft ihres Vaters forderten, erregten ihr Interesse. Meist waren es Krieger und Handelsleute, Mönche und fahrende Ritter, die auf verschlungenen Wegen vom Reichtum des Seigneurs d'Aubigné gehört hatten und nun seine Unterstützung, seinen Rat oder seine Hilfe wollten. Im Normalfall endeten diese Besuche damit, dass die Bittsteller wütend und aufgebracht und mit leeren Händen das Schloss wieder verließen.
Sie alle hatten mit ihren Erzählungen dafür gesorgt, dass der Strom der Besucher in der letzten Zeit nachgelassen hatte und die Familie der d'Aubignés auf jede Abwechslung von außerhalb verzichten musste. Das Leben beschränkte sich auf die Alltäglichkeiten von Burg und Stadt: auf Geburt und Tod, Saat und Ernte, auf die Launen eines misstrauischen Seigneurs und die gesundheitlichen Probleme seiner mimosenhaften Gemahlin.
Das war ein Kreislauf, den Léonie in den zwanzig Jahren ihres jungen Lebens hassen gelernt hatte. Doch sie hatte auch gelernt, ihren Mund zu verschließen und ihre aufsässigen Gedanken für sich zu behalten. Hinter der ruhigen, gleichbleibend freundlichen Fassade schien nichts anderes zu sein als demütiger Gehorsam und friedfertige Frömmigkeit. Nicht einmal ihre Mutter ahnte von den Nächten, in denen sie wach lag und sich danach sehnte zu leben. Ihr Wunsch war so heftig und kompromisslos, dass sie in solchen Momenten lieber Schmerzen und Kummer auf sich genommen hätte als weiterhin das ewige Gleichmaß ihrer Tage.
Während sich hinter ihrer Stirn die Gedanken jagten, beobachtete sie, wie die beiden Fremden auf den Eingang des Palas zuschritten, in dem sich die Wohngemächer der Familie sowie die große Halle befanden. Sie taten es mit der Zielstrebigkeit von Männern, die sich in einer Burg wie dieser auskannten, die ein festes Ziel vor Augen hatten und nicht zögerten, es anzusteuern.
Léonie spürte plötzlich den Wind auf ihren Wangen, der den matten Abglanz der Herbstsonne kühlte und daran erinnerte, dass die Tage des Sommers vorbei waren. In Küche und Gesindehöfen arbeitete man daran, die Vorräte für den Winter zu sichern. Der Duft nach eingekochten Früchten und zerquetschten Mostäpfeln lag in der Luft, und in den Ställen quiekten die Schweine beim Schlachten.
Ein Bauernleben, schoss es der jungen Frau durch den Kopf, das Jahr um Jahr so weitergehen würde. Begleitet von sinnlosen Träumen und vergeblichen Wünschen, von heimlichen Sehnsüchten und Gebeten, die nie erhört wurden.
»Kind! Heilige Mutter Gottes, wo steckst du nur? Was treibst du auf den Mauern? Ich habe dich schon überall gesucht!«
Eine stattliche Person, von einer schneeweißen Leinenhaube gekrönt, trat auf den Wehrgang, als wolle sie den schmalen gepflasterten Weg hoch über den Zinnen entlangsegeln. Dame Bertheline, die im Schloss ungeschmälerte Autorität besaß, hatte die kleine Madeion Saint- Simon begleitet, als sie vor vielen Jahren den Seigneur d'Aubigné geheiratet hatte, und sie war dem einzigen Kind aus dieser Verbindung mit mehr Liebe und Fürsorge ergeben als die eigene Mutter. Jetzt allerdings wagte sie es, die Träumerin erst einmal gründlich zu schelten.
»Eure Mutter verlangt nach Euch«, verkündete sie. »Gehört es sich, diesem Ruf aus dem Weg zu gehen und seine Zeit beim Blick über die Zinnen zu vertrödeln? Es sind Gäste eingetroffen, und der Herr möchte sie mit allem ehren, was Küche und Keller bieten.«
»Lieber Himmel, Bertheline, willst du mir weismachen, dass du nicht längst alles veranlasst hättest? Und meine Frau Mutter verlangt immer nach mir, egal, wo ich mich befinde. Sag ihr, ich käme, sobald es meine Zeit erlaubt. Wer sind die Männer, die meinen Vater aufsuchen?«
Unter dem gebieterischen Blick der jungen Frau gab sich Bertheline geschlagen.
»Mathieu d'Escoudry und einer seiner jüngeren Brüder, Seigneur Rogier, Söhne des Falken, der zu den engsten Gefährten unseres armen Königs zählte. Sein Lehen grenzt an die Gebiete Eures Vaters in den Salzmarschen.«
»Weißt du mehr über den Grund ihres Kommens?«
Dame Bertheline zuckte mit den Schultern. »Geschäfte, nehme ich an«, antwortete sie. »Wenngleich der Seigneur d'Escoudry nicht viel besitzt, was er verkaufen kann. Man sagt, der Falke habe es versäumt, sich seine Dienste vom König lohnen zu lassen. Sein Erbe ist so arm wie eine Kirchenmaus ...«
Léonie antwortete ebenfalls mit einem Schulterzucken und raffte dann ihre Röcke, um Bertheline zu folgen. Sie hatte es plötzlich eilig. Wer von beiden war wohl der ältere? Der Ritter mit den strengen Zügen oder der geschmeidigere, elegantere?
»Euer Vater verlangt nach Euch in der Halle, Dame Léonie!«
Aubiette, die Zofe der Dame d'Aubigné, brachte diese Botschaft in die geräumige Kemenate, in der Léonie an der Seite ihrer Mutter saß und sich bemühte, die bunten Stränge der Stickerei zu entwirren, die Madeion in ihrer Gleichgültigkeit zu einem seidigen Knäuel verwirrt hatte. Wenn sie nicht mehr weiterkam, überließ sie es ihrer Tochter, die Knoten zu lösen.
»Was will er von ihr?« erkundigte sich die Schlossherrin, die auf einer breiten gepolsterten Bank ruhte.
Sie war von einem solchen Körperumfang, dass ihre Worte stets leicht zischend klangen, als befände sich in ihre Brust ein Blasebalg, der die Anstrengung beim Sprechen unterstützen musste. Sie griff mit spitzen Fingern in eine silberne Schale und wählte kritisch eine der gezuckerten Damaszenerpflaumen aus. Dann steckte sie die Köstlichkeit in den Mund und wartete ungeduldig auf die Antwort ihrer Dienerin.
»Ich weiß es nicht.« Aubiette schüttelte den Kopf, doch ihre Augen glitzerten vor Neugier. »Der Seigneur hat sich mit den Besuchern in sein Arbeitskabinett zurückgezogen und seinen Kammerdiener zu mir geschickt, damit ich diese Nachricht überbringe.«
»Bah!« Die nächste Pflaume folgte, und deswegen klang der Rest der Rede ein wenig undeutlich. »Ich wette, es ist wieder irgendein Habenichts, der darauf spekuliert, dass ihm die Mitgift unserer lieben Tochter ein feines Leben ermöglichen wird.«
»Und es wäre wahrhaftig an der Zeit für sie zu heiraten«, mischte sich die Dame Bertheline ein, die im Hintergrund des Gemaches die Gewänder ihrer Herrin in eine neue, noch prächtiger als alle ihre Vorgängerinnen geschnitzte Truhe packte. »Sie hat das zwanzigste Lebensjahr bereits überschritten. Ihr wisst, was das bedeutet! Sie sollte längst Kinder geboren haben. Sie ist schon über das Alter hinaus, um das erste Mal in Hoffnung zu kommen.«
»Sie kann sich glücklich schätzen, dass ihr diese Pein erspart geblieben ist«, schnaubte die Herrin empört und schob sogar für einen Moment die Schale mit den Süßigkeiten von sich. »Ich halte es nicht für erstrebenswert, meinem einzigen Kind die misslichkeiten einer Ehe aufzuladen. Ich habe nur sie, und ich will sie weder an das Kindbett noch an die zweifelhaften Aufmerksamkeiten irgendeines adeligen Tölpels verlieren.«
Léonie hatte in den Jahren ihres Lebens gelernt, diese Diskussionen zwischen Bertheline und ihrer Mutter zu ignorieren. Die eine machte sich ständig Sorgen um sie, und die andere hätte es ohnehin am liebsten gesehen, wenn sie bereits in jungen Jahren in ein Kloster eingetreten wäre, um Ehe und Kindbett zu entkommen. Die zahllosen Versuche ihres Gatten, am Ende doch noch den ersehnten Erben zu erhalten, hatten Madeion nach mehreren Fehlgeburten und einem Mädchen diese Seite der Ehe hassen gelehrt. Sie wollte ihrer Tochter ein solches Schicksal ersparen!
»Ihr versündigt Euch, Madeion!«
Dame Bertheline war die einzige, die es wagen durfte, Léonies Mutter hin und wieder zur Ordnung zu rufen. »Es ist die gottgewollte Pflicht einer jeden Frau, ihrem Gatten Kinder zu schenken! Und wenn Ihr weiter zögert, Léonie einem passenden Mann zu geben, wird es zu spät für sie sein! Mädchen ihres Standes werden normalerweise fünf bis sechs Jahre früher verheiratet!«
Léonie zog eine Grimasse und überließ die beiden ihrer Lieblingsdiskussion. Sie rückte die bescheidene Haube zurecht, die auf ihren hochgesteckten Haaren saß und nur das klare Oval des schmalen Antlitzes freiließ, und schüttelte sorgsam die Falten ihrer Röcke aus. Niemandem fiel auf, wie ungewöhnlich es war, dass sie ihrer Erscheinung Beachtung schenkte. Normalerweise wählte sie ihre Kleider danach aus, dass sie ihr genug Bewegungsfreiheit ließen und nicht schmutzempfindlich waren. Eleganz hatte in ihrem Alltag nichts zu suchen.
Sie verließ die Kemenate, die mit ihren bestickten Wandteppichen und den schweren geschnitzten Möbeln einer Königin würdig gewesen wäre, und eilte die steinerne Wendeltreppe in die Halle hinab. Von dort gelangte man durch eine mit reichen Schnitzereien verzierte Kassettentür in das Gemach des Hausherrn.
Hier waren die steinernen Quader mit besonders duftenden Kräutern bestreut, und Léonies Röcke wirbelten eine Wolke von sommerlichen Aromen auf, als sie sich respektvoll vor ihrem Vater verneigte. Der Seigneur d'Aubigné thronte wie üblich hinter seinem breiten Eichentisch, dessen gedrechselte Beine knapp über dem Boden im Karree verbunden waren. Auf dieses Holz stemmte der Schlossherr seine Beine, so dass er sitzend wesentlich größer wirkte, als er tatsächlich war.
Das quadratische Gemach, dessen getäfelte Wände und Decken Behaglichkeit vermittelten, besaß zudem den Luxus eines eigenen Kamins, in dem bereits mächtige Scheite glühten und angenehme Wärme vermittelten. Dennoch trug der Seigneur eine schwere Pelzkappe und über seiner Samttunika einen langen, ärmellosen, fellgefütterten Mantel. Die silbernen Stickereien und die breite Gliederkette aus rötlichem Gold verrieten seinen Reichtum. Im Gegensatz zu seiner Tochter fand er Gefallen an Luxus und teuren Stoffen aus Florenz und Venedig.
Vielleicht hielt Mathieu d'Escoudry aus diesem Grund die junge Frau, die nun den Raum betrat, im ersten Moment für eine Dienerin und nicht für die Tochter des Hauses. Er hatte hässlichkeit erwartet, Unförmigkeit, vielleicht sogar eine gewisse geistige Trägheit, denn irgendeinen Grund musste es doch geben, dass eine Dame mit dieser Mitgift noch nicht verheiratet war. Sie war nicht hässlich oder unförmig, sondern einfach eine armselige, nichtssagende Erscheinung. Eine langweilige graue Maus.
»Meine Tochter Léonie, Seigneur d'Escoudry!« bellte der Schlossherr in diesem Moment und zeigte dabei auf das bescheidene Geschöpf. »Sie wird Euch selbst die Antwort auf Eure Frage geben, wenn Ihr mir nicht glaubt.«
Léonie hatte die Fähigkeit, unter halb gesenkten Lidern ihre Umgebung scharf zu beobachten, zur Perfektion entwickelt. Wie sie vermutet hatte, war der Athletischere von beiden Mathieu d'Escoudry. Sie musterte ihn mit einer Mischung aus Erstaunen und Befriedigung, und ihr Herz begann plötzlich schneller zu schlagen.
Léonie registrierte eine gewisse Zwiespältigkeit an ihm. Genau wie eben nahm sie auch jetzt seine aggressive männliche Ausstrahlung wahr, doch nun erschien sie durch kalte Beherrschung wie von einem Mantel gedämpft und in Fesseln gelegt.
So, als ob dieser Mann sich selbst misstraute und den persönlichen Gefühlen gewaltsam Zügel anlegte. Er gab sich leidenschaftslos, aber Léonie glaubte das Feuer unter der Oberfläche glühen zu sehen. Doch er beherrschte sich mit soviel Routine, dass sie schon nach wenigen Herzschlägen versucht war, an eine Täuschung zu glauben. Vielleicht hatte sie sich die Glut nur eingebildet. Seine seltsamen Augen, die wie gesprenkelte hellbraune Kieselsteine wirkten, ruhten auf ihr wie die Berührung einer starken, besitzergreifenden Hand.
»Dame Léonie...« Die wohlklingende, aber nichts preisgebende Stimme sandte einen Schauer unbekannter, neuer Gefühle durch ihren ganzen Körper. Sie musste sich zwingen, nicht nur deren Klang, sondern auch dem Inhalt seiner Worte die nötige Aufmerksamkeit zu schenken. »Ich bin gekommen, um Euch die Ehe anzutragen.«
Léonie schwankte plötzlich und vergaß für einen Moment zu atmen. Sie hätte gerne geantwortet, aber sie brachte keinen Ton über die Lippen. Das blasse Gesicht gesenkt und die Hände sittsam gefaltet, versuchte sie ihre Fassung wiederzufinden.
Ihre Haltung bestärkte Mathieu d'Escoudry in der Meinung, dass diese junge Frau zwar weder auffallend hässlich noch närrisch war, dass ihre bescheidene Erscheinung aber wahrscheinlich den bescheidenen Qualitäten ihres Geistes entsprach. Also wandte er sich unwillkürlich wieder ihrem Vater zu, obwohl seine Worte weiterhin an sie gerichtet waren.
»Ich biete Euch den Schutz eines Namens, der bis in die ältesten Tage unseres Landes zurückreicht, Dame Léonie. Die Escoudrys sind seit jeher treue Diener des Königs und haben ihr Blut für die Krone vergossen. Mein Vater, den man den Falken nannte, war der Gefährte Ludwigs von Frankreich. Diese Treue wird zweifellos ihren Lohn durch unseren neuen, jungen König finden, sobald er die Macht fest genug in seinen Händen hält.«
Der Seigneur d'Aubigné wirkte sehr nachdenklich. Rogier, der die Menschen besser einschätzen konnte als sein geradliniger und nüchterner Bruder, erahnte die Habgier hinter seinen Überlegungen. Er hätte seine Tochter liebend gerne verheiratet gesehen, daran konnte es keinen Zweifel geben, aber aus irgendwelchen merkwürdigen Gründen schien die unschöne, langweilige junge Frau ein Mitspracherecht bei dieser Entscheidung zu haben.
»Was veranlasst Euch, ausgerechnet mir die Ehre dieses Namens anzubieten?« Die Direktheit dieser Frage verblüffte die beiden Brüder.
Mathieu runzelte die Stirn und entschied sich nach kurzem Nachdenken für die strikte Wahrheit. Im Grunde war es ohnehin egal. Allen Beteiligten war klar, dass eine Frau wie sie nur durch ihre Mitgift einen Mann finden konnte. Warum also um den heißen Brei herumschleichen?
»Der Tod meines Vaters verpflichtet mich, für den Fortbestand der Familie zu sorgen. Glain ist kein großes Lehen, und wenn der Name Escoudry zu neuem Glanz kommen soll, muss ich mich nach einer Frau umsehen, deren Mitgift dies ermöglicht. Ihr seid eine solche Person, und es erscheint mir nur recht und billig, die Ehe mit Euch in Betracht zu ziehen, auch wenn der bedauerliche Tod meines Vaters erst ein Jahr zurückliegt.«
Léonie zwang sich dazu, regelmäßig zu atmen. Es fehlte noch, dass sie diesen Mann ihre Gefühle erkennen ließ. Die Arroganz, mit der dieser verarmte Edelmann es auch noch als besondere Ehre erscheinen ließ, dass er überhaupt um sie warb, suchte ihresgleichen. Sie bemerkte, dass ihrem Vater die Röte in die Stirn gestiegen war, und sie wusste, dass er gleich das Falsche sagen würde.
Die Angst davor gab ihr endlich den Mut, die richtigen Worte zu finden. Sie wollte nicht, dass er Mathieu d'Escoudry fortschickte, egal, wie anmaßend und großspurig er sich gab.
»Ich danke Euch für diese Ehre«, flüsterte sie und war sich dabei bewusst, dass er die Ironie dieser Worte nicht wahrnahm. »Ich bin bereit, die Ehe mit Euch einzugehen!«
»Du bist was?«
Die Röte auf der Stirn des Schlossherrn hatte sich zu sattem Purpur vertieft, und seine Fassungslosigkeit amüsierte Léonie insgeheim.
Sie hatte nie herausgefunden, durch welche List es ihrer Mutter gelungen war, ihm das Versprechen abzuringen, Léonie nur einem Manne zu geben, den sie auch selbst wollte. Immerhin, es hatte ihr über Jahre hinweg das Vergnügen verschafft, ihre geldgierigen Freier vor den Kopf zu stoßen und ihre eigene Freiheit zu bewahren. Der heimliche Krieg ihrer Eltern hatte sie lange genug bedrückt, ehe sie gelernt hatte, ihn für die eigenen Zwecke zu nutzen.
»Ich bin bereit, die Gemahlin des Seigneurs d'Escoudry zu werden, mein Vater, wenn er dies will«, erklärte sie respektvoll. Sie sprach jedoch so leise, dass sich alle drei Männer anstrengen mussten, um ihre Worte zu verstehen. »Erlaubt, dass ich meiner Frau Mutter diese Nachricht übermittle!«
Noch bevor sie das prächtige Kabinett verließ, trat sie vor ihren künftigen Gemahl und wappnete sich, dem halb verblüfften, halb triumphierenden Blick Mathieus standzuhalten. Sie sah ihm an, dass er mit einem so schnellen Sieg selbst nicht gerechnet hatte und sich nun fragte, ob er sich darüber freuen sollte oder ob es an diesem Geschäft nicht doch einen Pferdefuß gab, der ihm entgangen war.
»Ich nehme an, es ist in Eurem Sinne, wenn die Trauung so schnell wie möglich vollzogen wird, Seigneur«, sagte sie atemlos und noch immer sehr leise. »Ihr findet mich bereit, Euren Plänen zu folgen.«
Der Erbe des Falken sah in das blasse, ruhige Gesicht, das fast so weiß war wie das Leinen der strengen Haube, die es umgab. Die schön geschwungenen Brauen und Wimpern fielen kaum auf, denn das viel zu helle Blond ließ das Antlitz seltsam kühl und herb erscheinen. Das Gesicht einer reizlosen Nonne, die wohl nie das Blut eines Mannes in Wallung bringen würde. Eine reiche Braut mit vollen Säckeln, aber ohne jede Anmut.
Nun, wenn auch ihr Äußeres wenig verlockend war, so besaß ihre königliche Mitgift um so mehr Verführungskraft. Der Gedanke daran, dass er gesiegt hatte, vertrieb das nagende Gefühl der Unsicherheit, das ihn für einen Moment beim Anblick seiner gelassenen Braut gestreift hatte. Dies war nicht der Augenblick, um Skrupel zu haben.
»Ich danke Euch, Dame Léonie!« Er griff nach ihrer Hand und neigte sich zu einem respektvollen Kuss über die schmalen Finger. »Ich schwöre Euch, dass Ihr Euren Entschluss nicht bereuen werdet.«
»Dessen bin ich sicher!« entgegnete Léonie und befreite sich hastig aus seinem Griff. Die weißen Flügel ihrer Haube verbargen die Röte auf ihren Wangen; genauso wenig war ihr anzumerken, welche wilde Kapriole ihr Herz schlug. Niemand konnte ihr ansehen, welch eigenartige, verblüffende Reaktionen dieser höfliche Kuss in ihr hervorgerufen hatte.
Die Berührung seiner warmen, festen Lippen hatte einen gleichsam magnetischen Strom durch ihren Körper rieseln lassen. Jene Faszination, die sie bereits bei seinem Anblick im Hof verspürt hatte, bekam weitere Nahrung. Noch nie in ihrem ganzen Leben hatte Léonie d'Aubigné etwas so sehr gewollt wie diesen Mann!
Vom ersten Blick an hatte sie es gewusst, und sie konnte nur hoffen, dass sie es nie bereuen würde. Denn ein Zurück gab es nicht mehr.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!