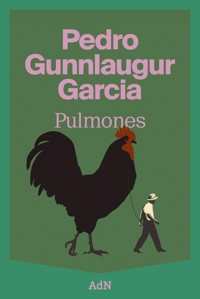22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Familiensaga aus Island – funkensprühend und unvergesslich | Ausgezeichnet mit dem Isländischen Literaturpreis Island 2089. Die junge Programmiererin Jóhanna versucht verzweifelt den Spagat zwischen ihrem anspruchsvollen Beruf und ihrem neuen Leben als alleinerziehende Mutter. Aber ihr Virtual-Reality-Projekt stockt, und so beginnt sie eines einsamen Abends, endlich das Romanmanuskript ihres Vaters zu lesen, zu dem sie seit einem heftigen Streit keinerlei Kontakt mehr hat. Vor ihr entfaltet sich überraschend ein zunehmend gewaltiges, Jahrhunderte und Kontinente umspannendes Familientableau. Immer dringlicher fragt sich Jóhanna, warum sie hier zum ersten Mal von den Wurzeln ihrer Familie erfährt. Welchem so lange unsagbaren Kern nähert sich ihr Vater mit seiner Erzählung? Und wird ihnen am Ende vielleicht doch eine Versöhnung möglich sein? Die isländische Variante von Hundert Jahre Einsamkeit für unser Hier und Jetzt – ein magisches Familienepos: humorvoll, spannungsgeladen, klug und höchst unterhaltsam.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 544
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Pedro Gunnlaugur Garcia
Unser leuchtendes Leben
Roman
Aus dem Isländischen von Tina Flecken
Herbst 2089
I.
Jóhanna sah, wie ihre Tochter die Stiefel von den Füßen kickte, sodass Sand quer durch die Garderobe des Kindergartens flog. Das war neu. Die Zweijährige brauchte ziemlich lange, um sich auszuziehen, und war noch weit von Perfektion entfernt, aber Jóhanna ließ sie in Ruhe machen. Nach einem solchen Morgen konnte sie keine weitere Auseinandersetzung gebrauchen.
Sie stellte den Rucksack ins Regal und vergewisserte sich, dass der Teddybär auch wirklich darin war. Dann drehte sie sich zu der Kleinen und umarmte sie.
– Tschüss, mein Schatz. Mama hat dich lieb.
Kaum hatte sie den Satz ausgesprochen, stürmte Ella auch schon los. Sie würden sich eine Woche nicht sehen, und obwohl Jóhanna ihre Tochter von ganzem Herzen liebte, verspürte sie Erleichterung.
Sie würde es nicht noch einmal so weit kommen lassen wie beim letzten Mal, als Ella bei ihrem Vater gewesen war. Sie würde weniger trinken und sich darauf konzentrieren, die Reise zum Ende des Universums fertig zu programmieren. Außerdem hatte sie eine Liste mit allen aufgeschobenen Haushalts-To-dos angefertigt: aufräumen, Wand streichen, Pflanze für die Ecke im Wohnzimmer aussuchen, neues Hamsterrad kaufen.
Darunter hatte sie eine Rotweinflasche gezeichnet, die sie erst aufmachen durfte, wenn alles andere erledigt war.
Zu Hause legte sie sich aufs Sofa und testete den Code für die neue Simulation. Sie war immer noch unsicher, wie sie die Timeline darstellen sollte. Einfach die Jahreszahlen einfügen, war zu plump. Die Leute wollten in eine Virtual Reality eintauchen, da war geschriebener Text ein Fremdkörper, der die Illusion zerstörte.
Jóhanna überließ das Problem ihrem Unterbewusstsein und begann, aufzuräumen. Sie sammelte Spielzeug ein, staubsaugte und wischte den Boden, warf leere Flaschen und Dosen scheppernd in eine Tüte.
In der Abstellkammer im Keller konnte man vor lauter Krempel kaum noch treten. Die Regale waren vollgepackt mit Sachen, die Hrafn nicht hatte mitnehmen wollen und für die es keinen Grund gab, sie noch länger aufzubewahren. Jóhanna war plötzlich genervt und wollte am liebsten alles wegschmeißen. Sie nahm ein paar Gegenstände heraus, und bevor sie sich’s versah, waren die Regale leerer und die Tüten auf dem Boden hatten sich deutlich vermehrt.
Sie hatte die Schmerzgrenze erreicht. Suchend schaute sie sich um, ob sich noch irgendwo etwas versteckte, das auf den Müll konnte.
Hinter dem alten Bastelkram stand ein eingestaubter Schuhkarton, und Jóhanna überlegte kurz, ob sie den auch wegwerfen sollte. Wenn sie ihn nicht aufmachte, konnte sie ihn einfach zusammen mit dem anderen Zeug entsorgen.
Das neue Buch ihres Vaters hatte sie gar nicht gelesen. Hatte es nur einmal durchgeblättert, weil er darin seine Familiengeschichte erzählte und sie checken wollte, ob er es gewagt hatte, sie und sein Enkelkind zu erwähnen, das er ablehnte und noch nie getroffen hatte. Oder ob er etwas über ihren Bruder geschrieben hatte. Das wäre dann nämlich das erste Mal, dass er Elías seit dessen Tod erwähnte. Nachdem sie sich vergewissert hatte, dass dem nicht so war, hatte sie das Buch zusammen mit den anderen Büchern ihres Vaters in den Schuhkarton gestopft und in den Keller gebracht.
Diesmal wurde sie nicht von diesem beklemmenden Gefühl erfasst. Sie nahm das Buch und blätterte darin. Ihr Vater hatte nie über die Vergangenheit gesprochen. Erst als Teenager hatten Elías und sie erfahren, dass sowohl italienisches als auch vietnamesisches Blut in ihren Adern floss – und das hatte ihnen ihre Mutter erzählt.
Es war typisch für ihren Vater, den Historiker und Sonntagsschriftsteller, wie er sich selbst titulierte, dieses Vermächtnis fast sein ganzes Leben lang zu verschweigen und es dann ausführlich in einem Roman zu verarbeiten. Er schien sich am wohlsten zu fühlen, wenn er Menschen in gebührendem Abstand hielt, nie sprach er mit seinen Kindern darüber und schrieb dann für die Öffentlichkeit diese abgeschmackten Ammenmärchen über seine Vorfahren. Wobei Öffentlichkeit stark übertrieben war. Es war ihm nie gelungen, auch nur eines seiner sogenannten Bücher zu verkaufen – weder hier noch in den USA, wo er seit einigen Jahren lebte.
Jóhanna war müde, und für einen kurzen Moment unterlag die Verachtung für ihren Vater der Neugier. Sie setzte sich auf eine Kiste und blätterte in dem Buch.
Enzo … Thảo … Sara … Alex … Anna.
Das waren nur Namen auf Papier, die keine besondere Bedeutung für sie hatten.
Oliven
Enzo wusste nie, wann seine Großmutter Beatrice die Wahrheit sagte. Nicht, weil ihre Geschichten unglaubwürdig waren, sondern wegen der Art, wie sie ihn gegen Ende der Erzählung anschaute, mit diesem neckischen Glitzern in den Augen. Dann argwöhnte er, dass sie sich wieder einmal ein Lügenmärchen ausgedacht hatte.
– Aber du schwindelst doch!
Wenn er sich als Erwachsener die Geschichten ins Gedächtnis rief, konnte er sich nicht wortwörtlich an sie erinnern und überlegte, wo seine kindliche Phantasie etwas hinzugedichtet haben mochte – ob das eine oder andere nicht auch aus einem Missverständnis herrühren konnte.
Beispielsweise die Geschichte über seine Urgroßmutter, Maria del Cielo, oder die Geschichte über die fliegenden Frauen.
– Del Cielo, sagte Großmutter, die auf ihrem Stuhl in der Küche saß. Maria des Himmels. So hieß die Mutter deines Großvaters.
Besagter Großvater stand mit einer Schürze um die Hüften neben ihnen und rupfte einen Vogel, den es zum Essen geben sollte. Er sah nicht so aus, als würde er zuhören.
– Und sein Vater, der hieß Dall’inferno – von der Hölle.
Sofort stellte Enzo sich vor, wie seine Uroma Maria gemächlich vom klaren, blauen Himmel hinabstieg, bis er Großmutters lächelnden Blick auf sich ruhen spürte. Sie neckte ihn. Natürlich konnte sein Uropa nicht von der Hölle heißen.
– Du musst mir sagen, wenn du schwindelst, Oma!
– Was? Ich schwindele?
– Ich weiß nie, wann du die Wahrheit sagst.
– Ach, mein Kleiner.
– Du musst mir ein Zeichen geben!
Seine Großmutter tupfte sich mit einer Serviette die Augen ab und schmunzelte. In diesem Moment reckte sich Großvater Giacomo, der hinter ihr stand, nach einem Teller im Regal und ließ bei der Anstrengung einen Furz.
– Da hast du dein Zeichen, sagte Großmutter, wieder mit diesem fröhlichen Glitzern in den Augen. Sie fing an zu lachen, und Enzo musste mitlachen. Bald heulten sie beide vor Lachen, während Großvater nur den Kopf schüttelte und weiter Federn rupfte.
Als Erwachsener verknüpfte Enzo diese Begebenheit mit einer anderen Erzählung, der Geschichte, wie Großmutter Beatrice als junge Frau ihre Cousins zur Gänsejagd begleiten durfte. Nachdem sie in der Nacht zuvor in der Berghütte an etwas Hochprozentigem genippt hatten, brachen sie im Morgengrauen auf, schlaftrunken und wackelig auf den Beinen. Beatrice war erst siebzehn und nicht an Alkohol gewöhnt, aber sie hielt sich wacker, stapfte mit ihrer Büchse voran und summte Jagdlieder, die sie in der Nacht gelernt hatte, setzte gedankenlos einen Fuß vor den anderen.
Die Stimmen der Männer verloren sich im Dunst, und auf einmal war es ganz still. Die junge Beatrice trat in die Nebelschwaden, die ihre Beine umwaberten – und stellte fest, dass sie vollkommen allein war.
Sie rief, doch niemand antwortete, und plötzlich nahm ihr dichter Nebel die Sicht. Die junge Frau, die sich in den Bergen nicht auskannte und vor kurzem noch an Gespenster geglaubt hatte, bekam es mit der Angst zu tun.
Sie ging bergauf, bis sich endlich ein Loch in der Nebelwand auftat und den Blick in ein grünes Tal freigab. Dann brach die Sonne hervor. Vor ihr erstreckte sich ein unbekannter Gebirgszug.
Und in der Ferne schwebte ein weißbekleidetes Wesen. Zuerst dachte sie, es sei ein Vogel – wunderschön und leuchtend weiß, aber mit schwarzen Flügeln wie ein Storch –, doch dann sah sie, dass es eine Frau war.
Die Frau glitt mühelos mit geschlossenen Augen durch die Lüfte, als hinge sie an einem Draht, obwohl über ihr nur der wolkenlose Himmel zu sehen war. Sie hatte den friedlichen Gesichtsausdruck einer Schlafwandlerin, die nicht dieser Welt angehört.
Hinter ihr entdeckte Beatrice eine weitere Frau in der Luft; sie sahen sich ähnlich und mussten Schwestern sein, hatten beide helle Haut, als wären sie nie mit Sonnenlicht in Berührung gekommen. Beatrice setzte sich auf die Wiese und legte das Jagdgewehr ab. Eine ganze Weile beobachtete sie die Frauen, wie sie ihre Kreise zogen, sah, wie sie die Augen öffneten, langsam die Hände hoben und die Arme ausbreiteten. Da füllte sich Beatrices Brust mit einer unbeschreiblichen Trauer.
Sie war kurz davor, in Tränen auszubrechen, als jemand aus dem dichten Nebel heraustrat. Ihr Cousin, ein Tischler namens Lamberto, fasste sie an der Schulter und schüttelte sie.
Beatrice zuckte zusammen, wie von einem Bann befreit. Lamberto half ihr auf die Beine und brachte sie wortlos zu den anderen. Sie lag schlafend im Gras, sturzbesoffen, sagte er, und die Jagdkumpane lachten schallend – Großmutter Beatrice beteuerte dem kleinen Enzo jedoch, sie habe das wirklich mit eigenen Augen gesehen und keinesfalls geträumt.
Diese Bilder brachte Enzo immer miteinander in Verbindung: seine Urgroßmutter Maria vom Himmel und die fliegenden Frauen. Wenn er sich das eine ins Gedächtnis rief, ging ihm auch das andere durch den Kopf.
Die Erinnerungen an die Geschichten seiner Großmutter sah er klarer vor sich als viele andere Erlebnisse seiner Kindheit. Das Fliegende und das Traumartige begleiteten ihn.
Als seine Frau mit ihrem ersten Kind schwanger war, sah Enzo einen Schwarm Gänse im Formationsflug. Er fragte sich, wie es wohl wäre, der jüngste Vogel zu sein, der nicht ahnte, welch langer Flug ihm bevorstand, an Orte, von denen er keine Vorstellung hatte.
Als die Vögel aus seinem Blickfeld verschwanden, durchfuhr ihn ein Schauer. Er stürmte los und rannte bergab, als wäre ihm der Teufel auf den Fersen, zum Dorf und auf den Hof, ohne innezuhalten, obwohl man ihm hinterherrief.
Er stieß die Tür zum Schlafzimmer auf und fand seine Liebste weinend neben dem Bett vor. Benedetta blickte ihn mit Panik in den Augen an, ein zusammengeknautschtes, blutiges Laken in den Händen.
An den darauffolgenden Tagen bemühten sich die Leute, sie mit Versprechungen zu trösten, bald würden sie mit Kindern überflutet, innerhalb weniger Jahre würde es im ganzen Haus vor Kindern nur so wimmeln, sodass es ihnen bald zu viel würde. In jener Zeit lief der Krieg schlecht, und mitten in seiner Trauer erhielt Enzo die Nachricht, das Wehrpflichtalter sei herabgesetzt worden. Kurz darauf kam die Einberufung, er musste zum Militär.
– Zum Militär! Welch eine Katastrophe, welch ein Unglück, die jungen Männer in den Krieg zu schicken!, rief seine Großmutter und war so aufgewühlt, dass die Aufregung und der Stolz, die Enzo beim Öffnen des Briefes verspürt hatte, im Handumdrehen verschwanden. Was ist, wenn du an die Front geschickt wirst, Enzo? Sie werden auf dich schießen!
Enzo legte den Brief weg und ging aus dem Haus. Er streifte umher und fühlte sich elend, erklomm einen Hügel, wo sich ein Olivenbaum vor dem violetten Himmel abzeichnete. Dort blieb er stehen, blickte auf das Dorf hinab, das im Sonnenuntergang leuchtete, und fragte sich, ob er jemals an diesen Ort zurückkehren würde.
Seine Eltern waren tot. Salvatore war bei einem Brand ums Leben gekommen, als Enzo drei Jahre alt war, und Teresa einige Jahre später an einer inneren Erkrankung gestorben. Der Name Coniglio war dem Tode geweiht. Enzo blieb lange auf der Wiese liegen und betrachtete die gleitenden Wolken. Als er sich endlich aufsetzte, fiel sein Blick auf getrockneten Hundekot, der in der Sonne gebacken war, und selbst das betrübte ihn. War das Leben bedeutungslos? Er bat den Schöpfer, ihm ein Zeichen zu senden, einen fliegenden Vogel, einen brennenden Busch, irgendetwas. Doch nichts geschah, nur die Sonne sank hinter dem Berg.
Die Blätter des Olivenbaums raschelten in der schwachen Brise. Als Enzo die Früchte musterte, bekam er Lust, den Geschmack roher Oliven zu probieren, die demselben Erdboden entsprungen waren wie er. Er pflückte eine und steckte sie in den Mund, schmeckte die Bitterkeit auf der Zunge, während er vergeblich versuchte, die steinharte, ungenießbare Frucht zu kauen, bis er sie schließlich ganz hinunterschluckte. Er pflückte noch eine Olive und wiederholte das Spiel, dann noch eine und noch eine, schluckte eine Handvoll nach der anderen aus trotzigem Groll, bis sein Hals brannte. Danach machte er sich auf den Heimweg.
Als er am nächsten Tag aufwachte, fühlte er sich so elend, dass ein Arzt gerufen werden musste. Nach der Untersuchung verkündete er, der junge Mann befinde sich an der Schwelle des Todes und müsse sofort ins Krankenhaus. Enzo bekam vor Bauchschmerzen kaum ein Wort heraus, doch als wäre es ein Wink des Schicksals, gab es im Spital ein nagelneues Röntgengerät. Enzo bekam Schmerzmittel, und als es ihm besser ging, überbrachte ihm ein Facharzt die Diagnose.
– Ich habe mir die Röntgenbilder angeschaut, sagte er.
– Und? Ist alles in Ordnung?
– Ich fürchte nicht. Wir haben Schatten entdeckt.
– Was heißt das?
– Schatten. Krebs, junger Mann. Er hat sich im ganzen Darm ausgebreitet. So etwas habe ich noch nie gesehen. Da ist es völlig normal, dass Sie Schmerzen haben. Bei diesen Röntgenbildern ist es ein Wunder, dass Sie sich überhaupt noch auf den Beinen halten können.
– Aber Herr Doktor, stöhnte Enzo. Die wollen mich in den Krieg schicken!
– Junger Mann, Sie müssen nirgendwohin, um zu sterben. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass Sie das Ende des Monats noch erleben. Gehen Sie nach Hause.
Enzo nahm seinen Hut, den Tränen nah. Der Arzt setzte sich an den Schreibtisch, schob die Brille auf der Nase zurecht und kritzelte etwas auf ein Blatt Papier.
– Die können einem jungen Mann, der zitternd vor der Todespforte steht, kein Gewehr in die Hand drücken. Beim ersten Hustenanfall würden Sie es fallenlassen und Ihren nächsten Kameraden erschießen.
Enzo nickte, ohne aufzuschauen.
– Geben Sie das Ihrem Vorgesetzten, sagte der Arzt und überreichte ihm einen Brief, der bezeugte, dass Enzo Coniglio aufgrund einer unheilbaren Krebserkrankung, der er über kurz oder lang erliegen werde, untauglich sei, den Wehrdienst auszuüben.
Enzo dankte dem Facharzt für das Todesurteil, verabschiedete sich, ging nach Hause und schloss sich auf dem Plumpsklo ein, wo er sich eines guten Kilos unverdauter Oliven entledigte.
So entging Enzo der weltweiten Kriegsmaschinerie, die ihn zweifellos zermahlen und der Familiengeschichte ein Ende gesetzt hätte. Er zog mit Benedetta nach Pennsylvania in den Vereinigten Staaten, wo sein Onkel väterlicherseits im Bergbau arbeitete. Dort bekamen sie ihr einziges Kind, Federico, den sie genauso sehr liebten, wie sie die gesamte Kinderschar geliebt hätten, die ihnen prophezeit worden war. Sie lebten ein einfaches Leben, wenn auch in größerem Wohlstand, als es im ländlichen Italien möglich gewesen wäre.
Bis ein zweiter Weltkrieg ausbrach und ihr einziger Sohn Federico einberufen wurde. Der Junge war außer sich vor Angst, und als Enzo nach Hause kam, lag er verstört auf dem Sofa.
– Was ist los?, fragte Enzo.
– Die wollen mich in den Krieg schicken, Papa, antwortete Federico.
– Nicht, wenn ich ein Wörtchen mitzureden habe, erwiderte Enzo und begann, nach rohen Oliven herumzutelefonieren. Schließlich fand er einen Produzenten, der ihm eine ganze Kiste zu einem akzeptablen Preis schicken wollte. Einige Tage später legte er ein schwarzglänzendes Häuflein vor seinem Sohn auf den Tisch.
– Iss die, wenn du leben willst, befahl er.
Federico wagte es nicht zu widersprechen, und danach fuhr Enzo ihn ins Krankenhaus, wo sein Sohn über Bauchschmerzen und qualvollen Stuhlgang klagte. Er wurde zum Röntgen geschickt, und siehe da, auch bei ihm wurde unheilbarer Krebs diagnostiziert. Untauglich für den Wehrdienst.
So sprang er dem Tod von der Schippe und konnte die Lebenszeit der Coniglio-Sippe um eine weitere Generation verlängern.
Federico heiratete Sara, ein italienisches Mädchen aus seinem Viertel, und bekam mit ihr ein Kind, genau wie sein Vater, der nur einen Sohn bekommen hatte. Der Junge wurde auf den Namen Anthony getauft. Genau wie sein Vater und sein Großvater wurde Anthony einberufen. Das war gegen Ende des Jahres 1972, und diesmal sollte ein Vertreter der Familie Coniglio nach Vietnam geschickt werden, um gegen die Kommunisten zu kämpfen.
Anthony hatte diesen Tag bereits mit Schrecken erwartet, denn das Olivenessen war zu einem Initiationsritus für die männlichen Mitglieder der Familie geworden. Sein ganzes Leben lang hatte er die Geschichten über seinen Großvater und seinen Vater gehört, die stets damit endeten, dass auf das Regal mit dem grünlich verfärbten Olivenkrug gezeigt wurde, der dort einen Ehrenplatz einnahm.
Die kleinen glänzenden Kugeln symbolisierten Leben und Tod, eine Reise durch die Geschichte der Familie – und durch die Körper von Anthonys Vater und Großvater. Eine Reise, die in ihren schmatzenden Mündern begann, durch das Fegefeuer der Därme und Röntgengeräte führte, bis die Oliven unversehrt wieder herauskamen, in einer Art degenerierten Wiedergeburt.
Wie zu erwarten, widerstrebte es dem Jungen, sich etwas derart Bedeutungsschweres einzuverleiben, und er hatte sich bisher immer standhaft geweigert, Oliven zu essen.
Als die Einberufung kam, traten sein Vater und sein Großvater mit einem Krug unreifer Oliven in Anthonys Zimmer, haargenau so, wie er es sich in seinen schlimmsten Albträumen ausgemalt hatte.
– Mein Sohn, sagte Federico. Die Zeit ist gekommen.
– Die Oliven, fügte Großvater Enzo hinzu. Jetzt bist du an der Reihe.
– Papa … Opa, stammelte Anthony leichenblass. Ich kann das nicht.
– Wie meinst du das?, fragte Enzo.
– Ich kann keine Oliven essen.
– Was soll das, mein Junge?, erwiderte Federico und hielt ihm den Krug hin. Dein Großvater und ich haben das auch gemacht. Das sind doch nur Oliven.
– Die sind widerlich.
– Was sagt er?, fragte Enzo.
– Er will sie nicht!
– Will sie nicht … Ist der Junge nicht ganz bei Trost?
– Mach den Mund auf, Sohn.
Anthony weigerte sich, und nach einer kurzen Rangelei mussten Vater und Großvater ihn festhalten und ihm die Oliven in den Mund schieben, woraufhin er sie sofort wieder ausspuckte.
– Nicht beißen, verflucht noch mal. Nicht beißen!, schrie der Großvater, während Federico seinen Sohn mit Oliven vollstopfte. Dann hielten sie ihm den Mund zu, bis Anthony schluckte, eine nach der anderen – zehn, zwanzig, dreißig. Schluckte, schluckte, schluckte. Er hatte schon rote Flecken im Gesicht, und plötzlich bekam er Atemnot.
– Um Himmels willen!, kreischte seine Mutter, als sie sah, was sie machten. Er erstickt, ihr bringt ihn um!
Doch selbst als sie ihn losließen, wurde es nicht besser. Anthonys Lippen schwollen an, und seine Augen quollen auf, als hätte man ihn geprügelt. Aber er erstickte nicht. Es war bloß eine allergische Reaktion. Sie rasten mit ihm zum Krankenhaus, wo ihm der ganze Fraß aus dem Magen gepumpt wurde.
Der Initiationsritus war missglückt. Die Familie stand unter Schock. Kein Krebs. Kein ärztliches Attest. Anthony war allergisch gegen seine einzige Rettung.
– Das kommt von der vielen Seife!, brüllte Federico seine Frau Sara wutentbrannt an. Wegen dir hat er eine Sauberkeitsneurose, die seine Widerstandsfähigkeit gegen alles Natürliche abgetötet hat.
– Soll das jetzt meine Schuld sein?
– Ja, du verhätschelst ihn.
– Ihr habt ihn doch drangsaliert!
– Drangsaliert … wir wollten ihm das Leben retten.
– Immer die Geschichten über diese furchtbaren Oliven.
– Oliven sind nicht furchtbar, seid ihr denn alle verrückt geworden?
– Jetzt hat er ein psychosomatisches Trauma, da bin ich mir sicher.
– Psychosomatisch? Verfluchter Schwachsinn.
– Krankheiten haben seelische Ursachen, das wird doch immer klarer.
Die Oliven hatten versagt, und sie mussten mitansehen, wie ihr Sohn im Dschungel von Vietnam verschwand. Mehrere Jahre sahen und hörten sie nichts von ihm und bekamen auch keine Briefe.
Dann tauchte er eines schönen Tages wieder auf, mit einer vietnamesischen Frau.
– Nun denn, sagte er. Ich bin aus dem Krieg heimgekehrt.
Aber das stimmte nicht ganz. Anthony war weder, wie geplant, in die Kaserne gegangen noch nach Vietnam. Er war über die Grenze nach Kanada geflohen und vier Jahre dortgeblieben. Erst nachdem Präsident Carter eine Amnestie für Deserteure erlassen hatte, traute er sich nach Hause. In der Zwischenzeit hatte er in Notunterkünften von Hilfsorganisationen geschlafen, in ständiger Angst vor den amerikanischen Behörden – und vor seinem Vater und Großvater. Er war umhergestreunt und hatte zeitweise wie ein Landstreicher gelebt. Bis eine Flüchtlingsfamilie in Toronto Mitleid mit ihm bekam.
Bis eine junge Frau ihn von ferne liebte.
Die Familie, die Anthony kennenlernte, genoss unter den Vietnamesen im Viertel eine gewisse Sonderstellung. Als Intellektuelle mit katholischem Hintergrund fiel es ihnen leichter als den meisten ihrer Landsleute, sich zu integrieren. Unter französischer Kolonialherrschaft war es der Familie in ihrem Land gut ergangen, und der Vater Bảo Lộc und sein Bruder wurden als junge Männer zum Studium nach Paris geschickt. Der Bruder studierte Zahnmedizin und Bảo Lộc Volkswirtschaftslehre. Während der Studienzeit begeisterte sich Bảo Lộc für den Kommunismus, und als er nach Hause zurückkehrte, wurde er zum großen Kummer seines Vaters zu einem glühenden Verfechter der Unabhängigkeitsbewegung – ebenjener Bewegung, die den Untergang ihrer eigenen Gesellschaftsklasse anstrebte.
Es betrübte Bảo Lộc und seine Frau Lieu sehr, dass sie nicht im französischsprachigen Teil Kanadas gelandet waren, sondern in Toronto, was sie jedoch nicht davon abhielt, bei jeder Gelegenheit Französisch zu sprechen – sogar im Englischkurs, an dem sie gemeinsam mit ihrer Tochter Thảo teilnahmen.
– Good morning, class, sagte der Lehrer, als er hereinkam und fixierte Bảo Lộc, der in der ersten Reihe saß. Doch Bảo Lộc hatte überhaupt nicht damit gerechnet, so direkt angesprochen zu werden, sprang hektisch auf und antwortete laut und deutlich – Bonjour!
Zudem missachteten Bảo Lộc und Lieu das ungeschriebene Gesetz, Menschen aus Nordvietnam nicht anzusprechen, die auf der Straße möglichst leise redeten aus Angst, dass ihr Akzent erkannt wurde. Durch ihre gute Laune machten sich die Eheleute unbeliebt, als wäre das keine echte Herzlichkeit, sondern ein Zeichen von Arroganz – trotzdem machte sich ihre Geradlinigkeit im Laufe der Zeit bezahlt, denn sie knüpften schnell Kontakte zu allen möglichen Leuten, die ihnen den Weg ebneten und dabei halfen, eine Firma zu gründen. Wenn Bảo Lộc seinen Nachbarn im Garten begegnete, wo diese sich beim Kartenspiel vergnügten, rissen sie meistens auf seine Kosten Witze.
– Bonjour, riefen sie spöttisch.
– Ah, bonjour, entgegnete er vergnügt.
– Wo hat Monsieur sich denn versteckt?
– Hier und da, damit beschäftigt, mir eine Existenz aufzubauen, Messieurs.
– Ach! Schau her! Und was haben Sie da? Eine Weinflasche?
– Ja. Der soll sehr gut sein. Hier in Kanada produziert.
– Laden Sie vielleicht Ihre Freunde vom Vietkong dazu ein?
– Nein, antwortete Bảo Lộc und lachte leise. Der ist für den Coq au Vin, den es heute zum Essen gibt. Aber nun entschuldigen Sie mich bitte. Au revoir!
Bảo Lộc und Lieu nahmen die Anspielungen ihrer Landsleute nie sonderlich ernst. Anstatt dem sozialen Status nachzutrauern, den sie verloren hatten, fügten sie sich stoisch in ihr neues Los – ihr Los als Kapitalisten – und gründeten im mittleren Alter zum ersten Mal im Leben eine Firma, mit Geldern von Privatpersonen, die Flüchtlinge unterstützten. Als sie mächtig stolz in ihrem Lieferwagen vorfuhren, der auf allen Seiten mit Nguyen’s Cleaning Service bedruckt war, stand das ganze Viertel Kopf. Passanten strömten herbei und riefen diejenigen, die drinnen waren, an die Fenster, und alle mühten sich, einen Blick auf die Eheleute zu erhaschen, die gemächlich durch das Viertel kutschierten, Runde um Runde um den Alexandra Park drehten, damit auch niemand den Beginn ihres Siegeszugs verpasste. Doch dann ertönte Gelächter, und jemand behauptete:
– Das ist ein Eiswagen.
Die Eheleute schienen diese Aussage gar nicht wahrzunehmen, zumindest fuhren sie unbeeindruckt weiter, mit ernsten Mienen und Sonnenbrillen auf der Nase.
– Die haben euch einen alten Eiswagen verkauft, erklang es wieder, gefolgt von noch lauterem Gelächter, und kurz darauf bog der Lieferwagen um die Ecke und verschwand.
– Das stimmt nicht, hörte Thảo ihren Vater sagen, als ihre Eltern nach Hause kamen, das ist kein Eiswagen, wie kommen die auf solchen Unfug?
Doch als seine Frau das Haus verlassen hatte, schlich er sich zum Telefon und wählte eine Nummer. Nach langem belanglosem Geplauder kam er endlich zum Thema, und Thảo hörte ihn leise fragen, ob es sein könne, dass der Wagen dazu benutzt worden sei, den Kindern im Viertel Eiswaffeln zu verkaufen. Sie konnte nicht hören, was der Mann am anderen Ende der Leitung antwortete, aber Bảo Lộc murmelte oui, oui oder bien sûr oder très bien, was er meistens machte, egal in welchem Zusammenhang, weshalb sich nicht feststellen ließ, wie die Antwort gelautet hatte.
Während dieser ersten Monate in Toronto saß Thảo, die Tochter der Familie, häufig auf der Fensterbank, appetitlos und einsam, und betrachtete den Trubel und die Herbstfarben der Bäume in dem öffentlichen Park vor dem Haus. Sie wohnten in einer kleinen, aber gepflegten Wohnung in der Nähe von Chinatown, wo Thảo einen Sprachkurs besuchte. Ansonsten blieb sie zu Hause und bereitete sich auf das Studium vor.
Es kostete sie Überwindung zu essen, und weil sie sich dafür schämte, wollte sie es verbergen und ließ die Happen in eine Serviette fallen, wenn ihre Mutter Lieu nicht hinsah.
Trotz der Freiheit, die sie jetzt genossen, fühlte Thảo sich eingesperrt, nicht nur, weil sie lernen musste, sondern auch weil ihre Eltern sie verrückt machten – ihre peinlichen französischen Phrasen und ihr Geschäftsgebaren mit diesem dämlichen Eiswagen hatten die Familie zum Gespött aller Vietnamesen in Chinatown gemacht.
Als Thảo eines Tages gelangweilt mit ihrem Grammatikheft auf der Fensterbank saß, fiel ihr ein junger Mann auf, der oft allein auf einer Bank im Alexandra Park saß, die Hände in den Taschen seiner dünnen Jacke vergraben. Es war Anthony Coniglio mit seinem dunklen, schulterlangen Haar, der großen Nase und den traurigen Augen, die Thảo ein bisschen an Ringo Starr erinnerten.
Sie verstand nicht, warum kanadische Jungen in ihrem Alter lange Haare hatten, als wollten sie feminin wirken, und fand sie geradezu läppisch, aber manchmal auch ein bisschen bedrohlich.
Drogen machten ihr solche Angst, dass sie sicherheitshalber die Luft anhielt, wenn sie einer Gruppe Jugendlicher mit brennenden Zigaretten begegnete. Trotzdem war sie fasziniert von diesem obdachlosen Eigenbrötler, der Tag für Tag unrasiert im Park saß. Und mit jedem Tag, der verging, wurde ihre Begeisterung größer. Sah sie ihn nicht, konnte sie sich kaum aufs Lernen konzentrieren und schaute ständig von ihren Büchern auf, in der Hoffnung, er würde auftauchen. Kam er dann endlich, jubilierte sie innerlich, fast so, als hätte sich ein zwitschernder Vogel auf einem Zweig vor ihrem Fenster niedergelassen – und las danach kein einziges Wort mehr.
Auf geheimnisvolle Weise glich er ihr, wenn er dort durch den Park wanderte wie ein Dichter, tief in Gedanken versunken. Sie mussten ein gemeinsames Schicksal haben. Thảo projizierte alle romantischen Helden, über die sie je gelesen hatte, auf diesen jungen Mann. Er war verloren, genau wie sie. Sie fristeten beide dasselbe einsame Dasein.
Er war gleichermaßen hungrig, wie sie appetitlos war. Thảo stellte sich vor, wie sie ihm Essensreste in eine Zeitung wickelte und hinunterbrachte – in ihrer Phantasie begegnete sie niemandem im Treppenhaus, und der Park war leer, nur sie beide – er war allein, und sie ging auf ihn zu …
An dieser Stelle endete ihre Vision.
Nicht, weil sie Scham empfand, wenn sie an Küsse dachte. Sie wollte keinen Kuss. Sie wollte ihm nur Essen geben. Und dass er sie anschaute, erst ungläubig und dann mit zunehmender Dankbarkeit.
Ihr Traum war genauso bescheiden wie sie und bestand lediglich aus Fragmenten, bevor er verpuffte. Thảo hatte keine Ahnung, was sie zu ihm sagen sollte. Sie befürchtete, ihn nicht zu verstehen, oder dass sie nicht antworten könnte, ohne sich lächerlich zu machen.
Tag für Tag saß sie auf der Fensterbank und betrachtete verzückt den jungen Mann. War enttäuscht, wenn sie ihn mit einem Sandwich und einem Kaffee herumspazieren sah. Dann warf sie ihr Pausenbrot in den Müll, und es war ihr vollkommen egal, ob ihre Mutter es mitbekam. Sie überlegte fieberhaft, wer ihm etwas zugesteckt haben könnte.
Es war Liebe. Die reinste Qual.
Sie musste einen Vorwand finden, um rauszugehen, ohne dass ihre Mutter sie zur Rede stellte, aber ihr fiel nichts ein. Alles klang unglaubwürdig. Sie zerbrach sich den Kopf darüber, und mitten in ihren Überlegungen fiel ihr plötzlich auf, dass der Müßiggänger den ganzen Tag noch nicht erschienen war.
Hatte sie ihn vor zwei oder vor drei Tagen das letzte Mal gesehen? War er verschwunden, ausgerechnet jetzt, da sie im Begriff war, zu ihm zu gehen? Oder hatte er einen Unfall gehabt?
– Du bist so dünn, dass du bald zusammenklappst, sagte Lieu. Hast du Blutarmut?
Thảo hörte kaum, was ihre Mutter sagte. Nichts war mehr wichtig.
– Was ist mit dir los?, fragte Lieu, aber Thảo wollte oder konnte nicht antworten. Irgendwann begann die Mutter zu ahnen, was ihre Tochter bekümmerte. Das konnte natürlich nur eins sein. Als Thảo mal wieder von Liebeskummer geplagt im Bett kauerte, setzte sie sich zu ihr und strich ihr über die hageren Schultern.
– Mein Töchterchen.
Thảo murmelte etwas.
– Mein Töchterchen.
Sie murmelte wieder.
– Thảo!
– Ach, Mama.
– Wie heißt er?
– … nichts.
– Ist es der Sohn von Bian, dieser große?
– … nein.
– Ist es dieser Phuc, der in der Sprachschule in der letzten Reihe sitzt und Popel an die Wand klebt, wenn er glaubt, dass es niemand sieht?
– Igitt, nein.
– Ist es Duc Luong, der von der Polizei verhaftet wurde, nur weil er so gerissen aussieht?
– Nein!
– Na gut … ist es dieser alte, widerliche Kerl, der hinter dem Laden wohnt, der mit seinen Klamotten verwachsen ist und sich manchmal die Fetzen vom Leib reißt, wenn ihm heiß ist? Liebst du den?
– Nein! Mama!
– Wer ist es dann?
– Ich … weiß nicht, wie er heißt.
– Ach.
– Er ist so hübsch.
– Oh je.
Sie seufzte.
– Töchterchen, hat er dich …
– Nein, Mama. Ich habe noch nie mit ihm gesprochen. Ich weiß nicht, wo er ist.
Lieu war es nicht gewohnt, Zärtlichkeiten mit ihrer Tochter auszutauschen, aber jetzt tröstete sie sie, streichelte sie, strich ihr übers Haar, erleichtert.
– Es kommt ein anderer.
– Ich will keinen anderen!
So vergingen Tage und lange Nächte. Während die Erinnerung an den rotnasigen Landstreicher verblasste, löste sich ein Teil von Thảo selbst auf. Sie wurde zu nichts.
Schließlich fiel es ihrem Vater auf.
Beim Mittagessen starrte seine Tochter mit leerem Blick vor sich hin, blass und krank.
– Hat man sie lobotomisiert?, fragte Bảo Lộc seine Frau. Sie isst nicht, spricht nicht. Was ist los? Ist es dasselbe wie bei Luc Duon?
– Nein, Bảo Lộc.
– Der ist zusammengefallen, egal, was er gegessen hat, das hat niemand verstanden …
– Bitte nicht schon wieder diese Geschichte, bat Lieu.
– Er wurde immer schmaler. Als wäre er verhext.
– Hör auf zu quasseln, steck dir lieber was zu essen ins Maul.
– Bis sie ihn zum Arzt brachten. Der wusste sofort, was los war. Er musste seine Hose ausziehen und sich vorbeugen. Luc Duon sagte: Das mache ich normalerweise nicht für jeden, aber natürlich vertraute er dem Arzt.
– Bảo Lộc, hör auf.
– Und was glaubt ihr, was er sah …?
– Meinst du, deine Tochter hat noch Appetit, wenn du so eine scheußliche Geschichte erzählst?
– Er zog diesen langen, hässlichen …
– Du und deine Geschichten, purer Unsinn und nichts daran wahr.
– … weißen, durchsichtigen Wurm …
– Papa?
– … aus dem … Ja, mein Schatz?
– Darf ich in mein Zimmer gehen?
– Ja, antwortete Bảo Lộc. Ja, natürlich.
Thảo stand auf und ließ ihre Eltern einfach sitzen.
– Sie ist verliebt, du Idiot, schimpfte Lieu.
– Verliebt, wiederholte Bảo Lộc stirnrunzelnd.
– Ja, eindeutig verliebt.
Lieu fixierte ihren Mann.
Bảo Lộc schaute an die Decke, als versuche er, etwas zu begreifen.
– Und wie heißt er, fragte er dann, … der Wurm?
Thảo ging in ihr Zimmer und schloss die Tür, hatte aber aufgehört zu weinen. Sie wollte nur ihre Englischnotizen durchschauen.
Als sie vor dem Spiegel stand und ein Gedicht rezitierte, das sie auswendig lernen wollte, fiel ihr der letzte Vers nicht ein. Sie nahm das Buch, um ihn sich einzuprägen. Dabei ließ sie den Blick über den Park schweifen. Und da stand er, in seinem currygelben Mantel, und schlenderte umher, als wäre er nie fortgewesen. Gebannt starrte sie ihn an, sank auf die Fensterbank und stieß einen halb erstickten Schrei aus. Er spazierte aus ihrem Blickfeld und verschwand hinter ein paar Bäumen und Büschen.
Bevor sie wusste, wie ihr geschah, hatte sie ihren Mantel geschnappt und war an ihren Eltern vorbei durch die Tür gestürmt – die beiden saßen wie erstarrt da, während die Schritte ihrer Tochter im Treppenhaus hallten, dann stürzten sie zum Fenster, um zu sehen, wo sie hinwollte.
Thảo rannte geradewegs in den Park und schaute sich suchend um, aber er war nirgends zu sehen, deshalb lief sie zu der Brache, wo ein Gewirr von Sträuchern seelenruhig vor sich hin wucherte. Dort gab es ein kleines Wäldchen und dahinter eine matschige Fläche, Zäune, weitere Wohnblocks. Nirgendwo erspähte sie im Herbstgrau den gelben Mantel. Sie blieb stehen und lauschte, vernahm ein Rascheln und starrte in das dichte Gestrüpp. Da zeichnete sich ein Schatten ab.
Die Sonne brach durch die Wolken und warf einen Lichtstrahl in die Dämmerung, auf etwas Blassrosafarbenes, das zwischen Ästen und Blättern aufblitzte. Thảo begriff erst, was es war, als ein hellgelber Strahl den Boden nässte. Sie stand wie angewurzelt da und blickte gebannt auf dieses baumelnde Fleisch, so hässlich und harmlos zugleich, während ihr Vergötterter auf einen Busch strullte. Plötzlich trat er aus dem zugewucherten Beet, von Licht und Schatten gemustert, und da schrie sie so laut, dass er zusammenschreckte und stolperte, sodass er fast hingefallen wäre, dabei aber trotzdem heldenhaft damit kämpfte, seinen Hosenstall zu schließen. Als er sich wieder gefangen hatte, gaffte er sie mit offenem Mund an, puterrot und dümmlich. Vor ihm stand eine Teenagerin, die verwirrt zurückstarrte. Dann lächelte sie.
Die Eltern klebten am Wohnzimmerfenster und sahen ihre Tochter neben einem jungen Mann auftauchen, einer blassen Bohnenstange mit großer Nase. Die Wolkenbank glitt auseinander, sodass abwechselnd Licht und Schatten auf die beiden fielen, als wollte der Allmächtige höchstpersönlich sie segnen.
Lieu und Bảo Lộc empfingen diesen neuen Freund ihrer Tochter nicht unbedingt mit offenen Armen, doch als Thảo erklärte, er sei vor dem Wehrdienst geflohen, wurden sie nachsichtiger. Der junge Mann erschien zu Beginn des Herbstfestes – und obwohl die Familie pro forma noch katholisch war, meinten sie, er müsse der Vorbote von etwas Gutem sein. Als er ihnen erzählte, sein Nachname Coniglio bedeute Kaninchen, zeigte Thảo auf den riesengroßen Mond, der rasch am Himmel aufstieg, und fragte: – Dieses Kaninchen?
Er verstand überhaupt nicht, was sie meinte.
Da schaltete Thảo das Licht aus, holte Reispapier und hielt es an die Fensterscheibe. Er schaute ihr über die Schulter, nahm ihren Duft wahr, bemerkte, wie ihr Haar im Schein dieses gewaltigen Himmelskörpers glänzte.
Sie malte einen Kreis auf das Papier und zeichnete dann das Muster des Mondes nach, skizzierte langsam und ruhig. Ein undurchschaubares Lächeln umspielte ihre Lippen, und das einzige Geräusch, das man hörte, war das leise Kratzen des Bleistifts. Als sie mit ihrem Werk zufrieden war, legte sie das Blatt auf die Fensterbank. Um die Mondschatten hatte sie die Umrisse eines Kaninchens gezeichnet – zwei lange Ohren, einen kleinen Kopf, Beine und Stummelschwanz.
Anthony blickte in den Himmel und versuchte, das Tier in den Mondschatten zu erkennen, aber obwohl er die Zeichnung zum Vergleich hatte, konnte er es nicht sehen. Schweigend betrachteten sie den Mond. Anstelle des harmlosen Kaninchens erschienen vor Anthonys geistigem Auge nach und nach bedrohliche Bilder. Das Antlitz des Mondes nahm die Form einer aschgrauen Röntgenaufnahme mit schwarzen, widerwärtigen Geschwüren an, und er musste an die Oliven denken, die seine Vorväter in ihre Därme gestopft hatten.
Dann bekamen die Schattenbilder eine andere Bedeutung. Sie ähnelten dem Ultraschallbild, das er von einer Person bekommen hatte, die wusste, wohin er geflohen war. Einer jungen Frau, mit der er geschlafen hatte, nachdem er erfahren hatte, dass man ihn nach Vietnam schicken wollte.
Nach mehreren einsamen Monaten in Kanada hatte er etwas getan, was er nicht hätte tun sollen: ihr einen Brief geschrieben. Die Frau, die Leonor hieß, antwortete prompt mit einem Ultraschallbild. Anthony bewahrte es in seiner Jackentasche auf. Er konnte es nicht anschauen, aber auch nicht wegwerfen.
Sie erwartete einen kleinen Coniglio. Seitdem waren drei Jahre vergangen, und mehr wusste er nicht.
Nun blickte er in den Himmel.
Dort war es gestrandet, das Kaninchen auf dem Mond.
Salute
Gleich am ersten Tag in den USA fuhr das junge Paar zu seinen Eltern, weil sie kein Geld hatten und einen Schlafplatz brauchten. Anthony kämmte sein langes Haar zur Seite und drückte Thảos Hand so fest, dass es wehtat. Nach kurzem Zögern klopfte er an die Tür. Sie öffnete sich, und vor ihnen stand ein mittelalter Mann im Unterhemd. In seinem Gesicht prangte die gleiche große Nase wie bei seinem Sohn, nur aufgedunsen vom Rotwein. Der Mann klappte vor Erstaunen den Mund auf und ließ sie wortlos hinein.
Anthony sagte nichts und tappte mit Thảo im Schlepptau in den Flur.
Im Wohnzimmer saß ein winziger, eingefallener Mann, der Thảo vorkam wie ein Hundertjähriger, mit großen Ohren und langer Nase und Brillengläsern so dick wie Flaschenböden, fast so groß wie der Fernseher, auf den er guckte, während er seine falschen Zähne im Mund vor- und zurückschob.
Als Anthonys Mutter von ihrer Zeitung aufschaute, fiel ihr beinahe die Zigarette aus dem Mundwinkel, als sie sah, wer gekommen war. Die Eltern tauschten einen Blick, sagten aber nichts. Der Großvater saugte an seinem künstlichen Gebiss, bis er endlich mitbekam, dass Gäste da waren, und sie fragend anglotzte.
– Nun denn, sagte Anthony leise. Ich bin aus dem Krieg heimgekehrt.
– Aus dem Krieg, wiederholte sein Vater.
– Ja, Papa. Und das ist Thảo … Wir sind verheiratet.
– Aha, verheiratet.
Der Vater trat zu seinem Sohn, legte ihm die Hände auf die Schultern, blieb vor ihm stehen und nickte mit einem eigenartigen Gesichtsausdruck, während Anthony dämlich grinste und Thảo sich nicht traute, aufzuschauen. Sie hatte das Gefühl, als würden ihr jeden Moment die Beine wegsacken.
Plötzlich umfasste der Vater Anthonys Kopf.
– Du kommst also aus dem Krieg, ja?
– Ja, Papa. Ich bin wieder zu Hause.
Der Vater kniff ihm in die Ohren und drehte sie, sodass Anthony vor Schmerz aufschrie.
– Du warst also in Vietnam? Du verdammter Idiot … Glaubst du wirklich, dass sie nicht nach dir gesucht haben? Glaubst du, wir wissen nicht, dass du dich versteckt hast? Aus dem Krieg – hältst du uns für so dumm?
Thảo schrie auch. Mit so etwas hatte sie nicht gerechnet.
Die Mutter ging dazwischen, während Großvater Enzo auf dem Sofa sitzen blieb und die gewölbten Hände an die Ohren hielt, um besser hören zu können.
Schließlich ließ Federico los und überließ seinen Sohn der Umarmung seiner Mutter, mit feuerroten Ohren, während Thảo immer noch wie bestellt und nicht abgeholt mitten im Raum stand.
– Willst du ihm die Ohren abreißen?, kreischte Sara. Bist du total verrückt geworden?
– Du hast kein einziges Mal angerufen, nie einen Brief geschickt!
– Verzeih mir!
– Was geht in deinem Kopf vor?
– Verzeih mir!
– Wir konnten nicht mehr schlafen. Ich hab es am Herzen vor lauter Schlafmangel.
– Verzeih mir!
– Ich kann nicht schlafen, weil mein Herz unregelmäßig schlägt …
– Verzeih mir!
– Wie konntest du das deiner Mutter antun?, sagte der Vater mit zitternder Stimme. Deiner eigenen Mutter, die dich auf die Welt gebracht hat. Schäm dich!
– Verzeih mir, schluchzte Anthony.
Sein Vater hatte ebenfalls feuchte Augen bekommen, zählte aber weiter japsend die Qualen auf, die sie in Anthonys Abwesenheit erlitten hatten. Seine Großmutter war gestorben. Am Ende weinten sie alle. Die Mutter hielt ihren Sohn fest im Arm und drückte ihn an ihren weichen Busen. Federico setzte sich an den Abendbrottisch, schenkte sich ein Glas ein und trocknete sein Gesicht. Dann erinnerte er sich endlich an die neue Schwiegertochter, die ihn verschreckt musterte. Kopfschüttelnd hob er sein Glas.
– Salute, sagte er und trank.
Nach dem theatralischen Wiedersehen der Familie Coniglio nahm das Leben in den USA seinen reibungslosen Lauf. Anthony bekam einen Job als Botenfahrer bei seinem Onkel, und Thảo arbeitete als Tellerwäscherin in einem Restaurant, was sowohl schlecht bezahlt als auch anstrengender war, als sie erwartet hatte. Den ganzen Tag freute sie sich auf den Abend, den sie miteinander verbringen würden, und das machte die Schufterei erträglich.
Am Wochenende durchstöberten sie gemeinsam die Gebrauchtwarenläden und kauften Möbel für ihre Mietwohnung. In den ersten Monaten war Thảo glücklich und verliebt.
Sie genoss es, wenn sie sich liebten, und Anthony behandelte sie gut, aber dieser kummervolle Glanz in seinen Augen verschwand nicht. Es war, als wäre er stets auf der Hut. Thảo hatte gehofft, dass er sich nach seiner Heimkehr verändern würde, dass er glücklicher wäre – aber wenn sie versuchte, unter die Oberfläche vorzudringen, griff sie ins Leere. Er war wie ein geschlossenes Buch, und sie sehnte sich danach, in sein Herz zu schauen, den Schmerz zu verstehen, der sich hinter seinen traurigen Augen verbarg.
Die Romantik verging ihr schnell.
Anthony war zwar humorlos, aber nicht überheblich oder dominant. In dieser Hinsicht unterschied er sich von Thảos Eltern. Doch abends war er oft angespannt und distanziert, und dann befürchtete sie, er könnte sich mit ihr langweilen. Er war wehleidig und ein Stubenhocker, ging höchstens mal mit ihr ins Kino.
Deshalb war sie überrascht, als er eines Tages ankündigte, er werde sich mit seinen Freunden treffen. Die hatte er ihr noch nie vorgestellt, und er schien davon auszugehen, dass sie zu Hause bleiben würde. Bevor Thảo es richtig begriffen hatte, war er schon durch die Tür. Nun, sie kam zu dem Schluss, dass ihm das guttäte. Ein Mann brauchte seine Kameraden.
Das wurde schnell zur Gewohnheit, und Thảo mochte ihn nicht bitten, abends zu Hause zu bleiben, obwohl sie sich nichts sehnlicher wünschte.
Im Winter, als die Einsamkeit ihr zu schaffen machte, wurde sie schwanger. Sie hoffte, dass Anthonys Familie sie nun endlich akzeptieren würde, aber die Neuigkeit schien die Schwiegereltern nicht sonderlich zu erfreuen.
Thảo fühlte sich wie eine Gefangene. Eines Abends hatte sie eine Panikattacke und warf Anthony vor, er wolle das Baby gar nicht haben, er verprasse sein Geld für Bier, dabei hätten sie noch nicht mal einen Kinderwagen oder ein Kinderbett. Er versprach ihr, ein Bett zu bauen, aber sie lachte nur, weil er in der Wohnung noch keinen Handschlag getan hatte, seit sie eingezogen waren. Da wurde er sofort sauer, beschimpfte sie als undankbar und anderes mehr und stürmte hinaus. Als er nach Hause kam, war er stinkbesoffen und schlief auf dem Sofa. Am nächsten Tag entschuldigte er sich, er habe das alles nicht so gemeint.
Eines Abends stand schon das Essen auf dem Tisch, aber Anthony war nicht da. Thảo wünschte sich, er hätte das Auto zu Schrott gefahren und sich selbst zum Krüppel gemacht, so wütend war sie. Er war bestimmt in der Kneipe, »einen heben«. Doch dann bekam sie Panik: Was, wenn das tatsächlich passiert war und Anthony tot im Krankenhaus lag und ihr Kind keinen Vater mehr hatte?
Als er endlich zu Hause aufkreuzte, weigerte sie sich, mit ihm zu reden, schloss sich im Badezimmer ein und heulte. Er bat sie um Verzeihung und gelobte, sich zu bessern, also kam sie wieder heraus und entschuldigte sich für ihr Benehmen.
Doch als sie sich das nächste Mal einschloss, scherte er sich nicht um sie und guckte mit einem Bier in der Hand ein Baseballspiel. Als sie wieder herauskam, fragte er:
– Und, bist du fertig?
Thảo hatte ihre Familie verlassen, um der Liebe zu folgen. Sie durfte nicht traurig sein. Sie dachte an Menschen, die sie kannte, an den kleinen Trieu, der allein nach Kanada gekommen war und nicht wusste, was aus seinen Eltern geworden war, an die Mädchen, die jünger waren als sie und unbeschreiblich Grausames erlebt hatten; sie dachte auch an diejenigen, die in ihrem Heimatland zurückgeblieben waren, an die behinderten Menschen, denen niemand half, an die Kranken in den Flüchtlingscamps, die beim Warten auf ein besseres Leben starben. Sie musste dankbar sein.
Im Frühling bekamen sie eine Tochter mit dichtem Haar und schwarzen Augen. Sie nannten sie Sara nach Anthonys Mutter, die sich von dieser Ehre unbeeindruckt zeigte.
In den ersten Monaten eilte Anthony von der Arbeit nach Hause, um sein Kind auf dem Arm zu halten und dessen Schönheit zu bewundern – doch obwohl Thảo und er sich beide über dasselbe freuten, teilten sie ihr Glück nicht miteinander. Es dauerte nicht lange, bis er auf dem Heimweg wieder einen Abstecher in die Kneipe machte.
Und er regte sich auf, wenn das Baby ihn nachts weckte.
– Ich muss morgen arbeiten, schrie er einmal und schlug gegen die Wand, woraufhin das Baby noch lauter brüllte.
Thảo wurde klar, dass sich nichts ändern würde. Anthony hatte ihr nie mehr als einen Bruchteil dessen zurückgegeben, was sie ihm geschenkt hatte. Er stellte sich nie hinter sie und tat so, als würde er nicht hören, in welchem Tonfall seine Mutter mit ihr redete. Thảo konnte sich finanziell nicht auf ihn verlassen und war gezwungen, ihre Eltern in Kanada um Geld zu bitten.
So vergingen die Jahre – in einem Teufelskreis, aus dem es keinen Ausweg zu geben schien.
Sara wuchs heran, war blitzgescheit und nicht auf den Mund gefallen, und es stellte sich schon früh heraus, dass ihr das Lernen leichtfiel. Als sie zwölf Jahre alt war, ging Thảo in die Sprechstunde der Klassenlehrerin, mit der sie im Lauf der Jahre oft geredet hatte, und beklagte sich darüber, dass schon wieder zusätzliches Geld für Schulausflüge eingesammelt wurde.
– Wie kann die Schulleitung das machen?, sagte sie. Ich arbeite von morgens bis abends, aber wir können uns das trotzdem kaum leisten. Und mein Mann, bei dem könnte man meinen, seine Geldbörse hätte ein Loch …
Thảo schilderte der Lehrerin ihre Finanzprobleme, ohne zu erwarten, dass das etwas an den Ausflugskosten ändern würde, doch als sie fertig war, nahm das Gespräch eine unerwartete Wendung.
– Nicht, dass mich das etwas angehen würde, meinte die Lehrerin mit einer ungewohnt mitleidigen Miene. Oder dass es meine Aufgabe wäre, mich dazu zu äußern, aber ich muss Sie etwas fragen … Sie wissen doch, dass Anthony Unterhalt bezahlt?
– Wie meinen Sie das, Unterhalt?, fragte Thảo nach kurzem Zögern.
– Er hat einen Sohn, antwortete die Lehrerin, deren Gesicht vor Verlegenheit erstarrt war. Entschuldigung, ich hätte Ihnen das nicht erzählen sollen. Und eigentlich darf ich das auch gar nicht … Aber Sie tun mir so leid.
– Und Sie meinen ganz sicher meinen Anthony?
– Es ist ein Junge, der auf unsere Schule geht. Wissen Sie noch, der Junge, der vom Balkon fiel, weil das Geländer wegbrach? Es kam in den Nachrichten. Das ist er. Er weiß nicht, wer sein Vater ist … Bitte fragen Sie mich nicht, woher ich es weiß, sagen wir mal, im Lehrerzimmer gibt es keine Geheimnisse. Es tut mir leid, aber ich finde, Sie haben ein Recht, es zu erfahren.
– Das ist nicht wahr, stammelte Thảo. Das muss ein Missverständnis sein.
Wie vom Donner gerührt ging sie aus der Sprechstunde.
Sie hatte eine vage Vorstellung, wo dieser Junge wohnte, erinnerte sich daran, dass er vom Balkon gefallen war und sich den Arm gebrochen hatte. Darüber war im Fernsehen berichtet worden. Man hatte ihn mit seinem Gips in der Armschlinge interviewt, und er hatte die Leute dazu aufgefordert, ihre Balkongeländer zu kontrollieren.
In ihrer Erinnerung hatte er die gleiche große Nase.
Nach einem heftigen Streit mit Anthony beschloss Thảo, mit Sara zu ihren Eltern zu fahren. Als sie einige Tage in Kanada verbracht hatten, wurde ihr klar, dass sie nicht mehr zurückkehren würde. Sie konnte nicht einfach weitermachen, als wäre nichts geschehen.
Thảo dachte mit Grauen an all die Jahre, die sie mit diesem Mann zusammengelebt hatte, vollkommen ahnungslos. Jetzt wusste sie, warum er verhindert hatte, dass sie Bekanntschaften knüpfte. Und weshalb er nie Geld gehabt hatte. Sie waren sogar tagtäglich an dem Haus vorbeigefahren, in dem sein Sohn wohnte.
Das hatte sie nach fast vierzehn Jahren Ehe erfahren, von einer nahezu fremden Frau. Wer wusste sonst noch alles davon? Die ganze Schule? Alle lächelten, und keiner sagte etwas.
Thảo füllte sämtliche Formulare aus und machte ihre Tochter zu einer kanadischen Staatsbürgerin, sodass sie im Herbst in Toronto mit der Schule anfangen konnte. Sara war nicht sofort klar, dass diese Veränderung dauerhaft sein würde, und begann allmählich, ihre Mutter zu verachten.
Thảo war immer müde und lag oft den ganzen Tag im Bett. Manchmal bat sie ihre Tochter, ihr in dem schummrigen Zimmer Gesellschaft zu leisten, und einmal, als sie Sara ihr Herz ausschüttete, wobei es hauptsächlich darum ging, schlecht über ihren Vater zu reden, rastete Sara aus.
– Es war deine Entscheidung, mit Papa nach Amerika zu gehen, warf Sara ihr vor. Niemand hat dich dazu gezwungen.
– Du verstehst nicht, wie das damals war, lenkte Thảo ein, ich war gerade erst aus Vietnam gekommen …
– Du hättest es nicht tun sollen, wenn es so dumm war.
– Aber dann hätte ich dich nicht bekommen.
– Du bist selbst schuld, dass du so bist, dass du hier rumliegst und dich bemitleiden lässt.
– Sara …!
– Ich verstehe genau, warum er dich nicht ertragen hat.
Mit diesen Worten verdrückte sich die Teenagerin und ließ ihre Mutter allein zurück.
Auch wenn Sara sich dagegen sträubte, den Schmerz ihrer Mutter anzuerkennen, und ihren Vater sogar verteidigte, regten sich Vorwürfe gegen ihren Vater in ihr. Er hatte sie beide betrogen, dachte die Teenagerin.
Seine Abwesenheit störte Sara nicht sonderlich, aber als ihr bewusst wurde, dass er sie nie gebeten hatte, wieder nach Hause zu kommen, spürte sie eine innere Leere. Und weil er nicht da war, richtete sich ihre Wut gegen ihre Mutter.
Sie mochte es nicht, bei ihren Großeltern zu wohnen, die so altmodisch und exzentrisch waren und kaum Englisch sprachen, obwohl sie seit fast zwanzig Jahren in Kanada lebten. Ihr Großvater warf immer noch mit französischen Floskeln um sich, was mit jedem Jahr bizarrer anmutete.
Ihre Familiengeschichte war ihr vollkommen fremd, sie konnte nie eine richtige Verbindung zu der Flüchtlingsvergangenheit ihrer Mutter und ihrer Großeltern herstellen, selbst wenn sie viel über Vietnam und die Irrfahrten der Boatpeople las – sie hätten ebenso gut von einem anderen Planeten stammen können. Nichts davon weckte irgendeine Emotion in ihr, bis auf Frust darüber, dass es diese Herkunft war, die sie definierte. Sie konnte den Migrantenstempel nicht ausstehen und hasste alle, die sie zum Symbol für etwas machten, das sie nie gesehen oder erlebt hatte.
Sara sammelte alle möglichen Lexika über die Wunder der Natur. Manche waren gruselig, berichteten von einem Mann, der sein Gesicht auf dem Hinterkopf trug, das nachts flüsterte, oder zeigten die Biosphäre des Ozeans, auf jeder Doppelseite ein Stück tiefer, vom hellblauen Lebensraum der Zuchtfische bis hinunter an unheimlichere Orte, an denen die Schöpfung monströs war und Ungeheuer hausten.
Im Buch der Weltrekorde sah sie einen isländischen Hahn, der so überdimensioniert war, dass das Bild gefälscht sein musste. Der Hahn war so groß, dass ein kleiner Junge auf diesem Ungetüm reiten konnte wie auf einem Pferd. Sara inspizierte das Foto und beneidete den Bauernjungen. Dann schnitt sie es aus und heftete es an die Wand über ihrem Bett.
So vergingen ihre Teenagerjahre, sie lebte in den Naturkundebüchern, bis ihre eigene Natur an die Tür klopfte und alles durcheinandergeriet.
Mit fünfzehn hatte Sara ihren ersten Freund. Es war eine naive Liebe, jedoch einer Leidenschaft entsprungen, die man im späteren Leben schwerlich findet. Bis dahin hatte Sara eine Aversion gegen das männliche Geschlecht gehabt, besonders gegen Gleichaltrige.
Er war ein Jahr älter als sie. Weiß, geheimnisvoll, trug Lidschatten, und seine Haare waren schwarz wie Gewitterwolken. Er war ihr in der Schule aufgefallen, wo er hinter dem kleinen Schuppen rauchte, wie eine Goth-Version von James Dean, nur war sie leider so uncool, dass niemand ihren Namen kannte.
Eines Tages ging sie mit ihrer Freundin zu dem Schuppen, und bevor sie wusste, wie ihr geschah, hatte der Junge ihr eine Zigarette angeboten.
Er hieß Indigo. Seine Eltern waren Hippies und hatten ihre Kinder nach den Farben des Regenbogens benannt, aber aus Protest trug er nichts anderes als schwarz.
An einem Abend in seinem Kellerzimmer beschrieb Indigo ihr resigniert die Bedeutung der blauvioletten Farbe, nach der er benannt war, während sie seine Plattensammlung durchschauten, die hauptsächlich aus jahrzehntealtem New Wave bestand: Siouxsie and the Banshees, The Cure, Joy Division …
– Indigo ist Griechisch und bedeutet aus Indien, sagte er.
– Wow, das ist unglaublich schön, entgegnete Sara.
– Aber das Problem ist, dass … Ich kann es nicht sehen.
– Hä?
– Ich bin farbenblind.
– Oh … Echt?
– Ich kann die Farbe, die ich bin, nicht sehen.
– Ach, das ist so … traurig.
– Ich kann nicht sehen, was ich bin.
– Ich kann sehen, wer du bist.
– Mach dich nicht lustig darüber.
– Ich sehe dich, sagte Sara.
– Sag das nur, wenn du es auch wirklich meinst, sagte Indigo.
– Ich sehe dich.
– Sag das nur, wenn du es ernst meinst.
Sie schaute ihn mit großen, verständnisvollen Augen an. Dann küssten sie sich.
Er legte eine Platte von den Cocteau Twins auf, und bei Sugar Hiccup verlor Sara ihre Jungfräulichkeit.
Es war unangenehm, damit hatte sie gerechnet, aber auch schön – und noch etwas anderes.
Als sie den Kopf zurücklegte und die Augen schloss, hatte sie eine Vision, als wäre ein kurzer Filmschnipsel mit einem falschen Bild zusammengeschnitten worden – Schmetterlinge flatterten umher, blau und blitzend schwarz in einem duftenden, grünen Tal, und sie rannte ihnen mit einem Kescher hinterher.
Sara schlug die Augen auf und sah wieder das dunkle Zimmer und den jungen Mann, der sich auf ihr bewegte. Sie schaute ihm in die Augen, und die Intimität überschattete alles andere, sodass sie diese merkwürdige Vision sofort vergaß.
Doch als Indigo sie bei ihrem nächsten Besuch heimlich durch das leere Haus führte, entdeckte Sara an der Wand im Wohnzimmer einen Rahmen mit zartblauen Schmetterlingen. Sie blieb stehen und betrachtete sie. Indigo kam zu ihr und hielt sie im Arm, während er ihr erzählte, seine Urgroßeltern seien russische Aristokraten gewesen, die nach der Revolution geflohen waren. Die Schmetterlingssammlung sei eines der wenigen Dinge, die ihre Tochter, seine Großmutter, mit über den Ozean gebracht habe.
– Die habe ich schon mal irgendwo gesehen …, setzte Sara an und errötete.
Sie musste kichern, was Indigo nervte – und je genervter er wurde, desto mehr kicherte sie vor Nervosität und bekam schließlich einen regelrechten Lachanfall.
Indigo weigerte sich eine ganze Stunde, mit ihr zu reden, und vertiefte sich beleidigt in seine Comics, während Sara MTV schaute. Keiner sagte ein Wort, und Sara bekam Angst, dass sie sich nie wieder vertragen würden. Da schoss ein Korken aus einer Flasche: das Musikvideo von Kiss Them For Me von Siouxsie and the Banshees; Gläser und ein vergoldeter Engel versanken in Champagner, in einem herzförmigen Pool.
Indigo warf sich hinüber zu Sara und drückte jäh auf den Rec-Schalter des Videorekorders. Das war sein Lieblingssong, eine überbordende Flut aus hypnotischen, orientalischen Klängen. Die Sängerin trug ein glitzerndes Kleid und sang entrückt vor Verzückung. Sie erinnerte Sara an ein Bild, das sie aus einem Kunstbuch ausgeschnitten und an ihre Wand geklebt hatte, ein Gemälde von Gustav Klimt von einer Frau mit dem gleichen unergründlichen Gesichtsausdruck vor einem goldenen, wogenden Wald.
Als das Video zu Ende war, spulte Indigo zurück. Sie schauten es noch einmal und fingen an zu knutschen.
Er zog seine Hose runter, während sie sich ihrer Strumpfhose entledigte, dann wollte er sich auf sie legen, aber sie sagte nein. Dieses Mal lagen sie nebeneinander und benutzten nur ihre Hände. Er kam fast sofort, sodass ihre Hände klebten, streichelte sie aber weiter wie unter dem Bann des Songs, bis Wellen der Lust durch ihren Körper zuckten. Danach lagen sie leicht benommen und verlegen da.
– Ihiii, guck mal die vielen Kinderchen, sagte Sara und stupste ihn an, und jetzt lachten sie beide.
Dieses Mal waren ihr keine Schmetterlinge erschienen, obwohl sie ein bisschen darauf gehofft und sie fast vermisst hatte. Aber dann war sie doch erleichtert und vermutete, dass diese Vision nur ein wirrer Fehlschuss ihres Gehirns gewesen war.
Nachdem Sara sich von ihrem Freund verabschiedet hatte und auf die Straße trat, bekam sie Angst. Es wurde schon dunkel. Das Gefühl der Leichtigkeit wurde von Furcht verdrängt. Sie hastete durch die Abenddämmerung nach Hause und wollte sich in ihr Zimmer schleichen, als plötzlich ihre Mutter mit irrem Blick und struppigem Haar vor ihr stand.
Thảo hatte seit Stunden in der Küche gesessen und auf die Heimkehr ihrer Tochter gelauscht, schwankend zwischen rasender Wut und panischer Angst um diese undankbare Göre. Seit Lieu wegen ihrer Gicht nicht mehr in der Schneiderei arbeiten konnte, hatte Thảo zwei Jobs, kam abends todmüde nach Hause und musste dann noch den Haushalt machen – während Sara nur in der Schule saß.
Sie dachte, es wäre noch gar nicht so lange her, seit sie ihrer Tochter erklärt hatte, dass sie bald Blut in ihrer Unterhose fände, was aber nicht gefährlich sei. Soweit sie sich erinnerte, hatte ihr Kind kaum darauf reagiert. Wäre Sara nicht rot geworden, hätte man gar nicht erkennen können, ob sie zugehört hatte. Und jetzt, nicht viel später, war da diese Angst – die Angst vor Jungs. Vor Männern. Thảo glühte vor Rage und zitterte fast, während sie mit geballten Fäusten auf ihrem Stuhl saß. Als sie die Tür aufgehen hörte, stand sie erleichtert auf, aber sobald sie in das Gesicht ihrer Tochter schaute, flammte die Wut wieder hoch.
– Wo bist du gewesen?
– Ich war bei Jenny zum Lernen, aber das geht dich nichts an.
Sie schwiegen. Sara stellte ihre Schultasche ab.
– Hast du dich mit Jungs getroffen?
– Nein, Mama.
– Was hast du gemacht?
– Nichts! Ich schwöre.
Sie wurde knallrot.
– Du warst mit einem Jungen zusammen, glaubst du etwa, ich wüsste das nicht?
– Ich hab gelernt mit …
– Du Lügnerin!, schrie Thảo und schlug sie.
– … Mama …!
Sara hielt sich schützend die Hände vor den Kopf, während ihre Mutter sie mit Schlägen traktierte. Sie wollte sie wegstoßen, aber Thảo riss an ihren Haaren und hielt sie fest, während sie auf sie einschlug, bis Lieu dazukam und die beiden voneinander trennte.
– Du lügst, du Hure, kreischte Thảo noch lauter, und Anschuldigungen und Widerworte prallten gegeneinander, während das Gerangel immer heftiger wurde, bis Sara sich losriss und in ihrem Zimmer einschloss, derweil ihre Mutter und ihre Großmutter sich im Flur weiter anbrüllten.
– Du schlägst deine Tochter nicht wie einen Hund!, zischte Lieu.
– Hast du nicht gesagt, sie würde die Familie entehren?, hielt Thảo dagegen.
– Das hast du auch gemacht. Und schrei nicht so laut.
Mutter und Tochter stritten sich weiter, während Sara in ihrem Zimmer so laut schluchzte, dass es durch den ganzen Wohnblock drang. Sie schlief nicht, und mitten in der Nacht, als alles leise war, schlich sie sich mit einer Tasche voller Klamotten aus dem Haus und lief zu Indigo. Als sie an sein Fenster klopfte, erschien er mit seiner Robert-Smith-Frisur, in schlaftrunkenem Zustand noch Robert-Smith-mäßiger als sonst, und ließ sie rein. Sie erzählte ihm weinerlich, aber auch wütend, was passiert war. Er lauschte entsetzt, ohne ein Wort zu sagen – und als sie fragte, ob sie bei ihm übernachten dürfe, wirkte er überfordert.
– Sara, sagte er zögerlich. Ich kann dich hier nicht verstecken wie eine Kriminelle.
– Wie eine Kriminelle, wiederholte sie und setzte sich auf sein Bett.
Er schien nicht zu wissen, was er noch sagen sollte, schwieg nur unbeholfen, deshalb legte sie sich einfach hin und fing an zu heulen, lag da und heulte, bis Indigo zu ihr kam, sie in seine schmächtigen Arme nahm und festhielt, bis sie eingeschlafen war. Irgendwann wachte sie davon auf, dass sie sich aneinander gekuschelt küssten. Sie zogen sich aus, ohne zu wissen, was oder wie sie es machen wollten, doch nach ein paar missglückten Versuchen war er in ihr.
Sara schloss die Augen, und dann raste sie auch schon durch ein üppiges Tal zu einem Wäldchen unter einem mächtigen Gebirgszug. Sie wusste, wonach sie suchte, achtete darauf, die Augen nicht zu öffnen, und sprang auf eine Lichtung. Roch den schweren Duft von Birken und Blumen und sah Licht in blauen Säulen durch das Laub brechen, in das dunkelgrüne Blätterwerk hinein, und da flatterte ein prunkvoller Schmetterling, wie die Milde der ganzen Welt. Sara bewegte sich schlafwandlerisch und willenlos, während sie die blaugemusterten Bewegungen dieses geflügelten, winzigen Geschöpfs betrachtete, hob den Kescher, und just in dem Moment, als das Netz hinabrauschte und die Beute umschloss, verschwand alles wieder. Alles wurde so schwarz und leer, dass sie sich aufsetzte. Indigo schaute sie besorgt an.
– Ist alles okay?, wisperte er.
– Was?
– Du warst irgendwie so …
– Wie?
– Als wäre es nicht gut.
– Nein, flüsterte sie. Ich fand’s schön.
Er wirkte nicht überzeugt und sah auf einmal bedrückt aus, zu bedrückt, um ihr erzählen zu können, was ihn offenbar beschäftigte. Sie schwiegen lange, bevor sie wieder einschliefen. Am nächsten Morgen wachte Sara davon auf, dass eine erwachsene Frau neben dem Bett stand. Angsterfüllt zog sie sich die Decke über den Kopf und kauerte sich zusammen.
– Sara, es ist alles in Ordnung. Ich heiße Mona … ich bin Indigos Mutter.
Sara wagte es nicht, unter der Decke hervorzulugen, lag still da und sagte kein Wort, während sie die Frau reden hörte. Wo war Indigo? Warum war sie allein?
– Er hat mir erzählt, dass du hier geschlafen hast, und … ich bin nicht sauer, wir müssen uns nur unterhalten. Sara …
Sara antwortete nicht.
– … können wir reden?
Kurze Stille, dann nickte Sara unter der Bettdecke, und irgendwie schien die Frau das verstanden zu haben und sprach weiter. Als sie