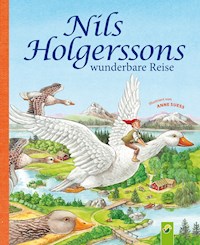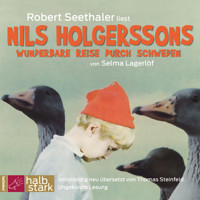Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: aristoteles
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die schwedische Schriftstellerin Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf hat Weltliteratur geschrieben. 1909 erhielt sie als erste Frau den Nobelpreis für Literatur. Dies ist die sorgsam zusammengetragene Sammlung von Novellen, wie Frau Fasta und Peter Nord, Die Legende vom Vogelnest, Das Steinmal, Die Vogelfreien, Reors Sage, Waldemar Atterdag brandschatzt Wisby, Mamsell Friederike, Der Roman einer Fischerfrau, Das Bild der Mutter, Ein entthronter König, Ein Weihnachtsgast, Onkel Ruben, Dunenkind, In den Kletterrosen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Selma Lagerlöf
Unsichtbare Bande
Erzählungen
Deutsch von Marg. Langfeldt
Mit einer Einleitung von Felix Salten
Einleitung
In der ersten ihrer »Christuslegenden« erinnert sich die Lagerlöf der Zeit, da sie ein kleines Kind von fünf Jahren, in Großmutters Stube saß, hingeschmiegt zu den Füßen der alten Frau, die Geschichten erzählte. Den ganzen Tag saß die Großmutter in ihrem Ecksofa, und den ganzen Tag erzählte sie Geschichten; vom Morgen bis zum Abend. Sie konnte auch viele schöne Lieder singen, aber dazu war sie nicht alle Tage aufgelegt. In einem dieser Lieder war von einem Ritter und von einer Meerjungfrau die Rede. Das hatte den Kehrreim: »Es weht so kalt, es weht so kalt, wohl über die weite See.« Ritter und Meerjungfrau und der melancholische Kehrreim haben sich dem lauschenden Kinde eingeprägt, daß es Zeit seines Lebens daran nicht vergessen konnte.
Wenn die Großmutter mit einem Märchen fertig war, legte sie ihre sanfte, müde alte Hand auf das blonde Haupt des Kindes und sagte: »Und das alles ist so wahr wie daß ich dich sehe und daß du mich siehst.« Alle die Märchen und Geschichten sind dann dem aufwachsenden Mädchen ineinander verdämmert und verschwommen. Nur eine kleine Legende von Jesu Geburt hat sich im Gedächtnis erhalten. Dazu noch der beschwörende Kehrreim, der jede Erzählung der Großmutter begleitete: »Und das alles ist so wahr .....«
Wie die Lagerlöf am Anfang ihrer Christuslegenden die Großmutter zeichnet, steht die Gestalt leibhaftig und vertraut vor unseren Augen, und es ist, als brauche man sich nur an sie zu wenden, um den Weg zu Selma Lagerlöfs tiefstem Wesen zu finden. Gleich einer guten alten Pförtnerin hilft uns diese großmütterliche Erscheinung über die Schwelle von Selma Lagerlöfs merkwürdig persönlicher, wunderbar volksliedhafter Kunst, schließt uns die innersten Kammern ihres Schaffens auf.
Ein früheres Erlebnis der Dichterin von nicht geringerer Kraft des Eindrucks: daß die Erzählerin all der Geschichten eines Tages stirbt, daß dieser liederreiche Mund, der ihrer Kindheit so viele holde Worte zugesungen hat, mit einemmal für immer verstummt. Die Lagerlöf sagt: »Und ich erinnere mich, wie Märchen und Lieder vom Hause wegfuhren, in einen langen, schwarzen Sarg gepackt, und niemals wiederkamen.«
Das schreibt sie als Dichterin auf, weil sie diesen Vorgang, wie alles, was sie denkt und erlebt, bildhaft und episch empfindet. Sie sieht den schwarzen Sarg, den man aus dem Haus trägt; sie sieht sich selbst als fünfjähriges Kind, das nicht begreifen kann, wie man einen Menschen in solch eine finstere Kiste steckt und ihn darin verschlossen hält. Sie fühlt den Schauer des Rätselhaften noch, der sie damals ergreift, und sie entsinnt sich der Leere, der Stille, der traurigen Einsamkeit noch, in der sie zurückblieb. Sie ist eine Dichterin und sie drückt das in einleuchtenden bildmäßigen Worten aus: »Es war, als hätte sich die Tür zu einer ganzen schönen, verzauberten Welt geschlossen, in der wir früher frei ein- und ausgehen durften. Und nun gab es niemand mehr, der sich darauf verstand, diese Tür zu öffnen.«
Aber es war nur die sterbliche Hülle der Großmutter, die hinausgetragen wurde; die Märchen und Lieder sind nicht mit in dem langen, schwarzen Sarg gewesen, die blieben zurück bei dem blonden, kleinen Kind. Dieses Kind wuchs auf und hatte die Kraft, jene Türe wieder zu öffnen, hatte die Gabe, die schöne, verzauberte Welt, die hinter jener Türe lag, wie eine Heimat zu betreten, und frei darin aus- und einzugehen, wie in einer Heimat. Denn dieses Kind war ja Selma Lagerlöf, die Dichterin.
Tief eingebettet in der herb süßen schwedischen Landschaft liegt das Haus, darin die Lagerlöf ihre Jugend verlebt hat, der Marbackahof. Ein rechtschaffenes, einfaches Haus mit weißen Fensterladen, mit glatten Mauern und mit einem Dach, das so schlicht ist wie ein Bauernhut. Selma Lagerlöfs Onkel hat dies Haus gemalt, und da schauen wir es auf dem Bilde an, wie ein Porträt, und wie es so vor uns liegt, auf breitem Wiesengrund, von Bäumen umschattet, blickt es uns an wie ein ehrliches, gutmütiges Alltagsantlitz voll Behagen und Mühsamkeit. Schön ist die schwedische Landschaft, und alle ihre Farben sind zart, sind abgetönt, gleichsam in jene blasse, helle Blondheit getaucht, die der Norden gibt. Dennoch haben diese Farben ein verhaltnes Leidenschaftlichsein, eine Kernigkeit, die wieder nur der Norden verleiht.
Die Luft über diesem Lande funkelt golden in ihrer Klarheit. Diese Luft zeichnet alle Dinge mit scharfen klaren Linien und hat in ihrer gleichmäßigen Durchsichtigkeit die herbe, unbeugsame Gewalt des Tatsächlichen. Zur Abendzeit jedoch flieht diese Luft in weichen, schmiegsamen Schleiern über die Landschaft hin, webt wie Ahnung des Ungewissen und Fernen um den Horizont.
Zeigt dieses Haus im grünen Wiesenland uns nicht die Wurzeln von Selma Lagerlöfs Art? Weltabgewendet liegt es da. Dem Treiben des modernen Lebens entrückt, ferne dem betäubenden, unklaren, überstürzten Katarakten der Ereignisse, die beständig über unsere Städte dahinschäumen, die Erinnerung an gestern, das Andenken des Vergangenen hinwegspülend. Auf uraltem Boden steht dies Haus. Das Gedächtnis derjenigen, die vordem hier lebten, ist auf allen Pfaden noch unverwischt lebendig und die Gegenwärtigen sind an die Gewesenen noch gebunden wie Menschen, die sich in einem langen Reigen an den Händen halten. Der Sturm des Empfindens, die schweren Gewitter der Leidenschaft toben hier aus in alten Legenden. Schicksale, die längst vorüber und zu Ende sind, Leiden und Seligkeiten, die längst durchlebt und durchlitten wurden, breiten sich statt der Zeitungen und ihren frischblutigen, noch zuckenden Menschenerlebnissen vor dem jungen Gemüt aus. Eine tiefe Ruhe geht von den gewesenen Dingen aus, denn hier ist jegliches Weh zu Ende geblutet, jegliches Verhängnis ist längst erfüllt. Zugleich aber sättigt das herrliche Schauspiel des Vergangenen die jugendliche Sehnsucht nach Bewegung, tränkt die durstende Phantasie. Alle diese abgespielten Schauspiele des Daseins kann man aufwecken. Wenn es gelingt, sie aus ihrem Schlummer hervorzuholen, sind sie wieder lebendig, und ihr Schicksal wird zu dem unsrigen. Die Menschen sind nicht durch Wände, Grüfte, Jahrhunderte voneinander getrennt. Sie hören nicht auf, sich zu gleichen; sie sind immer dieselben.
Das ist nun die merkwürdige Kraft, die wir an der Lagerlöf so sehr bewundern, daß sie die einfachen, geraden Linien des ewig Menschlichen auffindet. Sie denkt, sie empfindet nur in solchen einfachen, geraden Linien. Sie hört die menschlichen Akzente, die von Urzeiten her immer und immer wieder aus dem Herzen der Sterblichen aufklingen. Und sie spricht nur in solchen Akzenten, die von Land zu Land, von Epoche zu Epoche verstanden werden, die zu vernehmen man niemals überdrüssig wird, weil sie uns im Keim und Kern unseres Fühlens treffen.
Manchmal begegnet es mir, daß ich beim Lesen einer Lagerlöfschen Erzählung irgend eines Volksliedes mich erinnere. »Sah ein Knab' ein Röslein stehn«, fiel mir letzthin ein. Wie ist dies alles einfach und im Tiefsten war: »Knabe sprach, ich breche dich, Röslein auf der Heiden –«, denn man mag alle Varianten der Werbung nehmen, sie liegen schon in diesen geraden, naiven Worten beschlossen, wie jegliche Mädchenantwort in den Worten beschlossen ist: »Röslein sprach: ich steche dich, daß du ewig denkst an mich, denn ich mag's nicht leiden.« Jegliches Frauenschicksal birgt sich in dem kleinen Satz: »Half ihr doch kein Weh und Ach...« Und es klingt alles Menschenschicksal, wie kompliziert es auch sei, in diesem Liedchen mit. Unbegreiflich ist die alles umspannende Schönheit, die alles zusammenfassende Kraft eines Volksliedes. Manchmal ist es einem, wenn man die Bücher dieser schwedischen
Dichterin liest, wenn man die Macht verspürt, die sie im Hinstellen einer Legende besitzt, als sei sie dem Volkslied im innersten Wesen irgendwie verwandt.
Einfach wie der Alltag ist der äußere Gang ihres Lebens. Sie studiert und bildet sich nach Möglichkeit, kommt als vierundzwanzigjähriges Mädchen nach Stockholm, den Sinn auf Nützlichkeit und bescheidenen Erwerb gerichtet, macht hier das Lehrerinnenseminar durch und geht dann in das südschoonische Städtchen Landskrona, wo sie an der Volksschule eine Anstellung gefunden hat. Dort bleibt sie jahrelang, unterrichtet kleine Mädchen, schreibt und dichtet dabei, aber niemand kennt sie. Dann kommt über Nacht der Erfolg zu der Dreiunddreißigjährigen. Eine Stockholmer Frauenzeitung erläßt 1890 ein Preisausschreiben, Selma Lagerlöf sendet Bruchstücke ihres »Gösta Berling« hin, und ein Jahr darauf ist sie berühmt.
In Stockholm, während der Studienzeit, faßt das junge Mädchen, das sonst gewohnt war, über weite Wiesen dahinzuwandeln, auf Spaziergängen durch die engen Straßen der Stadt den Gedanken, das Gösta-Berling-Buch zu schreiben. Fern von Värmland und von dem traulichen Haus, darin die Großmutter einst auf dem Ecksofa saß und Geschichten erzählte, beginnen nun die Sagen und Märchen der Heimat in ihr zu klingen, wie dem Wanderer auf fremden Pfaden, im fremden Wind die Glocken der Heimat zu läuten beginnen. So hebt ihr Schaffen an. Sie ist langsam und still reif geworden. Aber jetzt ist ihr Wesen fest gefügt. Kein Suchen tastet mehr in ihr, kein Schwanken bebt durch ihre Art, kein Vorwärtsdrängen, und beinahe könnte man sagen: keine Entwicklung. Sie ist in sich beschlossen und fertig.
Und sie überwältigt auch gleich mit ihrem ersten Hervortreten. Mitten in einer Epoche der nervösesten Gegenwartsdichtung bricht ihr Buch herein wie ein Frühlingsgewitter. Diesem süßen Duft, dieser einfachen, in tiefen Atemzügen wehenden Leidenschaft kann sich niemand verweigern. Diese unbedingte Echtheit, diese volksliedhaft innige Durchseelung des Menschlichen versteht man sogleich in allen Ländern. Man kennt und liest sie erst seit gestern, aber allsogleich ist es, als ob sie schon lange mit uns leben würde. Ihr Ruhm währt jetzt kaum zwanzig Jahre, aber schon werden ihre Dichtungen zu denen der Klassiker gestellt.
Blicken wir auf ihr Leben und auf ihr Schaffen, dann ist alles so gerundet, daß Anfang und Ende, Ursache und Wirkung überall ineinander sich verschränken und Eins werden. In wie vielen ihrer Geschichten schreitet nicht irgendwo einmal am Horizont jener Ritter vorbei, von dem sie als fünfjähriges Kind die Großmutter hat singen hören. Sie hat sein Schicksal vergessen, hat nur seine geheimnisvoll zauberhafte Gestalt in ihrer Phantasie aufbewahrt und findet sich nun getrieben, diesem Schicksal nachzusinnen. Wie oft scheint nicht jenes Meerfräulein aus blauen Wellen aufzutauchen, und wie oft geht nicht der melancholische Kehrreim jenes alten Liedes: »... es weht so kalt, es weht so kalt, wohl über die weite See...« als eine leise Unterstimme mit in der Musik ihrer Erzählungen. Wenn sie dann als berühmte Dichterin ins gelobte Land Palästina zieht, um von dort ihre beiden prachtbeladenen Jerusalem-Bücher mit heimzubringen, ist es nicht, als sei es jene erste Legende, die sie gehen hieß; jene Legende von Jesu Geburt, die sie daheim als kleines Kind vernommen? Ist es nicht, als sei sie auf diesem Weg nur einem Ruf aus fernen, frühen Jugendtagen andächtig gefolgt?
Wenn sie uns aber ihre Märchen erzählt, dann ist es uns, als fühlten wir, wie sie uns ihre feine, mütterlich gütige Hand aufs Haupt legt, ist es uns, als hörten wir sie sagen, wie jene alte Frau im Ecksofa einst gesprochen, treuherzig, mild, von tiefem Glauben durchdrungen: »Und dies alles ist so wahr...«
Wien, Felix Salten
Frau Fasta und Peter Nord
1.
Die kleine Stadt steht mir in der Erinnerung so freundlich wie ein Heim vor Augen. Sie ist so klein, daß ich alle ihre Winkel und Ecken kennen lernen, mit jedem Kinde Freundschaft schließen und jeden Hund bei seinem Namen rufen konnte. Wer die Straße entlang ging, wußte, bei welchem Fenster er den Blick erheben mußte, um ein hübsches Gesicht hinter den Scheiben zu sehen, und wer im Stadtparke spazierte, kannte genau die Zeit, wann er sich dort einzustellen hatte, um dem zu begegnen, den er treffen wollte.
Man war beinahe ebenso stolz auf die Rosen im Nachbargarten wie auf seine eigenen. Passierte etwas Kleinliches oder Unfeines, so schämte man sich, wie wenn es in der eigenen Familie vorgekommen wäre, aber mit dem allerkleinsten Ereignis, einer Feuersbrunst oder einer Marktschlägerei, brüstete man sich und sagte: »Seht nur diesen Ort! Passiert wohl anderwärts dergleichen? Welch wunderbare Stadt!«
Und in dieser meiner geliebten Stadt verändert sich nichts. Komme ich wieder einmal dorthin, so werde ich dieselben Häuser und Läden, die ich von alters her kenne, wiederfinden, dieselben Vertiefungen des Pflasters bringen mich wieder zu Fall, und dieselben steifen Lindenhecken und rundbeschnittenen Fliederbüsche fesseln meine bewundernden Blicke. Wieder sehe ich den alten Senator, der die ganze Stadt regiert, mit elefantenschweren Schritten die Straße herabkommen. Welch ein Gefühl der Sicherheit erhält man, wenn man dich, du Patriarch und Vorsehung, so einherwandern sieht! Und der taube Halfvorson wird noch immer in seinem Garten graben und mit den wasserblauen Augen suchend umherstarren, als wollte er sagen: »Alles haben wir durchforscht, jetzt, Erde, werden wir uns bis in deine innersten Eingeweide einbohren.«
Doch wer dort nicht mehr zu finden sein wird, das ist der kleine, runde Peter Nord. Der kleine Värmländer, der, wie ihr wißt, in Halfvorsons Kramladen stand und die Kunden mit seinen kleinen mechanischen Erfindungen und seinen weißen Mäusen amüsierte. Über ihn gibt es eine ganze Geschichte. Man könnte überhaupt von allem und jedem in der Stadt eine Geschichte erzählen. Nirgends ereignen sich so seltsame Dinge.
Der kleine Peter Nord war ein Bauernjunge. Er war unter Mittelgröße und schneckenfett, hatte braune Augen und ein stets lächelndes Gesicht. Sein Haar war heller als das Laub der Birke im Herbste, seine Wangen rot und mit Flaum bedeckt. Und aus Värmland war er. Keiner, der ihn sah, hätte ihn für einen andern Landsmann gehalten. Die vortreffliche Heimat hatte ihn mit vorzüglichen Eigenschaften ausgerüstet. Rasch in der Arbeit, geschickt mit den Fingern, zungenfertig und klar im Kopfe. Und dabei ein Narr, ein geradezu großartiger Narr, gutmütig und obenhinaus, gefällig und zänkisch, neugierig und schwatzhaft. Der Dummkopf war nicht imstande, einem Bürgermeister mehr Ehrfurcht als einem Bettler zu erweisen! Doch ein gutes Herz hatte er, verliebte sich jeden zweiten Tag und zog die ganze Stadt ins Vertrauen.
Die Ladenarbeit besorgte dieses reichbegabte Geschöpf auf eine etwas übernatürliche Weise. Er bediente die Kunden, während er die weißen Mäuse fütterte. Er wechselte und zählte Geld, während er seine kleinen, selbstgehenden Wagen mit Rädern versah. Und während er den Kunden von seiner neuesten Liebe erzählte, hingen seine Augen an dem Litermaß, in das der braune Sirup in langsamen Ringeln floß. Und es ergötzte die bewundernden Zuhörer, ihn plötzlich über den Ladentisch setzen und auf die Straße hinausstürmen zu sehen, wo er sich mit einem umherlungernden Gassenbuben prügelte, um dann mit heiterer Miene wiederzukommen und die Schnur eines Paketes zuzuknoten oder ein Stück Zeug fertig zu messen.
War es nicht natürlich, daß er der Günstling der ganzen Stadt wurde? Wir fühlten uns alle verpflichtet, bei Halfvorson zu kaufen, seit Peter Nord dort im Geschäft war. Sogar der alte Senator schmunzelte stolz und befriedigt, wenn Peter ihn in die dunkle Ecke zog und ihm seine weißen Mäuse zeigte. Das Besehen der Mäuse war aufregend und spannend, denn Halfvorson hatte ihnen den Laden verboten.
Da aber kamen mitten in dem an Licht zunehmenden Februar ein paar dunkle, neblichte Tauwettertage. Peter Nord wurde auf einmal ernst und still. Er ließ die weißen Mäuse in ihr Drahtgitter beißen, ohne ihnen Futter zu geben. Er verrichtete seine Obliegenheiten tadellos. Er prügelte sich nicht mehr mit dem Gassenbuben. Konnte Peter Nord es denn nicht vertragen, daß der Winter umgeschlagen?
O nein, die Sache hing anders zusammen. Er hatte auf einer der Reolen einen Fünfzigkronenschein gefunden. Er hatte geglaubt, daß dieser mit einem Stücke Zeug hinaufgeworfen worden, und hatte ihn ganz unbemerkt unter einen Packen gestreiften Baumwollenstoffes geschoben, der außer Mode war und nie von der Borte heruntergenommen wurde.
Der Knabe hegte Groll gegen Halfvorson. Dieser hatte ihm eine ganze Mäusefamilie totgeschlagen, und nun wollte er sich dafür rächen. Er sah die weiße Mutter inmitten ihrer hilflosen Jungen noch immer vor Augen. Sie hatte gar keinen Fluchtversuch gemacht, sondern mit unerschütterlichem Heldenmut stillgehalten und den herzlosen Mörder mit den roten, brennenden Augen angestarrt. Verdiente dieser nicht auch ein Stündchen voll Herzensangst? Peter Nord wollte ihn totenbleich aus dem Kontor kommen und nach dem Fünfzigkronenschein suchen sehen. Er wollte in seinen wasserblauen Augen dieselbe Verzweiflung sehen, die er in den granatroten der weißen Maus erblickt. Der Krämer sollte suchen, er sollte den ganzen Laden umkehren, ehe Peter Nord ihn den Schein finden ließ.
Doch der Fünfzigkronenschein lag den ganzen Tag in seinem Verstecke, ohne daß jemand nach ihm fragte. Er war ganz neu, bunt und glänzend und trug eine große Fünfzig in allen vier Ecken. Wenn Peter Nord allein im Laden war, stellte er den Ladentritt an die Reole und kletterte hinauf nach dem Zeugpacken, er zog dann den Schein hervor, entfaltete ihn und bewunderte seine Schönheit.
Beim eifrigsten Handel überfiel ihn oft plötzlich die Angst, daß dem Scheine etwas passiert sein könnte. Da tat er, als suchte er etwas auf der Borte und fühlte unter dem Packen umher, bis er den glatten Schein unter seinen Fingern knistern fühlte. Der Schein hatte plötzlich eine übernatürliche Gewalt über ihn erlangt. War vielleicht etwas Lebendiges darin? Die von breiten Ringen umgebenen Fünfzigen glichen sich festsaugenden Augen. Der Knabe küßte sie alle und flüsterte: »Solche wie dich möchte ich viele haben, schrecklich viele!«
Er begann sich allerlei Gedanken darüber zu machen, daß Halfvorson gar nicht nach dem Scheine fragte. Gehörte er ihm am Ende nicht? Hatte er vielleicht schon jahrelang im Laden gelegen? Hatte er vielleicht keinen Besitzer mehr?
Gedanken stecken an. – Beim Abendessen hatte Halfvorson von Geld und Geldmenschen zu reden begonnen. Er erzählte Peter von all den armen Buben, die reich geworden waren. Er fing mit Whittington an und hörte mit Astor und Jay Gould auf. Halfvorson kannte ihre ganze Geschichte; er wußte, wie sie gestrebt und entbehrt, was sie erfunden und gewagt. Er wurde beredt, sobald er auf dieses Thema kam. Er durchlebte die Leiden der jungen Geldmenschen, er teilte ihre Erfolge, er jubelte bei ihrem Siege. Peter Nord hörte wie gebannt zu.
Halfvorson war stocktaub, doch dies erschwerte die Unterhaltung nicht, denn er las dem Sprechenden die Worte von den Lippen ab. Seine eigene Stimme konnte er jedoch nicht hören. Deshalb strömte seine Rede so seltsam eintönig dahin wie das Rauschen eines Wasserfalles in der Ferne. Doch infolge dieses wunderlichen Tonfalles biß sich alles, was er sagte, so im Ohre fest, daß man es tagelang nicht wieder los wurde. Der arme Peter!
»Was zum Reichwerden unumgänglich nötig,« sagte Halfvorson, »ist der Heckpfennig. Den aber kann man nicht verdienen. Denke daran, daß alle ihn entweder auf der Straße gefunden oder zwischen dem Futter und Oberzeuge eines auf der Auktion gekauften Rockes, ihn beim Spiele gewonnen oder ihn von einer schönen, barmherzigen Dame als Almosen bekommen haben. Sowie sie aber diese gesegnete Münze hatten, ist ihnen alles geglückt. Der Goldstrom wälzte sich wie aus einer Quelle daraus hervor. Die Hauptsache, Peter Nord, ist der Heckpfennig.«
Halfvorsons Stimme klang immer dumpfer. Der junge Peter Nord saß wie betäubt da und sah eitel Geld vor sich. Auf dem Tischtuche waren Haufen von Dukaten aufgestapelt, der Fußboden glänzte weiß von Silbergeld, und das unbestimmte Muster der schmutzigen Tapete verwandelte sich in Banknoten von Taschentuchgröße. Doch mitten vor seinen Augen flatterte die Fünfzig in einem breiten Ringe und lockte ihn wie die schönsten Augen. »Wer weiß,« lächelten die Augen, »ob der Fünfzigkronenschein auf der Borte nicht ein solcher Heckpfennig ist?«
»Merke dir,« sagte Halfvorson, »daß außer dem Heckpfennig noch zwei Dinge für den notwendig sind, der es zu etwas bringen will. Arbeiten, eisernes Arbeiten, Peter Nord, heißt das eine, und Entsagen das andere. Verzichten auf Spiel und Liebe, Plaudern und Lachen, Morgenschlaf und Mondscheinspaziergänge. Wahrlich, wahrlich, zwei Dinge sind notwendig für den, der das Glück gewinnen will. Arbeiten heißt das eine, und Entsagen das andere.«
Peter Nord sah aus, als wollte er anfangen zu weinen. Wohl wollte er reich, wohl wollte er glücklich werden, doch das Glück sollte nicht so ängstlich und sauer erworben kommen. Es sollte ganz von selbst kommen. Während er mit den Gassenbuben im Handgemenge war, sollte die edle Dame Fortuna ihren Tragstuhl vor der Ladentür halten lassen und dem Värmlandsjungen einen Platz an ihrer Seite anbieten. Doch nun tönte ihm Halfvorsons Stimme immerfort in den Ohren und erfüllte sein ganzes Hirn. Er glaubte an nichts anderes, wußte nichts anderes. Arbeiten und Entsagen, das war der Zweck des Lebens, ja das Leben selbst. Er begehrte nichts weiter und wagte gar nicht daran zu denken, daß er sich je etwas anderes gewünscht.
Am nächsten Tage wagte er den Schein nicht zu küssen, ja nicht einmal anzusehen. Er war still und verstimmt, ordentlich und fleißig. Er besorgte alle seine Geschäfte so tadellos, daß jeder Kunde gleich sah, daß etwas mit ihm nicht in Ordnung war. Dem alten Senator tat der Knabe leid, und er tat, was er konnte, um ihn zu trösten.
»Gehst du heute abend auf den Fastnachtsball, Peter Nord?« fragte der Alte. »So, nicht. Nun, dann lade ich dich dazu ein und bitte mir aus, daß du kommst. Sonst sage ich Halfvorson, wo du deine Mäusekäfige hast.«
Fastnachtsball, denkt nur, Peter Nord sollte auf den Fastnachtsball! Peter Nord sollte alle schönen, feinen Damen der Stadt in weißen, mit Blumen geschmückten Kleidern sehen! Doch Peter Nord durfte natürlich mit keiner von ihnen tanzen. Nun, das war ihm einerlei. Er war nicht zum Tanzen aufgelegt.
Auf dem Balle stand er in der Tür und setzte keinen Fuß zum Tanzen an. Einige hatten ihn dazu zu überreden gesucht, doch er war fest geblieben und hatte nein gesagt. Er könne diese Tänze nicht. Von den feinen Damen wolle auch keine mit ihm tanzen. Er sei ihnen nicht fein genug.
Doch während er so dastand, begannen seine Augen zu leuchten, und er fühlte, wie die Freude ihm die Glieder elektrisierte. Das kam von der Tanzmusik, das kam von dem Blumendufte, das kam von den hübschen Gesichtern, die er vor sich sah. Nach einer kleinen Weile war er so sprühend heiter, daß, wäre die Freude Feuer, die Flammen hoch über ihm zusammengeschlagen wären. Und wäre die Liebe es, wie so vielfach behauptet wird, so würde es ihm nicht besser ergangen sein. Er war allzeit in ein junges Mädchen verliebt, doch bisher stets nur in eine zurzeit. Doch wie er nun alle diese hübschen jungen Damen auf einmal sah, war es nicht mehr ein einfaches Kaminfeuer, das sein sechzehnjähriges Herz verzehrte, sondern ein ganzer Waldbrand.
Bisweilen blickte er auf seine Stiefel nieder, die nichts weniger als Ballschuhe waren. Wie fest hätte er mit den breiten Absätzen den Takt stampfen und sich auf den dicken Sohlen im Kreise drehen können! In ihm schob und drängte etwas und wollte ihn wie einen geschlagenen Ball auf den Tanzboden schleudern. Noch widerstand er, obgleich die innere Bewegung immer stärker wurde, je weiter die Nacht vorschritt. Ihm wurde heiß und schwindelig. Heißa, er war nicht länger der arme Peter Nord! Er war der junge Wirbelwind, der das Meer aufrührt und den Wald knickt!
Da wurde eine Mazurka aufgespielt. Der Bauernjunge geriet außer sich. Er meinte, es klänge wie Polska, wie Värmlandspolska.
Im Nu stand Peter Nord mitten im Saale. Alle Herrenmanieren hatte er abgeworfen. Er war nicht mehr auf dem Rathausballe, sondern daheim auf der Scheundiele beim Mitsommertanz. Er ging mit krummen Knien und emporgezogenen Schultern geradeaus. Ohne um die Erlaubnis zu fragen, legte er den Arm um eine Dame und zog sie mit sich. Und dann begann er Polska zu tanzen.
Die Dame folgte ihm halb widerwillig, beinahe fortgeschleppt. Sie konnte nicht in den Takt kommen, sie wußte gar nicht, was für ein Tanz dies war, doch plötzlich ging alles wie von selbst. Das Geheimnis des Tanzes wurde ihr klar. Die Polska trug sie, hob sie, verlieh ihren Füßen Schwingen und machte sie so leicht wie Luft. Sie schien zu fliegen.
Denn die Värmlandspolska ist der wunderbarste Tanz. Sie verwandelt die schwerfüßigen Söhne der Erde. Lautlos schweben sie auf zolldicken Sohlen über ungehobelte Scheunendielen dahin. Sie wirbeln so leicht umher wie die Blätter im Herbststurme. Die Polska ist weich, schnell, leise und gleitend. Ihre edlen, maßvollen Bewegungen lassen den Körper sich leicht und frei, elastisch und schwebend fühlen.
Während Peter Nord den Tanz seiner Heimat tanzte, ward es still im Saale. Anfänglich wurde gelacht, bald aber erkannten alle, daß dies Tanzen war. Wenn etwas Tanzen war, so war es dieses Dahinschweben in gleichmäßigen, schnellen Wirbeln.
Da merkte Peter Nord in seiner Ausgelassenheit, daß um ihn herum eine so seltsame Stille herrschte. Er hielt inne und fuhr sich mit der Hand über die Stirn. Keine schwarze Scheunendiele, keine mit Birkenzweigen geschmückten Wände, keine lichtblaue Sommernacht und kein munteres Bauernmädchen erblickte er in der Wirklichkeit, die er vor sich hatte. Er schämte sich und wollte sich fortschleichen.
Doch schon wurde er umringt und bestürmt. Die jungen Damen drängten sich um den Ladenjungen und riefen: »Tanzen Sie mit uns! Tanzen Sie mit uns!«
Sie wollten sich die Polska lehren lassen. Man hielt sich nicht mehr an die Tanzordnung, und der Ball verwandelte sich in eine Tanzstunde. Und Peter Nord ward an diesem Abend ein großer Mann.
Er mußte mit allen den feinen Damen tanzen, und sie waren außerordentlich freundlich gegen ihn. Er war ja nur ein Knabe und überdies ein so lustiger Narr. Man konnte nicht anders als ihn verziehen.
Peter Nord fühlte, daß dies das Glück war. Der Günstling der Damen sein, mit ihnen zu sprechen wagen, sich mitten im Lichte bewegen, gefeiert und verhätschelt werden, gewiß war dies das Glück.
Als der Ball zu Ende war, konnte er nicht einmal darüber traurig sein, so glücklich war er. Er empfand das Bedürfnis, alles, was er heute abend erlebt, zu Hause in Ruhe zu überdenken. –
Halfvorson war unverheiratet, hatte aber eine Nichte im Hause, die bei ihm im Kontor arbeitete. Sie war arm und auf Halfvorson angewiesen, behandelte ihn und Peter Nord aber sehr von oben herab. Sie hatte viele Freunde unter den angeseheneren Familien der Stadt und verkehrte in Kreisen, zu denen Halfvorson keinen Zutritt hatte. Sie und Peter Nord gingen zusammen vom Balle nach Hause.
»Wissen Sie, Nord,« fragte Edith Halfvorson, »daß Halfvorson bald wegen verbotenen Schnapshandels verklagt werden wird? Sie können mir immer sagen, was an der Sache ist.«
»Nichts, was der Mühe wert wäre, darum Lärm zu schlagen,« sagte Peter Nord.
Edith seufzte. »Natürlich ist etwas daran. Und es wird ein Prozeß mit Strafzahlen und Schande ohne Ende. Ich möchte so gern wissen, wie die Sache eigentlich zusammenhängt.«
»Davon wissen Sie besser nichts,« sagte Peter Nord.
»Sehen Sie, Nord, ich will vorwärts,« fuhr Edith fort, »und ich möchte Halfvorson mit hinaufziehen, aber er sinkt immer wieder hinab. Und dann tut er plötzlich etwas, wodurch er mich mit unmöglich macht. Ich sehe ihm nun an, daß er etwas beabsichtigt. Was kann es nur sein? Ich möchte es gar zu gern wissen, können Sie es mir nicht sagen?«
»Nein,« antwortete Peter und sprach kein Wort mehr. Wie unmenschlich, ihm, der von seinem ersten Balle kam, von solchen Dingen zu reden.
Hinter dem Laden lag ein kleiner Alkoven für den Ladenjungen. Da saß der Peter Nord von heute und ging mit dem Peter Nord von gestern ins Gericht. Wie blaß und feig der Lümmel aussah! Nun erfuhr er, wofür er gehalten wurde. Dieb und Geizhals! Kannte er das siebente Gebot? Von Rechts wegen müßte er eine Tracht Prügel haben. Das wäre ihm gesund.
Lob und Preis sei Gott, der ihn auf den Ball kommen lassen und ihm den Sinn verändert hatte. Pfui, wie häßlich hatte es in seinem Innern ausgesehen, doch nun war alles anders geworden. Als ob der Reichtum es wert wäre, daß man ihm sein Gewissen und seinen Seelenfrieden opferte! Als ob er so viel wert wäre wie eine weiße Maus, wenn man dabei nicht fröhlich sein durfte! Er klatschte jubelnd in die Hände. Frei, frei, frei! Sein Herz trug kein Verlangen mehr nach dem Fünfzigkronenschein. O wie schön war es doch, glücklich zu sein!
Als er sich zu Bett gelegt hatte, dachte er daran, Halfvorson den Schein am andern Morgen früh zu zeigen. Dann stieg ihm der Gedanke auf, der Krämer könnte morgen vor ihm in den Laden kommen, nach dem Scheine suchen und ihn finden. Dann würde er natürlich glauben, daß Peter ihn versteckt, um ihn zu behalten. Dieser Gedanke ließ ihm keine Ruhe. Er versuchte, ihn sich aus dem Sinn zu schlagen, doch es wollte ihm nicht gelingen. Er konnte nicht schlafen. Da stand er auf, ging in den Laden und holte den Schein. Nun schlief er ruhig mit demselben unter dem Kopfkissen ein.
Eine Stunde später wurde er geweckt. Ein greller Lichtschein blendete seine Augen, eine Hand griff suchend unter sein Kopfkissen, und eine dumpfe Stimme schalt und fluchte.
Ehe der Knabe sich noch besinnen konnte, hatte Halfvorson den Schein schon in der Hand und zeigte ihn zwei Frauen, die in der Tür des Alkovens standen. »Seht ihr, daß ich recht hatte,« sagte er. »Seht ihr, daß es sich für mich der Mühe verlohnte, euch aus dem Bette zu holen und als Zeugen gegen ihn mitzunehmen! Seht ihr, daß er ein Dieb ist?«
»Nein, nein, nein!« schrie der arme Peter Nord. »Ich wollte den Schein nicht stehlen. Ich habe ihn nur versteckt.«
Halfvorson hörte ja nichts. Die beiden Frauen wandten dem Alkoven den Rücken, als wollten sie weder hören noch sehen.
Peter Nord saß aufrecht im Bette. Er sah auf einmal bedauernswert schwach und klein aus. Seine Tränen flossen. Er jammerte laut.
»Onkel,« sagte Edith, »er weint.«
»Laß ihn heulen,« erwiderte Halfvorson, »laß ihn heulen.« Und er trat näher und sah den Knaben an. »Kann mir's schon denken, daß dir heulerig zumute ist. Macht aber auf mich keinen Eindruck.«
»O, o,« rief Peter, »ich bin kein Dieb. Ich habe den Schein aus Spaß versteckt – um Sie zu ärgern. Ich wollte Sie für die Mäuse bestrafen. Ich bin kein Dieb. Will mich denn niemand hören?! Ich bin kein Dieb!«
»Onkel,« sagte Edith. »Hast du ihn nun genug gequält, so daß wir wieder zu Bett gehen können?«
»Kann mir schon denken, daß es sich abscheulich anhört,« antwortete Halfvorson. »Läßt sich aber nicht ändern.« Er war heiter, förmlich ausgelassen. »Ich habe lange ein Auge auf dich gehabt,« sagte er zu dem Knaben. »Du hast stets etwas zu verstecken, wenn ich in den Laden komme. Doch nun bist du ertappt. Nun habe ich Zeugen und hole die Polizei.«
Peter stieß einen durchdringenden Schrei aus. »Kann mir niemand helfen, steht mir keiner bei?« rief er. Aber Halfvorson war schon fort, und die Frau, die dem Haushalte vorstand, trat zu ihm.
»Ziehen Sie sich an, Nord! Halfvorson holt die Polizei, und unterdessen müssen Sie machen, daß Sie fortkommen. Fräulein kann, in die Küche gehen und Ihnen ein wenig zu essen einpacken. Ich werde Ihre Sachen zusammensuchen.«
Das entsetzliche Weinen verstummte sofort. Bald war der Knabe fertig. Er küßte den beiden Frauen so demütig die Hand wie ein geschlagener Hund. Und dann eilte er fort.
Sie standen in der Tür und blickten ihm nach. Als er verschwunden war, stießen sie einen Seufzer der Erleichterung aus.
»Was Halfvorson nun wohl sagt?« fragte Edith.
»Er wird schon damit zufrieden sein,« antwortete die Haushälterin. »Er hat dem Knaben das Geld wohl hingelegt, denke ich mir. Er wollte ihn nur los sein.«
»Weshalb? Der Junge war ja der beste Ladendiener, den wir seit Jahren gehabt haben.«
»Er wollte ihn wohl nicht bei der Schnapsgeschichte zum Zeugen haben – –«
Edith stand stumm da und atmete heftig. »Wie gemein! wie gemein!« murmelte sie nach einer Weile. Sie drohte mit der Faust nach der Kontortür und der kleinen Scheibe, durch die Halfvorson in den Laden sehen konnte. Sie verspürte Lust, ebenfalls von all dieser Schlechtigkeit fort in die Welt hinauszufliehen.
Sie hörte hinten im Laden ein Geräusch. Sie lauschte, trat näher, ging dem Tone nach und fand endlich hinter einer Heringstonne Peter Nords Bauer mit den weißen Mäusen.
Sie hob es auf, setzte es auf den Ladentisch und öffnete seine Tür. Eine Maus nach der andern eilte heraus und verschwand hinter den Kisten und Tönnchen.
»Möchtet ihr euch hier wohl fühlen und euch vermehren,« sagte Edith. »Laßt mich sehen, daß ihr Schaden anrichtet und euern Herrn rächt!«
2.
Die kleine Stadt lag freundlich und zufrieden am Fuße ihres roten Berges. Sie lag so im Grünen, daß von fern nur der Kirchturm zu sehen war. Die Gärten kletterten in schmalen Terrassen an den Abhängen hinauf, und wo sie in dieser Richtung nicht weiterkommen konnten, stürzten sie sich mit Bäumen und Gebüsch quer über die Straße, breiteten sich zwischen den zerstreut liegenden Häusern aus und nahmen den flachen Uferstreifen unterhalb der Stadt ein, bis der breite Fluß ihnen den Weg verlegte.
Es war ganz still und ruhig in der Stadt. Kein Mensch war zu sehen, nur Bäume, Sträucher und hier und da ein Haus. Das einzige, was man hörte, war das Rollen der Kugeln auf der Kegelbahn, und es klang wie Donner in der Ferne an einem Sommertage. Das gehörte mit zu der Stille.
Doch jetzt knirschte das unebene Marktpflaster unter eisenbeschlagenen Absätzen. Der Klang rauher Stimmen hallte von den Mauern der Kirche und des Rathauses wider, wurde vom Berge zurückgeworfen und eilte ungehindert die lange Straße hinab. Vier Wanderer störten die vormittagliche Stille.
Ach, die süße Ruhe, der jahrelange Sonntagsfrieden! Wie sie erschraken! Man konnte förmlich hören, wie sie die Bergpfade hinaufflohen.
Einer der Lärmenden, die in das Städtchen einbrachen, war Peter Nord, der Värmlandsbube, der vor sechs Jahren, des Diebstahls angeklagt, aus der Stadt entflohen war. Seine Begleiter waren drei Strolche aus der großen Handelsstadt, die nur ein paar Meilen entfernt liegt.
Wie war es dem kleinen Peter Nord denn ergangen? Gut war es ihm ergangen. Er hatte einen der allervernünftigsten Freunde und Begleiter gehabt.
Als er an jenem dunklen, regenschweren Februarmorgen aus der Stadt entfloh, brausten ihm Polska-Melodien in den Ohren. Und eine derselben war eigensinniger als alle die andern. Es war die, welche sie alle bei dem großen Rundtanze gesungen:
»Nun ist es Weihnacht wieder, Und nach dem Feste kommt dann Ostern! Doch das ist gar nicht wahr, Denn nach Weihnachtsfeste kommt Frau Fasta!«
Dies hörte der kleine Flüchtling so deutlich, so deutlich. Und die in dem alten Reigen verborgene Weisheit drang in den kleinen, genußsüchtigen Värmlandsbuben ein, drang ihm in jede Fiber, vermischte sich mit jedem Blutstropfen, sog sich ihm im Hirn und Mark fest. So ist es, so soll es sein. Zwischen Weihnachten und Ostern, den Festen der Geburt und des Todes, kommt die Fastenzeit des Lebens. Vom Leben soll man nichts begehren, es ist eine arme, freudenlose Fastenzeit. Man kann ihm nie glauben, wie es sich auch verstellt. Im nächsten Augenblicke ist es schon wieder häßlich und grau. Es kann nicht dafür, das Ärmste, es versteht es nicht besser!
Peter Nord fühlte sich beinahe stolz, daß er dem Leben sein tiefstes Geheimnis abgelauscht.
Er glaubte die gelbblasse Frau Fasta im Bettlergewande mit der Fastnachtsrute in der Hand über die Erde schleichen zu sehen. Und er hörte, wie sie ihn zähneknirschend anfuhr: »Du hast mitten in der Fastenzeit, die man Leben nennt, das Fest der Freude und der Heiterkeit feiern wollen. Dafür sollst du in Schimpf und Schande leben, bis du dich gebessert hast.«
Doch er hatte sich gebessert, und Frau Fasta war seine Beschützerin geworden. Er hatte nicht weiter als bis in die große Handelsstadt zu fliehen brauchen, denn er war gar nicht verfolgt worden. Und dort hatte Frau Fasta ihren festen Wohnsitz im Arbeiterviertel. Peter Nord fand in einer Maschinenfabrik Beschäftigung. Er wurde stark und energisch, ernst und sparsam. Er hatte feine Sonntagskleider, vermehrte seine Kenntnisse, lieh sich Bücher und hörte populärwissenschaftliche Vorträge. Von dem kleinen Peter Nord waren nur noch die braunen Augen und das Flachshaar da.
Jene Nacht hatte etwas in ihm geknickt, und die schwere Fabrikarbeit hatte den Bruch noch erweitert, so daß der närrische Värmländer hatte ganz herauskriechen können. Er schwatzte keinen Unsinn mehr, denn in der Fabrik, wo das Reden verboten war, hatte er schweigen gelernt. Er machte keine Erfindungen mehr, denn, seit er sich ernstlich mit Federn und Rädern beschäftigte, machten sie ihm keinen Spaß mehr. Er verliebte sich nicht, denn seit er die Schönheiten der kleinen Stadt kennen gelernt, vermochten die Frauen des Arbeiterviertels ihn nicht mehr zu interessieren. Er hatte keine Mäuse mehr, kein Eichhörnchen, nichts, womit er spielen konnte. Er hatte keine Zeit dazu, er wußte, daß Spielen nicht nützlich ist, und er gedachte mit Entsetzen an die Zeit, da er sich mit den Gassenbuben prügelte.
Peter Nord glaubte nicht, daß das Leben anders als grau, grau, grau sein könnte. Er langweilte sich stets, war aber so daran gewöhnt, daß er es selbst nicht merkte. Peter Nord war stolz darauf, daß er so tugendhaft geworden war. Er datierte seine Erhebung von der Nacht, da der Frohsinn ihn treulos verließ und Frau Fasta seine Begleiterin und Freundin wurde.
Doch wie konnte der tugendhafte Peter Nord in Begleitung dreier versoffener, zerlumpter Strolche mitten an einem Werktage in die kleine Stadt kommen?
Er war trotz alledem doch stets ein guter Junge gewesen, der arme Peter Nord. Den drei Strolchen hatte er stets nach besten Kräften zu helfen versucht, obwohl er sie verachtete. Er hatte ihnen Brennholz in ihr elendes Loch gebracht, wenn der Winter am kältesten war, und ihnen die Kleider gestopft und geflickt. Die drei Kerle hielten wie Brüder zusammen, hauptsächlich darum, daß sie alle drei Peter hießen. Der Name vereinte sie fester, als wenn sie Geschwister gewesen wären. Und um dieses Namens willen ließen sie sich die Freundschaftsdienste des Knaben gefallen, und wenn sie abends in bequemer Stellung auf ihren Holzschemeln ihren Kaffee mit Branntwein schlürften, unterhielten sie ihn mit Galgenhumor und erlogenen Abenteuern, während er die handgroßen Löcher ihrer Strümpfe stopfte. Das machte Peter Nord Spaß, obgleich er es nicht eingestehen wollte. Die drei Kerle waren ihm nun beinahe dasselbe, was ihm früher die Mäuse gewesen.
Da begab es sich, daß den Strolchen das Gerede aus der kleinen Stadt zu Ohren kam, und nun, nach Verlauf von sechs Jahren, teilten sie Peter Nord mit, daß Halfvorson ihm den Fünfzigkronenschein hingelegt, um ihn als Zeugen unschädlich zu machen. Und ihre Meinung war, daß Peter in die kleine Stadt ziehen und Halfvorson durchprügeln müsse.
Peter Nord aber war klug und besonnen und mit der Weisheit dieser Welt ausgerüstet. Auf solche Streiche wollte er sich durchaus nicht einlassen.
Die drei Peter brachten die Geschichte im ganzen Arbeiterviertel herum, und alle Menschen sagten: »Peter Nord, prügle Halfvorson durch, damit du ins Loch kommst und eine Untersuchung eingeleitet wird. Kommt die Sache vor Gericht und in die Zeitungen, so ist der Kerl im ganzen Lande unmöglich gemacht.«
Doch Peter Noid wollte nicht. Es wäre freilich ein Spaß, aber Rache ist ein teures Vergnügen, und Peter Nord wußte, wie arm das Leben ist. Das Leben kann sich solche Späße nicht erlauben.
Da waren die drei Strolche eines Morgens zu ihm gekommen und hatten gesagt, sie wollten statt seiner hingehen und Halfvorson eine Tracht Prügel geben, damit »es auf Erden gerecht zugehe«.
Und Peter hatte versprochen, sie alle drei totzuschlagen, wenn sie nur einen Schritt nach der kleinen Stadt gingen.
Da hielt der eine, der klein und untersetzt war und der lange Peter hieß, Peter Nord eine Rede.
»Diese Erde«, sagte er, »ist ein Apfel, der an einem Faden über einem Feuer hängt und gebraten werden soll. Mit dem Feuer meine ich die Hölle, Peter Nord, und der Apfel muß über dem Feuer hängen, um weich und süß zu werden. Doch wenn der Faden reißt und der Apfel ins Feuer fällt, so ist er verdorben. Deshalb kommt es hauptsächlich auf den Faden an, Peter Nord. Weißt du, was ich mit dem Faden meine?«
»Ein Drahtseil, glaube ich,« antwortete Peter Nord.
»Mit dem Faden meine ich die Gerechtigkeit,« fuhr der lange Peter mit düsterem Ernst fort, »wenn es auf Erden keine Gerechtigkeit gibt, geht alles zugrunde. Deshalb darf der Rächer sich seinem Strafamte nicht entziehen, und weigert er sich, so müssen andere an seiner Stelle gehen.«
»Euch spendiere ich keinen Branntweinkaffee wieder,« sagte Peter Nord, auf den die Rede keinen Eindruck gemacht zu haben schien.
»Ja, das hilft dann nicht,« erwiderte der lange Peter. »Gerechtigkeit muß geübt werden.«
»Wir tun es nicht, um deinen Dank zu verdienen, sondern damit der ehrliche Petername nicht in Verruf komme,« sagte der zweite, der groß und mürrisch war und Walzenpeter hieß.
»Steht der Name in so hohem Ansehen?« fragte Peter Nord in verächtlichem Tone.
»Ja, und es ist uns unangenehm, daß nun in allen Wirtshäusern gesagt wird, du hättest den Fünfzigkronenschein wohl zu stehlen beabsichtigt, da du den Krämer nicht zur Verantwortung ziehen willst.«
Das Wort traf. Peter sprang auf und sagte, nun wolle er den Kaufmann durchprügeln.
»Ja, wir kommen mit und helfen dir!« riefen die Strolche.