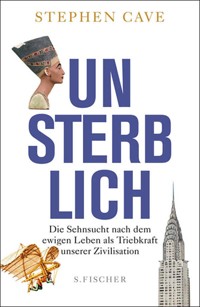
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Nicht nur die Mächtigen, Kaiser, Pharaonen und Päpste, wollen unsterblich sein, sondern in jedem von uns steckt die Sehnsucht nach dem ewigen Leben. Dieses Streben hat erstaunliche Kunstwerke, reiche religiöse Traditionen und den bewundernswerten Fortschritt der Wissenschaften hervorgebracht. Sein Ergebnis ist die menschliche Zivilisation. Vier Wege hat der Philosoph und Journalist Stephen Cave ausgemacht, von denen wir uns seit Jahrtausenden das ewige Leben erhoffen: durch die Wiederauferstehung des Körpers oder die Himmelfahrt der Seele, durch die Ausdehnung des Lebens via Medizin und Magie oder durch ein Vermächtnis. Mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen untersucht Stephen Cave die entscheidende Frag, ob wir so tatsächlich unserer Endlichkeit entkommen können. Anregend, elegant und unterhaltsam offenbart er die verborgenen Triebkräfte unserer Kulturen – eine neue Sicht auf den ältesten Traum der Menschheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Stephen Cave
Unsterblich
Die Sehnsucht nach dem ewigen Leben als Triebkraft unserer Zivilisation
Aus dem Englischen von Michael Bischoff
Fischer e-books
Vorwort
Dieses Buch handelt vom Leben, vom Tod und von der Zivilisation.
Wie alle Lebewesen haben wir das Bedürfnis, das Leben endlos fortzusetzen. Aber als einziges Lebewesen haben wir durch dieses Streben spektakuläre Zivilisationen hervorgebracht mit erstaunlichen Kunstwerken, reichen religiösen Traditionen und den bewundernswerten Errungenschaften der Wissenschaft. All das tun wir, um dem Tod zu entkommen.
In diesem Buch möchte ich zeigen, dass wir seit jeher vier Wegen folgen, die ewiges Leben verheißen. Auf diesen Reisen, so lege ich dar, haben wir unsere Zivilisationen erschaffen. Ferner werde ich fragen, ob diese vier Wege ihr versprochenes Ziel erreichen – und was die Antwort für unser Leben hier und jetzt bedeutet.
Thukydides hat gesagt, Geschichte sei Philosophieunterricht an Beispielen. Ich bin von meiner Ausbildung her Philosoph, aber ich stütze mich hier auch auf zahlreiche historische Beispiele – und auf Erkenntnisse aus vielen anderen Fachgebieten, von der Anthropologie bis hin zur Zoologie. Die Universitäten mögen die Welt säuberlich in Fachgebiete und Fakultäten einteilen, das Leben tut dies nicht. Bei solchen Exkursionen in fremde Fachgebiete habe ich mich bemüht, weitestgehend der Mehrheitsmeinung zu folgen – allerdings scheue ich mich auch nicht, selbst Stellung zu beziehen, wenn meine Argumentation dies verlangt.
Mir ist durchaus klar, wie unbescheiden es ist, umfassende Thesen über so große Dinge aufzustellen. Fachleute werden die Stirn runzeln angesichts meiner Vereinfachung komplexer und teilweise schon sehr alter Debatten. Aber es war von Anfang an meine Absicht, das Buch kurz und knapp zu halten, und ich hoffe, meine Analyse der Unsterblichkeit wird zumindest einige Leser anregen, Gedankengänge, auf die ich nur kurz hinweisen konnte, weiterzuverfolgen.
Stephen Cave im Oktober 2011
Erstes KapitelDie Schöne ist gekommen: Vier Wege zur Unsterblichkeit
Sie versuchten, sie zu vernichten. Mit Hämmern zertrümmerten sie ihre vornehme Nase und ihren langen, anmutigen Hals. Im ganzen Reich zerschlug man die Statuen und Büsten der Großen Königin zu Staub. Ihr Name wurde mit dem Meißel aus dem Stein der Monumente getilgt, die Nennung ihres Namens verboten.
Der Urteilsspruch sollte für die Ewigkeit Bestand haben. Kein Kult sollte ihr Grab hüten und ihre Seele mit Weihrauch und Opfergaben am Leben erhalten. Man konservierte sie nicht in Würde, so dass sie im Jenseits weiter hätte herrschen können. Ihre kurze Dynastie wurde ausgelöscht. Indem der neue Pharao sie systematisch aus der Geschichte tilgte, säuberte er Ägypten nicht nur von ihren Ideen und Einflüssen – er überantwortete sie auch ganz bewusst dem ewigen Vergessen. So glaubte er jedenfalls.
Dreitausendzweihundertdreißig Jahre später eilte Ludwig Borchardt, ägyptologischer Attaché am Deutschen Generalkonsulat in Kairo, über eine staubige Ebene. Sein junger Assistent wartete bereits ungeduldig am Zugang zu einem der vielen Grabungsschächte. Er erklärte ihm, man habe die Überreste eines vergrabenen Hauses entdeckt. Es sei offenbar einst stattlich gewesen, doch Diebe und Zeit hätten kaum etwas von Wert hinterlassen. Dann aber sei ein Arbeiter, der tausende Jahre Schutt und Trümmer beiseiteräumte, auf ein Stück Wand gestoßen, das offenbar hastig zugemauert worden war. Die uralten Ziegel hätten unter dem Druck seines Meißels nachgegeben und seien in ein schwarzes Loch dahinter gefallen.
Borchardt kletterte in den Graben und tastete sich durch Staub und Dunkelheit zu der geheimen Kammer. Als er die von dem Arbeiter geöffnete Mauer erreichte, stieg er vorsichtig über die zerbrochenen Ziegel. Er hielt eine Fackel in den kleinen Raum, schaute hinein – und erstarrte. Reihen steinerner Köpfe blickten ihn an wie Geister, aufgereihte schimmernde Gesichter, jedes einzigartig, jedes vollkommen realistisch dargestellt mit allen Spuren der Zeit – eine zerfurchte Stirn, ein faltenreiches Lächeln. Es war, als hätten sich diese antiken Menschen dort versammelt, um eine Botschaft aus dem Jenseits zu übermitteln.
Dann sah er sie: auf dem Boden, von einem herabgestürzten Sims halb verdeckt. Mit bloßen Händen schob Borchardt die Trümmer beiseite, um sie herauszuziehen. Dann hielt er sie in den Schein der Fackel und wurde nach mehr als dreitausend Jahren der erste Mensch, der Nofretetes ganze Schönheit erblickte.
Als Borchardt am Abend dieses 6. Dezember 1912 wieder in seinem Büro war, schrieb er in sein Tagebuch: »Arbeit ganz hervorragend. Beschreiben nützt nichts, ansehen.« Dann begann er darüber nachzudenken, wie er die Große Königin mit nach Hause zu seinem Kaiser nehmen konnte.
Die vier Wege
Alles Lebendige strebt danach, sein Leben in die Zukunft hinein zu verlängern, doch nur der Mensch sucht nach seinem ewigen Bestand. Dieses Streben – der Wunsch nach Unsterblichkeit – ist die Grundlage aller menschlichen Errungenschaften – der Ursprung der Religion, die Muse der Philosophie, der Baumeister unserer Städte und die treibende Kraft hinter der Kunst. Es gehört zu unserer Natur und bildet den Ausgangspunkt dessen, was wir Zivilisation nennen.
Trotz der gewaltigen Größe der altägyptischen Monumente unterschied sich das Streben nach dem ewigen Leben am Nil ansonsten nicht von den entsprechenden Bestrebungen aller anderen Gesellschaften der Antike wie der Neuzeit, im Osten wie im Westen. Der Traum eines wie auch immer gearteten endlosen Lebens ist ein universelles menschliches Merkmal, über alle Zeiten und Kulturen hinweg, und treibt uns heute noch zu Leistungen, die selbst die Pyramiden übertreffen.
In diesem Buch möchte ich drei Dinge tun. Erstens will ich zeigen, dass die scheinbare Vielfalt der Geschichten über den Zugang zur Unsterblichkeit sich auf nur vier Grundformen zurückführen lässt – die vier Unsterblichkeitserzählungen, wie ich sie nennen möchte. Alle Bemühungen um ein ewiges Leben, die jemals unternommen wurden oder auch in Zukunft unternommen werden, lassen sich einem dieser vier Wege zuordnen. Von Ägypten bis China, von New York bis Neu-Delhi folgen die Menschen auch heute noch diesen Erzählungen, wie sie es von jeher getan haben, in dem Glauben, sich vom Tod befreien zu können. Wir können sie uns als vier Wege vorstellen, die auf den mythischen Berg der Unsterblichen führen.
Die vier Erzählungen sind Reaktionen auf Grundkonstanten der conditio humana. Auch wenn diese alle eint, beweisen die verschiedenen Kulturen einen enormen Einfallsreichtum in ihrem Umgang damit: reiche religiöse Traditionen, Sagen und Mythen sowie Kunst und Wissenschaft. Sie sind eine beständige Quelle der Inspiration, der Innovation und der Kreativität. Diese Wege kanalisieren unseren elementarsten Trieb – weiterzuleben. Dennoch haben sie uns zu den höchsten intellektuellen, religiösen und künstlerischen Leistungen geführt. Deshalb möchte ich in diesem Buch zweitens zeigen, inwiefern dieses Streben zu unseren Zivilisationen geführt hat – Institutionen, Rituale und Überzeugungen, die das menschliche Dasein zu dem machen, was es ist.
Die vier Wege weisen zwar auf den Gipfel des ewigen Lebens, doch führen sie auch tatsächlich dorthin? Der Gipfel liegt über den Wolken, und wer ihn erreicht, kehrt nicht zurück, so dass er davon berichten könnte. Doch sind wir heute weitaus besser in der Lage als unsere Vorfahren, zu erkunden und zu klären, ob einer der Wege sein Ziel erreicht. Die moderne Wissenschaft bietet uns neue Einsichten in den Ursprung des Lebens und das Ende des Universums. Auf der Suche nach der Seele können wir einen Blick ins Gehirn werfen, und wir entwickeln neue Technologien, die einen Sieg über das Altern versprechen. Deshalb soll dieses Buch drittens die neuesten Erkenntnisse nutzen, um zu prüfen, welche dieser vier Erzählungen auch wissenschaftlich haltbar sind.
Obwohl die vier Wege viele Geheimnisse menschlichen Verhaltens zu erklären vermögen, sind sie doch auch intuitiven und unmittelbaren Charakters. Der erste entspringt ganz direkt unseren Instinkten. Wie alle Lebewesen versuchen wir, den Tod zu vermeiden. Der Traum, dies – physisch und in dieser Welt – auf ewig zu schaffen, ist die elementarste Unsterblichkeitserzählung. Ich möchte diesen ersten Weg ganz schlicht als Weiterlebenserzählung bezeichnen. Das klingt nicht gerade vielversprechend und vielleicht sogar absurd angesichts der Alltäglichkeit von Tod und Zerfall. Doch dieser Weg ist sehr weit verbreitet. In fast allen Kulturen finden sich Legenden von Weisen, von Helden eines Goldenen Zeitalters oder von Bewohnern entlegener Gebiete, die das Geheimnis eines Sieges über Altern und Tod gefunden haben sollen.
Diese Erzählung ist in Wirklichkeit nicht mehr als die Fortführung unseres Bemühens, jung und gesund zu bleiben oder ein wenig – ein oder zwei oder zehn Jahre – länger zu leben. Der erste Schritt auf diesem Weg ist die Befriedigung unserer körperlichen Bedürfnisse wie der nach Nahrung oder physischer Unversehrtheit, Medizin und Hygiene sind der zweite. Doch die meisten Zivilisationen versprechen sehr viel mehr als bloß ein Altern in Sicherheit. Sie nähren die Hoffnung auf ein Elixier, das Krankheit und Demenz vollständig besiegt. Dank dieses Versprechens haben Religionen wie der Taoismus und esoterische Kulte wie der des Heiligen Grals zahlreiche Anhänger gewonnen. Aber niemals wurde es so häufig gegeben wie heute. Schon die Idee des wissenschaftlichen Fortschritts basiert auf dem Gedanken einer stetigen Verlängerung der Lebenserwartung. Und zahlreiche angesehene Wissenschaftler und Ingenieure glauben, dass wir an der Schwelle zu einer neuen Langlebigkeit stehen.
Doch alles auf das Versprechen des Weiterlebens zu setzen wäre eine riskante Strategie, denn die bisherigen Erfolge sind nicht gerade berauschend. Deshalb bietet der zweite Weg einen Ersatzplan, der vorsieht, dass wir im Falle unseres Todes dennoch ein zweites Mal leben können. Das ist die Auferstehungserzählung, der Glaube, dass wir zwar physisch sterben müssen, aber dennoch mit dem Körper auferstehen könnten, den wir im Leben besessen haben.
Die Hoffnung auf eine Auferstehung ist zwar nicht so elementar wie das Bemühen, einfach nur weiterzuleben, aber sie wurzelt gleichfalls in der menschlichen Natur. Wir sehen Jahr für Jahr die Natur im Winter vergehen und im Frühjahr neu erblühen. Milliarden von Menschen in aller Welt feiern diesen Triumph des Lebens über den Tod in Frühlingsfesten wie Ostern. Obwohl sich viele Anhänger der drei großen monotheistischen Religionen nicht immer darüber bewusst sind, glauben Judentum, Christentum und Islam an die buchstäbliche physische Auferstehung – eine Überzeugung, die zu den zentralen Lehren dieser Religionen gehört und bei ihren Erfolgsgeschichten eine entscheidende Rolle spielte.
Doch ebenso wie diese alten Überlieferungen erfreuen sich gewisse Abwandlungen des Auferstehungsglaubens auch bei solchen Menschen wachsender Beliebtheit, die ihre Hoffnung eher auf Technologien als auf Götter setzen. Eine neue Spur dieses Weges ist die Kryonik, die Menschen dazu verleitet, sich nach ihrem Tod einfrieren zu lassen, in der Hoffnung, eines Tages »repariert« und wiederbelebt zu werden. Und dank rascher technologischer Fortschritte gibt es inzwischen Angebote, die noch stärker auf Hightech-Verfahren setzen, etwa die Möglichkeit, den Inhalt unserer Psyche auf Computer und von dort wiederum auf einen neuen Körper oder einen digitalen Avatar zu übertragen.
Manche sind allerdings gar nicht darauf erpicht, ihren Körper im nächsten Leben zurückzuerhalten, nicht einmal in digitaler Form. In ihren Augen ist die materielle Welt allzu unzuverlässig, als dass sie ein ewiges Leben zu garantieren vermöchte. Sie glauben daher an ein Überleben in Gestalt einer spirituellen Entität, einer Seele. Das ist der dritte Weg. Die Mehrzahl der heute auf Erden lebenden Menschen glaubt, eine Seele zu besitzen. Es ist der vorherrschende Glaube im Christentum und spielt auch im Hinduismus, im Buddhismus und in vielen anderen Religionen eine zentrale Rolle.
Die Anhänger der Seelenerzählung haben den irdischen Bezugsrahmen, d.h. der Auferstehung ihrer selbst, weitgehend aufgegeben und glauben an eine Zukunft eher spirituellen Charakters. Dieser Glaube ist zwar weniger stark in der Natur verwurzelt, gründet aber gleichfalls in der Intuition. In Träumen und mystischen Erfahrungen hatten Menschen seit langer Zeit schon das Gefühl, ihren Körper zu verlassen. Viele haben den Eindruck, die Seele oder der Geist könnten sich von dem Körper, in dem sie wohnen, trennen – und daher auch ohne ihn überleben.
Die Idee der Seele blüht zwar sowohl im Osten als auch im Westen, doch es gibt viele, die an der Existenz einer Seele zweifeln, vor allem Menschen, die materialistisch ausgerichtet sind. Aber auch sie können Trost in der wohl am weitesten verbreiteten Erzählung finden, der Vermächtniserzählung. Dieser vierte Weg bedarf weder eines Überlebens des physischen Körpers noch einer immateriellen Seele, vielmehr geht es um eine eher indirekte Projektion in die Zukunft hinein.
Ruhm und Unsterblichkeit wurden schon in der Antike miteinander assoziiert, und seither sind viele Menschen dem Beispiel des griechischen Helden Achill gefolgt, der auf dem Schlachtfeld vor Troja ewigen Ruhm einem langen Leben vorzog. Die Griechen glaubten, die Kultur besitze eine Dauer und Solidität, die der Biologie abgehe. Ewiges Leben winke daher dem Helden, der sich einen Platz in der kulturellen Sphäre zu sichern vermochte. Heute scheinen wir ebenso auf Berühmtheit erpicht zu sein wie Achill einst auf Ruhm. Der Wettstreit um einen Platz in der kulturellen Sphäre geht unvermindert heftig weiter.
Einige von uns hinterlassen ein greifbareres Vermächtnis als Ruhm und Ansehen, nämlich Kinder. Unsere Gene gelten als unsterblich, weil sie sich über Millionen von Jahren auf die allerersten Anfänge des Lebens zurückführen lassen, und wenn wir Glück haben, werden sie auch in ferner Zukunft noch vorhanden sein. Oder vielleicht liegt unser Vermächtnis, wie manche glauben, auch darin, dass wir einst Teil des Lebens auf Erden gewesen sein werden – ein Teil von Gaia, dem Superorganismus, der auch dann noch existieren wird, wenn wir als Individuen längst verschwunden sind, oder sogar Teil des sich entfaltenden Kosmos.
Diese vier Erzählungen zeigen sich in vielen verschiedenen Formen, von antiken Mythen bis hin zu politischen Manifesten, doch zumindest eine von ihnen findet sich in jeder Kultur. Manche Zivilisationen folgen über Tausende von Jahren demselben Weg. Andere wenden sich von einem Weg ab und einem anderen zu. Aber keine Zivilisation hat ohne einen der vier Wege überlebt. Jede von ihnen hat ihre Unsterblichkeitserzählungen, die sich alle einem der vier Wege zuordnen lassen.
Heute konkurrieren die vier Wege auf dem Markt der Glaubensüberzeugungen. Einige sehen sich dort um, bevor sie sich für einen Weg entscheiden, andere folgen jeweils der neuesten Mode, während die meisten genau das machen, was ihre Eltern gemacht haben. Doch ob wir uns dessen nun bewusst sind oder nicht, die große Mehrheit folgt einem oder mehreren dieser Wege.
Der Sonnenuntergang des Aton
Im Verlaufe dieses Buchs werden wir vielen Beispielen begegnen, die eine der vier Erzählungen am Werk zeigen. Doch es gibt keinen besseren Ausgangspunkt als die Ufer des Nils, denn dort erreichte das Streben nach Unsterblichkeit eine beispiellose Perfektion und Pracht. Die Zivilisation des alten Ägypten überdauerte nahezu unverändert gut dreitausend Jahre. Und selbst nach der Eroberung Ägyptens – zuerst durch die Perser, dann durch die Armeen Alexanders des Großen und schließlich, nach Kleopatras berühmtem Selbstmord, durch die Römer – übte sie weiterhin einen gewaltigen kulturellen und religiösen Einfluss aus. Bei Griechen und Römern stand Ägypten für uralte Weisheit. Man hatte das ausgeprägte Gefühl, die Ägypter hätten zu einer Wahrheit gefunden, nach der andere Kulturen noch mühevoll suchten.
Das ägyptische Pantheon ging erst endgültig unter, als die römischen Eroberer sich 380 n.Chr. massenhaft einem anderen Unsterblichkeitssystem zuwandten – dem Christentum, das dann wenige Jahrhunderte später in Ägypten von einem engen Verwandten, dem Islam, verdrängt wurde. Diese Dauerhaftigkeit und Attraktivität verdankte das ägyptische Weltbild seiner vollkommenen Unsterblichkeitserzählung. Und diese Erzählung war zum Teil deshalb so eindrucksvoll, weil sie in ihrer lebenssprühenden Mythologie alle vier Grundformen zu einer einzigen Erzählung verwob. Wie schon angemerkt, sind auch heute noch alle vier Erzählungen präsent – allerdings als Alternativen und nicht als einheitliche Geschichte. Auch in anderen Kulturen finden sich alle vier Erzählungen, doch dort stehen eine oder zwei von ihnen im Vordergrund. Nur im alten Ägypten verband man alle vier zu einer einzigen verführerischen Geschichte. Sie ist ein Beispiel für die religiöse Phantasie des Menschen und für eine allseitige Absicherung des Weges zur Unsterblichkeit.
Deshalb traf Haremhab – der Pharao, der sich daranmachte, Nofretete zu vernichten – alle erdenklichen Vorkehrungen. Die alten Ägypter konnten auf allen vier Wegen versuchen, ihre natürliche Lebenszeit zu verlängern. Obwohl sie vor allem für ihre kunstvolle Einbalsamierungstechnik berühmt sind, waren sie doch auch sehr darauf bedacht, den elementarsten Weg zu gehen und zunächst einmal weiterzuleben. Sie verfügten über ein hochentwickeltes System aus Medizin und Magie, das Alter und Krankheit fernhalten sollte. Kräuter, Zaubersprüche und Amulette sollten deren Anwender und Träger so lange wie möglich und bevorzugt auf ewig am Leben erhalten – in zahlreichen Papyri geht es in erster Linie um die Verlängerung des Lebens und eine Umkehrung des Alterns. Trotz der vielen Darstellungen, die farbenprächtig zeigen, wie man das Beste aus dem Tod macht, war das Weiterleben doch weitestgehend Plan A.
Da diese Taktik ganz offensichtlich ihre Grenzen hatte, setzte man seine Hoffnung in die Auferstehungserzählung. Die alten Ägypter unternahmen gewaltige Anstrengungen, um Leichen fachgerecht zu konservieren, in dem Glauben, sie eines Tages auf magischem Wege wiederbeleben zu können. Dieser Aufgabe widmete sich eine riesige Industrie, die man den Priestern anvertraute. Sie ließen die Körperflüssigkeiten ab, entfernten die weichen Organe, um sie gesondert zu präparieren, und entzogen der Leiche schließlich mit Natron, einem natürlich vorkommenden Salz, alle Feuchtigkeit. Dann stopften sie den Körper mit Tüchern und Sägemehl aus und umwickelten ihn mit Hunderten von Metern Leinen, das gelegentlich zur Abdichtung mit Harz oder Bitumen getränkt war (so entstand die Bezeichnung »Mumie«, die von dem persischen Wort für Bitumen, »mum«, abgeleitet ist).
Die Bedingungen bei der Präparierung waren alles andere als steril – so hat man in den Leinenbandagen Maden, Käfer und sogar Mäuse gefunden. Und die Priester waren durchaus nicht immer vertrauenswürdig. Wie der griechische Historiker Herodot berichtete, übergab man die Leichen junger Frauen den Einbalsamierern erst, wenn die Verwesung bereits begonnen hatte, um zu verhindern, dass sie ihre Privilegien missbrauchten. Der ganze Vorgang dauerte siebzig Tage und gipfelte in der Zeremonie des »Mundöffnens«, in der man den Verstorbenen auf magischem Wege wiederbelebte (auch wenn sich dessen Handlungsfähigkeit natürlich auf das Jenseits beschränkte). Die Pyramiden – die nur in einer kurzen, relativ frühen Phase der ägyptischen Geschichte errichtet wurden, da sich zeigte, dass sie allzu viel Anziehungskraft auf Grabräuber ausübten – wurden an den Stellen erbaut, an denen man das Jenseits angesiedelt glaubte, damit deren Bewohner auf kürzestem Wege dorthin gelangen konnten.
Doch die alten Ägypter legten ihre Hoffnungen nicht nur in den Körper. Sie besaßen auch eine Version der dritten Erzählung, der Seele. Wie viele andere Völker der Antike glaubten sie an mehrere Seelen, deren wichtigste ka, die Lebenskraft, war. Sie wurde dem Menschen im Augenblick seiner Geburt von den Göttern eingehaucht und befähigte ihn, Kinder hervorzubringen – so etwas wie sexuelle Potenz oder das von Bluessängern so genannte »Mojo«. Nach dem Tod lebte ka in der Mumie fort und benötigte eine beständige Versorgung mit Nahrung. Deshalb war es ganz entscheidend, dass Freunde und Verwandte Speisen an das Grab des Verstorbenen brachten, von denen ka sich ernähren konnte – wobei natürlich nur die spirituellen Bestandteile dieser Nahrung aufgenommen wurden und nicht die materiellen, die man großzügig den Priestern überließ.
Wie wir gesehen haben, bestand die vernichtendste Strafe darin, den oder die Verstorbene aus der Geschichte zu tilgen – die Römer bezeichneten dies als damnatio memoriae. Schließlich maßen auch die alten Ägypter der vierten Erzählung, dem Vermächtnis, entscheidende Bedeutung für das Überleben bei. In ihren Augen gehörten Name und Ansehen zu den elementaren Bestandteilen eines Menschen. Wenn er in der nächsten Welt ein volles Leben führen soll, müssen auch sie bewahrt werden. Deshalb unternahmen die Ägypter große Anstrengungen, um den eigenen Namen lebendig zu erhalten. Sie schrieben ihn, wie es heute Graffitisprayer tun, auf nahezu alles, was sich finden ließ – von Grabwänden über Gefäße bis hin zu Kämmen. Vor allem aber erwarteten sie, dass Freunde und Verwandte ihrer gedachten und ihre Namen priesen, wenn sie ihrem ka Speisen brachten. Solange der Name noch genannt wurde und die Monumente noch standen, lebte, so glaubten sie, zumindest ein Teil noch fort.
Wenn all diese Komponenten zusammenkamen, erwartete die alten Ägypter ein glorreiches und ewiges zweites Leben. Wurden sie dagegen zerstört, vernachlässigt oder vergessen, war der Verstorbene zu endgültiger Auslöschung verdammt – zu jenem »zweiten Tod«, den alle Ägypter fürchteten. Das war die Strafe, die Haremhab über Nofretete und ihren Mann, den Pharao Echnaton, verhängte. Für welches Verbrechen? Sie hatten das alte ägyptische Unsterblichkeitssystem für sich allein beansprucht.
Als der Archäologe Ludwig Borchardt Nofretete im Wüstenboden entdeckte, erblickte er eine lebensgroße Büste der Großen Königin in ihren besten Jahren. Ihr langer, schlanker Hals erhebt sich über einem äußerst fein herausgearbeiteten Halsband. Ihre Lippen sind voll, ihre Augen groß und mit verführerischem Lidstrich nachgezeichnet. Ihr Gesicht ist eingerahmt von einer einzigartigen blauen Krone, die die Linie ihrer Wangen und Schläfen fortsetzt. Sie strahlt Autorität und Selbstbewusstsein aus. Sie wirkt zugleich entschlossen und rätselhaft. Es ist ein Bild der Macht und der Schönheit, das heute noch ebenso kraftvoll wirkt wie vor mehr als dreitausend Jahren, als die Büste geschaffen wurde.
Damals um 1380 v.Chr. besaß sie eine Stellung und einen Einfluss, wie sie in der langen Geschichte Ägyptens noch keine Frau besessen hatte. Nofretete, deren Name »Die Schöne ist gekommen« bedeutet, war nicht nur die Große Königin des Pharao, seine Hauptfrau und Mutter von sechs gemeinsamen Töchtern – sie war ihm ebenbürtig. Zeitgenössische Darstellungen zeigen sie neben ihm im Kampf, im Streitwagen und bei der Huldigung der Götter.
Der Pharao Echnaton war dagegen eine eher komische Figur, mit dürren Beinen und Kugelbauch – weit entfernt vom ägyptischen Ideal des breitschultrigen Kriegers. Als Oberhaupt des Staates und der Religion – beide untrennbar miteinander verbunden – fiel ihm in der Unsterblichkeitserzählung eine entscheidende Rolle zu: Man erwartete von ihm, dass er die Rituale und Zeremonien leitete, die den Kosmos im Gleichgewicht hielten, und dass er seinem Volk damit den Durchgang durch diese und den Übergang in die nächste Welt sicherte. Doch er und seine mutige, schöne Frau hatten andere Vorstellungen.
Anfangs vernachlässigten sie lediglich die übrigen Götter und bauten stattdessen gewaltige Tempel für den zuvor obskuren Gott Aton, der mit der Sonnenscheibe assoziiert wurde. Nach fünf Jahren auf dem Thron brachen sie jedoch vollständig mit den alten Traditionen, gaben die alte Hauptstadt Theben auf und gründeten eine neue, der sie den Namen Achetaton gaben – »Horizont des Aton«. Diese prachtvolle, innerhalb weniger Jahre auf einer staubigen Ebene errichtete Stadt war voll von Bildwerken, die Echnaton und Nofretete im Licht der Sonne badend zeigen, ihres Gottes, dessen Strahlen ihnen ein »Anch« reichen, das kreuzförmige Symbol ewigen Lebens. Darunter findet sich in Hieroglyphen die Inschrift: »Mögen sie ewig leben«. Aber auch das war noch nicht genug, und als sie erst in ihrem neuen Palast residierten, verkündeten sie, die alte Religion sei tot – es gebe keinen Gott außer Aton, und sie seien seine Propheten. Damit hatten sie den ersten bekannten Monotheismus der Weltgeschichte eingeführt, und sie selbst waren seine einzigen Botschafter auf Erden.
Das erschütterte Ägypten bis ins Mark. Alle guten Ägypter waren dazu erzogen worden, die zahlreichen Gottheiten zu achten, die alle Aspekte des Lebens am Nil beherrschten. Bei Krankheit wandten sie sich an die Göttin Isis, und sie dankten dem falkenköpfigen Gott Horus, der für die Sicherheit der ägyptischen Grenze sorgte. Sie beteten zu dem Mumiengott Osiris, damit er verstorbene Angehörige sicher ins Jenseits geleite. Für die bereits alte und konservative ägyptische Gesellschaft war diese Revolution weitaus dramatischer als die Reformation für das Christentum. Es war so, als erklärte der heutige Papst sich zur Inkarnation des Gottes Horus und tauschte den Vatikan gegen eine Residenz am Nil. Die einfachen Leute dürfte diese Gotteslästerung nicht nur mit Angst vor göttlicher Vergeltung erfüllt haben, sie mussten auch glauben, wenn die Tempel geschlossen und die alten Rituale verboten wurden, sei ihnen der Weg ins Jenseits versperrt.
Doch eine so mächtige und so tief in den Institutionen und Bräuchen der ägyptischen Zivilisation verwurzelte Erzählung wie die von den alten Göttern war nicht so einfach zu überwinden. Nach vierzehn Jahren an der Macht begannen die lebenden Verkörperungen des Aton eine nach der anderen zu verschwinden. Zuerst fielen drei ihrer Töchter einer Seuche zum Opfer. Dann verschwand, ganz plötzlich, Nofretete von der Bildfläche. Und zwei Jahre später verschwand auch Echnaton sang- und klanglos.
Doch ihre Dynastie war noch nicht vollständig am Ende. Eine ihrer Töchter wurde mit einem ihrer Halbbrüder verheiratet, dem neunjährigen Tutanchamun, einem Sohn Echnatons mit einer Nebenfrau. Gemeinsam durften diese Kinder weiterregieren, unter Leitung der alten Garde, der Priester und Generäle, die langsam alles zerstörten, was ihre Eltern geschaffen hatten. Man verlegte die Hauptstadt zurück nach Theben, öffnete wieder die Tempel und machte Aton zu einer Randfigur. Als dieser junge Pharao starb, folgte ihm für kurze Zeit ein betagter Berater, bevor Haremhab, der Oberbefehlshaber der Armee gewesen war, die Macht ergriff und alle Spuren des Häretikers und seiner Dynastie zu beseitigen begann. So ist es denn eine Ironie, dass dieser Pharao – Tutanchamun – dank der Entdeckung seines unversehrten Grabs heute bekannter ist als zu seinen Lebzeiten.
Wissenschaftler spekulieren über die Frage, was aus Nofretete und Echnaton wurde, doch wegen Haremhabs Zerstörungswerk sind nur wenige sichere Zeugnisse erhalten geblieben. Nach einer Theorie änderte Nofretete ihren Namen, um zunächst die vollwertige Mitregentin ihres Mannes zu werden und ihm dann als Alleinherrscherin zu folgen. Was Echnaton selbst betrifft, glauben manche Forscher, er sei außer Landes getrieben worden und habe im Exil weiterhin sein monotheistisches Credo gepredigt. Es ist, wie Sigmund Freud anmerkte, in der Tat erstaunlich, dass die Bibel von einem ägyptischen Prinzen berichtet, der um diese Zeit seine an den einen, wahren Gott glaubenden Anhänger aus Ägypten in ein Gelobtes Land führte.
Wir wissen nicht, wie Atons Herrschaft ihr Ende fand, ob durch eine blutige Rebellion, einen Giftmord oder durch subtileren Druck. Wir wissen nur, dass sie ihr Ende fand. Osiris bestieg wieder seinen Thron im Jenseits, und die Einbalsamierer machten sich wieder an ihr Werk. Die Stadt des Aton mit ihren Palästen und Tempeln wurde aufgegeben und versank wieder im Wüstensand.
Echnaton und Nofretete hatten gewagt, das Unsterblichkeitssystem zu usurpieren, das ihrem Volk Ordnung, Sinn und Hoffnung schenkte, und dieses System rächte sich an ihnen. Mit bemerkenswerter Geschwindigkeit heilte die altägyptische Gesellschaft ihre Wunden und machte sich wieder daran, die Vorbereitungen für das nächste Leben zu treffen – doch die Große Königin und ihr häretischer Gatte sollten auf ewig davon ausgeschlossen sein. Ihre Nachfolger taten ihre Arbeit so gründlich, dass für Jahrtausende niemand wusste, dass sie überhaupt existiert hatten. Die rachsüchtigen Priester müssen geglaubt haben, sie hätten Nofretete für immer vernichtet. Aber sie irrten sich. Denn unter dem Treibsand, der die Ruinen ihrer Stadt bedeckte, harrte sie aus.
Der Wille zum (ewigen) Leben
Wie der Psychiater und Historiker Robert Jay Lifton schreibt, »streben Gruppen immer kollektiv nach (einfachen oder gemischten) Unsterblichkeitsmodi, die sie endlos anpreisen«. Sie »kämpfen und sterben, um alle Rivalen auszuschalten, die ihre Unsterblichkeitssysteme bedrohen«. Das galt auch für Echnaton und Nofretete, die trotz all der Macht und des Reichtums des Königshauses von den mächtigen Strömungen des altägyptischen Unsterblichkeitssystems hinweggefegt wurden.
Aber was drängt uns überhaupt, solche Systeme zu schaffen und dann für sie zu kämpfen oder gar zu sterben? Die schiere Universalität der Unsterblichkeitserzählungen, ihre zentrale Bedeutung für nahezu alle Kulturen legt die Vermutung nahe, dass die Wurzel in der menschlichen Natur selbst liegt. In der Tat gründen sie tief in jener Natur, die wir mit allen Lebewesen teilen, in dem Trieb, zu überleben. Doch unter allen Tieren haben wir allein – zumindest soweit wir dies wissen – Religionen, künstlerische Traditionen und Ehrsysteme hervorgebracht, die diesen Trieb zum Ausdruck bringen und in elaborierte Erzählungen verwandeln. Der Grund liegt darin, dass wir Menschen mit unseren übergroßen Gehirnen ein ganz besonderes Verhältnis zu Leben und Tod entwickelt haben – ein Verhältnis, das zutiefst paradox ist.
Manche sind skeptisch, wenn sie erstmals die These hören, dem Drang nach Zivilisation liege ein Wille zur Unsterblichkeit zugrunde. Es klingt allzu metaphysisch, als dass dies der Instinkt sein könnte, der hinter unserem alltäglichen Handeln steht; allzu mystisch, als dass er das Verhalten eines Lebewesens erklären könnte, das sich aus den Affen entwickelt hat. Doch der Ursprung unserer Ewigkeitssehnsucht ist weder mystisch noch metaphysisch – im Gegenteil, nichts könnte natürlicher sein. Dass wir uns in die Zukunft projizieren wollen, ist eine direkte Folge unseres langen evolutionären Erbes.
Die entschiedene Ausrichtung auf Überleben und Fortpflanzung – auf eine Verlängerung in die Zukunft hinein – ist das Einzige, was alle Lebensformen gemein haben. Der gewaltigste Berg erduldet die Erosion ebenso passiv wie das kleinste Sandkorn am Meeresstrand. Aber selbst der winzigste Organismus kämpft mit allem, was er hat, gegen den Ansturm der Elemente und der Feinde – gegen den Abstieg in die Unordnung, die das Universum ansonsten kennzeichnet. Lebewesen sind an sich dynamische Systeme, die sich gegen jede Wahrscheinlichkeit selbst erhalten. Ob Hund, Wurm oder Amöbe, sie alle scheinen ständig nur um ein einziges Ziel zu kämpfen: weiterzumachen. Dieser Drang nach Fortbestand ist das Wesen des Lebens. Oder wie der Evolutionsbiologe Richard Dawkins schreibt: »Wir sind Überlebensmaschinen, aber mit dem Wort ›wir‹ sind nicht nur wir Menschen gemeint. Es umfasst alle Tiere, Pflanzen, Bakterien und Viren.«
In der modernen Biologie ist das inzwischen zu einem Gemeinplatz geworden: Selbsterhaltung und Fortpflanzung gehören zu jeder Definition von Leben. Der Prozess der Evolution durch natürliche Selektion macht klar, warum das so ist. In einer variantenreichen Population sind die Individuen, die überleben und sich fortpflanzen, jene, die ihre Gene an die nächste Generation weitergeben. Jede Katze, jeder Baum und jeder Mistkäfer, denen wir begegnen, existieren nur, weil ihre Vorfahren die besten waren, wenn es darum ging, sich selbst und ihre Nachkommen zu erhalten. Sich durch Überleben und Fortpflanzung erfolgreich in die Zukunft zu projizieren unterscheidet also Evolutionsgewinner von Evolutionsverlierern.
Das wird noch klarer, wenn man sich einen Augenblick das Gegenteil vorstellt: eine Lebensform, die sich gleichgültig gegenüber den eigenen Zukunftsaussichten verhielte. Die apathische Maus, die keine Anstrengung unternähme, um sich vor Schlangen und Eulen zu verstecken, würde rasch gefressen, und mit ihr stürben auch ihre Gene. Wir könnten solchen gleichgültigen Lebewesen niemals begegnen, weil ihre Gene gar nicht hätten überleben können. Ihre stets eifrigen Vettern dagegen, die alles taten, um zu überleben und die Welt mit ihren Nachkommen zu füllen, gaben ihre Gene weiter. Schon bald gab es auf der Welt nur noch Mäuse mit solch kämpferischem Geist. Die natürliche Selektion produziert Lebewesen, die ihren eigenen Fortbestand sichern.
Deshalb, so schreibt der Soziologe Raymond D. Gastil, »verhalten alle Lebensformen sich so, als wäre der zukünftige Fortbestand – Unsterblichkeit – das Hauptziel ihres Daseins«. Der führende Hirnforscher Antonio Damasio hat gezeigt, dass Bauchgefühle, komplexe Emotionen und ausgeklügelte kognitive Prozesse sämtlich direkt oder indirekt dem Ziel des Überlebens dienen. Der Anthropologe James Chisholm geht noch weiter und behauptet, all unser Werteverständnis ergebe sich aus diesem einzigen Ziel, der »komplexen Aktivität, derentwegen der Körper existiert: endlosem Fortbestand«.
Der Philosoph Arthur Schopenhauer nannte diesen Urtrieb einfach den »Willen zum Leben«. Da der Fortbestand jedoch nicht zeitlich begrenzt, sondern, wie Chisholm sagt, »endlos« ist, sollten wir besser von einem Willen zum ewigen Leben sprechen – oder vom Willen zur Unsterblichkeit.
Dieser Trieb vermag viel von dem, was wir tun, zu erklären, einschließlich eines großen Teils der Zivilisation. Die erste der vier elementaren Unsterblichkeitserzählungen – Weiterleben – ist einfach der Wille zum ewigen Leben in seiner grundlegenden Form, und Weiterleben ist etwas, in dem wir Menschen sehr gut sind, denn wir haben uns über den ganzen Erdball, über viele verschiedene Klimazonen und Lebensräume, ausgebreitet und erreichen dort eine für Säugetiere außergewöhnlich lange Lebensspanne. Doch die drei übrigen Unsterblichkeitserzählungen gehen weit über den tierischen Instinkt hinaus, vor Feuer zu flüchten oder Nahrung für den Winter zu horten – und manchmal laufen sie dem sogar zuwider. Obwohl auch hinter diesen Erzählungen der Wille zur Unsterblichkeit steht, sind sie nicht allein das Produkt von Merkmalen, die wir mit anderen Lebewesen gemein haben, sondern auch von solchen, die uns von ihnen trennen.
Das Sterblichkeitsparadoxon
Unsere Besonderheit liegt natürlich in unserem großen, hochgradig vernetzten Gehirn. Auch dieses Gehirn hat sich entwickelt, um uns bei der Sicherung eines endlosen Fortbestands zu helfen, und ist von gewaltigem Nutzen im Kampf ums Überleben. Das Bewusstsein unserer selbst, der Zukunft und alternativer Möglichkeiten versetzt uns in die Lage, uns anzupassen und sehr durchdacht zu planen. Aber dieses Bewusstsein ermöglicht uns auch eine Sicht unserer selbst, die zugleich erschreckend und verblüffend ist. Einerseits gelangt unser Verstand unausweichlich zu der Erkenntnis, dass wir wie alle Lebewesen um uns herum eines Tages sterben müssen. Andererseits vermag dieser Verstand sich genau diesen Zustand der Nichtexistenz nicht vorzustellen. Er ist buchstäblich unfassbar. Der Tod erscheint daher zugleich unausweichlich und unmöglich. Das bezeichne ich als das Sterblichkeitsparadoxon, und seine Lösung führt zu den Unsterblichkeitserzählungen und damit auch zur Zivilisation.
Beide Seiten des Paradoxons resultieren aus demselben Set eindrucksvoller kognitiver Fähigkeiten. Seit die Gattung Homo, aus der die direkten Vorfahren des modernen Menschen stammen, vor zweieinhalb Millionen Jahren erschien, hat sich unser Gehirnvolumen verdreifacht. Das führte zu einer Reihe wichtiger Innovationen im Bereich des Denkens. Erstens sind wir uns unserer selbst als gesonderter Individuen bewusst – eine Fähigkeit, über die nur eine Handvoll mit großen Gehirnen ausgestatteter Spezies verfügt und die als wesentliche Voraussetzung für komplexe soziale Interaktionen gilt. Zweitens besitzen wir eine ausgeprägte Vorstellung von der Zukunft, die es uns ermöglicht, vorauszudenken und unterschiedliche Pläne zu fassen – gleichfalls eine Fähigkeit, die sich bei den allermeisten anderen Arten nicht findet (eine der seltenen Ausnahmen ist ein Schimpanse im schwedischen Furuvik, der nachts Steine sammelt, um sie am folgenden Tag auf Zoobesucher zu werfen). Und drittens können wir uns verschiedene Szenarien vorstellen, mit Möglichkeiten spielen und aus Erlebtem Verallgemeinerungen ziehen, so dass wir in der Lage sind, zu lernen, Schlüsse zu ziehen und zu extrapolieren.
Die Vorteile, die solche Fähigkeiten für das Überleben bieten, liegen auf der Hand. Von Mammutfallen bis hin zu Supermarkt-Zulieferketten vermögen wir zu planen, zu koordinieren und zu kooperieren, um die Befriedigung unserer Bedürfnisse sicherzustellen. Doch diese Fähigkeiten haben ihren Preis. Wenn man eine Vorstellung von sich selbst und von der Zukunft besitzt und wenn man das Gesehene zu extrapolieren und zu verallgemeinern vermag, dann erkennt man, wenn man sieht, wie ein Gefährte von einem Löwen getötet wird, dass man selbst ebenfalls von einem Löwen getötet werden könnte. Das ist nützlich, wenn es uns veranlasst, den Speer zu schärfen und bereitzuhalten. Aber es erzeugt auch Ängste – es verweist in der Gegenwart auf die zukünftige Möglichkeit des Todes. Am nächsten Tag sehen wir vielleicht, dass ein Gefährte von einer Schlange getötet wird, ein dritter an einer Krankheit stirbt und wieder ein anderer durch Feuer ums Leben kommt. Wir sehen, dass es zahllose Möglichkeiten gibt, ums Leben zu kommen, und dass dies jederzeit geschehen kann. Wir mögen uns noch so sehr vorsehen, der Tod schlägt unausweichlich zu.
Wenn wir sehen, wie andere Lebewesen um uns herum eins nach dem anderen ihr Leben verlieren, erkennen wir, dass niemand davon verschont bleibt. Wir erkennen, dass der Tod der eigentliche Feind ist. Dank unseres Verstandes können wir den Tod eine Weile mit scharfen Speeren und befestigten Toren, gefüllten Vorratslagern und Krankenhäusern fernhalten – doch zugleich sehen wir, dass all das letztlich fruchtlos ist, dass wir eines Tages nicht nur möglicherweise, sondern ganz sicher sterben werden. Das meinte der Philosoph Martin Heidegger, als er vom »Sein zum Tode« sprach, in dem er das Definitionsmerkmal der conditio humana erblickte.
Wir sind also mit einem Verstand gesegnet, aber zugleich auch verflucht: nicht nur zu sterben, sondern auch zu wissen, dass wir sterben müssen. »Der Mensch hat den Tod geschaffen«, schrieb der Dichter W. B. Yeats. Andere Geschöpfe kämpfen blind. Sie kennen nur das Leben, bis der Augenblick ihres Todes kommt. »Unsterblich zu sein ist nichts Besonderes; vom Menschen abgesehen«, schreibt der argentinische Schriftsteller Jorge Luis Borges, »sind es alle Geschöpfe, da sie den Tod nicht kennen.« Wir jedoch holen den Tod ins Leben hinein. Wir sehen ihn kommen, in jedem Sturm oder Waldbrand, jeder Schlange oder Spinne, in jeder Krankheit und jedem bösen Vorzeichen.
Das ist ein zentrales Thema der Philosophie, der Poesie und des Mythos. Der Tod definiert uns als sterbliche Wesen. Das sagt auch eine der ältesten und einflussreichsten Erzählungen, die Genesis: Als Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis aßen, wurde ihnen klar, dass sie sterben mussten. Das Wissen um die Sterblichkeit ist der Preis der Erkenntnis. Seit wir uns unserer selbst bewusst sind, schrieb Michel de Montaigne, haben wir das Gefühl, »dass der Tod uns jeden Augenblick am Kragen gepackt hält«. Das Leben ist ein beständiger Kampf, den wir nur verlieren können.
Der zweite Gedanke – die andere Seite des Sterblichkeitsparadoxons – sagt uns dagegen genau das Gegenteil: dass unsere eigene Auslöschung unmöglich ist. Wir können uns einfach nicht vorstellen, nicht zu existieren. Versuchen Sie es einmal. Vielleicht gelangen Sie bis zu einem Bild Ihres eigenen Begräbnisses oder einer dunklen Leere. Aber Sie sind immer noch da: als Beobachter, als das sehende Auge. Schon der bloße Akt des Vorstellens verleiht uns ein virtuelles Sein, einem Geist gleich.
Als Subjekte des Denkens bleibt uns die Realität des Todes verschlossen. Unser Vorstellungsvermögen lässt uns hier im Stich. Dem Vorstellenden ist es unmöglich, sich die Abwesenheit des Vorstellenden vorzustellen. »Der eigene Tod ist ja auch unvorstellbar, und so oft wir den Versuch dazu machen, können wir bemerken, dass wir eigentlich als Zuschauer weiter dabei bleiben«, schrieb Sigmund Freud 1915. »So konnte … der Ausspruch gewagt werden: Im Grunde glaube niemand an seinen eigenen Tod oder, was dasselbe ist: Im Unbewussten sei jeder von uns von seiner Unsterblichkeit überzeugt.« Oder wie der englische romantische Dichter Edward Young es ausdrückte: »Ein jeder hält einen jeden für sterblich – außer sich selbst.«
Das gilt ganz unabhängig davon, wie weit wir in die Zukunft zu schauen versuchen. Ob in einem Jahr oder in eintausend Jahren, wir kommen nicht umhin, auch in dieser Zukunft immer präsent zu sein. Es gibt keine Grenze für unsere Zukunftsprojektionen. Unser Vorstellungsvermögen endet nicht bei einer Million oder einer Milliarde Jahren. Und so hat denn, um das biblische Buch Kohelet (Prediger) zu zitieren, Gott oder die Natur den Menschen »die Ewigkeit in ihr Herz gelegt«. Nach unserem Verständnis sind wir Teil des Gewebes der Welt, für immer und unauslöschlich hier. Goethe hat einmal gesagt: »Den Beweis der Unsterblichkeit muß jeder in sich selbst tragen.« Wir können uns unsere eigene Nichtexistenz nicht vorstellen, und deshalb ist unsere Nichtexistenz unmöglich.
Wie der Psychologe Jesse Bering in seinen Forschungen gezeigt hat, glauben selbst Kleinkinder, die noch nicht in eine bestimmte Religion oder ein bestimmtes Weltbild hineinsozialisiert sind, dass der Geist den physischen Tod überlebt. Er und seine Kollegen sehen den Grund in der Tatsache, dass die Alternative – wonach der Geist verlöscht – nicht vorstellbar sei. Er schließt daraus, wir besäßen »einen angeborenen Sinn für Unsterblichkeit«, der aus dieser kognitiven Eigenheit resultiere. Das heißt, die scheinbare Unmöglichkeit unserer eigenen Auslöschung sei in unserem Gehirn gleichsam fest verdrahtet.
So haben wir es denn mit einem Paradoxon zu tun. Wenn wir in die Zukunft schauen, finden wir unseren Wunsch nach einem ewigen Leben erfüllt, denn es scheint unvorstellbar, dass wir eines Tages aufhören könnten zu sein. Deshalb glauben wir an unsere eigene Unsterblichkeit. Doch zugleich sind wir uns all der möglichen Gefahren für unser Leben – von Giftschlangen bis hin zu Autounfällen – schmerzlich bewusst, und überall um uns herum sehen wir, dass andere Lebewesen unausweichlich den Tod finden. Deshalb glauben wir an unsere eigene Sterblichkeit. Dieselben hochfliegenden geistigen Fähigkeiten scheinen uns zu sagen, dass wir unsterblich und dass wir sterblich sind, dass der Tod eine Tatsache und dass er unmöglich ist. Oder wie Zygmunt Bauman einmal schrieb: »Der Tod ist – und kann nichts anderes sein als – ein Widerspruch in sich.« Unsere Unsterblichkeit und unsere Sterblichkeit drängen sich dem Verstand mit gleicher Macht auf.
Beide Vorstellungen finden, wie wir gesehen haben, ihre Anhänger unter Dichtern, Denkern und Mythenschöpfern. Die eine Hälfte sagt, wir müssten mit dem Wissen um unser unvermeidliches Ende leben, die andere Hälfte, wir könnten unmöglich an unserer Unsterblichkeit zweifeln. Und einige erkennen natürlich auch das hier vorliegende Paradoxon, wonach beide Vorstellungen wahr erscheinen. Der spanisch-amerikanische Philosoph und Schriftsteller George Santayana erfasste diesen Zusammenhang sehr genau, als er von unseren unbeholfenen Versuchen schrieb, die »beobachtete Tatsache der Sterblichkeit und die angeborene Unvorstellbarkeit des Todes« miteinander zu vereinbaren.
Das Paradoxon basiert auf zwei verschiedenen Perspektiven, die wir im Blick auf uns selbst einnehmen können – einerseits objektiv oder von außen, andererseits subjektiv oder von innen. Diese zwei entgegengesetzten, aber mächtigen Vorstellungen führen zu einer Spannung, mit der wir nicht leben können. Ein derartiger Zustand wäre ein beständiger lähmender Kampf zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Doch die meisten von uns leben durchaus nicht so. Wir sind nicht in aller Regel gelähmt von dem Widerspruch, der im Mittelpunkt der conditio humana liegt. Denn wir haben Geschichten entwickelt, mit deren Hilfe wir diese existentiell ausweglose Situation mit Sinn zu erfüllen vermögen – die Unsterblichkeitserzählungen.
Der Motor der Zivilisation
In den 1990er Jahren fand eine Gruppe amerikanischer Psychologen heraus, dass es bemerkenswerte Auswirkungen auf die politischen und religiösen Anschauungen der Menschen hat, wenn man sie kurz an ihre Sterblichkeit erinnert. So bat man eine Gruppe christlicher Studenten um ihren Eindruck von der Persönlichkeit zweier Menschen. Diese beiden Menschen waren einander in allen relevanten Merkmalen sehr ähnlich – außer in der Religionszugehörigkeit. Der eine war ein Christ, der andere ein Jude. Unter normalen Umständen beurteilten die Teilnehmer die beiden Personen recht ähnlich. Doch wenn man die Versuchspersonen zuerst an ihre eigene Sterblichkeit erinnerte (etwa indem man sie bat, einen Persönlichkeitstest auszufüllen, der auch Fragen zur Einstellung gegenüber dem Tod enthielt), beurteilten sie den Mitchristen positiver und den Juden negativer.
Diese Psychologen testeten die Hypothese, wonach wir unsere kulturellen Weltanschauungen entwickeln, um uns vor der Angst vor dem Tod zu schützen. Wenn diese These zutraf, so argumentierten sie, mussten die Menschen, wenn man sie auf ihre eigene Sterblichkeit hinwies, entschiedener an den zentralen Überzeugungen ihrer Weltanschauung festhalten und eine negativere Einstellung gegenüber solchen Menschen an den Tag legen, die eine Bedrohung für ihre eigenen Überzeugungen darstellten. Und genau das zeigte sich in ihren Experimenten.
In einer anderen Studie baten sie amerikanische Studenten anzugeben, wie »sympathisch und kompetent« sie die Autoren zweier Essays fanden, deren einer sich positiv über das politische System der Vereinigten Staaten von Amerika äußerte, während der andere eine kritische Haltung zum Ausdruck brachte. Die Studenten äußerten sich durchgängig positiver über den amerikafreundlichen und negativer über den kritischen Autor, doch dieser Effekt zeigte sich deutlich stärker, wenn man sie zuvor an ihre Sterblichkeit erinnerte. Nach Ansicht der Forscher zeigt diese Studie, dass wir angesichts des Todes nicht nur an religiösen Vorstellungen entschiedener festhalten – auch das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Nation vermag uns existentiellen Trost zu spenden.
Die drei Forscher Sheldon Solomon, Jeff Greenberg und Tom Pyszczynski ließen sich in ihrem Studium von Sigmund Freud und einem amerikanischen Anthropologen namens Ernest Becker inspirieren. Sie waren davon überzeugt, dass die Zivilisation psychologische Schutzmechanismen gegen die Angst vor dem Tode bereitstellt, und haben zur Überprüfung ihrer These seither mehr als 400 Experimente unternommen. Ihre Schlussfolgerung lautet, dass kulturelle Weltbilder einschließlich der Religionen, der Nationalmythen und der Werte »von Menschen geschaffene und von ganzen Gruppen geteilte Glaubensüberzeugungen bezüglich der Realität sind, die (zumindest in Teilen) dem Umgang mit der Angst dienen, die das allein beim Menschen anzutreffende Wissen um den Tod auslöst«.
Die von ihnen so genannte Terror Management Theory der Entwicklung der menschlichen Kultur findet inzwischen großen und immer noch wachsenden Anklang. Die Anhänger dieser Theorie glauben, dass das Wissen um unsere Sterblichkeit potentiell verheerende Auswirkungen habe. Wir müssen mit der Erkenntnis leben, dass gerade das denkbar Schlimmste eines Tages ganz sicher geschehen wird. Die Auslöschung – eine persönliche Apokalypse, das Ende unserer individuellen Welt – scheint unausweichlich zu sein. Wenn die Menschen sich dieser unabwendbaren Katastrophe vollauf bewusst wären, so behaupten die Anhänger der Terror Management Theory, wären sie nur »zuckende Haufen Gewebe, die vollkommen von Angst durchsetzt und unfähig wären, wirkungsvoll auf die Anforderungen ihrer unmittelbaren Umgebung zu reagieren«.
Deshalb vertreten sie die Hypothese, wir hätten kulturelle Institutionen, Philosophien und Religionen entwickelt, um uns vor dieser Angst zu schützen, indem wir das unabwendbare Schicksal des Todes leugnen oder zumindest davon ablenken – und genau das bestätigen ihre Experimente. Die den Tod leugnenden Institutionen und Religionen variieren beträchtlich in Zeit und Raum, sie reichen vom Polytheismus der alten Babylonier bis hin zur Konsumorientierung des modernen Westens. Doch sie alle bieten eine Erklärung, die uns sagt, weshalb wir nicht wirklich Angst vor dem Sterben zu haben brauchen – von der These, wir seien in Wirklichkeit geistige Wesen, die in einem Jenseits weiterlebten, bis hin zu dem Glauben, dass wir dem Sensenmann entgehen könnten, wenn wir nur genug Vitamine zu uns nähmen und ausreichend Jogging betrieben.
Die Terror Management Theory bietet also eine moderne wissenschaftliche Erklärung, die uns zeigt, in welcher Weise der erste Teil des Sterblichkeitsparadoxons, das Wissen um unsere Sterblichkeit, die Entwicklung von Unsterblichkeitserzählungen motiviert. Wie wir jedoch bereits gesehen haben, prädisponiert uns der zweite Teil des Sterblichkeitsparadoxons, wonach wir uns unser Nichtsein nicht vorzustellen vermögen, bereits zu dem Glauben, dass wir nicht sterben könnten. Diese zweite intuitive Vorstellung – wonach wir unmöglich jemals vollständig vernichtet werden können – ist von großem Nutzen, wenn es darum geht, Geschichten zu entwickeln, die den Tod leugnen. Sie bietet gleichsam einen geistigen Nagel, an dem sich die Erklärung aufhängen lässt, weshalb wir nicht wirklich sterben.
So räumt der Glaube an eine unsterbliche Seele zwar ein, dass unser Körper – in Übereinstimmung mit dem ersten Teil des Sterblichkeitsparadoxons – vergeht, hält sich dann aber an den zweiten Teil des Paradoxons, wonach wir nicht gänzlich vergehen können, um die These aufzustellen, dass wir den körperlichen Tod überstehen und in spiritueller Gestalt weiterexistieren. Hier werden beide Seiten des Paradoxons akzeptiert und in eine Geschichte eingebaut, die den scheinbaren Widerspruch aufhebt. Unsere Angst vor dem Tod wird besänftigt, und die Geschichte wirkt intuitiv plausibel, weil sie auf Vorstellungen basiert, die zu glauben wir bereits disponiert sind.
Auf diese Weise werden Unsterblichkeitserzählungen geschaffen. Jede von ihnen findet einen Weg zur Lösung des Sterblichkeitsparadoxons, eine Möglichkeit, uns davon zu überzeugen, dass wir trotz gegenteiligen Anscheins in Wirklichkeit überleben werden; dass der körperliche Tod entweder nicht unausweichlich oder nicht das ist, was er zu sein scheint; dass wir recht haben, wenn wir an die Unmöglichkeit unserer Auslöschung glauben.
In der wettbewerbsorientierten Welt der akademischen Psychologie streiten die Experten heftig über die Frage, welcher Seite des Sterblichkeitsparadoxons primäre Bedeutung bei der Erklärung menschlicher Kultur zukommt. Sozialpsychologen wie die Anhänger der Terror Management Theory sind leidenschaftliche Verfechter eines Primats der Todesverleugnung bei der Entwicklung unserer Weltbilder. Während kognitive Psychologen wie der oben erwähnte Jesse Bering meinen, die Unfähigkeit des Menschen, sich seine Nichtexistenz vorzustellen, reiche zur Erklärung der allenthalben anzutreffenden religiösen Überzeugungen aus. In Wirklichkeit verhalten sich die Auswirkungen der beiden Seiten des Paradoxons komplementär zueinander. Die Angst vor dem Tod liefert ein starkes Motiv zur Entwicklung von Weltbildern, die Unsterblichkeit versprechen. Und das Gefühl der eigenen psychischen Fortdauer ist ein natürlicher Nagel, an dem solche Bilder sich aufhängen lassen.
Manche Aspekte unserer Kultur sind unmittelbarer Ausdruck unseres unstillbaren Lebenswillens. Landwirtschaft, Verteidigung, Hausbau, all das hilft uns zu überleben. Doch Religion oder Poesie zum Beispiel sind nicht gerade die besten Wege, um Essen auf den Tisch zu bringen oder Feinde auf Distanz zu halten. Und aus der Sicht reinen Überlebens lassen sich Mönche, die sich selbst geißeln, oder Literaten und Künstler, die ein Hungerdasein fristen, kaum erklären, ganz zu schweigen von Menschen, die um des posthumen Ruhmes willen alles opfern und den Tod auf sich nehmen. Diese allein in der menschlichen Gesellschaft anzutreffenden Merkmale sind nur als Versuche verständlich, unsere paradoxe Sicht der Unsterblichkeit zu verstehen. Der Schriftsteller Bryan Appleyard hat das so zusammengefasst: »Jeder stirbt, daher muss auch ich sterben. Da das unvorstellbar ist, erfinden wir die Unsterblichkeit, und aus dieser Erfindung entsteht Kultur.«
Der Fortschritt selbst ist eine Folge unseres Drangs nach einem endlosen Leben. Nicht nur einzelne Zivilisationen sind von diesem Streben geprägt, sondern auch ihre Wechselwirkung, ihr Aufstieg und ihr Niedergang. Für Hegel war die Geschichte der Umgang des Menschen mit dem Tod. Der bereits erwähnte Psychiater Robert Jay Lifton erläutert, was damit gemeint ist: »Geschichte läßt sich weitgehend als ein Bemühen verstehen, bei ständig wechselnden psychischen und materiellen Bedingungen ein kollektives Unsterblichkeitsgefühl zu erreichen, zu bewahren und zu festigen.« Fast alle Facetten der Menschheitsentwicklung lassen sich als Ausdruck des Willens zum ewigen Leben begreifen.
Ich sage, »fast« alle Facetten, weil es noch weitere Prismen gibt, durch die wir die menschliche Kultur gleichfalls betrachten müssen. Erstens ist jede Zivilisation ebenso sehr das Produkt ungezählter Zufälle wie von großen historischen Bewegungen. Eine Malerin mag malen, weil die vorherrschenden Unsterblichkeitserzählungen der Kunst die Fähigkeit zuschreiben, die zeitlose Einzigartigkeit des Einzelnen oder die sich selbst transzendierende Macht des Schaffensprozesses zu demonstrieren, doch wenn wir verstehen wollen, warum sie gerade in dieser Weise malt, müssen wir durch das Prisma der Kunstgeschichte oder der individuellen Biographie blicken.
Zweitens haben manche Denker versucht, die unsere instinktive Hingezogenheit zu solchen Geschichten kritisch beurteilen, alternative Weltbilder zu entwickeln – doch da sie die Ausnahme darstellen, lassen sie sich noch am ehesten über die Regel begreifen, deren Ausnahme sie sind.
Und drittens ist eine Zigarre manchmal eben nur eine Zigarre, wie Freud einmal gesagt haben soll – ein besonders aufschlussreiches Beispiel, da Rauchen verheerende Auswirkungen auf unsere Überlebensaussichten hat (Freud, der täglich Zigarren rauchte, starb an Mundhöhlenkrebs). Aber das Rauchen bietet einen unmittelbaren Genuss – der allerdings süchtig macht. Es bedarf keiner großartigen Theorie und keiner Tiefenpsychologie, um erklären zu können, weshalb wir Genuss suchen und Schmerz meiden. Es ist durchaus möglich, dass wir einen Rosenstrauch nicht deshalb pflanzen, weil wir den Wunsch haben, dass andere Menschen sich nach unserem Tod an uns erinnern, oder weil wir einen Geschlechtspartner finden möchten, mit dessen Hilfe wir unsere Gene in die Zukunft weitergeben können, sondern einfach deshalb, weil wir den Duft von Rosen lieben oder der Liebe verfallen sind. Die Besonderheit der menschlichen Zivilisation liegt gerade in der Tatsache, dass sie über das bloße Streben nach Lust und die Vermeidung von Schmerz hinausgeht, und das tritt noch am deutlichsten im Wunsch nach einem ewigen Leben zutage. Die Zivilisation aus der Sicht der den Tod leugnenden Erzählungen zu verstehen ist nicht hinreichend, aber notwendig. Oder wie der Soziologe Zygmunt Bauman es ausgedrückt hat: »Ohne Sterblichkeit keine Geschichte, keine Kultur – keine Humanität.«
In den folgenden Kapiteln werde ich jede der vier Unsterblichkeitserzählungen genauer untersuchen. Wir werden sehen, dass jede von ihnen einen Beitrag zur Ausgestaltung unserer Zivilisation geleistet hat, aber wir werden auch fragen, welcher der vier Wege sein Versprechen tatsächlich einlöst. Dass die Erzählungen in tiefgründigen Aspekten der conditio humana wurzeln, sagt noch nichts über deren Wahrheit aus. Es könnte sich um echte Entdeckungen handeln, die einst die Menschheit am Anbeginn der Geschichte gemacht hat, oder um ausgefeilte Produkte bloßen Wunschdenkens. Es ist denkbar, dass uns das Unsterblichkeitsparadoxon dazu getrieben hat, die Geheimnisse des ewigen Lebens zu enthüllen oder sie einfach nur zu erfinden. Jeder Weg hat in der Geschichte Millionen oder sogar Milliarden von Anhängern gehabt – und hat sie vielfach auch heute noch. Und jeden dieser Wege haben Tausende von Philosophen, Theologen oder Weisen verteidigt. Wir werden prüfen, ob einer oder keiner von ihnen oder vielleicht sogar alle uns durch den dichten Wald und die Wolken hinauf zum Gipfel des Berges der Unsterblichen zu führen vermögen.
Wie andere im alten Ägypten dürfte auch Nofretete auf alle vier Möglichkeiten zur Sicherung des ewigen Lebens gesetzt haben. Doch ihre Chancen, dem Schicksal anderer Sterblicher zu entgehen, standen sicher nicht gut angesichts des Zorns, den sie auf sich zog. So hatte sie wahrscheinlich wenig Erfolg mit der ersten Erzählung, nach der es einfach nur darum geht, weiterzuleben. Falls sie der Vergänglichkeit allen Fleisches zum Opfer fiel, dürfen wir eigentlich annehmen, dass sie mumifiziert wurde. Doch aufgrund der Sorgfalt, mit der ihre Nachfolger sie vernichteten, ist es unwahrscheinlich, dass man ihre Überreste unangetastet ließ – womit sie jede Hoffnung auf die in der zweiten Erzählung angesprochene Auferstehung zunichtemachten. Auch ihr ka dürfte vor langer Zeit schon zugrunde gegangen sein – da die von den Ägyptern als unerlässlich empfundene Versorgung mit Lebensmitteln ausblieb. Der einzige Weg, der ihr blieb, um ihren maßlosen Drang nach Unsterblichkeit zu befriedigen, war daher der vierte: das Vermächtnis.
Die Schöne kehrt wieder
Sechs Wochen, nachdem Borchardt Nofretete erstmals erblickt hatte, war die Stimmung im deutschen Lager angespannt. Am nächsten Tag erwartete man Gustave Lefebvre, den Inspektor der Altertümerverwaltung. Der Franzose hatte die Aufgabe, gemäß den ägyptischen Gesetzen die Hälfte der in der Ausgrabungssession gefundenen Objekte für den ägyptischen Staat zu requirieren. Die Auswahl der Objekte lag ganz in seinem Ermessen, und niemand im deutschen Team glaubte, er werde zulassen, dass die Büste der Nofretete nach Berlin ging. Am Abend dieses Tages betraten sie nacheinander den Schuppen, der ihr als zeitweiliger Thronsaal diente, und verabschiedeten sich im Kerzenschein von der Dame, die sie einfach »Ihre Majestät« nannten.
Am folgenden Tag begrüßte Borchardt den Inspektor und führte ihn in die Baracke, in dem man die Artefakte versammelt hatte. Die Sonne stieg hoch über die Ebene, während die übrigen Expeditionsmitglieder auf die Entscheidung warteten. Endlich traten die beiden Männer aus dem Schuppen, um die Papiere zu unterzeichnen. Der Franzose ließ seine Hälfte zusammenpacken und machte sich bereit, nach Kairo zurückzukehren. Als die Kisten zusammengestellt wurden, verbreitete sich langsam die Erkenntnis im ungläubigen deutschen Lager: Sie würden »Ihre Majestät« behalten.
Niemand weiß, mit welcher Hexerei Borchardt in diesem Schuppen verhinderte, dass Nofretete in den höhlenartigen Kellern des Kairoer Museums verschwand. Bis heute kursieren wilde Anschuldigungen, die von Betrug, Korruption und Inkompetenz sprechen. Manche behaupten, man habe dem Inspektor nur eine schlechte Fotografie der Büste gezeigt, oder er habe sie nur in einer Kiste in einer dunklen Ecke des Schuppen sehen können, oder Borchardt habe gelogen und ihm erzählt, es handle sich nur um einen wertlosen Gipsabdruck. Einige behaupten sogar, man habe ihm eine Fälschung vorgeführt, die Borchardt in der Kairoer Unterwelt habe anfertigen lassen.
Doch Borchardts – und Nofretetes – Kampf war noch nicht gewonnen. Da Borchardt fürchtete, sie könne ihm vom streng kontrollierenden ägyptischen Zoll gestohlen werden, bat er das Auswärtige Amt, ihm dabei zu helfen, die Büste dem Kaiser »nicht nur diskret, sondern im Geheimen« zuzustellen. Er hatte Erfolg, und die Große Königin gelangte nach Deutschland. Als man sie in Berlin ausstellte, sorgte sie sogleich in ganz Europa für großes Aufsehen – und für Empörung in Kairo. Die ägyptische Regierung forderte unverzüglich ihre Rückführung und stoppte alle weiteren deutschen Ausgrabungen. Bis heute verlangt sie von Deutschland die Rückgabe dieser Mona Lisa der Antike an ihr Heimatland.
Borchardt nahm seine Geheimnisse mit ins Grab. Mit Sicherheit wissen wir nur, dass Nofretetes strahlende Schönheit ihn ebenso verführte, wie sie einst den jungen Pharao Echnaton verführt hatte. Heute befindet sie sich auf der Museumsinsel in Berlin, wo ihr jährlich mehr als eine halbe Million Besucher ihre Reverenz erweisen. Ihr Name wird wieder ausgesprochen, und ihr Bild ist in ganz Ägypten zu sehen, wie zu Zeiten der Herrschaft Atons. Mit ihrem heiteren, selbstsicheren Lächeln sagt sie: Ich bin wieder da. Ich bin unsterblich.
Erster TeilWeiterleben
Zweites KapitelMagische Schranken: Zivilisation und das Elixier des Lebens
Der König von Qin hatte gute Gründe für seinen Verfolgungswahn. Man trachtete ihm tatsächlich nach dem Leben. Sein Vorgänger, der sein Vater gewesen sein mag oder nicht, hatte sich nur drei Jahre auf dem Thron halten können und dessen Vorgänger gerade einmal zwölf Monate. Sein Hof blickte auf eine lange Tradition der Komplotte, Verschwörungen und Staatsstreiche zurück. Selbst seine eigene Mutter hatte gegen ihn konspiriert und geplant, ihren jüngeren Sohn auf den Thron zu setzen. Der arme König von Qin konnte niemandem trauen. Aber zudem besaß er auch ein besonderes Talent, sich Feinde zu machen.
Das war China zur »Zeit der streitenden Reiche«, wenig mehr als tausend Jahre nach Nofretetes Sturz. Es war eine blutige Zeit, in der konkurrierende Kriegsherren sich miteinander verbündeten, gegeneinander intrigierten und ums Überleben kämpften. In einer einzigen Schlacht – der berüchtigten Schlacht von Changping – hatten die Armeen seines Urgroßvaters gut 400 000 Soldaten des Nachbarstaats Zhao getötet. Und unser Held bemühte sich eifrig, dieser Tradition gerecht zu werden. Er hatte den Ruf, arrogant und grausam zu sein.
Er selbst meinte jedoch, er würde nur missverstanden. Denn in Wahrheit war der König von Qin ein Mann mit einer Vision – ein vereinigtes China, in dem die Menschen miteinander und mit dem Himmel in Harmonie lebten. Deshalb fielen seine schwarzgekleideten Armeen ständig in die Nachbarstaaten ein und drangen aus der im Nordwesten gelegenen Bergregion nach Osten vor. Seine Soldaten – deren Beförderung von der Zahl der abgehauenen Köpfe abhing, die sie erbeuten konnten – waren skrupellos und effektiv. Schon bald hatte Qin zwei der übrigen streitenden Reiche geschluckt und wandte seine Aufmerksamkeit dem kleinen, im Osten gelegenen Königreich Yan zu.
Zur Zufriedenheit des Königs schickte Yan im Jahr 227 v.Chr. zwei Gesandte, die Qin die Unterwerfung unter dessen Oberhoheit anboten. Als Zeichen ihres guten Willens brachten sie Geschenke mit: eine detaillierte Karte der fruchtbarsten Regionen von Yan – und einen abgeschlagenen Kopf.
Bei dem Kopf handelte es sich um den eines hohen Qin-Generals, der beim König in Ungnade gefallen und nach Yan geflohen war. Der König war hocherfreut über die Nachricht von der Enthauptung des Verräters, dessen gesamte erweiterte Familie er bereits hatte töten lassen, und er bereitete sich darauf vor, die beiden Besucher mit großem Pomp zu empfangen. Was der König nicht wusste, war indessen die Tatsache, dass der General sein Leben freiwillig hingegeben und den Yan-Gesandten sogar geholfen hatte, indem er sich selbst die Kehle durchschnitt, weil er hoffte, damit zum Sturz des Königs von Qin beitragen zu können.
Die Gesandten wurden zur Audienz vorgelassen. Einer von ihnen stieg die Stufen zum Thron empor und bot die Geschenke dar. Der König stellte den Korb mit dem Kopf beiseite und entrollte langsam die Karte. Kurz bevor er das Ende erreichte, sah er Metall aufblitzen – doch es war zu spät. In der Kartenrolle war ein Dolch mit einer vergifteten Klinge versteckt. Der Gesandte ergriff mit einer Hand die Waffe, packte mit der anderen den König am Ärmel und stach zu.
Aber der König reagierte zu schnell und war bereits zurückgesprungen, wobei der Ärmel seines Gewands abriss. Er griff nach dem mächtigen Zeremonialschwert, das neben ihm hing, doch es war so lang, dass er es nicht vollständig aus der Scheide ziehen konnte, und der Attentäter stellte ihm weiter nach. Der König flüchtete hinter eine Säule, während seine Höflinge auseinanderstieben – sie trugen ironischerweise keine Waffen, damit sie keine Attentatsversuche unternehmen konnten. Die vor dem Thronsaal stehenden Wachen durften nur auf ausdrücklichen Befehl des Königs hereinkommen – und der war zu beschäftigt damit, um sein Leben zu kämpfen.
Als der Attentäter erneut versuchte, sich auf den König zu stürzen, wehrte dessen alter Arzt den Dolch mit seiner Tasche ab und gab seinem Herrn so die Gelegenheit, die Scheide abzustreifen und die Klinge zu befreien. Nun hatte der Attentäter es plötzlich mit einem erzürnten König zu tun, der ein sehr langes Schwert in der Hand hielt. Er schleuderte den Dolch auf ihn, verfehlte sein Ziel aber. Der König schlug ihn nieder. Er brauchte acht Schwerthiebe, um ihn zu töten.
Am folgenden Tag schickte der König die Armeen von Qin zum Angriff auf Yan. Nach einem Jahr nahmen sie die Hauptstadt ein, und innerhalb von fünf Jahren hatten sie das Königreich von der Landkarte getilgt. Ein Jahr später hatten seine Armeen die ganze bekannte Welt – »alles unter dem Himmel« – erobert. Und der König erklärte sich zum Ersten Kaiser Chinas.
Natürlich war sich der Erste Kaiser seiner Sterblichkeit nur allzu bewusst. Es gab viele, die ihm nur zu gern einen Dolch zwischen die Rippen gestoßen hätten, und einige versuchten es auch. Bei einem anderen legendären Attentatsversuch lockte ein blinder Lautenspieler den Kaiser in seine Nähe und griff ihn dann mit seiner – eigens zu diesem Zweck mit Blei beschwerten – Laute an. Da er jedoch blind war, verfehlte er den Kaiser und wurde exemplarisch hingerichtet. Bei einem anderen Mordversuch warf ein kräftiger Mann, den man dafür angeheuert hatte, einen 100 kg schweren Metallzylinder von einem Felsvorsprung auf die Kutsche des Kaisers und zertrümmerte sie vollständig. Doch der Kaiser hatte mit solch einem Hinterhalt gerechnet und fuhr in einer anderen Kutsche. Wäre er jemals der Versuchung erlegen, seine Sterblichkeit zu vergessen, hätte die Welt sich verschworen, ihn daran zu erinnern.
Der erste Teil des Sterblichkeitsparadoxons sagt uns, dass wir mit dem Bewusstsein unserer Sterblichkeit leben müssen. Wir alle wissen, dass alles Geborene sterben muss. Doch die meisten von uns vermögen diese Tatsache dank der von der Kultur bereitgestellten Hilfsmittel zu verdrängen. Menschen jedoch, die ständig in der Angst vor Attentaten leben, Pharaonen, Diktatoren und Könige, werden auch beständig daran erinnert, wie gefährdet ihr Dasein ist. Es ist eine schöne Ironie, dass gerade die Mächtigsten im Bewusstsein dieser Verletzlichkeit zu leben haben. Das meint Shakespeares Heinrich IV., den der Dichter sagen lässt: »Schwer ruht das Haupt, das eine Krone drückt.«





























