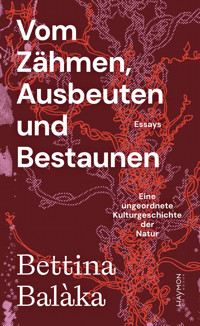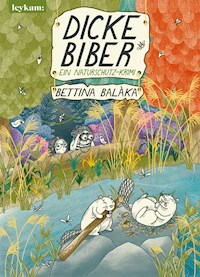Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Berti heißt auch Fekete, Robert Pattinson, Ricky, Zorro und Bagheera. Er ist das Ergebnis der unglücklichen Liaison eines Jack Russell Terriers mit einem Straßenköter, er sieht aus wie ein schwarzer Fleck und benimmt sich wie ein übermütiges Kind. Er ruiniert die Geschäfte eines ungarischen Welpenhändlers, bricht einer Zwölfjährigen das Herz, weckt die Lebensgeister eines neurotischen Physikers und landet auf der Müllhalde eines Haustiermessies. Überall, wo er hinkommt, hinterlässt er seine Spuren in den Herzen und in den Leben seiner Menschen, die er als kleiner Schatten ihres Glücks und Unglücks begleitet. Bettina Balàka erzählt in ihrem neuen Roman nur scheinbar die Geschichte eines Hundelebens: Unter Menschen ist zugleich ein Reigen zwischenmenschlicher Tragödien und Komödien - grandios komponiert, durchtrieben ironisch und unterhaltsam, voll überraschendem Witz und geistreicher Erkenntnis. **************************************************************************************************************** LESERSTIMMEN: "Wir gehen mit einem aufgeweckten und klugen Hund auf Entdeckungsreise und begegnen dabei außergewöhnlichen Charakteren. Unter Menschen bietet uns die brillante Gelegenheit, über ein Hundeleben hinter die Fassaden des menschlichen Daseins zu blicken." "Frech, spritzig und gerade aus: Bei Bettina Balàka sitzt jedes Wort an der richtigen Stelle. Wie auch schon bei ihrem vorigen Roman Kassiopeia hat sie mich auch diesmal wieder mit großartiger Leseunterhaltung beglückt". Für Sebastian Gilli (DER STANDARD) ist der Roman Unter Menschen "der gelungene Versuch, anhand der Lebensstationen eines Hundes Verhaltensweisen von Menschen aufzugreifen, zu hinterfragen und nachzuspüren. Gassigehen auf hohem stilistischem Niveau." **************************************************************************************************************** Alle Bücher von Bettina Balàka erschienen bei Haymon:´ Auf offenem Meer Kassiopeia Unter Menschen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bettina Balàka
Unter
Menschen
Roman
Inhalt
Titel
Zitat
Fekete
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Robert Pattinson
1.
2.
3.
4.
Ricky
1.
2.
3.
4.
5.
Rocco
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Zorro
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Bagheera
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Berti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Danksagung
Bettina Balàka
Zur Autorin
Impressum
Weitere E-Books aus dem Haymon Verlag
Weitere E-Books aus dem Haymon Verlag
Weitere E-Books aus dem Haymon Verlag
Weitere E-Books aus dem Haymon Verlag
„I have a theory that every time you make an important choice,
the part of you left behind continues the other life you could have had.“
Jeannette Winterson
Fekete
1.
Berti war gebürtiger Ungar. Seine Mama Pihe (was soviel wie „Flocke“ bedeutete) war ein schneeweißer Jack Russell Terrier mit einem lohfarbenen Abzeichen an der Schwanzwurzel und einem gleichfärbigen rechten Ohr. Mit fünf Jahren war sie noch nicht alt, hatte aber bereits sieben Würfe gehabt und fühlte eine Erschöpfung, von der kein Schlaf mehr Erholung brachte. Waren die Welpen fünf bis sechs Wochen alt, nahm man sie ihr weg und wartete, bis sie wieder läufig wurde. Dann ließ man den Rüden zu ihr.
Diesmal aber, infolge menschlicher Verstrickungen, die von sogenannten unvorhergesehenen Umständen rührten, wartete man einen halben Tag zu lang. Pihe war läufig, sie lag allein in ihrem Zwinger und ihr verführerischer Duft breitete sich in der ganzen Nachbarschaft aus.
Bertis Papa hatte, da er niemandem gehörte, keinen Namen. Seine Fortpflanzung und die Weitergabe seiner Gene waren von niemandem erwünscht, nicht nur, weil er ein Straßenhund, sondern auch, weil er das Ergebnis einer Kreuzung war, und zwar der eines Dackels und eines Schnauzers. Das Auge des Betrachters – insbesondere, wenn dieser von auswärts kam, sodass ihm die vertrauten Streuner nicht von Grund auf verhasst waren – vermochte in der äußeren Erscheinung des Rüden durchaus Schönheit zu entdecken: Er hatte den sprichwörtlichen Blick und die sprechenden Brauen des Dackels, ebenso wie – wenngleich auf höheren Beinen stehend – den langen Rücken und die dazugehörige lange Schnauze. Von der Nasen- bis zur Schwanzspitze war sein Fell kohlrabenschwarz. Wenn er rannte, klappten seine Hängeohren nach hinten und gaben die rosige, gekräuselte Innenseite frei. Vom Schnauzer hatte er das struppige Haar und am Kinn ein prächtiges Bärtchen. Seine Augen sahen aus wie glänzende Seifenblasen, in denen zwei braune Sterne gefangen waren.
Der Streuner folgte dem verführerischen Duft der unbekannten Hündin und trabte bis zu dem langen Lattenzaun am äußersten Rand des Dorfes, wo die Häuser schwarze Schlieren angenommen hatten, sodass sie aussahen wie verweinte Gesichter, wo die Straße nicht mehr asphaltiert war und sich bei Regen in einen ockerfarbigen Spiegel verwandelte, und wo zwischen den Obstbäumen ausrangierte Kühlschränke, Kaninchenställe und Autowracks verrotteten. Bertis Papa kannte die Gegend. Der Geruch vieler Hunde wehte über den langen Lattenzaun, von Französischen Bulldoggen, Toy Terriern, Papillons, Maltesern, Chihuahuas und Jack Russells, von Rüden, Hündinnen und vielen, sehr vielen Welpen. Man roch die hohe Note des Urins, die älteren Schichten und die täglich erneuerten, da die Hunde aus ihren Verschlägen nie herauskamen, man roch die tieferen Noten von Nachgeburten und Blut, von muffigem Fell und unbehandelten Geschwüren, man roch die säuerliche Note von verdorbenem Essen und die beklemmende von Aas. Man hörte die Hunde kläffen. Sie kläfften aus Langeweile, aus Zorn, oder weil die anderen kläfften. Der schwarze Streuner kläffte zurück, nur so aus Prinzip, und lief, die Nase knapp über dem Boden in einer Zickzack-Bewegung führend, den Lattenzaun entlang. Schließlich fand er, wonach er suchte: die Stelle, wo Pihes Geruch sich verdichtete, wo sie nur durch ein paar Bretter von ihm getrennt im Staub stand und nach allen Richtungen lauschte. Er kläffte wieder, aber diesmal mit einem liebenswürdigen Unterton, um die fremde, duftende Hündin zu begrüßen, und Pihe kläffte freundlich zurück.
Bertis Papa war, ohne es zu wissen, vor Kurzem zwei Jahre alt geworden. Er hatte gelernt, Mäuse und anderes Getier zu fangen, was ihm einen Vorteil gegenüber den ewig hungernden Müllfressern verschaffte. Muskulös, ausdauernd, schnell und mit einem furchteinflößenden tiefen Knurren begabt, hatte er dem alten Erztyrann der Dorfgosse, einem sabbernden, übellaunigen Boxermischling, bereits eine empfindliche Verletzung am rechten Hinterlauf und an seinem Ego zugefügt. Es kam ihm vor, als würde seine Kraft täglich wachsen. Sein Körper, der sich so mühelos streckte und wand und in die schmalsten Öffnungen hineinbog, war ein Quell der Wonne. Und oh – die Hündinnen! Sie wurden auf ihn aufmerksam, sie wussten seine Leistungen zu schätzen, und immer öfter ließen sie es zu, dass er sie deckte. Bisher war er den langen Lattenzaun nur entlang gelaufen, hatte ihn als natürliche Grenze akzeptiert, aber heute war er bereit, etwas Neues zu wagen. Er brach aus der geraden Richtung aus, wandte sich seitwärts und begann, am unteren Ende der Bretter, wo sich eine schmale Ritze zwischen diesen und dem Erdboden befand, mit seinen mit kräftigen Krallen bewehrten Vorderpfoten zu graben.
Auf der anderen Seite des Zaunes legte sich Pihe ganz nahe zu der Stelle, wo das Scharren zu hören war, hielt den Kopf schief und lauschte. Seit die Läufigkeit eingesetzt hatte, war sie alleine in dem Zwinger und hatte kein Ziel für die wachsende Unruhe in ihrem Körper. Jeden zweiten oder dritten Tag kam die Frau, die ihr mit Wasser verdünnte Essensreste in eine alte Babybadewanne schüttete. Um zu fressen, musste die Hündin in die Wanne springen und in der Brühe stehen; wenn sie wieder herauskam, hingen Reiskörner und Krautfäden in ihren nassen Pfoten. Doch seit einigen Tagen schwand der Inhalt der Wanne nicht mehr. Als die Frau bemerkte, dass Pihe nicht fraß, hatte sie als Bonus ein paar Scheiben hartes Toastbrot ausgegeben, die aber ebenfalls nicht angerührt wurden. Pihe stand im Staub und witterte, den schwarzen, weichen Nasenspiegel in alle Richtungen biegend, mit geöffnetem Maul, sodass der Geruchsstrom auch über Zähne und Zahnfleisch glitt, sie biss sich in die lohfarbene Schwanzwurzel, sie drehte sich im Kreis. „Bald kommt der Rüde“, hatte die Frau gesagt, „er ist nur gerade ausgeliehen, aber bald kommt er zurück.“
Bertis Papa war ein versierter Gräber. Er grub die Kinderstuben der Wühlmäuse aus, er hatte Maulwürfe und sogar ein Kaninchen erwischt. Es kostete ihn nicht allzu viel Zeit, die schmale Ritze zu einem ausreichenden Durchgang zu erweitern, und sobald sie seine Pfoten unter dem Zaun hervorkommen sah, wurde auch Bertis Mama von der Grablust angesteckt und half von ihrer Seite aus mit. Dann trat sie zurück und beobachtete mit leise wedelnder Rute, wie der schwarze Rüde sich durch das Loch zwängte.
Er näherte sich ihr höflich, mit großem Umweg und von der Seite. Sie ließ ihn an ihrem Hinterteil schnüffeln und schnüffelte dann an seinem, wobei sie in vielen Umdrehungen tanzten. Sie forderte ihn zum Fangenspielen auf und Runde um Runde tollten sie durch den Zwinger. Sie legte sich auf den Rücken und ließ ihn an ihren Geschlechtsteilen schnuppern, dann sprang sie schnell auf und rannte weiter im Kreis vor ihm her. Sobald die Stimmung genügend angeregt war, paarten sie sich. Danach verloren sie umgehend das Interesse aneinander. Der schwarze Streuner verschlang die harten Toastbrotscheiben und erfrischte sich mit etwas Brühe aus der Babybadewanne. Er sah sich noch ein wenig im Zwinger um, fand nichts weiter Brauchbares und robbte durch das Loch unter den Zaunlatten wieder zurück auf die ockerfarbene, in den Lehm eingegrabene Straße. Obwohl kein anderer Hund zu sehen war, ging er im Imponiertrab davon und folgte der bitteren Geruchsmischung von Eichhörnchenkot, Schierling und siegreichen Kämpfen in den nahen Wald.
Pihe starrte eine Weile das Loch an, in dem er verschwunden war, beschnüffelte es ausgiebig, dann zwängte auch sie sich hindurch. Sie sah sich die fremde Welt an, in der Häuser mit schwarzen Schlieren in verwahrlosten Obstgärten standen, ein paar Krähen über die mit Pfützen gefüllte Straße hopsten, und in der Ferne, jenseits eines brachen Feldes, ein winziger schwarzer Schatten in einem großen schwarzen Schatten verschwand. Pihe trank aus einer Pfütze, dann kroch sie durch das Loch unter dem Lattenzaun wieder zurück in ihren Zwinger, legte sich auf den Stapel feuchter Zeitungen, der ihr als Bett diente, und schlief ein.
Am Nachmittag kamen die beiden Männer – der Mann und der Sohn der Frau, die das Essen brachte – und ließen den Jack Russell-Rüden, der Pihe schon die beiden letzten Male gedeckt hatte, in ihren Zwinger. Doch Pihe war unfreundlich. Sie schnappte nach ihm, knurrte ihn an, ließ ihn nicht einmal an sich schnuppern. Von ihrem Duft in zunehmende Aufregung versetzt, wurde er immer zudringlicher, duckte sich unter ihrem Schnappen hindurch, versuchte, sie von der Seite und sogar an ihrem Gesicht zu bespringen. Die beiden Männer schüttelten die Köpfe über so viel Ungeschick.
Die Hündin knurrte, schnappte, kläffte. Das Reißen ihres Geduldsfadens war von einem Aufwallen letzter Energiereserven begleitet, und sie ging in Angriffsposition. Fest stemmte sie die Vorderbeine auf den Boden und verlagerte das Gewicht nach vorne. Dabei war sie so angespannt, dass ein leichtes Zittern durch ihren Körper ging. Die Rute war waagrecht nach hinten gestreckt, ein Balancierstab. Das Nackenhaar war gesträubt, die Nase kräuselte sich. Pihe zog die Oberlippe hoch, bis man das Zahnfleisch sah. Ihr Knurren wurde leiser, und umso bedrohlicher dadurch.
Der Rüde war um einiges jünger und um vieles dümmer als sie. Als er wieder wie ein Zicklein auf sie zuhopste, griff Pihe an. Eine Fahne aus Kieseln und Staub spritzte auf die beiden Männer. Ineinander verkeilt drehten sich die Hunde wie ein rasender Kreisel. Dabei gurgelten sie aus den geöffneten Fängen, und wenn ein Biss saß, jaulte einer von ihnen auf. Als den Männern klar wurde, dass sich daraus keine Liebesgeschichte mehr entwickeln würde, beschlossen sie, die Hunde zu trennen. Mit einem Fußtritt ging der Sohn dazwischen, wodurch der Vater den Rüden zu fassen bekam, ihn hoch und höher hob, außer Reichweite von Pihe, die wie ein Gummiball an ihm hochsprang.
In diesem Moment entdeckte der Sohn das Loch unter dem Zaun. Mit einer Kette von Flüchen machte er seinen Vater darauf aufmerksam, kniete sich in den Staub, versuchte, durch das Loch nach draußen zu sehen. Der Vater klemmte sich den zappelnden Rüden unter den Arm und rannte aus dem Zwinger. Nachdem er den Hund in einem Verschlag deponiert hatte, stürzte er auf die Straße hinaus, um das Loch von der anderen Seite zu begutachten. Durch den Lattenzaun hindurch informierte er seinen Sohn, dass das Loch unzweifelhaft von außen gegraben worden war. Was das bedeutete, wussten sie nur zu gut: Nicht Pihe hatte einen Ausbruchsversuch gemacht, sondern ein Eindringling hatte sich Zutritt verschafft. Die Chancen, dass es sich dabei um einen Rüden gehandelt hatte, waren hoch. Die Chancen, dass dieser ein reinrassiger Jack Russell Terrier gewesen war, waren gering.
Von dem Geschrei angelockt, lief nun auch die Frau aus dem Haus und in Pihes Zwinger. Ihr Mann kam ebenfalls wieder herein, auf den Armen ein paar Ziegel, die er wütend in das Erdloch zu stopfen begann, während ihr Sohn sie über die Details der unglückseligen Ereignisse informierte. Die Frau rang die Hände, rief herausragende katholische Heilige an und schimpfte mit Pihe, die einen fremden Streuner herein- und offenbar auch wieder hinausgelassen hatte, anstatt ihn zu vertreiben oder wenigstens in seine Einzelteile zu zerlegen. Die solchermaßen Angeklagte hatte sich indessen wieder auf ihren Zeitungsstapel verkrochen und hechelte erschöpft. Die Menschen berieten sich. Es gab nur eine Lösung: Die Hündin musste noch einmal gedeckt werden. Nur so bestand die Hoffnung, dass zumindest einige der Spermien des Jack Russell-Rüden den Wettlauf gegen jene des Streuners gewannen, Eizellen erreichten und sich mit diesen zu einwandfreien Jack Russell-Welpen verbanden. Wenn man Glück hatte, waren dann von sechs Welpen zwei oder drei vom gewünschten Vater. Dies konnte aber nur geschehen, wenn die Deckung möglichst bald vonstattenging, da anderenfalls alle Eizellen bereits von Streunerspermien besetzt waren und sich mit diesen zu scheußlichen Bastardkonglomeraten verbanden. Man beschloss, Pihe eine Viertelstunde Pause zu gewähren. Die Frau holte aus dem Haus ein Würstchen, um die Laune der Hündin zu heben. Es funktionierte. Der Rüde wurde wieder gebracht, und diesmal ließ Pihe ihn an sich heran.
2.
Mit höchster Anspannung war Pihes Wurf erwartet worden, und als man eines Morgens die fiependen Knäuel entdeckte, ließ man sie sogleich von Hand zu Hand gehen. Jack Russell oder Promenadenmischung, was würde aus ihnen wohl werden? Verwandte und Nachbarn erschienen, um ihre Meinung zu den blinden, noch undefinierten Würmern abzugeben. Fünf Welpen hatte Pihe geworfen, weniger als sonst, und vier davon waren weiß mit winzigen lohfarbenen Abzeichen – für diese bestand Hoffnung. Der fünfte aber, ein kleiner Rüde, war von der Nasen- bis zur Schwanzspitze kohlrabenschwarz – hier war Hopfen und Malz verloren. Berti – denn um diesen handelte es sich – hörte nun jenes ungarische Wort, das er als den ersten seiner vielen Namen ansah: Fekete. Das bedeutete: Schwarz. Der Zufall wollte es, dass es sich dabei auch um den Familiennamen seiner Besitzer handelte, und man hätte nun den Schluss ziehen können, dass die Feketes ob dieses Umstandes eine besondere Verbindung zu Berti empfanden, aber das Gegenteil war der Fall. Nur den weißen Welpen schenkte man Aufmerksamkeit, nur für die weißen wurde Bertis Mama mit Rosinenbrötchen gefüttert, ja, es kam sogar vor, dass man Berti mitten im Saugen von der Zitze wegzog und einen weißen daran ansetzte.
„Vielleicht wird er ja noch ganz süß, und wir können ihn verkaufen“, sagte Frau Fekete zweifelnd.
„Niemals“, erwiderte ihr Mann, „er sieht aus wie etwas, das direkt aus der Hölle kommt. Wie ein kleiner Teufel.“
„Wie diese scheußlichen südamerikanischen Fledermäuse“, fügte der junge Fekete hinzu, der eine Dokumentation im Fernsehen gesehen hatte.
Schon bald aber fielen auch die weißen Welpen in Ungnade. Ihre Rücken wurden lang und länger, ebenso wie ihre Schnauzen, sie bekamen struppiges Fell und kleine Kinnbärtchen. Es bestand kein Zweifel: Zwar hatten sie die Färbung ihrer Mutter, davon abgesehen aber waren die Gene des Streuners zum Zug gekommen.
Hündin und Welpen wurden fortan sich selbst überlassen. Es gab auch keine Rosinenbrötchen mehr.
3.
Als die Welpen sechs Wochen alt waren, kam der junge Fekete mit einer Transportbox in den Zwinger. Pihe wusste, was nun folgte, und hektisch begann sie ihre Jungen abzuschlecken, als müsste sie sie für die Reise zurechtmachen.
Sie hatte nie jenen Zeitpunkt erlebt, zu dem eine Hundemutter ihren groß gewordenen Jungen klarmachte, dass diese Mutter-Kind-Sache nun vorbei sei und sie sie in Ruhe lassen sollten. Soweit war es nie gekommen. Bei ihren ersten beiden Würfen hatte Pihe Widerstand geleistet, hatte geknurrt, gebellt, die Zähne gefletscht, war immer wieder mit allen vieren seitlich gegen den Mann gesprungen, bis dieser aus der Hocke in den Staub kippte, und einmal hatte sie ihn sogar in den Finger gebissen. Das aber hatte sie mit Schlägen und längerer Haft in einem kleinen Käfig gebüßt, sodass sie in der Folge resignierte und dem Raub ihrer Welpen nur mehr mit unterdrücktem Winseln zusah.
Der junge Fekete brachte die vollgestopfte Transportbox zu dem klapprigen Passat, mit dem man die Hunde über die Grenze nach Österreich brachte (die besseren Autos wurden dafür nicht verwendet, da der Verkauf aus ihren Kofferräumen kaum funktionierte – der Kunde hatte wohl nicht das Gefühl, etwas Gutes zu tun, wenn er Welpen aus einem fabrikneuen Hyundai erwarb). Dann ging er, um einen Wurf Malteser und die erst fünf Wochen alten Französischen Bulldoggen zu holen. Frau Fekete erschien mit drei Wäschekörben, deren Böden mit Papierstreifen aus dem Schredder bedeckt waren – in diese würden die Welpen dann zum Verkauf gesetzt werden. Skeptisch betrachtete sie Berti, der eine winzige Pfote durch das Gitter der Transportbox steckte. Leider gelang es ihm nicht, die Pfote auch wieder hineinzuziehen, sodass er in reichlich ungemütlicher Position am Gitter hängen blieb. Frau Fekete machte keinerlei Anstalten, ihm zu helfen.
„Ich bin gespannt, ob den jemand will“, sagte sie. „Er ist so schwarz, dass man eigentlich gar kein Gesicht sieht. Er ist nur ein schwarzer Fleck.“
„Für Thailand wäre er perfekt“, erwiderte ihr Sohn, der einen Artikel im Internet gelesen hatte, „dort gilt schwarzer Hund als besonders wohlschmeckend und bekömmlich.“
4.
Die Feketes hatten drei Verkaufsargumente für ihre Welpen. Erstens: Sie waren niedlich, und zwar weitaus niedlicher als jene, die man beim regulären Züchter bekam. Dies lag daran, dass sie auch weitaus jünger waren als bei diesem. Der reguläre Züchter gab die Welpen – egoistisch, vermutlich, um selbst die niedlichste Zeit mit ihnen zu erleben – erst in einem Alter ab, in dem sie aus der Niedlichkeit bereits herausgewachsen waren. Was sollte das für einen Sinn haben? Der Mensch – und namentlich die Frau – wollte Hundebabys haben, die an Fingern nuckelten, aus Handtäschchen guckten und hilflos torkelten und tapsten, nicht muskelbepackte Teenager-Hunde, die schon Flausen bekamen.
Zweitens: Der Preis. Die Welpen der Feketes waren nicht nur niedlicher, sondern auch erheblich billiger als die vom regulären Züchter. Ungefähr halb so teuer. Und das, obwohl es sich um reinste Rassehunde handelte. Ein Spitzen-Preis-Leistungs-Verhältnis.
Der dritte verkaufsfördernde Faktor wirkte subtil und war von den Feketes mit feinem psychologischen Gespür in jahrelanger Beobachtung erkannt worden. Der österreichische Kunde, der ja nur zur Hälfte ein Ost-, zur anderen aber ein Westeuropäer war, schätzte das gute Gefühl, das mit dem Bewusstsein einherging, sich karitativ zu betätigen. Er – und namentlich sie – wollte nicht nur einen Hund haben, sondern ihn auch retten. Der Welpe sollte also nicht nur niedlich und billig sein, sondern auch aus düsteren Verhältnissen freigekauft werden können – daher der klapprige Passat. Als Verkäufer fungierten Vater und Sohn, die sich dafür eigens einen Dreitagebart stehen ließen und ausgebeulte Jogginganzüge anlegten. Sie gaben sich einen mürrischen Anschein und packten die Welpen hart an. Mutter Fekete im feinen Kostüm und mit frischgefönten Haaren hatte sich als verkaufshindernd erwiesen. Bei einer so netten, adretten Frau, dachten die Leute, hatten es die Hunde sicher gut.
5.
Sie fuhren über die Grenze nach Österreich und weiter nach Wien, wo sie des älteren Fekete Schwester besuchten, die dort als Sozialpädagogin am Jugendamt dafür sorgte, dass niemand seine Kinder vernachlässigte. Heute aber war Samstag und sie empfing die Verwandten zu Hause mit Kaffee, Kuchen und Energydrinks. Einen der Malteserwelpen übergab man ihr, sie würde ihn an eine Arbeitskollegin verkaufen, der Rest der Hunde wartete im Kofferraum. Nach guten zwei Stunden ging es weiter zur Westautobahn, auf dieser eine Stunde lang bis zu einem altbewährten Rastplatz mit Picknicktischen und Toiletten. Hier blieben die Leute gerne stehen, es war ein sauberer, gemütlicher Rastplatz mit landschaftlich schönem Hintergrund: Das Stift Melk lag auf seinem Hügel wie eine rotgoldene Brosche auf grünem Samt. Das Wetter war herrlich. Man hatte sehnsüchtig darauf gewartet, denn dass schönes Wetter auf den verkaufstechnisch günstigen Samstag fiel, kam nicht unbedingt nach Bedarf vor. Ein frischer, leuchtend blauer Himmel spannte sich über die Autobahn, eine Maisonne blitzte, die schon an den Juni denken ließ. Die Feketes parkten an einer gut einsehbaren Stelle, öffneten den Kofferraum und räumten die Welpen aus den Transportboxen in die Wäschekörbe um. Sie stellten zwei Campingstühle auf, in denen sie sich mit weiteren Energydrinks niederließen.
Die Kundschaft ließ nicht lange auf sich warten. Frauen flehten ihre Männer an, Kinder ihre Eltern: Bitte! Bitte! Er ist so süß. Er ist so billig. Man tut doch auch etwas Gutes, wenn man so einen kleinen Kerl aus Ungarn und aus dem Wäschekorb befreit. Wer weiß, was die mit denen machen, die nicht verkauft werden!
Am frühen Nachmittag hatten bereits zwei Drittel der Welpen den Besitzer gewechselt, waren in schützende Arme und an pochende Herzen gepresst davongetragen worden. Manche Leute, die nicht genügend Bargeld dabei hatten, fuhren sogar von der Autobahn ab, um einen Bankomaten zu suchen. Am besten gingen die Französischen Bulldoggen – laut Ansicht von Frau Fekete wurden sie deshalb so gerne von Frauen gekauft, da es ein Leichtes war, neben ihnen schön auszusehen. Aber auch Pihes weiße Welpen fanden ihre Abnehmer, der Begriff „Jack Russell-Mix“ wirkte auf die Kunden elektrisierend. Zum einen war es sympathisch, einen Mischling zu besitzen, wies man sich dadurch doch als tolerant und weltoffen aus, zum anderen waren Jack Russells sehr in Mode gekommen, nachdem einer ihrer akrobatisch besonders talentierten Vertreter eine deutsche Castingshow gewonnen hatte. Es lag also im Trend, sich einen Jack Russell oder zumindest Jack Russell-Mix zuzulegen. Die Enttäuschung war groß, wenn dieser auch noch nach Monaten keinerlei Anstalten machte, von sich aus drollige Kunststücke vorzuführen, und sich stattdessen in Ermangelung anderer Beschäftigung zum konsequentesten Kläffer der Nachbarschaft entwickelte.
Berti sah aus, als gehörte er nicht dazu. „Was ist denn das für einer?“, fragten die Leute und konnten es kaum glauben, dass er mit den Jack Russell-färbigen Welpen verwandt sein sollte. Anfangs war er noch durch die geschredderten Papierstreifen gestakst wie ein Tiger durch den Dschungel, dann, als sie plattgetreten und von Ausscheidungen durchtränkt waren, wurde auch er schlapp. Er hatte seit vielen Stunden nicht mehr getrunken und spürte den Durst wie eine Naturkatastrophe, wie eine Krankheit: umfassend, existenzbestimmend. Jedes Mal, wenn eines seiner Geschwister verschwand, war es für ihn, als würde ein Loch aufbrechen, durch das der Wind hereinfuhr. Es wurde kälter und unwirtlicher um ihn, das Leben nahm einen lebensentziehenden Verlauf.
Für die Betrachter war Berti das, was er schon für Frau Fekete gewesen war: ein schwarzer Fleck. Nur ein einziges Mal hatte ihn ein Bub aufgehoben und genauer angesehen. „Iiihhh!“, sagte der Bub und drehte Berti auf den Rücken, „der hat ja eine Warze am Kinn, aus der ein fettes Haar wächst!“ Das war leider wahr und förderte Bertis Verkaufschancen nicht.
Als die Sonne tiefer in den Westen sank, packten die Feketes zufrieden ihre Jausenbrote aus. Breitbeinig, wie es der Ausdruck von Maskulinität verlangte, lümmelten sie in ihren Campingstühlen und kauten. Eine junge Frau näherte sich ihnen im Zickzack-Kurs, es sah fast ein wenig aus, als würde sie sich anpirschen. Sie trug Kleidung, die nach Abverkauf beim Textildiskonter aussah – geklaut beim Designer, hergestellt in einem Sweatshop in Bangladesch –, eine Drahtbrille, lange, halb um den Hals gewickelte Haare. Typ: Studentin der Bodenkultur. Vater und Sohn Fekete erkannten sofort, dass hier keine potentielle Kundin auf sie zuging, sondern jemand, der Ärger machen wollte, und sie setzten sich noch breitbeiniger hin, um Haltung zu demonstrieren. Dann stand die junge Frau vor dem geöffneten Kofferraum und ließ die Augen von einem Wäschekorb zum anderen schnellen. In ihrem Gesicht stand nicht Entzücken, wie in jenen der anderen Betrachter, sondern Entsetzen. Sie seufzte und schüttelte den Kopf, als würde sie auf ein fürchterliches Gemetzel hinabsehen. Als die beiden Männer keinerlei Anstalten machten, ihren Zustand zu würdigen (der junge Fekete rülpste sogar laut, um seine Entspanntheit deutlich zu machen), begann sie laut zu schimpfen.
„Sie dürfen das nicht!“, rief sie, „Sie können doch hier nicht lebende Hunde verkaufen! Hören Sie auf damit, oder ich rufe die Polizei!“
Einen Moment lang überlegte Vater Fekete, ob es hier nun klüger wäre, des Deutschen mächtig zu sein oder eher nicht, und entschied sich für Ersteres. Sie irre sich leider, erklärte er der aufgeregten Frau, denn der Verkauf von Welpen am Straßenrand sei genauso legal wie der von Spargel, Erdbeeren, Honig oder Kirschen. Jeder dürfe seine eigenen Produkte verkaufen, ob sie das denn nicht wisse? Habe sie denn selbst noch nie etwas bei einem Straßenstand gekauft? Kürbisse? Marillen? Knoblauchketten? Die Frau bestand darauf, dass Tiere mit Obst und Gemüse nicht vergleichbar seien, aber man sah ihr an, dass sie unsicher wurde.
Tatsächlich hatten die Feketes bereits öfters Bekanntschaft mit aufgeregten Personen und der von diesen herbeigerufenen Polizei gemacht. Wenn die Beamten nichts Besseres zu tun hatten, machten sie ein bisschen Ärger, kontrollierten Ausweise, durchsuchten das Auto langwierig nach Drogen oder ließen die Hunde vom Amtstierarzt untersuchen. Es endete immer damit, dass man ihnen die Welpen wieder aushändigte und sie weiterfahren ließ – Eigentum war schließlich Eigentum und Freiheit war Freiheit –, aber so eine Amtshandlung kostete doch viel Zeit. Es empfahl sich also, nichts unversucht zu lassen, und Herr Fekete senior griff zu seiner wirksamsten Waffe: Er holte einen putzigen, flauschigen Malteserwelpen aus dem Korb und reichte ihn der jungen Frau: „Wollen Sie halten?“ Sie konnte nicht widerstehen (wer konnte das schon?). Wie ein Schneeball saß das Hündchen auf ihren Handflächen, und als sie es an sich drückte, kletterte es hinter ihr Ohr, wo es etwas mit seiner Schnauze zu suchen schien.
„Ich kann sein Herz fühlen!“, hauchte die Frau, und Herr Fekete lächelte.
„Fünfhundert Euro“, sagte er, „Okkasion!“
„Es geht nicht“, erwiderte die Frau, „mein Freund hat eine Tierhaarallergie.“
„Wissen Sie was?“, sagte Herr Fekete. „Ich mache für Sie Sonderpreis. Spezialpreis, bester Preis von ganze Tag. Dreihundertfünfzig Euro.“
Der Welpe war auf die Handflächen der Frau zurückgekehrt. Plötzlich fielen ihm die Augen zu, der Kopf nickte zur Seite, er schlief ein. Was tatsächlich völlige Erschöpfung war, sah aus wie innigstes Vertrauen. Die junge Frau riss die Augen auf, man konnte sehen, wie es in ihr arbeitete. Wahrscheinlich zog sie gerade in Erwägung, ihren Freund umständehalber an einen guten Platz abzugeben. Sie bewegte lautlos die Lippen, als würde sie in Gedanken mit jemandem verhandeln. Dann fuhr plötzlich ein neuer Geist in sie, und entschlossen legte sie den Welpen in den Wäschekorb zurück.
„Es ist keine Frage des Preises“, sagte sie, „es geht einfach nicht.“ Wie betäubt ging sie über den Parkplatz zurück zu ihrem eigenen Wagen, und die Feketes berieten sich sotto voce, ob die Sache mit der Polizei wohl vergessen wäre. Man beschloss, das Risiko einzugehen. Die dösenden Welpen wurden angestupst, aufgehoben und fallengelassen, damit sie noch einmal muntere Drolligkeit zur Schau stellten, denn wie ein Raubtier reagierte der Kunde vor allem auf Bewegung – reglose Tiere konnte er leicht übersehen.
Als sich von Osten her erste Dämmerung über das Stift Melk zu schieben begann und im Westen früchtefarbene Wolkenrüschen die abstürzende Sonne schmückten, waren alle Welpen verkauft, mit Ausnahme jener beiden, für die man Unverkäuflichkeit prognostiziert hatte: Berti und ein Französisches Bulldoggenweibchen mit einer Augenentzündung, die selbst für die mildtätigsten Seelen nach zu hohen Tierarztkosten aussah. Die normalerweise weißen Halbmonde, die die Augäpfel links und rechts wie eine Klammer einfassten, waren blutigrot, an den Lidern klebte weißlicher Schleim, und trübe Tränenflüssigkeit tröpfelte über das Gesicht, bis sie im Fell kristallisierte.
6.
Sie hatten die Grenze nach Ungarn bereits wieder überquert, als Frau Fekete ihren Mann am Handy anrief, um sich nach dem Erfolg des Verkaufstages zu erkundigen. Er schilderte ihr das herrliche Wetter, das dazu beigetragen hatte, dass viele Menschen am Parkplatz umherschlenderten und die Blicke schweifen ließen, die sie schließlich zu der geballten Ladung Kindchenschema führten, das sich in den ausgestellten Wäschekörben befand. Obwohl einige harte Feilscher unter den Kunden gewesen waren, hatte man mehr als achttausend Euro eingenommen. Nur jene beiden Welpen, für die man ohnehin nichts anderes erwartet habe, erzählte Herr Fekete, seien übriggeblieben: die Triefäugige und der Schwarze.
„Bist du sie schon losgeworden?“, fragte Frau Fekete. Ihr Mann, dem Verschwendung zuwider war, protestierte wie immer in solchen Fällen: Vielleicht werde die eine ja noch gesund und der andere noch niedlich, sodass man am Ende doch ein gutes Geschäft mit ihnen machen würde. Aber seine Frau hatte für Mängelexemplare, Ladenhüter und Restposten nichts übrig. Entweder man retournierte die Welpen an ihre Mütter, dann dauerte es länger, bis diese wieder läufig wurden, oder man kümmerte sich selbst um sie, und dafür hatte man keine Zeit. Also gab es nur eine Lösung.
Seufzend legte Herr Fekete das Handy weg und hielt am Straßenrand. Hier befand sich ein Zuckerrübenfeld, auf der gegenüberliegenden Seite ein Sonnenblumenfeld. Die Pflänzchen waren noch hellgrün und taumelten unbeholfen aus den gepflügten Furchen. Die Straße, die durch das weite, flache Land schnitt, war von Sanddornbüschen gesäumt.
„Schmeiß sie raus“, sagte Herr Fekete zu seinem Sohn.
„Hab ich doch gleich gesagt, dass wir die loswerden müssen“, erwiderte jener, obwohl er zwar nichts gesagt, aber an die Notwendigkeit einer solchen Maßnahme gedacht hatte. Er stieg aus und ging zum Kofferraum.
„Du musst auf den Knopf drücken!“, schrie er nach vorne zu seinem Vater, der in Gedanken versunken war. Der Wind, der sich gerade zu einem abendlichen Sturm aufbaute, pfiff so laut, dass man das Klicken der Entriegelung nicht hörte. Die beiden Welpen lagen aneinandergeschmiegt in einer der Transportboxen und schliefen. Der junge Fekete nahm einen in jede Hand und überlegte, sie in hohem Bogen in den Zuckerrübenacker zu werfen. Dann wirkte auch auf ihn das Kindchenschema, gegen das er noch nicht ganz immun war, und er ging einige Schritte einen Feldweg hinein, an dessen Saum aus hohem, strohigem Gras er die Welpen absetzte. Er ging zum Wagen zurück, und kaum hatte er die Türe hinter sich zugeschlagen, stieg sein Vater aufs Gas.
Lange dauerte die Dämmerung über der Ebene, wo weder Hügel noch Berg die chemischen Reaktionen in der Atmosphäre überdeckten. Berti lauschte dem Pfeifen, Hochrauschen und Zusammenstürzen des Windes, den Halbtonverschiebungen im Brummen der vorbeifahrenden Autos. Es roch überwiegend nach Erde, vereinzelt nach Vögeln, leider aber aus keiner Richtung nach Wasser. Erst als die Sonne untergegangen und Nebel eingefallen war, konnte Berti von den Halmen Wassertropfen lecken. Die kleine Französische Bulldogge hatte sich ins Gras verkrochen und dämmerte vor sich hin, sie hatte keine Kraft mehr, ihren Durst zu stillen. Es wurde kälter, Berti schmiegte sich an seine winzige Leidensgenossin und vermisste die große, warme, atmende Flanke seiner Mama Pihe.
In der Nacht wachte er durch einen scharfen, beängstigenden Geruch auf. Jemand war da, jemand, der nach Hund roch, aber mit der Note des Einzelgängertums, der Gesetzlosigkeit. Instinktiv richtete sich Berti auf und sträubte das Nackenfell. Der Fuchs kam näher, um die Fremden zu beschnüffeln. Da stieg aus Bertis Kehle das erste Knurren seines Lebens. Wie Geröll, das vom reißenden Wasser über den Grund eines Wildbaches geschliffen wurde, klang die Abfolge tiefer, bedrohlicher Töne. Der Fuchs, der keinen großen Hunger hatte, beschloss, sich die Stelle für eine spätere Rückkehr zu merken, und trollte sich.
7.
Der Bauer János Hatvany war Spiegeltrinker. Dies bewirkte, dass er die Welt in angenehmen Farben und wohltuend unklaren Schattierungen sah. Als er an jenem Morgen kurz nach fünf Uhr über den Feldweg schritt, sah er über den ganzen weiten Himmel ein herrliches Aquarell in blassen Gelb-, Blau- und Weißtönen gespannt, das im Osten von der Frühsonne geklärt wurde, während im Westen noch ein grauvioletter Streifen Nacht hing. Er liebte diese frühe Stunde, nie war die Welt verzauberter. Die Sanddornbüsche, die den Verlauf der Schnellstraße markierten, waren vom Wind zu bizarren Gestalten geformt und erschienen wie Unglückliche, die mitten in der Bewegung versteinert waren. Die empfindlichen Rübenpflänzchen dagegen sahen frisch und gesund aus, keine Spur von Schädlingen oder dem gefürchteten Pilz. Wenn es den Sonnenblumenkeimlingen ebenso gut ging, konnte er zufrieden sein. Schnecken und Raupen waren es auch dort, auf die man achten musste, später dann, wenn die Kerne ausgereift waren, plündernde Vögel.
Plötzlich sah Hatvany vor sich auf dem Weg einen schwarzen Fleck, der ungefähr dreieckige Form hatte. Er war schwärzer, als jeder Stein und jeder Baumstrunk es je sein konnten, schwärzer selbst als ein Stück von einem geplatzten Autoreifen. Dann bewegte sich der Fleck und nahm eine andere Form an. Ein Tier? Aber welches? Weder Hase noch Fuchs noch Dachs waren schwarz; das schwärzeste Tier, das es in diesen Breiten gab, war der Maulwurf, aber der war erheblich kleiner als das hier. Der Bauer ging weiter auf das Tier zu, dann bemerkte er, dass es seinerseits auf ihn zukam, und dann hatte er die kritische Entfernung erreicht, ab der er erkannte, worum es sich handelte: einen Hundewelpen. Daran hätte er gleich denken können, schließlich war es nicht das erste Mal, dass er einen Hund auf einem seiner Felder fand. Die Schnellstraße, die zum Grenzübergang nach Österreich führte, war eine übliche Route der Welpenhändler. Auch erwachsene Hunde, derer man überdrüssig geworden war, wurden gerne auf der menschenleeren Strecke ausgesetzt und an einer der verkümmerten Zerreichen entlang des Feldwegs angebunden.
Der Bauer ging weiter auf den Welpen zu und blieb wenige Zentimeter vor ihm stehen. Der kleine Kerl schnupperte interessiert an seinen erdverkrusteten Gummistiefeln und zuckte mit dem Schwänzchen in einem unbeholfenen Versuch zu wedeln. Hatvany hob ihn auf und begutachtete seine Unterseite.
„Junge“, stellte er fest, dann bemerkte er, dass der Welpe vor Kälte zitterte. Er steckte ihn in die Brustinnentasche seiner Jacke und ließ den Blick schweifen: Oft waren es mehrere Welpen, die auf einmal ausgesetzt wurden. Doch am Weg fanden sich keine weiteren auffälligen Flecken, der Grassaum bildete einen durchgängigen Ockerstreif, am Zuckerrübenacker gab es keine Bewegung. Der Bauer ging weiter auf die Schnellstraße zu, um nach seinen Sonnenblumen zu sehen.
Nachts kehrte der Fuchs zurück, und diesmal hatte er Hunger. Im hohen Gras fand er die dehydrierte und halb erfrorene Französische Bulldoggenhündin. Sie hatte sich kaum von der Stelle bewegt, seit er sie zuletzt gesehen hatte. Als ihr sein scharfer Geruch in die Nase stieg, öffnete sie einen Spaltbreit die Augen. Der Fuchs tötete sie mit einem schnellen Biss in den Nacken, dann brach er sie auf und fraß das warme Eingeweide. Anschließend kaute er an den kurzen Beinchen, gemächlich wie ein Cocktailgast, der an einer Selleriestange nagt, dann verschlang er den Rest. Nur den Kopf mit seiner runden, harten Schädeldecke ließ er liegen.
Der Fuchs sollte seine Mahlzeit bereuen – oder er hätte sie bereut, wenn er einen Zusammenhang zwischen ihr und seinem bald eintretenden Leiden herstellen hätte können. Der Welpe trug nämlich einen Virus in sich, der Hunde nur bisweilen, Füchse jedoch immer tötete, und das sehr schnell. Schon nach wenigen Stunden fühlte der Fuchs sich abgeschlagen von hohem Fieber, er erbrach, und bald darauf setzte Durchfall ein. Nach zehn Tagen schleppte er sich aus dem Bau, den er sich mit einem Dachs teilte, und legte sich zum Sterben an den Feldrain, wo die Sonne das Frösteln ein wenig linderte.
Robert Pattinson
1.
Alexandra Székely wusste genau, was ihr bevorstand, als sie aus dem Küchenfenster blickte und die leicht schwankende Gestalt des Bauern Hatvany die Straße entlang kommen sah.
„Oh nein, bitte nicht heute“, sagte sie laut, obwohl niemand da war außer Oszkár, ihrem alten Golden Retriever, der auf seiner Decke lag. Sie hatte im Büro eine volle Mailbox abzuarbeiten und Kunden, die bereits ungeduldig anriefen.
Es gab zwar einen Gehsteig, doch benutzte Hatvany ihn nicht – wahrscheinlich, weil er das Gehen auf Landstraßen gewohnt war. Sie konnte keinen Hund an seiner Seite erkennen, also trug er wohl einen, vielleicht auch mehrere sehr kleine Welpen in den Jackentaschen bei sich. Alexandra Székelys Tochter hatte eben das Haus verlassen, um mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren, und sie selbst hatte vorgehabt, nachdem die Frühstückssachen weggeräumt waren, auf schnellstem Weg in die Arbeit zu fahren. Das konnte sie nun vergessen. Seit dem Tag, an dem sie den Bauern davon abgehalten hatte, einen Sack voller Steine mit ein paar Welpen aufzufüllen und in den Bach zu werfen, hatten sie einen Deal: Er brachte ihr alle Hunde, die er auf seinen Feldern auffand, und bekam dafür die Gewissheit, zum zivilisierten Teil der Menschheit zu gehören, sowie ab und zu ein Päckchen Zigaretten.
Tatsächlich bog János Hatvany in ihre Auffahrt ein und ging auf die Haustür zu. Noch immer konnte sie nirgends ein Welpenschnäuzchen entdecken. Alexandra Székely stellte den Toaster hin, den sie von Krümeln gesäubert hatte, und ging zur Tür, noch ehe es klingelte.
„Junge oder Mädchen?“, fragte sie, nachdem sie einander durch wortloses Kopfnicken begrüßt hatten. Der Bauer bestand darauf, erst in den warmen Flur einzutreten und die Tür hinter sich zu schließen, ehe er ihr seinen Fund zeigte. Im Lauf der Jahre war er fürsorglich geworden und keiner seiner Schützlinge sollte von einem kalten Luftzug geschädigt werden.
„Ein Junge“, sagte er dann, holte Berti aus seiner Brusttasche und hielt ihn Frau Székely so vor die Nase, dass sie die Beweisstücke an dessen Unterleib direkt in Augenschein nehmen konnte. Sie nahm den schwarzen Welpen in die Hände und begutachtete ihn von allen Seiten.
„Oje, das ist keine Rasse“, meinte sie. „War er alleine?“
„Hab keinen anderen gesehen“, erwiderte der Bauer.
„Wo hast du ihn gefunden?“
„In den Zuckerrüben. Nicht weit von der Straße.“
Frau Székely trug Berti in die Küche, wo sie ihn auf den Boden setzte, damit er und Oszkár einander beschnüffeln konnten. Berti war außer sich vor Freude, einen anderen Hund kennenzulernen. Einen großen, wunderbaren Hund, fast so wunderbar wie seine Mama Pihe! Immer wieder versuchte er, auf den alten Graubart hinaufzuklettern, und tappte ihm mit den Pfoten ins Gesicht. Dieser aber war wenig geneigt zu spielen. Er war alt, er war träge, er war ein Golden Retriever: Seine Aufgabe war es, Ruhe auszustrahlen. Als es ihm zu bunt wurde, hob er seine mächtige Pranke und hielt Berti damit am Fußboden fest.
Der Bauer war in der Küchentür stehengeblieben. „Also, dann …“, sagte er.
„Warte noch, ich habe Kirschkuchen!“, rief Alexandra Székely. Sie wusste, dass die Frau des Bauern Krebs hatte und öfter im Spital war als zu Hause, um zu backen. Hastig öffnete sie das Rohr und holte ein Blech Kuchen heraus. Sie schnitt ein großes Stück ab, wickelte es in Alufolie und drückte es János Hatvany in die Hand.
„Danke“, sagte er, „also …“
„Warte!“, rief sie und riss eine Schublade auf, aus der sie ein Päckchen Zigaretten nahm. „Ich danke dir“, sagte sie, als sie es dem Bauern überreichte.
Nachdem die Tür hinter ihm ins Schloss gefallen war, ging sie in die Küche zurück. Der schwarze Welpe lag auf der Hundedecke neben Oszkár, der ihn mit seiner großen, flatternden Zunge abschleckte. Es sah aus, als würde der Pfleger einer psychiatrischen Anstalt versuchen, einen hyperaktiven Patienten zu kalmieren.
Frau Székely hob den Kleinen auf und setzte ihn auf die Anrichte. In eine Untertasse füllte sie eine Pfütze Wasser und stellte sie vor ihn hin. Gierig schleckte er alles auf. Währenddessen griff sie zum Telefon und rief bei ihrer Arbeitsstelle an, um mitzuteilen, dass sie sich aufgrund eines Notfalls den Vormittag freinehmen müsse. Sobald die Untertasse leer war, füllte sie etwas Joghurt hinein, das Berti ebenfalls aufschleckte. Sie rief bei der Tierschutzorganisation an, der sie all die Zeit widmete, die sie gar nicht hatte, und gab bekannt, dass es einen Neuzugang gab. Welpe, männlich, allem Anschein nach gesund. Rasse Mischling, wahrscheinlich irgendwas mit Dackel, schwarz. Vermittlungschancen gut. Sehr gut. Aufgeweckt und kontaktfreudig.
Berti versuchte ungeschickt, seine joghurtbeschmierte Schnauze sauber zu lecken, und blickte sie erwartungsvoll an.
„Noch immer hungrig?“, fragte Frau Székely. Sie öffnete eine Dose Hundefutter und gab einen Löffel davon auf die Untertasse. Als hätte er bereits sein Leben lang feste Nahrung zu sich genommen, fraß Berti alles auf. An seinem Blick erkannte Frau Székely, dass es nun eilte. Sie hob ihn auf und rannte mit ihm vor das Haus, einige Meter weg von ihrem Grundstück, wo sie ihn auf den Grasstreifen neben dem Gehsteig setzte. Prompt erleichterte sich Berti, als wäre alles, was er zu sich genommen hatte, einfach durch ihn hindurchgeronnen.
2.
Der Tierarzt leuchtete Berti in den Rachen, in die Augen und in die Ohren. Er maß seine Temperatur, indem er ihm ein kaltes Thermometer in den After schob, und hörte ihn mit dem harten Bruststück seines Stethoskops ab. Er zwang Berti, eine zerdrückte, nach Erbrochenem schmeckende Wurmtablette zu schlucken und reinigte seine milbenbefallenen Ohren mit Wattestäbchen, die er in eine stinkende Flüssigkeit getaucht hatte. Er stach ihm eine Spritze mit einem Cocktail an Impfseren ins Hinterteil, sowie eine weitere mit Antibiotika, für alle Fälle. Berti merkte sich, dass Menschen in weißen Kitteln böse waren – sehr böse.
„Und, wie soll er heißen?“, fragte der Tierarzt, der sich an seinen Tisch gesetzt hatte, um Berti einen EU-Pass auszustellen. Frau Székely war es schon seit geraumer Zeit leid, den von ihr aufgenommenen Hunden Namen wie Borzi oder Laska oder Piros zu geben, und nicht zuletzt in der Hoffnung, dadurch ihre Vermittlungschancen zu erhöhen, war sie dazu übergegangen, ihnen die Namen von berühmten Hollywood-Schauspielern zu verleihen. Der Erfolg gab ihr recht – immerhin hatten Sandra Bullock, Katherine Heigl, Daniel Craig und selbst eine humpelnde Dogge namens Alec Baldwin bereits gute Plätze gefunden. Nachdenklich betrachtete sie den kleinen schwarzen Rüden.
„Er sieht wie eine Fledermaus aus“, bemerkte der Tierarzt, um ihr zu helfen. Sie dachte an Fledermäuse, an Vampire, an die Vampirfilme, für die ihre Tochter so schwärmte. Und dann wusste sie es.
„Robert Pattinson“, sagte sie.
3.
Binnen einem Tag war Berti von der Hölle des Rübenackers in ein Paradies gelangt, von dem er niemals träumen hätte können. Das Futter war herrlich und wurde in schöner Regelmäßigkeit dargereicht, sodass erst gar kein quälender Hunger aufkam. Das Haus war groß und warm und hatte viele kuschelige Ecken. Es duftete gut nach Hund, was Oszkár zu verdanken war, der zwar an einem bedauerlichen Mangel an Bewegungsdrang litt, dafür aber auch deutlich weniger zum Maßregelungsschnappen neigte als Pihe. Das Beste aber war Gréta, die zwölfjährige Tochter der Frau Székely. Sie roch nach vielerlei Früchten, Schokolade oder Vanille, je nachdem, welche Kosmetika sie auf ihre Haut auftrug, und darunter lag ihr eigener warmer, leicht nussiger Menschengeruch. Er ähnelte jenem der Sonnenblumenkerne, die die Vögel viele Wochen später in einem anderen Land von den Feldern in den Garten tragen würden, um damit ihre Jungen zu füttern. Sie würden die Kerne aus den Schalen picken, die Schalen zu Boden fallen lassen, Berti würde daran schnuppern und sich an Gréta erinnert fühlen.
Gréta war über die Maßen entzückt, als sie von der Schule nach Hause kam und dort Robert Pattinson vorfand. Endlich einmal hatte ihre Mutter einen guten Namen ausgewählt! Sie trug den Welpen in ihr Bett und ließ ihn dort auf ihrem Bauch liegen, während sie alle ihre Freundinnen anrief. Zwei derselben kamen gleich herüber und quiekten und herzten den Kleinen, der fand, dass er endlich als der Prachtkerl gewürdigt wurde, der er im Grunde war. Menschen waren fantastisch. Während Gréta ihre Hausaufgaben machte, durfte Berti über den Schreibtisch spazieren, an den Stiften nagen und aus ihrem Wasserglas trinken. Gréta kannte das Procedere, wie ihre Mutter trug sie ihn danach ins Freie, damit er sich entleeren konnte.
„Oh wie süß!“, rief sie, „du pinkelst ja noch wie ein Mädchen!“ Noch hatte Berti nicht gelernt, wie ein richtiger Rüde das Hinterbein anzuheben, sondern senkte beim Pinkeln einfach das Becken ein wenig ab.
Natürlich wusste Gréta, dass die Hunde, die ihre Mutter aufnahm, nie lange blieben. Als sie klein war, hatte sie so manche Träne darüber vergossen und sich lange, verschwurbelte und generell vollkommen unlogische Erklärungen ihrer Mutter anhören müssen. „Wir können sie nicht alle behalten.“ Wer redete denn von allen, um den Einen ging es, nur den Einen! Aber der Eine wurde immer weitervermittelt, und dann gab es den nächsten Einen, der ebenfalls ging. Einige Jahre lang hatte Gréta die Hunde sogar völlig ignoriert, nicht mit ihnen gespielt, sie nicht gestreichelt oder gefüttert, nur um aus diesem Mühlrad der Enttäuschung herauszukommen. Nur Oszkár blieb, und erst, wenn Oszkár tot war, würde es einen neuen Hund geben. Bisweilen hatte sie Oszkár deshalb sogar den Tod gewünscht, was sie dann durch das geheime Zustecken von Wurstscheiben wieder gutzumachen versuchte. Er konnte ja nichts dafür, dass er zu groß war, um herumgetragen zu werden, zu faul, um bei Apportierspielen eine gute Figur zu machen, und zu alt, um noch Muttergefühle auszulösen. Es war nicht seine Schuld, dass er nicht der Eine war. Ihr Hund, ihr ständiger Begleiter, ihr bester Freund. Aber Robert Pattinson hatte das Zeug dazu, für ihn würde sie noch einmal in die Bresche springen, sie würde um ihn kämpfen, dafür war sie nun alt und stark genug.
„Bei der Heiligen Muttergottes“, sagte sie – sie war kürzlich religiös geworden, hauptsächlich aus dem Grund, weil ihre Mutter antireligiös war – „eines verspreche ich dir, Robert Pattinson: Uns wird sie nicht trennen.“
4.
Alexandra Székely kannte ihre Tochter gut genug um zu wissen, dass sie zwar zahllose Schlachten gewonnen hatte, aber noch lange nicht den Krieg. Eine große Liebe bahnte sich an zwischen Gréta und Robert Pattinson. Frau Székely konnte ihn nicht weggeben, ehe er nicht alt genug war, um gechippt zu werden. Er musste noch etliche Tierarztbesuche absolvieren, seine Gesundheit und sein Impfschutz mussten absolut sichergestellt sein. Erst dann würde er zu einer Pflegefamilie nach Österreich gebracht werden, die seine endgültige Vermittlung in die Hand nahm. Überdies litt er gerade an einer Kehlkopfentzündung und spuckte weißlichen, schaumigen Schleim, was seine Ausreise wohl noch weiter verzögern würde. (Der Virus, der den Fuchs getötet hatte, versuchte sich auch Bertis Organismus’ zu bemächtigen, dank dessen guter Konstitution sollte es ihm aber nicht gelingen.)
Seit ihr Mann, Grétas Vater, weggegangen war, um mit einer anderen Frau andere Kinder zu bekommen, litt sie an Schuldgefühlen. Gréta war noch kein halbes Jahr alt gewesen. Er halte das Leben mit einem Baby einfach nicht aus, hatte er Alexandra erklärt.
„Und das fällt dir jetzt ein?“, hatte sie gekreischt, was nicht ganz unverständlich war angesichts dessen, dass Gréta keineswegs das Ergebnis eines „Unfalls“ war. Vielmehr waren ihrer Entstehung eineinhalb Jahre an Hormonkuren, Temperaturmessungen und angestrengtem Zeugungssex vorausgegangen. Neun Jahre hatte Alexandra mit ihrem Mann geteilt, fünf davon verheiratet.
„Hätte dir das nicht früher einfallen können?“, hatte sie gekreischt, immer wieder, aber ihr Mann hatte sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Manche Dinge müsse man eben ausprobieren, sagte er, ehe man mit absoluter Sicherheit wisse, dass sie für einen nicht das Richtige seien. Als Alexandra ihn ein Jahr später im Supermarkt mit einem Baby in der Bauchtrage sah, blieben ihr Luft, Spucke und der Glaube an Gott mit einem Schlag weg.
Nicht lange nach seinem Auszug hatte sie mit der Arbeit für die Tierschutzorganisation begonnen. Es hatte etwas damit zu tun, dass sie den Hunden das geben wollte, was ihr – so schien es zunächst – zerschlagen worden war: eine Familie, ein Zuhause. Es hatte sich aber bald herausgestellt, dass Familie und Zuhause auch ohne ihren Mann weiterbestanden. Sie hatte geschuftet, um den Kredit für das Haus abzubezahlen, sie hatte sogar ein wenig Karriere gemacht. Gréta entwickelte sich mit Unterstützung der Großeltern prächtig.
„Ist er wegen mir gegangen?“, fragte sie manchmal, als sie älter wurde.
„Nein“, antwortete Alexandra, „die Liebe kommt, die Liebe geht. Das ist ganz normal.“ Was Männer anging, hatte sie beschlossen, nicht länger mit Partnern, sondern nur noch mit Liebhabern zusammen zu sein. Es funktionierte gut. Das Herzenbrechen war nun Alexandras Sache geworden.
Die Schuldgefühle ihrer Tochter gegenüber aber kehrten immer wieder. Hätte sie etwas anders, besser machen können, um zu verhindern, dass ihr Mann ging? Hätte sie nicht wenigstens einen stabilen Ersatz-Papa in ihr Leben integrieren müssen? Und auch die Sache mit den Hunden, die kamen und gingen, war selbstverständlich schwierig. Aber Alexandra hatte sich nun einmal vorgenommen, vielen zu helfen. Und vielen konnte man nur helfen, wenn man sich nicht an sie band. Bei manch einer ihrer Kolleginnen in der Tierschutzorganisation hatte sie sehen können, wohin es führte, wenn man einmal von diesem Prinzip abwich. Plötzlich hatte man drei, vier, fünf Hunde, Katzen kamen dazu, und schließlich begann man auch Nymphensittiche, Schildkröten und Dsungarische Zwerghamster aufzunehmen, die kein anderer haben wollte. Man musste Überstunden reduzieren, halbtags arbeiten, den Job kündigen, Schulden und Scheidungen waren die Folge, und nicht zuletzt Kinder, die sich darüber beklagten, dass ihr Leben ein Jammertal ohne Urlaube und Markenkleidung war.