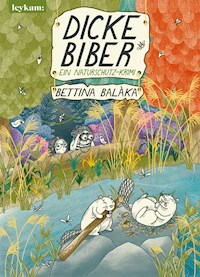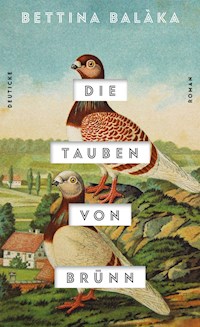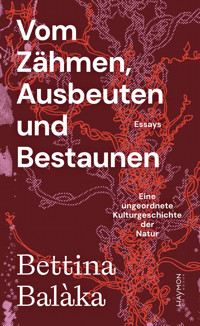
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Toxic Relationship – der Mensch und die Natur Zwischen Lovebombing, Grenzenlosigkeit und Zerstörung Wir haben die Natur kartiert und taxonomiert, wir lieben und vernichten sie zugleich. Kognitive Dissonanz ist unser Alltag. Dabei kontrastiert das permanente Bedürfnis, Tiere, Pflanzen, Ökosysteme unter Kontrolle zu bringen und nutzbar zu machen, mit dem mittlerweile ebenso großen Bedürfnis, die Wildnis zu sehen, zu bereisen, zu genießen. Der Wunsch, Ordnung durch Bodenversiegelung herzustellen, geht einher mit der Sehnsucht, der Asphaltwüste der Städte zu entfliehen und in Wäldern aufzutanken. Man will das Unberührte berühren, idealerweise als erste und einzige Person, aber auch sicher und klimatisiert – und weiß um das Paradoxon. Wohin uns das führt? In den Abgrund. "Das einzige Tier, das seinen eigenen Lebensraum vernichtet, ist der Mensch." Die erobernde Beziehung des Menschen zu Umwelt und Mitgeschöpfen hat tiefe Wurzeln in der Tradition und Religion. Es gibt eine Fülle von bizarren Verhaltensweisen und Meinungen auszuloten. Man will fühlenden, intelligenten Lebewesen möglichst nahe sein und sperrt sie daher ein. Demgegenüber steht etwa der amerikanische Anwalt Steven Wise, der dafür kämpft, zumindest Menschenaffen, Elefanten und Meeressäugern aufgrund ihrer kognitiven Fähigkeiten Persönlichkeitsrechte zu geben. Dabei gibt es viele Wildtiere bereits nur mehr in Gefangenschaft. Was von ihnen in ihrer natürlichen Umgebung noch übrig ist, wird gierig beforscht. Doch wie und wann hat das eigentlich alles begonnen? Nature Writing auf einem ganz neuen Level Die Autorin Bettina Balàka versteht es, Geschichte, Forschung und literarische Erzählung über ein so weitreichendes Thema wie "Natur und Mensch" auf beeindruckende Weise zu vereinen. In einer Reihe von Essays arbeitet sie dieses ambivalente Verhältnis auf: subjektiv und wissenschaftlich, historisch und persönlich, gejätet und verwildert, analytisch und experimentell. Sie schreibt von Überfischung und Meereserforschung, Tierhaltung und Veganismus, Klimakatastrophe und Verehrung – und darüber, dass es nicht nur ein individuelles Umdenken braucht, sondern politische Entscheidungen: für diesen Planeten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
“Humans love to commune with nature, but they can’t seem to do so without colonizing it.”
Geoffrey C. Howes
Inhalt
Cover
Titel
Motto
Inhalt
Das Unberührte berühren. Ein Vorwort
Vorstellungen und Einstellungen
Zoobesuch mit Kinderschnitzel
In andere Häute schlüpfen: Empathie in der Literatur
Brot und Spiele: Nahrung und Entertainment aus der Natur
Kraut und Unkraut: Vom Anbauen und Verbauen
Vom Dschungel ins Puppenheim: Die Zerstörung der Wildnis und der Transfer von Flora und Fauna
Nicht Fisch, nicht Fleisch: Wenn Bewusstmachung die Geschmacksnerven verändert
Ausgebüxt: Tiere auf der Flucht
Geschichte und Geschichten
Geister im Naturhistorischen Museum
Von Lerchen und Lercherln in Wien
Das Öffnen der Zeitkapseln: Wiederentdeckte Naturaliensammlungen des Stifts Seitenstetten
Beaver believer
Danksagung
Eine ungeordnete Literaturliste
Weitere e-books aus dem Haymon Verlag
Über die Autorin
Impressum
Das Unberührte berühren. Ein Vorwort
Wir haben die Natur kartiert und taxonomiert, wir lieben und vernichten sie zugleich. Kognitive Dissonanz ist dabei unser Alltag. Die erobernde Beziehung des Menschen zu Umwelt und Mitgeschöpfen hat tiefe Wurzeln in der Tradition und Religion. Dabei kontrastiert das permanente Bedürfnis, Tiere, Pflanzen, Ökosysteme unter Kontrolle zu bringen und nutzbar zu machen, mit dem mittlerweile ebenso großen Bedürfnis, „die Wildnis“ zu sehen, zu bereisen, zu genießen. Man will das Unberührte berühren, idealerweise als Erster und Einziger, aber auch sicher und klimatisiert – und weiß um das Paradoxon.
Dabei ergeben sich eine Fülle von bizarren Verhaltensweisen und Meinungen. Man will fühlenden, intelligenten Lebewesen möglichst nahe sein und sperrt sie daher ein, um sie wie Gegenstände zu bestaunen, oder zwingt sie gar zu Kunststücken, um von ihnen unterhalten zu werden. Dem gegenüber steht die – etwa von dem amerikanischen Anwalt Steven M. Wise propagierte – Forderung, zumindest Menschenaffen, Elefanten und Meeressäugern aufgrund ihrer kognitiven Fähigkeiten Persönlichkeitsrechte zuzuerkennen. Dabei existieren viele Wildtiere bereits nur mehr in Gefangenschaft, weil man in atemberaubendem Tempo ihre Lebensräume zerstört. Aber nicht nur in Zoos, Wildparks und Aquarien werden Wildtiere eingesperrt, sondern auch in vielen Privatwohnungen. Aber wohin mit den Gefangenen, wenn sie zu groß werden, man ihrer überdrüssig ist oder ihr Leiden nicht mehr erträgt? Kann man die Mata-Mata in den Donauauen oder den Axolotl in den Kärntner Kalkalpen aussetzen?
Was an Wildtieren in der Wildnis noch übrig ist, wird gierig beforscht und dabei nicht nur gequält und beeinträchtigt (etwa durch das Einfangen mittels Betäubungsgewehr, Einstanzen von Ohrmarken oder Anbringen von behindernden Sendern), sondern durchaus auch getötet und zerstört, etwa wenn man im Dienste der Wissenschaft mit Schleppnetzen den Meeresgrund abrasiert, um ein erstes und gleichzeitig letztes Mal zu erfahren, was dort so lebt beziehungsweise ab sofort gelebt hat.
Das Bedürfnis, Ordnung durch Bodenversiegelung herzustellen, geht einher mit dem komplementären Bedürfnis, der Asphaltwüste der Städte zu entfliehen und in möglichst unberührten Wäldern Lebensenergie aufzutanken. Bei der Jagdkonkurrenz mit Raubtieren wird so getan, als wäre es für Schafe angenehmer, im Schlachthof an den Hinterbeinen aufgehängt und per Kehlschnitt getötet als auf der Wiese von einem Wolf gerissen zu werden. Das menschliche Streichelbedürfnis geht nahtlos ins Schlachten und Verzehren der Gestreichelten über. Dabei stellt sich die Frage: Wann hat das alles begonnen? Und wie weit – in einem durchaus geografischen Sinne – wäre die Menschheit wohl gekommen ohne die Hilfe von Pferden, Kamelen, Elefanten und Hunden?
Die folgenden Essays beschäftigen sich mit dem ambivalenten Verhältnis des Menschen zur Natur, subjektiv und wissenschaftlich, historisch und persönlich, gejätet und verwildert, analytisch und experimentell.
VORSTELLUNGEN UND EINSTELLUNGEN
Zoobesuch mit Kinderschnitzel
Ein Besuch im Zoo gibt Anlass zu allerlei ethischen Überlegungen, vor allem, wenn man mit Kindern hingeht. Warum zum Beispiel ist der Eisbärpapa von der Eisbärmama und den -kindern getrennt? Gab es etwa eine Scheidung und nun wird dem Papa das Umgangsrecht verweigert? Nein, nein, beruhigt die Zoologin die Kinder, die von allerlei anthropomorphisierten Bärenfamilien in Bilderbüchern, wo der Bärenpapa mit der Brille auf der Nase den Bärenkindern eine Gutenachtgeschichte vorliest, hinters Licht geführt wurden. Der Eisbärpapa muss von der Familie getrennt werden, weil er die Jungen auffressen würde. Er ist nicht böse. Er sieht die Jungen einfach als Beute an.
Im Anschluss führt man die Kinder dann gerne zu den Kaiserpinguinen, wo die Väter in vorbildlicher Weise halbe-halbe bei der Aufzucht des Nachwuchses machen. Man muss allerdings aufpassen, wenn die Kinder in der Folge einen Dokumentarfilm zum Thema anschauen. Es sind da erschütternde Dinge zu sehen. Kaiserpinguineltern, die ihr eigenes Ei verloren haben – rollt es auf das Eis, stirbt der Embryo schon nach ein bis zwei Minuten ab –, gehen auf erbarmungslose Raubzüge, um fremde Küken zu entführen. Oft stürzen sich so viele Pinguine in Entführungsabsicht auf ein Küken, dass sie es unter sich ersticken. Auch in der Kaiserpinguingesellschaft gäbe es nach menschlichem Strafrecht so einige Verurteilungen.
Raubtierfütterung. Warum, fragen die Kinder, sind die Kaninchen, die den Geparden vorgeworfen werden, bereits tot? Das, erklärt die Zoologin, gebietet das Tierschutzgesetz. Das menschliche Gesetz schreibt vor, dass das Kaninchen nicht wie in der Natur vom Geparden gejagt und mit einem Nackenbiss getötet werden darf, sondern vom Menschen schonend und stressfrei eingeschläfert werden muss. Was sie den Kindern nicht erzählt, ist, dass das in einer Gaskammer geschieht, die wie eine riesige Mikrowelle aussieht. In die Futtertieraufzuchtstationen, wo Meerschweinchen, weiße Ratten, Kaninchen, Mäuse und Heimchen gezüchtet werden – für Letztere wie für andere Insekten gilt das Tierschutzgesetz nicht und sie dürfen lebend verfüttert werden –, führt man die Kinder nicht. Sie würden angesichts der Gaskammer, in die die flauschigen, putzigen Futtertiere nicht unbedingt stressfrei, aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit gestopft werden, wohl zu weinen beginnen. Denn das ist es, worum es tatsächlich geht: die Sichtbarkeit. Es wäre unvorstellbar, den Panther vor den Augen der Besucher:innen ein Rind schlagen zu lassen. Schöner sieht es aus, ihm eine fein säuberlich geviertelte Karkasse vorzulegen.
Irgendwann bekommt man selber Hunger und geht mit den Kindern in einen Gastronomiebetrieb, wo sie ein Kinderschnitzel verzehren können. Dem Schwein, das den Rohstoff zu diesem Schnitzel geliefert hat, hat man ohne Betäubung die Zähne abgeschliffen und den Schwanz per Brennstab kupiert. Kupieren ist ein schöneres Wort für abschneiden. Sofern das Schwein männlich war, wurde es auch ohne Narkose kastriert. All das ist erlaubt, weil man es nicht sieht. Das menschliche Gesetz ist bar jeder Logik, denn würde man dieselben Folterungen bei einem Hund durchführen oder einem Geparden, würde man sich strafbar machen. Der Unterschied ist nicht mit der Intelligenz des Tieres begründet. Nach Ansicht von Tiertrainern sind Schweine sogar intelligenter als Hunde. Der Unterschied liegt in der Definition des Schweines als Nutztier. Für Nutztiere gilt das Tierschutzgesetz nicht. Das Nutztier ist de jure immer schon Fleisch und niemals ein Lebewesen. Die Kinder wären nachhaltig traumatisiert, wenn sie sehen könnten, wie so ein Schwein am Schlachthof vor Angst und Schmerzen schreit, geprügelt wird, mit Kohlendioxid mehr erstickt als betäubt wird und im schlimmsten Fall noch am Leben ist, wenn es ausblutet und ihm die Borsten von der Haut gesengt werden.
Kognitive Dissonanz entsteht bei nicht miteinander zu vereinbarenden Haltungen und Handlungen. Man will nicht, dass Tiere leiden, will aber trotzdem Fleisch essen. Dieser psychologische Konflikt löst unangenehme Gefühle aus, man versucht ihn mit allen Mitteln zu vermeiden. Niemand könnte sich noch amüsieren, wenn das Schreckliche sichtbar würde. Darum darf der Gepard im Zoo keine Beute schlagen, darum hofft man, dass es doch ein richtiges Leben im falschen gibt. Und darum ist es genau das, was wir bis zum Äußersten hinterfragen, entzaubern und entkleiden sollten: das Schreckliche, das mit einer goldenen Panier und einem Petersiliensträußchen auf einem schönen Teller liegt und von keinem bemerkt wird. Nicht weil man nicht darum weiß, sondern weil man es ausblenden kann. Das Schreckliche, das verbrämt, entfernt und normal ist, weil autorisiert wie im Milgram-Experiment. Das Schreckliche, das als das Gute daherkommt.
In andere Häute schlüpfen: Empathie in der Literatur
Patricia Highsmith (1921–1995) hatte ein feines Gespür für Grausamkeiten. In ihrer 1962 erschienenen Kurzgeschichte „The Terrapin“ nimmt sie sich exemplarisch zweier Gruppen an, mit denen oft gedankenlos umgesprungen wird: Kinder und Tiere.
„Terrapin“ bezeichnet verschiedene Arten von Sumpfschildkröten, die in Nordamerika heimisch sind und bis vor wenigen Jahren im europäischen Zoohandel als Babys verkauft wurden, wie Rotwangen- oder Gelbwangen-Schmuckschildkröten. Da sie bis zu dreißig Zentimeter groß werden können und dann nicht mehr gut in ein praktisches kleines Aquaterrarium passen, wurden sie oft im nächstliegenden Gewässer ausgesetzt. Dort verdrängten sie die heimische Europäische Sumpfschildkröte, sodass sie in der EU mittlerweile auf der Liste invasiver Arten stehen und nicht mehr importiert, gezüchtet oder verkauft werden dürfen.
Highsmiths Schildkrötengeschichte wird aus der Perspektive eines elfjährigen Jungen namens Victor erzählt, der mit seiner Mutter in einem winzigen Apartment in New York lebt. In wenigen kräftigen Pinselstrichen wird das angespannte Verhältnis zu ihr skizziert. Als sie vom Einkaufen nach Hause kommt, versteckt Victor schnell das Buch, das er gelesen hat, unter dem Sofakissen – er holt sich gerne Werke über Psychologie aus der öffentlichen Bücherei, aber seine Mutter verbietet ihm diese Lektüre. Obwohl es Oktober ist, muss er kurze Hosen tragen, da sie, eine Ungarisch-Französin, ihn „französisch“ aussehen lassen will. Er wird aufgefordert, ihre aller Wahrscheinlichkeit nach unverkäuflichen Kinderbuchillustrationen zu kommentieren, und als er darüber zu gleichgültig wirkt, als psychisch krank und zurückgeblieben beschimpft. Sie erwartet eine Freundin zu Besuch und er soll für diese ein Gedicht zur Rezitation vorbereiten. Über die Auswahl desselben kommt es zu einer Auseinandersetzung, die für Victor mit einer Ohrfeige endet.
Die Mutter geht ins Bad, um sich die Haare zu waschen, der Junge in die Küche. Da hört er aus den dort abgestellten Einkaufstaschen ein kratzendes Geräusch. In einer Kartonschachtel findet er eine lebende Schildkröte und in Sekundenschnelle ist seine Welt völlig verwandelt: Die Mutter hat ihm ein Haustier als Geschenk mitgebracht! Warum hat sie denn nichts davon gesagt?
Freudig hüpft er zur Badezimmertür, um sie nach der Schildkröte zu fragen. Doch die Antwort ist niederschmetternd: „C’est une terrapène! Pour un ragoût!“ Französisch spricht die Mutter, wenn sie keinen Widerspruch duldet. Darüber hinaus ist Französisch die Sprache der Haute Cuisine, die mit nonchalant verschliffenen Nasalen noch jede kulinarische Grausamkeit veredelt: „Gänsestopfleber“ klingt wenig appetitlich, „foie gras“ jedoch deliziös. Dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, lässt uns ebenso wie dem Jungen das hier angekündigte „ragoût“ weniger das Wasser im Mund zusammen- als kalte Schauer über den Rücken laufen.
Obwohl er weiß, dass er nur wenig Zeit mit ihr hat, beschäftigt sich Victor mit der Schildkröte. Er versucht, sie zu füttern, setzt sie in eine Wasserschale, lässt sie im Wohnzimmer frei herumlaufen – die Bindung wächst ebenso wie das Interesse an ihrer natürlichen Lebensweise. Schließlich sieht er im Wörterbuch unter „terrapin“ nach:
He learned nothing except that the name was of Algonquian origin, that the terrapin lived in fresh or brackish water, and that it was edible. Edible. Well, that was bad luck, Victor thought. But he was not going to eat any terrapène tonight. It would be all for his mother, that ragout, and even if she slapped him and made him learn an extra two or three poems, he would not eat any terrapin tonight.
Als die Mutter schließlich mit gewaschenen Haaren erscheint, nimmt sie ihm die Schildkröte wieder ab, setzt sie in die Schachtel zurück und stellt diese in den Kühlschrank. Der Besuch kommt, das Gedicht wird rezitiert, der Tag vergeht. Victor träumt davon, noch länger mit der Schildkröte spielen zu können, vielleicht sogar mit ihr hinauszugehen, um sie einem anderen Jungen zu zeigen. Doch kaum hat sich die Freundin verabschiedet, stellt die Mutter einen Topf mit Wasser auf den Herd.
Victor watched his mother lift the terrapin from the box, and as she dropped it into the boiling water, his mouth fell open. ‘Mama!’
‘What is this? What is this noise?’
Victor, open-mouthed, stared at the terrapin whose legs were now racing against the steep sides of the pot. The terrapin’s mouth opened, its eyes looked directly at Victor for an instant, its head arched back in torture, the open mouth sank beneath the seething water – and that was the end.
Die Mutter erklärt dem entsetzten Kind, dass ein solcher Tod dem Tier nichts ausmache, wie Hummer verspürten Schildkröten keinen Schmerz. Doch für Victor ist die Sache klar, die Schildkröte hätte nicht so verzweifelt versucht, aus dem Topf hinauszuklettern, hätte sie nicht gelitten. Er beobachtet die Mutter dabei, wie sie die kleinen Krallen des Tieres abschneidet, den Bauchpanzer öffnet, es ausweidet, in Stücke schneidet, mit Sherry und Eigelb schmort. Es wäre nicht Highsmith, würde die Sache nicht äußerst schlecht für die Köchin ausgehen.
Literatur ist eine Übung in Empathie. Man kann sich in andere Menschen hineinversetzen, und ja, auch in Tiere. Highsmith zieht in dieser Geschichte den Leser in einen doppelten Perspektivwechsel hinein, wir schlüpfen in die Haut des Jungen, der in die Haut der Schildkröte schlüpft. Der Kontrast zwischen der Mutter, die den „normalen“ Standpunkt vertritt, der darin besteht, ein lebendes Tier als eine Art Kartoffel anzusehen, und dem des Kindes, für das die Schildkröte nicht nur ein Spielkamerad, sondern auch ein äußerst interessantes Lebewesen ist, wird ohne jedes moralisierende Wort allein durch die präzise Schilderung der Ereignisse, das genaue Hin- und durch die Schleier der alltäglichen Konvention Hindurchschauen gezeichnet. Der Effekt ist verstörend, wir können dem Kochprozess nicht mehr „normal“ beiwohnen, da wir durch die Augen des Kindes (und in den Augen der Schildkröte) sehen, dass hier nichts „normal“ ist.
Auch in Marie von Ebner-Eschenbachs (1830–1916) Erzählung „Die Spitzin“ aus dem Jahr 1901 steht ein Junge im Mittelpunkt. Er allerdings ist grausam zu Tieren – so wie es alle sind, und so wie alle zu ihm sind. Als kaum Zweijähriger wurde er in einem oberösterreichischen Dorf nackt neben der Kirchhofmauer ausgesetzt gefunden. Seine Pflegemutter nannte ihn Provi Kirchhof – sie hatte die Aufforderung des Pfarrers, dem Kind einen „provisorischen“ Namen zu geben, missverstanden. Bald jedoch stirbt die alte Frau und Provi ist auf sich gestellt. Er wird verachtet, geprügelt und beschimpft und vergilt Gleiches mit Gleichem. Allein die Schoberwirtin hat Mitleid mit ihm und gibt ihm jeden Morgen einen Krug Milch. Als ihr Mann verlangt, dass Provi darum bittet, weigert sich dieser. Der mittlerweile wohl Vierzehnjährige ist zu stolz dazu, lieber hungert er. Schließlich arbeitet er als Tagelöhner bei einem Wegemacher, in dessen Ziegenstall er schlafen darf.
Die fünf Wegemacherbuben konnte der Auswürfling nichts Böses lehren, sie wußten ohnehin schon alles und waren besonders Meister in der Tierquälerei. Die Ziegen, Kaninchen, die Hühner, die ihnen untertan waren, und der Haushund, die unglückliche Spitzin, gaben Zeugnis davon, ihre Narben erzählten davon und ihre beschädigten Beine und ihre gebrochenen Flügel. Provi fand sein Ergötzen an dem Anblick der Roheit, den er jetzt stündlich genießen konnte. Er fing für die kleineren der Buben Vögel ein und gab sie ihnen „zum Spielen“, und diese Opfer konnten von Glück sagen, wenn sie kein allzu zähes Leben hatten.
Regelmäßig bekommt die Spitzin Welpen, regelmäßig werden sie ihr – bis auf einen – auf Auftrag des Vaters von den Buben weggenommen und im See ersäuft, was Provi als „Hauptspaß“ ansieht. Im hohen Greisinnenalter wird sie noch einmal trächtig und wehrt sich gegen den Raub der Jungen wie nie zuvor. Mit einem Trick nehmen die Buben sie ihr ab. Nun kann sie sich nicht damit abfinden, dass ihre Welpen verschwunden sind. Nacht für Nacht sucht sie nach ihnen in ihrem Verschlag, der direkt neben dem Provis liegt, trippelt, scharrt, wirft Gerätschaften um. Der Junge kann durch den Lärm nicht mehr schlafen, und auch nach einer Woche hat sich die Hündin noch nicht beruhigt. Da plötzlich, bei all seiner Wut über das „Rabenviech“, wird ihm eines klar: Wenn seine Mutter ebenso unermüdlich nach ihm gesucht hätte wie die Spitzin nach ihren Welpen, hätte sie ihn wohl gefunden. Vielleicht aber hat sie ihn auch den Zigeunern, die ihn zurückließen, geschenkt, oder sogar noch was draufgezahlt, damit sie ihn nahmen. Vielleicht ist sie „was Hohes, eine Bauerstochter oder eine Wirtstochter“, die ein uneheliches Kind nicht brauchen konnte.
In diesem Moment überschreitet Provi gedanklich die Mensch-Tier-Grenze, er kann die Spitzin verstehen. Schmerzhaft wird ihm bewusst, dass sie eine weitaus bessere Mutter ist als seine eigene. Doch als sie ihn durch ihr hartnäckiges Weitersuchen immer noch nicht schlafen lässt, wird sein Zorn auf sie unermesslich. Mit einem Holzscheit drischt er in ihren finsteren Verschlag hinein, bis ihm ihr Geheul anzeigt, dass er sie wohl schwer, vielleicht tödlich getroffen hat. Tatsächlich wird es still. Am nächsten Morgen, nach erquickendem Schlaf, sieht er nach ihr. Die Spitzin lebt noch ein wenig, blutend schleppt sie sich zu Provi heran und drückt ihm ihr einzig verbliebenes Junges an die nackten Füße. In ihrem letzten Blick sieht er die Bitte, er möge sich um das Kleine kümmern, und dies lässt ihn sein eigenes Elend umso deutlicher spüren. Weinend wirft er sich auf den toten Hund: „Jo du! Jo du! – du bist a Muatta gwest!“
Provi weiß, dass er den Welpen ertränken muss, schließlich hat er nichts, um ihn zu füttern – es sei denn, er bittet um etwas Milch. Und plötzlich spielt sein Stolz keine Rolle mehr, er hat nun Verantwortung: Er hat von einem Hund Menschlichkeit gelernt.
Gesteht man Tieren Gefühle wie Mutterliebe zu, ist schnell von „Vermenschlichung“ die Rede. Tatsächlich kann es bei der Einschätzung tierischer Verhaltensweisen durchaus zu Fehlinterpretationen kommen. So kursierte vor einigen Jahren ein Video von einem thailändischen Fischmarkt, auf dem ein Hund zu sehen ist, der auf dem Boden zappelnde Fische vermeintlich zu retten versucht, was viele Klicks und weltweite Rührung auslöste. Mit der Schnauze fährt er immer wieder in die umliegenden Pfützen und spritzt Wasser über die Fische, was aussieht, als versuchte er, sie feucht und am Leben zu erhalten. Tatsächlich erkennt man die typische Kopfbewegung, die ein Hund anwendet, wenn er Essen vergräbt. Die Fische sind für ihn Nahrung, die er nicht gleich verzehren kann, zum Vergraben hat er allerdings auch nichts zur Verfügung, also bleibt ihm nur das Wasser zum Bedecken der Beute.
Auch Thomas Mann (1875–1955) war vor solchen Projektionen nicht gefeit, wie sich an seiner 1918 entstandenen autobiografischen Erzählung „Herr und Hund. Ein Idyll“ nachvollziehen lässt. Idyllisch ist hier allerdings wenig. Kaum zu ertragen ist beispielsweise die Szene, wo Thomas Mann seinem als „bäurisch“ beschriebenen Hund Bauschan befiehlt, über einen quer vorgehaltenen Stock zu springen. Dieser versteht nur die grundsätzliche Aufgabe, das Hindernis zu überwinden, und läuft unten durch. Dem großen Schriftsteller wird das Kommunikationsproblem auch nach vielen Versuchen nicht klar: „(…) in deiner Wut wird dir nichts übrigbleiben, als ihn beim Kragen zu nehmen und den gellend Quiekenden hinüberzuwerfen (…)“. Thomas Mann sieht nicht ein, dass Bauschan, der es ja vermag, auf Befehl über eine geschlossene Hecke zu springen, trotz heftigen Einsatzes der von ihm gefürchteten Lederpeitsche die Forderung seines Herren nicht und nicht erfüllt. „Hundertfach bittet er um Vergebung, um Nachsicht, um Schonung, denn er fürchtet ja den Schmerz, fürchtet ihn bis zur Memmenhaftigkeit“, und würde sich dennoch eher totprügeln lassen, als eine so einfache Leistung zu erbringen, diese „wunderliche Seele“.
Dass es aus der Perspektive eines Hundes unsinnig ist, über einen Stock zu springen, wenn man auch darunter durchlaufen kann, und dass man ihm dieses Kunststück mit anderen Mitteln beibringen müsste als mit Prügeln, bleibt unbedacht.
Ein weiterer Klassiker des Missverständnisses ist das Gähnen. Während eines Spazierganges beobachten Thomas Mann und Bauschan einen Jäger, der eine Ente schießt. Als sie weitergehen, empört der Hund durch sein Verhalten seinen Herren zutiefst:
Aber alle dreißig bis fünfzig Schritte gähnte er, und das war es, was mich erbitterte. Es war das unverschämte, sperrangelweite, grob gelangweilte und von einem piepsenden Kehllaut begleitete Gähnen, das deutlich ausdrückt: „Ein schöner Herr! Kein rechter Herr! Ein lumpiger Herr!“, und wenn der beleidigende Laut mich niemals unempfindlich läßt, so war er diesmal vermögend, unsre Freundschaft bis in den Grund zu stören.
Thomas Mann denkt, der Hund verachte ihn, weil er keine Büchse zum Entenjagen hat. Heute weiß man, dass Hunde bei Stress und Aufregung gähnen, und nicht, weil sie gelangweilt sind oder dem Menschen Verachtung signalisieren wollen: Bauschan ist offenkundig durch die aufreibende Jagdszene in Erregung versetzt.
Derlei Auswüchse der Vermenschlichung führen dazu, dass oft das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und sicherheitshalber jegliches Mitgefühl mit Tieren ausgeschaltet wird. Das geht so weit, dass selbst mit Schutzmaßnahmen befasste Wissenschaftler:innen darum ringen, zu einzelnen Tieren keine Bindung aufzubauen. Wichtig sei der Erhalt der Art, erklärt man, das Schicksal des Individuums sei gleichgültig. Es ist aber das Individuum, das nur dieses eine Leben hat, das es genauso leben möchte wie wir.
Auch wenn es aufgrund unterschiedlicher Körpersprachen zu vereinzelten Fehlinterpretationen kommen kann, bedeutet das nicht, dass Empathie mit Tieren grundsätzlich verkehrt ist. Wir würden ja auch nicht Menschen Gefühle absprechen, nur weil wir ihre Sprache nicht verstehen.
In ihrem Gedicht „Ein grünes Fröschlein“ geht Gertrud Kolmar (1894–1943) nicht nur auf ihre eigenen Gefühle, sondern auch auf die des titelgebenden Tieres ein:
EIN GRÜNES FRÖSCHLEIN
Ich habe einen kleinen Frosch gesehen,
Ein grünes Fröschlein auf dem dunklern Blatt.
Es weilte, wohl von Schmaus und Springen satt,
Ganz kindernackt, mit Augen, die verstehen.
Es sonnte sich. Wir bauten ein Gefäß
Mit Rasenstücken, schlanken Fliederzweigen
Voll Laub, für’s lust’ge Auf- und Niedersteigen,
Zu räumig hellem Häuschen, ihm gemäß.
Nun aber ängstet’s aus Gezweig und Gras
An die papierne Decke, klettert, rennt,
Von Luft und ungebrochnem Licht getrennt
Durch dünne Wand nur, eine Wand von Glas …
Schon schickt Oktober streng’ren Wind. Ich friere.
Ein Frost – sein atmend zarter Leib wär’ Stein.
Ich weiß ja nichts. Vergebt mir, kleine Tiere!
Ich bin nicht mehr als ihr und sperr’ euch ein …
Laubfrösche sind mittlerweile selten geworden und streng geschützt. Das Gedicht jedoch ist exemplarisch. Der Mensch richtet einem Tier ein puppenhausartiges kleines Gefängnis ein und stellt sich vor, dass es ihm „gemäß“ sei und es sich darin „lustig“ bewegen werde. Stattdessen jedoch ängstigt es sich und versucht verzweifelt, wieder ins Freie zu gelangen. Am Ende muss der Mensch sich damit beruhigen, dass das Tier in Gefangenschaft ja länger lebt als in Freiheit – die Schuldgefühle loswerden kann er damit nicht. Schon ganz zu Beginn hat das Fröschlein „Augen, die verstehen“. Indem das lyrische Ich dies wahrnimmt, kann es den Selbstbetrug nicht durchhalten und muss sich am Ende entschuldigen. „Ich bin nicht mehr als ihr“ ist das Fazit, der Mensch hat den „kleinen Tieren“ den Freiheitswunsch nicht voraus. Getrud Kolmar selbst konnte auf kein Mitgefühl zählen: Sie wurde von den Nazis in Auschwitz ermordet.
Es kommt selten vor, dass ein literarisches Werk gesellschaftliche Veränderungen herbeiführt. Im Fall des Romanes „Black Beauty“ von Anna Sewell (1820–1878) ist es verbürgt. Darin erzählt der Rappe „Black Beauty“ seine Lebensgeschichte in der ersten Person und macht damit deutlich, was ihm, seinen Artgenossen und auch anderen Tieren von Menschenhand widerfährt. Nach einer glücklichen Kindheit mit seiner Mutter auf der Weide wird er zugeritten, im Englischen „broken in“, was deutlich macht, dass der Wille des Pferdes gebrochen wird. Er beschreibt, wie es sich anfühlt, eine Metallstange zwischen die Zähne und über die Zunge geschoben zu bekommen und mit an dieser befestigten Lederbändern herumgezogen zu werden. Es sei sehr hart für ein Pferd zu lernen, von Kopf bis Fuß fremdbestimmt zu sein, um Reiter zu tragen und Wagen zu ziehen:
He must never start at what he sees, nor speak to other horses, nor bite, nor kick, nor have any will of his own; but always do his master’s will, even though he may be very tired or hungry; but the worst of all is, when his harness is once on, he may neither jump for joy nor lie down for weariness.