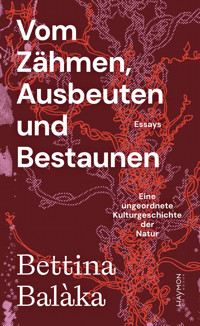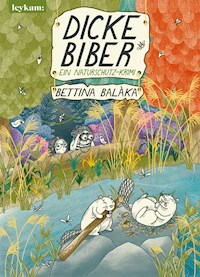Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
1918-2018: ein Making-of des modernen Europa mit besonderem Blick auf die Frauen. 100 Jahre danach: eine Auseinandersetzung mit dem Erbe des Ersten Weltkriegs 1918 endete mit dem Ersten Weltkrieg auch die Donaumonarchie. Übrig blieb ein verklärtes Bild der Habsburger Monarchie, in dem Völkerkerker und Kriegsbegeisterung ebenso wie weltläufige Fin-de-Siècle-Kunst und Sissi-Idylle Platz haben. Zum 100. Jubiläum der Ausrufung der Republik beschäftigt sich Bettina Balàka mit der Frage, wo die Vergangenheit in die Gegenwart hineinwirkt und wo das Private zum Politischen wird: von der Entwicklung der Nationalismen bis zum Niederschlag der Geschichte in der Literatur. Ein besonderes Augenmerk legt die Autorin auf die Historie der Frauenrechte. Schwerpunkt Emanzipation: ein Best-of der österreichischen Frauengeschichte Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs hatten auch die tradierten Geschlechterrollen eine Wandlung erfahren: Schon während des Krieges hatten Frauen viele vormals männliche Tätigkeitsfelder und die Organisation des Alltags an der Heimatfront übernommen. Sie kämpften um ihr aktives und passives Wahlrecht und schafften mit der Ausrufung der Ersten Republik ihren Einzug in die Politik. Präzise recherchierte und erzählerisch-gewitzte Essaykunst von Bettina Balàka Erhellend und unterhaltsam schreibt Bettina Balàka über die vergessenen Heldinnen der österreichischen Frauenbewegung, den mühsamen Kampf der Frauen um Zugang zu Universitäten und "Männerberufen" und die politischen und rechtlichen Auswirkungen der 68er Revolution. In ihren vielschichtigen Essays wirft die Autorin einen Blick auf den immer noch lebendigen Habsburger-Mythos, die Tradition Europas als Schmelztiegel der Kulturen und darauf, wie wir uns an den Krieg erinnern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bettina Balàka
Kaiser, Krieger, Heldinnen
Exkursionen in die Gegenwart der Vergangenheit
Ginster hatte niemals Völker kennengelernt, immer nur Leute, einzelne Menschen.
Siegfried Kracauer
Heldinnen
1.
Ein Bus steht in der Haltestelle. Doch er fährt nicht los. Die Minuten vergehen. Immer wieder versucht der Fahrer zu starten, doch der Motor bleibt tot. Unruhe macht sich breit unter den Passagieren.
„Wie lange dauert das denn noch?“
Dann plötzlich sagt eine Frau: „Is des a Frau?“ Alle lugen nach vorne zum Führerstand und versuchen, über die Köpfe der anderen hinweg zu erkennen, wer sich dort abmüht.
„Des is a Frau!“, sagt eine andere Frau zur ersten.
„Wirklich?“, schalten sich weitere Fahrgäste ein.
„Jössas na!“
„Na dann wundert mi nix.“
Die Fahrerin kämpft. Der Busmotor stottert, jammert und stirbt. Man schüttelt die Köpfe, raunt, spricht gerade so laut, dass es die Fahrerin hören muss, aber nicht laut genug, als dass man einem Einzelnen vorwerfen hätte können, er hätte etwas gesagt. Oder sie hätte etwas gesagt. Denn vor allem Frauen sind von der Aussichtslosigkeit der Fahrerinnenbemühungen überzeugt. Zumindest tun sie diese Überzeugung kund, während die Männer still beobachten.
Die Fahrerin steigt aus. Sie hat rote Flecken im Gesicht und ein bisserl verschwitzt scheint sie auch zu sein. Sie geht um den Bus herum und schaut irgendetwas nach.
„Des wird nix mehr.“
„Also wenn ma so an Bus ned amal starten kann …“
Die Busfahrerin steigt wieder ein und versucht, halbwegs würdevoll eine Durchsage zu machen: „Bitte alle aussteigen. Aufgrund eines technischen Gebrechens kann die Fahrt leider nicht fortgesetzt werden.“
Die Bustüren öffnen sich, die Fahrgäste versammeln sich vor dem zusammengebrochenen Bus zum Meinungsaustausch. Die Fahrerin kommt dazu, sie ist mit ihren Nerven am Ende, hat sie gar Tränen in den Augen? Wahrscheinlich wird sie auch gleich zusammenbrechen. Sie versucht sich zu rechtfertigen: „Ich kann nichts machen! Es ist ein technisches Problem!“
Man tauscht wissende Blicke aus und strömt auseinander. „A Jammergschpü, des Ganze …“, ist noch zu hören.
Diese Szene spielte sich nicht 1916 ab, nicht 1956 und auch nicht 1976, sondern 1992 – dem ersten Jahr in der Geschichte der Wiener Verkehrsbetriebe, in dem Frauen als Busfahrerinnen eingesetzt wurden. Was undenkbar erscheint, kann sich erstaunlich schnell ändern. Heute wäre eine Szene wie die eben beschriebene undenkbar, vor einigen Jahrzehnten waren es Frauen als Busfahrerinnen.
Ich wünschte nun, ich könnte eine glorreiche Erinnerung vorweisen, etwa, dass ich damals schon (womöglich als eine von wenigen) genau durchschaute, was sich da abspielte. Oder dass ich gar in einem heroischen Akt der Zivilcourage der Fahrerin gegen das Mehrheitsknurren zu Hilfe gekommen wäre. Aber für ein solch geistesgegenwärtiges Handeln war ich damals, mit sechsundzwanzig, zu unsicher und unerfahren.
Allerdings bezog ich aus dem Vorfall einige wertvolle Erkenntnisse. Etwa: Die Sozialisation wirkt auf sehr heimtückische Weise. Denn obwohl ich mich – insbesondere im universitären Umfeld – seit Jahren geradezu im Zentrum feministischen Denkens und Forschens bewegte, und obwohl ich nicht eine Sekunde gezögert hätte, für die Ausübung jeden Berufes durch Frauen auf die Barrikaden zu gehen, trieb mein Gehirn für wenige Augenblicke ein unheimliches Spiel mit mir. Inmitten des raunzigen Aufruhrs hatte auch ich – plötzlich und sofort niedergekämpft – das Gefühl: Vielleicht ist es doch nicht so eine gute Idee, wenn Frauen Autobusse fahren.
Gewohnheit prägt. Man will auf der sicheren Eisschicht des eigenen vorbildlichen Denkens über sie hinwegschreiten, und bricht doch immer wieder ein. Bis zu jenem Zeitpunkt hatte ich noch nie eine Busfahrerin gesehen. Ich hatte in meinen wenigen Jahren in Wien auch noch nie eine Straßenbahnfahrerin gesehen, obwohl diese offiziell seit 1970 zugelassen waren. Wohl operierten sie nur sehr vereinzelt und sehr versteckt oder mittlerweile vielleicht gar nicht mehr.
Im Salzburger Biotop meiner frühen Kindheit, Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre, war selbst das Autofahren für Frauen ein nervenaufreibender Ausstieg aus der traulichen Normalität, in der der Mann die Familienkutsche lenkte. Nur wenige Mütter in meiner Bekanntschaft fuhren Auto (oder besaßen gar eines), und ehrlich gesagt fuhr ich auch lieber bei den Vätern mit. Sie waren gelassener und souveräner und schrien nicht zu den Kindern, die unangeschnallt auf der Rückbank herumkugelten, nach hinten: „Ihr müsst jetzt still sein, damit ich mich konzentrieren kann!“
Zuschreibungen wirken innerlich. Die Frauen, denen man immer wieder gesagt hatte, dass sie zum Autofahren zu nervös, zu emotional, zu hysterisch, zu sehr hormonellen Schwankungen unterworfen, zu wenig technisch versiert und nicht hinreichend mit räumlichem Orientierungsvermögen ausgestattet seien – wie sollten sie dabei souverän sein? Sie mussten nicht nur gegen die äußeren, sondern auch gegen innere, internalisierte Stimmen aufbegehren: Kann ich das wirklich? Was, wenn die anderen Recht haben und ich mich irre?
Auf der anderen Seite gab es für Auto fahrende Frauen eine spezielle Gratifikation. So manche berichtete, sie habe schon wieder „einen Mann überholt“. Im wörtlichen Sinne. Damit könnte man heute wohl kaum mehr Furore machen.
Auch die Busfahrerin aus der eingangs geschilderten Szene sah sich einer selbsterfüllenden Prophezeiung ausgesetzt. Obwohl es fast jeder Fahrgast schon einmal erlebt hatte, dass ein Bus auf der Strecke blieb, und keiner je auf die Idee gekommen wäre, den männlichen Fahrer dafür persönlich verantwortlich zu machen, musste sie gegen den Generalverdacht auf weibliche Busfahrunfähigkeit ankämpfen. Sie zeigte Nerven, sie hatte Mühe, ihr Selbstbewusstsein zu bewahren. (Im Übrigen: Wäre es nicht sogar vorstellbar, dass sich spaßig aufgelegte Kollegen den Jux machten, der neuen Fahrerin zum Einstand einen nicht ganz fahrtüchtigen Bus zuzuweisen?)
Es ist wichtig, sich an diese Pionierinnen zu erinnern und ihnen zu danken. Nicht nur den Wissenschaftlerinnen und Künstlerinnen, den Ärztinnen und Politikerinnen, den Juristinnen und Journalistinnen, sondern jeder einzelnen Frau, die bei all dem vorauseilenden Misstrauen den Mut hatte, in eine „Männerdomäne“ zu gehen. Junge Frauen der Gegenwart sind häufig überzeugt, dass sie niemals Selbstzweifel gehabt oder sich irgendetwas gefallen hätten lassen. Wie mühevoll die Wege geebnet wurden, auf denen sie heute schreiten, ist ihnen oft schwer vorstellbar.
2.
Meine Kindheit war reich an Innovationen, gegen die es stets sehr viele Argumente gab. Als etwa die Anschnallpflicht eingeführt wurde (zunächst nur auf den Vordersitzen), war der Autofahrer – und seltener: die Autofahrerin – über die Maßen empört. „Gefesselt“ musste man nun in seinem eigenen Fahrzeug sitzen, verschwitzte sich unterhalb des Gurtes das saubere Hemd – und war es nicht sogar gefährlich, ohne den gewohnten Bewegungsfreiraum auf die Anforderungen des Verkehrs reagieren zu können? Was, wenn das Auto zu brennen anfing oder in einen Fluss stürzte – würde man sich rechtzeitig aus den Gurtschlingen befreien können? Und hatte der Staat überhaupt das Recht, dem Bürger vorzuschreiben, wie er sein eigenes Leben zu schützen habe? Da konnte man ja gleich das Rauchen verbieten!
Ach ja, geraucht wurde überall. Im Zug, am Flughafen, im Flugzeug, im Büro, im Sprechzimmer des Arztes, bei Regierungs- und Redaktionssitzungen, im Restaurant, im Wohnzimmer. Im Auto gab es Aschenbecher in jeder Tür, wichtig war auch der Anzündeknopf. Bei Fernsehdiskussionen und -interviews wurde geraucht. Manche Journalisten moderierten mit der Kippe in der Hand, in einer aufwendigen Choreografie aus Sprechen, Anzünden, Sprechen, Inhalieren, Sprechen, Abaschen, Sprechen, Ausdämpfen. In einer legendären Literatursendung mit Friedrich Dürrenmatt und Marcel Reich-Ranicki gelang es Ersterem im Zuge heftigen Qualmens sogar, den Studioaschenbecher in Brand zu setzen. Was ich bei meinem Studienbeginn 1984 nicht mehr erlebte, war das Rauchen im Hörsaal. In Spielfilmen aus den vierziger Jahren kann man sehen, wie sich Menschen sogar im Krankenhaus am Patientenbett eine Zigarette anzünden.
Man kann sich nie sicher sein, was verrückt ist oder vielleicht doch eine gute Idee, was normal und was irrational, weil einen Geschichte und Gewöhnung nicht selten eines Besseren belehren. Manchmal geht gesellschaftliche Veränderung so schnell, dass eine Generation der nächsten davon erzählt wie aus grauer Vorzeit. Was heute vollkommen vernünftig erscheint, löst Jahrzehnte später ungläubiges Kopfschütteln aus. Wir dürfen davon ausgehen, dass auch so manches von dem, was wir im Augenblick für gut und richtig halten, von diesem Schicksal ereilt werden wird.
Eines Tages gab es einen neuen Frauenberuf, der noch dazu im öffentlichen Raum sichtbar war: die Politesse. In Wien wurden Politessen ab 1965 eingesetzt, in den Bundesländern deutlich später, etwa in Graz ab 1972. Politessen arbeiteten im Polizeidienst, waren aber keine richtigen Polizistinnen. Sie durften ausschließlich in der Überwachung des ruhenden Verkehrs tätig sein, und das bedeutete im Wesentlichen: Strafzettel fürs Falschparken verteilen. Sie trugen Uniformen mit Röcken, deren Schnitt und Schick ausgiebig diskutiert wurde. Ebenfalls diskutiert wurde die Frage, ob es für männliche Autofahrer nicht demütigend sei, von Frauen zurechtgewiesen, belehrt oder gar abgestraft zu werden. Peinliche Situationen ergaben sich, wenn man zu seinem falsch geparkten Fahrzeug zurückkehrte und feststellen musste, dass mit der Vertreterin des schwachen Geschlechts so gar nicht darüber zu verhandeln war, ob sie nicht ein Auge zudrücken konnte. Musste man denn wirklich dermaßen erbittert auf seinem Strafzettel bestehen, nur weil man Angst hatte, nicht ernst genommen zu werden? Megärenhaft war das. Männliche Polizisten waren da viel kulanter.
Außerdem stellte sich natürlich immer die Frage, warum diese Frauen sich für einen derartigen Beruf entschieden hatten. Bei den Hässlichen war es klar: Sie fanden keinen Mann. Aber es waren ja auch Hübsche dabei – hatten die das nötig? Zudem gab es lustige Wortspiele à la „Gott sei Dank dürfen Frauen nicht den Verkehr regeln – hahahah!“
Doch eine kleine Lücke im Denken war geöffnet, und die ließ eine neue Frage zu: Könnten Frauen nicht eventuell, und wirklich nur ganz vorsichtig spekuliert, eines Tages richtige Polizistinnen sein?
Es war natürlich klar, dass man Frauen nicht mit Waffen ausstatten konnte. Warum? Na weil ein Verbrecher einer Frau die Waffe sofort aus der Hand gewunden hätte! Überhaupt das Körperliche: Im Nahkampf wäre eine Frau sofort unterlegen, und bei einer Verfolgungsjagd wäre ihr der Kriminelle mühelos davongerannt. Also nein, es war nicht denkbar, dass Frauen eines Tages vollwertige Polizistinnen sein würden.
Diese Diskussionen zogen sich durch die siebziger und achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Gelegentlich blitzte die ketzerische Frage auf, inwiefern eigentlich jene stark übergewichtigen und schon im Schritttempo nicht besonders wendigen Polizisten, die man bisweilen im Streifendienst sah, bei Nahkampf und Verfolgungsjagd reüssieren konnten. Und wie kam es, dass in anderen Ländern, wo es Polizistinnen bereits gab (etwa den USA), diese nicht im großen Stil von Verbrechern ausgeknockt und ihrer Waffen beraubt wurden?
Aber auch die Gegner waren kreativ. Sie bereicherten die Debatte um das unwiderlegbare Argument, dass es auf der Polizeischule ja gar keine Damentoiletten gab, weshalb eine Ausbildung von Frauen dort selbstredend unmöglich war.
Irgendwie fand sich dann wohl doch eine Lösung für die Toilettenproblematik. Vereinzelte Polizistinnen durften schließlich den Verkehr regeln oder bei der Kriminalpolizei die Vernehmungen von Vergewaltigungsopfern führen. Ausgestattet waren sie mit einer Trillerpfeife, eine Waffe tragen durften sie nicht. Bis 1991. Es gab keinen Knall, keinen Aufschrei, keine Sensation. Eines Tages waren sie einfach da: richtige, den männlichen Kollegen gleichgestellte Polizistinnen – ganz zu Beginn in die viel zu großen Männeruniformen eingekleidet, was aussah, als wollte man noch einmal mahnen: Es sind große Fußstapfen, in die ihr da tretet.
Die Person, die im Hintergrund die politischen Fäden zog, war Johanna Dohnal, die im selben Jahr Frauenministerin geworden war. 1993 trat das von ihr initiierte Bundes-Gleichbehandlungsgesetz, das die Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Bundesdienst festlegte, in Kraft.
3.
In einer pointierten Erzählung aus dem Jahr 1918 mit dem Titel „Rückkehr“ schildert Alfred Polgar das Schicksal eines Straßenbahnschaffners und seiner Frau. Vor dem Krieg war dessen zwölf- oder mehrstündiger Dienst hart gewesen, das Privatleben allerdings bot Entschädigung. Kam er nach Hause, brachte ihm seine Frau die Pantoffeln, stopfte ihm die Pfeife und lieh ihm ihr bewunderndes Ohr für seine Erzählungen: „Man war zwölf Stunden Sklave draußen, aber dann zwölf Stunden Herr daheim.“
Als er aus der Kriegsgefangenschaft heimkehrt, kommt auch seine Frau gerade nach Hause – von ihrer Arbeit als Straßenbahnschaffnerin. Hunderte Frauen, erzählt sie dem Verblüfften, seien nun als Schaffnerinnen tätig. Sie zieht sich die Pantoffeln selbst an und erzählt von ihrem anstrengenden Dienst. Als er seinerseits von Sibirien berichten will, muss er feststellen, dass sie vor Erschöpfung eingeschlafen ist: „Sein Königtum war abgeschafft. Wie das russische.“
Was die Frau betrifft, schildert Polgar jedoch keineswegs einen emanzipatorischen Triumph. Sie übernimmt das Königtum nicht, dessen Insignien – die Pantoffeln – sie mehr selbstvergessen als usurpatorisch überstreift. Niemand kümmert sich um ihr leibliches Wohl, niemand schenkt ihr Bewunderung. Alles, was ihr der neue Beruf – zusätzlich zu ihrem alten als Hausfrau und Mutter – bringt, ist völlige Erschöpfung.
1919 beschreibt D. H. Lawrence in seiner Erzählung „Tickets, Please“, wie sich der neue Frauenberuf beim Kriegsgegner England ausnimmt. Bei Lawrence sind die Schaffnerinnen keine ausgebrannten Hausfrauen und Mütter, die durch die Abwesenheit der Männer zur Berufstätigkeit gezwungen wurden, sondern junge unabhängige Frauen, die ihre Chance nützen: „The girls are fearless young hussies. In their ugly blue uniform, skirts up to their knees, shapeless old peaked caps on their heads, they have all the sang-froid of an old non-commissioned officer.“
Draufgängerischen Seefahrern gleich rasen die mit ungewohnter Autorität Ausgestatteten in den Tramwaywaggons dahin. Doch das ist noch nicht alles, denn nicht nur sind die Röcke kürzer, sondern auch die Sitten loser geworden. Den Schaffnerinnen ist ein „Inspector“ vorgesetzt, der sich mal mit dieser, mal mit jener von ihnen einlässt, nur um sie stets bald wieder abzuservieren. Irgendwann reicht es den Frauen und sie locken den Casanova in eine Falle. Im Aufenthaltsraum der Remise sieht er sich einem veritablen Amazonenangriff ausgesetzt: „(…) the girls threw themselves upon him with unnatural strength and power, forcing him down.“ Einige Zeilen später ist ihre Kraft nicht mehr nur unnatürlich, sondern sogar übernatürlich: „They felt themselves filled with supernatural strength.“
Sie zwingen den Mann, sich für eine von ihnen zu entscheiden. Die jedoch, auf die seine Wahl fällt, will ihn gar nicht. Nun beschließen sie, selbst zu wählen: „‚Who wants him?‘ cried Laura, roughly. ‚Nobody‘, they answered, with contempt.“ Doch hofft jede insgeheim, dass der attraktive Chef sie ansieht. Er jedoch sucht nur die zerrissenen und zerstreuten Teile seiner Uniform zusammen. Schließlich lässt man den Gedemütigten gehen.
Die herrlich sarkastische Geschichte zeigt das Ausmaß der befürchteten historischen Umwälzungen: Erst erlangen die Frauen Autorität im Beruf. Schon sind sie nicht mehr bereit, im Liebesleben die Opferrolle einzunehmen. Sie solidarisieren sich und werden handgreiflich, ja brutal.
Die beiden von männlichen Autoren verfassten Erzählungen fokussieren auf die möglichen Auswirkungen weiblicher Berufstätigkeit auf die männliche Würde. Wie die Schaffnerinnen sich selbst sahen, darüber gibt es keine Aufzeichnungen. Womöglich fehlte ihnen die Zeit, über ihre so aufsehenerregende Tätigkeit schriftlich zu reflektieren.
Was hatte es mit dem mittlerweile längst ausgestorbenen Beruf des Straßenbahnschaffners auf sich, dass seine Ausübung durch Frauen solchen Eindruck machte? 1978 sang Wolfgang Ambros in seinem Lied „Schaffnerlos“, einem Abgesang auf die zunehmend durch Fahrkartenautomaten Ersetzten: „Hot ana a Schaffneruniform, hot ma früha fost salutiert.“ Der Schaffner verkaufte Fahrkarten, lochte sie, rief die Stationen aus. Doch es war mehr als nur das. Er hatte die unumschränkte Autorität in seinem Waggon, durfte die Fahrgäste dirigieren und Anweisungen geben.
In dem Wienerlied „Liebe kleine Schaffnerin“ aus dem Jahr 1941 heißt es:
„Einsteigen bitte, einsteigen bitte,
Ruft sie jedem laut ins Ohr.
Bleiben Sie bitte
Nicht in der Mitte,
Gehen Sie endlich doch vor.“
In der Aufnahme von Franz Schier und Maria Roland hört man auch den recht forschen Schaffnerinnenruf: „Gemma gemma gemma!“
Die weibliche Autorität konnte man sich schmackhaft machen, indem man sie verniedlichte und erotisierte. Man stelle sich vor, ein heutiger Songtexter würde uniformierten Frauen ein derartiges Lied widmen, etwa: „Liebe kleine Justizwachebeamtin“.
Das Kommando war durch die Uniform untermauert. Eine Uniform ist etwas anderes als eine Schwesterntracht. Hässlich fand D. H. Lawrence diese neuartige Frauenbekleidung, die Kappen unförmig. Auch mit Röcken – in Österreich-Ungarn waren sie deutlich länger als in Großbritannien – hatten die Schaffnerinnenuniformen einen maskulin-militärischen Anstrich.
Und wie stand es mit den Straßenbahnfahrern, beziehungsweise Motorführern, wie sie damals hießen? D. H. Lawrence schreibt: „Since we are in war, the drivers are men unfit for active service: cripples and hunchbacks.“ Auch aus Österreich-Ungarn gibt es Berichte, wonach „Kriegskrüppel“, die nicht mehr an die Front zurückgeschickt werden konnten, als Motorführer dienten. Ein schwer behinderter und womöglich traumatisierter Mann an der Kurbel war offenbar immer noch besser als eine Frau. Erst spät und nur im äußersten Notfall griff man auf Frauen zurück. So gab es Straßenbahnfahrerinnen beispielsweise in Glasgow und verschiedenen deutschen Städten, für Österreich sind Einzelfälle für Innsbruck, Linz und Salzburg verbürgt.
Erzherzogin Augusta Marie schreibt in ihrem im letzten Kriegsjahr verfassten Werk „Die Frau im Weltkriege“ über die Wiener städtischen Straßenbahnen: „Mit der Einstellung von Fahrerinnen wurde erst im Jänner 1917 der Anfang gemacht, allein es zeigte sich bald, daß gerade für dieses Amt, das Geistesgegenwart, körperliche Kraft, Umsicht und Ruhe fordert, sich die Frauen im Großen und Ganzen wenig eignen, daher erst rund 120 Fahrerinnen beschäftigt werden.“ Eine beachtliche Zahl (wenn sie denn stimmt) angesichts der Problemlage, möchte man meinen. So viele reaktionsschwache, gedankenlose und unruhige Motorführerinnen – war das nicht gefährlich? Doch die Erzherzogin, die selbst wohl nie mit der Straßenbahn fuhr, fügt beruhigend hinzu: „Bisher verschuldeten die angestellten Frauen weder schwere Unfälle noch andere grobe Unzukömmlichkeiten im Dienste, sie zeigten sich willig, anstellig und pflichttreu (…).“
Es verstand sich von selbst, wie man so schön sagt, dass alle Frauen, die hier Jobs von Männern übernahmen, eine deutlich geringere Bezahlung erhielten als jene. Als die Soldaten mit Kriegsende an ihre alten Arbeitsplätze zurückkehrten, war es auch schnell wieder vorbei mit diesen neuen Berufen – in Wien durften nur die Witwen von gefallenen Straßenbahnern etwas länger verbleiben.
Allerdings muss die Motorführerin in den darauffolgenden beiden Jahrzehnten irgendwann wieder zurückgekehrt sein, sonst hätte man es nicht im Jahr 1940 für nötig befunden, eine solche Beschäftigung von Frauen explizit zu verbieten. Als Begründung wurde der Schutz vor gesundheitsgefährdenden Arbeitsbedingungen angegeben. Straßenstaub? Verkehrslärm? Im Zweiten Weltkrieg waren bei den Wiener Verkehrsbetrieben wieder ein Viertel der Beschäftigten Frauen. Vermutlich waren sie primär als liebe kleine Schaffnerinnen tätig.
Das Verblüffende ist: An dieser fürsorglichen Einschränkung aus der NS-Zeit wurde bis 1970 nicht gerüttelt. Erst die Achtundsechziger-Bewegung machte es möglich, die Glaubenssätze neu zu überprüfen. Eine deutsche Studie aus dem Jahr 1969 ergab, dass die gesundheitlichen Bedrohungen für Frauen beim Steuern einer Straßenbahn höchstwahrscheinlich überschätzt worden waren, dass allerdings die hohe nervliche Belastung und die Anforderungen an die Konzentrationsfähigkeit möglicherweise doch ein Beschäftigungsverbot rechtfertigten. Eine durchaus ähnliche Diagnose, wie sie Erzherzogin Augusta Marie 1918 gestellt hatte. Noch immer galten Frauen als durch die Bank nervenschwach und nicht in der Lage, ihre Aufmerksamkeit zu fokussieren – ein labiles, kränkelndes Geschlecht. Dies durfte man wissenschaftlicherseits ohne Schamesröte behaupten. Dennoch, das Beschäftigungsverbot fiel, und auch, wenn etliche Lehrfahrer rebellierten und sich weigerten, Frauen auszubilden, so trat ab 1970 doch die eine oder andere Fahrerin in Dienst.
Weshalb dauerte es im öffentlichen Busverkehr zwanzig Jahre länger, bis Fahrerinnen eingestellt wurden? Ließ die Straßenbahn durch die Vorgabe der Schienen zumindest symbolisch weniger Freiheit, wodurch ihre Bedienung Frauen eher zugetraut wurde? Doch auch U-Bahnfahrerinnen wurden in Wien erst ab 1991 eingestellt. Was ist es, dass das Fahren, Steuern und Lenken von „großem Gerät“ für Frauen so unmöglich erscheinen ließ?
Wer Fahrzeuge steuert, in denen Personen transportiert werden, trägt Verantwortung für die Sicherheit und das Leben derselben und bedarf eines entsprechenden Vertrauensvorschusses. Passiv ist der Passagier, den Fähigkeiten eines anderen Menschen ausgeliefert, der gleich einem Elternteil die Dinge unter Kontrolle haben sollte. Menschliches Versagen im Führerstand, im Cockpit, auf der Brücke kann tödlich sein, es geht also um viel. Zwar zeigt die Erfahrung, dass auch Männer so manches Staats- oder Kreuzfahrtschiff auf Grund setzen können, aber bei Frauen wollte man es lange Zeit nicht einmal auf den Versuch ankommen lassen.
Natürlich ging es immer auch um das Ökonomische, um Einkommen und Jobs, man darf aber ebenso tieferliegende psychologische Mechanismen annehmen. So wie die Menschen die Gurtpflicht auch deshalb ablehnten, weil sie sie daran erinnerte, dass Autofahren gefährlich war, so zog man es aus ähnlich irrationalen Gründen vor, im Zweifelsfall lieber von einem Mann ins Jenseits befördert zu werden. Und auch, wenn wir das Gefühl haben, das alles sei schon sehr, sehr lange her, manchmal ist es das gar nicht: Die ersten beiden Copilotinnen bei der Lufthansa traten 1988 ihren Dienst an. Infolge der langen Ausbildungsdauer gab es die erste Flugkapitänin erst im Jahr 2000.
Doch noch weitaus hartnäckiger war man bei den Austrian Airlines: Im Jahr 2000 wurden Frauen erstmals zum Auswahlverfahren zugelassen. 2001 war die Burgenländerin Petra Wadl die erste weibliche Copilotin im Cockpit einer Linienmaschine, die die AUA-Flugschule ab initio absolviert hatte.
Dabei ist es doch erstaunlich, dass man Frauen das Fliegen so lange nicht zutrauen wollte. Seit Anbeginn der Luftfahrt hatte es Pilotinnen gegeben, die Flugschulen betrieben, sich in Flugwettbewerben bewiesen und Rekorde aufgestellt hatten.