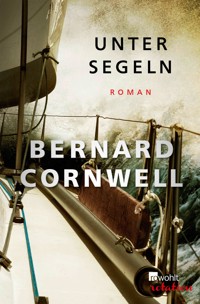
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Segel-Thriller
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Paul Shanahan ist ein Schurke und liebt das Abenteuer. Wenn jemand fünf Millionen Dollar in Gold an den Behörden vorbeischmuggeln kann, dann er, und zwar auf seinem Schiff, der «Rebel Lady». Aber mit dem Gold, das eine Organisation aus dem Nahen Osten für einen Waffendeal benötigt, hat er seine eigenen Pläne: Schon lange träumt er von einem gepflegten Ruhestand auf Cape Cod. Daraus jedoch wird nichts, wenig später ist ihm die halbe Welt auf den Fersen: seine Auftraggeber, die IRA, die CIA – und das ist nicht alles, denn im Rumpf seines Schiffes liegt nicht nur Gold verborgen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 486
Ähnliche
Bernard Cornwell
Unter Segeln
Roman
Aus dem Englischen von Gerhard Beckmann
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Paul Shanahan ist ein Schurke und liebt das Abenteuer. Wenn jemand fünf Millionen Dollar in Gold an den Behörden vorbeischmuggeln kann, dann er, und zwar auf seinem Schiff, der «Rebel Lady». Aber mit dem Gold, das eine Organisation aus dem Nahen Osten für einen Waffendeal benötigt, hat er seine eigenen Pläne: Schon lange träumt er von einem gepflegten Ruhestand auf Cape Cod. Daraus jedoch wird nichts, wenig später ist ihm die halbe Welt auf den Fersen: seine Auftraggeber, die IRA, die CIA – und das ist nicht alles, denn im Rumpf seines Schiffes liegt nicht nur Gold verborgen …
Über Bernard Cornwell
Bernard Cornwell, geboren 1944, machte nach dem Studium Karriere bei der BBC. Nach Übersiedlung in die USA entschloss er sich, einem langgehegten Wunsch nachzugehen: dem Schreiben. Im englischen Sprachraum gilt er als unangefochtener König des historischen Abenteuerromans. Bernard Cornwells Werke wurden in über 20 Sprachen übersetzt, die Gesamtauflage liegt bei mehr als 20 Millionen Exemplaren.
Unter Segeln ist für Jackie und Jimmy Lynch
ERSTER TEIL
Am 1. August wurde ich vierzig Jahre alt, meine Geliebte Sophie ließ mich, nach drei Jahren, wegen eines Jüngeren sitzen, und meine Katze wurde krank. Am Tag darauf überfiel Saddam Hussein Kuwait.
Die sogenannten besten Jahre des Lebens fingen schön an.
Drei Wochen später meldete sich Shafiq mit der Frage, ob ich ein Schiff aus dem Mittelmeer in die USA überführen wollte. Den Anruf nahm meine Sekretärin Hannah entgegen. Sie kam, wie immer, am späteren Nachmittag zum Fischerhafen herunter, um mir die Neuigkeiten des Tages zu bringen.
«Wer hat angerufen?» Ich arbeitete bei laufendem Motor im Maschinenraum eines Schleppnetzfischers. Ich glaubte, mich verhört zu haben. «Wer hat angerufen?», rief ich noch einmal durch die offene Luke nach oben.
«Shafiq», sagte Hannah achselzuckend. «Sonst nichts. Bloß Shafiq. Er hat gesagt, Sie kennen ihn.»
Und ob ich ihn kannte. So, dass ich mich sofort fragte, was zum Teufel wohl als nächstes käme. Shafiq! Großer Gott! «Was hat er gewollt?»
«Sie sollen ein Schiff überführen.»
«Wann?»
«Das weiß er nicht.»
«Von wo aus im Mittelmeer? Frankreich? Spanien? Italien? Zypern? Griechenland?»
«Einfach nur vom Mittelmeer. Genaueres könnte er nicht sagen. Hat er gesagt.»
«Und wohin soll ich das Schiff bringen?»
Hannah lächelte. «Nur nach Amerika.»
Ich stellte den Motor ab. Ich hatte die hydraulischen Pumpen des Trawlers überprüft, weil ich mich vergewissern wollte, ob nicht irgendein Mistkerl den Druck um eine halbe Tonne gesenkt hatte, damit ein kaputtes Ventil oder ein defekter Schlauch unbemerkt blieb. Ich wartete, bis der Lärm aufhörte. Dann schaute ich zu Hannah hoch. «Und was für ein Schiff?»
«Weiß er nicht.» Sie lachte. Hannah hatte ein schönes Lachen. Ich muss aber zugeben, dass ich an jedem weiblichen Lachen Gefallen fand, seit Sophie mir den Laufpass gegeben hatte. «Ich werde nein zu ihm sagen», meinte sie. «Ja?»
«Ja. Sagen Sie ja.»
«Was?»
«Sagen Sie ja.»
Hannah setzte wie immer die Geduldsmiene auf, wenn sie glaubte, mich vor mir selbst schützen zu müssen. «Ja?»
«Ja, oui, yes, si. Das ist unsere Arbeit. Dafür sind wir doch da.» Wenigstens offiziell; oben auf meinem Briefpapier stand nämlich: «Nordsee-Jacht. Lieferung, Wartung, Begutachtung von Schiffen. Alleineigentümer Paul Shanahan, Nieuwpoort, Belgien.» In den letzten Jahren waren allerdings nur noch Aufträge für Wartung und Gutachten hereingekommen.
«Aber Paul! Sie wissen weder wann, wie, was noch wohin! So was Dummes kann ich nicht zulassen!»
«Wenn er wieder anruft, sagen Sie ihm: Meine Antwort lautet ja.»
Hannah stieß einen typisch flämischen Laut aus, so etwas wie einen gutturalen Grunzer, der, wie ich im Laufe der Zeit verstehen gelernt hatte, die Verachtung eines praktischen Menschen für einen unpraktischen Trottel ausdrückte. Sie blätterte in ihrem Notizbuch herum. «Dann hat noch eine Frau angerufen. Eine gewisse Kathleen Donovan. Amerikanerin. Möchte Sie sprechen. Klingt sympathisch.» O Gott, dachte ich, was hat das nur zu bedeuten? Kaum vierzig, und schon wird man von der eigenen Vergangenheit eingeholt. Mir stand plötzlich wieder ein grässliches Bild vor Augen: der gelbe Felsen mit Roisins Blut. Menschlicher Verrat kam mir in den Sinn, Liebeslust und -leid: Falls die Frau, die da nach mir suchte, Roisins Schwester sein sollte, konnte ich nur hoffen, dass sie mich nie finden würde. Nie. «Sagen Sie ihr nein», erwiderte ich.
«Aber sie sagt …»
«Sie kann sagen, was sie will. Ich kenne sie nicht und will sie auch nicht kennenlernen.» Ich konnte Hannah diese Geschichte nicht erklären. Hannah würde sie nie verstehen – dazu war sie viel zu bodenständig, dazu führte sie mit ihrem Mann, einem stämmigen Polizisten, eine viel zu normale Ehe. «Und bestellen Sie Shafiq: Ich will wissen, warum.»
«Sie wollen wissen, warum?» Hannah musterte mich kritisch. «Warum was?»
«Fragen Sie ihn: Warum?»
«Aber …»
«Fragen Sie einfach nur: Warum?»
«Okay. Ich werde ihn fragen!» Sie hob ergeben die Hände, drehte sich um und ging am Kai lang. «Ihre Katze hat Würmer, glaub ich!», rief sie zurück.
«Dann geben Sie ihr eine Tablette!»
«Es ist Ihre Katze!»
«Bitte – geben Sie ihr eine Tablette.»
«Okay.» Sie machte eine rüde Geste mit der Hand. Das galt aber nicht mir, sondern dem Fischer, der ihr nachgepfiffen hatte. Mir winkte sie ein letztes Mal, bevor sie verschwand.
Ich machte mich wieder an die Arbeit fürs Gutachten über den Trawler, der nach Schottland verkauft werden sollte. Doch innerlich war ich mit ganz anderen Dingen beschäftigt als mit Rumpf, Motor oder Hydraulik des Schiffes. Ich fragte mich immer wieder, warum beides – das Gespenst verratener Liebe und der Schatten vergangener Gefahren – an ein und demselben Tag wie aus dem Nichts wiederkehrten, um mich zu quälen. Aber – wenn ich ehrlich war – es erregte mich auch. Grau, berechenbar und langweilig war mein Leben geworden. Nun kam wieder Bewegung hinein.
Vier Jahre hatte ich gewartet, dass Shafiq sich an mich erinnerte, mich wieder mit heikleren Aufgaben betraute. Vier Jahre. Ich war bereit.
«Vier Jahre sind’s her, Paul! Vier Jahre!» Da saß Shafiq: träge, schlank, freundlich, gerissen – in mittlerem Alter. Er saß auf einem tiefen, mit Kissen überladenen Sofa. Er hatte im Hotel Georges V. in Paris eine Suite gemietet. Ich sollte ihn im Wohlstand bewundern. Außerdem befand er sich in überschäumend guter Laune. Kein Wunder. Shafiq liebte Paris. Er liebte Frankreich. Je größer der Hass der Franzosen auf die Araber, desto größer Shafiqs Bewunderung für den gallischen Geschmack. Shafiq war ein Palästinenser, der in Libyen wohnte; dort war er in Oberst Gaddafis Center für Widerstand gegen Imperialismus, Rassismus, Rückständigkeit und Faschismus tätig. Ich hatte zunächst nicht geglaubt, dass es solch eine Organisation gab; sie existierte aber doch, und Shafiq gehörte tatsächlich zum Personal – eine Tatsache, die sicherlich erklärte, warum ihm europäische Dekadenz so zusagte.
«Also – was willst du?», fragte ich säuerlich.
«So heiß habe ich Paris noch nie erlebt! Gott sei Dank, dass es Klimaanlagen gibt!» Wir sprachen Französisch, wie immer. «Nimm dir vom Gebäck, bitte! Der mille-feuille ist köstlich.»
«Was willst du von mir?»
Shafiq überhörte die Frage. Er öffnete ein emailliertes Pillendöschen und schob sich eine Cachou unter die Zunge. «Ich gebe mich als Grieche aus. Ich habe sogar einen Diplomatenpass! Sieh mal!»
Auf den gefälschten Diplomatenpass und auf Shafiqs Stolz auf den Besitz des Dokuments ging ich nicht ein. Shafiq leistete seinen Beitrag zum Widerstand gegen Imperialismus, Rassismus, Rückständigkeit und Faschismus als Laufbursche zwischen Libyen und den Terroristengruppen, die eben gerade nach Oberst Gaddafis Geschmack waren. Auf den ersten Blick wirkte er überhaupt nicht wie ein Agent; er war wie ein Kind, allzu auffällig und liebenswert. Vielleicht hatte er jedoch gerade aufgrund dieser Eigenschaften so lange überlebt. Es war beinahe unmöglich, einem so lächerlichen Mann wie Shafiq Verbindung mit dem Bösen in der Politik zuzutrauen.
«Was willst du von mir?», wiederholte ich. Was es auch sein mochte – er würde es wahrscheinlich bekommen. Aber nach vier Jahren musste ich den Zurückhaltenden spielen.
«Möchtest du eine Gauloise? Hier! Da hast du die ganze Packung, Paul!» Er schob sie zu mir herüber.
«Ich habe das Rauchen aufgegeben. Was, zum Teufel, willst du von mir?»
«Du hast das Rauchen aufgegeben? Das ist wunderbar, Paul, einfach wunderbar! Mir raten die Ärzte, dass ich das Rauchen aufgeben soll. Aber was wissen die Ärzte schon? Ich habe einen Schwager, der ist Arzt. Habe ich dir das schon erzählt? Er raucht am Tag vierzig, manchmal fünfzig Zigaretten, und er fühlt sich … Wie sagt man doch? So munter wie ein Fisch im Wasser! Möchtest du Tee?»
«Verdammt – was willst du von mir, Shafiq?»
«Du sollst ein Schiff nach Amerika bringen. Wie ich deiner Sekretärin gesagt habe. Ist sie schön?»
«Wie eine Rose im Morgentau, wie eine Pfirsichblüte, wie eine Einpeitscherin der Dallas-Cowboys. Was für ein Schiff? Von wo? Wohin? Wann?»
«Das weiß ich nicht genau.»
«Phantastisch! Das hilft mir wirklich sehr, Shafiq.» Ich lehnte mich in meinem viel zu weichen Sessel zurück. «Das Schiff gehört dir?»
«Es gehört nicht mir.» Er zündete sich eine Zigarette an und machte eine Geste, ganz vage, wie um anzudeuten, das fragliche Schiff gehöre einem anderen, irgendwem anderen, niemand Besonderem. «Was macht dein Liebesleben?»
«Gar nichts. Ich bin eben erst wegen eines verheirateten französischen Apothekers sitzengelassen worden. Aber das Sorgerecht für die Katze ist mir geblieben. Wem gehört das Schiff?»
«Du hast deine Freundin verloren?» Shafiq machte sich sofort Sorgen um mich.
«Wem gehört das Schiff, Shafiq?»
«Freunden.» Er machte wieder eine Geste mit der Zigarette – was so viel hieß wie: Die Eigentumsfrage sei ohne Bedeutung. «Wie lang wirst du brauchen?»
«Wie lang werde ich wofür brauchen?»
«Um das Schiff nach Amerika zu bringen natürlich.»
«Das hängt von der Art des Schiffes ab. Und davon, wie weit die Reise geht und zu welcher Jahreszeit es zugestellt werden soll.»
«Ein Segelschiff», sagte er, «und meines Wissens bald.»
«Ein wie großes Segelschiff?»
«Mit einem großen Bleikiel.» Er lächelte, als wären durch dieses Detail sämtliche Fragen geklärt.
«Wie groß?»
Er zog nachdenklich an seiner Zigarette. «Ich weiß nicht, wie groß. Also, nun schätz mal – wie heißt das bei euch doch noch? Pi mal Daumen? Pi mal Daumen!»
Ich warf einen flehentlichen Blick zur reich verzierten Stuckdecke. «Drei Monate? Vier? Wie, zum Teufel, soll ich das wissen? Je größer das Schiff, desto rascher. Vielleicht.»
«Drei Monate? Vier?» Er klang weder zufrieden noch enttäuscht. «Ist es eine Blondine?»
«Ist wer eine Blondine?»
«Deine Sekretärin.»
«Ihr Haar ist braun.»
«Am ganzen Körper?»
«Keine Ahnung.»
«Ah.» Ich tat ihm leid. «Warum hat deine Geliebte dich verlassen?»
«Weil ich mich eines Tages nach Amerika zurückziehen möchte und sie nicht mitkommen will, weil sie mich für zu verschlossen hält, weil sie das Leben in Nieuwpoort langweilig findet und weil ihr Franzose ihr einen Mercedes geschenkt hat.»
«Du möchtest in Amerika leben?», fragte Shafiq schockiert.
«Ja. Dort bin ich zu Hause.»
«Kein Wunder, dass du unglücklich bist.» Shafiq muss den Kopf geschüttelt haben, weil Sophie mir den Laufpass gegeben hatte, und nicht, weil ich Amerikaner war. Denk ich mir.
«Wenn mich irgendetwas unglücklich macht», versicherte ich ihm, «dann unsere momentane Unterhaltung. Shafiq! Um Himmels willen! Vier Jahre lang vergisst du mich völlig. Dann zerrst du mich nach Paris, um mir mitzuteilen, dass ich für dich ein Schiff überführen soll. Und dann kannst du mir nicht ein einziges gottverdammtes Detail nennen!»
«Aber ich biete dir doch ein Geschäft an!», flehte er.
«Auf einmal? Nach vier Jahren?»
Achselzuckend klopfte er die Asche seiner Zigarette in eine Kristallschale ab. «Du weißt, warum, Paul, du weißt doch, warum.» Dabei schaute er jedoch weg.
«Hat dir der Duft meines Deos nicht gepasst?», fragte ich spöttisch.
Da hob er den Kopf und erwiderte meinen Blick. Er wollte die alten Beschuldigungen mir gegenüber nicht aussprechen. Aber ich nahm ihn in die Mangel. Er wusste, dass er sich das gefallen lassen musste. «Es hieß, du seist ein CIA-Agent, Paul.»
«Ach Scheiße.» Ich lehnte mich im Stuhl zurück und ließ meinen Abscheu durchklingen.
«Wir wissen natürlich, dass es nicht stimmt», sagte Shafiq charmant.
«Und ihr habt vier Jahre gebraucht, um das zu begreifen?»
«Wir können gar nicht vorsichtig genug sein. Das weißt du doch.» Die Zigarette glühte auf, als er zog. «Mit unserem Geschäft ist es heute wie mit dem Sex, klar? Geh auf Nummer sicher oder lass es ganz bleiben. Oder, Paul?» Er lachte und wollte, dass ich mich von ihm mitreißen ließ, aber ich verzog keine Miene, sodass er traurig den Kopf schüttelte. «Wir haben dich nicht beschuldigt, Paul. Es war das Mädchen, Paul. Es war deine eigene Freundin! Dein Mädchen! Wie hieß sie doch? Roisin?» Er sprach den Namen sogar korrekt aus, Rosh-een, was nur zeigte, wie gut er sich an sie erinnerte. «Sie ist deine Freundin gewesen, Paul.»
«Meine Freundin, Shafiq? Sie ist das Firmenfahrrad gewesen, auf dem alle fahren durften.»
«Das ist gut, Paul. Das gefällt mir! Das Firmenfahrrad!» Er kicherte. Dann machte er eine abfällige Handbewegung. «Du begreifst, ja? Du verstehst, warum wir dir nicht vertrauen konnten? Ich rede ja nicht von mir. Ich habe nie geglaubt, dass du ein Agent bist! Ich habe ihnen gesagt, wie lachhaft die Idee ist! Idiotisch! Aber sie wollten sichergehen. Sie haben gesagt: Abwarten. Wollen wir doch mal sehen, ob er nach Amerika läuft. Aber du bist nicht nach Amerika gelaufen, was?» Er lächelte mir zu. «Schön, dich wiederzusehen, Paul. Es hat viel zu lang gedauert.»
«Sprechen wir von eurem Segelschiff», sagte ich kalt. «Worum geht’s denn dabei?»
«Um etwas rein Geschäftliches.»
«Hat’s etwas mit dem Irak zu tun?»
«Mit dem Irak?» Shafiq breitete seine Hände aus, die so groß waren wie Ruderblätter. Mit der Geste schien er mir suggerieren zu wollen, dass er vom Irak und der irakischen Invasion Kuwaits nie gehört habe.
«Hat die Sache mit dem Irak zu tun?», fragte ich noch einmal.
Beim Lächeln zeigte er seine gelben Zähne. «Es geht um etwas rein Geschäftliches.»
«Etwas Geschäftliches – im Sinne von Schmuggeln?», fragte ich.
«Vielleicht?» Er grinste mich komplizenhaft an.
«Dann will ich damit nichts zu tun haben.» Was natürlich nicht stimmte, ganz und gar nicht stimmte – doch wenn ich allzu rasch einwilligte, würde dabei zu wenig für mich herausspringen, und diesmal wollte ich viel herausholen. Deshalb mimte ich den Schwierigen. «Auf Schmuggeln lass ich mich nicht ein, Shafiq. Außer ich weiß, was ich schmuggle und wie es versteckt ist und warum es geschmuggelt wird und wohin es geht, wer die Schmuggelware bekommt und wie viel sie wert ist und wann die Reise stattfinden soll und wer davon profitiert und wem dran liegen könnte, das Ganze zu verhindern, und wie viel ich bekomme, wenn ich’s durchziehe.»
«Ich hab ihnen gesagt, dass du so was fragen würdest!», sagte Shafiq triumphierend.
«Ihnen?»
«Sie wollen, dass du morgen nach Miami fliegst», sagte er ausweichend, in der Hoffnung, dass es mich ablenken würde, wenn er Miami erwähnte.
«Wer sind sie?» Ich ließ nicht locker.
«Alte Freunde von dir», sagte er – womit er bestätigte, was ich vermutet hatte.
«Sie sind in Miami?» Ich war überrascht.
«Sie wollen dich morgen dort treffen.» Er stopfte sich ein Stück Mandelkuchen in den Mund und murmelte dann: «Sie erwarten dich. Ich habe ein Flugticket für dich. Erster Klasse!» Er sagte es so, als handle es sich um ein ganz besonderes Extra – einen roten Teppich in die Höhle des Löwen. Als ob es eines solchen Köders bedurft hätte! Vier Jahre hatte ich darauf gewartet, von der Beschäftigung mit Hydraulik, Osmose von Fiberglas und verrosteten Kielbolzen erlöst zu werden!
Ich rief Hannah in ihrer Wohnung in Nieuwpoort an. Es war Sonntagnachmittag. Sie klang schläfrig warm – hatte ich sie und ihren stämmigen Polizisten bei einer Orgie unterbrochen? «Bitte annullieren Sie alle Termine für diese Woche», sagte ich ihr.
«Aber Paul …»
«Ausnahmslos», betonte ich. «Alle annullieren!»
«Warum?»
«Weil ich nach Miami fliege», sagte ich, als ob so etwas jeden Monat vorkäme und sie gar keinen Anlass hätte, überrascht zu sein.
Hannah seufzte. «Kathleen Donovan hat wieder angerufen. Sie ist auf Besuch in Europa. Sie will Sie auch gar nicht lange belästigen. Sie hat’s mir fest versprochen, und ich hab ihr gesagt, Sie würden …»
«Hannah! Hannah! Hannah!», unterbrach ich sie.
«Paul?»
«Sehen Sie zu, dass die Katze ihre verdammten Pillen kriegt, ja?», sagte ich zärtlich und leise, bevor ich den Hörer auflegte. Am nächsten Morgen flog ich nach Miami.
Auf dem internationalen Flughafen von Miami erwartete mich Little Marty Doyle. Er hüpfte trotz der Wahnsinnshitze wie ein aufgeregter Pudel. «Wie schön, dich zu sehen, Paul! Einfach schön! Es ist Jahre her, oder? Jahre! Ich hab’s Michael erst gestern Abend gesagt. Jahre!»
Marty ist eine Null, ein Speichellecker, ein Botenjunge. Offiziell arbeitet er für das Boston School Committee; inoffiziell belämmert und chauffiert er Michael Herlihy. Herlihy hat das Autofahren nie gelernt, weil er an Kinetose leidet – an See-, Luft- und Autokrankheit. Seine Mutter hat dafür gesorgt, dass er als Kind immer im Fond saß; seither lässt er sich herumkutschieren wie Graf Koks. Neuerdings ist Marty sein Mädchen für alles und sein Chauffeur. «Also – was treibst du in Miami?», fragte ich ihn.
«Ich kümmere mich um Michael. Dem geht’s nicht besonders. Wegen der Hitze. Dem ist Hitze noch nie bekommen. Sie macht ihn ganz nervös. Ist das dein ganzes Gepäck?» Er zeigte auf meinen Seesack.
«Wie viel Gepäck sollte ich denn deiner Meinung nach mit mir herumschleppen?»
«Ich werd’s für dich tragen.»
Ich hob den Seesack außer Reichweite. «Jetzt halt’s Maul und mach, dass wir weiterkommen.»
«Ich hab dich Jahre nicht mehr gesehen, Paulie! Aber du siehst überhaupt nicht älter aus. Nicht einen Tag älter! Der Bart steht dir. Ich hab auch mal versucht, mir einen Bart stehen zu lassen. Er hat einfach nicht wachsen wollen. Ich sah aus wie der Filmchinese, Fu Man-chu, du weißt, wen ich meine? Also, wie geht’s dir denn, Paulie? Das Auto steht da drüben. Hast du schon gehört?» Wie ein aufgeregtes Kind lief er um mich herum.
«Der Krieg hat angefangen?», riet ich.
«Krieg?» Der militärische Aufmarsch unter amerikanischer Führung in Saudi-Arabien schien Marty entgangen zu sein. «Ich red von Larry», meinte er schließlich. «Man nimmt an, dass sie geheilt ist, klar? Sie wird so gut wie neu sein!»
«Was ist geheilt?»
«Seine Hacke! Er hat sie sich operieren lassen.» Marty musste plötzlich über einen witzigen Einfall lachen. «Seine Hachse ist gesundgehackt worden! Kapiert?»
Ich blieb mitten im Terminal stehen und schaute auf Marty hinunter. Mein Blick fiel auf seine Glatze. Ich war todmüde, mir war heiß, Marty kläffte herum wie ein läufiger Pudel – es war kaum auszuhalten. «Wer ist dieser verdammte Larry?», fragte ich. «Wovon redest du überhaupt?»
«Larry Bird!» Marty war über meine Begriffsstutzigkeit verblüfft. «Wegen seiner Ferse hat er doch nicht bis zum Schluss der Saison spielen können! Hatte am Knochen ein Gewächs oder so was Ähnliches.»
«Du meine Güte!» Ich ging weiter. Ich hätte mir denken müssen, dass es für Marty nichts Wichtigeres gab als die Boston Celtics. Alles, was die betraf, war Bostonern hoch und heilig. Dass mir dieser Kult meiner Heimatstadt irgendwie fremd und unverständlich geworden war, lag sicherlich daran, dass ich in einer kleinen Hafenstadt an der belgischen Küste gelebt hatte.
Aber es tat gut, wieder amerikanischen Boden unter den Füßen zu spüren. Trotz der ungewohnten tropischen Hitze in Florida. Ich hatte nie vorgehabt, so lange wegzubleiben. Es hatte dann jedoch immer wieder einen Grund gegeben, nicht über den Atlantik zu fliegen. Einmal hatte ich sogar schon die Tickets gekauft; da kam das lukrative Angebot, ein brandneues Schiff von Finnland nach Monaco zu fahren, und ich gab meinen Plan auf. Familienanlässe für einen Heimflug hatte es nie gegeben. Meine Eltern waren tot, und meine Schwester hatte einen Idioten geheiratet, den ich nicht ausstehen konnte. Deshalb war ich während der letzten Jahre in Nieuwpoort geblieben und hatte nur davon geträumt, eines schönen Tages für immer heimzukehren und in dem kleinen Haus in Cape Cod, das ich von meinem Vater geerbt hatte, einen gemütlichen Lebensabend zu genießen. Dafür hatte ich gespart – noch ein Grund, für teure Transatlantikflüge kein Geld auszugeben. Trotzdem – ich war zu lange weg gewesen.
«Michael wartet auf uns.» Marty hielt mir die hintere Tür der Limousine auf. «Und da ist jemand aus Irland gekommen, der dich sehen will. Brendan heißt er. Brendan Flynn. Er ist gestern hier eingetroffen.»
«Brendan Flynn?» Das war eine Überraschung. Mir wurde plötzlich ganz kalt. Brendan gehörte der IRA-Führung an. In der Rangordnung stand er an dritter oder vierter Stelle. Aus kleinlichen Gründen reisen solche Leute nicht ins Ausland. Aber an diesem komischen Deal schien gar nichts kleinlich zu sein – Transatlantikflüge, Suiten im Hotel Georges V. in Paris, eine weiße Limousine am internationalen Flughafen in Miami. Ich war mit Feuereifer in die Sache hineinmarschiert. Die Erwähnung von Brendan verlieh ihr jetzt einen echt gefährlichen Blutgeruch.
«Es muss eine große Kiste sein, Paulie, wenn ein Typ den weiten Weg von Irland herüberfliegt. Und du selbst bist ja auch ein paar Meilen gereist, was? Von Paris!» Marty angelte jetzt nach Informationen. «Also, was meinst du – worum geht es wohl?», fragte er, als wir uns aus dem Flughafenverkehr lösten.
«Woher, zum Teufel, soll ich das wissen?»
«Aber du musst doch eine Ahnung haben!»
«Halt’s Maul, Marty!»
Schweigen war nicht Martys Sache. Während der Fahrt Richtung Norden erzählte er mir, erst vergangene Woche habe er zufällig meine Schwester gesehen, gut hätte Maureen ausgeschaut, die Söhne würden langsam erwachsen, aber so sei das nun mal mit Jungen, oder? Ob ich schon gehört hätte, was den New England Patriots passiert sei? Der Klub sei von einem Elektrorasierer-Fritzen gekauft worden, obwohl sie immer noch wie Amateure Football spielten. Selbst eine Klosterschule brächte ein besseres Team zustande. Ehrlich. Und wer meiner Meinung nach in dieser Saison wohl die Super Bowl gewinnen würde? Schon wieder die Forty-Niners?
Marty legte erst eine Pause ein, als wir uns der Hialeah-Rennbahn näherten. Er hielt inmitten des Wirrwarrs der Lagerhäuser und kleinen Technikgeschäfte Ausschau nach einer bestimmten Abzweigung. «Da sind wir», verkündete er, und der weichgefederte Wagen schaukelte über eine raue Wegstrecke, bog ab, hin zu einer rostenden Toreinfahrt in einem engmaschigen Drahtzaun, und hielt im Schatten eines weiß gestrichenen Lagerhauses ohne irgendeine Kennzeichnung an; die anonyme Fassade wies nicht einmal eine Ziffer auf. Der Mann im Wachhäuschen neben dem Haupteingang saß mit steinerner Miene da. Er muss Marty wiedererkannt haben; ich wurde ohne Umstände weitergewinkt, ohne Fragen, ohne Durchsuchung. «Du sollst sofort rein», rief Marty mir nach. «Ich muss hier warten.»
Ich ging durch die Tür und trat in das riesige, dämmrige Innere des Lagerhauses. Zwei Gabelstapler standen neben dem Eingang; sonst konnte ich außer Kartontürmen nichts wahrnehmen. Es roch nach Maschinenöl und frischgeschnittenem Palettenholz – oder auch nach Maschinengewehröl und Sargholz. Wer zu Brendan Flynn bestellt wurde, tat gut daran, nervös zu sein.
«Bist du das, Shanahan?» Aus dem Dunkel der Riesenhalle klang vom anderen Ende her Herlihys missbilligende Stimme.
«Ich bin’s.»
«Komm und leiste uns Gesellschaft!» Das war ein Befehl. Für die freundlicheren Seiten des Lebens hatte Michael Herlihy keine Zeit; er kannte nur Arbeit und Pflicht. Er war ein dürres Zwerglein, das nur aus Sehnen und eisigem Ehrgeiz bestand; Muße und Freizeit – für ihn hieß das: ein Wettlauf auf der Marathonlaufbahn von Boston. Er war Anwalt, und er stammte, wie ich auch, aus dem Kreis der Bostoner «Zwei-WC-Iren»: die wohlhabenden Amerika-Iren, die ein Haus am Point besaßen und Sommerhäuser am South Shore oder in Cape Cod. Nicht, dass Michael gewesen wäre, was ich einen richtigen Anwalt genannt hätte; er hatte gar nichts von seinem Vater, der es selbst mit einer Tabak- und Bourbonfahne geschafft hätte, eine Jury aus presbyterianischen alten Jungfern zu überzeugen, die Hure von Babylon freizusprechen. Old Joe war lange tot. Sein einziger Sohn praktizierte in Massachusetts – ein piekfeiner Rechtsanwalt, der zwischen Stadtverwaltungen und privaten Deponieunternehmen Verträge über die Müllabfuhr aushandelte. In seiner Freizeit amtierte er als Vorsitzender des Komitees für die Wiederwahl des Kongressabgeordneten Thomas O’Shaughnessy und als Präsident der Neuenglandsektion der Friends of Free Ireland. In letzterem Zusammenhang zog Michael es vor, sich als Kommandant der Brigade Boston in der Provisorischen IRA zu bezeichnen – das war ein bisschen dick aufgetragen, da so etwas wie eine Brigade Boston gar nicht existierte. Doch Michael posierte gern als Freiheitskämpfer und bewahrte ein Paar schwarze Handschuhe und eine schwarze Baskenmütze in Seidenpapier auf, damit sie ihm eventuell auf den Sarg gelegt werden konnten. Er hat nie geheiratet – nicht heiraten wollen, wie er selbst sagte.
Hier in der drückenden Hitze von Miami wartete er mit drei Männern auf mich. Zwei kannte ich nicht. Der dritte, der mir zur Begrüßung mit ausgestreckten Armen entgegenkam, war Brendan Flynn persönlich. «Bist du’s, Paulie? Mein Gott! Er ist es. Wirklich! Großartig, dich wiederzusehen! Einfach großartig! Es hat viel zu lang gedauert.» Sein Belfaster Akzent war so sauer wie eine Essiggurke. «Gut schaust du aus! Das kommt bestimmt vom belgischen Bier. Oder sind’s die Frauen? Mein Gott, welch ein Glück, dass du noch am Leben bist, ehrlich!» Er zerdrückte mich fast mit seiner Umarmung, trat zurück und versetzte mir einen freundlichen Schlag auf die Schulter, der einen Stier zu Boden gestreckt hätte. Es gab ein Gerücht, dass Brendan Flynn einen IRA-Informanten einmal mit einem einzigen Schlag der flachen Hand auf den Kopf getötet hatte; ich konnte mir’s vorstellen. Er war hochgewachsen, wie ein Ochse gebaut mit einem Borstenbart und einer Stimme, die aus der Tiefe seines Bierbauchs stieg. «Und wie geht’s dir, Paulie? Schlägst dich gut durch, oder?»
«Mir geht’s prima.» Ich hatte mich für die vier Jahre des Schweigens von ihrer Seite mit kühler Zurückhaltung rächen wollen, sprach aber auf Brendans begeisterten Ton an. «Und selber?», fragte ich.
«Mein Bart wird grau! Siehst du? Ich werde alt, Paulie, ich werde alt. Bald werde ich ins Bett machen, da werden mir die Nonnen eins auf die Finger geben, weil ich ein böser Junge war. Gott, aber wie großartig, dich zu sehen!»
«Du solltest öfter mit mir zusammenkommen, Brendan.»
«Genug davon! Hier sind Freunde.» Er legte mir einen Arm um die Schulter und drückte sie. Mir war, als ob mein Brustkorb von einer hydraulischen Presse geplättet wurde. «Aber, mein Gott, die Hitze! Wie kann ein Mensch bloß bei solcher Hitze leben? Süße Muttergottes, es ist ja wie in einem Backofen.» Es war gar kein Wunder, dass Brendan die Hitze spürte. Er trug eine Tweedjacke und eine Wollweste über einem Flanellhemd, als würde in Miami das gleiche Klima herrschen wie in Dublin. Brendan hatte immer nur in Dublin gelebt, seit er in Belfast eine Bombe zu viel gelegt hatte. Er zog mich jetzt voller Begeisterung zu einer geöffneten Kiste. «Komm und sieh dir mal an, was Michael da für uns gefunden hat!»
Michael Herlihy schlängelte sich an meine Seite. «Paul?» Das war seine Art der Begrüßung. Wir kannten uns seit dem zweiten Schuljahr. Er hatte noch immer nicht gelernt, guten Tag zu sagen.
«Wie geht’s dir, Michael?», erkundigte ich mich. Er ist nie Mike, Mick oder Micky genannt worden. Er hieß Michael – und Schluss. In unserer Kindheit hatten wir alle Spitznamen: Ochs, King, Steak, Super-Auge, Dink, Krümmchen – nur Michael X. Herlihy nicht. Der war für alle immer bloß Michael. Das X stand für seinen Taufnamen: Xavier.
«Gut geht’s mir, Paul, danke.» Er antwortete ernst, als ob die Frage ernst gemeint gewesen wäre. «Du hast auf dem Weg zu uns keine Probleme gehabt?»
«Warum sollte ich Probleme gehabt haben? Ich werde in keinem Land polizeilich beobachtet.» Die Bemerkung galt Brendan, dessen lautem Charakter Zurückhaltung nicht lag, und falls er, als hohes Tier, mit der üblichen Großspurigkeit gereist war, müsste man es beinahe wie ein Wunder betrachten, wenn das FBI und die Polizei von Miami uns jetzt nicht bereits mit Argusaugen beobachteten.
«Lass das Sticheln, Paulie.» Brendan wischte meine Kritik beiseite. «Du redest wie ein altes Weib, ehrlich. Die Garda meint, ich sei auf einer holländischen Konferenz über die Zukunft Irlands.» Die drei letzten Wörter betonte er mit ironischem Nachdruck, um dann aus einer geöffneten Kiste Berge von Wellpappe und Styroporpackmaterial auszugraben. «Ich bin nach Holland geflogen, mit dem Zug in die Schweiz, mit einem Flugzeug nach Rio und mit einem anderen hierhergekommen. Die Affen haben meine Fußspuren schon vor Tagen verloren.» Seine hallende Stimme füllte den staubigen Riesenraum des Lagerhauses, der nur mit dem bisschen Tageslicht erhellt war, das durch die Fächer der Deckenventilatoren gefiltert wurde. «Außerdem – schau doch mal. Das hier ist’s Risiko wert – oder?» Er drehte sich mit einem plastikverpackten Bündel um, das er der Kiste entnommen hatte. Er hielt es hoch – mit der Pietät eines Priesters, der die Hostie in die Höhe hebt. Michael Herlihy neigt wirklich nicht dazu, Begeisterung zu zeigen, aber diesmal wirkte sogar er erregt.
«Da!» Brendan legte das Bündel oben auf eine andere Kiste und zog die Plastikhülle ab. «Um der Liebe des barmherzigen Gottes willen, Paulie – würdest du bitte dem allerliebsten Schätzchen einen Blick gönnen?»
«Eine Stinger», sagte ich. Ich vermochte es nicht zu unterdrücken – in meiner Stimme lag ein Ton der Ehrfurcht.
«Eine Stinger! Eine von dreiundfünfzig», ergänzte Brendan, «und alle in erstklassigem Zustand, in Originalverpackung, mit Gebrauchsanweisung und Tragriemen. Nicht schlecht, was? Kapierst du jetzt, warum mir das Risiko nicht zu groß war?! Warum ich herkommen musste?!»
Ich begriff sofort, warum ihm das persönliche Risiko nicht zu hoch gewesen war, weil ich genau wusste, wie hoch die IRA gerade diese Waffe schätzte und dass sie für einen sauberen Bestand von Stingers alle möglichen Risiken auf sich nehmen würde. Die Stinger ist eine Boden-Luft-Rakete, die in den USA hergestellt und von der Schulter abgefeuert wird und mit einem wärmesuchenden hochexplosiven Sprengkopf ausgerüstet ist. Geschoss und Abschussvorrichtung zusammen wiegen bloß dreißig Pfund; die Rakete selbst ist schnell, zielsicher und innerhalb von vier Meilen vom Ort des Abschusses tödlich. Brendan bewunderte die ausgepackte Waffe mit einem verträumten Blick. Vor seinem inneren Auge sah er bestimmt schon, wie britische Hubschrauber über dem okkupierten Irland brennend vom Himmel stürzten. «Lieber Gott!», sagte er leise, von der Schönheit der Vision überwältigt.
Die Provos hatten es mit einigen anderen von der Schulter abgefeuerten Flugzeugabwehrraketen versucht. So etwa vom Belfaster Hersteller Short Brothers gestohlene Blowpipes und russische Red Stars, ein Geschenk Libyens. Doch weder die Blowpipes noch der Rote Stern konnten es mit der Stinger aufnehmen. Es gab da einen großen Unterschied, wie Brendan mir einmal erläutert hatte – die Stinger funktionierte, und zwar praktisch jedes Mal. Schieß eine Stinger ab – und im selben Moment wird ein britischer Hubschrauber, der Millionen von Pfund kostet, zu Altmetall. Schieß eine Stinger ab – und die Briten können ihre Stützpunkte in South Armagh nicht mehr versorgen. Schieß eine Stinger ab – und die Briten müssen ihre Überwachungshelikopter über dem Lager Creggan oder über Ballymurphy abziehen. Schieß eine Stinger ab, und alle Zeitungen in England, Irland und den USA werden aufhorchen und die IRA ernst nehmen. Schieß eine genügende Anzahl Stinger ab, so dachte Michael Herlihy, und in St. Stephen’s Green in Dublin würde einem asketischen Anwalt aus Boston ein Denkmal gesetzt.
«Das ist die wichtigste Waffenlieferung in der Geschichte des irischen Kampfes», sagte Michael Herlihy leise mit Blick auf die Waffe; und wenn seine Worte eine gewisse Übertreibung darstellten, so war das verzeihlich. Die Libyer hatten der IRA Tonnen von Sprengstoff und Gewehre geschickt; jedoch hatten weder Bomben und Kugeln noch die unschuldigen Toten auf den grünen Friedhöfen die Briten bewegt, in Ulster auch nur einen Zoll Boden aufzugeben. Die Stinger dagegen, so glaubten Brendan und Herlihy, würden die Feinde vom Himmel jagen und die Besatzungstruppen derart erschrecken, dass Irland frei würde – so sicher, wie auf Tage der Dunkelheit die Sonne folgt.
Es gab bei der Sache nur ein Problem. Oder zwei – und beide waren schmal, beide groß, beide trugen Anzüge aus blassem Leinen, beide hatten ein glattes Gesicht und dunkle Hautfarbe. Michael Herlihy stellte die beiden vor. «Juan Alvarez und Miguel Carlos.» Die Namen waren nicht ernst zu nehmen; sie waren bloß die Etiketten für dieses Treffen unter ratternden Entlüftungsventilatoren, die in einem anonymen Lagerhaus in Hialeah staubiges Sonnenlicht filterten. «Mr. Alvarez und Mr. Carlos vertreten das Konsortium, das diese Raketen erworben hat», erklärte Michael in einer etwas unglücklichen Formulierung. «Konsortium?», fragte ich.
Die Antwort gab der Mann, der sich Alvarez nannte. «Die dreiundfünfzig Geschosse sind gegenwärtig als Eigentum der US-Regierung registriert.» Er sagte das ohne jede Ironie so, als ob ich für die Information dankbar sein müsste.
«Mein Gott, ist die aber schön!», murmelte Brendan. Er streichelte die Stinger. Seine Hände glitten über die olivgrüne Röhre, das Visier. Die Rakete hinter der Membran, die die Laufröhre versiegelte, blieb unsichtbar.
«Und was für einen Preis verlangt das Konsortium?», wollte ich von Alvarez wissen.
«Für dreiundfünfzig Stück, Señor, fünf Millionen Dollar.»
«Großer Gott!» Ich konnte nicht an mich halten. Das war reinster Wucher. Seit vier Jahren hatte ich mit Waffenhandel nichts mehr zu tun gehabt, konnte es mir aber einfach nicht vorstellen, dass der Preis für eine Stinger dermaßen in die Höhe geschossen war. Die USA hatten afghanischen Mudschaheddin Stinger geliefert; seither mussten doch mit Sicherheit Stinger auf dem Schwarzmarkt zu bekommen sein. Wie könnten diese Kubaner da für dreiundfünfzig Stinger fünf Millionen Dollar verlangen?
Alvarez zuckte die Schultern. «Wenn Sie gleiche Qualität anderswo billiger bekommen, Señor – wir würden es verstehen. Aber unser Preis steht. Fünf Millionen Dollar.» Er machte eine Pause. Er wusste ja, wie sehr die Provisorische IRA nach diesen Waffen gierte. «Die fünf Millionen sind in Goldmünzen zu bezahlen. Hier in Miami.»
«Selbstverständlich», spottete ich.
«Und selbstverständlich», fuhr Alvarez ruhig fort, «wird eine kleine Anzahlung erforderlich sein, Señor.»
«Ach so, eine kleine Anzahlung obendrein. Sofort?», sagte ich verächtlich.
«Die Kosten gehn dich nichts an, Paul. Also halt die Schnauze», wies mich Brendan zurecht. Er war in die Raketen verliebt; sie schienen ihm jeden Preis wert. Er nahm mich am Arm und steuerte mich außer Hörweite der Kubaner. «Der Witz ist der, Paul – wir haben das Gold bereits. Die Sache steht. Wir müssen das Gold jetzt nur noch herüberholen.»
In dem Moment fiel bei mir der Groschen. «Per Schiff? Vom Mittelmeer?»
«So ist es.»
«Die Araber geben euch das Gold?»
«Und warum nicht? Wo die Mistkerle doch so reich sind? Sie haben das viele Öl, und das arme Irland hat bloß eine Menge nassen Torf. Was bedeutet denen Gold, Paulie?» Sein Griff wurde so fest, dass er mir wehtat. «Wir haben dich nur aus einem bestimmten Grund eingeladen: Du solltest diese Stinger mit eigenen Augen sehen. Shafiq hat uns erklärt, du würdest uns nur helfen, wenn du weißt, worum es geht. Aus dem Grund haben wir sie dir jetzt gezeigt. Du bist schon immer ein vorsichtiger Mann gewesen, Paulie – hab ich nicht recht?»
«Außer bei Frauen, Brendan?» Ich fragte sarkastisch. Da bohrte ich in einer Wunde, die vier Jahre alt war.
«Diese eine hat mehr Ärger gemacht, als sie wert war.» Er meinte Roisin. Der lässige Ton verdeckte die alte Wunde aber nicht ganz. Brendan ließ mich los und versetzte mir einen Schlag auf den Rücken. «Also – du wirst das Schiff für uns holen? Wirst du es nun tun? Dann wär alles wieder wie damals – in den alten Tagen. Wie in der guten alten Zeit.»
«Klar», sagte ich. «Aber klar doch.» Weil es nämlich dann wirklich wieder so wäre wie in der guten alten Zeit.
Ich war der Verbindungsmann der IRA zum Nahen Osten gewesen. Ich bin der Kerl, der mit den Palästinensern die Geschäfte gemacht und sich stundenlang Muammar al-Gaddafis Pläne für die Weltrevolution angehört hatte. Ich war der Beschaffer gewesen, der den Provos die Millionen, der ihnen Gewehre und Bomben besorgt hatte – bis sie plötzlich befunden hatten, mir sei nicht zu trauen. Ein Gerücht war aufgekommen: Ich gehöre zur CIA. Das hatte mich erledigt. Aber sie hatten mich wenigstens am Leben gelassen; Roisin dagegen war auf dem gelben Berghang unter der brennenden Sonne des Libanon hingerichtet worden.
Die Führer der Provisorischen Irisch-Republikanischen Armee hatten behauptet, Roisin hätte einen Mann verraten; Roisin hatte versuchte, die Sache auf mich abzuwälzen; und dieser Hauch eines Verdachts hatte der IRA genügt, mir das Vertrauen zu entziehen. Man hatte mich in den letzten vier Jahren ab und zu als Laufburschen eingesetzt und meine Wohnung auch ein-, zweimal als Versteck für Flüchtende benutzt, vom früheren Vertrauen mir gegenüber jedoch nichts mehr gezeigt – bis jetzt, auf einmal, weil sie ein Schiff über den Atlantik bringen mussten und ich in ihrem Umfeld der Einzige war, der sich mit den dazu notwendigen Dingen auskannte.
«Wir hätten Michael das Schiff fahren lassen», erklärte Brendan, «aber Michael wird ja schon seekrank, wenn er das Meer sieht!» Er lachte. Herlihy lächelte dünn und verspannt. Er mochte es nicht, wenn man ihn wegen dieser chronischen Schwäche aufzog, die einem Soldaten des Untergrunds wirklich nicht anstand.
Brendan goss mir einen Whiskey ein. Wir saßen in seinem Hotelzimmer an der Küste. Auf dem niedrigen Couchtisch stand eine Flasche Jameson. Brendan aalte sich unter der Klimaanlage und erklärte mir, warum die Jacht aus Europa nach Amerika geholt werden musste. «Die kubanischen Schweine wollen unbedingt mit Gold bezahlt werden. Ehrlich. Aber es ist praktisch unmöglich, sagt Michael, uns das Gold hier im Land zu beschaffen.»
«Verordnung des Finanzministeriums», erläuterte Herlihy. Er trank keinen Whiskey. Er hielt sich an Mineralwasser. «Transaktionen über zehntausend Dollar unterliegen der Meldepflicht. Ein Gesetz zum Aufspüren von Drogenhändlern.»
«Und deshalb sind deine alten Freunde eingesprungen. Die Libyer.» Brendan nahm den Faden wieder auf. Er war ans Fenster getreten. Er zog an einer Zigarette und beobachtete eine Gruppe von Pelikanen unten am Strand. «Im Phoenix-Zoo habe ich auch mal Pelikane gesehen. Ehrlich. Ist aber nicht dasselbe. Was meinst du?»
«Die Libyer geben euch das Gold?» Ich wollte sichergehen, dass es aus Libyen stammte und nicht aus dem Irak kam.
«So viel haben wir selber nicht», erklärte Brendan munter. «Aber die Anzahlung haben wir zusammengekratzt. Das heißt, Michael hat sie beschafft.»
«Du hast eine halbe Million zusammengebracht?», fragte ich Herlihy erstaunt. Die Leute in Boston, New York, Philadelphia und den übrigen Zentren der amerikanisch-irischen Bevölkerung mochten großzügig sein, doch reich waren sie selten; ihre Spenden hielten sich gewöhnlich im Rahmen, und selbst solche kleinen Spenden waren seit geraumer Zeit eher rückläufig, weil Politiker aus der Republik Irland die Vereinigten Staaten bereist und gepredigt hatten, die IRA sei ebenso ein Feind des irischen Südens wie ein Feind Großbritanniens. Wie sollte Michael Herlihy da plötzlich eine halbe Million gesammelt haben? «Wie hast du denn das geschafft?»
«Kümmer dich um deine eigenen Sachen», erwiderte Herlihy sauer.
«Deine Sache, Paulie», sagte Brendan, «betrifft die fünf Millionen in Gold. Die spendieren uns die Libyer. Gott segne sie. Die Libyer bestehen aber darauf, dass wir den Transport des Goldes von drüben besorgen. Und da haben wir an dich gedacht.» Brendan schenkte mir ein fröhliches Lächeln. «Also, könntest du das übernehmen?»
Es klang freundlich. Doch Brendan klang immer freundlich. Es waren schon viele gestorben, weil sie Brendans offenes, fröhliches Gesicht und seine jovial derbe Art missverstanden hatten. Unter der Schale war er unerbittlich. Er war von Hass verzehrt – ein Mensch, der mit jeder Faser seines Lebens der irischen Sache diente. Falls ich diesen Auftrag ablehnte, würde er mich vermutlich umbringen. Er würde mich bis zum letzten Moment freundlich anlächeln, mir scheinbar vertrauen, mich «Paulie» nennen, mich in den Arm nehmen – und dann töten.
Ich nippte an meinem Whiskey. «Habt ihr mal überlegt, was fünf Millionen Dollar in Gold wiegen?»
«Tausend Pfund, so in der Richtung», antwortete Brendan. Er wartete auf meine Reaktion. «Sagen wir mal: Sie brauchen so viel Platz wie drei große Koffer?» Aber ich hatte nicht an den Platz gedacht, den eine solche Menge Gold beanspruchen würde; was mir Sorgen machte, waren die Auswirkungen, die ein solches Gewicht auf einem Segelschiff haben würde. Eintausend Pfund Ballast dürften einem anständigen Kreuzfahrtschiff allerdings nichts ausmachen. «Also?», drängte Brendan.
«Mit tausend Pfund Gold komme ich klar», sagte ich.
«Und wie?», fuhr Herlihy mich an.
«Das geht dich nichts an.»
Brendan lachte über die Feindseligkeit, die zwischen Herlihy und mir bestand. «Für dich ist natürlich auch ein klein bisschen was drin, Paulie.»
«Wie viel?»
«Die Anzahlung. Die halbe Million – die bekommen wir beim Eintreffen des Goldes zurück. Scheint dir die Summe okay?» Brendan warf Herlihy einen Blick zu, als brauche er dafür seine Zustimmung. Ich spürte: Der Punkt war zwischen den beiden vorher nicht abgesprochen worden. Ich bemerkte auch, dass Michael Herlihy bei dieser Summe zusammenzuckte. Ich rechnete schon damit, dass er protestierte. Aber dann nickte er beifällig.
«Die Sache ist die.» Brendan strahlte mich an. «Ich weiß doch, dass ein Schiff mit so viel Gold eine verdammt große Versuchung ist. Sogar für einen ehrlichen Menschen wie dich, Paulie. Ich sehe es so: Wenn du versuchen solltest, das Gold zu stehlen, hast du mich zum Feind, und irgendwann werde ich dich finden, und du wirst einen langsamen Tod sterben, der unangenehmer ist als in deinen schlimmsten Albträumen. Oder du bleibst anständig – dann springt zum Schluss für dich eine halbe Million heraus. Eine halbe Million Dollar müsste doch ausreichen, damit ein Mann ehrlich bleibt.» Er lächelte, als würde der Gedanke ihn sehr zufrieden machen, und drehte sich wieder zum sonnenklaren Meer hinter den getönten Scheiben. «Sieh mal, wie groß die Vögel sind! Sind die eigentlich essbar?»
«Eine halbe Million scheint mir in Ordnung», sagte ich möglichst gelassen.
«Nicht, dass wir total blöd wären, Paulie.» Brendans Blick ruhte noch immer auf den Pelikanen. «Und deshalb geben wir dir ein bisschen Begleitung mit. Nur um dir unter die Arme zu greifen.»
«Du meinst wohl: um auf mich aufzupassen?», fragte ich verstimmt.
«Du brauchst doch eine Crew.» Brendan drehte mir den Rücken zu. Er blieb während des ganzen Gesprächs lässig. Das hatte einen simplen Grund: Er wusste, dass ich sein Angebot nicht ablehnen konnte. Schon die Tatsache, dass ich überhaupt nach Miami gekommen war, bewies, dass ich auf alles eingehen würde, was er von mir verlangte. «Sagen wir mal so: Deine Crew besteht aus zwei von meinen Jungs», fuhr er fort. «Nimm sie hart ran. Klar?»
Ich zuckte mit den Schultern. «Prima.» Wieso, überlegte ich, war ich eigentlich zuerst von Shafiq kontaktiert worden, wenn die Libyer die Verantwortung für den Transport des Goldes auf die IRA abgewälzt hatten? Und wieso hatten Brendan und Michael sich vor ihrer Unterredung mit mir nicht über mein Honorar verständigt? Oder hatten sie sich abgesprochen, aber aus einer typischen Eingebung des Augenblicks heraus hatte Brendan dann eine viel höhere Summe genannt, um mich in Versuchung zu führen? Was allerdings auch bedeutete: Er hatte nicht die Absicht, mich so lang am Leben zu lassen, dass ich das Geld in die Hand bekam. Ich sah in der halben Million auf einmal nur mehr einen Köder, damit ich den Job annähme; sobald ich den Auftrag erledigt hätte, würden die beiden Jungs von Brendan mich abknallen.
Die ganze Sache kam mir seltsam unausgegoren vor, und das gab mir zu denken, weil die IRA, nachdem sie aus allzu vielen Fehlern der Vergangenheit gelernt hatte, eigentlich keine halbfertigen Pläne mehr anfasste; ein so wichtiges Detail wie die Festlegung des Honorars würde man mit Sicherheit vorher abgeklärt haben. Ich musste zu dem Schluss kommen, dass diese Aktion in größter Eile geplant worden war, möglicherweise sogar nur in der Kürze des einen Monats, seit ein irakisches Heer das hilflose Kuwait überrannt hatte. «Im Moment ist nur eins wichtig», fuhr Brendan vergnügt fort. «Wir müssen ein geeignetes Schiff finden, und das könnte niemand besser als du.»
«Wenn ich das Schiff über den großen Teich segeln soll», erklärte ich, «dann will ich’s mir auch selber aussuchen.»
«Du hättest also nichts dagegen, wieder nach Europa zu fliegen?», fragte Brendan. «Die Libyer haben es nämlich sehr eilig, das Gold rüberzuschaffen. Ehrlich.»
«Wir haben es eilig», verbesserte Herlihy und schloss eine Erklärung an. «Im nächsten April liegen die Osteraufstände fünfundsiebzig Jahre zurück. Zur Erinnerung wollen wir den Briten ein blutiges Gedenken verpassen. Die Stinger können wir aber erst nach Irland abschicken, wenn das Gold hier ist.»
«Ich soll morgen schon zurückfliegen?», fragte ich Brendan überrascht. Ich hatte gehofft, Zeit zu haben, nach Norden zu fliegen zu meinem Haus in Cape Cod, das ich seit sieben Jahren nicht mehr gesehen hatte. Und vielleicht auch zum Grab meiner Eltern in Boston. Also wieder nichts – weil Michael und Brendan es eilig hatten.
Sie hatten es noch viel eiliger, als ich dachte. «Nicht morgen», sagte Brendan, «heute Nacht», und zauberte ein Flugticket aus der Tasche seines Tweedjacketts. «Es geht nach Paris und von dort weiter nach Tunesien. Erster Klasse, Paul!»
Die geben sich ja verdammt viel Mühe, dachte ich. Ein Ticket erster Klasse wäre bestimmt nicht nötig gewesen. Ich war freiwillig gekommen; entsprechend hätten sie mich behandeln müssen; solcher Lockmittel hätte es gar nicht bedurft. Ich gewann fast den Eindruck, dass Brendan und Michael mich zu etwas überreden suchten, womit ich möglicherweise nichts zu tun haben wollte. Irgendetwas stimmte da nicht – also schon wieder eine Ungereimtheit. Meine Unruhe wuchs. Meine Neugier aber auch. Da gab es eine Menge Leute, die alles daransetzten, damit ich diesen Auftrag annahm, und solche Anstrengungen weckten in mir den Verdacht, dass in der ganzen Kiste viel zu entdecken und viel herauszuholen sein könnte. Ich erklärte mich deshalb bereit, noch am gleichen Abend zu fliegen.
Brendan begleitete mich zum Flughafen. «Es ist herrlich, wieder mit dir zusammenzuarbeiten, Paul. Einfach herrlich.»
Ich überging den Schmus. «Ihr konntet außer mir niemand finden, der für den Job qualifiziert war. War’s nicht so?»
Er stutzte für den Bruchteil einer Sekunde. Dann lachte er laut auf. «Ja. Genau.»
«Und deshalb musst du mir notgedrungen wieder vertrauen?» Ich konnte meine Verbitterung nicht verhehlen. Little Marty Doyle spitzte merklich die Ohren.
«Du weißt doch, wie’s läuft, Paul», meinte Brendan ein wenig verlegen. «Wir werden schon beim Verdacht eines Verdachts misstrauisch.»
«Misstrauisch!» Ich protestierte. «Nur weil irgendein Weibsbild mich beschuldigt, der CIA anzugehören, lasst ihr vier Jahre lang nichts von euch hören? Nun mach aber ’n Punkt, Brendan! Andere Frauen simulieren Kopfschmerzen. Roisin hat stattdessen Märchen erfunden. So etwas hättet ihr doch nicht ernst nehmen dürfen.»
«Was das Mädchen über dich erzählt hat, war gelogen. Das wissen wir inzwischen auch», gab er düster zu. «Du hast es ja bewiesen. Du hättest uns während der letzten vier Jahre jederzeit verraten können. Du hast es aber nicht getan. Und im übrigen hat Herlihy bei seinen Gewährsmännern in Boston angefragt; die haben bestätigt, dass sie gesponnen hat. Ausgeschlossen, dass die Yankees so eine Sache laufen hatten. Reine Phantasie. Aber eine hübsche Geschichte war’s trotzdem. Eine süße kleine Geschichte. Erzählen konnte sie, die Roisin. Langweilig war sie nie.»
Wer könnten Herlihys Gewährsleute gewesen sein? Männer bei der Polizei in Boston vermutlich, die das FBI anzapfen konnten, dem wiederum die CIA einen Gefallen schuldig war. Da hatte jemand Roisins Behauptungen überprüfen lassen, und ich hatte eine blütenweiße Weste. «Haben Herlihys Leute auch Roisin überprüft?», fragte ich.
«Die war mir vielleicht eine!», sagte Brendan voller Bewunderung, womit er meiner Frage geschickt auswich. «Du heiliger Strohsack! Eine Zunge wie ’n Flammenwerfer! Mit der Zunge hätte man die Farbe von den Wänden beizen können.»
«Hat sie der CIA angehört?»
«Sie war bloß ’n kleines Miststück, das Probleme gemacht hat. Mehr nicht.» Er schwieg eine Zeitlang vor sich hin. «Aber als Frau – was für eine Frau! Hab ich nicht recht?»
Ich hatte schon immer vermutet, dass Brendan und Roisin ein Verhältnis gehabt hatten. Beim nostalgischen Klang der letzten Worte kam die alte Eifersucht in mir wieder hoch. Roisin war ein Terroristengroupie gewesen, eine Anhängerin des gewaltsamen Todes. Aber sie hätte mit dem Teufel ins Bett gehen können – ich hätte sie trotzdem geliebt. Ich war ihr verfallen gewesen. Für mich hatte sich in der Welt alles nur um sie gedreht. Für mich war sie heller gewesen als die Sonne, sie hatte den Mond in den Schatten gestellt und die Sterne mit ihrem Glanz überstrahlt. Und sie war tot.
Ich schaffte den Nachtflug nach Paris.
Auf dem Shanes-Monastir-Flughafen erwartete mich Shafiq. Er trug einen silbergrauen Leinenanzug mit einer rosaroten Rose im Knopfloch – aus Plastik, wie sich bei näherem Hinsehen zeigte. Neben ihm wirkte ich schäbig in meinen Klamotten, die von der langen Reise ganz zerknittert waren . «Wie war’s in Miami?», wollte Shafiq wissen.
«Heiß.»
«Und die Frauen?»
«Exquisit. Verführerisch. In durchsichtigen Kleidern.» Genau das wollte Shafiq hören. Der arme Kerl träumte von westlichen Frauen. Von französischen ganz besonders. In den guten alten Zeiten hatte er sich mit mir im Sommer stets an der Riviera verabreden wollen, an der Promenade flanieren und von oben auf die Brüste nackter Französinnen am Strand hinabschauen wollen, die dort eine neben der anderen gelegen hatte. Davon hatte er nie genug bekommen können. Stundenlang hatte er geglotzt. Die unverbindlich dargebotene Nacktheit hatte seine Phantasie genährt. Im Café des Hotels Negresco hatte er mir einmal ganz scheu von seinem größten Wunsch erzählt: eine französische Braut zu finden. «Keine Hure, Paul. Du verstehst? Keine Hure. Huren hab ich genug.» Er hatte daraufhin geschwiegen, in eine Napoleonschnitte gestochen und die Creme genossen, die zwischen den Kuchenschichten heraus und auf seinen Teelöffel gelaufen war. Shafiq liebte Süßes. Trotzdem sah er aus wie ein Skelett. «Huren habe ich satt», sagte er, als er den Löffel abgeleckt hatte. «Ich will ein zartes Pariser Mädchen mit schneeweißer Haut, schmalen Knochen und kurzem Goldhaar, das bei meinem Eintreten lächelt. Dann wird sie mir etwas auf dem Klavier vorspielen. Anschließend werden wir den Hund an der Seine spazieren führen.» Shafiq war, wie ich später entdeckte, mit einer fetten, dunkelhäutigen Frau verheiratet und hatte drei Töchter mit Damenbart, die sich in der kleinen Wohnung in Tripolis nur zankten.
Er begleitete mich jetzt zum Parkplatz, wo sein weißer Peugeot-Leihwagen stand. Nach alter Seglergewohnheit schaute ich zum Himmel. Es war ein wolkenloser Tag, aber der Wind kam aus Norden und war so kühl, dass ich froh war, einen Pullover mitgebracht zu haben. «Wohin geht’s?»
«Zum Jachthafen von Monastir.» Shafiq schloss den Wagen auf. «Dort liegen Schiffe zum Verkauf. Westliche Schiffe. Du solltest sie sehen, Paul! Wenn sie in den Hafen segeln, tragen die Frauen so kleine Bikinis – sie könnten genauso gut gar nichts anhaben! Sie sind – wie sagt man doch – fast im Naturkostüm.»
Shafiq war von einem Feuer erfüllt wie ein Liebhaber, den die Glut der ersten Leidenschaft mitreißt. Ich hatte schon andere Männer mit dieser Euphorie gesehen – Männer bei ihrer ersten Terroraktion, die mit Toten ein neues Irland schaffen wollten. Aber Shafiq war im Dienst der Gewalt ein reifer Mann geworden. Mir schien völlig unverständlich, warum ihn der Kauf einer westlichen Jacht dermaßen beflügeln sollte. Er fuhr an, ließ einen Schwall arabischer Flüche gegen einen Taxifahrer los, der es gewagt hatte, mit lautem Hupen dagegen zu protestieren, dass der Peugeot in den Verkehrsstrom einscherte. «Wir treffen jemanden», verkündete Shafiq, als hätte er für mich etwas ganz Besonderes vorbereitet.
«Ich dachte, wir wollten ein Schiff kaufen?»
«Wollen wir auch, wollen wir auch. Aber zuerst werden wir uns mit jemandem treffen. Er heißt Halil!»
«Halil.» Ich wiederholte den Namen ohne die Begeisterung, mit der Shafiq ihn ausgesprochen hatte. «Und wer ist Halil?»
«Er ist an diesem Ende für die Aktion verantwortlich. So wie am anderen Ende Mr. Herlihy.»
Herlihy war verantwortlich? Nicht Brendan Flynn? Seltsam! Ich merkte mir das: ein weiterer kleiner Misston, der das ganze Unternehmen in ein merkwürdiges Licht rückte. «Und wer ist Halil?», fragte ich erneut. Es handelte sich zweifellos um einen Decknamen; doch in der Vergangenheit war Shafiq oft genug bereit gewesen, solch kleine Geheimnisse zu verraten.
Diesmal nicht. «Einfach Halil!» Shafiq lachte. Dann raste er an einem Lastwagen vorbei, der mit Kisten voll gackernder Hühner beladen war. «Halil ist aber ein großer Mann. Das muss man wissen, bevor man ihm begegnet.» Er sagte das durchaus freundlich, doch es war als Warnung gemeint.
«Liegt das Gold bereit?», fragte ich.
«Ich weiß nicht. Kann sein. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht.» Unter die Scheibenwischer des Peugeot hatten sich Hühnerfedern geklemmt. Shafiq versuchte sie loszuwerden, indem er die Wischer anschaltete. Die Federn waren hartnäckig. Shafiq gab auf. Er steckte sich eine Zigarette an und grinste mir komplizenhaft zu. «Du hast die Stinger gesehen?»
«Eine hab ich gesehen.»
«Was für eine Waffe! Welch eine Waffe! Nun weißt du, was es mit dem Schiff auf sich hat, ja?»
«Nein.»
«Paul! Willst du nicht, dass die Helden von Irland Stinger erhalten?»
«Klar bin ich dafür, dass sie Panzer und Raketenwerfer erhalten. Ich kapiere nur nicht, warum die Waffen mit Gold bezahlt werden müssen, das heimlich in einem Schiff über den Atlantik geschippert werden soll. Haben eure Leute noch nie was von Schecks gehört? Von Bankaufträgen? Überweisungen?»
Shafiq lachte. «Paul! Paul!» Er sprach meinen Namen aus, als rüge er mich wegen einer chronischen, liebenswürdigen Streitsucht. Als wir in die Nähe des Hafens kamen und er den Peugeot durch dichten Verkehr manövrierte, wurde er still. Über unseren Köpfen hoben sich die Türme und Zinnen der Festung Ribat; ihr folgte die Große Moschee, von deren Minarett ein Tonband über Lautsprecher die Gläubigen zum Gebet rief. Dann bogen wir um eine Ecke, und vor uns, im Licht der Oktobersonne, lag der Jachthafen. Im Mittelmeer war die Segelsaison noch nicht zu Ende gegangen. Die Schiffe lagen dicht nebeneinander an den Pontons; an vielen flatterten große, kunstvolle Rennwimpel; man gewann den Eindruck, unter den bunten Bannern des alten Hafens habe sich eine Flotte mittelalterlicher Kriegsschiffe versammelt. «Halil erwartet uns auf dem Schiff», sagte Shafiq. Er war plötzlich nervös geworden.
«Auf dem Schiff? Ich denke, ich sollte das Schiff erst noch aussuchen?»
«Halil hat ein Schiff gefunden, das er für brauchbar hält. Es wäre am besten, wenn du ihm zustimmst.» Shafiq war sichtlich besorgt. Wer immer Halil war – er besaß offenbar Macht über Leben und Tod, und Shafiq versuchte, mir diese Tatsache einzuprägen.
Ich war fest entschlossen, mich nicht beeindrucken zu lassen. «Ist Halil ein Experte für Atlantiküberfahrten?», fragte ich sarkastisch.
«Er ist Experte für alles, wofür er Experte sein will», gab Shafiq zurück. «Also komm!»
Wir gingen an den Sicherheitsposten vorbei und über einen der langen schwimmenden Pontons. Shafiq war so ängstlich, dass er für die sonnengebräunten Frauen in den Cockpits der ankernden Jachten nicht einmal einen Blick übrig hatte. Er führte mich bis zum Ende des Pontons, wo eine ansehnliche Schaluppe vertäut lag. «Das ist unser Schiff!» Shafiq blieb stehen, um sich eine Zigarette anzuzünden. «Gefällt’s dir?»
«Wie soll ich das wissen?», erwiderte ich gereizt. Doch der weiße Schiffskörper der Corsaire gefiel mir sehr. Der Name war über die Schwimmbrücke des zuckerlöffelförmigen Hecks gemalt, direkt über den Herkunftshafen, Port Vendres – der französische Mittelmeerhafen nahe der spanischen Grenze. Die Corsaire schien ein hübsches Schiff, teuer, gut ausgestattet. Sie stach die kleineren, schäbigeren Boote weiter unten am Ponton mühelos aus. Aus einer mir bekannten Werft stammte sie nicht. Sie war vermutlich speziell für einen reichen Eigentümer mit ganz persönlichen Vorstellungen von einem Kreuzfahrtschiff entworfen und erbaut worden. Dieser Mann hatte sich eine minimale Takelage, die Plicht im Zentrum und ein langes, niedriges Freibord auf einem Schiff von vierundvierzig Fuß Länge gewünscht – gar keine schlechte Wahl, wie ich widerwillig zugeben musste, für eine Fahrt über den Atlantik. Vorausgesetzt, das Schiff befand sich in gutem Zustand.
«Wieso steht es zum Verkauf?», fragte ich Shafiq.
«Der Eigentümer hat es im letzten Winter hiergelassen. In Tunesien sind die Hafengebühren für den Winter billiger als in Frankreich. Verstehst du? Inzwischen ist er jedoch erkrankt. Deshalb muss er verkaufen.» Shafiq hob die Hand zum Gruß der beiden jungen Männer, die in der Plicht der Corsaire saßen, unter einem weißen Baumwollsonnensegel, das über den Baum getakelt war. Er sprach Arabisch mit ihnen und deutete auf mich. Als Antwort grunzten sie kurz zurück. Diese Art Männer kannte ich von früher – Schlägertypen, die in den Flüchtlingslagern der Palästinenser ausgesucht und zum Töten trainiert wurden; dann bekamen sie Waffen, Frauen und die Erlaubnis, unter ihrem vertriebenen Volk herumzustolzieren, als ob sie Helden wären.
«Ist Halil auch so einer?», murmelte ich.
«Das sind seine Leibwächter», erwiderte Shafiq leise und lächelte unterwürfig, als uns die beiden Männer aufs Schiff winkten. Während der eine Wache stand, tastete der andere uns ab, um sicherzugehen, dass keiner von uns bewaffnet war. Falls jemand von den Crews der westlichen Jachten die zudringliche Leibesvisite bemerkt haben sollte, ließ er es sich nicht anmerken. Trotz allem modernen Dekor war Tunesien immer noch ein islamisches, arabisches Land, und man tat gut daran, die hiesigen Bräuche und Barbareien kommentarlos hinzunehmen. Ein Leibwächter nahm mir meinen Seesack ab und schob mich zur Treppe der Hauptkajüte. «Verhalt dich respektvoll!», zischte mir Shafiq zu. «Bitte!»
Ich stieg die steilen Stufen hinab. Zur Rechten befanden sich der Kartentisch und die Instrumente, zur Linken die Kombüse. Vor mir lag der geräumige Salon mit komfortablen Sofas und Regalen. Nach dem hellen Sonnenlicht wirkte der Salon dunkel, aber den jungen Mann, der sich auf dem entferntesten Sofa ausstreckte, sah ich dennoch. Auf den ersten Blick schien er mir genauso unsympathisch wie die zwei Kerle in der Plicht. Ich hielt ihn für einen weiteren Leibwächter zum Schutz des Herrn und Meisters, der sich wahrscheinlich in der vorn liegenden Schlafkabine aufhielt. Der junge Mann nahm die Sonnenbrille ab und lehnte sich mit den Ellbogen auf den Tisch.
«Ich bin Halil.»
«Ich heiße Shanahan.»
«Setzen Sie sich.» Es war eher Befehl als Einladung. Die Setzborde hinter uns wurden zugeschlagen und der Lukendeckel geschlossen. Ich saß mit diesem Halil im Bauch der Corsaire gefangen. Im Schiff war es stickig und feucht. Im abgeschlossenen Schiffskörper roch es außerdem irgendwie nach Fäulnis.
Ich saß auf der Steuerbordbank. Meine Augen gewöhnten sich allmählich an die Dunkelheit. An dem Menschen, der Shafiq in solche Angst versetzte, konnte ich nichts Bemerkenswertes entdecken. Halil schien Mitte dreißig zu sein, dunkelhäutig und unauffällig. Er hatte dichtes schwarzes, glatt nach hinten gekämmtes Haar. Die einzige persönliche Note war ein schmaler Schnurrbart, wie Bandleader der vierziger Jahre ihn schätzten. Er trug ein weißes Hemd ohne Krawatte und einen schwarzen Anzug. Er war kräftig gebaut, wie ein Bauer. Die linke Hand – nur sie war sichtbar – hatte kurze, kantige Finger. Im Aschenbecher auf dem Tisch lag eine brennende Zigarette, daneben eine Schachtel Camel und ein teures Goldfeuerzeug. «650000 Franc will der Besitzer für das Schiff», sagte Halil ruhig. «Ist das ein fairer Preis?»
«Wenn das Schiff in einem guten Zustand ist», sagte ich, «ist das geschenkt.»
«Es ist frivol.» Halils Rechte war zu sehen, als er die Zigarette an die Lippen führte. Er sog den Rauch tief ein und legte die Zigarette sofort wieder ab. Dass seine rechte Hand bebte, hatte ich bemerkt; es war so stark, dass sogar der Rauch der Zigarette zitterte.
«Frivol?», fragte ich.
Die dunklen Augen wandten sich mir ruckartig zu. Ich begann Shafiqs Nervosität zu verstehen. Die leeren Augen dieses Mannes wirkten fast reptilienartig. «Schiffe», belehrte er mich, «sollten edlen Zwecken dienen, Shanahan. Man kann sie nutzen, um Meerestiere zu fangen oder Güter zu transportieren. Oder zum Kampf, als Abschussrampe für Waffen. Schiffe zu Vergnügungszwecken kann nur ein frivoles Volk bauen.» Er sprach Englisch und mit einer tiefen Stimme, die seinen Worten Autorität verlieh. «Sie meinen, ein so frivoles Schiff sei 650000 Franc wert?»
«Es ist meines Erachtens noch mehr wert.»





























