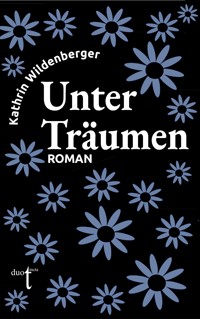
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: duotincta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Spätsommer 2016. Beinahe 30 Jahre ist es her, seit die Mauer fiel, Ania Hochlinger an den Montagsdemonstrationen in Leipzig teilnahm und in der Nikolaikirche ihrer ersten Liebe Bernd wiederbegegnete. Ania, eine so starke wie suchende Frau in der Mitte ihres Lebens, wird jäh mit dieser Vergangenheit konfrontiert, als sie von Bernds Freitod erfährt und in das gemeinsame Heimatdorf im Südharz zur Bestattung fährt. Warum wollte Bernd sterben? Und was hat sein Tod mit Ania zu tun? Kathrin Wildenberger lässt mit "Unter Träumen" ihre Montagsnächte-Trilogie in der Gegenwart enden. In der Wiederbegegnung mit den Protagonisten aus "Montagsnächte" und "ZwischenLand", denen einst blühende Landschaften versprochen worden waren, finden sich Antworten auf Fragen, die seinerzeit so groß vor ihnen standen wie ihre Träume.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
verlag duotincta
Unter Träumen
Kathrin Wildenberger
Roman
Über die Autorin
Kathrin Wildenberger wurde 1971 in Sangerhausen/Sachsen-Anhalt geboren, sie lebt als freie Autorin in Leipzig und veröffentlichte zahlreiche Texte in Zeitschriften und Anthologien. 2007 wurde ihr Debütroman »Montagsnächte« im Plöttner-Verlag, Leipzig, veröffentlicht.
Für ihr zweites Romanmanuskript »ZwischenLand«, das die Geschichte der »Montagsnächte« weitererzählt, erhielt sie 2011 ein Stipendium der Stiftung Kulturraum Sachsen und 2013 ein Stipendium der Bayerischen Akademie des Schreibens am Literaturhaus München (Seminar Jugendromane).
2017 erschienen »Montagsnächte« in einer Neuausgabe und 2018 »ZwischenLand« bei duotincta, Berlin.
www.montagsnächte.de
Denn die Herausforderung durch das Leben läßt nicht nach.
(Eva Strittmatter »Briefe aus Schulzenhof«)
Kasachstan, Nähe Almaty, 15. Juni 2012 (überklebt)
Sie ist alt und Heilerin. Jeder hier kennt sie.
Sie schüttet mir einen Eimer Wasser über den Kopf. Und noch einen. Ich schreie. Fühle mich, als wäre ich kopfüber in einen Gebirgssee gesprungen. Sie packt meine Schultern. Schüttelt mich. Wassertropfen fliegen um mich herum. Sie murmelt etwas, ich verstehe sie nicht, öffne die Augen. Sie hält mir ihre hohlen Hände hin.
In deutlichem Russisch sagt sie: Trink! Noch einmal: Trink!
Die klare Flüssigkeit schmeckt nach Moos und ihren Händen. Ich schlucke sie mühsam runter. Haben die anderen, die in der Küche sitzen, auch davon getrunken? Vielleicht haben sie damit nur ihre Gesichter gewaschen.
Plötzlich ist die alte Frau weg. Ist die Zeremonie vorbei? Bin ich jetzt aufgenommen, getauft? Darf ich sie jetzt fotografieren?
Ich schüttele mir das Wasser aus den Haaren. Wische es mir aus dem Gesicht. Schimmelgeruch in der Nase. Sie sitzt vor ihrer Hütte auf einem umgestülpten Blecheimer. Schaut mich an. Blinzelt nicht. Neigt den Kopf zur Seite.
Fotografiert zu werden, ist hier eine ernste Angelegenheit.
1. Ankommen
Am Anfang war alles wie immer gewesen.
Vater hatte Ania vom Bahnhof der Kleinstadt abgeholt, er hatte auf dem Parkplatz vor dem frisch angestrichenen, aber menschenleeren Bahnhofsgebäude gewartet, er war ausgestiegen und hatte ihr zugewinkt. Zur Begrüßung hatten sie sich fest umarmt. Im Auto war es klimaanlagenkühl gewesen, und Ania hatte sich das Kleid über die nackten Knie gezogen. Während der Fahrt hatten sie die meiste Zeit geschwiegen und Ania hatte aufgeatmet, als sie von der Hauptstraße, die das Dorf durchzog, in Richtung der Felder und Wiesen abbogen und vor dem Haus ihrer Schwester ankamen.
Brit und Mutter wären schon auf dem Weg zum Friedhof, erzählte Vater und schüttelte auf Anias Frage hin den Kopf. Er sei in der letzten Zeit auf so vielen Beerdigungen gewesen, und jemand müsse ja schließlich auf die Kinder aufpassen. Vic sei mit Bauchschmerzen zu Hause und schlafe, und Ella würde gleich aus der Schule kommen und hoffe auf ein Fußballmatch mit Opa.
Ania lächelte, auch wenn ihr eigentlich gar nicht danach war. Ihren Vater als fürsorglichen Großvater zu erleben, irritierte und amüsierte sie noch immer.
Sie stellte ihre Reisetasche ins Gästezimmer, die Wände waren zartgelb gestrichen, es roch noch nach frischer Farbe. Doch sonst war auch hier alles unverändert, beruhigend, vertraut.
»In einer halben Stunde fängt die Trauerfeier an, soll ich dich fahren?«, fragte Vater, als sie aus dem Badezimmer kam.
»Lass nur, das schaffe ich locker.«
Zu Fuß brauchte Ania etwa eine Viertelstunde zum Friedhof, und sie wollte noch etwas für sich sein, bevor es begann.
Die Mittagssonne verbreitete Spätsommerlicht und Wärme.
Ania nahm die Sonnenbrille aus ihrer Handtasche, sie war froh darüber, ihr Haar eben noch schnell zu einem Knoten gewunden und aufgesteckt zu haben. Fast wie in Dhaka, dachte sie, doch dort hatte sie die Sonne manchmal tagelang nicht gesehen, verdeckt durch Smog und Wolken. Die Luft war heiß und feucht gewesen, und Ania hatte sich oft wie unter einer Glocke aus Schwüle gefühlt.
Nun war sie zurück, den Sommer hatte sie schon in Deutschland verbracht, und sie mochte sich nicht vorstellen, wie es sich für sie angefühlt hätte, wenn sie die Nachricht von Bernds Tod in Bangladesch erhalten hätte.
Ania spürte die wärmenden Sonnenstrahlen auf ihrem Gesicht, schloss kurz die Augen, wechselte dann auf die schattige Seite des Amselweges und ging am Flüsschen entlang, das sich, mit Schilf und hohen Gräsern zugewachsen, durchs Dorf schlängelte. Als sie die Hauptstraße erreichte, gab es keinen Schatten mehr. Sie kniff trotz der Sonnenbrille die Augen zusammen. Nur ab und zu fuhr ein Auto an ihr vorbei.
Die Fenster der kleinen Häuser direkt an der Straße versteckten sich hinter heruntergelassenen Rollläden. In den Vorgärten nickten blasse Sonnenblumen vor sich hin. Auf der weitläufigen Wiese hinter Rothmanns Haus surrten Wespen über den Äpfeln, die am Boden lagen. Es roch nach Sommer und Kindheit, nach Zuhause, doch das passte nicht zu Anias Stimmung, es machte sie nur trauriger.
Vor dem Wartehäuschen an der Haltestelle des Schulbusses standen zwei Jungen mit Fahrrädern. Sie unterbrachen ihr Gespräch, grüßten, und Ania spürte, wie sie ihr nachsahen. Wie oft hatte sie hier gestanden, bei Regen und Schnee, zusammen mit Suse und Brit und darauf gewartet, die Scheinwerfer des Busses an der Kurve zu sehen. Das Wartehäuschen hatten meist die Jungen besetzt, mit den Mädchen, die laut waren, rauchten und kicherten. Suse war ab und zu dabei gewesen, Ania hatte lieber draußen gewartet, umfangen von Morgenmüdigkeit. Sie hatte es gemocht, für die zehn Minuten Fahrt ins Nachbardorf aus der dunklen Kälte draußen in die warme Stickigkeit des Busses abzutauchen.
Ihr Elternhaus, das auf der anderen Straßenseite, direkt an der Einfahrt zur Kastaniengasse lag, wirkte auch verlassen, aber im Vorgarten blühten farbenfroh die Dahlien, und die Holzbank, auf der Ania vor vielen Jahren gesessen und zu Bernd hinübergeschaut hatte, gab es noch immer, wenn auch verwittert, ohne Farbe und mit einer herausgebrochenen Strebe.
Das hellgrau verputzte Haus mit der breiten Treppe, auf der Bernd gesessen, geraucht und gelesen hatte, hatte seine Mutter im Frühjahr verkauft. Nun wohnte eine junge Familie darin, und die Treppe war einem offenen Verandavorbau gewichen. Eine schlanke Frau goss die Blumenkästen, sie nickte Ania zu.
Ania fühlte sich erschöpft. Der dünne Stoff ihres schwarzen Kleides klebte am Rücken, ihr Herz schlug zu schnell. So gern würde sie umkehren, zurückgehen zum Haus ihrer Schwester, Vater Gesellschaft leisten, Vic begrüßen und mit Ella das verrückte Brettspiel spielen, das sie zum achten Geburtstag bekommen hatte und an dessen Namen sich Ania nicht erinnern konnte. Oder sie könnte den Bus nehmen, zurück in die Kleinstadt fahren und in den nächsten Zug nach Leipzig steigen. Sie wäre kurz da gewesen, sie hätte es versucht, immerhin.
Vorm Grundstück von Max Kuhn ging die Hauptstraße in eine scharfe Kurve. Hinter den Resten des Gartenzauns ein Schutthaufen. Vom Haus standen nur noch drei nackte Wände mit Fensterhöhlen. Im Inneren, wo einmal das Wohnzimmer und der Wintergarten gewesen waren, hatte Max Holz aufgeschichtet. Aus der Scheune daneben, die nahezu unversehrt wirkte, drangen Hammerschläge. Das Tor war offen, doch es war niemand zu sehen. Ania lief schneller, sie wollte Max nicht begegnen, der, seit er sein Wohnhaus nach und nach verfeuerte und, mit einer struppigen Fellweste bekleidet, bei jedem Wetter im Freien wohnte, im Dorf nur noch der Wikinger genannt wurde. Er war ihr Onkel, er gehörte zu ihrer Familie, und doch war er ihr unheimlich. Sie wollte ihn nicht begrüßen, nicht mit ihm reden, schon gar nicht heute.
Sie könnte jetzt den Hohen Weg nehmen, der am Kindergarten vorbei in einem recht steilen Anstieg zum Friedhof führte. Doch Ania hatte noch etwas Zeit, sie wollte nicht zu früh am Friedhof sein und wählte den zwar längeren, aber bequemeren Weg durch den Ort.
Sie lief weiter auf dem schmalen Bürgersteig die Hauptstraße herab, die zur Dorfmitte führte. Schon von weitem sah sie einen roten Wagen, der vorm Hoftor des Hauses von Suses Mutter parkte.
Entweder Frank oder Suse – einem von beiden wird das Auto gehören. Einer von beiden wird da sein.
Das Auto hatte ein Berliner Kennzeichen. Es war also Suse. Ob sie auch auf dem Friedhof war, auf der Beerdigung des Dorfintellektuellen, wie sie Bernd oft genannt hatte? Es hatte herablassend geklungen, fand Ania, und Suse hatte Ania auch nicht verschwiegen, dass sie die Zuneigung ihrer besten Freundin zu dem etwas verschrobenen Nachbarsjungen nicht nachvollziehen konnte. Vor einem Jahr hatten sie sich zuletzt gesehen, und auch wenn die Fremdheit zwischen Suse und ihr mit den Jahren mehr und mehr zugenommen hatte und dies auch bei ihrem letzten Wiedersehen zu spüren gewesen war, hatte Ania das Treffen in guter Erinnerung behalten. Vielleicht besuchte Suse auch nur ihre Mutter.
Ania schluckte. Ihr Hals war trocken, und sie hatte nichts zu trinken dabei.
Es gab für sie kaum eine Kindheitserinnerung ohne Suse. Seit dem Kindergarten waren sie beste Freundinnen gewesen. Vielleicht würde sie ja doch auf dem Friedhof sein.
Die Ladentür der Fleischereigenossenschaft gegenüber stand offen. Ania vermied es, hineinzuschauen. Unangenehm war es ihr schon immer gewesen, doch im Moment wäre es ihr regelrecht zuwider, begrüßt und ausgefragt zu werden, ob von der Verkäuferin hinter der Theke oder von einer der alten Frauen, die mal mit Großmutter befreundet gewesen waren und zu denen die Neugier gehörte wie die hautfarbenen Feinstrümpfe und die Einkaufskörbe aus Bast.
Der Ort wirkte auf sie wie eine leere Kulisse. Alles schien zu warten.
Vorm Dorfgemeinschaftshaus parkten zwischen den einheimischen Autos ein Opel und ein Mercedes mit Berliner Kennzeichen. Ania ging über die Straße. Vielleicht hatte eines der Autos Bernd gehört. Sie schaute durch die getönten Fensterscheiben des Opels auf eine helle Lederrückbank, ein Häuflein Stoff lag da, ein Jackett vielleicht, das bei dieser Hitze niemand tragen wollte. Nur einmal hatte Ania Bernd im Jackett gesehen, bei ihrer Wiederbegegnung vor sieben Jahren in Leipzig, es war schwarz gewesen, und er hatte es offen und lässig über der Jeans getragen, die Hände in den Hosentaschen. Ania musste lächeln, als sie daran dachte.
Sie überquerte wieder die Straße und lief den Weg zum Friedhof hinauf. Ein Dackel kläffte hinter einem Gartenzaun, sein Gebell unterbrach die Stille und hallte in Ania nach, bis sie am Friedhofstor angekommen war.
Mitten in Kasachstan, 16. Juni 2012
– Zeit haben (ich habe sie, wenn ich sie mir nehme!)
– auf das richtige Bild, den richtigen Augenblick warten (Geduld!)
– beobachten, wie sich das Licht verändert (wenn der Tag vergeht)
– abgrenzen!
– arbeiten! (weitermachen!)
Gedanken des Tages:
Die Probleme hier kann ich nicht lösen. Was nicht heißt, dass ich nichts tun kann. Ich kann zeigen, was bisher nicht sichtbar war. Mit meinem Blick von außen Dinge erkennbar machen, die im Verborgenen liegen.
Ja, das, vielleicht.
2. Lebensfeier
»Mitten im Leben geschieht der Tod. Wir können vielleicht damit rechnen. Aber wir können uns nicht darauf vorbereiten. Der Tod geschieht, und wir müssen damit zurechtkommen, dass jemand gegangen ist und nicht wiederkommen wird.«
Bernds Vater Richard war zu einem kleinen Mann geworden, schmal und mit weißem Haar, doch er stand aufrecht, und noch immer strich er sich langsam selbst über den Kopf, als wolle er sich damit beruhigen; von der Stirn über den Hinterkopf bis in den Nacken. Er trug einen schwarzen Anzug, ein helles Hemd, keine Krawatte, er war heute nicht als Pfarrer hier. Er redete laut, denn es gab kein Mikrofon. Es strengte ihn an, sein ganzer Körper sagte das, seine Stimme auch. So oft hatte Ania ihn schon reden hören, reden sehen, aber das heute, das war etwas anderes.
»Bei Bernd hat niemand damit gerechnet. Die Nachricht hat uns alle zutiefst erschüttert. Nun sind wir hierhergekommen, um an ihn zu denken, nicht allein mit unserer Trauer zu sein und zu spüren, dass Bernd auf seine Weise noch immer bei uns ist. Er lebt weiter in uns, in unseren Gedanken und Erinnerungen, und es liegt an uns, wie viel Raum wir all dem schenken möchten.«
Weiterleben. Wie sollte das gehen, wenn nichts von ihm übrig war als Staub, gesammelt in dieser schlichten schwarzen Urne? Wenn es nur noch Bilder von ihm gab und das, was sie über ihn wussten, was sie mit ihm erlebt hatten, eben das, was sie Erinnerung nannten?
Ania lehnte sich an die Wand hinter ihr und wollte doch eigentlich nur weg, die Kapelle verlassen, nicht weiter Richards Worten zuhören müssen, nicht auf den Rücken, den gebeugten Kopf von Bernds Mutter schauen müssen, nicht nach Louise suchen und vor allem nicht immer wieder das Bild betrachten müssen, das neben der Urne stand.
Viel zu müde war sie für all das hier.
Die Beklemmung, die sie schon auf dem Weg durchs Dorf begleitet hatte, wuchs. Es fiel ihr schwer zu atmen. Dabei wollte sie sich nicht verschließen, nicht so tun, als wäre das Vergangene vorbei. Erinnern wollte sie sich, an Bernd denken, um ihn weinen, mit ihm in Gedanken sprechen, doch all das lieber in Stille, im Alleinsein.
Warum brauchte sie dann diesen inszenierten Abschied? Niemand bis auf Ria hatte ihr dazu geraten, nicht mal Mutter oder Brit und auch nicht ihre langjährige Freundin Irene. Warum war Ania nach ihrem Nachtdienst nicht zu Hause geblieben, sondern in den nächsten Zug gestiegen, um hierherzukommen, an diesen Ort, den sie Zuhause nannte, nicht, weil es sich so anfühlte, sondern weil es immer so gewesen war?
Ania war plötzlich hellwach und voller Angst, fühlte sich all dem hier ausgeliefert. Warum ging sie nicht einfach? Es wäre wie ein Spießrutenlauf mit dem halben Dorf als Publikum, ja, aber was kümmerten sie die Gedanken der anderen hier?
Als sie in die Kapelle gekommen war, waren längst alle Sitzplätze belegt gewesen. Sie hatte sich neben einen älteren Herrn gestellt, den sie nicht kannte, der ihr aber freundlich zunickte. Der Geruch nach Staub und modrigen Blumen hatte sie umfangen, und sie hatte sich für einen Moment beschützter gefühlt.
»Lasst uns auf eine Reise gehen.«
Richard hob die Stimme, senkte dann kurz den Kopf, als müsse er sich sammeln.
»Bernd wäre im November neunundvierzig Jahre alt geworden. Er wollte nicht mehr leben, und uns als Hinterbliebenen bleibt nur, ihm diese Feier zu schenken, eine Feier für ihn und sein Leben. Bernds Lebensgefährtin Louise, seine Mutter und ich haben Gedanken, Erinnerungen, Geschichten zusammengestellt und, natürlich, Musik, die er mochte, die ihn die Jahre über begleitet hat.«
Wie viel Leben hatten sie zusammen gehabt, fragte sich Ania. Erst vor etwa einem Jahr war Bernd in die Gegend zurückgekehrt. Weggezogen war er nach der Schule, und wahrscheinlich war er noch seltener zu Besuch hierhergekommen als Ania. Was war in diesem einen Jahr seit seiner Rückkehr passiert? Hatte er sich seinen Eltern angenähert? Waren sie vertrauter miteinander geworden?
Richard holte eine Fernbedienung aus der Tasche seines Jacketts, hielt sie in Richtung der Stereoanlage, die neben dem Fenster auf einem schiefen Holzschränkchen stand. Er drückte mehrmals auf einen der Knöpfe, schüttelte schließlich den Kopf. Die Frau mit den glatten schwarzen Haaren, die neben Bernds Mutter saß und von der Ania inzwischen glaubte, dass es Louise war, hielt den Kopf gesenkt und rührte sich nicht. Die Dame neben ihr stand auf, sie hatte locker hochgestecktes graues Haar und ein dezent geschminktes, fein geschnittenes Gesicht. Erst ging sie zu Richard, dann zu dem Gerät, hielt die Fernbedienung ganz nah an den CD-Player. Es blinkte grün, dann erklang »Imagine«.
In der Halle wurde es wieder stiller, die leisen Geräusche, das Rascheln und das Getuschel legten sich.
John Lennon sang, und Ania traten Tränen in die Augen, sie zwinkerte, doch sie kam nicht dagegen an. Wie oft hatten Bernd und sie den Song gehört, an den kühlen Oktoberabenden nach den Demos, den Zusammenkünften in der WG und in ihren Nächten? Noch immer kannte sie jedes Wort, jede Nuance der Melodie. Ihr Körper war plötzlich ein einziger Schmerz, sitzen würde sie gern oder sich einfach nur irgendwo festhalten. Warum hatte sie, wenn sie schon geblieben war, nicht doch nach Brit und Mutter gesucht, draußen, vor der Kapelle? Warum tat sie sich all das hier an?
Und warum ging es ihr überhaupt so schlecht? Es war doch alles so lange her.
Die Tränen liefen ihr übers Gesicht, sie griff nach der Packung Papiertaschentücher, die sie in das Außenfach ihrer Handtasche gesteckt hatte, schnäuzte sich leise, wurde etwas ruhiger. Wieder betrachtete sie das Foto, das im schwarzen Rahmen neben der Urne stand. Bernd am Fenster, er klopfte die Asche der Zigarette auf eine Untertasse auf dem Fensterbrett. Noch immer die Brille, runde Gläser ohne Rand, noch immer die leicht zusammengekniffenen Augen, der Mund als Strich, die Locken, im Nacken zusammengebunden. Ein einfaches schwarzes Shirt, schmale Arme, die aus den weiten Ärmeln hervorschauten.
Er sah John Lennon ähnlich, mehr als früher sogar. Doch wann war früher? Vor dreißig Jahren, als sie sich zum ersten Mal geküsst hatten, im Skoda seines Onkels, auf dem Parkplatz vorm Haus seiner Eltern, an dem Abend, bevor er Bausoldat in Prora wurde? Oder ein paar Jahre später, als sie an den warmen Oktoberabenden in Leipzig auf dem Ring liefen, mit Kerzen in den Händen und nichts als ihrer Angst und ihrer Hoffnung? Oder noch später, als er plötzlich aus Anias Leben verschwand, den Vagabunden in sich wiedergefunden hatte und nur einen Zettel mit eilig dahingekritzelten Zeilen hinterließ? Oder vor sieben Jahren, als sie sich in Leipzig wiedergesehen hatten?
Der Anruf von Mutter war vor etwa vier Wochen gekommen, an einem sommerwarmen Sonntagabend.
»Ania, meine Liebe«, hatte Mutter gesagt und noch einmal, »meine Liebe.« Dann hatte sie angefangen zu weinen.
Eine Woche später hatte sich Louise über Facebook bei Ania gemeldet. Von Mutter wusste Ania, dass es Louise in Bernds Leben gab, dass sie zusammen mit ihm von Berlin in die Kleinstadt gekommen war, dass sie gemeinsam das Atelier von Fotograf Schwab übernommen hatten, der vor einem Jahr in den Ruhestand gegangen war. Es hatte Ania wehgetan, als sie von Louise hörte, mehr, als sie sich eingestehen wollte.
Nun hatte Louise Ania geschrieben, sie hatte geschrieben, dass sie die Freundin von Bernd gewesen sei, von Bernd Lehne.
Sie schrieb, dass sie nach einem langen Fototermin spätabends nach Hause gekommen wäre, ihn im Bett gefunden hätte, ins Kissen gewühlt, und geglaubt hätte, er würde schlafen. Doch sein Körper war kalt gewesen, er hatte sich mit offenen Augen nicht mehr geregt, neben ihm lagen eine leere Wodkaflasche, und mehrere Packungen starker Schlafmittel.
Liebe Ania, es ist mir ein Bedürfnis, allen zu schreiben, von denen ich weiß, dass sie Bernd gekannt haben. Ich habe ein Bild von Dir in seinem Notizbuch gefunden. Hintendrauf stand »Ania«, und ich habe mich daran erinnert, dass Bernd von Dir erzählt hat.
Ania war lange an ihrem Schreibtisch vor dem Laptop sitzengeblieben. Louises Nachricht war fast ein Brief, sie hatte Ania so offen geschrieben, als wären sie alte Freundinnen, und Ania hatte beim Lesen eine Vertrautheit gespürt, die sie anfangs erschreckte und irritierte und erst später etwas tröstete. Als sie aufgehört hatte zu weinen, war es Nacht geworden. In diesen Stunden hätte sie sich nicht vorstellen können, zu Bernds Beerdigung zu fahren, sich ihrem Schmerz so ungeschützt auszusetzen und all der verlorenen Zeit ins Auge zu blicken.
Doch schon am nächsten Morgen war ihr bewusst geworden, wie wichtig es war, genau das zu tun. Vor sieben Jahren war sie Bernd zuletzt begegnet. Wie lange war das her? Eine Ewigkeit? Einen Moment?
Letztlich, so dachte sie, zählte nur, dass die Zeit für den Abschied gekommen war. Einen anderen Zeitpunkt würde es nicht geben, einen besseren auch nicht.
»Bernd wurde am 22. November 1967 hier in der Kleinstadt geboren. Er ist bei uns im Dorf aufgewachsen, ging nach der Schule zur Ausbildung ins Erzgebirge. Filmvorführer hat er gelernt, denn Filme waren sein Leben, bis die Fotos kamen, bis er selbst Geschichten erzählte und die Menschen, die er porträtierte, in ihrem Leben zeigte. Das Land seiner Kindheit war ihm zu eng, raus wollte er, raus in die Welt. Gleichzeitig wollte er aber etwas verändern, dort, wo er sich trotz allem zu Hause gefühlt hat. Und so ist er im September 2015, also vor genau einem Jahr zurückgekehrt, nach langer Zeit des Unterwegsseins und vielen Jahren in Berlin und hat, zusammen mit Louise, das Atelier von Fotograf Schwab übernommen.«
Richard. Sein Vater. Ob Bernd es gewusst hat? Ob sie es ihm nun doch gesagt haben, irgendwann in den letzten fünfundzwanzig Jahren? Bei ihrem letzten Wiedersehen hatte er nichts davon erzählt, und Ania hatte nicht danach gefragt.
Über so vieles hatte sie an diesem Abend, in dieser Nacht und am nächsten Morgen geschwiegen, und wieder fragte sie sich, warum sie nicht noch einmal bei ihm angerufen hatte. Sie hatte es versucht, ein einziges Mal, seiner Stimme auf der Mailbox zugehört, aufgelegt. Bernd hatte nicht zurückgerufen, und erst später war ihr eingefallen, dass er ihre Nummer nicht hatte, dass er nicht wissen konnte, von wem der Anruf kam. Sie hätte wenigstens eine Nachricht hinterlassen sollen. Noch einmal anzurufen, wagte sie nicht. Nach und nach war alles verblasst, und Ania hatte begonnen zu glauben, dass es wohl so sein sollte – ab und zu eine Begegnung mit ihm, wenn überhaupt – doch nun war es zu spät, nun war Bernd tot, und neben vielem anderen konnte Ania seine Stimme im Ansagetext auf der Mailbox nicht vergessen und sich selbst nicht verzeihen, dass sie keine Nachricht aufgesprochen hatte.
Richard hörte auf zu reden und wischte sich mit einem karierten Herrentaschentuch über die Augen. Wieder Musik. Ein Stück aus den Brandenburgischen Konzerten von Bach. Richard sah in Anias Richtung, seine Augenbrauen hoben sich, es wirkte, als wolle er lächeln, doch er nickte ihr nur leicht zu.
Als Ania zum letzten Mal hier in der Kapelle gewesen war, vor fünf Jahren, zur Beerdigung von Großmutter, war das Wetter auch spätsommerlich schön gewesen, wurde auch ein Leben verlesen, auch von Richard, der inzwischen Pfarrer für zehn Gemeinden war. Aber es war ein Leben, das neunundneunzig Jahre gedauert hatte, neunundneunzig Jahre in diesem Dorf, neunundneunzig Jahre in diesem Haus, in dem Großmutter geboren wurde und in dem sie schließlich gestorben war.
Anias Handy vibrierte kurz. Sie konnte die Nachricht jetzt nicht lesen. Oder doch? Musste sie vielleicht sogar? Nein, sie hatte dienstfrei. Nach einem langen Nachtdienst mit drei Geburten und einer schwierigen Entbindung am frühen Morgen hatte sie Feierabend. Eigentlich hasste Ania dieses Wort. Viele Jahre hatte es keine Bedeutung für sie gehabt, sie hatte gearbeitet und war da, wenn sie gebraucht wurde, wenn die Frauen, die sie schon seit Monaten im Geburtshaus betreut hatte, ihr Kind bekamen. Jetzt kümmerte sie sich um die Schwangeren, die in ihrer Dienstzeit zur Entbindung ins Klinikum kamen. Oft sah Ania die Frauen dann zum ersten Mal, so wie diejenige, deren Kind sie heute Morgen gegen fünf Uhr auf die Welt geholfen hatte.
Vielleicht war doch noch etwas gewesen mit der Patientin. Vielleicht hatte es eine Komplikation gegeben. Ania wollte in die Tasche greifen, nach dem Handy suchen, doch sie ließ es. Schließlich hatte Ria sie abgelöst.
»Du wirst es bereuen, wenn du die Beerdigung verpasst«, hatte sie gestern gesagt, als Ania wieder laut darüber nachgedacht hatte, zu einem späteren Zeitpunkt hierher zu fahren, um auf den Friedhof zu gehen und für sich und in Stille Abschied von Bernd zu nehmen. »Nicht kneifen, Ania!«
Ania hatte mit einer Floskel geantwortet, sie hatte so getan, als würde Rias Bemerkung sie nicht berühren, doch im Innersten hatte sie sich getroffen und bevormundet gefühlt. Schließlich war es ganz allein an ihr, Ania, sich dafür oder dagegen zu entscheiden, was auch immer andere dazu sagten. Für sich wusste sie längst, dass sie sich diesem offiziellen Abschied von Bernd aussetzen musste, um Ruhe zu finden.
So war sie nach dem Dienst nach Hause gefahren, hatte lange geduscht, ihr Lieblingskleid angezogen, auf dem Balkon gefrühstückt und in letzter Minute die S-Bahn nach Halle und den Zug in die Kleinstadt bekommen.
Nun war sie hier, und da vorn, in diesem schwarzen Gefäß, war Bernd, war das, was von seinem Körper noch übrig war. Es war schon jetzt kaum zu fassen und zu verstehen, und bald schon würde es für Ania nur noch das von ihm geben, was in ihren Gedanken war, was sie in sich trug. Sie brauchte nicht mehr suchen, nicht mehr hoffen, und das war beruhigend, auch wenn es noch so traurig war.
Rausgehen, endlich, der Menschenmenge nach. Sie ließ die Wand los, mit weißen Fingern. Durch die Tür der Kapelle kam frische Luft, sie atmete tief.
Eine ältere Frau drehte sich nach ihr um. Das Gesicht kam Ania bekannt vor, an den Namen erinnerte sie sich nicht. Die Frau musterte sie, nickte ihr zu, war plötzlich so nah, dass Ania das Haarspray auf ihrer auftoupierten Frisur riechen konnte.
Die Träger hoben die Urne auf einen kleinen Wagen, legten die Blumen dazu, fuhren an ihnen vorbei. Direkt dahinter gingen Bernds Eltern, seine Mutter Helga hatte sich bei Richard eingehakt. Louise und die Grauhaarige folgten, sie gingen ebenfalls untergehakt, beide schauten stumm nach vorn.
Ania ließ alle anderen vorgehen, draußen warteten noch einmal so viele Leute. Wenn sie als eine der Letzten die Kapelle verließ, war sie mittendrin in der Menschenmenge.
Alle hier würden irgendwann nicht mehr da sein, so wie Bernd jetzt. Was war besser? Das Sterben selbst in die Hand zu nehmen wie er? Oder es geschehen zu lassen, wenn die Zeit dafür gekommen war? All diese Fragen.
Jemand tippte Ania von der Seite an, sie zuckte zusammen und sah in das Gesicht ihrer Schwester. »Da bist du ja«, flüsterte Brit. Sie umarmten sich, Brits Schultern zitterten, sie hielten sich fest, und da kamen auch Ania wieder die Tränen. Es war tröstlich, wie vertraut sie miteinander waren, auch wenn sie sich nur selten sahen. Sie waren Schwestern, und wenn es darauf ankam, fühlten sie gemeinsam, es gab eine Verbindung zwischen ihnen, die alles, was sie trennte, überdauert hatte.
Als sie zu den anderen gingen, die sich um die Grabstelle versammelt hatten, sah Ania noch immer alles durch einen Tränenschleier, doch sie konnte wieder freier atmen.
In der Eile hatte sie vergessen, Blumen mitzubringen. Nicht mal eine einzelne Rose, eine Sonnenblume, eine Lilie, irgendetwas. Welche Blumen hatte Bernd eigentlich gemocht? Fast unmöglich, aber Ania erinnerte sich nicht.
Louise hielt eine einzelne rote Rose in der Hand. Sie ließ den Arm der Grauhaarigen los, wehrte ab, als diese ihr folgen wollte.
Jung sah Louise aus, viel jünger, als Ania erwartet hatte. Sie hatte die Figur einer Zwölfjährigen, wirkte wie eine dieser alterslosen Frauen, die mit vierzig noch immer wie Mädchen aussahen.
Aber vielleicht täuschte Ania sich auch. Dass Louise eine Kollegin von Bernd war, hatte sie auf ihrer Facebook-Seite gesehen. Ania hatte das Porträt lange betrachtet. Eine Fotografie in Schwarzweiß, verschwommener Hintergrund, Halbprofil, die dunklen Haare offen, verspielte Strähnen, eine Stupsnase, lange Wimpern. Ernst wirkte sie, und Ania hatte sich gefragt, wer sie fotografiert hatte, ob Bernd es gewesen war oder jemand anderes.
Louise ließ die Rose in die Grube fallen, sie weinte, hielt inne, als wollte sie noch etwas sagen. Dann legte sie die Hände vors Gesicht, es war von weitem zu sehen, dass sie zitterte. Die Grauhaarige zog sie sanft zur Seite. So klein und blass war Louise, eher Schneewittchen als Rosenrot.
Rosenrot. So hatte Bernd Ania genannt, ein paar Wochen nach dem Mauerfall, als er Brit und sie fragte, ob sie Lust hätten, sich für ein paar Fotos zu verkleiden, es wäre doch bald Fasching. Brit, die sich seit ein paar Wochen nur noch schwarz anzog und ihre blonden Haare unter einer Baskenmütze versteckte, hatte erst den Kopf geschüttelt, doch dann hatte die Neugier gesiegt, und sie hatten in einer verlassenen Villa im Osten Leipzigs eine Fotoserie aufgenommen, die wie aus einer anderen Zeit wirkte, märchenhaft, geheimnisvoll und anders als alles, was Bernd zuvor fotografiert hatte.
Ania schreckte auf, als sie Brits Hand an ihrer spürte. Die Erinnerungen bildeten ein dichtes Netz, das sich um sie legte und sie einspann.
Brit streichelte ihren Arm. »Hat Mama für uns gebunden«, flüsterte sie und drückte Ania eine Lilie mit etwas Grün in die Hand. Dass es zwei kleine Sträuße waren, die Brit bei sich hatte, bemerkte Ania erst jetzt. Sie hatten an alles gedacht, wie immer. Und sie hatten ganz selbstverständlich für Ania mitgeplant und sie nicht gefragt, ob sie eigene Blumen mitbrachte. Wie auch immer sie das fand – sie gehörte eben dazu.
»Danke«, flüsterte sie und drückte Brits Hand.
Sie standen nun schon eine ganze Weile in der Reihe, die am Grab vorbeizog, zu den Angehörigen hin, die sich daneben versammelt hatten. Anias Beine zitterten, als sie schließlich nach vorn trat. Sie blieb vor dem Loch in der Erde stehen, schaute auf die Urne herab, ließ die Lilie fallen. Sie fühlte sich zu beobachtet und sie konnte nicht zu Bernd sprechen, weder in Gedanken noch in Worten.
Dennoch war sie hier, und das war gut so. Ania trat vom Grab zurück, eine große Ruhe breitete sich plötzlich in ihr aus. Sie ging auf Bernds Mutter zu. Helga Lehne drückte sie fest und strich ihr über den Rücken. »Dass du gekommen bist, Ania.«
Louise schaute Ania aus mandelförmigen Augen lange an. Dann umarmten sie sich.
Berlin, 14. August 2000
– Sommer. Zwischenstation Berlin. (von Ankommen nicht zu reden)
– Der Wecker tickt. Drei Uhr. (wieder eine schlaflose Nacht)
– Klinkenputzen, getarnt als Gespräch. (Termine kreiseln in meinem Kopf)
– reinschlagen könnte ich in die selbstgefälligen Visagen der Redakteure, der Agenturchefs. (in welcher Welt leben die eigentlich?)
– Warum wollen sie unbedingt eine Präsentation von mir? (Sprechen meine Fotos nicht für sich?)
– wenn nur die Leere danach nicht wäre, die Anstrengung, die mir noch tagelang in den Knochen steckt, das Gedankendurcheinander …
– ist es das wirklich wert?
Gedanken des Tages:
Zum Beobachten bin ich geboren, nicht zum Agieren. Und schon gar nicht zum Inszenieren. Wozu eigentlich inszenieren? Um Verborgenes nicht erkennen zu müssen? Um nur zu sehen, wonach ich suche, was ich sehen will? Gedankendurcheinander. Doch vieles wird klarer, wenn ich es aufschreibe. Ein Foto ist eine Momentaufnahme, ihr geht ein Prozess voran. Schreiben scheint mir jedoch mehr ein Prozess an sich zu sein. Wenn ich reise, bin ich meist allein mit meinen Eindrücken, meinen Ideen, meinen Erfahrungen. Fotos reichen nicht, das alles zu erfassen. Aufgeschriebenes auch nicht. Aber es ergänzt die Bilder. Und es befreit mich. Vor allem, wenn ich genügend Zeit und Ruhe in mir finde, um aus Fragmenten Texte, manchmal sogar Geschichten zu machen.
Berlin, 15. August 2000
Gerade gelesen: »Was die PHOTOGRAPHIE endlos reproduziert, hat nur einmal stattgefunden: sie wiederholt mechanisch, was sich existentiell nie mehr wird wiederholen können.«
(Roland Barthes »Die helle Kammer«)
3. Danach
»Na, dann, auf zum Leichenschmaus!« Brit schaltete ihr Handy wieder ein, tippte mit beiden Daumen eine Nachricht, während Ania eine leichte Strickjacke aus ihrer Tasche nahm und überstreifte. Die SMS auf ihrem Telefon war von Irene gewesen. Sie hatte gefragt, wie es Ania ginge, nun, wo die Trauerfeier vorbei wäre, und ob sie sich um ihre Balkonblumen kümmern solle, wo es doch so heiß wäre und falls sie länger wegbliebe. Es war eine Nachricht aus ihrem eigentlichen Leben gewesen, und sie hatte Ania gutgetan.
»Was für ein Zirkus!«, murmelte Brit, während sie langsam den Friedhofshügel herabliefen. Sie waren fast die letzten Trauergäste. »Aber was hilftʼs, so eine Tradition, die hat ja auch was. Vor allem, wenn alle schön was zu reden haben.« Brit steckte das Handy in ihre Jackentasche. »Wenigstens geht es Vic wieder besser.«
»Schön«, sagte Ania.
»Sind ja doch ein paar Leute da, die man beobachten, beschauen und begucken kann, unter anderem dich, große Schwester.«
Ania lachte auf. »Geht’s heute nicht eigentlich um Bernd?«
»Eigentlich.« Brit zog die Augenbrauen hoch, holte ihr Handy wieder raus, schaute drauf, redete trotzdem ununterbrochen weiter. »Du warst mal mit Bernd zusammen und bist selten hier und hast ein spannendes Leben, mit deiner Zeit in Bangladesch und so, da kommen sicher ein paar neugierige Fragen.« Brit steckte das Handy wieder weg. »Die Gäste auf den Beerdigungen sind doch oft interessanter als der Tote selbst«, sagte sie, »fast das ganze Dorf war da. Und ganz sicher nicht, weil sie alle Bernd kannten und um ihn trauern. Viele sind bestimmt auch wegen Richard und Helga gekommen. Der Sohn des Pfarrers hat sich selbst getötet – geht es tragischer?«
»Wissen die Leute denn inzwischen, dass Richard Bernds Vater ist?«
»Ich glaube, die wissen alles. Oder sie glauben es. Das reicht ja schon.«
»Wo ist Mama eigentlich?«, fragte Ania. »Wollte sie nicht auch mit?«
»Waren ihr zu viele Leute. Und sie hätte zu lange stehen müssen in der Hitze. Sie ist schon vorgegangen in die Gaststätte.«
Brits Auto parkte direkt hinter der Kurve, die zum Friedhofshügel führte. Sie stiegen ein, Brit ließ alle Fenster herunter, nahm eine Wasserflasche von der Rückbank, trank einen großen Schluck, drückte Ania die Flasche in die Hand. Das Wasser war warm, aber es sprudelte noch. Ania trank und trank, bis die Flasche leer war. Ihr war, als müsste sie alles, was in den letzten Stunden in ihr hochgestiegen war, wegspülen.
»Hast du noch mehr?«
Brit zeigte hinter sich, und Ania fand in der Ecke des Rücksitzes noch eine ungeöffnete Flasche. Doch bevor sie den Verschluss aufdrehen konnte, fiel ihr das vergilbte Foto auf, das an der Blumenhalterung am Armaturenbrett lehnte. Es zeigte Brit als Harlekin, tanzend, mit breit geschminktem Mund und weißen Pumphosen.
»Wo hast du das denn her?«, Ania lächelte, strich mit dem Daumen über Brits lachendes Gesicht unter der Spitzenhaube.
»Gestern aus der Kiste gekramt.«
»Dann hast duʼs damals geklaut?« Ania stieß Brit mit dem Ellenbogen an.
»Was denkst du denn? Musste doch meinen Ruf verteidigen.«
Sie lachten beide auf, und Ania spürte, wie sich die Spannung in ihr etwas löste. Sollte sie Brit von der Ausstellung vor sieben Jahren in Leipzig erzählen? Von ihrem Wiedersehen mit Bernd? Wollte sie das? Oder sollten manche Geheimnisse einfach Geheimnisse bleiben?
Ania drehte die Wasserflasche vorsichtig auf, trotzdem zischte es laut. »Das war so eine verrückte Aktion damals. Hab eben dran gedacht, als ich Louise gesehen hab.«
»Warum?« Brit startete den Wagen.
»Sie sieht aus wie Schneewittchen.«
»Findest du?«
»Du nicht?«
»Nochmal Rosenrot wäre auch nicht gegangen.«
Sie lachten wieder, und Ania lehnte sich entspannt im Sitz zurück. Sie hatte so lange nach Bernd gesucht, hatte es sich eingestanden und auch wieder nicht, hatte eigentlich nicht aufgeben wollen, hatte sich selbst gehasst dafür, bis sie ihn dann doch aus ihrem Leben geschoben und die Zeit mit ihm verdrängt hatte. Nun saß ihre Schwester neben ihr, auch sie hatte Bernd verloren, ein Stück ihrer Vergangenheit, ihrer Geschichte, ihres Lebens. Sie steckten alle mitten in ihren Leben, und er war schon gegangen, er hatte sich, warum auch immer, so früh entschlossen, zu sterben. Aber sie, Ania und Brit, waren noch da, sie kicherten miteinander, so wie früher, es gab so vieles, was sie verband, und sie hatten sich.
Ania trank noch einen großen Schluck Wasser, schloss die Flasche wieder, legte sie zurück auf den Rücksitz. Sie fuhren langsam zur Hauptstraße herunter, die Klimaanlage blies.
Ein Fahrradfahrer kam ihnen entgegen, quälte sich den Berg hinauf, in weißem Unterhemd und kurzen Jeanshosen, mit hochrotem Kopf. Er hob die Hand. Brit grüßte zurück. Ania drehte sich um.
»War das Max?«
Brit nickte.
»Und, wie geht’s ihm?«
»Er wohnt jetzt in der Scheune und macht immer noch jeden Abend sein Feuerchen. Selbst bei der Wärme. Wir riechen das manchmal bis zu uns.«
»Und sonst so?«
Brit zuckte mit den Schultern. »Eigentlich alles unverändert.« Ihre Stimme klang, als wäre ihr das Thema unangenehm. Auch das war wie immer. Niemand wollte über Max sprechen, er war eben einfach da, gehörte auf seine Weise dazu. Das war seit vielen Jahren so, und mehr gab es nicht zu sagen.
Brit lenkte das Auto auf den Parkplatz vor der Dorfgaststätte. Als sie einparkte, fiel das vergilbte Foto, das wieder an der Blumenvase lehnte, nach unten. Ania hob es auf.
»Vielleicht hängen die ersten Abzüge der Bilder immer noch in der Grauen Lady.«
»Wenn Rosi sie nicht inzwischen entsorgt hat.« Brit stellte den Motor ab. »Hast du eigentlich noch Kontakt zu ihr?«
»Immer mal in der Frauenkultur. Oder bei Veranstaltungen in der Volkshochschule. Sie arbeitet als Yoga-Trainerin, hat inzwischen ein eigenes kleines Studio. Im Sommer hat sie abends Yoga im Park angeboten, da war ich ab und zu.«
»Weiß sie das mit Bernd?«
»Ich habe sie angerufen, dachte, es wäre wichtig, es ihr zu sagen, sie haben schließlich einige Jahre zusammen in der Grauen Lady gewohnt. Sie hat an diesem Wochenende ein Seminar in Berlin, sonst wäre sie mit hierhergekommen. Sie wollte auch Maik Bescheid geben. Entschuldige, aber ich muss noch einen Schluck trinken, bevor wir da rein gehen.« Ania nahm die Wasserflasche vom Rücksitz, drehte sie auf. Es zischte laut, Wasser spritzte heraus, lief über Anias nacktes Knie.
»Dann war er es vielleicht doch?« Brit nahm Ania die Flasche ab, trank.
Ania stutzte.
»Ich war mir nicht sicher. Aber wenn es Maik war, hat er sich kaum verändert.«
»Das wäre ja … », Ania schüttelte langsam den Kopf, »unglaublich.«
»Da war noch ein Kleinerer mit Halbglatze dabei. Den kannte ich nicht.«
»Vielleicht Uwe. Der wohnt auch noch in Leipzig, soweit ich weiß.«
»Sie standen ganz hinten am Friedhofstor. Ich habe sie nur bemerkt, weil Maik so groß ist. Und dann habe ich sie nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich sind sie direkt nach der Trauerfeier wieder gefahren.«
Ania schluckte schwer. »Das glaub ich ja nicht.«
Brit drehte die Flasche wieder zu, legte sie auf die Rückbank. »Warum? Bernd und Maik waren doch so dicke Freunde damals.«
»Und dann plötzlich Feinde.« Ania strich immer wieder über ihr nacktes Knie, obwohl die Wasserspritzer längst getrocknet waren. »Warum ist Maik nicht zu mir gekommen? Einfach so, um Hallo sagen? Wir haben fast ein halbes Jahr in der WG zusammengewohnt.« Sie schluckte wieder, all das Wasser, das sie getrunken hatte, half nicht. Sie fühlte sich von Erinnerungen und Bildern eingesponnen, so fest, dass sie kaum noch Luft bekam.
»He, alles wird gut. Wir gehen jetzt da rein und bringen das hinter uns. Und dann machen wir es uns mit einem Wein gemütlich«, flüsterte Brit Ania ins Ohr und drückte sie noch einmal fest. »Komm!«





























