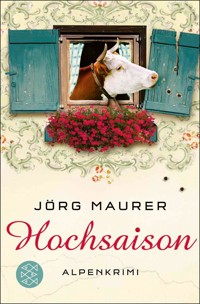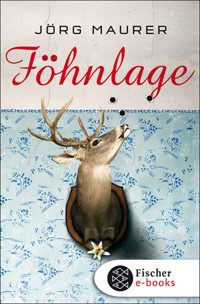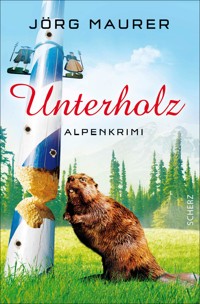
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Jennerwein ermittelt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Auf der Alm, da mäht der Tod noch selbst: Kult-Ermittler Hubertus Jennerwein vor seinem abgründigsten Fall. Der fünfte Alpenkrimi von Spiegel-Bestseller-Autor Jörg Maurer. Auf der Wolzmüller-Alm oberhalb des idyllischen alpenländischen Kurorts wird eine Frauenleiche gefunden. Jennerweins Bemühungen, etwas über die "Tote ohne Gesicht" zu erfahren, laufen ins Leere. Niemand im Ort will etwas über geheime Treffen auf der Alm gewusst haben, und der Bürgermeister bangt nur um seine Bollywood-Kontakte. Endlich verrät das Bestatterehepaar a.D. Grasegger dem Kommissar, dass es sich bei der Toten um die "Äbtissin" handeln soll, eine branchenberühmte Auftragskillerin. Wer hat es geschafft, sie umzubringen? Da geschieht ein weiterer Almenmord, ein mysteriöser Maler gerät ins Fadenkreuz, und Jennerwein pirscht mit seiner Truppe durchs Unterholz…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 479
Ähnliche
Jörg Maurer
Unterholz
Alpenkrimi
FISCHER E-Books
Inhalt
1
Als Unterholz bezeichnet man in der Forstwirtschaft den Bewuchs unterhalb der Baumkronen, der aus Sträuchern oder kleinen Bäumen besteht.
Der dünne Stahldraht um seinen Hals zog sich ruckartig zusammen. Jennerwein schrie auf vor Schmerzen. Er hatte versucht, den Kopf zu heben, dabei war der empfindliche Ruhezustand der straff gespannten Drähte, mit denen er fixiert war, aus dem Gleichgewicht geraten. Der Druck auf seine Kehle nahm zu. Jennerwein würgte und hustete. Nur mit großer Mühe konnte er Luft holen, denn jede noch so kleine Bewegung steigerte seine Schmerzen ins Unerträgliche. Er lag auf dem Bauch. Direkt vor seinen Augen konnte er moosigen Waldboden erkennen, der mit Wurzelwerk durchsetzt war. Der Boden war leicht abschüssig. Die Erde roch scharf und unverschämt wohltuend nach Bergwald und Pilzen. Die Erinnerung kam langsam zurück. Er war angegriffen worden. Für einen Sekundenbruchteil war er nicht bei der Sache gewesen. Und alles um ihn herum war schwarz geworden.
Kommissar Jennerwein konzentrierte sich. Er versuchte sich ein Bild von seiner momentanen Lage zu machen. Eine Drahtschlinge riss an seinem Hals, eine weitere Schlinge schnitt in seine Handgelenke, die hinter dem Rücken gefesselt waren. Zwei weitere solche Befestigungen spürte er an den Fußgelenken. Seine Beine und sein Kopf wurden nach oben gezogen, vermutlich lag er unter einem Baum, und alle vier Drähte waren hoch über seinem Rücken an einem Ast zusammengebunden. Wenn er ein Körperteil bewegte, um sich etwas Linderung zu verschaffen, spürte er die Einschnitte an den anderen Stellen umso schmerzhafter. Vermutlich liefen die Drähte dort oben durch eine Rolle, die leise knarzend im Wind schaukelte. Es klang so, und es fühlte sich so an. Wie war er bloß in diese Situation geraten? Schon wieder hatte er eine unbedachte Bewegung gemacht. Die Schmerzen fraßen sich fest wie wütende Hunde. Er begriff langsam, dass ein Entkommen unmöglich war. Diese Konstruktion war unter dem Namen Die Schweinefessel bekannt. Mitglieder der Fremdenlegion verwendeten sie, um Gefangene ruhigzustellen oder zu foltern.
Jennerwein versuchte, wenigstens den Kopf etwas zur Seite zu drehen, um sich zu orientieren, doch auch bei dieser winzigen Drehung fuhr ihm ein solch scharfer Schmerz durch den Körper, dass er es aufgab. Regungslos hing er im Netz. Auf die berüchtigte Schweinefessel deutete auch der Klavierdraht hin, der ihn gefangen hielt. Ein Stückchen davon hing in sein Gesichtsfeld, vielleicht war das Absicht, wie um ihm zu zeigen, dass er es nicht mit Dilettanten zu tun hatte. Kupferumwickelte Klaviersaiten waren rutsch- und reißfest. Sie hatten an beiden Enden vorgefertigte kleine Schlaufen, mit denen man die Drähte gut und schnell verbinden konnte, ohne komplizierte Knoten knüpfen zu müssen. Eine solche Klaviersaite war zudem leicht zu beschaffen, auf jedem Schrottplatz stand ein alter Klimperkasten, den man ausweiden konnte. Am geeignetsten waren die mittleren Klaviersaiten aus Gussstahldraht, sie waren hauchdünn, trotzdem stabil. Wo oben auf den Elfenbeintasten die Läufe und Arpeggios von Mozart und Beethoven endeten, begannen unter dem Holz die besten Saitenstärken für eine Fesselung. Der Hustenreiz wurde langsam unerträglich. Jennerwein versuchte zu husten, ohne sich zu bewegen. Es war nicht möglich. Wer hatte ihn in diese Lage gebracht? Und wo waren die anderen Mitglieder seines Polizeiteams?
Seine Gedanken gingen ein paar Tage zurück. Wie hatte er sich gefreut, seine Kollegen nach einem halben Jahr Pause wiederzusehen! Er hatte in dieser Zeit nur unspektakuläre Schreibtischfälle zu bearbeiten gehabt. Dann aber hatte er einen überraschenden Anruf aus dem idyllisch gelegenen alpenländischen Kurort erhalten. Polizeiobermeister Ostler war dran.
»Entschuldigen Sie die frühe Störung, Chef.«
»Guten Morgen. Was gibts?«
»Eine weibliche Leiche. Todesursache ungeklärt. Nicht natürlich. Ich hole Sie mit dem Jeep ab.«
»Kann ich nicht selbst –«
»Der Tatort ist unzugänglich gelegen, auf sechzehnhundert Meter Höhe.«
Jennerwein hatte gewusst, dass er sie alle bald wieder um sich haben würde, die beiden ortskundigen Polizeiobermeister Johann Ostler und Franz Hölleisen, den knorzigen Allgäuer Ludwig Stengele, die kriminalistisch hochbegabte Nicole Schwattke und vor allem – die Psychologin Maria Schmalfuß. Was für ein angenehm warmes Gefühl war in ihm aufgestiegen, als er gehört hatte, dass sie auch mit dabei war!
Jetzt lag er bewegungsunfähig auf dem Bauch. Sechzehnhundert Meter Höhe? Er überlegte. Natürlich! Er befand sich irgendwo in der Nähe dieser verdammten Wolzmüller-Alm, hoch am Berg, über dem Talkessel. Er drehte die Augen nach rechts, ohne den Kopf zu bewegen. Er blinzelte ungläubig. Einen halben Meter vor ihm bewegte sich etwas. Ein dunkler Schatten, der sich auf der Erde vorwärtsschob. Was war das? Eine Maus? Ein Ast im Wind? Ein Schuh? Schließlich sah er die klumpige Masse aus den Augenwinkeln. Es war eine Ansammlung von zwei, drei Dutzend Käfern. Sie bildeten eine breite Front, und von hinten drängten weitere heran. Beim näheren Hinsehen konnte Jennerwein die schwarze Panzerung und das dunkelrote Halsschild erkennen. Ein paar Zentimeter vor seinem Gesicht hielt die seltsame Prozession an. Die Insekten bewegten sich nicht weiter. Ihre kolbenartigen Fühler drehten sich ruckartig in alle Richtungen, ihre sechs plumpen Beinchen zitterten, und die schwarzen klebrigen Deckflügel wölbten sich über der starren Brustpanzerung. Jennerwein konnte sogar die feinen goldenen Haare erkennen, die den roten Halsschild der Käfer bedeckten. Entsetzen packte ihn. Es waren Aaskäfer. Und sie schienen auf etwas zu warten.
2
Als Unterholz wird beim Klavierbau der Teil des hölzernen Stimmstocks bezeichnet, in den die Wirbel eingeschlagen werden, die die Klaviersaiten halten. Jazzpianisten bevorzugen weiches Unterholz aus Pappel und Linde, klassische Pianisten hartes aus Buche und Eiche. Elton John verwendet Kirsch- oder Walnussholz.
Um die Wolzmüller-Alm rankten sich viele Spekulationen und Gerüchte. Sie war nicht leicht zugänglich, lag vom Kurort drei bis vier Fußstunden entfernt, und besonders das letzte Stück des Weges war ein mühevoller Schlauch, der sich den Berg hinaufwand. Das alles verstärkte das Geheimnis um die Alm nur. Zum Mythos wird immer nur das nicht ganz Zugängliche. Nur das Verschattete und Halbseidene, das Verfluchte und Abschüssige ist auf Dauer von Interesse. Und gerade diese Wolzmüller-Alm hatte in der Tat eine wechselvolle Geschichte. In den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts lief sie noch einigermaßen gut. Regelmäßig rückten Tiroler Landarbeiter an, die das Gras in mühevoller Handarbeit mit der Sense mähten, die Butter stampften, die Bäume für die Holzwirtschaft fällten und die gereiften Käselaibe mit Kraxen ins Tal hinuntertrugen. Auch eine Leitung hatten sie gebaut, mit der die frisch gemolkene Ziegenmilch sprudelnd in den Kurort rauschte. Damals, vor dreißig Jahren, gab es noch einen leibhaftigen Almbauern, den Wolzmüller Andreas. Natürlich kamen auch Kurgäste. Die schwer zugängliche Alm war ein Geheimtipp.
»Ja, was treibst denn dann du den ganzen Tag?«, fragte der Wolzmüller Andreas einen dieser Kurgäste, nachdem der sich in seinem kleinen Gästezimmer häuslich eingerichtet hatte.
»Das siehst du doch. Ich bin Maler.«
»Gibts das heute auch noch? Es kommt doch alles im Fernsehen.«
»Es werden schon noch richtige Bilder gemalt.«
»Richtige Bilder? Das habe ich nicht gewusst.«
Der Wolzmüller-Bauer war ein grobschlächtiges Mannsbild, ein herumfliegender Dreschflegel hatte ihm ein Auge herausgehauen, fast zwei Meter groß war er, und einen Sohn hatte er, der nichts taugte. So viel wusste der Maler, der sich mit Frank Möbius vorgestellt hatte.
»Wie viel Bilder malt man dann so?«, fasste der alte Wolzmüller nach.
»Eines in der Woche schon.«
»Und da verdienst du so viel, dass du dir bei mir heroben auf der Alm eine Stube leisten kannst?«
Vorsicht!, dachte Möbius, nicht sagen, dass es sehr billig ist hier auf der Alm. Und dass er sein Zimmer in der Stadt gut vermietet hatte. An einen Malerkollegen, der ebenfalls eine Schulbibel illustrierte, eine evangelische allerdings. Er erhöht womöglich den Preis. Laut sagte Möbius:
»Ja, mal sehen, wie lange ich mir das leisten kann.«
»Weißt du was, Maler: Du kriegst das Zimmer umsonst, wenn du meinem Buben das Handwerk lernst.«
»Welches Handwerk?«
»Deines. Er will nix arbeiten. In der Landwirtschaft ist er unbrauchbar. Zwei linke Hände hat er. Mit lauter Daumen dran. Ich habe ihn hinunter ins Dorf geschickt, aber dort will er auch nichts lernen. Da ist doch die Malerei grade recht.«
Wie erklärt man das jetzt einem hinterwäldlerischen Almbauern, dachte Möbius, ohne ihn zu beleidigen?
»Das geht nicht so leicht«, begann er vorsichtig.
»Aha, so ist das! Fürchtest du die Konkurrenz?«
»Ist er überhaupt interessiert, dein Michl?«
»Interessiert? Am Nichtstun ist der schon interessiert. Der Handel ist der: Du lernst ihm jeden Tag was, dann hast du freie Kost und Logis.«
Der Wolzmüller hielt seine Riesenpratzen hin. Frank Möbius war eigentlich Buchillustrator. Er hatte einen Auftrag an Land gezogen, der war in drei Wochen abzuliefern. Er sollte eine katholische Schulbibel bebildern, möglichst plastisch, möglichst eingängig, mit einem kleinen Schuss Humor, wie der Verleger gesagt hatte. Bisher hatte er erst eine einzige Illustration fertiggestellt: Adam wartete draußen vor dem Garten Eden, Eva packte drinnen noch ihre Sachen zusammen. Der Abgabetermin drohte. In drei Wochen musste er die dreißig Zeichnungen fertig haben, das ganze Alte Testament rauf und runter.
Der Sohn des Almbauern, der Wolzmüller Michl, war ein maulfauler Geselle, der mit seinen zwanzig Jahren keinen Bock zu gar nichts hatte. Seine Augen glotzten blöde und trübe, als er Möbius vorgestellt wurde. Widerwillig gab er ihm die Hand.
»Wann hast du denn Zeit?«, fragte Möbius.
Keine Antwort. Schulterzucken.
»Hast du schon einmal etwas gemalt?«
Wieder keine Antwort. Ein schwieriges Stück Fleisch, dieser Wolzmüller Michl, dachte Möbius.
»Schaust du gern Bilder an?«
Dann, nach furchtbar langer Zeit:
»Wenn es gute sind, schon.«
»Willst du einmal ein Bild von mir sehen?«
Schulterzucken. Möbius zeigte ihm seinen Entwurf zum Buch Jona eins bis vier.
»Was soll das sein?«, murmelte der Michl.
»Jonas und der Wal.«
»Ich sehe nichts.«
Möbius deutete mit dem Bleistift auf die Figuren.
»Das ist Jonas, und das ist der Wal.«
Michl Wolzmüller schüttelte den Kopf.
»So schaut keiner aus, der gerade ins Meer geworfen worden ist und der Angst hat. So schaut auch kein Wal aus.«
»Ich habe es natürlich etwas überspitzt –«
Und dann nahm der Michl ein Stück Papier und einen stumpfen dicken Zimmermannsbleistift und malte auf dem unebenen Holztisch, der in der Almhüttenstube stand, seine Interpretation des Buches Jona eins bis vier. Er kritzelte ein paar Striche und Kurven. Und es war Jonas. Und es war der Wal. Und es waren auf einem fernen Schiff im Hintergrund die Männer, die Jonas ins Meer geworfen hatten. Und es war die Angst von Jonas vor dem Wal, und der skeptische Blick des Wals angesichts dieses unverdaulichen Brockens.
»Ninive könnte man auch noch hinzeichnen«, nuschelte der Wolzmüller Michl. »Im Hintergrund.«
Möbius wusste, dass er diesem Schüler nichts beibringen konnte. Der beherrschte es bereits. Ganz intuitiv. Der war nicht dumm, der war bloß faul. Und in Möbius’ Kopf reifte ein Plan.
Schon nach zwei Wochen schickte er dreißig Zeichnungen in die Stadt. Eine besser als die andere: Erschaffung der Tiere, Sintflut, Heuschreckenplage, das übliche fundamentalistische AT-Programm. Der Bibelverlag war begeistert.
»Und, wie läuft es mit dem Michl?«, fragte der alte Wolzmüller.
»Das ist ein harter Brocken«, sagte Frank Möbius. »Er hat ein kleines bisschen Talent, einen Hauch davon, aber man müsste viel arbeiten mit ihm. Es fehlt an der Technik und überhaupt an allen Ecken und Enden. Er müsste schon noch sehr viel lernen.«
Wenn er es geschickt anstellte, hatte er in nächster Zeit eine todsichere Einkunftsquelle.
Und mit diesem ungleichen Trio begann damals, vor dreißig Jahren, der Aufstieg, aber auch der Niedergang der Wolzmüller-Alm.
3
Die alten Griechen bezeichneten die Gedärme als pankreas (wörtlich: »alles Untere«), also das Unterholz des Leibes. Der heilige Pankratius ist folgerichtig Schutzheiliger der Bauchspeicheldrüse. Man ruft ihn bei allen pankreatischen Beschwerden an, bei Bauchgrimmen, Seitenstechen, Gallenkoliken, Nierenentzündungen, Leibdrücken und ähnlichen unbehaglichen Zuständen.
Jetzt aber schmorte das Loisachtal unter der stechenden Sommersonne. In den Vorgärten stiegen Hunderte von kleinen Grillfeuerrauchwölkchen auf. Die beiden Wanderer waren nach viereinhalb Stunden auf dem Gipfel der Kramerspitze angekommen, und von Ferne sah der Kurort aus wie ein rauchender Trümmerhaufen. Sie stießen kleine Schreie des Entzückens aus und warfen ihre Rucksäcke auf den Boden. Der Kramer, ein knapper Zweitausender, ein freistehender Klotz von einem Berg, war technisch nicht allzu schwer zu erklimmen, aber durchaus schweißtreibend. Sie ließen sich, etwas abseits vom Gipfelkreuz, an einer windgeschützten Stelle nieder, die durch einige Moose und farnige Bodendecker ein gewisses Mehr an Bequemlichkeit bot.
»Acrodermatitis, sagst du?«
»Ja, sogar chronica.«
»Atrophicans?«
»Herxheimer. Ohne jede Therapiemöglichkeit.«
»Das hast du ihm so ins Gesicht gesagt?«
»Schwere Lyme-Arthritis mit Neuroborreliose, das war meine Diagnose.«
»Und das alles durch einen Zeckenbiss! Zieh deine Wadlstrümpfe hoch. Hier am Kramergebirge soll es wimmeln von den Viechern. Und wie hat dein Patient darauf reagiert?«
»Ziemlich gefasst. Als ich ihm allerdings die durchschnittliche Lebenserwartung in solchen Fällen geschildert habe –«
Unten im Tal schwoll das Zwölfuhrläuten der St.-Martins-Kirche an, das war der perfekte Zeitpunkt zum Obenankommen und Herrjessas-wie-schön-Rufen. Die beiden Bergsteiger unterbrachen ihren medizinischen Diskurs. Obwohl sie schon ein paarmal auf der Ausblicksbank unter dem prächtigen Gipfelkreuz gesessen hatten, starrten sie abermals gebannt auf das pompöse Panorama. Gegenüber, auf der anderen Seite des Talkessels, lag das Karwendelgebirge, und aus der Wettersteinwand richteten sich die drei würdigen kulissenartigen Wahrzeichen auf: die Alpspitze, die Waxensteine, das Zugspitzmassiv. Unten im Kessel glitzerte und brodelte der Kurort, und ganz hinten, wie ein schräg in den Sand gesteckter Schuhlöffel, protzte die sündhaft teure Skischanze. Die beiden Mediziner legten sich auf den Rücken und blickten entspannt ins föhnige Azur, umschmeichelt von Gustl, Hias, Blasi und Naaz – so nannte der Volksmund die vier rastlosen Lokalwinde. Einer Sage nach waren dies einst Loisachtaler Holzknechte gewesen, die sich bei einem Maitanz zu gotteslästerlichen Flüchen verstiegen hatten. Es ging damals um die schöne, reiche, kluge und kugelrunde Theresia (de kuglerte Resl), die den hässlichen, armen, dummen und ausgemergelten Burschen einen Stampfwalzer verwehrt hatte. Die Burschen gaben nun so gotteslästerliche Verwünschungen von sich, dass sie diese bis in alle Ewigkeit zu büßen hatten. Man kann sich allerdings Schlimmeres vorstellen, als in einen Lokalwind mit überschaubarem Einsatzgebiet reinkarniert zu werden.
»Normalerweise führt eine Borreliose doch nicht zum Tod, oder?«
»In diesem Fall aber ist sie zu spät entdeckt worden. Die Borrelien haben sich in der äußeren Hirnrinde eingenistet.«
»Hast du ihm gesagt, was das bedeutet?«
»Natürlich. Die seltene Art der borrelia metschnikowi führt dazu, dass das Gehirn innerhalb weniger Monate nur noch ein nutzloser Zellhaufen ist. Und dass er damit noch Jahrzehnte leben kann. Das weiß er jetzt.«
Das Bergsteigerpärchen, ein stämmiger Mann und eine drahtige Frau, deren Wadeln die knallroten Bergsteigerstrümpfe fast sprengten, waren keine Einheimischen, sondern Zugereiste. Der Mann konnte auch nach zwanzig Jahren das Sächseln nicht ganz unterdrücken, die Frau hatte einen leicht küstennahen Akzent behalten, damit pries sie jetzt die klare Luft, die Ruhe, den sensationell weit reichenden Blick Richtung Norden.
»Wenn die Erdkrümmung nicht wäre, dann könnte man von hier aus sogar den Hamburger Fischmarkt erkennen.«
Er hingegen blickte in die entgegengesetzte Richtung. Er bewunderte die rostroten Wolken im Süden, die dicken marokkanischen Saharastaub-Ansammlungen, die sich schlierig und mit mediterraner Grandezza übereinanderschoben.
»Manche Frühlingsschwalben sollen diese Scirocco-Wolken als Gefährt benutzen, um sich so ein paar tausend Kilometer Flug zu ersparen.«
Die beiden öffneten die Rucksäcke, redeten noch eine Weile über frische Nordseekrabben, flügellahme Schwalben und die Spätfolgen von unbehandelter Borreliose.
»Was ist denn das?«
»Ein echtes Fernglas aus den Beständen der DDR.«
»Eigentum der Nationalen Volksarmee?«
»Ja, das berühmte Einheitsdoppelfernrohr EDF7 × 40 mit radioaktiver Strichplattenbeleuchtung, hergestellt von Carl Zeiss Jena.«
»Darf ich mal? – Toller Blick. Wo hast du das her?«
»Vom Flohmarkt.«
Von wegen Flohmarkt! Sammler zahlen ein paar Tausender für das historische Siebenmalvierziger. Leichte Gebrauchsspuren machen es noch wertvoller. Da muss man schon einen DDR-Grenzer in der Familie gehabt haben.
»Das musst du dir einmal anschauen«, sagte der, dessen Wurzeln an den Ufern der Saale lagen. »Da, nimm das Glas. Zwischen der Ziegspitz-Scharte und der oberen Stepberg-Wiese.«
»Ah, jetzt sehe ich sie auch: Eine Alm! Da arbeitet einer mit einer richtigen Sense. Aber so hoch droben?«
»Wenn ich mich nicht täusche, ist das die Wolzmüller-Alm. Liegt auf sechzehnhundert Meter Höhe.«
»Dass man auf solch einer steilen Wiese überhaupt noch mähen kann, unglaublich!«
Erneuter Wechsel des Einheitsdoppelfernrohrs, dazwischen Einheitsdoppelfernrohrlinsenputzen.
»Almwirtschaft, klingt romantisch.«
»Klingt so, ist es aber nicht. Ist eher anstrengend.«
»Das glaube ich auch. Aber: Wolzmüller-Alm? Den Namen habe ich schon öfter gehört.«
»Das wundert mich nicht, um die Alm gibt es jede Menge Gerüchte. Der alte Wolzmüller soll in den Achtzigern plötzlich stinkreich geworden sein, kein Mensch hat gewusst, wo er das viele Geld auf einmal herhatte. Später hat er die Alm allerdings verkommen lassen. Es sollen wilde Partys stattgefunden haben, bei einer davon soll er angeblich umgekommen sein.«
»Unsaubere Geschäfte?«
»Wahrscheinlich. Der neue Pächter, ein gewisser Ganshagel, bemüht sich sehr. Er bewirtschaftet sie aber nicht mehr klassisch. Da finden jetzt Manager-Seminare und so Schmarrn statt. Es liegt irgendwie ein Schatten auf der Alm.«
»Vielleicht ist der Sensenmann da drüben dieser Ganshagel.«
»Möglich. Der arme Mensch muss alles alleine machen.«
Alle Wolkentypen dieser Welt durchquerten gerade den Himmel, der dunstige Zirkus dort oben hätte mehr als einen Blick verdient. Ein Steinadlerpärchen kreiste, ein Murmeltier pfiff, die Berggeister schnatterten in den würzig duftenden Latschen. Nach einem Stündchen Geplauder trugen sich die beiden Mediziner mit knappen Worten ins Gipfelbuch ein: Schön hier oben! Sie blätterten die Seiten zurück. Andere hatten sich mehr Mühe gegeben. Feindselig, wildzerrissen steigt die Felswand. Das Auge schrickt zurück, bang sucht es, wo es hafte. Meyer. Dann packten die beiden Mediziner ihre Rucksäcke wieder zusammen und machten sich an den Abstieg.
»Was wurde eigentlich aus dieser Theresia? Wurde die auch in irgendetwas reinkarniert?«
»Natürlich, schau mal da rüber, zwischen dem Kreuzeck und dem Schwarzenkopf, der kleine, kompakte Berg, das ist die Kuglerte Resl.«
»Sie ist zu Stein geworden?«
»Ja, so sagt man. Auch Stolz wird bestraft.«
»Weißt du was: Da könnten wir doch nächste Woche raufgehen!«
»Gute Idee. Von der Kuglerten Resl müsste man eine bessere Sicht auf die Wolzmüller-Alm haben als hier von der Kramerspitze.«
»Vielleicht sehen wir mal richtige Almarbeit. Mit Buttern, Käsen und Kühe melken.«
»Ja, klar, mit Heidi, dem Geißenpeter und dem Alpöhi, oder?«
Lachend machten sie sich an den Abstieg. Sie sollten auch in der kommenden Woche keine richtige Almarbeit sehen. Vom Geißenpeter ganz zu schweigen.
4
5
Manchmal stellt dich das Leben vor eine Kreuzung. Ein Wegweiser zeigt hinüber ins liebliche Tal, der andere ins Unterholz. Nimm nicht den erstbesten Weg.
Indisches Sprichwort
In ganz Westindien blühte der Senf, auch in Mumbai, das früher Bombay hieß. Auf der Straße schepperten Eselskarren, die mit Heu und Stoffballen vollgestopft waren. Fauchende Trockennasen-Affen verfolgten harmlose Bananenkäufer, während die Sonne hinter der Stadt unterging. Irgendwo meditierte ein weißbärtiger Yogi. Mächtige Elefanten liefen durchs Bild, sie waren die untrüglichen Vorboten einer indischen Hochzeit: Frauen in kostbar aussehenden Saris sangen Lieder von Glück und reiner Liebe, selig lächelnde Männer umtanzten einen Schimmel, auf dem der bärtige Bräutigam saß. Aus einem der bunten Häuser schlingerten Laute, als ob jemand Sitar übte: Tschoingtaschatschoinasiriiischauauau! Wie gesagt: In ganz Westindien blühte der Senf. Trotzdem gab es etwas durch und durch Werdenfelserisches dort in Mumbai, denn in einem der bunten Häuschen lag eine Karte des Loisachtals im Maßstab 1 : 10000 ausgebreitet auf dem billigen Plastiktisch. Sie war über und über mit Notizen und Zeichen vollgeschmiert. Viele kleine Nebenwege waren markiert – und der Wolzmüller-Hof war sogar mehrmals eingekringelt. Drei Männer beugten sich darüber, sie fuhren Seitenstraßen und Trampelpfade mit den Fingern ab: den Stangensteig, den Schrottelkopfweg und die Bölserhöhe. Milchkaffeehäutig waren die Männer, sie hießen Pratap Prakash, Dilip Advani und Raj Narajan, und alle drei waren hochgradig reisefiebrig. Die Koffer waren gepackt, morgen früh ging der Flieger, ihr erstes Ziel war die bayrische Landeshauptstadt, dann sollte es weitergehen nach Süden, ins Werdenfelser Land. Noch aber saßen sie in dem kleinen Häuschen in einem der vielen Vororte von Mumbai, bissen in ihre dreieckigen Samosas und tranken Mango-Lassi dazu. Andere hätten vor solch einem Trip Champagner getrunken, aber man weiß vielleicht, dass indischer Champagner im Ländervergleich nicht ganz oben steht.
»Weiterbildung!«, hatte ihr Chef gesagt. »Weiterbildung ist heutzutage wichtiger als alles andere.«
Der Chef war ein mächtiger Mann. Wenn der Chef eine solche Einladung aussprach, dann befolgte man sie. Sofort. Seine Wahl war auf Europa gefallen. Ziemlich in der geographischen Mitte von Europa gab es einen Alpen-Kurort mit unaussprechbarem Namen, dort fand ein Seminar mit international bedeutenden Referenten statt. Und da sie dann schon mal in Europa und in Deutschland wären, sollten sie auch gleich einen bestimmten Auftrag dort erledigen.
»Da seht her, Kat – zen – kopf – höl – zl«, buchstabierte Pratap Prakash, und Dilip Advani versuchte ebenfalls, einige fremde Namen zu entziffern.
»Freunde«, sagte Pratap Prakash feierlich, »der Flug morgen führt uns in ein unbekanntes Land. Ich freue mich auf die vielen neuen Eindrücke, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch ein Projekt durchzuführen haben. Ein ehrenvolles Projekt. Und ein wichtiges Projekt. Wir dürfen nicht versagen. Wir dürfen unseren Chef nicht so enttäuschen wie Mohit Bannerjee, der leider nicht mehr unter uns weilt.«
»Da hast du etwas ganz und gar Richtiges in gute Worte gefasst«, sagte Dilip Advani. »Wir haben einen Auftrag. Aber die vielen fremden Gebräuche, die es dort gibt! Ich habe im Reiseführer etwas gelesen vom Jodeln, vom Schuhplatteln, von Weißwürsten, die über die geraniengeschmückten Balkone geworfen werden, um die bösen Geister zu vertreiben.«
Unglaublich, was in indischen Reiseführern über Europa im Allgemeinen und das Werdenfelser Land im Besonderen so alles steht. Raj Narajan, der bisher geschwiegen hatte, schwieg auch weiterhin. Er wurde Der Stumme genannt, kein Mensch wusste mehr, ob er aus religiöser Inbrunst schwieg, wegen eines geleisteten Schwures oder gar wegen eines körperlichen Mangels, zum Beispiel einer fehlenden Zunge. Raj Narajan, der Stumme, nahm einen Zettel und kritzelte etwas darauf.
»Madhva sagt«, so schrieb er, »dass man bei jeder guten Reise folgende neun Dinge erleben sollte: Liebe, Heldentum, Ekel, Komik, Schrecken, Wundersames, Wut, Pathos und Friedvolles.«
Raj Narajan zeigte seinen Freunden den Zettel.
»Er wieder mit seinem Madhva«, sagte Pratap Prakash augenrollend.
»Habt ihr die Pässe?«, fragte Dilip Advani.
Alle nickten und befingerten ihre nagelneuen Reisepapiere. Gute Arbeit. Mit einem tadellosen Pass und mit einem freundlichen Gesicht kam man überall auf der Welt durch.
»Hat sich jeder sämtliche Daten eingeprägt?«
Wieder nickten alle, warfen noch einen letzten Blick auf den Plan. Sie hatten alles besprochen. Sie hatten alles im Kopf.
»Dann auf eine gute Reise!«
Pratap Prakash nahm die Wanderkarte, hielt sie bedeutungsvoll hoch, zerriss sie und warf sie in das offene Feuer des rauchenden alten Ofens, der neben dem Tisch stand. Nachdenklich betrachteten die drei Männer aus Mumbai den Untergang des Werdenfelser Landes im Maßstab 1 : 10000.
6
In der n’koga-Sprache gibt es etwa sechzig verschiedene Bedeutungen für das Wort Unterholz. T’t’k’har kann Gehölz bedeuten, aber auch Erde, Zunge, Mann, Frau, Zweitgeborener, Hölle, Löffel, das Unbekannte, Vorfreude, Erschöpfung, Föhn, Beilage, Stipendium, Entfleischung, Kiste, Windröschen – um nur die wichtigsten zu nennen.
»Ich glaube, wir sollten jetzt langsam über das Finanzielle reden.«
»Ja, das denke ich auch.«
»Also, was stellen Sie sich vor?
»Ich habe mal was von zwanzigtausend gehört.«
»Zwanzigtausend, das klingt spannend.«
»Was ist denn Ihr Vorschlag?«
»Sag ich doch: Zwanzigtausend klingt spannend.«
»Eines muss aber klar sein: Mehr als zwanzigtausend kann ich nicht zahlen.«
Marlene Schultheiss war gestern weisungsgemäß Punkt elf Uhr nachts nochmals vor der Philomena-Bar in der Kaiserstraße erschienen, dort war ihr wieder ein Zettel in die Tasche gesteckt worden, ohne dass sie es bemerkt hatte. Es war ein Computerausdruck. Sie war für den nächsten Tag in die Massageabteilung eines Fitnesscenters bestellt worden, sie sollte eine Reisetasche mit dem Nötigsten mitbringen, denn vielleicht wäre es erforderlich, eine Nacht wegzubleiben. Kein Wort zu Dritten, sonst würde alles sehr ungünstig für sie ausgehen. Wenn sie sich alles eingeprägt hätte, sollte sie das Blatt zerknüllen und es in einen bestimmten Papierkorb in der Kaiserstraße werfen.
Jetzt, einen Tag später, lag Marlene Schultheiss bäuchlings auf der Massagebank, über ihren Kopf war ein großes weißes Handtuch ausgebreitet. Am Anfang hatten sie knochige, beherzt zupackende Hände massiert, dann auf einmal waren es andere Hände gewesen. Und es war eine andere Stimme gewesen. Eine geflüsterte Stimme. Marlene wusste nicht, ob sie zu einer Frau oder einem Mann gehörte, ob die Stimme alt oder jung war, nicht einmal die Nationalität konnte sie bei dem Flüstern ausmachen. Bei dem letzten Satz hatte sie unwillkürlich den Kopf gehoben.
»Scht!«, fauchte die Flüsterstimme, und sie spürte einen Zangengriff im Genick. »Bloß, dass wir uns richtig verstehen. Machen Sie keinen Unsinn. Bleiben Sie so liegen, wie Sie sind. Lassen Sie das Tuch, wo es ist, versuchen Sie keine Tricks. Wenn unser Gespräch – mit welchem Ergebnis auch immer – beendet ist, wird Xu-Zhimo wieder übernehmen. Sie werden liegen bleiben, solange Sie der Chinese massiert. Dann werden Sie noch weiter liegen bleiben, Sie werden bis tausend zählen, dann erst werden Sie aufstehen und den Raum verlassen. Wenn Sie irgendwelche Dummheiten machen, sind Sie tot.«
Die Hand, die zu der Stimme gehörte, umkreiste ihren Hals, sie griff ihr von vorne an die Kehle, nicht unsanft, nein, das nicht, aber jetzt kam die andere Hand und drückte an eine bestimmte Stelle am Hals.
»Das ist die berühmte Carotis«, wisperte die Stimme, jetzt ganz nahe an ihrem Ohr. »Und Ihre Carotis finde ich überall, ob Sie nun auf der Straße gehen oder ob Sie auf die S-Bahn warten. Ich bin immer hinter Ihnen, merken Sie sich das.«
»Ja, ist schon gut. Sie machen es also? Für zwanzigtausend?«
»Sie wollen es kurz und schmerzlos haben?«
In Marlenes Ekel vor ihrem Mann mischte sich plötzlich eine unangenehm warme Strömung Mitleid.
»Ja, kurz und schmerzlos. Peter soll nicht leiden. Ich will ihn nur nicht mehr sehen.«
Die Flüsterstimme lachte auf. Das lautlose Lachen war gruselig anzuhören. Es folgten einige Massagegriffe. Einige Klopfer auf die Schulterblätter. Einige Walker und Kneter den Rücken hinunter, alles durchaus professionell – der Chinese war allerdings besser gewesen.
»So lobe ich mir die brave Ehefrau. Denkt bis zum Schluss an ihren armen Peter. Peter heißt er also. Kurz und schmerzlos, das macht dreitausend, nebenbei gesagt.«
»Nur dreitausend?«
»So ist es.«
»Und er soll natürlich spurlos verschwinden. Man darf ihn nicht finden.«
»Das macht dann wieder zwanzigtausend. Töten ist einfach. Leichenverschwindenlassen, das ist immer das Problem.«
»Ist das ein Ja?«
»Noch ein paar Fragen. Ihr Name, Ihre Adresse. Wie Sie leben, was Sie so treiben. Da bräuchte ich ein paar Informationen.«
Marlene antwortete auf jede der Fragen so ausführlich wie möglich. Manchmal zögerte sie. Aber jetzt steckte sie schon so tief in der Sache drin, ein Rückzug war vermutlich gar nicht mehr möglich.
»Warum haben Sie sich dazu entschlossen?«, sagte die Stimme langsam und eindringlich.
Das war eine seltsame Frage. Eine Frage, die sie gar nicht so richtig beantworten konnte.
»Ich muss das wissen«, beharrte die eindringliche Stimme. »Ich muss wissen, ob es Ihnen ernst mit Ihrem Auftrag ist.«
»Manchmal schaut er mich so an. Da habe ich mir schon oft gedacht: Wenn er nicht zu feige dazu wäre, dann würde er mich jetzt umbringen.«
»Hm. Haben Sie die Kohle dabei?«
»Sehen Sie in meiner Tasche nach.«
Die Stimme kam wieder ganz nah an ihr Ohr.
»Noch was: In den Zwanzigtausend inbegriffen ist Ihr Alibi. Ich konstruiere Ihnen ein absolut wasserdichtes Alibi. Und eine falsche Spur, die von Ihnen wegführt. Das gehört sozusagen zum Service. Sie übernachten heute in einem Hotel, Sie bleiben in Ihrem Zimmer, gehen keinesfalls raus. Wenn Sie rausgehen, sind Sie tot. Wenn Sie versuchen, irgendwo anzurufen, sind Sie tot. Und zwar nicht kurz und schmerzlos. Sie werden morgen um Punkt halb sechs Uhr geweckt. Ich organisiere für Sie einen kleinen Ausflug, bei dem Sie von vielen Leuten gesehen werden.«
»Ein Ausflug? Warum kann ich mir das Alibi nicht selbst verschaffen?«
»Wie stellen Sie sich das vor? Bei einer Freundin? In der Stammkneipe? Viel zu riskant. Ich verschaffe Ihnen ein zweihundertprozentiges Alibi.«
»Ich werde meinen Mann nie wiedersehen?«
»So ist es. Nur zu Ihrer Information: Ich habe dieses Gespräch aufgezeichnet.«
»Was haben Sie gemacht?«, keuchte Marlene, und sie hätte sich fast wieder umgedreht.
»Regen Sie sich ab. Nur, damit Sie auf keine dummen Gedanken kommen.«
Marlene Schultheiss hörte ihre eigene Stimme:
»Sie machen es also? Für zwanzigtausend?«
»Sie wollen es kurz und schmerzlos haben?«
»Ja, kurz und schmerzlos. Peter soll nicht leiden. Ich will ihn nur nicht mehr sehen.«
Dann hatte Marlene Schultheiss wieder die anderen Hände gespürt, die Hände von diesem Chinesen, die Hände von Xu-Zhimo. Sie konnte sich aber nicht entspannen. Auch im Hotelzimmer lag sie die ganze Nacht wach. Mehrmals war sie kurz davor, die ganze Sache wieder abzublasen. Aber ging das überhaupt? Eine Welle von Angst und Scham durchflutete sie. Einmal hatte sie schon den Telefonhörer in der Hand, dann legte sie wieder auf. Das hatte wohl keinen Sinn. Sie schaltete den Fernsehapparat ein und starrte auf die bunten Bilder. Sie bekam nichts davon mit. Sie hatte einen Auftragskiller angeheuert. Und es war alles so furchtbar leicht gegangen.
7
Nist’ im Unterholz der Star
wer’n die Sommernächte klar.
Brüt’ im Unterholz die Eule,
frierst im Sommer du dir Beule.
Alte Bauernweisheit
»Ja, siehst du, ich hab dirs gesagt: Die Kuglerte Resl ist der einzige Berg, von dem aus man die Wolzmüller-Alm einigermaßen gut einsehen kann.«
»Zumindest mit einem Zeiss’schen Einheitsdoppelfernrohr.«
Wie vor einer Woche vereinbart, hatten die beiden Bergsteiger eine Tour auf die Kuglerte Resl unternommen. Sie blickten jetzt schon ein halbe Stunde lang aufmerksam hinüber zur Wolzmüller-Alm. Der größte Teil des Anwesens entzog sich neugierigen Blicken, denn die verstreute Ansammlung von Hütten, Schobern und Quellen lag in einer Talfalte – aber das war ja gerade das Besondere an dieser Lage. Der Neurologe mit den sächsischen Grenzschützerwurzeln stellte seinen Almgucker scharf.
»Ein paar Wiesenstücke kann ich erkennen. Und eine riesige Lärche. Und eine schöne Zirbelkiefer.«
»Siehst du jemanden?«, fragte die Internistin.
»Ja, aber ich glaube nicht, dass das richtige Bauern sind.«
»Was dann?«
»Ich weiß nicht so recht. Sie sind viel zu entspannt. Es scheinen Touristen zu sein. Aber jetzt geschieht was! Eben sind zwei aufgestanden und greifen sich die Sensen.«
Es hatte sie schon gegeben, die ländlichen Malocher. Vor einigen Jahren waren Tiroler Wanderarbeiter über die Grenze gekommen, die das bisschen Heu geerntet hatten, das zu ernten war. Sie hatten die Sensen hart, ruhig und besonnen geschwungen, sie waren wetterkundig, sie lasen aus den Bewegungen der Spinnen im Gras die Tiefdruckumschwünge der nächsten zwei Tage ab, und ihre Voraussagen trafen immer zuverlässig ein. Das jedoch war lange her. In dieser Woche hatte sich stattdessen ein gutes Dutzend Seminarteilnehmer aus allen möglichen Ländern auf dem abschüssigen Gelände breitgemacht. In welcher Branche die Freizeit-Alpler hauptberuflich arbeiteten, das konnte man auch mit dem superscharfen EDF7 × 40 nicht erkennen.
»Sie haben sich zerstreut«, sagte der Neurologe. »Jeder sitzt für sich allein im Gras.«
Der Neurologe schwenkte von Teilnehmer zu Teilnehmer. Ein dunkelhäutiger, schlanker Nordafrikaner knetete einen Tennisball, er tat das abwechselnd mit der linken und der rechten Hand, und er betrachtete das Muskel- und Sehnenspiel seiner kakaobraunen Unterarme aufmerksam. Fünfzig Meter weiter tippte ein Mann mit erkennbar fernöstlichen Wurzeln auf einem Notebook herum, ohne auch nur einmal aufzusehen. Noch weiter entfernt, an der Biegung eines kleinen Almbachs, lümmelte eine bullige Gestalt, ein Rockertyp mit Lederjacke und einem Sonnenbrand auf der Glatze, er hockte auf dem Boden und nuckelte an einer Flasche Limonade. Alle hatten sich ein einsames Plätzchen gesucht, lediglich zwei ausgesprochen südeuropäisch aussehende Männer (schwarzblauer Bartschatten, maßgeschneiderte Schuhe, Zahnstocher im Mundwinkel) saßen auf einer Bank nebeneinander. Sie starrten ins Gras. Ab und zu sagte einer etwas, es schien sich um etwas Bedeutungsvolles zu handeln.
»Schade, dass ich nicht Lippen lesen kann«, sagte der Neurologe.
Es war in der Tat eine sehr gemischte und internationale Truppe, die sich da versammelt hatte. Der Nordafrikaner, der den Tennisball knetete, kam aus Tunesien und nannte sich Chokri, den Namen des Asiaten mit dem Notebook wusste niemand. Der Altrocker mit Sonnenbrand auf der Glatze war Deutscher. Die beiden Italiener kamen aus Sizilien und Kalabrien, sie wollten mit Lucio und Fabio angeredet werden. Vielleicht hießen sie ja wirklich so.
»Starker Vortrag«, sagte Fabio und deutete mit dem Daumen nach hinten, in Richtung Almhütte.
»Ja, es ist immer sehr interessant, zu solchen Seminaren zu kommen«, erwiderte Lucio. »Man erfährt viel Nützliches. Wusstest du das mit dieser Optographie?«
»Nein, keine Ahnung. Habe noch nie davon gehört. Da denkt man, dass man sich auskennt in seinem Beruf. Und dann erfährt man so was. Optographie! Kann ja ziemlich unangenehm für uns werden.«
Lucio antwortete nicht und pfiff stattdessen ein sizilianisches Liedchen. So ein sizilianisches Liedchen kommt manchmal einer Antwort sehr nahe. Fabio pflückte ein Almblümchen und betrachtete es.
»Sieht giftig aus.«
»Man müsste sich viel mehr mit Kräutern und Pflanzen beschäftigen.«
Lucio wiederholte das sizilianische Liedchen. Fabio kaute vorsichtig auf dem Almblümchen herum.
»Was ist eigentlich mit diesen drei Indern, von denen alle geredet haben?«
»Ich habe sie noch nicht gesehen.«
»Wie hießen sie noch mal? Hast du dir ihre Namen gemerkt?«
»So ähnlich wie – warte, ich habe es mir aufgeschrieben.«
Lucio zückte einen altmodischen Notizblock, der über und über vollgekritzelt war.
»Hier habe ichs: Pratap Prakash, Dilip Advani und Raj Narajan. Die müssten eigentlich schon längst da sein.«
»Vielleicht kommen sie ja heute noch.«
Der Tunesier, der Asiate, der Deutsche, die beiden Italiener – das waren beileibe nicht alle Kursteilnehmer auf der Wolzmüller-Alm. Unter der angeblich sechshundert Jahre alten Lärche saß beispielsweise ein eleganter junger Mann, der wohl als Einziger vergessen hatte, Outdoor-Kleidung einzupacken. Der feine Zwirn war über und über verstaubt und beschmutzt, aber er trug ihn mit Würde. Er las in einem Buch. Es war ein Buch mit einem französischen Titel. Und es war Pierre, der Franzose. Kaum hatte er ein paar Seiten gelesen, bekam er Besuch. Ein igelköpfiger GI-Typ, auf tausend Meter Entfernung als US-Amerikaner erkennbar, näherte sich dem gallischen Bücherfreund.
»Hi, Pierre«, sagte der Amerikaner. »Lust auf ein bisschen Feldarbeit?«
Pierre schlug das Buch zu.
»Gerne. Aber sollen wir das ’eu mit der ’and ausrupfen?«
»Da drüben in dem Schuppen gibt es Sensen und Rechen.«
Und tatsächlich, der amerikanische GI und Pierre, der feine Pinkel aus Aix-en-Provence, waren kurz darauf auf einem Steilhang zu sehen, wie sie Sensen schärften und Gras mähten. Allzu geschickt stellten sie sich nicht an, kein Vergleich zu den erwähnten Tiroler Wanderarbeitern, aber es ging leidlich voran.
»Das sieht ja gefährlich aus«, sagte die Internistin und reichte das Einheitsdoppelrohr wieder zurück.
»Hast du schon mal Gras mit der Sense gemäht?«, fragte der GI.
»Ja, schon oft. Meine Familie ’atte ein Landgut in Aix-en-Provence.«
Ein dritter Erntearbeiter gesellte sich zu den beiden. Es war Wassili Wassiljewitsch, der Russe mit den Schweinsäugelchen und der piepsigen Stimme. Er zog sein T-Shirt aus, auf dem Rücken konnte man ein prächtig ausgestaltetes Tattoo in kyrillischen Schriftzeichen erkennen.
»Was steht denn da?«, fragte der Amerikaner.
Wassili Wassiljewitsch lachte.
»Übersetzt heißt das in etwa: Bei den Oblonskijs herrschte Riesenverwirrung …«
»Versteh ich nicht.«
»Das ist von Leo Tolstoi«, sagte Pierre. »Der Anfang seines Romans Anna Karenina.«
»Was du nicht alles weißt«, sagte der Amerikaner.
»Kulturnation«, sagte Pierre, der Franzose.
»Brotzeit!«, rief eine klare, durchdringende Männerstimme, und jetzt hatte er seinen Auftritt, vom Hauptgebäude der Alm her, der umtriebige und zuvorkommende Herbergsvater, Rainer Ganshagel, der für den gastronomischen Teil hier oben auf der Alm verantwortlich war. Er war gleichzeitig Hausmeister, Hotelier und technischer Direktor, er hielt den großen Multimediaraum in Schuss, überprüfte Wasser- und Stromversorgung und kümmerte sich schließlich um das leibliche Wohl der Teilnehmer. In dieser Eigenschaft zog er nun einen Leiterwagen mit klappernden Tiegeln und Töpfen hinter sich her. In einem hölzernen Bottich steckten Limonadeflaschen in Eiswürfeln. Die Kursteilnehmer diese Woche hatten darauf bestanden, dass es keinen Alkohol gab und keine Drogen. Ganshagel hatte sich daran gehalten.
»Eine typische almerische Brotzeit!«, sagte er diensteifrig und teilte die Teller nach allen Seiten aus. »Schweinebratensülze mit Sauren Knödeln –«
»English please«, unterbrach ihn eine sonnengebräunte asketische Frau mit Meckifrisur und Armreif. Kein Problem für Rainer Ganshagel. Internationale Gäste war er gewohnt. So schwenkte er auf ein bavarizistisches, schleppendes Amerikanisch um, das man wahrscheinlich auch in Colorado so sprach, Föhn ist Föhn.
»Für die Vegetarier unter Ihnen habe ich mehr Saure Knödel – sour dumplings – gemacht. Greifen Sie zu, Herrschaften.«
»Sind Sie von hier aus der Gegend?«, fragte der kleine Mann mit den fernöstlichen Wurzeln, der sein Notebook zugeklappt hatte und es nun als Brotzeitbrettl verwendete – das Vertrauen der Asiaten in ihre eigene Technik ist groß.
»Schauen Sie da hinunter ins Tal!«, sagte Ganshagel mit einer weit ausholenden Armbewegung. Lokalpatriotischer Stolz schwang in seiner Stimme. »Da bin ich geboren. Im Loisachtal.« Fast hätte er die Worte gejodelt.
»Und diese sour dumplings, die haben Sie selbst fabriziert? Hier oben auf der Alm?«
»Natürlich, aber Sie werden jetzt nicht erwarten, dass ich Ihnen das Rezept verrate!«
Internationales Gelächter. Nur Chokri, der Tennisballkneter, lachte nicht mit. Er knetete weiter.
»Sie verraten mir die Geheimnisse Ihres Berufes ja auch nicht«, sagte Ganshagel verschmitzt.
Nun kam auch dem Tunesier ein kleines Lächeln aus.
»Was wird das Ge’eimnis dieser boulettes sein, Monsieur Gans’agel?«, fragte Pierre.
»Gewürze und Kräuter, von denen Sie noch nichts gehört haben«, raunte der Hüttenwirt verschwörerisch.
Man aß. Man trank. Man schwieg. Was mag das für eine Branche sein, dachte Ganshagel. Normalerweise gab es bei Businessveranstaltungen ein munteres Geschnatter, das hier war eher ein Treffen der einsamen Cowboys. Ein einziges medizinisches Referat hatte er am Rande mitverfolgt – vielleicht arbeiteten diese Leute in einer Firma, die kompliziertes Gerät herstellte, wie es ein Augenarzt braucht.
»In meiner Familie –«, platzte er in das Schweigen hinein, weil er meinte, die Gäste unterhalten zu müssen. »In meiner Familie, da hat jeder gute Dumplings machen können. Aber unübertroffen war der Großonkel Benedikt. Einen Mord hätte ich dafür begangen, wenn ich das Knödelrezept vom Onkel Benedikt bekommen hätte!«
Gelächter.
»Einen Mord, oh là là!«, rief Pierre. Sein Jackett aus feinem hellen Stoff hatte er nun wenigstens ausgezogen und über einen tiefen Ast der angeblich sechshundertjährigen Lärche gehängt.
»Es war irgendwas drin in den Knödeln, was bei den anderen nicht drin war. Wir haben versucht, es aus dem Onkel Benedikt herauszukitzeln, aber er hat das Geheimnis mit ins Grab genommen. Erst ein Jahr nach seinem Tod habe ich bemerkt, dass ich noch ein paar Knödel von Onkel Benedikt in der Tiefkühltruhe eingefroren hatte. Einen habe ich aufgetaut und an ein Labor für Lebensmittelanalyse geschickt. Und dann hatte ich es schwarz auf weiß.«
Ganshagel erwartete, dass jemand fragte, was denn schwarz auf weiß. Niemand fragte. Man prostete sich mehrsprachig-babylonisch zu. Die Frau mit der Meckifrisur, von der weder Name noch Nationalität bekannt war, öffnete ein kleines Säckchen und reichte es Ganshagel.
»Ich habe hier ein paar Kräuter gesammelt. Können Sie mir sagen, ob Giftpflanzen dabei sind?«
Ganshagel nahm eine Pflanze nach der anderen heraus und betrachtete sie eingehend.
»Oh, Himmelsherold – das ist eine echte Rarität! Was haben wir noch: Weiße Silberwurz, Klebkraut, Kriechender Günsel – soviel ich sehe, ist nichts davon toxisch.«
»In dieser Höhe wachsen aber doch auch Giftpflanzen!«
»Ja, ich kann Ihnen morgen gerne ein paar zeigen.«
Wassili Wassiljewitsch deutete auf einen schmalen Graben, der sich ein Stück weit über die Almwiese zog.
»Was ist das? Ein Bachbett?«
»Nein«, sagte Ganshagel. »Das sind die Reste einer Holzriese. Das sind Rutschen, mit denen früher die Baumstämme zu Tal befördert wurden. Andere Bezeichnungen sind auch Rusche, Husche, Laaße, Ploße, Swende –«
»Interessant«, sagten der GI und die Frau mit der Meckifrisur gleichzeitig.
Die Sonne senkte sich und verlor an Kraft. Manche, wie die beiden Italiener, legten sich auf den Rücken und schlossen die Augen. Der Asiate verschickte Mails. Wassili Wassiljewitsch steckte einen Grashalm in den Mund und stocherte mit seiner russischen Seele im bayrisch-blauen Himmel herum. Das Tagwerk war getan, jeder wollte seine Ruhe.
»Wann geht es morgen los?«, fragte Lucio.
»Um sechs Uhr weckt man uns vermutlich wieder mit dieser verdammt nervigen Ziehharmonika-Musik«, antwortete Fabio. »Halb sieben Waldlauf, gut, das finde ich o.k. Um acht ist das erste Referat.«
»Thema?«
»Interkulturelle Kommunikation.«
»Wird immer wichtiger in unserem Geschäft.«
Ganshagel räumte ab und stellte das Geschirr auf den Leiterwagen. Vereinzelt gab es Gelächter. Schweres russisches Gelächter, wie es in den weiten Ebenen der Taiga erklingt. Elegantes französisches Gelächter, dem frisch perlenden Klang eines Akkordeons ähnlich. Man entspannte sich.
Hundert Meter entfernt lugte ein trübes Augenpaar durch die Büsche. Bei näherem Hinsehen hätte man glauben können, dass der Mann blind war. Glasig schimmerten seine Augen, und sie schienen ins Leere zu blicken. Aber das konnte nicht sein. Der Mann war Maler. Er hielt einen schmutzigen Block in der Hand und zeichnete die Szene mit hastigen Strichen. Und es gab viel zu zeichnen hier auf der Wolzmüller-Alm. Die Sonne ging jetzt langsam drüben in Österreich unter. Von der Käserei wehte eine leichte, aber scharfe Brise von Süßlich-Gegorenem.
»Riecht wie unser Casu Marzu«, sagte Lucio zu Fabio.
Der Tunesier knetete wieder, Pierre las in seinem französischen Buch. Ganshagel wunderte sich. Was war das für eine Gesellschaft! Keiner trank auch nur ein Gläschen Wein oder ein Feierabendbier. Diszipliniert sahen diese Teilnehmer aus, durchtrainiert, ein festes Ziel vor Augen, begierig, bei den morgigen Referaten etwas zu erfahren. Doch jetzt ließen sie sich von der Stimmung auf der Alm gefangennehmen. Einige streiften umher und setzten sich unter kleine Latschen, lehnten sich an Felsbrocken, plantschten in den winzigen Rinnsalen mit frischem Bergwasser. Einer untersuchte die zugewachsene Holzriese mit einem Taschenmesser. Eine Frau hatte sich an eine Zirbelkiefer gesetzt. Nicht die mit der Meckifrisur, sondern der andere der beiden weiblichen Gäste. Das Schauspiel der untergehenden Sonne wollte sich keiner entgehen lassen. Wassili Wassiljewitsch, der Russe, und der GI-Typ fotografierten und schickten die Bilder weg. Der Deutsche mit dem Sonnenbrand auf der Glatze plantschte mit den Füßen im Wasser des Baches. Viele nickten andachtsvoll. Alle genossen die Stimmung.
Nur die Frau, die an der kleinen Zirbelkiefer lehnte, genoss die Stimmung nicht. Sie war tot.
8
Unpräzise Lösegeldforderung
Die beiden medizinischen Alpinisten, die in ein paar Kilometern Luftlinie entfernt oben auf der Kuglerten Resl standen, hielten das Fernglas auf die tote Frau unter der Zirbe gerichtet, aus dieser großen Entfernung hatten sie jedoch den Eindruck, als ob sich da eine den Schlapphut ins Gesicht gezogen hätte und schliefe. Vielleicht hätte man mit einem noch besseren Fernglas die ungewöhnliche Handstellung erkennen können, die leichte Verkrampfung der Mittelhand, den beginnenden Rigor mortis, der für eine Schlafende eher untypisch, für eine seit einigen Minuten Tote aber völlig zwingend ist. Sowohl die Internistin wie auch der Neurologe hatten die Hand gesehen, die locker im Gras zu liegen schien, wie in müßiger Beiläufigkeit hingestreckt, wo doch in Wirklichkeit etwas Erschreckendes zu sehen gewesen wäre. Später, als die Mediziner von der Brisanz der Sache erfuhren, versuchten sie sich krampfhaft daran zu erinnern, was genau sie durch das Fernglas gesehen hatten. Vergeblich, sie erinnerten sich an nichts Konkretes, nur an eine vage Feierabendstimmung auf dem Wolzmüller-Anwesen, an herumsitzende Menschen wie zum Beispiel den Nordafrikaner, der den Tennisball knetete; den kleinen Asiaten, der mit seinem Notebook verwachsen schien; die Frau mit der Meckifrisur; den dienstbeflissen herumwieselnden Hüttenwirt Rainer Ganshagel. Sie konnten später sogar ziemlich genau angeben, wann sie mit dem Grenzstreifengucker hinübergeschaut hatten zu den Anlagen der Wolzmüller-Alm, nämlich um sieben Uhr abends – als die Glocken der St.-Martins-Kirche zur Abendmesse gerufen hatten. Sieben Uhr, das war auch der später festgestellte ungefähre Todeszeitpunkt der Frau. Das bedeutete nichts anderes, als dass sie einen Mörder gesehen hatten, ohne zu diesem Zeitpunkt davon zu wissen. So etwas ist ärgerlich. Mehr noch: So etwas ist äußerst unangenehm, wenn dieser Mörder noch frei herumläuft.
So sprachen sie noch über dies und das, zum Beispiel, dass die Kuglerte Resl natürlich offiziell und amtlich irgendwie anders hieß, südliches Dammkopfkofelkar oder so ähnlich, aber der drollige Spitzname hätte sich hartnäckig gehalten. Sie zogen die Verschnürungen der Rucksäcke zu, wechselten noch ein letztes Mal das Einheitsdoppelrohr.
»Siehst du die Gräben, die durch das Anwesen laufen?«
»Ja, sehe ich. Sind das ausgetrocknete Bachläufe? Oder schon die ersten Risse in der europäischen Kontinentalplatte?«
»Das sind Reste von alten Holzriesen. Damit wurden früher die gefällten Bäume zu Tal befördert. Das Werdenfelser Land war ein Land der Holzfäller und Flößer, deshalb sind noch viele dieser Holzriesen erhalten. Es gab auch tollkühne Wettrennen unter den Holzknechten – die damit praktisch den Bobsport vorweggenommen haben.«
»Ja, jetzt sehe ich es auch: Die Rinnen der Holzriesen verzweigen sich.«
»Eine Bahn, die dort oben beginnt, kann genauso unten im Werdenfelser Tal enden wie drüben in Österreich.«
Sie packten das Fernrohr ein und begannen mit dem Abstieg von der Kuglerten Resl. Leise pfiffen die vier Windsburschen ihr melancholisches Lied.
»Wie geht es eigentlich dem Mann, der sich die tödliche Borreliose eingefangen hat?«
»Den Umständen entsprechend gut, ich habe ihm einen Aufenthalt in einem betreuten Pflegeheim empfohlen, er jedoch hat darauf bestanden, die letzten Monate, die er noch klar bei Verstand ist, zu Hause zu verbringen.«
»Ich kann mir schon vorstellen, wie sauer der ist. Sein ganzes Leben hat er darauf geachtet, fit zu sein, Sport zu treiben, sich gesund zu ernähren – und dann so was. Was war denn seine Lieblingsdisziplin? Wahrscheinlich Langstreckenlauf, oder?«
»Nein, Bergsteigen und Kampfsport, so was wie Tameshiwari. Muskelpakete hatte der! Der muss einen ziemlichen Schlag draufgehabt haben. Er hat es mir demonstriert, auf ziemlich eindringliche Weise. Er hat eine ganze Reihe von explosiven Faustschlägen in die Luft geführt – Das ist für den Fitnesstrainer!, hat er dazu geschrien. Das ist für den ganzheitlichen Körpertherapeuten! Für den südkoreanischen Akupunkteur! Die Mittenwalder I-Ging-Meisterin! Und das ist für meine Frau, die mich dreißig Jahre lang mit ihrem Gesundheitstick getriezt hat! Bei der Ehefrau hat er mir ein Regalbrett demoliert.«
»Wenigstens hat er seinen Humor nicht verloren.«
»Ich habe es auch für einen Scherz gehalten. Aber ein paar Wochen später sind bei uns in der chirurgischen Notaufnahme innerhalb von wenigen Tagen ein Fitnesstrainer und eine Ernährungsberaterin eingeliefert worden, ein ganzheitlicher Körpertherapeut –«
»Vielleicht Zufall.«
»Vielleicht. Ich habe den Mann jedenfalls bisher noch nicht bei der Polizei gemeldet.«
Der Abstieg von der Kuglerten Resl dauerte eine halbe Stunde, auf einem kleinen vorgelagerten Plateau machten sie nochmals Rast, man hatte diesmal einen einigermaßen guten Blick von unten auf die Wolzmüller-Alm. Wenigstens auf einen Teil des Geländes.
»Wollen wir noch hinübergehen und uns das mal anschauen? Wir wären noch vor Einbruch der Dämmerung dort.«
»Ich habe mächtig Durst. Ich weiß nicht, ob unsereins dort was zu trinken bekommt. Das ist doch bestimmt eine sehr exklusive Gesellschaft.«
Sie entschieden sich deswegen dafür, ins Tal abzusteigen. Ein Mann mit trüben Augen kam ihnen entgegen, er grüßte nur flüchtig mit einem Nicken und drehte sich dann weg. Er hatte einen Zimmermannsbleistift hinter dem Ohr stecken, und aus seinem Rucksack ragte eine Transportrolle, wie sie Maler verwenden, um ihre Skizzenblätter aufzubewahren.
Unten im Kurort kehrten sie in einer Kneipe ein. Sie setzten sich, so rotkariert und verschwitzt, wie sie waren, an den Tresen und stillten ihren Bergsteigerdurst.
»Unglaublich, was man mit dem Einheitsdoppelfernrohr alles sieht«, sagte der Neurologe. Und er sagte es sehr, sehr laut.
»Kann ich mal einen Blick drauf werfen?«, fragte der Barkeeper. »Ist das wirklich eines aus NVA-Beständen?«
»Ja, wir haben von der Kuglerten Resl hinüber auf die Wolzmüller-Alm geschaut, quer über den ganzen Talkessel«, sagte die Internistin. »Wir haben einen gesehen, der einen gelben Tennisball geknetet hat. Stellt euch vor: einen Tennisball! Wenn ich das Fernglas noch schärfer gestellt hätte, hätte ich vielleicht sogar den Markenschriftzug erkennen können.«
Der Barkeeper drehte die Musik leiser, die Gäste hörten gespannt zu. Ein Gast lauschte besonders aufmerksam. Als der Neurologe von der Frau mit dem Riesensombrero erzählte, die schlafend unter einer Zirbe gesessen war, stand der Gast auf und verließ die Kneipe. Kein Mensch beachtete ihn.
»Und wie ich die gesehen habe!«, sagte die Medizinerin.
»Wen?«
»Na, die Frau mit dem Sombrero! Da habe ich mir gedacht: So möchte ich jetzt auch dasitzen!«
Nein, liebe Internistin aus dem hohen Norden, das möchtest du ganz sicher nicht.
9
Unter dem Titel Le sous-bois ist leider kein einziger Film mit Jean Gabin belegt. Hartnäckig hält sich jedoch in Cineastenkreisen das Gerücht, dass es solch einen Film gibt. Gabin soll die Filmrolle mit ins Grab genommen haben.
Internationales Filmlexikon
Es war Mitternacht auf der Wolzmüller-Alm, und die Seminarteilnehmer lagen in ihren Betten: Pierre, der Franzose, der igelköpfige GI-Amerikaner und Wassili, der Russe, alle waren erschöpft von der ungewohnten Feldarbeit und der würzigen Höhenluft. Nur eine kleine Gruppe von Unentwegten diskutierte in der Zirbelstube bei Kerzenschein über die verschiedenen kulturellen Gepflogenheiten, die es auf der Welt gab. Lucio und Fabio, die beiden Italiener, und der namenlose deutsche Rocker schüttelten den Kopf.
»Man hält japanischen Kunden die Hand hin, und sie verneigen sich.«
»Umgekehrt: Man macht in Thailand einen Diener, und alle laufen schreiend davon.«
Alles war ruhig und gut, lediglich einer hier oben war noch aktiv, nämlich der Hüttenwirt und Herbergsvater der Wolzmüller-Alm, Rainer Ganshagel. Er strich draußen in der abschüssigen Umgebung herum und sah nach dem Rechten. Er hatte die Alm vor zwei Jahren gepachtet, er hatte viel Geld und Mühe investiert, den heruntergewirtschafteten Betrieb wieder ins Laufen zu bringen. Von wegen Unstern, der über der Alm schwebte! Diesem Unstern würde er schon zu Leibe rücken! Liebenswerterweise hatte ihn der Bürgermeister persönlich dabei unterstützt. Der Erhalt der alten Bräuche und Sitten wäre das Höchste, hatte er gesagt. Ganshagels Arbeit auf der Alm war eine einfache. Er versorgte die Seminarteilnehmer mit dem Notwendigsten und schirmte sie von der lärmenden und neugierigen Welt da drunten ab. Manchen verirrten Wanderer hatte er schon verjagt, manchem vorwitzigen Journalisten hatte er schon Mistgabel und Sense gezeigt. Das genügte in den meisten Fällen. Ging die Neugier einmal darüber hinaus, was bisher selten vorgekommen war, griffen die Bodyguards der hochrangigen Seminarteilnehmer ein. Es hatte bisher kaum ein Seminar ohne Leibwächter gegeben. Es waren mürrische Muskelberge mit militärischer Vorgeschichte, humorlose Grantler mit Blicken wie Dolche und Fragen wie Handgranaten. Je wichtiger die Leute, desto mehr Leibwächter. Überraschenderweise hatte Ganshagel bei den jetzigen Seminarteilnehmern überhaupt keine Bodyguards gesehen. Waren die Teilnehmer nicht so schützenswert? Oder waren die Bodyguards so gut, dass man sie nicht sah? Eigentlich ging es ihn nichts an. Er hatte es sich zur Angewohnheit gemacht, sich nicht einzumischen. Er managte einen diskreten Rückzugsort für Geschäftsleute und Mitglieder der Wirtschaftselite. Damit verdiente er sein Geld.
Für Rainer Ganshagel war der mitternächtliche Kontrollgang Routine. Ein paarmal hatten sich zu dieser Stunde Jugendliche angeschlichen, einfach so, nur der Neugier wegen. Sie waren leicht zu verscheuchen gewesen. Ein anderes Mal hatten sich Fotografen nachts angepirscht, der Grund dafür mussten wohl die anwesenden hohen Wirtschaftsbosse gewesen sein. Und erst letzten Monat hatte der Bürgermeister höchstpersönlich mit ein paar Mitgliedern des Gemeinderats die Alm hier oben besucht. Allerdings tagsüber. Viele Inder waren mitgekommen, es wimmelte von Bhartriharis und Chattopadhyays. Sie deuteten viel herum in der Gegend, diese Inder, sie fotografierten und filmten die Berge, es musste also um Dreharbeiten gehen, dachte Ganshagel bei sich. Und richtig: Am nächsten Tag wurden Probeaufnahmen gemacht. So ein Typ wie Aamir Khan, die Bollywood-Größe, vielleicht war er es auch selber, stand da und sagte etwas auf Hindi. Sieben mit bunten Seidensaris umwickelte Schönheiten aus Mumbai-Andheri umtanzten ihn singend, während er mit ausladender Geste auf die zackigen Spitzen der Waxensteine wies. Das alles wurde mit mehreren großen Kameras gefilmt, und die Filmcrew hatte gelacht und die Gläser erhoben mit einem milchigweißen Zeug drin, das Lassi genannt wurde.
»Gell, da schaugst, Ganshagel«, hatte der Bürgermeister gesagt.