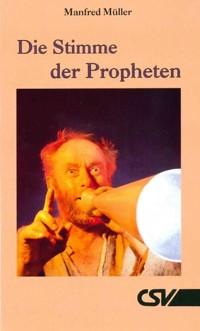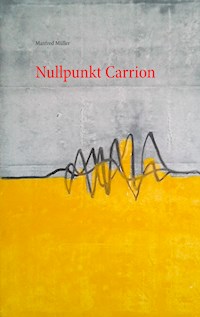Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der junge, sensible Peter wird erwachsen im II. Weltkrieg, in der Nachkriegszeit und dem sogenannten Wirtschaftswunder. Sein Stiefvater prophezeit ihm: "Aus Dir wird nie was werden." Was aus ihm tatsächlich wird, wie er mit den wirren Zeiten, mit Misshandlungen, Leiden und Freuden, Enttäuschungen und Liebe umgeht und darum kämpft, sich gegen den Strom zu behaupten und seinen Lebenstraum zu erfüllen, wird auf eine Art berichtet, die den Leser in Spannung versetzt und verstehen und dadurch mitempfinden lässt. Der historische Hintergrund liegt zwar im vorigen Jahrhundert, aber die Geschichte ist aktueller denn je.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 784
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das historische Umfeld der Geschichte entspricht den tatsächlichen Ereignissen. Die Personen und ihre Handlungen sind erfunden. Der von ihnen verwendete Eigenname, der im spanischen Sprachgebrauch für „el negro, los negros“ steht, war zur damaligen Zeit gebräuchlich und nicht abwertend gemeint. Um der heutigen Befindlichkeit Rechnung zu tragen, steht er hier für „N…“.
„Gestatten, von Knattern“, sagte er und streckte seinen Arm vor, steif und zackig wie eine Aufziehfigur aus der Spielzeugkiste, steif auch seine Beine, mit denen er ein paar Zentimeter vorwärtszockelte - fehlte noch, dass er das Blechscheppern und Rattern des Spielzeugs nachahmte - und bevor der Angeredete die angebotene Hand ergreifen konnte, falls er das überhaupt vorhatte, drehte der angebliche von Knatten, also der Mühlweck, die Handfläche schnell nach oben, sodass jeder kapierte, er sollte sein Geld herausrücken. Doch die meisten gingen vorbei, tippten sich an die Stirn oder sagten irgendetwas Unfreundliches.
Die Freunde standen daneben. Teils lauerten sie auf einen Obolus, teils spielten sie die Unbeteiligten, die zufällig hier herumhingen. Besonders Peter trieb das bis zur Vollendung: Er machte den Eindruck, als sei er nicht da. Trotz seiner Größe konnte er leicht übersehen werden, weil er oft mit seinem Kopf woanders war und nie bei der Sache.
Sein Blick mit dem schepsen Auge war dann leer und seine Ausstrahlung abgestellt. Was da in ihm vorging, weiß der Teufel!
Sobald die Sache langweilig wurde oder die Kunden ausblieben, zählten sie ihre Barschaft zusammen und zogen johlend nebenan in den Pavillon vom Heurong und kauften Süßigkeiten; das waren ein paar Himbeerbonbons, Pfefferminzkissen und, wenn das Geld reichte, ein, zwei Tütchen Brausepulver. Der Peter ging meistens nicht mit, vor allem dann nicht, wenn das Hänschen mit dabei war, denn zu dritt vertrugen sie sich nicht: Peter, das Hänschen und der Mühlweck. Er hatte dem Hänschen sogar einmal die Fresse…
Aber so wird das nichts!
Es können nicht wahllos Geschichten aus seinem Leben herausgegriffen werden, um ihn zu beschreiben und einigermaßen zu verstehen. Sein Leben war eh ein Wirrwarr, im Krieg, in der Nachkriegszeit und dem Tohuwabohu, das danach kam. Alles muss der Reihe nach berichtet werden, möglichst aus seiner Sicht. Die Sicht in diesem Alter ist einfacher und weniger dramatisch. Mag sein, dass die Jungen um die Seele eine Schutzhülle haben, die Schlimmes erst nach und nach eindringen lässt. Später zeigen sich oft Auswirkungen, die sich keiner erklären kann, wie bei ihm. Psychologisieren brauchts trotzdem nicht, seine Handlungen sind Ausfluss seiner Seele und sprechen für ihn. Aber von Geburt an muss sein Leben auch nicht berichtet werden. Die zehn, zwölf Jahre bis zum Erwachsenwerden reichen. Diese Geschichte mit dem Mühlweck, dem sogenannten Mücke, spielte zu einer Zeit, in der Peter mit seiner Familie längst wieder zurück in der Stadt war. Ein früheres, wichtiges Ereignis, noch im Krieg, war die Sache mit dem Kuchen:
Seine Mutter hatte lang gespart. Butter, Mehl, Eier, Zucker und die anderen Zutaten von den täglichen Rationen abgezwackt und auf die Seite gelegt. Das heißt, nicht die Sachen selbst, sondern die Lebensmittelmarken. Dann war es so weit: Sie hatte genug Marken angesammelt, um mit ihrer größten Einkaufstasche in den Laden vom Konsum zu gehen. Gut hatte sie sich auch angezogen für diesen besonderen Gang. Aber sie bekam nicht die ganze Menge der Marken in Naturalien eingetauscht. Die Verkäuferin sagte ihr, sie habe nicht so viel Vorrat für einen einzigen Kunden, da müsste sie in drei, vier Tagen wieder vorbeikommen.
Schließlich war alles beisammen in der Küche, bis auf das Mehl, das gab es nicht; stattdessen bekam sie Gries.
Sie rührte einen Teig an, unter der Aufsicht von Peter und Rosalinde, gab die Masse in die schwarze, runde Kuchenform und schob sie in die Backröhre, die lang vorher mit Kohlen eingeheizt worden war. Zu dritt saßen sie dann in der Küche, die vom Backofen gemütlich warm wurde, und warteten. Ab und zu stach die Mutter mit einer Nadel in den Kuchen und prüfte den Teig. Irgendwann öffnete sie wieder den Herd und nahm die Backform aus der Röhre und stellte sie auf die Ofenklappe. Genau in diesem Moment heulten die Sirenen, erst kurz, dann dieser lange, schaurige Ton: Fliegeralarm! Es schien so, als habe die Mutter mit ihrer Herdklappe den Alarm ausgelöst. Sie sprangen auf! Peter dachte, wenn er jetzt die Klappe zuschlägt, hört die Sirene mit dem Geheule auf.
Aber sie mussten sich sputen. Alles war vorbereitet. Sie zogen ihre Mäntel an, griffen sich ihre Taschen im Hausflur. Die Mutter hastete nochmals zurück in die Küche, nahm den Kuchen aus der Form und ließ ihn auf der Herdklappe stehen zum Abkühlen. Dann liefen sie, rannten auch zwischendurch, zum Bunker im Hof der Schokoladenfabrik. Unterwegs schrie die Mutter auf: Sie habe den Wohnungsschlüssel daheim vergessen, wenn sie zurückkämen, würden sie den Hauswart brauchen: ein schlimmer Gedanke! Der Mann war widerlich, ein Erznazi.
Die Sache war schnell vorbei. Gemütlich spazierten sie in der Sonne nach Hause. Die Haustür stand offen und die Wohnungstür auch; ihre Schlüsselsorgen waren umsonst gewesen, dachte Peter.
Dann sahen sie, dass die Holztür schräg in den Scharnieren hing. Hatte die Mutter sie so gewaltsam zugeschlagen? Sie gingen in den Flur; die Küchentür war herausgerissen und lag auf dem Boden im Wohnzimmer. Peter ging sofort zum Kuchen. Seine Schuhe knirschten auf Glasscherben, die überall herumlagen. Die Scheibe des Küchenfensters war eingeschlagen, die Rahmen hingen ohne Glas kreuz und quer herum. Auch die Tapeten an den Küchenwänden waren zum Teil heruntergerissen.
Nur der Kuchen war heil. Das freute ihn gewaltig. Das Durcheinander ringsum müsste der Hauswart richten.
Das gefiel ihm, weil sie immer so blitzblank alles aufräumen mussten. Jetzt hatten sie einen richtigen Saustall!
Außerdem sollte der Vater, der angebliche Vater - er und Rosalinde nannten ihn heimlich Angebervater oder nur der Angeber oder auch der Angebliche - in den nächsten Tagen zum Urlaub kommen. Der konnte auch aufräumen. Der echte Vater kam nicht mehr.
Die Mutter hatte einmal gesagt:
„Kinder, euer Vater kommt nicht mehr. Er ist im Krieg gefallen“, dann weinte sie.
Peter fragte sie:
„Wenn er gefallen ist, warum steht er nicht auf und kommt zu uns?“
Die Mutter wischte sich mit einem Taschentuch die Augen und sagte:
„Er ist jetzt im Himmel. Da kann er nie mehr kommen, aber er ist ein Engel und schaut immer auf dich, damit dir nichts passiert.“
Das war alles recht unverständlich, aber er gewöhnte sich an den Gedanken, fand ihn stark, dass einer vom Himmel herunter auf ihn aufpasste. Statt des Vaters kam dann ein fremder Soldat zur Mutter. Erst saß er ab und zu am Küchentisch und trank einen Zichorie, dann schlief er im Bett vom echten Vater, zog seine Hosen und Jacken an und tat so, als wäre er ihr richtiger Vater und sie müssten gehorchen. Rosalinde sagte zum Peter:
„Der ist ein richtiger Arsch“;
dabei mochte der Angebliche seine Schwester; ihn mochte er nicht.
Zunächst wollten sie den Kuchen essen. Auch die Mutter war einverstanden, obwohl sie etwas traurig zu sein schien. Sie säuberten die Tischplatte von den Glasscherben, stellten den Kuchen in die Mitte und die Rosalinde musste ihn aufschneiden, weil die Mutter nicht konnte.
Sie saß nur auf dem Stuhl und sah sich die Bescherung in der Küche an. Da schrie die Schwester auf: Sie hatte sich am Kuchen ein bisschen in die Fingerspitzen gepikst und blutete, weil der Teig voller Glassplitter war, bis tief in sein Inneres hinein. Sie mussten ihn in den Mülleimer werfen. Das war für Peter das Traurigste an dieser Geschichte und an dem Scheißkrieg.
Nein, trauriger war, die Mutter anzuschauen. So hatte er sie noch nie gesehen, sie war ihm fremd. Das war unheimlich. Da bekam er Angst. Wenigstens die Mutter durfte sich nicht verändern, wo sie ständig alles veränderte. Aber als er aus dem kaputten Fenster schaute, sah er noch gewaltigere Veränderungen: Im Innenhof dort, wo der große Sandspielplatz lag, war jetzt ein riesiger Bombentrichter, mitten in der Wiese. Die Bäume ringsherum waren verschwunden. Der Bombentrichter war tief, seine Wände waren ganz glatt, wie abgekehrt.
Dieser Ort wurde zum Mittelpunkt für sie; nicht nur für die paar Freunde vom Betteln, sondern auch für die Kinder vom Karree. Das war ein Geschrei den ganzen Tag, was da zwischen den vier Häuserblocks schallte, besonders jetzt, wo die Bäume weg waren! Nur wenn es dämmerte oder wenn Fliegeralarm war, wurde es still, abgesehen vom Heulen der Sirenen. Manchmal war es ein Fehlalarm, der sie heimrennen ließ, und kurz danach die Entwarnung sie wieder in den Bombentrichter zurückholte. Dieses Hin und Her passierte jetzt immer öfter. Sie sangen, oder besser grölten, wenn sie heimmussten:
„Wenn die Glocke zwölf Uhr schlägt, kommt der Churchill angefegt mit dem Nachttopf unterm Arm, Täterä, Täterä Fliegeralarm.“
Peter langweilte sich bald mit dieser Spielerei und blieb zu Hause oder schaute den anderen vom Küchenfenster aus zu oder zeichnete am Küchentisch.
Die Küche war längst wieder in Ordnung. Erst kam der widerliche Hauswart jeden Tag, manchmal zweimal am Tag, und redete mit der Mutter und schaute sie dabei so komisch an. Dann kam der Angebervater und zimmerte im Zimmer herum. Einmal schlug er sich mit dem Hammer ein bisschen auf die Hand und schrie lauter als Rosalinde bei ihrem Kuchenschneiden. Danach war er wieder grantig und trank seinen Wein. Aber die Küche hatte er zum Schluss sauber hergerichtet.
Wenn er so aus dem Fenster schaute, vermisste er die Bäume rings um ihren Sandplatz. Die Mutter sagte, jetzt im März hätten sie ausgetrieben mit frischen Blättern, und die Vögel hätten einen schönen Platz zum Singen gehabt. Die Vögel hatte er früher, wenn es in der Früh hell wurde, schon beim Aufwachen gehört: Ein Spektakel war das vorm Fenster! Das vermisste er auch. Wenn er jetzt aus dem Fenster schaute, wurde ihm manchmal so komisch wie damals, als er die Mutter am Küchentisch sitzen sah nach dem Durcheinander: Warum verändert sich immerzu alles, fragte er sich. Danach schrie er in der Nacht, wenn im Traum Soldaten die Tür eintraten und hereinstürmten und die Küche und die anderen Zimmer kaputt hauten und wie Sirenen heulten und sogar lachten und einen Spaß hatten, bis Peter laut weinte, bis sie hinausstolperten, vertrieben von der Mutter, die an sein Bett kam und ihn streichelte. Rosalinde sagte am nächsten Tag zu ihm, wenn er nochmal nachts so einen Zirkus veranstaltete, würde sie ihn aus ihrem Zimmer schmeißen.
Es war nicht ihr Zimmer allein. Sie hatte sich nur so breit gemacht mit ihren Sachen. Aber ansonsten war sie in Ordnung!
Ein anderes Mal lag er schon im Bett, als sie hereinkam ins Zimmer und sich auszog. Sie dachte wahrscheinlich, er schliefe schon, weil sie sich nackt auszog, direkt vor ihm. Heimlich schaute er ihr zu. Sie war recht dünn. Er wunderte sich, dass sie auf so langen, spindeldürren Beinen stehen konnte. Er schaute ihr auch zwischen die Beine, wo sie nichts hatte, sowas wie er. War es das erste Mal, dass er den Unterschied so deutlich zwischen ihr und ihm sah? Sie tat ihm etwas leid, so glatt wie sie war ohne Schniedel. Die Mutter nannte ihn so, wenn sie samstags in der Küche badeten, in der Zinkwanne. Sie sagte:
„Peter, denk daran, auch deinen Popes und deinen Schniedelwutz zu waschen.“
Die Schwester zeterte immer: Sie wolle sich nicht in seiner Drecksbrühe waschen. Sie käme zuerst dran, weil sie viel sauberer sei. Da war ihm nie aufgefallen, dass sie keinen Schniedel hatte. Mit solchen Gedanken schlief er ein. Das Geheul der Sirene ließ ihn die Augen aufreißen und automatisch aus dem Bett springen. Auch Rosalinde zog sich rasch wieder an, ohne ihn zu beachten. Da riss der Vater die Tür auf und schrie:
„Raus, raus, sofort raus, jetzt wird’s ernst!“
Wenn der einmal bei ihnen ist, dachte Peter, meint der wohl, er müsse alles bestimmen! Peter hatte mehr Angst vor ihm als vor den Sirenen. Die Mutter kam auch und sagte:
„Kommt Kinder, vielleicht ists wieder ein Fehlalarm, aber wir gehen halt mal los. Das kennt ihr ja schon auswendig.“
Ihre Sachen waren immer griffbereit im Wohnungsflur.
Sie zogen die Mäntel an und griffen die Taschen und die Schwester sagte:
„Mutti, den Wohnungsschlüssel.“
„Danke, dass du mich erinnerst, aber ich habe ihn schon eingesteckt.“
Währenddessen lärmte der Angeber im Hauseingang, sie sollten sich beeilen; er habe einen Marschbefehl für zweiundzwanzig Uhr. Er tat so, als wäre der Angriff früher vorbei, wenn sie sich beeilten. Licht durften sie nicht anmachen. In der schwarzen Nacht liefen sie wieder auf der Straße zum Bunker der Schokofabrik. Es war vollkommen dunkel, weil die Straßenlaternen ausgeschaltet waren wegen der Verdunklung. Sie kannten den Weg auswendig. Rosalinde hing immer etwas zurück. Sie sagte, sie sei so müde, aber der Angeber trieb sie zur Eile und sagte, sie müssten zusammenbleiben. Sie tat ihm leid; mit ihren dürren Beinen fiel ihr das Laufen sicher schwer.
Die Mutter hatte Peter an die Hand genommen. So konnte er gut Schritt halten. Er schaute auf seinen Weg. Ab und zu schaute er die Straße hinunter auf die Innenstadt, genauer gesagt, wo er sie vermutete, weil nur der Fluss etwas glitzerte, aber sonst wars auch dort stockdunkel. Nur dort, wo er sich den Stadtrand dachte, waren helle Punkte, Lichthaufen sogar, rings um die Stadt verteilt. Er fragte die Mutter, ob sie das auch sähe, und sie sagte, das würde Christbäume heißen, die beleuchtet sind und an Fallschirmen abgeworfen werden, damit die Flugzeugführer sähen, wo sie ihre Bomben abwerfen müssten. Er stellte sich den Flugzeugführer vor, wie er im Dunklen herumflog und die Lichter suchte und sie endlich sah und die Lucke aufmachte und seine Bomben abwarf, ohne zu sehen, wohin sie fielen; vielleicht ahnte er nicht einmal, dass sie da unten herumliefen.
Die Bombe, die sie in seinen Innenhof geworfen hatten, war eine Sprengbombe, die wahrscheinlich auf ihr Haus fallen sollte. Das wäre dann zerrissen worden mitsamt ihrer Küche und allen Zimmern. So aber hat nur die Druckwelle ein bisschen Schaden angerichtet, erklärte der Vater einmal, der sich mit solchen Sachen auskannte.
„Und warum hat die Welle nicht auch das Fenster in unserem Schlafzimmer eingeschmissen“, wagte er zu fragen.
„Das verstehst du nicht. Das ist zu kompliziert für dich.“
Er wollte es wissen, machte sich mutig und fragte noch einmal:
„Warum wurden aber alle Fenster beim Hänschen eingeschmissen?“
„Jetzt geh mir nicht auf die Nerven mit deiner Fragerei.“
Der Angebliche mochte ihn nicht. Weiter konnte er nicht nachdenken, weil sie am Bunker angekommen waren.
Am Eingang zum Bunker stießen sie auf eine Menge von Menschen, ein schwarzer Menschenhaufen, der nur von einem Lichtschimmer, der aus dem Treppenloch herauskam, angeleuchtet wurde. Alle warteten still und steif, bis sie an die Reihe kamen nach unten zu gehen. Peter schmiegte sich an die Pelzjacke der Mutter; er hätte im Stehen schlafen mögen, aber er jammerte nicht. Männer jammerten nicht, sagte immer der Angebervater, doch die Schwester ödete ihn an mit ihrem Gejammer, sie sei so furchtbar müde. Die Mutter sagte:
„Kinder, gleich sind wir unten und da könnt ihr euch schlafen legen.“
Und der Vater sagte:
„Schluss mit dem Gejammer! Wir sind auch müde und jammern nicht.“
Jetzt erst sah Peter seine Soldatenuniform, die er trug, weil er ja einen Marschbefehl hatte. Er musste noch heute Nacht abhauen; bei dem Gedanken wurde seine Müdigkeit gleich etwas weniger. Dann kamen sie an die Reihe, die Treppe hinunterzusteigen. Peter konnte die Treppenstufen kaum erkennen, so schwach war das Licht in dem langen Schacht, der in die Tiefe führte. Auch die vielen Menschen, die dichtgedrängt wie ein Wurm hinunterkrochen, versperrten ihm die Sicht. Hätte die Mutter ihn nicht eng an sich geführt, wer weiß! Der Vater führte Rosalinde, die war ja auch sein Lieblingskind. Am Ende der Treppe stand ein Luftschutzwart, der ihnen sagte, sie sollten durch die linke Türe gehen; andere schickte er zur rechten. Die Eltern sprachen später darüber, nach welchen Gesichtspunkten, die sich als so wichtig herausstellten, er wohl eingeteilt habe. Sie kamen in das riesige, runde Gewölbe, das auch schwach beleuchtet war. Es war vollgestellt mit Tischen und Bänken wie in einem Biergarten. Er und seine Schwester durften sich sofort auf eine Tischplatte legen. Die Mutter schob ein Stoffbündel unter ihre Köpfe, und sie schliefen ohne weiteres ein.
Vom Geschrei der Menschen wurden sie aufgeweckt. Sie machten ihre Augen auf, aber sie sahen nichts. Der Saal war stockdunkel. Rosalinde fing an zu weinen. Da knipste der Vater eine Taschenlampe an: Auch andere Kinder weinten und schrien Mama, und auch alte Menschen schluchzten. Der Vater, als Soldat, kannte sich aus und sagte, der Strom sei ausgefallen, weil über ihnen ein Haus eingestürzt sei. Der Schutt läge jetzt wahrscheinlich auf ihrem Eingang und auf dem Luftschacht zu ihrem Saal. Dann schrie er in den Saal:
„Achtung, Achtung! Der Luftschacht ist zu. Wir sind verschüttet. Wir müssen Luft sparen, bis wir ausgegraben werden. Alle sofort flach auf den Boden legen und wenig bewegen.“
Er sagte noch mehr, um die Leute zu beruhigen, die nach seiner Ansprache fürchterlich herumschrien. Manche zündeten ihre Kerzen an, die sie sofort ausmachen mussten wegen der Luftverschwendung. Andere drängten zum Ausgang. Der Vater sprang dazwischen und stellte sich an die Tür und sagte, wer hier die Tür öffnen wollte, würde erschossen werden und zog seine Pistole aus dem Halfter und stellte sich breitbeinig vor die Tür und beleuchtete sich mit seiner Taschenlampe. Das sah zum Fürchten aus. Peter sagte keinen Mucks. Auch die Rosalinde hatte sich beruhigt. Sie hatte nur einen Schluckauf, aber nicht laut. Der Angeber werde schon alles richten.
Sie legten sich auf den dreckigen und feuchten Boden, aber einschlafen konnten sie nicht mehr. Die Mutter redete leise mit ihnen. Sie erklärte ihnen, warum der Vater die Leute nicht durch die Tür gehen lassen wollte, weil die Luft im Gewölbe wie ein Luftkissen die Mauern festhielte. Wenn die Tür aufgemacht werde, würde die Luft hinaussausen und das Gewölbe einstürzen. Eine halbe Ewigkeit mussten sie so ausharren. Dazwischen schliefen sie dann doch ein bisschen.
Irgendwann wurde die Tür von außen geöffnet. Alle wollten zuerst hinaus, aber der Luftschutzwart rief, es sei keine Eile geboten, es gäbe keine Gefahr mehr für sie, der Schutt sei weggeräumt. Er sagte noch, sie alle sollten dem Herrgott danken. Den Nachbarsaal habe es bös erwischt, viele Tote und Verletzte. Das war die Tür nach rechts!
Die Treppe war jetzt hell beleuchtet, ganz rot, und oben war es heller als der Tag: Die Schokoladenfabrik brannte lichterloh. Die Luft roch stark nach Schokolade. Kurz musste Peter an Weihnachten denken, so feierlich wars ihm. Aber leider nur kurz, denn sie setzten sich auf die Bordsteinkante und die Mutter steckte, rechts und links, die Köpfe der Kinder unter ihre Pelzjacke und sagte mit einer fremden Stimme;
„Kinder, bitte, bitte schaut da nicht hin. Das werdet ihr sonst euer Leben lang nicht vergessen.“
Aber er spähte dann durch einen Schlitz in der Jacke hindurch: Das war ein Höllenfeuer! Er kannte den Ausdruck, der ihm plötzlich einfiel, von einer Geschichte, die ihm seine Schwester einmal vorgelesen hatte, und er murmelte die ganze Zeit: so ein Höllenfeuer, so ein Höllenfeuer… aber leise, damit die Mutter nichts hörte. Wo der Vater steckte, wusste er nicht. Vielleicht hatte er schon seinem Marschbefehl gehorcht? Ihm wurde immer heißer unter der dicken Jacke, trotz des Luftlochs; aber die Luft, die er durch den Jackenschlitz einatmete, war ja auch heiß. Er sagte, er möchte aufstehen und weggehen. Auch Rosalinde quäkte unter der Jacke.
„Wir müssen auf den Vater warten, der noch etwas erledigen muss. Wenn wir jetzt gehen, verfehlen wir uns in dem Gewühl hier.“
So warteten sie. Seine Augen waren schon ganz geblendet von der Feuersglut. Ab und zu stürzte ein Teil vom Fabrikdach oder von der Mauer ein, was in die Flammen fiel und wie eine Explosion riesige Mengen von Funken nach allen Seiten schleuderte. Der vorher süße Schokoduft, roch inzwischen verbrannt und machte seine Atemluft noch dicker. Endlich hörte er die Stimme des Vaters über sich:
„Kommt, sitzt nicht hier herum, wir gehen!“
Der Angebliche brachte es immer fertig, wenn er anfing, ihn ein bisschen zu mögen, sich wieder unbeliebt zu machen.
Sie drängten sich durch das Menschenknäuel, bis sie auf ihre Straße gelangten. Dort war Platz, aber er konnte wenig sehen. Der Himmel, eigentlich alles, war ausgefüllt mit Feuerfunken. Die schossen aus den brennenden Häusern heraus und sausten schräg im Sturm durch die Straße und über die Wiese. Aber nicht nur aus den Häusern kamen sie. Die größte Masse kam von der Stadt herauf, jagte im Sturmwind hinter ihnen her und stach sie am Kopf und in den Rücken und zischte an ihnen vorbei zu den anderen Leuten, die vor ihnen liefen. Der Vater schrie, sie sollten ihre Beine unter den Arm nehmen und Tempo machen. Sie seien gleich am Haus, da wären sie geschützt. Die Mutter führte ihn wieder an der Hand, sonst wäre er ständig gestolpert, und der Vater zerrte Rosalinde hinter sich her. Sie waren beide zu müde, um noch einen Mucks zu machen. Peter wusste, dass es nur eine Kraftverschwendung wäre, wenn er den Mund aufmachte. Er brauchte seine ganze Kraft für die Beine. Die Schwester tat ihm leid mit ihren spindeldürren, sicher kraftlosen Beinen.
Ins Haus durften sie nicht gehen, weil die Nachbarhäuser alle brannten. Nur der Vater ging hinein und war lang verschwunden. Die Mutter machte sich Sorgen. Sie stellten sich hinter die Gartenmauer auf der anderen Straßenseite, da waren sie geschützt vom Sturmwind und dem Funkenregen. Endlich kam er wieder heraus mit einer Menge von Sachen. Erst gab er jedem ein feuchtes, weißes Betttuch, das sie sich umwickeln mussten, dann verteilte er Decken und Rucksäcke. Auch die Kinder mussten mittragen.
So bepackt, gingen sie die Straße weiter aus der Stadt hinaus. Glücklicherweise wohnten sie nicht weit vom Stadtrand entfernt, sodass die Feuerhäuser bald hinter ihnen lagen. Der Funkenregen ließ nach. Er schaute zurück: Eigentlich sah das schön aus! Die Innenstadt war ein riesengroßer Scheiterhaufen. Die Flammen loderten weit in den schwarzen Himmel hinauf, und ringsum waren kleine Feuerstellen, wo einzelne Häuser verbrannten, und dazwischen stoben die Funken wie verrückt hin und her, ganz so, wie sie der Sturm herumblies. Die Rosalinde hatte keine Haare mehr, das heißt, ihre langen Haare waren verschwunden, aber das wollte er ihr jetzt nicht sagen.
Ob er noch Haare auf dem Kopf hatte, das konnte er nicht nachprüfen, weil er das Betttuch festhalten musste. Der Angebliche würde sich freuen, wenn er ein Glatzkopf wäre, dann bräuchte er nicht mehr an seinen Haaren herummäkeln.
Hier waren sie nun allein unterwegs. Wo die Straße schmaler und steiler wurde, lag ein Haufen mitten auf dem Weg. Die anderen gingen vorbei, ohne ihn zu beachten. Er blieb stehen. Er sah ein bläulich, grünlich glänzendes Ding. Er fand keinen Namen dafür, denn sowas hatte er noch nie gesehen. Er musste an junge, nackte Mäuse denken, die er in einem Nest auf dem Feld entdeckt hatte. Nur war der Klumpen hier viel, viel größer, fast wie ein Mensch. Der Angeber schrie von weitem, das ginge ihn nichts an, er solle sofort zu ihnen kommen.
Während er weglief, drehte sich ihm der Magen um. Dunkel ahnte er, was er gesehen hatte. Er hatte einmal den Vater gehört, wie er mit jemandem über Phosphorleichen sprach. Die Leute redeten viel und ängstlich über Phosphor, der in Brandbomben steckte und bläulich herauszischte und alles verbrannte, was in der Nähe war.
Endlich waren sie im Gartenhäuschen angelangt. Sie warfen ihre Sachen hinein und fielen um, auf den Stuhl, auf das Sofa, wo gerade Platz war, und fingen das Weinen und Schreien und Jammern an, bis sie nicht mehr konnten. Der Vater sagte, sie hätten Glück, hier gäbe es noch Wasser am Brunnen. Sie holten Gläser und Tassen aus dem Schränkchen und gingen zur Wasserleitung.
Trotz der Nacht konnten sie den Gartenweg gut sehen, weil der Himmel feuerrot leuchtete, obwohl es hier bei ihnen kein Feuer gab. Sie durften nur abwechselnd ein bisschen trinken, weil sie nicht wussten, wieviel Wasser noch in der Leitung war, aber sie konnten genug trinken.
Dann gingen sie wieder, dicht aneinandergeschmiegt, zurück ins Häuschen. Der Vater sagte, er werde jetzt mal losgehen und nachschauen, was Sache sei, und was sie machen könnten, und Essen besorgen. Die Mutter richtete für sie ein Lager und, ohne sich auszuziehen, nur die Stiefel, legten sie sich hin. Er hörte noch, wie die Mutter sagte:
„Kinder, wir wollen dem lieben Gott danken, dass er die ganze Zeit auf uns geschaut hat und wir heil hier angekommen sind. Vater unser im Himmel…“, da schlief er ein. Die Rosalinde schnarchte schon ein bisschen.
In derselben Nacht schaute der Onkel Karl aus dem Fenster seines Schlafzimmers, weil er nicht einschlafen konnte. Das erzählte er ihnen später. Er wunderte sich, dass der Himmel am Horizont so rot war, röter und größer als ein Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Der Schein war im Westen, so hätte es nur ein Sonnenuntergang sein können, aber um diese Uhrzeit, unmöglich! Da durchzuckte ihn ein Gedanke: Die Großstadt brennt!
Tage vorher gab es schon Gerüchte, die Stadt würde angegriffen werden. Er wollte das nicht glauben, weil es dort nichts Kriegswichtiges gab, nur Krankenhäuser und Lazarette. Er öffnete das Fenster und schaute hinunter auf die Straße. Da standen Menschen und blickten in Richtung des Feuerscheins. Dann sah er die Straße voller Papiere liegen und Blätter durch die Luft segeln.
„Hallo, ihr dort unten, was ist da los?“
„Die Stadt brennt“, schrien sie durcheinander. Die Papiere kommen von dort. Die kommen wahrscheinlich aus dem Rathaus. Das sind so Formulare und Ähnliches.“
„Das gibt es nicht. Die können nicht fünfzehn Kilometer durch die Luft fliegen.“
Während sie so diskutierten, wurde es ihm immer heißer, so erzählte er weiter. Um Himmels willen, was ist mit Peter und Rosalinde und Adele und Ernst, durchfuhr es ihn. Er setzte sich hin, schnallte seine Prothese wieder an, zog seine Kleidung, die er vor kurzem erst abgelegt hatte, wieder über und ging ins Schlafzimmer zur Frau, weckte sie auf und sagte zu ihr;
„Die Großstadt brennt lichterloh. Die Kinder! Ich saus mal los und schau, wie ich helfen kann. Ich geh zum Poldi, der soll mir sein Fuhrwerk geben.“
„Mann, du spinnst! Du kannst unmöglich mit den Pferden zum Feuer fahren. Das ist zu gefährlich. Dann wirst du noch getroffen und ich steh allein da.“
„Ich hab keine Ruhe, ich muss. Ich bin vorsichtig.“
Der Poldi gab ihm tatsächlich sein Fuhrwerk mit den zwei Pferden. Aber er musste ihm als Pfand seinen Kiosk überschreiben. Sie machten ein Schriftstück darüber, dann zog er los. Da stellte er bald fest: Auf der Hauptstraße durfte er sich nicht aufhalten; die war verstopft.
Mit den Tieren konnte er leicht auf den Feldwegen kutschieren und zudem den Weg abkürzen. Von fern sah er über die flachen Äcker hinweg das Höllenfeuer. Auch auf der Flur lagen Papiere herum, aber es wurden weniger, je näher er der Stadt kam. Weil die heiße Luft sie aus den zerstörten Amtsstuben hoch aufsteigen ließ, segelten sie erst nach einigen Kilometern zu Boden, dachte er bei sich. Er durfte die Pferde nicht scheuchen, sondern ließ sie vor sich hin traben. Weil der Ernst am Stadtrand wohnte, kam er an wenige Häuser vorbei, die brannten oder nur noch rauchten. Das Haus vom Ernst brannte zum Glück nicht und schien auch nicht beschädigt zu sein.
Eine große Erleichterung packte ihn da. Er konnte ohne Gefahr ins Haus gehen, weil auch die Eingangstür offenstand. Die Türglocke ging nicht, so klopfte er. Tatsächlich kam der Ernst heil heraus. Er glaubte an einen Geist, sagte er dann, als er den Onkel erkannte. Der freute sich so sehr, als er ihn am Leben sah, dass er ihn umarmen wollte, aber der Ernst stand stocksteif und sagte nur.
„Was suchst du denn da?“
Das nahm der Onkel ihm übel, aber er sagte nichts. Er ließ ihn dann eintreten. Er müsse noch einige Sachen verbrennen, dann könnten sie abhauen. Der Karl sollte sich inzwischen in die Küche setzen und etwas essen. Aber er protestierte:
„Hör mal Ernst, ich bin nicht auf Urlaub hier. Wir müssen Tempo machen, sonst kommen wir in Teufels Küche.
Ich muss vor Morgengrauen zurück sein, sonst laufen wir Gefahr, unser Fuhrwerk werde von den SS-Streifen beschlagnahmt. Die nehmen doch alles, was sie brauchen können. Und du könntest verhaftet werden. Ich nehme mal an, du hast keinen Urlaub und keinen Entlassungsschein. Stimmts?“
„Deshalb verbrenne ich gerade mein ganzes Gelump, die Uniform, Papiere, und so. Ich bin gleich fertig. Wir laden dann noch ein paar Sachen auf, Bettzeug, warme Kleidung und so, dann können wir los.“
Während der Ernst an seinem Feuer im Hof kokelte, lud der Onkel den Leiterwagen voll mit Bettsachen und was er sonst noch in die Hände bekam. Dann schrie er:
„Ernst, ich fahr jetzt los“, und setzte sich auf den Bock.
Der kam dann aus dem Haus gestürzt mit Sachen unterm Arm und mit seiner Gitarre und wollte nochmal zurück, die anderen Musikinstrumente zu holen. Aber der Karl fuhr rasch an und der Ernst musste schnell mit einem Satz auf den Kutscherbock aufspringen. Unterwegs einigten sie sich, dass Karl die Adele und die Rosalinde und den Peter mit zu sich nehme und der Ernst nur bis zum Garten mitfuhr und dann in die Wohnung zurückginge. Er werde sich um seine Arbeit kümmern, morgen am Montag; danach käme er zu ihnen. Er fragte noch, erzählte der Onkel weiter:
„Was machst du in der Wohnung. Da gibt es keinen Strom und kein Wasser?“
Und der Ernst antwortete kurz angebunden:
„Das lass mal meine Sorge sein.“
Wenigstens jetzt, wo er half, hätte der Ernst zugänglicher sein können; er hielt seine Hilfe wohl für selbstverständlich. Außerdem, warum musste er unbedingt noch schnell sein Gelump verbrennen, wenn er wieder zurückwollte und dann Zeit hatte, und warum hatte er nur die paar Lebensmittel aufgeladen, der Küchentisch war doch voll davon? Fragen über Fragen, sagte er, aber er wollte sich nicht den Kopf noch schwerer machen und sagte nichts zu ihm. So erzählte der Onkel Karl die Geschichte.
Peter wurde wachgerüttelt. Die Mutter beugte sich über ihn und sagte:
„Komm, Bub, der Onkel Karl ist da. Er fährt uns mit einem Pferdefuhrwerk zu sich. Da geht’s uns gut und ihr könnt in einem richtigen Bett schlafen.“
Die Rosalinde war auch wach und ächzte zwischen ihren Kissen und Decken. Der Vater war auch da und kommandierte wieder herum: Sie sollten Tempo machen. Sie müssten sich sputen.
Sie kletterten dann auf den Leiterwagen, ans hintere Ende, auf den Bretterboden; da war noch ein bisschen Platz. Der Wagen war voller Sachen. Aber Peter konnte nicht sehen, was da aufgeladen war, weil es noch dunkel war und weil er keine Lust hatte, sich groß umzusehen wegen der Müdigkeit und der Kälte. In der Stadt mit dem Feuer wars schön warm gewesen, auch im Gartenhäuschen mit den Kissen und Decken wars gemütlich. Die Mutter gab ihnen dann Decken; da wurde es wärmer und gepolstert waren sie auch. Das half ihnen gegen das Rumpeln und Holpern des Wagens. Die Mutter setzte sich zu ihnen in die Mitte und legte ihre Arme rechts und links um sie. Zu dritt lehnten sie sich an die Holzwand, die schräg war. So wurden sie nicht mehr hin und her geworfen und mussten keine Angst haben, sich blaue Flecken zu holen.
Die Rosalinde meckerte die ganze Zeit: Hier würde es stinken nach Pferdescheiße, die Bretter seien schmutzig, der Wagen werde gleich mit ihnen umkippen, sie müsse gleich kotzen und Pipi machen müsse sie schon längst.
Die Mutter sagte:
„Der Onkel muss sich furchtbar beeilen. Wir können nicht anhalten. Kind, du kannst auf den Bretterboden machen; dort in der Ecke sind Spalten, da tropft alles nach unten.
Die Rosalinde kreischte:
„Igittigitt, nie werde ich das machen, wo der Peter zuschauen kann; und dann stinkts noch mehr.“
„Der Peter schaut dir nicht zu. Das macht er nicht.“
„Ja! Mit seinen verschiedenen Augen glotzt er geradeaus und gleichzeitig um die Ecke.“
Da regte sich Peter nun doch auf, trotz seiner Müdigkeit:
„Ich habe keine verschiedenen Augen. Ich weiß schon längst, dass du keinen Schniedelwutz hast. Du kannst überhaupt nicht richtig Pipi machen.“
Die Mutter regte sich auch auf:
„Also Kinder, gestritten wird nicht! Seid froh, dass wir gerettet sind und bald in einem warmen Zimmer gemütlich uns einrichten können. Ihr solltet lieber eurem Schutzengel danken, anstatt euch zu beschimpfen.“
Sie machte dann mit der Decke über ihre Köpfe ein Dach, das vor ihren Gesichtern herunterhing. Da sahen und hörten sie wenig und Rosalinde roch auch nichts mehr, obwohl es nie gerochen hatte.
Das mit dem gemütlichen Einrichten in einem warmen Zimmer rückte in immer weitere Ferne. Peter hatte das Gefühl, diese wilde Fahrerei durch die Nacht werde nie zu Ende gehen, und zum Schluss werden alle Knochen in seinem Körper kreuz und quer durcheinander liegen. Er werde dann, wenn sie irgendwann mal ausstiegen, wie ein Sack voller Holzstöckchen zusammenklappen. Außerdem habe er keine verschiedenen Augen. Das eine Auge drehte sich nur manchmal weg auf die Seite. Daran war er nicht schuld. Die Mutter hatte gesagt, vielleicht habe er mal was Schreckliches gesehen; wenn das Tohuwabohu vorbei sei, würden sie das richten lassen.
Aber als sie endlich stehen blieben, begann das Tohuwabohu erst richtig. Der Vater war nicht mehr auf dem Kutscherbock! War er unterwegs heruntergefallen, und der Onkel hatte es bei seiner Sauserei nicht gemerkt? Der sagte zu ihnen, er müsse sofort weiter, das Fuhrwerk abgeben. Er werde nur noch schnell abladen; sie sollten inzwischen nach oben gehen. Oben rief die Tante Rosel an der Tür:
„Du lieber Himmel, was macht ihr denn hier!“
Sie trat zurück und schloss die Tür vor ihrer Nase. Doch bevor sie sich richtig erschrecken konnten, öffnete die Tante wieder und sagte, es täte ihr so leid, sie sei so erschrocken, sie sollten hereinkommen. Immer wieder fragte Peter die Mutter, schon auf der Treppe, wo der Vater sei, aber sie antwortete nicht, als ob sie ihn nicht hörte, bis er zur Tante schrie:
„Der Vater ist vom Kutscherbock gefallen und verschwunden.“
Die Tante schlug ihre Hände vor den Mund, als wollte sie einen Schrei ersticken. Aber die Mutter sagte:
„Unsinn! Er ist wieder in die Wohnung zurückgegangen. Er muss ja arbeiten und außerdem die Wohnung bewachen vor Einbrechern und Räubern. Jetzt treibt sich allerlei Gesindel herum, wo so viel Unordnung herrscht.“
Viel Unordnung herrschte auch bei ihnen. Bei Tante und Onkel blieben sie zwei Tag. Der Onkel erzählte dem Peter viel vom Krieg an der Front und von seiner Schussverletzung und zeigte ihm, wie er seine Prothese ans Knie schnallte. Die Tante schimpfte, der Onkel sollte ihm nicht vom Krieg erzählen, der arme Bub habe schon genug mitgemacht. Der Onkel protestierte, er würde nur Lustiges erzählen. Zum Beispiel, wie die Gulaschkanone explodierte und die Kameraden ringsum voll Soße und Fleischstückchen waren und sich ihr Essen vom Gesicht und von der Uniform abkratzen mussten. Entzündungen, wie der Onkel am Knie, hatte Peter keine, aber sein ganzer Körper war zerdrückt von der Rumpelfahrt. Die Mutter sagte, das gäbe sich wieder, er müsse tapfer sein, er sei jetzt der einzige Mann in der Familie. Von Tapferkeit hörte er immerzu die Leute reden. Es gab sogar Medaillen für Tapferkeit. Der Onkel zeigte ihm in einem Kästchen einen Orden, den er vom Führer bekommen hatte für Tapferkeit vor dem Feind.
Zwei Tage wohnten sie danach bei dem guten Freund des Onkels, der ihm das Fuhrwerk gegeben hatte. Dort hingen sie im Zimmer herum und hatten wenig Lust, zum Spielen nach draußen zu gehen. Der Onkel hatte zu ihnen gesagt, der Poldi, sein Freund, sei ein guter Mensch, aber der kümmerte sich nicht um sie. Der Onkel kam mit dem Fahrrad angeradelt und bracht ihnen Esssachen, die die Tante für sie eingepackt hatte. Bald würden sie ordentlich untergebracht sein, sagte er. Sie warteten nur auf einen Evakuierungsbescheid, wie die Mutter immer wieder sagte.
Danach waren sie in einer anderen Wohnung untergebracht in einem Zimmer, das aussah wie eine Rumpelkammer. Oder war das Zimmer bei dem Poldi eine Rumpelkammer und das andere Zimmer nicht? Peter, der sich immer schnell einrichten wollte, damit sich wenig veränderte, hatte bei diesem Hin und Her den Überblick verloren. Jedenfalls durften sie von dem neuen Zimmer aus nicht zum Spielen auf die Straße gehen. Die Mutter sagte, der Hausherr vertrüge kein Kindergeschrei; und weit weg vom Haus durften sie nicht gehen, weil sie vor dem Gesindel auf der Straße Angst hatte und vor den Bomberflugzeugen, die sie überfliegen könnten. Er musste jetzt nachts öfter schreien, weil das Gesindel sogar ins Zimmer kam, aber die Mutter, die mit ihnen schlief, hielt ihm den Mund zu oder sie krochen zusammen unter die Bettdecke. Die Rosalinde, die bei ihnen im Bett schlief, sagte nichts. Sie konnte ihn ja nicht hinausschmeißen, weil es nicht ihr Zimmer war. Manchmal kuschelten sie zu dritt unter der Bettdecke. Den Angeblichen hatte er fast vergessen. Einmal sagte die Mutter, er könne nicht kommen, er müsse erst sein Motorrad herrichten und sich auch um den Evakuierungsbescheid kümmern. Woher sie das wusste, hatte er vergessen zu fragen, denn sie sagte einmal, die Verbindung zur Stadt sei unterbrochen. Er vermisste ihn nicht. Eigentlich vermisste er niemanden, nicht einmal die Tante Rosel, die seine Lieblingstante war. Auch die Freunde vom Hof vermisste er nicht. Die Schwester sagte zu ihm, sie vermisse alles. Das hier sei ein Zigeunerleben; das sei ihr zu lumpig und ihrer nicht angemessen.
Eines Tages hielt ein Auto vorm Haus; das war ungewöhnlich. Sie liefen vor die Tür. Das sei ein Geschäftsfahrzeug, ein Kleintransporter, sagte Rosalinde, aber eine echte Rostlaube. Zum Glück sagte sie das leise zu ihm, sodass der Angebliche, der aus dem Führerhaus stieg, es nicht hören konnte. Er tat so, als würde er sich riesig freuen und polterte überall herum und fing gleich das Kommandieren an. Sie mussten sich beeilen und ihre Sachen in den Kleintransporter laden. Mittlerweile setzte er sich wieder an das Steuer. Sie befürchteten, er werde ohne sie davonfahren. Doch die Mutter kam noch angerannt und schwenkte einen Zettel in der Luft und sagte:
„Kinder, der Vater hat einen Evakuierungsbescheid mitgebracht. Wir werden in einen Bauernhof einquartiert.
Jetzt wird alles gut.“
Sie lief wieder weg, aber kam bepackt mit Sachen zurück, und verstaute sie hinten in den Kleintransporter und lief noch einmal weg und kam wieder mit Sachen, die sie in den Laderaum warf. Dann setzte sie sich vor zum Vater, der nörgelte, warum das alles so lange dauere. Die Kinder setzten sich auf den Rücksitz. Das war eine breite Polsterbank mit Rissen und Löchern auf der Sitzfläche. In dem Blechgehäuse roch es nach Benzin, aber die Schwester meckerte nicht wieder über den Gestank. Sie fuhren durch ein schönes Wetterchen, wie der Angebervater sagte, auf einer kurvigen Straße, zwischen Äckern, die braun waren von der umgepflügten Erde und grün vom Winterweizen, wie die Mutter erklärte. Sie kannte sich aus, weil sie auf einem Bauernhof groß geworden war. Auf manchen Feldern stand ein Traktor oder fuhr hin und her. Auch Pferde sahen sie herumstehen. Die Mutter sang vorn auf dem Beifahrersitz:
„Im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt. Er setzt seine Wiesen und Felder instand.“
Sie sollten mitsingen, aber sie kannten die Worte nicht.
So sang die Mutter immerzu, bis sie auch mitsingen konnten. Sie war ganz lustig; so hatte er sie schon lang nicht mehr gesehen.
Peter fragte die Schwester, was der Bauer mit den eingespannten Rosen macht. Sie war ja immer so schlau.
„Bist du doof! Das heißt nicht Rosen, sondern Rosse.
Das sind Pferde, die der Bauer Rosse nennt, Rösslein sind kleine Pferde. Die Bauern haben eine eigene Sprache, mit der sie sich verständigen. Wenn wir jetzt bei Bauern wohnen werden, müssen wir ihre Sprache lernen.“
„Müssen wir dazu in die Schule gehen?“
„Nein, die Mutter ist ja auch ein junges Bauernmädchen gewesen. Sie kann uns helfen.“
„Was sagt der Bauer, wenn er Hunger hat?“
„Weißt du, der Bauer bemüht sich dumm zu sein. Denn es heißt: Der dümmste Bauer hat die größten Kartoffeln.“
„Was du alles weißt!“
„Du musst mich nur fragen. Ich sag dir alles.“
Ihre Unterhaltung hätte sich vertieft, wenn Peter nicht ein Flugzeug mitten auf einem Feld gesehen hätte. Er schrie vor Staunen auf. Erst glaubte er, es sei dort gelandet, aber dann sah er, dass ein Flügel tief in der Erde steckte und das Blech ganz schwarz war, als hätte es gebrannt. Mit Brennen kannte er sich aus. Der Vater fuhr langsam näher und wollte anhalten, aber die Mutter sagte, das möchte sie nicht sehen; sie habe genug davon. Dann sagte sie schnell:
„Kinder, schaut mal die lange Reihe von Obstbäumen.
Sie schlagen schon aus. Im Sommer könnt ihr da Kirschen und Zwetschgen und Birnen und Äpfel essen, so viel ihr wollt.“
Peter sagte:
„Könnte ich jetzt schon was essen? Ich habe argen Hunger.“
„Halte noch ein bisschen aus. Wir sind bald bei dem Bauer auf dem Gutshof. Da wird er uns ein schönes Mahl auftischen.“
Später war vor ihnen ein Pferdefuhrwerk. Hinten im Planwagen saß eine Familie und winkte ihnen zu und rief etwas, was sie nicht verstehen konnten. Der Vater versuchte immer wieder zu überholen, was er nicht konnte, weil die Straße so kurvig war. Er sagte:
„Das ist eine scheiß kurvige Fahrerei hier. Ich müsste schon längst zurück sein“, und hätte ihnen fast die lustige Stimmung verdorben. Aber die Mutter kurbelte ihr Fenster herunter und streckte ihren Arm weit hinaus und winkte. Da riefen die auf dem Wagen durcheinander und lachten, aber Peter konnte sie nicht verstehen und dachte, da müsse er viel Bäurisch lernen.
Im Dorf angekommen, fragte die Mutter nach dem Hof des Herrn Adelmann. Sie bräuchten nur die Straße weiterfahren. Auf der rechten Seite würden sie ein grünes Hoftor sehen, dort seien die Adelmanns. Sie fuhren eine holprige, schmale Straße ohne Gehsteig entlang. Rechts und links drückten sich kleine Häuser eng zusammen, mit Türen und Toren in dunklen Farben. Auch an einem dunkelgrünen Tor fuhren sie vorbei, aber daneben stand nur ein kleines, buckliges Häuschen, das nicht ihr Gutshof sein konnte. Bald endete die Straße an einem Feldweg, der in eine Wiese hineinführte und zwischen Bäumen verschwand. Das Auto schepperte und knarzte, als der Vater wendete und die Straße zurückfuhr und immer wieder sagte:
„So eine Scheiße, so eine Scheiße!“
Er hielt dann doch vor dem grünen Tor und stieg aus und klopfte an das Holz, nein, haute mit der Faust darauf, bis es von innen aufgemacht wurde. Nein, bis rechts neben dem Tor eine kleine Pforte, die sie übersehen hatten, aufging und ein Mann breitbeinig im Rahmen erschien. Sie redeten miteinander, der Vater zeigte ihm einen Zettel und der Mann kam mit dem Vater zu ihnen ans Auto und sagte:
„So, so, unsere Flüchtlinge. Dann kommt mal schön mit.“
Peter dachte, der Mann schaut aus, als habe er hinter dem Tor einen großen Gutshof versteckt.
Sie stiegen alle aus dem Wagen. Der Mann gab jedem von ihnen die Hand. Der Vater nannte ihre Namen. Als er an die Reihe kam, sagte der Vater:
„Das ist der Peter. Stell dich gerade auf und zeig dem Herrn Adelmann, was für ein ordentlicher Bursche du bist.“
Peter, der sich vom langen Sitzen auf der kaputten Lederbank ganz krumm fühlte, richtete sich auf, verlagerte sein Körpergewicht etwas auf die Fußballen, um einen zackigen Hacken mit den Absätzen zu schlagen, so wie ihm das der Angebervater hunderte Male gezeigt und mit ihm eingeübt hatte. Doch er kippte nach vorn und fiel in die Arme des Herrn Adelmann, der blitzschnell reagierte und ihn auffing. Er rettete ihn vor einem Sturz auf den Boden und vor dem Geschrei des Angeblichen, der nämlich rot im Gesicht anlief und schon den Mund aufriss, aber ihn wieder zumachte, weil der Herr Adelmann lachte und sagte:
„Hoppla, ein stürmischer Junge. Das gefällt mir. Dich kann ich hier gut gebrauchen.“
Dann ließ er ihn los, drehte sich um und ging über die Straße zur Pforte, während er zum Vater sagte, er werde ihm das Tor aufmachen, dann könnte er in den Hof fahren. So machten sie es: Der Vater stieg ins Auto und steuerte es zum Tor und sie gingen durch die Pforte in den Hof. Dahinter sah er keinen prächtigen Gutshof, wie erwartet , sondern eine Jauchegrube, einen Misthaufen und dahinter eine Scheune mit einem hohen, dunklen Brettertor. Der Vater steuerte das Auto bis knapp vor die Grube; wäre er rechts ausgestiegen, wäre er in die Jauche gefallen. Gleich neben der Grube war der Hauseingang.
Der Bauer ging voran und führte sie in einen langen Hausflur und dann zu einer steilen Treppe und stieg, ohne ein Wort zu sagen, die Stufen nach oben. Zum Glück hatten sie ihre Sachen im Auto gelassen. So konnten sie ihm leicht folgen. Oben waren das Dach und ein riesiger Sandhaufen mitten auf dem Boden, Nein, als Peter näherkam, wunderte er sich, es war kein Sand, es waren Körner. Am Ende des langen Dachs sah er eine Wand mit einer Tür. Der Bauer öffnete sie und sagte:
„So, das ist euere Bleibe. Es soll ja nur für kurze Zeit sein, hat der Bürgermeister gesagt.“
Dann ging er weg. Der Vater sagte, er werde die Sachen aus dem Auto holen; er, Peter, solle mithelfen.
„Ernstl, lass den Bub, der ist müde und die Treppe ist so steil, da stürzt er uns noch mit den Sachen hinunter.“
„Ach was! Der muss lernen sich anzustrengen. So eine Blamage, wie vorhin bei dem Adelmann, darf nicht wieder passieren. Komm jetzt!“
„Mann, sei vernünftig! Der Peter kann mir auch hier oben im Zimmer helfen.“
Der Ernstl sagte nichts und ging davon. Nach langer Zeit kam er bepackt zurück und sagte, er habe mit dem Bauern gesprochen. Jetzt müsse er sofort los, weil er noch vor Einbruch der Dämmerung zurück sein müsste. Die Stadt würde dann abgeriegelt werden. Er käme morgen oder übermorgen mit den Möbeln wieder.
Jetzt erst bemerkte Peter, dass im Zimmer keine Möbel waren; nur vier Matratzen lagen auf dem Boden und ein Tisch war da mit Stühlen und in der Ecke, in einem Schacht, eine kleine Küche. Sie setzten sich auf die Stühle und warteten darauf, dass jemand käme und sie zum Essen führte. Dann mussten sie alle, aber sie suchten vergeblich eine Toilette, auch auf dem Dachboden. Da war nur der Riesenhaufen von Körnern und eine alte Kommode und im Hintergrund ein bisschen Gerümpel.
Die Rosalinde quietschte schon und quetschte ihre Beine zusammen. Da stiegen sie die Treppe hinunter in den langen Flur. Die Mutter klopfte an eine Tür. Sie musste lang klopfen, bis die Tür aufgemacht wurde und eine alte, schwarze Frau, nein, eine echte Hexe herauskam. Peter hatte Angst, auch Rosalinde vergaß ihr Quietschen. Nur die Mutter verstand, was sie sagte. Sie mussten aus dem Haus gehen, an der Jauchegrube vorbei - Rosalinde sagte immerzu „Igittigitt“ - zu einem Holzhäuschen mit einem Plumpsklo. Das stank nicht so stark, wie die Jauche. Peter fand das lustig, vor allem das Herz, das wie ein Loch in der Tür war. Nachdem sie ihr Geschäft erledigt hatten, gingen sie wieder nach oben in ihr Zimmer und setzten sich auf die Stühle. Auf dem Rückweg hatten sie niemanden gesehen.
Die Mutter erzählte ihnen, dass früher die alten Römer Plumpsklos hatten, auf die sich mehrere Menschen gleichzeitig setzten und sich unterhielten und wichtige Geschäfte erledigten, deshalb hieße es heute immer noch: ein Geschäft machen. Aber sie hatten so großen Hunger, dass sie das im Moment nicht so interessierte. Wieder war es Rosalinde, die das Meckern anfing, wann endlich das schöne Mahl aufgetischt werde, von dem die Mutter gesprochen habe. Und überhaupt würde ihr dieses Plumpsklo Haus nicht gefallen. Hier würde alles stinken und eine Hexe wohnen. Sie hatte gedacht, sie kämen in einen Gutshof, nicht in dieses Zimmerloch ohne Klo und Fenster, nur dieses Fensterloch da drüben in dem Küchenloch. Sie wolle in einem Gutshof sein, wo die Menschen schön angezogen seien und vor der Türe die Reitpferde stünden, mit denen alle dann spazieren ritten, und das Personal inzwischen kochte und die Zimmer schön machte und warm und den Kamin anzündete. Wenn sie dann von ihrem Ausritt zurückkämen, würden ihnen Getränke kredenzt werden in Kristallgläsern mit Goldrändern, und der Gutsherr würde eine Ansprache halten, dass alle willkommen seien, und nicht wie dieser Bauer hier, der einfach verschwindet und sie warten lässt. Noch bevor die Mutter etwas antworten konnte, fragte Peter:
„Mutti, warum gehen wir nicht lieber in unsere Wohnung zurück?“
„Weil wir nicht können. In der Stadt darf keiner wohnen. Da gibt es kein Leitungswasser, kein Licht, keine Geschäfte, nichts, nur Schutt und Asche und tote Menschen. Wir können froh und glücklich sein, dass wir hier sind.“
„Aber warum kann der An… äh Vater dort wohnen?“
„Weil er arbeiten muss und in der Firma versorgt wird.
Er hilft mit, dass in der Stadt wieder Strom fließt.“
„Aber, gibt es in unserem Haus auch Schutt und Asche und tote Menschen?“
„Nein, unser Haus ist als einziges stehen geblieben.“
„Aber dann könnten wir doch dort wohnen.“
„Nein, Bub, wie oft soll ich das noch sagen: Wir dürfen nicht. Das ist verboten! Wir wurden evakuiert.“
„Warum hat dann der Herr Adelmann zu uns gesagt:
So, so, unsere Flüchtlinge?“
„Wir sind keine Flüchtlinge. Wir sind Evakuierte.“
„Müssen Evakuierte immer in einem Loch wohnen?“
„Nein, wir richten es uns hier schön ein. Jetzt schau ich mal, wie´s mit dem Essen steht.“
Die Mutter stand auf und ging hinunter und kam nach kurzer Zeit zurück mit einem roten Kopf und kramte in ihrer Einkaufstasche und holte das Portemonnaie heraus und ging wieder. Nach langer Zeit kam sie zurück mit ihrer vollen Einkaufstasche und sagte:
„Diese Halsabschneider! Ich muss sagen, diese Halsabschneiderin. Die verlangt einen Haufen Geld für die paar Sachen, aber jetzt können wir uns was Feines kochen.
Wir bereiten uns selbst ein schönes Mahl. Rosalinde, du darfst mir helfen, und Peter deckt den Tisch.“
Rosalinde nörgelte weiter in der Küchenecke: das sei alles ein Gelump hier, kein Topf und kein Teller sei schön, das Besteck nur Blech. Sie reichte dem Peter das Geschirr und Besteck für den Tisch. Ein Tischtuch gäbe es auch nicht und keine Gläser, nur diese verbeulten Blechnäpfe.
Dann sagte die Mutter zu ihr, sie solle die Kartoffeln schälen, und sie werde das Gemüse schneiden. Da war die Schwester beschäftigt und gab Ruhe.
„Kinder, wir müssen mit dem, was wir hier haben, zurechtkommen und zufrieden sein“, sagte die Mutter.
Es gäbe nur eine Kochplatte für zwei Töpfe, damit müssten sie auskommen. Während die beiden in der Küche hantierten und klapperten, deckte Peter den Tisch. Viel Arbeit hatte er nicht. Die drei grauen Blechteller, das graue Blechbesteck und die Blechnäpfe, die innen weiß waren, hatte er schnell auf die braune Holztischplatte zurechtgestellt. In ihrer Wohnung hatten sie eine weiße Tischplatte mit bunten Servietten und einer Tischdecke.
Aber er vermisste diese feinen Sachen nicht, obwohl er keine Veränderung mochte, aber hier war jetzt ein warmes, reichliches Essen wichtiger. Das rief er auch zur Schwester in das Küchenloch, es sei wichtiger, viel zum Essen zu haben, als ein schönes Geschirr. Sie antwortete mit ihrer alten Leier, in einem Gutshof gäbe es viel gutes Essen in edlem Geschirr und Kristallgläser und sogar Kerzenleuchter auf dem Tisch. Die Mutter stoppte ihr Geleier und schickte sie hinunter, sie solle um etwas Salz bitten, das habe sie vergessen. Die Schwester jammerte, wenn die Hexe herauskäme, was sie machen sollte. Sie gäbe ihr fünf Pfennige mit, da solle sie sagen, sie würde bezahlen. Und im Übrigen gäbe es keine Hexen. Das sei nur eine sehr alte Frau. Auf dem Land zögen sich die alten Frauen gern schwarz an. Das sei auch bei ihnen, in ihrer Kindheit, so gewesen.
Die Schwester kam ohne Salz zurück und erzählte, die andere Frau habe gesagt, sie seien kein Krämerladen, sie müsse zum Kolonialwarenladen am Rathaus gehen. Es gehe auch ohne Salz, sagte die Mutter und stellte eine Schüssel mit gekochten Kartoffeln in die Mitte des Tisches und einen Topf mit Gemüse und eine Birne und einen Apfel auf einem Teller. In die Näpfe goss sie Wasser aus einer Kanne. Kaum hatte sie das Essen in ihre Teller verteilt, beschwerte sich die Schwester, sie habe weniger als der Peter bekommen. Der sagte:
„Ich brauche mehr, weil ich noch viel mehr wachsen muss als du. Du brauchst nur Essen für deine dürren Beine.“
Die Mutter sagte:
„Kinder, es ist für alle viel Essen da. Es ist einfach, aber viel. Ihr könnt so viel essen, bis ihr platzt.“
Das taten sie dann auch. Nein, sie platzten nicht, sondern aßen viel, bis ihnen ganz warm wurde. Zum Schluss bekam jeder einen Schnitz vom Apfel und der Birne. Die Mutter erzählte, das Obst baue der Bauer an. Sie habe zwei große Weidenkörbe davon gesehen, die in der Wohnzimmerecke stünden. Aber seine Frau wollte ihr nicht mehr abgeben.
Dann konnten sie kaum noch die Sachen auf dem Tisch erkennen, so dämmrig war es inzwischen geworden.
Durch das Fenster im Küchenloch schien dann der Mond herein; zunehmend sei er, meinte Rosalinde, die ja alles wusste. Als die Mutter die Deckenlampe über dem Tisch anmachte, verschwand der Mond an der schwarzen Fensterscheibe; dafür tauchte die Lampe ihren Tischplatz in einen gelben, gemütlichen Lichtkegel. Peter legte die Arme auf den Tisch und seinen schweren Kopf obenauf.
Die Schwester machte es ihm nach. Die Mutter sagte:
„Wir sind alle rechtschaffen müde. Es war ein langer, anstrengender Tag, all das Neue. Ich räume nur noch den Tisch ab. Spülen werden wir morgen. Waschen braucht ihr euch heute ausnahmsweise nicht. Wir gehen gleich ins Bett.“
Das war erstaunlich! Die Schwester stand unaufgefordert auf und half, die Sachen in das Küchenloch zu tragen.
Dann legten sie drei Matratzen eng aneinander an die Wandseite, bezogen sie mit den weißen Laken und legten die Kopfkissen und die Decken darüber. Ihre Kleidung hingen sie über die Stühle am Tisch. Dann löschte die Mutter die Deckenlampe; der Mond schien wieder durchs Fenster und spendete ihnen Licht, so konnten sie ihre Liegen erkennen. Die Mutter legte sich auf die Matratze in die Mitte und die Kinder rechts und links von ihr. Sie sagte:
„Heute beten wir im Liegen: Lieber Gott, wir danken dir“… mehr konnte Peter nicht hören, weil er einschlief.
In der Nacht wachte er auf; ihm war kalt. Das Zimmer war stockdunkel. Er fühlte die Mutter neben sich liegen und schlüpfte zu ihr unter die Decke. Sie schien nicht zu schlafen, oder er hatte sie aufgeweckt, denn sie drückte ihn fest an sich. Er fragte sie leise:
„Mutti, warum ist immer alles anders?“
Sie flüsterte:
„Das ist nur außenherum so. Wir haben uns lieb. Das ändert sich nicht. Das bleibt immer so.“
Er wollte noch darüber nachdenken, aber an ihren warmen Leib gedrückt, schlief er ein.
Als er die Augen aufmachte, war es hell im Zimmer.
Die Mutter war nicht mehr im Bett, und von der Schwester sah er nur die Haare auf dem Kopfkissen liegen. Sein Gesicht war wie eingefroren und seine Nase tropfte kalt.
Vom Küchenloch her kamen Geräusche. Als er den Kopf etwas anhob, sah er die Mutter dort hantieren. Sie schien zu spüren, dass er sich bewegte, obwohl sie nicht zu ihm geschaut hatte:
„Auf, ihr Schlafmützen, die Sonne scheint. Wir machen uns heute einen schönen Tag.“
Da klopfte es an die Tür und hereintrat der Herr Adelmann mit einer Menge von Holzstücke auf den Armen.
Peter versteckte sich sofort unter der Bettdecke. So früh wollte er mit einem fremden Menschen nichts zu tun haben. Als er wieder hervorkroch, war der Bauer weg und in der Küche lag ein Berg Holzscheite und daneben stand ein Weidenkorb mit Ästen und Zweigen. Die Mutter sagte, er solle sofort aufstehen und Feuer machen. Sie werde ihm zeigen, wie das geht. Das versprach ein großer Spaß zu werden. Rasch zog er sich an. Für die Morgenwäsche war keine Zeit. Zur Mutter sagte er, die Rosalinde sollten sie schlafen lassen und mit der Wärme überraschen; die Mädchen seien eh so verfroren. Damit erhöhte er die Wichtigkeit seiner Arbeit. In dem weißen Küchenherd machte er Feuer, wie ihm die Mutter das zeigte. Es war nicht schwer, Papier hatte der Herr Adelmann auch mitgebracht. So loderten schnell die Flammen auf und die Zweige und Äste brannten. Gespannt beobachtete er, wie das Feuer an den hellen Holzscheiten leckte. Kurz fiel ihm das Höllenfeuer von der Schokoladenfabrik ein.
Da fühlte er die Wärme im Zimmer aufsteigen, sie beide, denn die Mutter lobte ihn, jetzt werde es gemütlich werden. Nun bequemte sich die Schwester aufzustehen. Sie reckte und streckte sich in der Wärme. Als die Mutter ihr sagte, das sei das Feuer vom Peter, antwortete sie, sie hätte das auch gemacht, aber sie wäre ja nicht geweckt worden. Die Mutter zeigte ihr eine kleine Tüte und sagte, sie solle mal nachschauen, das habe der Herr Adelmann für sie mitgebracht. Jetzt war sie hellwach. Aber als sie aufgeregt in die Tüte schaute, machte sie ein langes Gesicht und sagte, das sei Zucker oder Salz, was sie damit machen solle. Die Mutter erklärte es ihr:
„Der Herr Adelmann hätte es dir gern selbst gegeben als Wiedergutmachung, weil sie dir gestern nichts mitgegeben haben. Seine Frau sei so nervös gewesen, weil sie es nicht gewohnt sei, fremde Menschen im Haus zu haben. Auch seine alte Mutter sei sehr nervös. Die Kinder sollten Rücksicht nehmen; nicht laut sein und nicht herumrennen.“
Dann sagte sie noch:
„Nach dem Frühstück gehen wir aus. Wir schauen uns das Dorf an, gehen ins Rathaus, wegen der Anmeldung für die Schule und kaufen ein. Dann setzen wir uns ins Wirtshaus und trinken etwas. Wir müssen doch unsere Ankunft hier im Dorf feiern.“
Da wurden sie nervös und nahmen sich kaum Zeit zum Frühstücken. Endlich waren die Frauen angezogen. Die Mutter hatte ihre Pelzjacke vom Luftschutzkeller an und einen lustigen Rock und die Schwester hatte eine dicke Strumpfhose und ihr schönstes Kleid und eine Strickweste übergezogen. Schön sahen sie aus, dachte Peter, so als gingen sie an einem Sonntag im Stadtpark spazieren.
Leise schlichen sie die Treppe hinunter und aus dem Haus. Nur die Hoftür quietschte beim Öffnen und Schließen, aber da waren sie schon auf der Straße. Die Richtung kannten sie von ihrer Autofahrt: Rechts ging es zu den Bäumen, links ins Zentrum. Die Straße war holprig gepflastert. Sie schauten auf die Häuschen mit den Hoftoren, die alle geschlossen waren. Ruinen sahen sie keine.
Peter fragte, ob es hier auch Krieg gegeben habe, aber die beiden Frauen redeten miteinander. Sie gaben ihm keine Antwort. Die Rosalinde sagte dann, hier würde es nach Scheiße stinken. Das Plumpsklo Haus, die Straße und wahrscheinlich auch die Leute würden nach Scheiße stinken. Bald werde sie auch stinken. Dann könne sie nie mehr in die Stadt zurück. Ihre Freundinnen würden sich die Nase zuhalten, wenn sie ankäme. Der Gedanke, er werde auch stinken, störte Peter nicht. Nur nicht mehr in die Stadt zurückzukehren, das traf ihn schwer. Die Mutter schimpfte, sie solle nicht immer Scheiße sagen, denn das sei Mist vom Vieh und sehr wertvoll für die Felder.
Die Straße - das sei keine Straße, sondern eine Gasse, sagte die gescheite Rosalinde - also die Gasse herauf kam eine Frau, auch schwarz angezogen, mit einem Rucksack auf dem Buckel. Sie sollten ordentlich grüßen, wenn sie an ihnen vorbeiginge, sagte die Mutter. Das taten sie auch, aber die Frau schaute sie böse an und ging weiter, ohne ein Wort zu sagen. Vielleicht sei die Arme taubstumm, meinte die Mutter. Nicht lange gingen sie, da standen sie schon auf dem Rathausplatz. Sie sollten warten, während die Mutter ins Rathaus ging. Sie musste eine hohe, steile Treppe hinaufsteigen und verschwand hinter einem großen Holzportal.
Die Treppe ging hoch zum Eingang und auf der anderen Seite hinunter. So liefen sie eine Runde nach der anderen, hoch, hinunter und herum.
„He, ihr da! Das dürft ihr nicht machen. Das ist unser Rathaus.“
Erschrocken blieben sie mitten auf der Eingangstreppe stehen und drehten sich um. Am Fuß der Treppe standen drei Buben, die aussahen wie kleine Bauern, breitbeinig, die Hände in den Hosentaschen.
„Kommt sofort da runter. Ihr seid doch die Flüchtlinge.
Ihr habt hier nichts verloren. Haut ab!“
Die anderen zwei, neben ihm, sagten nur immerzu: Ja, Ja.
Die Schwester flüsterte zum Peter, sie dürften die nicht provozieren. Sie sollten am besten freundlich zu ihnen sein. So kamen sie die Treppe herunter und stellten sich in die Nähe der drei.
„Wir haben euch nichts getan. Wir sind keine Flüchtlinge. Wir sind Evakuierte.“