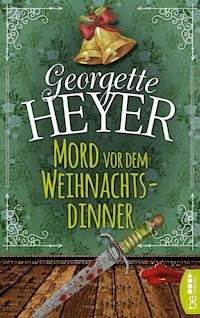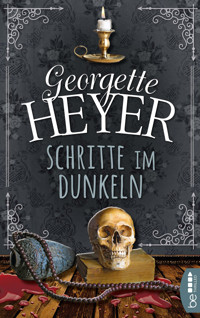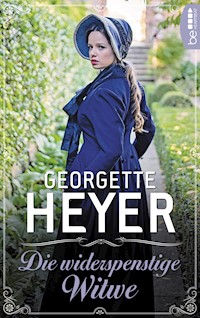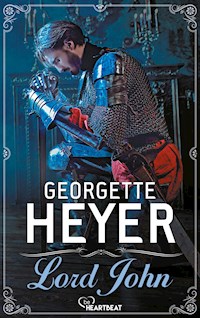Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: AUDIOBUCH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Liebe, Gerüchte und Skandale - Die unvergesslichen Regency Liebesromane von Georgette
- Sprache: Deutsch
Yorkshire, 1818: Venetia Lanyon war noch nie verliebt. Und mit fünfundzwanzig glaubt sie nicht mehr daran, einen Mann zu treffen, der ihr Herz erobert. Doch dann begegnet sie Lord Damerel - auch "der Verruchte Baron" genannt -, über den in der Grafschaft die schlimmsten Gerüchte kursieren. Venetia ist fasziniert von dem charmanten Lebemann, der ihren Humor zu schätzen weiß und mit dem sie wundervolle Gespräche führen kann.
Bald schon verbindet das ungleiche Paar eine tiefe Freundschaft. Doch die feine Gesellschaft ist empört, und alle Nachbarn und Verwandten versuchen, das unschuldige Mädchen aus den Klauen des Wüstlings zu befreien. Auch Damerel möchte Venetias Ruf nicht ruinieren und wendet sich von ihr ab. Aber so einfach lässt Venetia sich nicht abweisen und ersinnt eine List, um den Lord zum gemeinsamen Glück zu zwingen ...
"Venetia und der Wüstling" ist einer der humorvollsten Regency Romane von Georgette Heyer, der seine Leser mit fein geschliffenem Wortwitz und entzückend verschrobenen Charakteren in seinen Bann zieht. Jetzt als eBook bei beHEARTBEAT.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
1. KAPITEL
2. KAPITEL
3. KAPITEL
4. KAPITEL
5. KAPITEL
6. KAPITEL
7. KAPITEL
8. KAPITEL
9. KAPITEL
10. KAPITEL
11. KAPITEL
12. KAPITEL
13. KAPITEL
14. KAPITEL
15. KAPITEL
16. KAPITEL
17. KAPITEL
18. KAPITEL
19. KAPITEL
20. KAPITEL
21. KAPITEL
Über dieses Buch
Yorkshire, 1818: Venetia Lanyon war noch nie verliebt. Und mit fünfundzwanzig glaubt sie nicht mehr daran, einen Mann zu treffen, der ihr Herz erobert. Doch dann begegnet sie Lord Damerel – auch „der Verruchte Baron“ genannt –, über den in der Grafschaft die schlimmsten Gerüchte kursieren. Venetia ist fasziniert von dem charmanten Lebemann, der ihren Humor zu schätzen weiß und mit dem sie wundervolle Gespräche führen kann.
Bald schon verbindet das ungleiche Paar eine tiefe Freundschaft. Doch die feine Gesellschaft ist empört, und alle Nachbarn und Verwandten versuchen, das unschuldige Mädchen aus den Klauen des Wüstlings zu befreien. Auch Damerel möchte Venetias Ruf nicht ruinieren und wendet sich von ihr ab. Aber so einfach lässt Venetia sich nicht abweisen und ersinnt eine List, um den Lord zum gemeinsamen Glück zu zwingen …
Über die Autorin
Georgette Heyer, geboren am 16. August 1902, schrieb mit siebzehn Jahren ihren ersten Roman, der zwei Jahre später veröffentlicht wurde. Seit dieser Zeit hat sie eine lange Reihe charmant unterhaltender Bücher verfasst, die weit über die Grenzen Englands hinaus Widerhall fanden. Sie starb am 5. Juli 1974 in London.
Georgette Heyer
Venetia und der Wüstling
Aus dem Englischen von Emi Ehm
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Copyright © Georgette Heyer, 1958
Die Originalausgabe VENETIA erschien 1958 bei William Heinemann.
Copyright der deutschen Erstausgabe:
© Paul Zsolnay Verlag GmbH, Hamburg/Wien, 1962.
Textredaktion: Lena Madl
Lektorat/Projektmanagement: Kathrin Kummer
Umschlaggestaltung: Maria Seidel, atelier-seidel.de unter Verwendung einer Illustration © Richard Jenkins Photography, London
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Ochsenfurt
ISBN 978-3-7325-3178-3
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
1. KAPITEL
„Heute Nacht ist ein Fuchs unter die Hennen geraten und hat eine unserer besten Legerinnen entführt“, bemerkte Miss Lanyon. „Noch dazu eine Urgroßmutter! Er sollte sich wirklich schämen!“ Da sie keine Antwort bekam, fuhr sie mit veränderter Stimme fort: „Ja, wirklich! Das ist zu schlimm. Was sollen wir jetzt tun?“
Ihr Gefährte wurde aufmerksam, hob die Augen von dem Buch, das offen neben ihm auf dem Tisch lag, und schaute sie, etwas geistesabwesend, fragend an. „Was soll das? Hast du etwas zu mir gesagt, Venetia?“
„Ja, Liebling“, antwortete seine Schwester heiter, „aber es war ganz und gar unwichtig, und ich habe auf alle Fälle gleich für dich geantwortet. Du würdest wirklich staunen, wenn du wüsstest, was für interessante Gespräche ich mit mir führe und wie ich sie genieße.“
„Ich habe gelesen.“
„Stimmt – und deinen Kaffee kalt werden lassen, abgesehen davon, dass du das Butterbrot nicht fertiggegessen hast. So iss es doch auf! Ich glaube wirklich, ich sollte dir nicht erlauben, bei Tisch zu lesen.“
„Och, ohnehin nur am Frühstückstisch!“, sagte er verächtlich. „Probier’s, ob du mich davon abhalten kannst!“
„Natürlich kann ich das nicht. Was ist es eigentlich?“, gab sie zurück und schaute den Band an. „Ach, Griechisch! Zweifellos irgendeine erbauliche Geschichte.“
„Die ‚Medea‘“, sagte er zurückhaltend. „In der Ausgabe von Porson, die mir Mr. Appersett geliehen hat.“
„Und ob ich die kenne! Sie war doch dieses bezaubernde Geschöpf, das ihren Bruder zerschnippelt und die Stücke ihrem Papa vor die Füße geworfen hat, nicht? Sicher eine absolut liebenswürdige Person, wenn man sie erst näher kennt.“
Er zuckte ungeduldig die Achsel und antwortete wegwerfend: „Das verstehst du nicht, und es ist pure Zeitverschwendung, dir das zu erklären.“
Sie zwinkerte ihm zu. „Aber ich versichere dir, ich verstehe sie! Ja, bin ganz auf ihrer Seite, abgesehen davon, dass ich mir wünsche, ich besäße ihre Entschlossenheit! Obwohl ich glaube, ich hätte deine Überreste fein säuberlich im Garten vergraben, mein Lieber!“
Diese ausfallende Bemerkung entlockte ihm ein Grinsen. Aber er sagte bloß, bevor er sich wieder seinem Buch zuwandte, ein solcher Befehl an sie wäre bestimmt die einzige Aufmerksamkeit gewesen, die ihre Eltern der Sache gewidmet hätten.
Gegen seine Gewohnheiten abgehärtet, versuchte es seine Schwester nicht weiter, seine Aufmerksamkeit zu fesseln. Das Butterbrot – alles, was er an diesem Morgen zu essen gewillt war – lag zur Hälfte aufgegessen auf seinem Teller, aber ihn weiter zu ermahnen wäre Zeitverschwendung gewesen. Und hätte sie es gewagt, sich zu erkundigen, wie er sich heute Morgen fühle, hätte sie ihn doch nur aufgebracht.
Er war ein magerer Junge, ziemlich klein für sein Alter, keineswegs unhübsch, aber mit einem Gesicht, das über seine Jahre hinaus scharf und von Linien durchzogen war. Einem Fremden wäre es schwergefallen, sein Alter zu schätzen, da die Unreife seines Körpers in seltsamem Gegensatz zu seinem Gesicht und seinem Benehmen stand. Tatsächlich war er erst vor Kurzem siebzehn geworden, aber körperliches Leiden hatte die Linien in sein Gesicht gegraben. Auch der Umgang ausschließlich mit Menschen, die älter waren als er, gepaart mit einem Intellekt, der zu Gelehrsamkeit neigte und sehr ausgeprägt war, hatte ihn frühreif gemacht.
Eine Erkrankung des Hüftgelenks hatte ihn von Eton ferngehalten, wo sein Bruder Conway, um sechs Jahre älter als er, erzogen worden war. Diese, und – oder, wie seine Schwester manchmal dachte, die verschiedenen Behandlungen seiner Krankheit, die er hatte durchmachen müssen – hatte dazu geführt, dass eines seiner Beine kürzer war. Er konnte nur mit einem sehr deutlich merkbaren und hässlichen Hinken gehen; und obwohl die Krankheit angeblich zum Stillstand gebracht worden war, schmerzte ihn das Gelenk bei ungünstigem Wetter oder wenn er sich überanstrengt hatte immer noch. Sportarten, für die sich sein Bruder begeisterte, waren ihm verwehrt.
Aber er war ein tapferer Reiter und ein recht guter Schütze, und nur er wusste – und Venetia erriet es –, wie bitterlich er sein Leiden hasste.
Eine Knabenzeit erzwungener physischer Unbeweglichkeit hatte in ihm die angeborene Neigung zur Gelehrsamkeit verstärkt. Als er vierzehn war, hatte er seinen Erzieher, wenn nicht an Wissen, so doch an Erfassen übertroffen; und der würdige Mann erkannte, dass der Junge einen Pauker höheren Wissens bedurfte, als er es zu liefern imstande war.
Zum Glück war ein Mann, der darüber verfügte, vorhanden. Der Pastor war ein bedeutender Gelehrter und hatte seit Langem mit einer Art sehnsüchtigem Entzücken Aubrey Lanyons Fortschritte verfolgt. Er bot sich an, den Jungen für Cambridge vorzubereiten; Sir Francis Lanyon, erleichtert, dass es ihm erspart blieb, einen neuen Erzieher in seinen Haushalt aufnehmen zu müssen, stimmte dem Arrangement zu; und Aubrey, damals bereits imstande, sich auf ein Pferd zu setzen, verbrachte daraufhin den größten Teil des Tages im Pfarrhaus.
Er brütete in dem halbdunklen Bücherzimmer des Reverend Julius Appersett über gelehrten Texten, sog eifrig das umfassende Wissen seines sanften Präzeptors in sich ein und erfüllte diesen mit einem sich ständig steigernden Glauben an Aubreys Fähigkeit, dereinst zu brillieren. Aubrey war schon im Trinity College immatrikuliert, wo er im kommenden Jahr zu Michaeli aufgenommen werden würde. Und Mr. Appersett setzte durchaus keinen Zweifel dahingehend, dass Aubrey, so jung er dann noch immer sein würde, sich sehr bald in den Rang eines Scholaren erhoben sähe.
Weder seine Schwester noch sein älterer Bruder hegten in diesem Punkt die geringsten Zweifel. Venetia wusste, dass er einen hohen Verstand besaß; und Conway, selbst ein prächtig robuster junger Sportler, für den schon das Schreiben eines Briefes eine unerträgliche Mühe bedeutete, betrachtete den Bruder mit ebenso großer Ehrfurcht wie mit Mitleid. Scholar werden zu wollen erschien Conway ein seltsamer Ehrgeiz, aber er hoffte aufrichtig, dass es Aubrey gelingen würde, denn was sonst – sagte er einmal zu Venetia – konnte der arme kleine Bursche tun, als sich an seine Bücher zu halten?
Was Venetia betraf, so meinte sie, dass er sich viel zu eng an diese hielt und in einem erschreckend frühen Alter alle Anzeichen zeigte, ein ebenso eigensinniger Eigenbrötler zu werden, wie es ihr Vater gewesen war. Derzeit sollte er gerade Ferien genießen, denn Mr. Appersett war in Bath und erholte sich von einer schweren Krankheit, indes ein Vetter, mit dem er zum Glück hatte tauschen können, seine Pflichten hier erfüllte.
Jeder andere Junge hätte seine Bücher in ein Regal gestopft und wäre mit seiner Angelrute ausgezogen. Aubrey brachte selbst an den Frühstückstisch Bücher mit und ließ seinen Kaffee kalt werden, während er dasaß, seine hohe, zarte Stirn aufgestützt, die Augen auf die Druckseite gerichtet, das Gehirn derart darauf konzentriert, was er gerade las. Man hätte seinen Namen dutzendmal aussprechen können und trotzdem keine Antwort erhalten. Es fiel ihm nicht auf, dass er durch eine derartige Konzentration zu einem schlechten Gesellschafter wurde. Erzwungenerweise fiel es Venetia auf. Aber da sie seit Langem erkannt hatte, dass er genauso egoistisch war wie sein Vater oder sein Bruder, konnte sie seine seltsame Art völlig gleichmütig hinnehmen und ihn auch weiterhin gernhaben, ohne schmerzlich enttäuscht zu sein.
Sie war um neun Jahre älter als er, das älteste der drei überlebenden Kinder eines Großgrundbesitzers in Yorkshire mit einer langen Ahnenreihe, einem behaglich großen Vermögen und exzentrischen Gewohnheiten. Der Verlust seiner Frau, bevor Aubrey noch lange Hosen trug, war die Ursache gewesen, dass sich Sir Francis in den dicken Mauern seines Herrenhauses, etliche fünfundzwanzig Meilen von York entfernt, vergrub; voll erhabener Gleichgültigkeit dem Wohlergehen seiner Sprösslinge gegenüber und der Gesellschaft seiner Kameraden abschwor. Venetia konnte nur annehmen, dass sein Wesen schon immer zum Einsiedlertum geneigt hatte, denn sie konnte unmöglich glauben, dass ein derart ausgefallenes Verhalten aus einem gebrochenen Herzen kam.
Sir Francis war ein Mann von steifem Stolz, aber nie ein empfindsamer Mensch gewesen, und dass seine Ehe ungetrübte Seligkeit gewesen wäre, war eine liebenswürdige Fiktion, die seine klaräugige Tochter einfach nicht glaubte. Ihre Erinnerungen an die Mutter waren vage, aber sie enthielten den Nachhall erbitterten Zanks, zugepfefferter Türen und peinlich hysterischer Anfälle.
Sie konnte sich erinnern, dass sie in das duftende Schlafzimmer ihrer Mutter kommen durfte, um zuzuschauen, wie diese für einen Ball im Howard-Schloss angekleidet wurde; sie konnte sich an ein wunderschönes, aber unzufriedenes Gesicht erinnern, an ein Gewirr teurer Kleider, an eine französische Kammerzofe. Aber sie konnte nicht eine einzige Erinnerung an mütterliche Besorgnis oder Liebe heraufbeschwören. Sicher war, dass Lady Lanyon die Liebe ihres Gatten zum Landleben nicht geteilt hatte. Jedes Frühjahr hatte das schlecht zusammenpassende Paar in London gesehen; der Frühsommer brachte sie nach Brighton. Wenn sie nach Undershaw zurückkehrten, dauerte es nicht lange, bis Ihre Gnaden Trübsal blies. Und wenn sich der Winter über Yorkshire senkte, konnte sie unmöglich das strenge Klima ertragen und war mit ihrem widerstrebenden Gatten auf und davon, auf einer Besuchstour bei ihren Freunden. Kein Mensch hätte sich vorstellen können, dass Sir Francis eine solche Schmetterlingsexistenz passte, dennoch war er ein geschlagener Mann, als eine plötzliche Krankheit seine Frau dahinraffte. Nicht imstande, den Anblick ihres Porträts an der Wand zu ertragen, noch ihren Namen erwähnt zu hören.
Seine Kinder wuchsen in der Wüste auf, die er geschaffen hatte; nur Conway, der nach Eton geschickt wurde und von dort in ein Infanterieregiment eintrat, entfloh in eine größere Welt. Weder Venetia noch Aubrey waren weiter als von Undershaw nach Scarborough gekommen, und ihre Bekanntschaft beschränkte sich auf die paar Familien, die in Reichweite des Herrenhauses lebten. Keinem von beiden tat das leid. Aubrey nicht, weil er davor zurückschreckte, unter Fremde zu gehen. Venetia, weil es ihr einfach nicht lag, es zu bedauern.
Sie war nur ein einziges Mal untröstlich gewesen, und zwar, als sie siebzehn wurde und Sir Francis es ablehnte, sie zu seiner Schwester nach London fahren zu lassen, damit Venetia bei Hof vorgestellt und in die Gesellschaft eingeführt werde. Es schien hart, und sie hatte einige Tränen vergossen. Aber nur ein bisschen Überlegung hatte genügt, sie zu überzeugen, dass der Plan wirklich ziemlich undurchführbar war. Sie konnte Aubrey, damals ein kränklicher Achtjähriger, nicht allein der Pflege der Amme überlassen: Die Ergebenheit dieses vortrefflichen Geschöpfes hätte ihn ins Irrenhaus gebracht. So hatte sie die Tränen getrocknet und sich mit der Situation abgefunden. Papa war schließlich doch nicht so unvernünftig. Wenn er auch einer Londoner Saison nicht zustimmen wollte, so erhob er doch keinen Einwand dagegen, dass sie die Unterhaltungen in York oder sogar in Harrogate mitmachte, wann immer Lady Denny oder Mrs. Yardley sie einlud mitzufahren. Was sie ziemlich häufig taten, die eine aus Güte, die andere unter dem Druck ihres entschlossenen Sohnes. Auch war Papa durchaus nicht kleinlich: Er kümmerte sich nie um ihre Ausgaben für den Haushalt, gab ihr eine recht schöne Apanage und hinterließ ihr, einigermaßen zu ihrer Überraschung, nach seinem Tod ein recht respektables Einkommen.
Dieses Ereignis hatte sich vor drei Jahren abgespielt, einen Monat nach dem glorreichen Sieg bei Waterloo und ganz unerwartet, durch einen tödlichen Schlaganfall. Es war für seine Kinder zwar ein Schock, aber kein Kummer gewesen. „In Wirklichkeit“, hatte Venetia zum Entsetzen der gütigen Lady Denny gesagt, „kommen wir viel besser ohne ihn aus.“
„Aber, meine Liebe!“, hatte Ihre Gnaden nach Luft geschnappt; sie war ins Herrenhaus gekommen, darauf vorbereitet, die Waisen in ihr sentimentales Herz zu schließen. „Du bist überreizt!“
„Aber wirklich nicht!“, hatte Venetia lachend geantwortet. „Wie oft haben Sie, Ma’am, doch selbst von ihm erklärt, dass er der unnatürlichste Vater sei?“
„Aber jetzt ist er doch tot, Venetia!“
„Ja, aber ich glaube nicht, dass er jetzt mehr Zärtlichkeit für uns übrig hat als in seinem Leben, Ma’am. Wissen Sie, er hat sich nie im Geringsten angestrengt, unsere Liebe zu gewinnen, also kann er doch wirklich unmöglich erwarten, dass wir um ihn trauern.“
Da Lady Denny gefunden hatte, dass sie darauf keine Antwort geben konnte, hatte sie Venetia bloß gebeten, so etwas nicht zu sagen, und schnell gefragt, was Venetia nun vorhabe. Venetia hatte gesagt, dass alles von Conway abhänge. Bis er heimkam, um sein Erbe anzutreten, konnte sie nichts tun als weiterleben wie bisher. „Außer natürlich, dass ich jetzt imstande bin, unsere Freunde daheim zu bewirten, was viel gemütlicher sein wird als damals, als Papa niemandem als Edward Yardley und Dr. Bentworth erlaubte, die Schwelle zu überschreiten.“
Drei Jahre später wartete Venetia immer noch auf die Heimkehr Conways, und Lady Denny hatte fast aufgehört, sich über seinen Egoismus aufzuregen, mit dem er die Last seiner Angelegenheiten auf den Schultern Venetias liegen ließ.
Niemand war überrascht, dass er es zuerst unmöglich gefunden hatte, nach England zurückzukehren. Zweifellos musste alles in Belgien und Frankreich drunter und drüber gehen, und dabei alle englischen Regimenter nach einer so blutigen Schlacht wie Waterloo so traurig dezimiert! Aber als die Monate verstrichen war alles, was von Conway zu erfahren war, ein kurzes Gekritzel an seine Schwester.
Er versicherte ihr, er habe alles Vertrauen in ihre Fähigkeit, in Undershaw genau das zu tun, was zu tun war, und dass er ihr wieder schreiben würde, sowie er mehr Zeit habe, sich dieser Aufgabe zu widmen. Da begann man allgemein das Gefühl zu haben, dass seine dauernde Abwesenheit weniger aus einem Pflichtgefühl als von der Abneigung kam, ein Leben aufzugeben, das – aus Berichten von Besuchern der Besetzungsarmee zu schließen – zum Großteil aus Kricket-Matches und Bällen zu bestehen schien. Das Neueste, das man von Conway hörte, war, dass er das Glück gehabt hatte, in den Stab Lord Hills ernannt zu werden, und nun in Cambray stationiert war. Er konnte Venetia unmöglich einen langen Brief schreiben, weil der „große Mann“ erwartet wurde und eine Truppenschau abgehalten werden sollte mit anschließendem Dinner, was bedeutete, dass der Stab so viel zu tun hatte. Er wusste, sie würde genau verstehen, wie es war, und er verblieb als ihr sie liebender Bruder Conway. „P. S.: Ich weiß nicht, welches Feld du meinst, am besten, du tust, was Powick für richtig hält.“
„Und wenn es nach ihm ginge, kann sie ihr Lebtag in Undershaw leben und als alte Jungfer sterben!“, erklärte Lady Denny weinerlich.
„Wahrscheinlicher ist, dass sie Edward Yardley heiratet“, antwortete ihr Herr und Gebieter prosaisch.
„Ich kann nichts gegen Edward Yardley sagen – ja, ich halte ihn für einen wirklich schätzenswerten Menschen! –, aber ich habe immer schon gesagt, und ich werde es auch immer sagen, dass sie sich damit wegwerfen würde! Wenn nur unser lieber Oswald zehn Jahre älter wäre, Sir John!“
Aber hier nahm das Gespräch eine abrupte Wendung, da Sir Johns böser Geist ihn zu dem Ausruf herausforderte, er hoffe, dass ein so prächtig aussehendes Mädel mehr Verstand habe, als den dümmsten jungen Hund der Grafschaft auch nur zweimal anzuschauen. Da er außerdem noch hinzusetzte, es sei höchste Zeit, seine Frau hörte damit auf, Oswald zu ermutigen, dass er mit seinem theatralischen Getue einen Narren aus sich mache, wurde Venetia in einem ziemlich hitzigen Austausch widerstreitender Meinungen vergessen.
Niemand hatte geleugnet, dass Venetia ein sehr gut aussehendes Mädchen war; ja, die meisten hätten nicht gezögert, sie schön zu nennen. Selbst unter den Erlesensten der Debütantinnen bei Almack hätte sie Aufmerksamkeit erregen müssen; in der begrenzteren Gesellschaft, in der sie verkehrte, hatte sie nicht ihresgleichen. Es waren nicht nur die Größe und der Glanz ihrer Augen, die Bewunderung erregten, noch die Pracht ihres glänzenden rotgoldenen Haares noch selbst der bezaubernde Schwung ihres hübschen Mundes. Es war außerdem noch etwas sehr Einnehmendes in ihrem Gesicht, das nichts mit der Vortrefflichkeit ihrer Züge zu tun hatte. Ein Ausdruck der Süße, das Glitzern eines nicht zu unterdrückenden Humors, ein ungewöhnlich freimütiger Blick, in dem keine Spur Schüchternheit lag.
Dieses humorvolle Glitzern trat in ihre Augen, als sie Aubrey anschaute, der immer noch in der Antike versunken war. Sie sagte: „Aubrey! Lieber, grässlicher Aubrey! So leihe mir doch deine Ohren! Gerade nur wenigstens eines deiner Ohren, Liebling!“
Er schaute auf, und in seinen Augen antwortete ihr das gleiche Glitzern. „Nicht wenn es etwas ist, das ich besonders ungern mag!“
„Nein, ich verspreche dir, das ist es nicht!“, antwortete sie lachend. „Nur wenn du vorhast, gleich auszureiten, wirst du dann so nett sein und im Postamt nachfragen, ob dort für mich ein Päckchen aus York abgeliefert wurde? Ein ganz kleines Päckchen, lieber Aubrey! Nicht im Allergeringsten unhandlich, Ehrenwort!“
„Ja, will ich machen – wenn nicht Fisch drin ist! Sollte das der Fall sein, dann kannst du gleich Puxton darum schicken, meine Liebe!“
„Nein, es ist einwandfrei Musselin!“
Er hatte sich erhoben und ging in seinem unbeholfenen, schleppenden Gang zum Fenster. „Es ist zu heiß, um überhaupt auszureiten, glaube ich, aber ich will – oh, und ob ich will, und das sofort! Meine Liebe, da kommen deine beiden Freier gleich auf einmal, um uns einen Morgenbesuch abzustatten!“
„Oh nein!“, rief Venetia flehend aus. „Doch nicht schon wieder!“
„Reiten gerade die Allee herauf“, versicherte er ihr. „Oswald schaut außerdem mürrisch wie ein Bär drein.“
„Also, Aubrey, bitte, sag das nicht! Es ist sein düsterer Blick. Er brütet über namenlosen Verbrechen, vermute ich, und bedenke bloß, wie entmutigend, wenn man seine düsteren Gedanken mit Mürrischsein verwechselt!“
„Was für namenlose Verbrechen?“
„Mein Lieber, wie soll ich das wissen – oder er selbst? Der arme Junge – daran ist nur Byron schuld! Oswald kann sich nicht entschließen, wem er eigentlich ähnlich sieht, Seiner Lordschaft oder dem Corsair Seiner Lordschaft. In beiden Fällen ist es für die arme Lady Denny sehr besorgniserregend. Sie ist überzeugt, dass er an irgendeiner Unordnung im Blut leidet, und bittet ihn immer wieder, James-Pulver zu schlucken.“
„Byron!“, würgte Aubrey hervor, mit seinem ungeduldigen Achselzucken. „Ich verstehe nicht, wie du so ein Zeug lesen kannst!“
„Natürlich lese ich es nicht, Liebling – und ich muss zugeben, ich wollte, Oswald hätte entdeckt, dass es auch ihm unmöglich ist. Ich möchte nur wissen, welche Ausrede Edward uns für diesen Besuch bieten wird. Es kann doch bestimmt nicht noch eine Königshochzeit oder allgemeine Wahlen gegeben haben?“
„Oder dass er meinen kann, uns liege was an einem solchen Mist.“ Aubrey wandte sich vom Fenster ab. „Wirst du ihn heiraten?“, fragte er.
„Nein – oh, ich weiß nicht! Ich bin überzeugt, dass er ein freundlicher Gatte wäre, aber so viel ich auch versuche, ich kann nicht mehr als ihn schätzen“, antwortete sie in einem komisch verzweifelten Ton.
„Warum versuchst du’s dann überhaupt?“
„Nun ja, weißt du, irgendwen muss ich doch heiraten! Conway wird es bestimmt tun, und was soll dann aus mir werden? Es würde mir nicht passen, dass ich hier weiterlebe und zu einer Tante zusammenschrumpfe – und ich glaube sagen zu können, dass das meiner unbekannten Schwägerin sicher auch nicht passen würde!“
„Oh, du kannst mit mir zusammenleben! Ich werde bestimmt nicht heiraten, und ich hätte überhaupt nichts dagegen – du störst mich nie!“
Ihre Augen tanzten, aber sie versicherte ihm ernst, dass sie ihm sehr verbunden sei.
„Es würde dir besser gefallen, als mit Edward verheiratet zu sein.“
„Der arme Edward! So sehr kannst du ihn nicht leiden?“
Er antwortete mit einem verzerrten Lächeln: „Ich vergesse nie, wenn er bei uns ist, dass ich ein Krüppel bin, meine Liebe.“
Hinter der Tür hörte man eine Stimme sagen: „Im Frühstückszimmer sind sie, nicht? Oh, Er braucht mich nicht anzumelden, ich kenne mich hier aus!“
Aubrey fügte hinzu: „Und ich mag es nicht, dass er sich hier auskennt.“
„Ich auch nicht, wirklich! Man kommt ihm nicht aus!“, stimmte sie ihm zu und wandte sich zur Tür, um die Besucher zu begrüßen.
Zwei Gentlemen, einander denkbar unähnlich, betraten das Zimmer: Der ältere, ein solide aussehender Mann im dreißigsten Lebensjahr, ging voraus wie einer, der nicht daran zweifelt, dass er willkommen ist; der jüngere, ein Jüngling von neunzehn, mit einem Mangel an Sicherheit, der nur unvollkommen hinter einem leicht nonchalanten Einherstolzieren verborgen wurde.
„Guten Morgen, Venetia! Na, Aubrey?“, sagte Mr. Edward Yardley und schüttelte ihnen die Hände. „Was für ein Paar Langschläfer, wirklich! Ich fürchtete schon, ich würde euch an einem solchen Tag nicht daheim finden, kam aber auf die Chance hin, dass Aubrey vielleicht gern sein Glück mit den Karpfen in meinem See versuchen möchte. Was sagst du dazu, Aubrey? Du kannst vom Boot aus fischen, weißt du, und strengst dich dabei nicht an.“
„Danke, aber es ist wohl kaum zu erwarten, dass ich bei einem solchen Wetter etwas fange.“
„Es würde dir aber guttun, und du kannst deinen Einspänner bis auf wenige Meter an den See heranfahren, wie du weißt.“
Es wurde freundlich gesagt, aber in Aubreys wiederholter Ablehnung war etwas von Zähneknirschen zu spüren. Mr. Yardley nahm mitleidig an, dass ihm die Hüfte wehtat.
Inzwischen war der junge Mr. Denny dabei, seine Gastgeberin zu informieren, eindringlicher, als die Gelegenheit es angemessen erscheinen ließ, dass er gekommen war, um sie zu sehen. Er fügte in einer leisen, vibrierenden Stimme hinzu, dass er einfach nicht wegbleiben konnte. Dann schaute er düster Aubrey an, der ihn mit spöttischen Augen betrachtete, und schwieg plötzlich errötend. Er war fast drei Jahre älter als Aubrey und hatte viel mehr von der Welt gesehen, aber Aubrey war imstande, ihn aus der Fassung zu bringen, ebenso durch seinen leidenschaftslosen Blick wie durch den Gebrauch seiner giftigen Zunge. Der junge Denny konnte sich in Gegenwart des Jungen einfach nicht wohlfühlen. Abgesehen davon, dass er ihm in einem Wettstreit des Verstandes nicht gewachsen war, hatte er die Abneigung eines gesunden jungen Tieres gegen physische Missbildung und hegte außerdem die Meinung, Aubrey schlage in einer sehr schäbigen Art Kapital daraus. Wenn es das nachschleppende linke Bein nicht gegeben hätte, hätte man ihm sehr schnell beigebracht, welche Höflichkeit er Älteren gegenüber schuldete. Er weiß, dass er vor mir sicher ist, dachte Oswald und verzog den Mund.
Nachdem er eingeladen worden war, sich zu setzen, hatte er eine nachlässige Pose auf einem kleinen Sofa eingenommen. Er entdeckte jetzt, dass der zweite Gast ihn unverwandt und mit einer unverkennbaren Missbilligung ansah, und er war sofort hin und her gerissen zwischen der Hoffnung, eine romantische Figur zu bieten, und der Angst, dass er die nonchalante Haltung doch um eine Spur übertrieben hatte. Er setzte sich also auf, und Edward Yardley wandte seinen Blick nunmehr Venetia zu.
Mr. Yardley, der keinen Wunsch hegte, romantisch zu erscheinen, hätte es sich nie zuschulden kommen lassen, in der Gegenwart einer Dame zu lümmeln. Noch hätte er einen Morgenbesuch in einer Jagdjacke gemacht und mit einem seidenen Taschentuch um den Hals, dessen Enden unordentlich über der Jacke getragen wurden. Er war nett und schicklich in eine nüchterne Reitjacke und Reithosen gekleidet und so weit davon entfernt, eine Haarlocke darin zu schulen, dass sie über eine Braue fiel, dass er sein Haar eher kürzer geschnitten trug, als es Mode war. Er hätte als Modell für einen Landedelmann soliden Wertes und bescheidener Ambitionen dienen können; bestimmt hätte kein Fremder vermutet, dass er und nicht Oswald das einzige Kind einer in ihn vernarrten verwitweten Mutter war.
Da sein Vater gestorben war, bevor Edward seinen zehnten Geburtstag feierte, war er schon in sehr frühem Alter in den Besitz seines Vermögens gekommen. Das war eher ansehnlich denn beträchtlich, aber immerhin groß genug, um einen vorsichtigen Mann in den Stand zu versetzen, ein elegantes Leben zu führen und es trotzdem zustande zu bringen, der Welt zuvorzukommen. Ein Modejüngling, darauf aus, Eindruck zu machen, hätte es für Armut gehalten, aber Edward hatte keine ausgefallenen Steckenpferde. Sein Besitz, der nicht ganz zehn Meilen weit von Undershaw lag, war weder so ausgedehnt noch so bedeutend wie Undershaw, wurde aber allgemein für ein recht nettes Eigentum gehalten und übertrug auf dessen Besitzer eine anerkannte Stellung im Norddistrikt von Yorkshire, den Gipfel seines Ehrgeizes. Von angeboren seriösem Charakter, besaß er auch ein starkes Pflichtgefühl. Er machte alle Anstrengungen seiner Mama zunichte, seinen Charakter durch übertriebene Duldsamkeit zu ruinieren, übernahm früh die Leitung seiner Angelegenheiten und wuchs sehr schnell zu einem ernsthaften jungen Mann uniformer Tugenden heran. Zwar war er weder lebhaft noch geistreich, besaß aber dafür sehr viel Vernunft. Und wenn ihn seine herrische Natur in seinem Haushalt auch etwas zu autokratisch machte, so war das feste Regiment, das er über seine Mama und seine Angestellten führte, doch von dem aufrichtigen Glauben beseelt, dass er fähig sei zu entscheiden, was sie bei allen Gelegenheiten am besten zu tun hätten.
Venetia, die das Gefühl hatte, dass es ihr obliege, Aubreys knappe Höflichkeit gutzumachen, sagte: „Wie nett von dir, dass du an Aubrey gedacht hast! Aber du hättest dir nicht so viel Mühe machen sollen – ich bin überzeugt, du hast tausend Sachen zu tun.“
„Nicht direkt tausend“, antwortete er lächelnd. „Nicht einmal hundert, obwohl ich gestehe, dass ich im Allgemeinen ziemlich beschäftigt bin. Aber du darfst nicht glauben, dass ich irgendeine wichtige Pflicht vernachlässige – ich hoffe, dass ich mir darin nichts vorzuwerfen habe! Dem Dringlichen konnte ich mich schon widmen, als ihr, wette ich, noch geschlafen habt. Mit etwas Einteilung findet man immer Zeit, musst du wissen. Ich habe außerdem noch einen anderen Grund für meinen Besuch – ich habe dir mein Exemplar der Morning Post vom Dienstag mitgebracht, worüber du, glaube ich, froh sein wirst. Ich habe die Stelle angezeichnet – du wirst sehen, dass es die Besetzungsarmee betrifft. Es scheint sicher zu sein, dass die Aversion der Franzosen gegen die Anwesenheit unserer Soldaten immer stärker wird. Zum Wundern ist es nicht, obwohl, wenn man denkt – aber das ist für dich weniger interessant als die Aussicht, dass ihr Conway daheim begrüßen werdet! Ich glaube, er dürfte bei euch sein, bevor noch das Jahr um ist.“
Venetia nahm die Zeitung entgegen, dankte ihm mit einer Stimme, die fast vor Lachen schwankte, und hütete sich, Aubrey anzuschauen.
Seit Edward entdeckt hatte, dass die Lanyons, was Neuigkeiten betraf, von der Wochenzeitung Liverpool Mercury abhingen, hatte er es zu einer Ausrede für seine häufigen Besuche in Undershaw gemacht, dass er seine Londoner Tageszeitung mit ihnen teilte. Zuerst war er nur gekommen, wenn irgendeine große Neuigkeit darin stand, wie etwa der Tod des alten Königs von Schweden und die Wahl des Marschalls Bernadotte auf den Thron. In den Frühlingsmonaten dienten ihm die Zeitungen netterweise mit einer Flut königlicher Hochzeiten.
Zuerst hatte es die wirklich erstaunliche Nachricht gegeben, dass die Prinzessin Elizabeth, obwohl schon etwas bejahrt, mit dem Prinzen von Hessen-Homburg vermählt wurde. Kaum hörten die Beschreibungen ihres bräutlichen Gewandes und die Preislieder auf ihre Geschicklichkeit als Künstlerin auf, als gleich nicht weniger als drei ihrer ältlichen Brüder ihrem Beispiel folgten. Das war ganz natürlich, weil die Erbin von England, die arme Prinzessin Charlotte, vor Kurzem samt ihrem Kind im Wochenbett gestorben war.
Selbst Edward gab zu, dass es amüsant war, denn zwei der königlichen Herzoge waren über fünfzig, und man sah es ihnen an; und jeder Mensch wusste, dass der älteste der drei Vater einer großen Schar hoffnungsvoller Bastarde war. Aber seit der Hochzeit Clarences im Juli hatte Edward große Mühe, irgendetwas in den Zeitungen zu entdecken, das nur von Weitem danach aussah, als könnte es die Lanyons interessieren. Er war mehr als einmal gezwungen gewesen, seine Zuflucht zu Berichten zu nehmen, dass die Gesundheit der Königin den Leibärzten Grund zu Depression gab oder dass über Tierneys fortgesetzte Führung der Partei Uneinigkeit ihr Haupt unter den Whigs erhob. Selbst der überzeugteste Optimist hätte nicht annehmen können, dass sich die Lanyons für solche Gerüchte interessierten, aber man konnte vernünftigerweise erwarten, dass sie die Aussicht auf Conways Heimkehr begrüßen würden.
Aber Venetia sagte nur, sie werde es erst glauben, dass Conway den Dienst quittiert habe, wenn sie ihn zur Tür hereinkommen sah; und nachdem Aubrey die Sache stirnrunzelnd überdacht hatte, fügte er in einem beklagenswert optimistischen Ton hinzu, man brauche nicht zu verzweifeln, da Conway wahrscheinlich eine andere Ausrede finden werde, um bei der Armee bleiben zu können.
„Ich würde das bestimmt!“, sagte Oswald, erkannte aber dann, dass dies entschieden kein Kompliment für seine Gastgeberin war, verfiel in Todesqualen und stammelte: „Das heißt, ich meine nicht – das heißt, ich meine, ich würde das, wenn ich Sir Conway wäre! Er wird es hier so verteufelt langweilig finden. Das ist es eben, wenn man einmal die Welt gesehen hat.“
„Das ist es für dich nach einem Ausflug nach Westindien nicht?“, fragte Aubrey.
Die Bemerkung entlockte Edward ein Lachen, und Oswald, der zuerst Aubreys Bosheit ignorieren wollte, sagte mit unnötigem Nachdruck: „Jedenfalls habe ich mehr von der Welt gesehen als du. Du hast keine Ahnung – du wärst verblüfft, wenn ich dir erzählen würde, wie in Jamaika alles anders ist!“
„Ja, wären wir“, stimmte Aubrey zu und begann sich aus seinem Stuhl hochzustemmen.
Edward kam ihm sofort mit der Besorgtheit, die so wenig geschätzt wurde, zu Hilfe. Nicht imstande, den unterstützenden Griff an seinem Ellbogen abzuschütteln, fügte sich Aubrey, aber sein „Danke“ klang eisig, und er rührte sich so lange nicht von der Stelle, an der er stand, bis Edward seine Hand zurückzog. Dann glättete Aubrey seinen Ärmel und sagte an seine Schwester gewandt: „Ich geh dieses Päckchen holen, meine Liebe. Ich möchte, dass du, wenn du einen Augenblick für dich hast, an Taplow schreibst und ihn verständigst, er solle uns in Zukunft eine der Londoner Tageszeitungen liefern. Ich glaube, wir sollten uns selbst eine halten, meinst du nicht auch?“
„Das ist nicht nötig“, sagte Edward. „Ich versichere euch, ich bin nur zu glücklich, die meine mit euch zu teilen.“
Aubrey blieb unter der Tür stehen, schaute zurück und sagte sanft: „Aber wenn wir unsere eigene hätten, dann wärst du nicht gezwungen, so oft zu uns herüberzureiten, nicht?“
„Wenn ich gewusst hätte, dass ihr eine haben wollt, wäre ich mit dem Exemplar meines Vaters wirklich jeden Tag herübergeritten!“, sagte Oswald ernst.
„Unsinn!“, sagte Edward, so verärgert darüber, wie er es nicht einmal über Aubreys offene Feindseligkeit gewesen war. „Ich stelle mir vor, dass Sir John vielleicht auch etwas zu diesem Plan zu sagen hätte! Venetia weiß, dass sie sich auf mich verlassen kann.“
Diese Zurechtweisung stachelte Oswald zu der Bemerkung an, dass sich Venetia bei wesentlich gefährlicheren Diensten als der Ablieferung einer Zeitung auf ihn verlassen könne. Zumindest war das der Kern dessen, was er hatte sagen wollen, aber die Rede, die in Gedanken sehr schön geklungen hatte, veränderte sich recht unglücklich, sowie sie ausgesprochen wurde. Sie verwickelte sich hoffnungslos, klang selbst für ihren Autor lahm und verlief sich unter der toleranten Verachtung in Edwards Auge ins Nichts.
Gerade da aber schuf das alte Kinderfräulein der Lanyons eine Ablenkung, als es auf Suche nach Venetia ins Zimmer trat. Als die Amme entdeckte, dass Mr. Yardley, den sie billigte, mit ihrer jungen Herrin beisammen war, entschuldigte sie sich sofort, sagte, ihre Angelegenheit könne warten, und zog sich wieder zurück. Aber Venetia, die der Gesellschaft ihrer schlecht zusammenpassenden Bewunderer ein häusliches Zwischenspiel vorzog, selbst wenn sie dadurch gezwungen wurde, abgenützte Bettlaken zu inspizieren oder sich Klagen über die Säumigkeit der jüngeren Dienerschaft anhören zu müssen, stand auf und entließ die beiden in der denkbar freundlichsten Art. Sie sagte, sie würde sich die Ungnade der Amme zuziehen, wenn sie sie warten ließe.
„Ich habe meine Pflichten vernachlässigt, und wenn ich mich nicht vorsehe, werde ich ein schreckliches Donnerwetter über mich ergehen lassen müssen“, sagte sie lächelnd und streckte ihre Hand Oswald hin. „Daher muss ich euch beide wegschicken. Seid nicht böse! Ihr seid so alte Freunde, dass ich mit euch nicht auf formellem Fuß stehen muss.“
Nicht einmal Edwards Anwesenheit konnte Oswald davon abhalten, ihre Hand an seine Lippen zu ziehen und einen glühenden Kuss auf sie zu drücken. Sie nahm dies mit ungerührtem Gleichmut hin, und sowie sie wieder über ihre Hand verfügte, hielt sie sie Edward hin. Aber er lächelte nur, sagte: „Gleich!“, und hielt die Tür für sie auf. Sie ging an ihm vorbei in die Halle, und er folgte ihr, indem er seinen Rivalen sehr entschieden im Frühstückszimmer einschloss. „Du solltest diesen stupiden Jungen nicht ermutigen, hinter dir herzulaufen“, bemerkte er.
„Ermutige ich ihn?“, fragte sie und schaute überrascht drein. „Ich dachte, ich benehme mich zu ihm wie zu Aubrey. Genauso sehe ich ihn – außer“, fügte sie nachdenklich hinzu, „dass Aubrey nicht die Vernunft abgeht und er viel älter zu sein scheint als der arme Oswald.“
„Meine teure Venetia, ich beschuldige dich ja nicht, dass du etwa mit ihm flirtest!“, antwortete Edward mit einem nachsichtigen Lächeln. „Auch bin ich nicht eifersüchtig, solltest du vielleicht das meinen!“
„Nun, das meine ich nicht“, sagte sie. „Du hast, wie du weißt, weder einen Grund, eifersüchtig zu sein, noch das Recht dazu.“
„Bestimmt keinen Grund. Was das Recht betrifft, sind wir uns doch einig – nicht? –, dass es unschicklich wäre, mehr über diesen Punkt zu sagen, bis Conway heimkommt. Du wirst vielleicht erraten, mit was für einem Interesse jedenfalls ich jene Spalte in der Zeitung gelesen habe!“
Das wurde mit einem derart schelmischen Blick gesagt, dass es sie zu dem Ausruf herausforderte: „Edward! Ich bitte dich sehr, rechne nicht allzu sehr auf Conways Heimkehr! Du bist in eine Art verfallen, davon zu reden, als würde mich das bereit machen, sofort in deine Arme zu fallen, und ich wünsche, dass du nicht so sprichst!“
„Ich hoffe – ja, ich bin ganz sicher –, dass ich mich niemals in solchen Worten ausgedrückt habe“, antwortete er ernsthaft.
„Nein, nie!“, stimmt sie zu, und dabei tanzte ein spitzbübisches Lächeln um ihre Lippen. „Edward, bitte – bitte frage dich wirklich, bevor mir Conway so unerträglich langweilig wird, dass ich bereit sein werde, aber schon nach jedem Heiratsantrag zu schnappen, ob du mich auch wirklich heiraten willst! Denn ich glaube gar nicht, dass du das wirklich willst!“
Er schaute verblüfft, ja sogar ziemlich schockiert drein, aber nach einem Augenblick lächelte er und sagte: „Ich weiß, wie gern du Spaß machst! Du bist immer amüsant, und wenn deine Scherzhaftigkeit dich hie und da dazu verführt, seltsame Dinge zu sagen, so bilde ich mir ein, dass ich dich viel zu gut kenne, um zu glauben, dass du sie auch wirklich meinst.“
„Edward, bitte – ich bitte dich, bemühe dich zumindest ein wenig, dich vor einer Illusion zu hüten“, bat Venetia sehr ernst. „Du kannst mich nicht im Geringsten kennen, wenn du dir das wirklich einbildest – und was für ein grässlicher Schock wird es für dich sein, wenn du entdeckst, dass ich die seltsamen Dinge, die ich sage, auch wirklich meine!“
Er antwortete scherzhaft, ohne dass sein Selbstvertrauen im Geringsten gemindert worden wäre: „Vielleicht kenne ich dich besser als du dich selbst! Das ist ein Kniff, den du von Aubrey gelernt hast. Du jedenfalls gehst nicht über die Grenze dessen hinaus, was heiter ist – aber wenn du von Conway sprichst, klingt es, als hättest du ihn nicht lieb!“
„Nein, hab ich auch nicht“, sagte sie freimütig.
„Venetia! Bedenke, was du sagst!“
„Aber es ist wirklich wahr!“, sagte sie beharrlich. „Oh, schau nicht so entsetzt drein! Nicht, dass ich ihn nicht mag – obwohl ich sagen muss, es könnte durchaus der Fall sein, wenn ich gezwungen wäre, viel mit ihm beisammen zu sein; denn abgesehen davon, dass er sich keinen Deut um die Bequemlichkeit eines anderen Menschen kümmert, nur um seine eigene, ist er ganz schauerlich gewöhnlich!“
„Das solltest du nicht sagen“, antwortete er zurückhaltend. „Wenn selbst du von deinem Bruder mit so wenig Mäßigung sprichst, kann man sich nicht wundern, dass Aubrey keine Gewissensbisse hat, von Conways Heimkehr so zu sprechen, wie er es soeben getan hat.“
„Mein lieber Edward, noch vor einer Weile hast du gesagt, ich hätte diesen Kniff von ihm gelernt!“, verspottete sie ihn. Sein Gesicht entspannte sich nicht, und sie fügte einigermaßen amüsiert hinzu: „Die Wahrheit ist – wenn du sie nur erkennen würdest! –, dass wir gar keine Kniffe haben, wir sagen nur, was wir denken. Und ich muss gestehen, dass es erstaunlich ist, wie oft wir dasselbe denken, denn wir sind einander sonst, glaube ich, nicht sehr ähnlich – bestimmt nicht in unserem Geschmack!“
Er schwieg eine Weile und sagte dann: „Es ist dir vielleicht zuzugestehen, dass du ein bisschen Groll hegst. Ich kann deine Gefühle gut verstehen. Deine Lage hier seit dem Tod deines Vaters ist unbehaglich, und Conway hatte keine Skrupel, seine Bürden – ja, eigentlich seine Pflichten! – auf deine Schultern zu legen. Aber bei Aubrey ist das anders. Ich war sehr in Versuchung, ihn herunterzukanzeln, als ich ihn so von seinem Bruder sprechen hörte. Was immer die Fehler Conways sein mögen, er ist sehr gutmütig und ist immer nett zu Aubrey gewesen.“
„Ja, aber Aubrey mag Leute nicht, weil sie nett zu ihm sind“, sagte sie.
„Jetzt redest du Unsinn!“
„Oh nein! Wenn Aubrey Leute mag, dann ist es nicht um dessentwillen, was sie tun – es ist darum, was sie im Sinn haben, glaube ich.“
„Es wird für Aubrey sehr gut sein, wenn Conway heimkommt!“, unterbrach er sie. „Wenn die einzigen Leute, die er dummerweise leiden kann, klassische Gelehrte sind, ist es höchste Zeit.“
„Was für eine Dummheit, so etwas zu sagen, wenn du doch wissen musst, dass er mich mag!“
Er sagte steif: „Verzeihung! Zweifellos habe ich dich missverstanden.“
„Das hast du wirklich! Du hast auch missverstanden, was ich über Conway sagte. Ich versichere dir, ich verspüre nicht den leisesten Groll, und was meine Lage betrifft – oh, wie albern du bist! Die ist doch natürlich nicht unbehaglich!“ Sie sah, dass er verletzt dreinschaute, und rief aus: „Jetzt habe ich dich verärgert! Nun, es ist heute zu heiß zum Streiten, deshalb wollen wir uns, bitte, nicht mehr zanken! Jedenfalls muss ich jetzt hinaufgehen und schauen, was denn die Amme will. Auf Wiedersehen! Und danke, dass du so nett warst und uns deine Zeitung gebracht hast!“
2. KAPITEL
Nachdem sie der Amme entflohen war, die ihr außer abgenutzten Bettlaken zwecks Missbilligung auch zwei Hemden von Aubrey unterbreitet hatte, deren Ärmelbündchen durch achtlose Behandlung zerrissen worden waren, fiel Venetia in die Klauen der Haushälterin. Mrs. Gurnards offizieller Zweck war es, sie daran zu erinnern, dass jetzt oder nie die Zeit gekommen sei, Brombeergelee einzukochen. Ihr wirkliches Thema, zu dem sie auf vielen Umwegen gelangte, war, das neue Wäschermädchen, ihre Nichte, vor den Anklagen der Amme zu verteidigen. Da diese beiden ältlichen braven Gefolgsleute gut sechsundzwanzig Jahre lang in einem Verhältnis gegenseitiger Eifersucht gelebt hatten, wusste Venetia, dass die angeblichen Mängel des Wäschermädchens unvermeidlich zu der Aufzählung einer Anzahl anderer Beschwerden gegen die Amme führen würden. Darauf würde dann die Amme über sie herfallen, die bei einem langen Besuch Venetias im Zimmer der Wirtschafterin bestimmt Verdacht schöpfte, um durch ein rigoroses Verhör aufzudecken, was für boshafte Lügen ihr erzählt worden waren.
Daher brachte Venetia mit einer Geschicklichkeit, die langer Praxis entstammte, das Gespräch schnell wieder auf Brombeergelee zurück und lenkte Mrs. Gurnard durch das Versprechen ab, ihr noch am selben Tag einen Korb voll Brombeeren zu bringen. Dann entschlüpfte sie schnell in ihr Schlafzimmer, bevor sich die furchterregende Dame weiterer Schändlichkeiten der Amme entsinnen konnte.
Venetia zog das Kleid aus französischem Batist, das sie trug, aus und nahm ein altes Barchentkleid aus ihrem Garderobenschrank. Es war ziemlich altmodisch, und sein ursprüngliches Blau war zu einem unbestimmten Grau verblichen, aber zum Brombeersammeln war es gut genug, und selbst die Amme würde nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn es fleckig würde. Ziemlich derbe Schuhe und ein Strohhut gegen die Sonne vervollständigten ihre Kleidung.
Mit einem großen Korb bewaffnet verließ sie gleich darauf das Haus, beflügelt von der Nachricht, die ihr Ribble, der Butler, zuflüsterte: Mr. Denny, der nach Thirsk geritten war, wo er etwas Geschäftliches zu erledigen hatte, meine, er werde auf seinem Heimweg doch lieber noch einmal in Undershaw vorsprechen, falls Miss Lanyon vielleicht wünsche, ihm eine Post für seine Mama mitzugeben.
Ihr einziger Gefährte auf dieser Expedition war ein liebenswürdiger, wenn auch gedankenloser Spaniel, den ihr Aubrey geschenkt hatte, als er entdeckte, dass das Hundejunge, abgesehen von einem erregbaren Charakter, unheilbar schussscheu war. Als Begleiter einer Dame auf einsamen Spaziergängen war er keineswegs ideal, denn abgesehen von seiner unglückseligen Schwäche war er sehr jagdlüstern. Nachdem er sie einige hundert Meter weit beim Gehen behindert hatte, indem er um sie herumtollte und mit hysterischem Gekläff an ihr hochsprang und sich überhaupt wie ein Hund betrug, der nur selten von der Kette losgelassen wird, stürzte er davon, taub gegen alle Mahnungen. Er tauchte nur hie und da wieder auf, mit hängender Zunge und einer Miene, als hätte er sich gerade nur einen Augenblick von dringenden privaten Angelegenheiten losgerissen, um sich zu vergewissern, dass mit ihr alles in Ordnung war.
Wie die meisten Mädchen ihrer Generation, die auf dem Land aufwuchsen, war Venetia eine flotte Fußgängerin; aber anders als die meisten ihrer Zeitgenossinnen höherer Abstammung zögerte sie nie, allein herumzustreifen. Es war eine Gewohnheit, die sie schon als Schulmädchen entwickelt hatte, um ihrer Erzieherin zu entgehen. Miss Poddemore meinte, für eine Dame sei es genügend Bewegung, wenn sie eine Stunde lang auf den Pfaden zwischen Gartensträuchern herumschlenderte. Bei den seltenen Gelegenheiten, wenn Umstände oder Überredung sie dazu brachten, sich zu einem Spaziergang zum nächsten Dorf verführen zu lassen, das eineinhalb Meilen entfernt lag, war ihr würdiges Dahinschreiten für ihren Zögling ebenso aufreizend wie ihre Gewohnheit, den Weg mit belehrendem Gespräch zu verkürzen. Obwohl sie nicht so hochgebildet war wie Miss Selina Trimmer, der sie ein einziges Mal begegnet war und die sie nachher auf immer verehrte, war sie gut erzogen. Unglücklicherweise besaß sie weder Miss Trimmers starke Persönlichkeit noch deren Fähigkeit, ihren Schülerinnen Liebe einzuflößen. Als Venetia siebzehn geworden war, war sie von ihrer Erzieherin derart herzlich gelangweilt, dass sie ihren Eintritt in die Periode des Junge-Dame-Seins mit der Mitteilung an ihren Vater markierte: Da sie ja nun erwachsen und durchaus imstande sei, den Haushalt zu führen, könnten sie sich die Dienste von Miss Poddemore ersparen.
Von da an hatte sie keine andere Anstandsdame als die Amme gehabt, aber da sie, wie Lady Denny erklärte, weder in Gesellschaft ging noch Gäste in Undershaw empfing, war nicht einzusehen, wozu sie eine Anstandsdame haben sollte. Da Lady Denny unmöglich sagen konnte, es sei unschicklich, wenn ein Mädchen im Haus seines Vaters ohne Anstandsdame lebte, musste die Lady dieses Argument fallen lassen und konnte stattdessen Venetia nur anflehen, nicht im Freien herumzustreifen, ohne auch nur eine Zofe mitzunehmen. Aber Venetia hatte nur gelacht und ihr scherzhaft gesagt, sie sei genauso schlimm wie Miss Poddemore, die es nie müde geworden war, das Beispiel der Lady Harriet Cavendish zu zitieren, einer der Schutzbefohlenen der berühmten Miss Trimmer. Die hatte sich, als sie noch vor ihrer Heirat auf Schloss Douglas lebte, nie ohne Begleitung ihres Lakaien über die Gärten hinausgewagt.
Da sie, Venetia, aber nicht die Tochter eines Herzogs sei, habe sie nicht das Gefühl, es obliege ihr, sich Lady Harriet zum Vorbild zu nehmen. „Außerdem, Ma’am, muss das mindestens vor zehn Jahren gewesen sein! Und wenn ich eines der Mädchen mitschleppen sollte, wenn es stattdessen etwas Vernünftigeres zu tun hat, würde es mir wahrhaftig mein Vergnügen verderben. Nein, nein, ich habe mir Miss Poddemore nicht dazu vom Hals geschafft! Und was soll mir auch schon hier geschehen, wo jedermann weiß, wer ich bin?“
Seufzend musste sich Lady Denny mit dem Versprechen zufriedengeben, dass ihr unabhängiger junger Schützling nie ohne Begleitung nach York oder Thirsk fahren würde.
Als Sir Francis starb, erneuerte sie ihre dringenden Bitten, aber ohne viel Hoffnung, dass Venetia auf sie hören würde. Es brachte sie zur Verzweiflung, dass Venetia sagte, sie sei ihrer Mädchenzeit entwachsen, aber zu leugnen war es nicht: Venetia war damals dreiundzwanzig, gefährlich nahe daran, sitzen zu bleiben.
„Wobei diese Gefahr immer schon bestanden hat, Sir John – obwohl das nicht genau das ist, was ich meine, sondern nur, dass es geradezu eine Schmach ist, so schön wie sie ist und so voll Leben, abgesehen davon, dass sie den denkbar besten Charakter hat! Ich jedenfalls halte von dieser Tante von ihr herzlich wenig! Sie hat sich nie ernsthaft angestrengt, Sir Francis zu überreden, dass er Venetia auf eine Saison nach London lässt, als das arme Kind zum ersten Mal in die Gesellschaft eingeführt wurde, und falls sie sie nun, da er tot ist, gedrängt haben sollte hinzukommen, habe jedenfalls ich nichts davon gehört! Ich halte sie für genauso egoistisch, wie es ihr Bruder war, und wenn es nicht so viel kosten würde und wir nicht unsere eigenen Töchter einführen müssten – denn selbst falls überhaupt wirklich etwas bei dieser Zuneigung zwischen Clara und Conway herauskommen sollte – worauf ich durchaus nicht rechne –, bin ich entschlossen, dass alle fünf bei Hof vorgestellt werden müssen und es auch werden! –, nun, wie ich gesagt habe, wenn das alles nicht wäre, wäre ich sehr in Versuchung, Venetia selbst nach London zu bringen, und ich wäre nicht erstaunt, wenn sie eine sehr ansehnliche Partie machen würde, obwohl sie nicht mehr in der ersten Jugend ist! Nur kannst du dich darauf verlassen, dass sie sich ja doch weigern würde, Aubrey allein zu lassen“, fügte sie verzweifelt hinzu. „Und bald wird es zu spät sein – wenn sie das nur wüsste!“
Venetia wusste es. Aber da sie nicht sah, wie dem abzuhelfen war, solange Conway hartnäckig im Ausland blieb, fand sie sich auch weiterhin mit ihrer Situation ab. Lady Denny wäre erstaunt gewesen, hätte sie erfahren, mit welch bösen Ahnungen Venetia ihre Zukunft betrachtete.
Für ein jedes Frauenzimmer in ihrer Lage wäre diese Zukunft wirklich freudlos gewesen. Sie schien ihr keine andere Wahl zu lassen, als entweder Edward Yardley zu heiraten oder das Leben einer alternden und wahrscheinlich unwillkommenen, unnützen alten Jungfer im Haushalt ihres Bruders zu führen. Da sie Herrin über ein ausreichendes Einkommen war, so würde es eher Konvention als Abhängigkeit sein, die sie zwingen würde, in Undershaw zu bleiben. Unverheiratete Damen hatten einfach nicht allein zu leben. Schwestern über das Heiratsalter hinaus durften das eventuell. Vor vielen, vielen Jahren hatten es Lady Eleanor Butler und ihre teure Freundin, Miss Sarah Ponsonby, getan, freilich trotz elterlicher Opposition. Sie waren in ein Bauernhaus irgendwo in Wales geflohen und hatten der Welt entsagt, ganz als wären sie Nonnen gewesen. Aber da sie immer noch dort lebten und sich, soweit bekannt, nicht von ihrer Zuflucht weggerührt hatten, dürften sie vermutlich zufrieden gewesen sein.
Aber Venetia war keine Exzentrikerin, und selbst wenn sie eine Busenfreundin besessen hätte, hätte sie auch nicht einen Augenblick lang daran gedacht, mit ihr zusammenzuziehen – da wäre selbst eine Heirat mit Edward einer solchen Verbindung vorzuziehen gewesen. Und ohne ihre Fantasie mit kindisch mädchenhaften Träumen von einem edlen und schönen Freier zu füttern, hatte Venetia doch das Gefühl, dass eine Ehe mit einem anderen als Edward die angenehmste Lösung ihrer Schwierigkeiten bedeutet hätte.
Sie war noch nie verliebt gewesen. Und mit fünfundzwanzig hegte sie keine großen Erwartungen mehr. Ihre einzige Bekanntschaft mit romantischer Liebe lag zwischen den Deckeln der Bücher eingeschlossen, die sie gelesen hatte. Und wenn sie vor langer Zeit auch einmal vertrauensvoll das Auftauchen eines Sir Charles Grandison auf der Bildfläche erwartete, so hatte es nicht lange gedauert, bis die Vernunft einen solchen Optimismus verdrängte.
In den Tagen, als sie hie und da bei den Unterhaltungen in York erschien, hatte sie sehr viel Bewunderung erregt. Mehr als ein vielversprechender junger Gentleman, der zuerst von ihrer Schönheit betroffen und dann von ihrem freimütigen Benehmen und dem Charme ihrer lächelnden Augen gefangen genommen wurde, wäre sehr glücklich gewesen, eine bloße Ballsaalbekanntschaft zu vertiefen. Leider gab es aber keine Möglichkeit, sie in der üblichen Art zu vertiefen. Wenn auch verschiedene empfängliche Herren verbittert gegen das Barbarentum eines Vaters tobten, der keinem Besucher erlaubte, sein Haus zu betreten; keiner von ihnen war so tief ins Herz getroffen, nachdem er mit der lieblichen Miss Lanyon einen einzigen Ländler getanzt hatte, dass er jeden Kanon der Schicklichkeit beiseitegeschoben hätte. Aus der grässlichen Angst heraus, einen großen Narren aus sich zu machen, war keiner von York nach Undershaw geritten, um dort um die Parktore des Herrenhauses zu schleichen, in der Hoffnung, ein heimliches Treffen mit Venetia zu erreichen oder gar sich seinen Weg in das Haus zu erzwingen.
Nur Edward Yardley, dem Patenkind Sir Francis’, wurde stillschweigend die Erlaubnis gewährt, dessen Schwelle zu überschreiten. Er wurde nicht willkommen geheißen, da Sir Francis während seiner Besuche selten aus seiner Bibliothek auftauchte, aber da Edward mit Venetia spazieren gehen, plaudern und ausreiten durfte, glaubte man allgemein, dass ein Heiratsantrag von ihrem mürrischen Papa akzeptiert worden wäre.
Niemand hätte Edward als einen ungeduldigen Liebhaber bezeichnen können. Venetia war der Magnet, der ihn nach Undershaw zog, aber es dauerte vier Jahre, bevor er sich erklärte, und sie hätte damals fast glauben können, dass er es gegen seine bessere Überzeugung tat. Sie zögerte nicht, seinen Antrag abzulehnen, denn wie sehr sie auch seine guten Eigenschaften schätzte und wie dankbar sie ihm auch für die verschiedenen Dienste, die er für sie besorgte, war – lieben konnte sie ihn nicht.
Sie wäre froh gewesen, mit ihm weiter in alter Freundschaft zu verkehren, aber Edward, der sich endlich zu dem Antrag aufgerafft hatte, war dann anscheinend ebenso hartnäckig wie zuversichtlich. Er war über ihre Ablehnung durchaus nicht niedergeschlagen. Er schrieb diese ganz ernstlich der Schüchternheit zu, einer mädchenhaften Bescheidenheit und Überraschung, ja sogar ihrer Ergebenheit zu ihrem verwitweten Vater. Er versicherte ihr freundlich, dass er solche Gefühle durchaus verstand, und gab sich zufrieden, zu warten, bis sie ihr eigenes Herz erforscht hatte – und begann von jenem Tag an, ihr gegenüber ein herrisches Benehmen zu entwickeln, das sie sehr oft dazu reizte, genau entgegengesetzt zu dem zu handeln, was er riet, und zu sagen, was immer ihr einfiel, das ihn bestimmt schockieren musste.
Aber es wirkte nicht. Er zeigte zwar seine Missbilligung häufig, milderte sie aber durch Duldsamkeit. Ihre Lebhaftigkeit faszinierte ihn, und er zweifelte nicht daran, dass er fähig war, sie – sobald sie einmal ihm gehören würde – ganz so zu formen, wie er sie haben wollte.
Als Sir Francis starb, wiederholte Edward seinen Antrag. Wieder wurde er abgelehnt. Diesmal war er hartnäckiger, was Venetia ohnehin erwartet hatte. Was sie hingegen nicht erwartet hatte, war, dass er plötzlich annahm, ihr dauerndes Zögern, seinen Antrag anzunehmen, entspringe dem, was er als ihre „besonders heikle Situation“ bezeichnete. Er sagte, er ehre sie wegen ihrer Gewissensbisse – was sie insgeheim für albern hielt – und würde es sich versagen, sie um eine andere Antwort zu drängen, bis Conway, ihr natürlicher Beschützer, heimkommen würde.
Was ihm eine derartige Idee in den Kopf gesetzt hatte, konnte sie beim besten Willen nicht entdecken, da sich ihrer Verblüffung nur zwei mögliche Lösungen boten: die erste, dass sie ihn zwar stark anzog, er jedoch durchaus nicht überzeugt war, sie würde als seine Gattin zu einem behaglichen Leben beitragen; die zweite, dass ihm das seine Mutter suggeriert hatte.
Mrs. Yardley war eine farblose kleine Frau, immer seinem Willen untertan, die sich nur in seiner Gegenwart mild erwärmte. Sie war Venetia gegenüber nie anders als höflich gewesen, aber Venetia war fest überzeugt, dass sie Edwards Heirat mit ihr nicht wünschte.
Mit der Neuigkeit einer sehr realen Hoffnung, dass die Besetzungsarmee bald aus Frankreich abgezogen werden würde, war für Venetia das Problem der Zukunft plötzlich nahe gerückt.
Während sie nun mit ihrem Hund durch den Park von Undershaw wanderte, wälzte sie dieses Problem immer wieder, aber es hatte nicht viel Zweck, wie sie sich traurig eingestand. So viel beruhte auf Vermutungen, im besten Fall auf Möglichkeiten. Das einzig Sichere war, dass Edward, wenn Conway heimkam, eine günstige Antwort auf seine Werbung erwarten und nicht leicht zu überzeugen sein würde, irgendeine andere zu akzeptieren. Das war natürlich ihre eigene Schuld, weil sie zu sehr bereit gewesen war, an dem Aufschub festzuhalten, den ihr seine seltsame Vorstellung von Schicklichkeit gewährt hatte. Ihm, wenn auch nur stillschweigend, zuzustimmen, dass nichts entschieden werden konnte, solange Conway nicht heimkam. Man konnte von Edward kaum Verständnis dafür erwarten, dass ihre Antwort weitgehend davon abhing, was Conway zu tun beabsichtigte. Zwischen Conway und Clara Denny hatte eine ziemlich sentimentale Kinderliebe bestanden, bevor er zur Armee gegangen war, der zumindest Clara Bedeutung zuzuschreiben schien. Wenn Conway ihr eine gleiche Bedeutung beimaß, würde sie sich mit einer Schwägerin behaftet sehen, die nur allzu bereit sein würde, die Führung ihres Haushalts in die Hände von Conways Schwester zu legen, zu der sie ihr ganzes Leben lang mit demütiger Bewunderung aufgeschaut hatte. Das, dachte Venetia, wäre sehr schlimm für Clara, aber auch sehr schlimm für mich, nur glaube ich nicht, dass ich es wirklich über mich brächte, bei der armen kleinen Clara die zweite Geige auf Undershaw zu spielen!
Eine Ehe mit Edward würde bequem und etwas Sicheres sein. Er würde ein freundlicher Gatte werden und sie bestimmt vor unfreundlichen Stürmen schützen. Aber Venetia war mit einem Lebenshunger geboren worden, der ihm unbekannt war, und einem hohen Mut, der sie in den Stand versetzte, Schicksalsschlägen ins Auge zu blicken und nicht davor zurückzuschrecken, ihnen zu begegnen. Weil sie nicht über das ihr aufgezwungene abgeschlossene Leben jammerte, glaubte Edward, sie sei so wie er damit zufrieden, alle ihre Tage in dem Schatten der Cleveden-Berge zu verbringen.
Sie war so sehr alles andere als zufrieden, dass sie sich nie auch nur vorgestellt hatte, dies könnte ihr endgültiges Schicksal sein. Sie wollte die übrige Welt sehen – die Ehe interessierte sie nur als einziges Mittel der Flucht für ein adeliges Mädchen.
Praktisch genommen, dachte Venetia, als sie den Park verließ und in einen schmalen Heckenweg einbog, der ihn von dem Nachbargut Elliston Priory trennte, ist meinem Fall klar und deutlich nicht zu helfen, und mir bleibt nichts übrig, als mich zu entschließen, ob ich die Tante für Conways Kinder oder die Mutter für Edwards Kinder werden soll – und ich habe eine deprimierende Ahnung, dass Edwards Kinder grässlich langweilig ausfallen werden, arme kleine Dinger! Wo ist bloß dieser grässliche Hund wieder? „Flurry! Hierher, Flurry!“
Nachdem sie mit wachsendem Ärger ihren Hundefreund gerufen hatte, kam er dahergaloppiert, voll Liebenswürdigkeit, mit keuchenden Flanken und hängender Zunge. Da er beträchtlich außer Atem war, war er so nett, in ihrer Sicht zu bleiben, bis sie nach einigen hundert Metern den Heckenweg hinunter die Gründe der Priory durch ein Drehkreuz neben einem schweren Gutstor betrat. Dieses gewährte den Zutritt zu einem uralten Wegrecht, aber Venetia, die mit dem Verwalter des Lord Damerel auf vorzüglichem Fuß verkehrte, stand es frei, auf Damerels Domäne herumzustreifen, wo sie wollte, wie Flurry sehr gut wusste.
Erholt durch das kurze Zwischenspiel im Heckenweg, raste er in Richtung der Wälder davon, die sich über einen sanften Abhang zu dem Fluss hinabzogen, der sich durch die Gründe der Priory schlängelte. Jenseits des Flusses lag die Priory selbst. Ein weit ausladendes Gebäude, das in Tudorzeiten auf den Grundfesten des ursprünglichen Baus errichtet und später erweitert worden war und von dem es hieß, es stecke ebenso voll von einem Schatz an Vertäfelungen wie einer Menge Unbequemlichkeiten. Um das Haus kümmerte sich Venetia nicht, aber die Gründe waren jahrelang die Lieblingsschlupfwinkel der drei jungen Lanyons gewesen.
Sir Francis’ Launen hatten ihn immerhin nicht dazu verführt, seinen Besitz zu vernachlässigen, den er in vorzüglicher Ordnung hielt. Seine Kinder aber zogen es vor, Abenteuer in weniger gepflegter Umgebung zu suchen. Die Wälder der Priory, einer Art Wildnis, entsprachen genau jugendlichen Vorstellungen davon, was romantisch-abenteuerlich ist. Wenn es auch Venetia, als sie erwachsen war, für einen Jammer hielt, dass der Besitz so vernachlässigt war, so behielt er doch immer noch seinen Zauber für sie, und sie wanderte oft hier herum. Da sein Besitzer nur sehr selten herkam, konnte sie es dem ungehorsamen Flurry erlauben herumzustreifen, wie er wollte, Kaninchen zu jagen und Fasane aufzuscheuchen, ohne die Gefahr, dass er Zorn auf sein Haupt lud.
Der „verruchte Baron“, wie sie vor langer Zeit Lord Damerel getauft hatten, würde es weder erfahren, noch würde es ihn kümmern – die einzige Gesellschaft, die er je in die Priory mitgebracht hatte, war bestimmt keine Jagdgesellschaft gewesen.
Seine Familie war alt und vornehm, aber den derzeitigen Träger des Titels hielten die Ehrbaren für den einzigen schwarzen Fleck der Umgebung. Es war geradezu eine Ungehörigkeit, seinen Namen in anständiger Gesellschaft zu erwähnen. Unschuldige Erkundigungen der Kinder, die wissen wollten, warum Lord Damerel eigentlich nie in der Priory lebte, wurden unterdrückt. Man sagte ihnen, sie seien zu jung, um das zu verstehen, und dass sie durchaus nicht über ihn nachzudenken und noch weniger über ihn zu sprechen brauchten – es sei zu befürchten, dass Seine Lordschaft kein wirklich guter Mensch war; und jetzt sei es genug, und sie sollten laufen und spielen gehen.
Das war, was Miss Poddemore Venetia und Conway sagte, und natürlich spekulierten sie über die mögliche – und auch unmögliche – Art der Verbrechen Seiner Lordschaft und schufen sehr schnell eine Gestalt düsterer Romantik aus Miss Poddemores geheimnisvollen Äußerungen. Es dauerte Jahre, bevor Venetia entdeckte, dass Damerels Schurkerei nichts so Entsetzliches wie Mord, Verrat, Piratentum oder Straßenräuberei enthielt und eher schmutzig als romantisch war.
Das einzige Kind von Eltern vorgerückten Alters. Kaum hatte er eine diplomatische Karriere eingeschlagen, als er sich auch schon Hals über Kopf in eine verheiratete Dame von Rang verliebte und mit ihr durchbrannte. Auf diese Weise ruinierte er seine eigene Zukunft, brach das Herz seiner Mama und war die Ursache dafür, dass sein Papa einen Schlaganfall erlitt, von dem sich dieser nie mehr ganz erholte. Ja, da diesem drei Jahre später ein zweiter und tödlicher Schlaganfall folgte, war es nicht zu viel gesagt, dass ihn die schockierende Affäre tatsächlich umgebracht hatte. Jede Erwähnung seines Erben war in seinem Haushalt verboten gewesen.
Nach seinem Tod lebte seine Witwe, die für Venetia Sir Francis Lanyon deutlich verwandt zu sein schien, halb abgeschlossen in London und besuchte die Besitzungen in Yorkshire nur sehr selten.
Was den neuen Lord Damerel betraf, gab es zwar sehr viele Gerüchte über seine späteren Handlungen, aber niemand wusste wirklich, was mit ihm geschehen war. Sein skandalöses Benehmen war mit dem kurzlebigen Frieden von Amiens zusammengefallen, und er hatte seine gestohlene Herzensdame aus dem Land verschwinden lassen. Alles, was nachher von ihr bekannt wurde, war, dass ihr Gatte eine Scheidung verweigert hatte. Wie lange sie bei ihrem Liebhaber geblieben war, ob sie geflohen waren, als der Krieg wieder ausbrach, sowie ihr endgültiges Schicksal waren Probleme, über die viele Vermutungen angestellt wurden.
Deren populärste war die, dass sie von ihrem Liebhaber verstoßen und Bonapartes gierigen Soldaten zur Beute gefallen war. Womit ihr, wie die Dorfbewohner nicht verfehlten, ihren irrenden Töchtern vor Augen zu führen, ganz recht geschah und was genau das war, was jedem Mädchen zustoßen muss, das mit seiner Tugend sorglos umgeht.