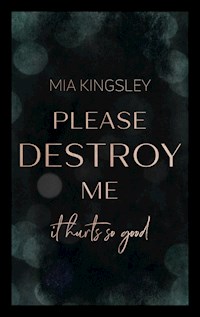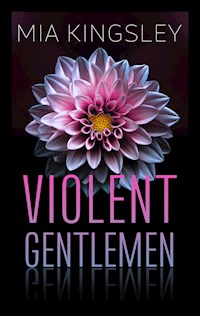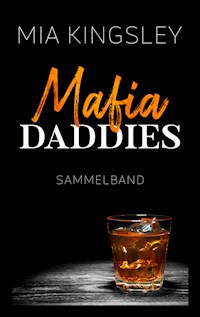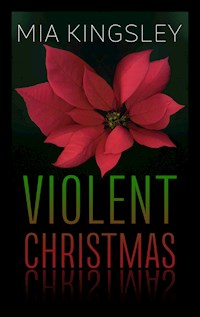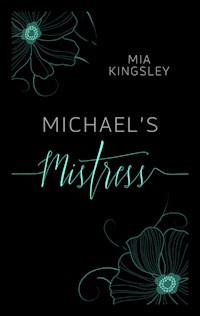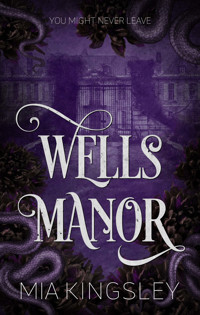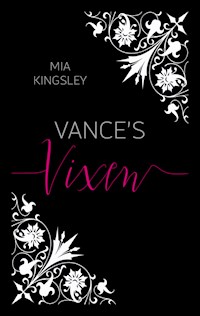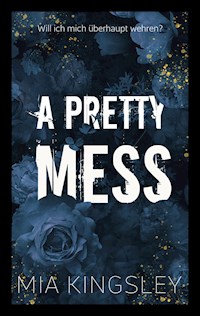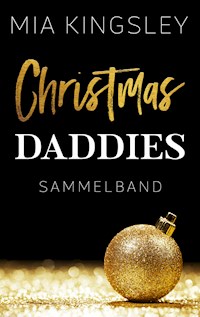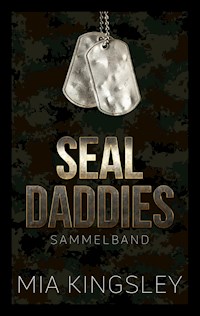Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Black Umbrella Publishing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie ist wie ein Feuer, das ich löschen muss. Doch ich habe kein Wasser. Ich habe nur Benzin. Er ist wie ein Song, den ich einfach nicht aus meinem Kopf bekomme. Im Alter von 17 Jahren wurde ich entführt. Es dauerte mehr als vier Jahre, bis ich die Chance bekam, den Mann zu töten, der mir die Freiheit genommen hat. Ich dachte, nach meiner Flucht könnte mein Leben weitergehen. Ich habe gehofft, meine Wunden würden heilen. Bis jetzt. Denn mein Entführer hatte einen Sohn – und er ist hinter mir her, um zu beenden, was sein Vater begonnen hat … WARNUNG IM BUCH BEACHTEN! Dark Romance. Düstere Themen. Eindeutige Szenen. Deutliche Sprache. In sich abgeschlossen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
VENGEANCE IS HIS
MIA KINGSLEY
DARK ROMANCE
INHALT
Vengeance Is His
Playlist
Warnung
0
0.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Mehr von Mia Kingsley lesen
Über Mia Kingsley
Copyright: Mia Kingsley, 2018, Deutschland.
Coverfoto: © Mia Kingsley
Korrektorat: http://www.swkorrekturen.eu
Alle Rechte vorbehalten. Ein Nachdruck oder eine andere Verwertung ist nachdrücklich nur mit schriftlicher Genehmigung der Autorin gestattet.
Sämtliche Personen in diesem Text sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zufällig.
Black Umbrella Publishing
www.blackumbrellapublishing.com
VENGEANCE IS HIS
Sie ist wie ein Feuer, das ich löschen muss. Doch ich habe kein Wasser. Ich habe nur Benzin.
Er ist wie ein Song, den ich einfach nicht aus meinem Kopf bekomme.
Im Alter von 17 Jahren wurde ich entführt. Es dauerte mehr als vier Jahre, bis ich die Chance bekam, den Mann zu töten, der mir die Freiheit genommen hat.
Ich dachte, nach meiner Flucht könnte mein Leben weitergehen. Ich habe gehofft, meine Wunden würden heilen. Bis jetzt.
Denn mein Entführer hatte einen Sohn – und er ist hinter mir her, um zu beenden, was sein Vater begonnen hat …
PLAYLIST
Hurt – Johnny Cash
This Could Be Love – Alkaline Trio
Misery – Creeper
Still A Stranger – AFI
Serpent – Neck Deep
Warning From My Demons – Slaves
ihateit – Underoath
Liar (It Takes One To Know One) – Taking Back Sunday
Lying Is The Most Fun A Girl Can Have Without Taking Her Clothes Off – Panic At The Disco
Count Bassy – Dance Gavin Dance
Screen – Twenty One Pilots
What You Do To Me – Don Broco
Dance Macabre – Ghost
Mulholland Drive – The Gaslight Anthem
History – Funeral For A Friend
Leave Out All The Rest – Linkin Park
It Ends Tonight – The All-American Rejects
Iris – The Goo Goo Dolls
Just Give Me A Reason – Pink
I Hate You, Don’t Leave Me – Demi Lovato
Issues – Julia Michaels
My Gun – Tove Lo
Him & I – G-Eazy feat. Halsey
One Dance – Conor Maynard feat. Harper
Dusk Till Dawn – ZAYN feat. Sia
Dark Side – [Sebell]
Monsters – Ruelle
Bite – Troye Sivan
Young And Beautiful – Lana Del Rey
WARNUNG
»Vengeance Is His« ist eine Rachegeschichte mit düsteren Themen wie Missbrauch, Folter und Mord. Einige Szenen könnten Trigger für sensible Leser enthalten.
Es handelt sich um fiktionale Elemente, die in eine fiktionale Geschichte eingebunden sind. Die Schilderung solcher Situationen bedeutet weder dass ich Missbrauch gutheiße noch dass ich ihn verharmlosen möchte.
Wer sich bei der Beschreibung von sexualisierter Gewalt unwohl fühlt, sollte das Buch nicht lesen.
Wer noch kein Buch von mir kennt, sollte nicht mit dieser Geschichte anfangen.
Wer meine bisherigen Bücher bereits als »auf der Schmerzgrenze« empfunden hat, sollte dieses Buch definitiv nicht lesen.
Verurteile nicht meine Entscheidungen,
wenn du die Gründe nicht kennst.
0
Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich meinen Vater um etwas bat. Nachdem ich stets seine Anweisungen befolgt und ihm immer geholfen hatte, wusste ich, dass er nicht ablehnen konnte.
Am Tag, an dem ich Maggie traf, entschied sich ihr Schicksal.
Ich wollte sie für mich.
Bis heute hat sich daran nichts geändert. Jedes Mal, wenn ich Maggie sah, wollte ich ihr wehtun. Ich musste ihr wehtun. Es war ein innerer Drang, gegen den ich keine Chance hatte. Es trieb mich in den Wahnsinn, dass sie mir nicht gehörte und wahrscheinlich nie gehören würde. Deshalb wollte ich mir alles von ihr nehmen, was ich bekommen konnte.
Vielleicht habe ich deswegen getan, was ich getan habe. Wenn ich meine Finger langsam krümme, kann ich spüren, wie ihr Puls unter meinem harten Griff panisch schneller klopft, bevor er langsamer wird. Ich spüre es so deutlich, als wäre sie immer noch hier.
0.5
Die Luft auf dem Friedhof war kalt und frisch, weil die hohen Bäume das meiste Sonnenlicht abhielten. Der Geruch nach Mottenkugeln durchbrach das kühle Aroma. Ich hasste das seidige, schwarze Kleid, das ich tragen musste.
Meine Tante schien es aus der hintersten Ecke des Kleiderschranks hervorgezerrt zu haben. Ich wollte nicht hier sein, nicht dieses Kleid tragen und schon gar nicht nach Mottenkugeln riechen.
Bisher war niemandem aufgefallen, dass ich mich davongeschlichen hatte. Ich wanderte durch die langen Grabreihen und versuchte, mich in ein anderes Leben zu träumen – in eine parallele Dimension, in der ich nicht übrig geblieben war, nachdem ein betrunkener Lkw-Fahrer den Rest meiner Familie ausgelöscht hatte.
Wäre, hätte, könnte.
Ich presste die Augen zusammen, um nicht zu weinen. Stattdessen konzentrierte ich mich auf das Gefühl des Taus an meinen nackten Beinen. Ich hatte das Kleid zusammengerafft, weshalb die feuchten Halme meine Waden streiften.
Wäre ich nicht so eine gute Schülerin gewesen, hätte ich nicht am Debattierklub nach dem Unterricht teilgenommen, der mir keinen Spaß machte, aber gut auf der College-Bewerbung aussah. Wäre, hätte, könnte. Ich wollte nicht länger über die Alternativen nachdenken. Wäre ich mit im Auto gewesen, wäre vielleicht etwas anderes passiert.
Wäre, hätte, könnte.
So oder so hing ich nun in Maine bei meiner unsympathischen Tante fest. Sie hatte organisiert, dass meine Eltern und mein kleiner Bruder hier anstatt im sonnigen L. A. beerdigt wurden.
Ich legte den Kopf in den Nacken und fragte mich flüchtig, ob ich die Sonne jemals wiedersehen würde. Es war elf Uhr vormittags, fühlte sich allerdings an wie mitten in der Nacht.
»Mein Beileid.«
Erschrocken fuhr ich herum, ließ das Kleid los. Der Stoff raschelte um meine Beine, während ich den Typen anstarrte, der zwischen zwei Grabsteinen stand, lässig an einen von ihnen gelehnt. Er war bloß ein wenig älter als ich, möglicherweise siebzehn oder achtzehn Jahre alt.
Seine blonden Haare waren sorgfältig durcheinandergebracht. Ich war mir sicher, dass er dafür lange gebraucht hatte. Sein Kiefer war ausgeprägt und das Kinn hatte ein Grübchen. Instinktiv war mir klar, dass er sehr attraktiv sein würde, wenn er älter war. Dabei machte ich mir immer noch nicht viel aus Jungs.
Am faszinierendsten fand ich jedoch seine hellen Augen. Sie glänzten wie flüssiger Honig. Wie Bernstein. Der Gedanke war absurd, denn er stand zu weit weg, als dass ich sie dermaßen deutlich hätte sehen können. Trotzdem wusste ich, wie sie aussahen. Einfach so.
»Warum sagst du das?«, fragte ich.
Er hob eine Augenbraue, da er offensichtlich sehr von sich überzeugt war. »Du bist an einem Schultag auf dem Friedhof und trägst ein schwarzes Kleid.«
Ich sah an mir hinunter, weil mir schlagartig klar wurde, dass ich nach Mottenkugeln roch. Obwohl mir seine Meinung egal sein konnte, wollte ich ihn nicht in meiner Nähe haben, damit er mich nicht für einen nach Mottenkugeln stinkenden Freak hielt.
Ich zuckte mit den Achseln. »Und wenn schon.« Dann wandte ich mich ab, um zur Beerdigung meiner Familie zurückzukehren. Ich wollte nicht dorthin, aber noch weniger wollte ich verlegen mit einem fremden Jungen reden.
»Warte.« Er folgte mir.
Es behagte mir nicht, mit dem Rücken zu ihm zu stehen, weshalb ich mich wieder umdrehte. »Was?«
»Wie heißt du?« Er blieb hinter dem Grabstein stehen und verschränkte die Arme.
Ich strich mein Kleid glatt. »Wie heißt du?«
»Ich habe zuerst gefragt.« Er legte den Kopf schräg. Es gefiel mir, wie das Licht sich in seinen Augen brach, weshalb sie zu funkeln schienen. Wenn ich zu lange hinsah, flatterte es in meinem Bauch.
»Und?«
»Mein Name ist Roscoe.«
»Aha.« Ich warf ihm einen letzten Blick zu, bevor ich gehen wollte.
Mit überraschender Schnelligkeit beugte er sich vor und packte meinen Arm. »Das ist nicht sehr nett.«
Mein Herz klopfte heftiger. »Lass mich los.«
»Wenn du mir deinen Namen verraten hast.« Er machte einen Schritt um den Grabstein herum, bis er vor mir stand. Meinen Arm hielt er dabei die ganze Zeit fest. Ich spürte überdeutlich, wie lang und kräftig seine Finger waren, wie warm seine Haut.
»Marguerite. Meine Freunde nennen mich Maggie.«
Wie angekündigt ließ er mich los. »War das so schlimm, Maggie?« Ein Lächeln umspielte seine Mundwinkel.
»Du bist nicht mein Freund, also nenn mich nicht so.«
»Wir könnten Freunde werden.«
Ich musterte ihn von unten bis oben, bevor ich langsam den Kopf schüttelte. »Danke, nein.«
Er lachte, schob seine Hand in die Hosentasche und holte eine kleine Tüte mit Pfefferminzbonbons heraus. Nachdem er sich eines davon in den Mund geschoben hatte, hielt er sie mir hin. »Möchtest du auch?«
»Nein.«
Mit einem Achselzucken steckte er die Bonbons wieder ein. »Warum bist du hier?«
»Für eine Beerdigung, wie du schon so treffend festgestellt hast.« Mir war nicht klar, warum ich blieb. Ich wusste genau, dass ich nicht mit ihm sprechen sollte – aber im gedämpften Tageslicht des Friedhofs, nur wenige Meter von dem Loch entfernt, in dem meine Familie gleich verschwinden würde, sollte sich die Gefahr in Grenzen halten. Außerdem lenkten seine Augen mich von dem besagten Loch ab.
»Wessen Beerdigung, du kleine Klugscheißerin?«
Der Spitzname gefiel mir auf merkwürdige Weise, weil Roscoe ihn klingen ließ, als hielte er mich tatsächlich für clever. Roscoe war ein ungewöhnlicher Name. Zumindest war ich der Meinung, da ich ihn nie zuvor gehört hatte.
»Meine Familie.«
Er starrte mich bloß an.
»Meine Eltern und mein Bruder.«
»Mein Beileid.«
»Sagtest du bereits.«
»Dieses Mal meine ich es auch.«
Ich verstand nicht ganz, was er damit sagen wollte, und kommentierte es deshalb nicht. Stattdessen reckte ich das Kinn. »Ich glaube, ich brauche kein Beileid von Fremden. Außerdem sollte ich langsam zurück.«
»Du willst doch gar nicht zurück. Und wer sagt, dass wir keine Freunde werden können?« Er war ein Stück näher gekommen.
»Ich sage das. Auf Wiedersehen, Roscoe.«
»Bist du nicht einsam?« Seine Stimme hielt mich zurück.
Der Schmerz kam so schnell und scharf, dass mir die Luft wegblieb. »Was ist das für eine Frage?«, grollte ich, ohne mich umzusehen.
»Ich versuche nur, ein Gespräch mit dir zu führen.« Er berührte meine Schulter.
»Ich will nicht mit dir reden.« Damit schüttelte ich seine Hand ab. Ich war klug genug, um mir denken zu können, dass mit ihm etwas nicht stimmte. Warum ich mich auf dem Friedhof befand, war mir schmerzhaft bewusst, aber was wollte er hier? Die Bluejeans und das verwaschene, graue Shirt wirkten nicht, als wäre er ebenfalls auf einer Beerdigung zu Gast.
»Wir müssen nicht reden. Du könntest mich stattdessen küssen.«
Der Vorschlag war dermaßen absurd, dass ich lachte. Das Geräusch hallte unpassend über den Friedhof. In der Ferne flatterte ein Vogel davon.
»Was ist so lustig daran?« Roscoe legte einen Arm um meine Taille und zog mich an sich.
Weil ich nicht wusste, wie ich ihn sonst auf Abstand bringen sollte, legte ich beide Hände auf seine Brust und wollte drücken. Doch ich tat es nicht, da die neue Erfahrung, von einem Jungen gehalten zu werden, irgendwie interessant war. Er fühlte sich so fest unter meinen Fingern an. Die Neugier gewann für einige Sekunden und ich presste meine Handflächen gegen ihn.
Sein Körper war dicht an meinem, und als ich zum ersten Mal in meinem Leben einen harten Penis spürte, wusste ich sofort Bescheid. Roscoe wollte … mich. Oder Sex. Ich war mir aufgrund meines begrenzten Erfahrungsschatzes nicht sicher. Vielleicht waren die beiden Dinge aber auch deckungsgleich.
Er neigte den Kopf und küsste die empfindliche Stelle zwischen Hals und Schulter. Als ich merkte, wie er an mir schnupperte, erwachte ich wieder zum Leben. »Lass mich sofort los!«
Roscoe schaute mich an. »Magst du es nicht?«
»Nein.« Ich wollte ihn wegschieben, doch es ging nicht. Vor Anstrengung schnappte ich nach Luft und bemerkte, wie Roscoe daraufhin auf meine Lippen starrte.
Mit der einen Hand hielt er mich an sich gepresst, mit der anderen umfasste er meine Wange und küsste mich. Meine Finger krallten sich in seine Brust, was er nicht zu merken schien. Sein Kuss war ungestüm. Grob drang seine Zunge in meinen Mund. Er schmeckte nach Pfefferminz. Kurzzeitig war ich davon verwirrt.
Erst als er meine Brust umfasste und mein Nippel sich unter dem dünnen Stoff des Kleides zusammenzog, geriet ich in Panik. Sein Daumen zirkelte um die aufgerichtete Spitze. Ich spürte ein Prickeln zwischen den Schenkeln – der letzte Anstoß, den ich brauchte.
Ich nahm meine Hände zurück und stieß Roscoe mit aller Kraft von mir. Er rechnete nicht damit, stolperte nach hinten.
»Maggie …«, sagte er und breitete die Arme aus, als wäre ich ein wildes Tier, das er einfangen musste.
»Nicht!« Ich deutete mit dem Zeigefinger auf ihn. »Wage es ja nicht.«
»Ich bekomme immer, was ich will, Maggie.«
Die Selbstsicherheit, mit der er den Satz sagte, traf mich wie ein Vorschlaghammer. Ich drehte mich um und rannte los, weil es die einzige sinnvolle Reaktion war.
Kurz vor dem frischen Grab meiner Eltern hielt ich an und rang nach Luft. Meine Lippen und die Stellen, an denen Roscoe mich berührt hatte, prickelten.
Tante Maude kam zu mir und ließ ihren Blick über mich schweifen. »Wo warst du?«
Ich drehte mich um, doch Roscoe war weg. Die Gräber lagen friedlich und verlassen da. Ich schluckte. »Nur spazieren.«
1
Meine Lunge brannte längst, doch ich war zu sehr darauf fokussiert, wie meine Haare unter Wasser um meinen Kopf schwebten. Das Braun wirkte viel lebhafter und intensiver, als würde es trocken bis auf meine Schultern hängen.
Punkte flirrten vor meinen Augen. Nicht nur die Luft wurde knapp, auch die Zeit. Ich wollte so gern weiter auf dem Grund des Pools bleiben.
Mit einem innerlichen Seufzen stieß ich mich vom Boden ab und durchbrach die glatte Oberfläche des Hotelpools. Sofort hüllten mich die Geräusche ein. Die kühle Luft ließ mich erschauern.
Es war verdammt früh am Morgen, weshalb niemand außer mir hier war. So weit am Arsch der Welt, wie das Hotel lag, wagte ich ohnehin zu bezweifeln, dass hier jemand ein Zimmer hatte, der nicht zur Hochzeitsgesellschaft gehörte.
Ich kletterte aus dem Pool und nahm das weiße Handtuch von der Liege. Während Isabelle vermutlich längst in ihrem Brautkleid steckte und professionell zurechtgemacht wurde, blieben mir noch knapp 90 Minuten, um zu duschen und mir selbst ein ansehnliches Gesicht aufzumalen.
Mein Nacken knackte, als ich den Kopf kreisen ließ. Ich hatte vor Anspannung kaum geschlafen und den letzten Rest Energie, der danach geblieben war, hier im Pool gelassen. Fünfundsiebzig Bahnen war ich geschwommen, bevor meine Arme zu sehr gezittert hatten, um weiterzumachen. Meine Beine waren weich wie Pudding, aber das war gut. Vielleicht würde ich zu müde sein, um angesichts der bevorstehenden Hochzeit in Panik zu geraten.
Mit einem letzten sehnsüchtigen Blick auf den Pool, dessen Oberfläche bereits wieder spiegelglatt war, verließ ich den Raum und ging zu den Aufzügen. Im Foyer im zweiten Stock musste ich den Lift wechseln, da es nur einen für die ungeraden und einen für die geraden Stockwerke gab. Mein Zimmer lag im 15. Stock, der Pool im 4. Stock. Ich fragte mich, wie Isabelle auf dieses Hotel gekommen war.
Als die Türen sich gerade schlossen, glaubte ich, für einen Moment Detective Elliot Dale auf einem der Sofas zu sehen, die in kleinen Gruppen arrangiert im Foyer standen.
Während die Kabine nach oben glitt, runzelte ich die Stirn. Sicher hatte ich mir nur eingebildet, den Cop hier gesehen zu haben. Die Hölle wäre zugefroren, bevor Isabelle jemanden zur Hochzeit einlud, der sie an unsere gemeinsame Vergangenheit erinnerte. Außerdem hatte ich die Gästeliste ausgiebig studiert, und sein Name war definitiv nicht darauf gewesen.
Das Schloss an der Zimmertür piepte mit einem nervenaufreibenden Geräusch, als ich sie mit der Karte öffnete. Ich hatte schon Wecker gehabt, die nicht so aggressiv geklungen hatten.
Nachdem ich das Handtuch über den Rand der Badewanne gehängt hatte, zog ich den Badeanzug aus, der bereits unangenehm an meiner Haut klebte. Ich trat unter die Dusche, um das stark gechlorte Wasser des Pools abzuwaschen.
Mit geschlossenen Augen hob ich das Gesicht dem Strahl entgegen, wobei das sanfte Plätschern aus dem Duschkopf dieses Wort kaum verdiente. Ich wusch meine Haare, bevor ich nach dem Conditioner griff, weil ich immer noch Chlor riechen konnte.
Als ich fertig war, wickelte ich mich in ein frisches Handtuch und wischte den Spiegel frei. Unter meinen grünen Augen lagen tiefe Schatten, die ich gleich mit Concealer verdecken würde. Die Mühe konnte ich mir vermutlich sparen, da Isabelle sie trotzdem sehen und mir Vorhaltungen machen würde und ich ohnehin nicht daran interessiert war, die Aufmerksamkeit der anwesenden Single-Männer auf mich zu lenken.
Ungeschminkt würde ich auf einer Hochzeit allerdings ebenso auffallen.
Ich nahm meine Bürste und begann vorsichtig, meine Haare zu entwirren. Es dauerte eine Weile, bis sie nicht länger einem Vogelnest glichen, das der Schwerkraft zum Opfer gefallen war – der Preis für dickes Haar, um das ich oft beneidet wurde.
Automatisiert föhnte ich meine Haare und drehte sie mit dem Lockenstab ein, mein Kopf schaltete ab.
Kurze Zeit später stand ich mit dezentem Make-up und luftigen Locken, von denen in wenigen Stunden nichts mehr übrig sein würde, nackt vor dem Bett und versuchte mich dazu durchzuringen, das mintfarbene Kleid anzuziehen.
Ich hatte bereits die schmale Goldkette und die Ohrstecker angelegt, doch ich schaffte es nicht, in das Kleid zu steigen. Die Farbe verursachte mir Übelkeit. Ich hätte etwas sagen können, aber Isabelle war so in die mintfarbenen Kleider verliebt gewesen, dass ich es nicht über mich gebracht hatte.
Es ist nur ein Kleid, sagte ich mir selbst und griff mit spitzen Fingern nach dem Stoff, während ich zu ignorieren versuchte, wie mein Magen sich weiter und weiter verkrampfte.
2
Mein Rücken tat weh und meine Brust schmerzte dort, wo der Volleyball mich getroffen hatte. Außerdem verriet mir das Gefühl in meinen Füßen, dass ich neue Sportschuhe brauchte. Mit einem Seufzen kickte ich einen Kieselstein vom Bürgersteig, weil ich mir bereits vorstellen konnte, wie Tante Maude auf diese Nachricht reagieren würde. Noch mehr Geld, das sie für das ungewollte Kind, die zusätzliche Belastung ausgeben musste. Sie sagte es nicht, allerdings wusste ich, dass ich ein Klotz an ihrem Bein war. Für sie war es schwer genug, Männer kennenzulernen, die etwas taugten, doch ihnen zu erklären, warum ich in ihrem Haus herumlungerte, erstickte die Flamme meist, bevor sie überhaupt aufgeflackert war.
Ich hätte nur zu gern auf die Schuhe verzichtet – ebenso wie auf das Volleyballtraining. Allerdings brauchte ich ein Stipendium, wenn ich aufs College wollte, ohne meine Nieren zu verkaufen, und Sport schien momentan mein bester Weg dorthin zu sein.
Heute war wirklich nicht mein Tag gewesen. Eigentlich war jeder Tag nicht mein Tag, seit meine Familie gestorben war. Das Einzige, was mich morgens dazu brachte, aufzustehen, war die Gewissheit, wie enttäuscht Mum gewesen wäre, wenn ich mich hängen ließ. Leichter wurde es dadurch nicht.
An der nächsten Häuserecke lungerten vier Jungs herum, die kaum älter waren als ich, aber aussahen, als würden sie nicht die besten Absichten hegen. Schnell entschied ich, die Straßenseite zu wechseln. Ich war nicht dumm und gut darin, Ärger zu vermeiden.
Vor allem, da es bereits dunkel wurde. Das zusätzliche Volleyballtraining machte meinen ohnehin straffen Stundenplan noch voller. Es war bereits so spät, dass ich nicht wusste, wie ich die Hausaufgaben bewältigen sollte, zumal ich eigentlich nur schlafen wollte. Die Lehrer hier waren längst nicht so entspannt wie in Los Angeles.
Kurz bildete ich mir ein, dass die Jungs mir folgten, weil ich Schritte hörte, doch als ich mich umdrehte, hetzte eine Frau in einem abgetragenen Trenchcoat an mir vorbei. Sie trug zwei große Beutel und wurde mit jedem Schritt schneller.
Ich schob die Hände in die Taschen meiner gefütterten Jeansjacke. Sobald die Sonne unterging, wurde es eiskalt. Je länger ich nachdachte, desto weniger mochte ich Maine. Wenn ich nächstes Jahr volljährig war und meinen Schulabschluss hatte, würde ich nach Los Angeles zurückkehren – wobei die Stadt für mich immer mit den Erinnerungen an meine Familie verknüpft sein würde. Vielleicht sollte ich Miami oder Tampa eine Chance geben. Ein neues Leben in der Sonne. Der Gedanke versöhnte mich, als ein neuer Kälteschauer über meinen Rücken lief.
Ich ignorierte meine schmerzenden Füße und beschleunigte mein Tempo, um ins Warme zu kommen. Tante Maude hatte die ganze Woche Spätschicht, also konnte ich gleich so heiß und so lange duschen, wie ich wollte.
Die Laterne am Ende der Straße, in der Tante Maude im letzten Haus wohnte, war noch immer nicht repariert worden und flackerte traurig, als ich näher kam.
Ein schwarzer Wagen parkte nah vor dem Zaun, der das Grundstück eingrenzte. Wirklich ein merkwürdiger Ort zum Parken, überall im Wendekreis war genug Platz.
Das Gras im Vorgarten hätte schon vor Wochen gemäht werden müssen, doch Tante Maude gab sich keine große Mühe, das Haus oder das Grundstück zu pflegen. Nicht wie Dad, der jedes Wochenende einen Pinsel, eine Zange oder einen Schraubenzieher in der Hand gehabt hatte.
Ich biss die Zähne aufeinander, um nicht zu weinen. Als ich mich an dem Wagen vorbeischob, öffnete sich die Fahrertür.
Ein Mann etwa im Alter meines Dads stieg aus. Er trug eine Lederjacke mit einem mintfarbenen Shirt darunter. Die Farbe irritierte mich, weil sie an ihm deplatziert wirkte.
Er blieb einige Schritte von mir entfernt stehen, stemmte seine Hand in die Hüfte. Dadurch schob er die Lederjacke nach hinten und enthüllte eine Polizeimarke. Meine Kehle schnürte sich zu.
Ich sah das Mitleid in seinen hellen Augen. Er runzelte die Stirn und presste kurz die Lippen aufeinander, als würde er nicht wissen, was er zu mir sagen sollte.
»Marguerite Clarkson?«
Mein Magen verkrampfte sich. Um Himmels willen – nicht schon wieder. Das war der erste Gedanke, der mir durch den Kopf schoss. Als das letzte Mal eine Polizistin meinen Namen gesagt hatte, war gleich darauf die Nachricht vom Tod meiner Eltern gefolgt.
Ich schob die Hände tiefer in meine Jackentaschen, die Fäuste geballt. »Ja. Und Sie sind?«
»Detective Dylan White. Es tut mir sehr leid – deine Tante hatte einen Unfall.«
Ich hörte die Worte, aber ich konnte sie nicht glauben – nicht, weil ich leugnen wollte, was passiert war, wie es bei meinen Eltern der Fall gewesen war, sondern weil die Situation mir merkwürdig vorkam.
Seine Stimme war absolut tonlos, und er versuchte nicht, mich aufzumuntern. Beim letzten Mal waren es zwei Cops und eine Psychologin gewesen, die vor der Schule auf mich gewartet hatten.
Ich blinzelte und starrte auf sein mintfarbenes Shirt, weil der Blick aus seinen blassen Augen mir unangenehm war. »Was ist passiert?« Meine Stimme bebte.
»Sie hatte einen Unfall und wird gerade operiert. Es sieht leider nicht gut aus. Wenn du einsteigen würdest, fahre ich dich zum Krankenhaus.«
Ich sah von ihm zum Wagen und die Haare in meinem Nacken sträubten sich. Unwillkürlich trat ich einen Schritt zurück. Er hatte zweimal gesagt, dass sie einen Unfall hatte, allerdings nicht was für einen.
Das Handy begann hinten in meiner Gesäßtasche zu klingeln. Seine Miene verhärtete sich, als ich es hervorholte.
»Tante Maude« stand im Display. Mein Herz klopfte schneller. Ich nahm den Anruf entgegen. »Ja?«
»Maggie, Schatz, ich habe vergessen, Tonys Futter hinzustellen. Könntest du ihn gleich füttern?«
»Klar.«
»Danke.« Sie legte auf und ich steckte das Handy weg.
Tony war Tante Maudes fetter, schwarzer Kater. Ich wagte stark zu bezweifeln, dass sie sich von dem Operationstisch, auf dem sie sich angeblich befand, aufgerichtet hatte, um mich anzurufen.
Mit klammen Fingern deutete ich auf die Beifahrertür. »Soll ich einsteigen?«
Seine gerunzelte Stirn glättete sich sofort. »Ja.«
Ich legte die Hand an den Türgriff und wartete, bis er den Wagen umrundet hatte und einstieg, dann rannte ich los. Ich musste zum Haus unserer Nachbarn und laut um Hilfe schreien. Mister Curtis war Kampfsportlehrer – er würde mir sicher helfen.
Doch nach wenigen Schritten wurden meine Beine unter mir weggetreten und ich krachte auf den Bürgersteig. Schmerz explodierte hinter meiner Stirn. Etwas Feuchtes lief in mein Haar, als ich ruckartig auf den Rücken gedreht wurde.
Der Mann packte meinen Knöchel und zog mich hinter den Wagen, sodass wir für jeden anderen auf der Straße unsichtbar waren. Er presste eine Hand auf meinen Mund. Ich versuchte, mich aufzubäumen, aber er war viel zu schwer.
Eine Nadel durchstach die Haut an meinem Hals. Voller Entsetzen starrte ich auf das mintfarbene Shirt, bis meine Lider schwer wurden.
Hilfe.
3
Nachdem wir uns alle gesetzt hatten, räusperte sich der Priester. Ich beobachtete, wie Marc sich verstohlen eine Träne aus dem Augenwinkel wischte, und verstand ihn. Isabelle sah in dem weißen Kleid traumhaft schön aus. Es schmiegte sich an ihren Körper und ließ sie wie eine Elfe wirken.
Nichtsdestotrotz roch es in der Kirche nach Zwiebeln und zu viel Parfüm. Ich musste mich zusammenreißen, um an etwas anderes zu denken. Meine Nase war schon immer empfindlich gewesen, weshalb ich besonders große Menschenansammlungen unerträglich fand.
»Liebe Gäste, lieber Marc, liebe Isabelle, wir haben uns heute hier versammelt, um …«
Ich blendete aus – zum einen da ich mich schnell langweilte, zum anderen weil in mir nichts mehr existierte, was mit dieser Gefühlsduselei etwas hätte anfangen können. Nach allem, was passiert war, konnte ich mir nicht vorstellen, es eines Tages wie Isabelle hinter mir zu lassen und jemandem zu vertrauen.
Ich hatte gesehen, wie Isabelles Mutter mich angelächelt hatte. Sie hatte neues Vertrauen gefasst. Nach all den schrecklichen Dingen, die ihrer Tochter zugestoßen waren, gab es wieder Liebe in ihrem Leben. Ich spürte förmlich, wie ihre Hoffnung zu mir herüber waberte. Wahrscheinlich dachte sie, dass ich auch bald mein Glück finden würde. Weil es von mir erwartet wurde, hatte ich ihr Lächeln erwidert. Niemand musste erfahren, dass für mich keine Hoffnung mehr bestand.
Nachdem ich vor fünfzehn Jahren meine Familie beerdigt hatte, war nur noch ein schwacher Funken Zuversicht übrig gewesen. Als Dylan White mich entführt hatte, war er vollkommen erloschen. Ich wusste nicht mehr, wie Hoffnung und Optimismus sich anfühlten.
Für mich gab es kein Happy End – mit etwas Glück die Chance auf einen Abschluss, aber garantiert kein Happy End. Einen würdigen Abschluss und Antworten auf die Fragen, die mich seit Jahren quälten.
Ich war nicht wie Isabelle gewesen. Nicht, bevor ich aus meinem Leben gerissen worden war, und noch weniger danach.
Wenn ich nicht zufällig jeden Schritt des Weges dabei gewesen wäre, hätte ich Mark nicht in Isabelles Nähe gelassen. Ich war dabei gewesen, als sie sich in einem Buchladen kennengelernt hatten. Bei ihrem ersten Date hatte ich zwei Tische weiter gesessen. Isabelle hatte Marc schneller vertraut als ich und mir letztendlich gesagt, dass sie es wagen wollte, sich allein mit ihm zu treffen – in der Hoffnung, dass sie genauso stark sein konnte wie ich.
Drei Jahre später saßen wir hier und sie heiratete ihn.
Seit uns die Flucht von Reilly’s Island gelungen war, hatten Isabelle und ich jede freie Minute miteinander verbracht. Anfangs waren wir sogar zusammen zu den Therapiestunden gegangen, bis ein Psychologe meinte, es wäre besser, wenn wir lernen würden, unabhängiger voneinander zu sein. Vielleicht war es der zweite oder dritte Seelenklempner gewesen. Genau konnte ich mich nicht mehr erinnern. Ich hatte so viele verschlissen.
Die Sache mit der Stärke war eine der wenigen Lügen, über die ich Isabelle nie aufgeklärt hatte. In meinen Augen war sie viel stärker als ich.
Nur, weil ich besessen davon geworden war, Kampfsport zu machen, und immer alle Ausgänge und Personen in einem Raum zählte, war ich nicht die Stärkere. Sicher, der letzte Kerl, der mir im Klub an den Hintern gefasst und sich beim Tanzen an mir gerieben hatte, war mit einem gebrochenen Kiefer in der Notaufnahme gelandet, nachdem ich ihn dreimal gut hörbar gebeten hatte, seine Finger von mir zu lassen.
Trotzdem war sie viel mutiger als ich. Wäre es anders, würde ich heute vorn stehen, statt unbehaglich auf der Holzbank mein Gewicht zu verlagern und darüber nachzudenken, wie abgefuckt ich war.
Ich war nicht in der Lage dazu, Beziehungen zu führen. Selbst One-Night-Stands waren zur Qual geworden, da ich … Himmel. Ich war ein Wrack.
Ich wollte und konnte es niemandem zumuten, es mit mir auszuhalten. Mein Pessimismus kannte keine Grenzen, ich war emotional instabil und paranoid.
Oft, wenn ich nachts wach lag, fragte ich mich, was passiert wäre, wenn wir nicht entkommen wären. Wie alles geendet hätte, wenn ich gerannt wäre, statt zum Messer zu greifen. Isabelle wäre zugrunde gegangen, aber ich selbst hätte möglicherweise das Ende bekommen, das ich brauchte.
Meine Versuche, Männer kennenzulernen, liefen immer gleich ab, weshalb ich es aufgegeben hatte. Entweder die Typen wussten nicht, was passiert war, und kurze Zeit ging alles gut, oder sie wussten es und waren der Meinung, mich mit Samthandschuhen anfassen zu müssen.
Beide Varianten waren dazu bestimmt, zu kollabieren, sobald ich mit der Wahrheit herausrückte. Mit dem, was ich wirklich wollte – was ich brauchte.
Therapeutin acht oder neun war es gewesen, die zum ersten Mal gesagt hatte, dass es kein Problem war, ein Missbrauchsopfer zu sein und trotzdem harten Sex zu wollen.
Sie hatte nicht die geringste Ahnung, wovon sie sprach. Harter Sex. Dass ich nicht lachte. Ich wollte mehr als ein wenig an den Haaren gezogen bekommen.
In mir war nichts. Ein großes, schwarzes, bodenloses Loch, das mit Schmerz und dem anschließenden Rausch gefüllt werden konnte, und selbst diese Mischung hielt nur kurzzeitig vor.
Ich hatte weiß Gott versucht, es zu füllen. Doch es reichte nicht. Es hatte nie gereicht. Deshalb war es einfacher, niemanden an mich heranzulassen.
Isabelle war stärker als ich. Sie konnte noch lieben. Mir stand eine Zukunft als die schräge Frau am Ende der Straße bevor, die zu viele Katzen hatte und die Bälle nicht zurückgab, die beim Spielen über ihren Zaun flogen.
Vielleicht sollte ich nach Texas ziehen. Dort würde es nicht auffallen, wenn ich direkt mit einer Schrotflinte im Arm auf der Veranda saß.
Aus purer Gewohnheit ließ ich meinen Blick durch die Kirche schweifen. Isabelles und Marcs Münder bewegten sich abwechselnd, jeder Anwesende schien pures Glück zu verspüren.
Ich wusste, dass ich nach außen hin ebenfalls lächelte. In jahrelanger Arbeit hatte ich es mir wieder antrainiert. Leute misstrauten einem weniger, wenn man in den richtigen Situationen lächelte – egal, was in einem vorging. Niemand wollte wirklich die Wahrheit sehen oder hören. Wie geht’s? Gut. Das war die einzig akzeptierte Version. Schonung vor der Realität.
Rechts neben dem Altar war eine Tür. Sie führte in den Pfarrraum, dort gab es einen Ausgang auf den Friedhof hinter der Kirche.
Isabelle und Marc hatten 273 Gäste, von denen 137 Männer waren. 49 davon kannte ich nicht und war ihnen noch nie begegnet. Aber ich konnte damit umgehen. Manche der Therapeuten hatten etwas getaugt.
Ich musterte die Menge, als mein Nacken prickelte. Langsam wandte ich mich weiter um, bis ich den Mann sah, der mich geradewegs anstarrte. Er hatte sich ebenfalls ein Lächeln ins Gesicht gezwungen, das so falsch war wie mein eigenes. Auf die Distanz konnte ich seine Augenfarbe nicht erkennen, nur das helle Haar, das ihm ein skandinavisches Aussehen verlieh. Ein Schauer lief über meinen Rücken, und ich musste mich dazu zwingen, ruhig sitzen zu bleiben. Weit hinten in meinem Kopf versuchte eine Erinnerung, an die Oberfläche zu kommen.
Sein Lächeln vertiefte sich, weil ihm klar geworden war, dass ich sein unhöfliches Gaffen bemerkt hatte.
Die Erkenntnis, dass er mich ins Visier genommen hatte wie ein Raubtier seine Beute, erschütterte mich bis ins Mark. Mein Herz klopfte schneller, weil kein Zweifel darin bestand, wie offensichtlich er mich studierte. Wer war er?
Warum besaß er nicht den Anstand, sein Gesicht wegzudrehen?
Mein Puls war so laut, dass er in meinen Ohren dröhnte und die anderen Gäste mit jedem Schlag in den Hintergrund wichen. Ich konnte jetzt keine Panikattacke gebrauchen. Die letzte war Jahre her und ich war froh darüber. Meine Kehle war wie zugeschnürt.
Plötzlich erhoben sich alle. Ich stand ebenfalls auf, damit niemand bemerkte, wie durcheinander ich war. Das Gesangsbuch rutschte von meinen Knien. Ich musste mich danach bücken. Als ich mich aufrichtete, strich ich das mintfarbene Brautjungfernkleid glatt.
Streng genommen war ich eine der Brautjungfern, doch Isabelle hatte verstanden, dass ich nicht vorn stehen wollte. Sie hatte mich einfach nur umarmt.
Ich drehte mich wieder um und erstarrte. Der Mann war weg. Ich hatte mich weder in der Reihe geirrt noch ihn mir eingebildet, denn sein Platz am Rand der Bank war verwaist. Es war lange her, dass ein Mann mich so beschäftigt hatte, denn ich wusste nicht, ob ich erleichtert oder enttäuscht sein sollte, dass er verschwunden war.
4
Als ich aufwachte, konnte ich nicht atmen, mich nicht bewegen. Ich hatte das Gefühl, einen riesigen Zementblock auf der Brust zu haben. Meine Atmung ging pfeifend, nur mit äußerster Mühe schaffte ich es, Luft zu holen.
Ein Pochen meldete sich hinter meiner Stirn, mein Mund war trocken, meine Schultern brannten wie Feuer. Ich konnte nichts erkennen, weil es stockdunkel war. Die Kälte machte mir klar, dass ich nackt war.
Ich schien mit meiner abgehackten Atmung allein zu sein. Die Zeit stand still. Es war mir unmöglich, zu sagen, wie lange ich bewusstlos gewesen war oder wie viele Minuten vergangen waren, seit ich aufgewacht war.
Ich war gefesselt und lag auf einer Unterlage, die weder hart noch weich war. Sobald ich versuchte, mein Gewicht zu verlagern, merkte ich, wie straff ich fixiert war. Es war so gut wie kein Bewegungsspielraum vorhanden.
Tränen stiegen in mir auf. Es musste ein Albtraum sein und ich würde jede Sekunde in meinem Bett unter Tante Maudes Dach aufwachen – jede Sekunde. Doch egal, wie fest ich die Augen zusammenpresste, sobald ich sie öffnete, war ich wieder von Dunkelheit umgeben. Der Mann … ich erinnerte mich.
Dylan White, der vorgegeben hatte, ein Polizist zu sein. Die Spritze in seiner Hand. Der schwarze Wagen.
Ich schluchzte. Großer Gott!
»Sch«, machte eine Stimme und eine Hand tätschelte mein Schienbein.
Panik erfüllte mich. Ich war nicht allein. Ein heiserer Schrei entrang sich meiner Kehle, und mein Magen verkrampfte sich derart schnell, dass ich spürte, wie die Magensäure sich ihren Weg hoch bahnte.
Die Finger wanderten nach oben. »Wie geht es dir, mein kleines Spielzeug?«
Obwohl ich mich kaum bewegen konnte, versuchte ich, ihn abzuschütteln. »Lassen Sie mich los!«
Er lachte leise, und ich wusste, dass es der gleiche Mann war. Dylan White. Sollte das sein richtiger Name gewesen sein. Höher und höher strich er, bis er die Haare über meiner Pussy berührte. Ich keuchte, als er ohne Vorwarnung schmerzhaft fest an ihnen zog.
»Du solltest dir angewöhnen, auf meine Fragen zu antworten, mein kleines Spielzeug. Damit machst du dir das Leben leichter.«
Seine Worte rangen in meinem Kopf nach. Was hatte er vor? Hoffentlich hatte er nicht vor, was ich befürchtete.
Seine Hand glitt höher und höher, bis er mir eine Ohrfeige versetzte. »Antworte. Wie geht es dir?«
»Schlecht!«, schrie ich ihm entgegen, und mein Gehirn fühlte sich an, als würde es gleich in meinem Schädel explodieren.
»Du hast dir ziemlich übel den Kopf gestoßen. Das ist unglücklich gelaufen.«
»Was haben Sie vor?«
Er legte einen Finger auf meine Lippen. »Sch. Du musst jetzt leise sein, sonst weckst du die anderen.«
Die anderen? Hier waren noch mehr Mädchen? Ich wog die Optionen ab. Sollte ich schreien? Um Hilfe flehen?
Der Mann kam näher und im nächsten Moment spürte ich seine Erektion an meinem Oberschenkel. Er war bekleidet, doch selbst durch den Stoff war sie kaum zu verfehlen. Mein Puls beschleunigte sich, Schweiß brach aus.
Ich beschloss, zu schreien. Als hätte er es geahnt, legte seine Hand sich auf meinen Mund. Er drückte sie brutal nach unten, meine Lippen wurden so fest gegen meine Zähne gepresst, dass ich glaubte, sie würden aufplatzen.
Tränen liefen über meine Wangen und ich konnte nichts gegen das Gefühl der Hilflosigkeit tun. Je mehr ich weinte, desto weniger Luft bekam ich durch die Nase. Dylan hielt meinen Mund zu und schon bald strampelte ich aus einem anderen Grund. Ich glaubte, zu ersticken.
Als er mich endlich losließ, holte ich keuchend Luft.
»Wirst du noch einmal versuchen, zu schreien?«, fragte er. Seine Stimme war eiskalt und unbeteiligt.
Ich wollte hier nicht sterben, und mein Instinkt sagte mir, dass seine Hand beim nächsten Mal so lange auf meinem Mund bleiben würde, bis ich erstickte. »Nein«, wisperte ich.
»Braves Spielzeug.« Schwere Schritte ertönten, und ich spürte, wie er eine Fußfessel löste. »Nicht ein Wort«, warnte er mich.
Als er mich wieder anfasste, war seine Berührung sanft, beinahe liebevoll. Seine Finger zeichneten meine Umrisse nach, er streichelte meine Wange und fuhr kurz über meine Brustwarzen, die sich in der kalten Luft schmerzhaft hart zusammengezogen hatten.
Mein Herz raste, und ich brauchte meine ganze Konzentration, um nicht zu schreien. Dabei wollte ich nichts lieber, als zu schreien.
Immer neue Tränen liefen über meine Wangen und tropften in meine Haare. Nein. Nein. Nein. Nein. Nein.
Beide Hände legten sich auf meine Oberschenkel und drückten sie auseinander. Ich hatte sofort meine Beine zusammengepresst, als er die Fessel gelöst hatte. Wenigstens ein freies Bein zu haben, hatte mich optimistisch werden lassen.
Er war zu stark und zwang mich, die Schenkel für ihn zu spreizen. Meine Panik wurde erneut in die Höhe katapultiert, als ich seinen Atem spürte.
Ich wollte schreien, mein Mund hatte sich geöffnet, aber ich tat es nicht. Zu viel Angst. Ich hatte zu viel Angst. Es war alles bereits so schrecklich, dass ich mir nicht ausmalen konnte, wie viel schlimmer es werden würde, wenn ich ihn verärgerte.
Es war dunkel, ich war hilflos und gefesselt – welche Möglichkeiten blieben mir?
Keine. Angesichts dieser Erkenntnis kämpfte ich gegen Übelkeit.
Obwohl ich aufgrund der Dunkelheit nichts sehen konnte, presste ich die Augen zusammen und dachte an eine schöne Erinnerung.
Das Lachen meines Bruders, wenn er so hoch schaukelte, dass meine Mutter beinahe einen Nervenzusammenbruch bekam. Es lenkte mich von der gierigen Zunge zwischen meinen Beinen ab, die ein merkwürdig heißes Gefühl in meinem Bauch verursachte.
Ich erinnerte mich an Weihnachten, als mein Vater daran verzweifelt war, ein Lego-Set zusammenzubauen, und meine Mutter zu viel Punsch getrunken hatte, um ihm eine Hilfe zu sein.
Ich dachte an alles, nur nicht daran, wie er seinen Penis in mich presste. Nicht an den Schmerz. Nicht an seinen Geruch in meiner Nase. Nicht daran, wie er mein Gesicht drehte und seine Lippen auf meine presste.
Ich hielt mich an sein Verbot, nicht zu schreien. Allerdings hatte er nichts von beißen gesagt, und als er versuchte, mich zu küssen, biss ich in seine Unterlippe, bis ich Blut schmeckte.
Er reagierte mit einem Knurren und indem er eine Hand um meinen Hals legte. »Das wirst du verfickt noch mal bereuen.«
Er hatte recht.
5
»Nein, danke.« Ich zwang meine Mundwinkel nach oben, damit die Abfuhr den armen Mann nicht allzu hart traf. Er war der vierte heute, der mich gefragt hatte, ob ich tanzen wollte.
Ich wollte nicht.
Sein Lächeln bröckelte und mit einem Achselzucken verschwand er. Ich sah ihm nach, bevor ich an meinem Champagner nippte. Wie lange musste ich noch warten, bevor ich mich in mein Hotelzimmer schleichen konnte?
Isabelle erwischte mich, als ich auf die Uhr sah. Die Braut stemmte ihre Hände in die mit Perlen bestickte Taille und schüttelte den Kopf. »Ich hoffe, du willst nicht schon gehen.«
»Natürlich nicht«, log ich.
Isabelle lachte, raffte ihren Rock zusammen und setzte sich auf den Stuhl neben mir. »Ich wünschte, du würdest wenigstens versuchen, Spaß zu haben.«
»Du glaubst gar nicht, wie viel Spaß ich habe. Es ist beinahe zu viel.«
»Ich meine es ernst, Mags.«
»Ich auch.«
Isabelle rollte mit den Augen, griff nach meinem Champagnerglas und leerte es. »Wie geht es dir?«
Ich murrte leise. »Die Frage nervt.«
»Das weiß ich. Deshalb stelle ich sie.«