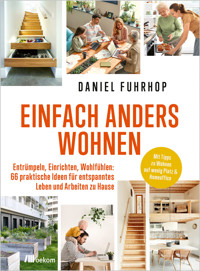Inhalt
Bauscham, Enteignung und Flächenfraß:zur Neuauflage 2020
Vorwort zur Erstauflage
Uwe Schneidewind
Einführung
1 Bauwut
Skandalprojekte und Prestigebauten
Mythos Eigenheim
Schrumpfen schützt vor Bauen nicht
2 Scheinbar ökologisches Bauen
Wir brauchen eine Bauscham
Ideale als Irrweg: Ökostadt und Idealstadt
Etikettenschwindel mit Siegel
3 Bauen ist unsozial
Es gibt einen Bauüberfluss
Von der Gentrification zur Investification
Enteignung statt Privatisierung
Teurer Neubau
4 Bauverbot konkret
Bürgerinnen gegen Flächenfraß
Flächenverbrauch null
5 Verbietet den Abriss
Abriss vernichtet Stadtgeschichte
Abreißen für die Konjunktur
6 Stadt umbauen
Eine vorbildliche Sanierung
Abreißen und neu bauen oder sanieren: eine Bilanz
Die Stadt ist schon gebaut
7 Leerstand füllen
Leerstand hat viele Gründe
Leerstand erfassen
Eigentum verpflichtet
Häuser besetzen, Leerstand managen
8 »Hört auf zu bauen!«
Platzverschwendung privat …
… Platzverschwendung beruflich
Einfach mal nicht bauen
9 Umbauen hört nie auf
Umbauen ist sexy
Zwischen Pinselsanierung und Totalumbau
10 Mut zur Nähe
Wenn Alt und Jung zusammenfinden
Zusammenleben
Gemeinsam wohnen, umbauen, besitzen
11 Umzug nach Düsseldorf-Nord
Das Wohnpartnerportal
Umziehen spart Geld
»Kommt nicht nach München!«
Coole Platte
12 Lebendige Städte ohne Amazon und ECE
Centerisierung der Stadtzentren
Widerstand unterstützen
Onlinehandel ist nicht virtuell
Zu guter Letzt: Anders wirtschaften
Gut bauen ist nicht genug
Grenzen setzen für die Freiheit
100 Werkzeuge für Wohnraum und mehr Platz im Bestand
Anmerkungen
Quellen
Über den Autor und Dank
Bauscham, Enteignung und Flächenfraß: zur Neuauflage 2020
Daniel Fuhrhop
Vor fünf Jahren erschien »Verbietet das Bauen!«, doch das Bauen boomt jetzt erst recht: 2018 wurden mit 286.000 Wohnungen fast doppelt so viele gebaut wie die 159.000 in 2009. Gleichzeitig explodierten die Mieten in vielen Großstädten, und es fehlen bezahlbare Wohnungen. Das beweist: Neubau löst nicht die Probleme des Wohnungsmarktes, es schafft Probleme. Wohnungen fehlen, gerade weil viel gebaut und investiert wird.
Investification: Wo keine Menschen wohnen, sondern das Geld
Internationale Investoren schieben in politisch wechselhaften Zeiten mehr Geld in das stabile Deutschland und angesichts niedriger Zinsen gern in Immobilien. Doch in den neu gebauten Häusern wohnt oft keiner: Anleger leisten sich Zweit- und Drittwohnungen, und teure Neubauviertel bleiben abends dunkel. An manchen Ecken entwickeln sich Berlin und München wie New York. Dort dienen um die 80.000 Wohnungen nur als Geldanlage und stehen sonst meist leer.1
Diese Veränderung ist nicht mehr die Gentrification, bei der reiche Menschen ärmere aus ihren Wohnvierteln vertreiben. Die entfesselte Kraft des Geldes sorgt für eine »Investification« – in den teuren Häusern wohnen keine Menschen mehr, dort wohnt das Geld. Wir können Wohnraum zurückgewinnen, wenn wir die Investification stoppen. Dabei helfen einige der »100 Werkzeuge für Wohnraum« in dieser Neuauflage.
Die Unternehmen enteignen, dem Staat aneignen?
Der Wohnungsmarkt entwickelt sich extrem, wie das neu verfasste dritte Kapitel beschreibt. Extrem reagieren darauf auch viele Menschen. Sie protestieren gegen Spekulation und fordern in Berlin: »Große Immobilienkonzerne enteignen!« Den Protest kann man verstehen, doch drei Details der Forderungen wecken Bedenken.
Erstens könnten von den Enteignungen öffentliche Wohnungsgesellschaften profitieren, denen die enteigneten Wohnungen übertragen werden. Oft kehrten damit früher privatisierte Häuser zurück, denn in den 1990er-Jahren verkauften Landespolitiker in Berlin etwa 200.000 Wohnungen öffentlicher Gesellschaften an private Konzerne. Diesen Fehler wieder rückgängig zu machen klingt verlockend, aber wollen wir öffentliche Wohnungsunternehmen wirklich immer größer machen? Das erinnert im Westen an die gigantische »Neue Heimat« der Gewerkschaften und im Osten an die bürokratische Kommunale Wohnungsverwaltung.
Außerdem wären die Enteignungen teuer: Die Privateigentümer müssten entschädigt werden. Schon jetzt werden früher verscherbelte Wohnungen zum Vielfachen zurückgekauft. Mit diesem Geld könnte man auf andere Arten vielleicht besser für gutes Wohnen sorgen.
Drittens wenden sich die Enteignungsfreunde meist nicht gegen das Bauen, sie fordern nur ein sozialeres Bauen. Die Forderungen nach deutlich mehr sozialem Wohnungsbau ähneln fatal den Forderungen bauwütiger Politiker und Immobilienleute, um jeden Preis mehr zu bauen.
Doch wir brauchen keinen Neubau, um soziales Wohnen zu ermöglichen. Zum einen schafft es Wohnraum, den Einfluss von Immobilienspekulanten zurückzudrängen, Investification zu beenden und Geldanlagen wieder in Wohnungen zu verwandeln. Zum anderen könnten alle Wohnungsunternehmen, öffentliche genauso wie private, ihren Mieterinnen ermöglichen, zusammenzuziehen oder sich zu verkleinern. So macht eine sozialere Wohnungswirtschaft Platz im Altbau und damit Neubau überflüssig.
Wie gut wir vorhandene Mietwohnungen nutzen, entscheidet nicht allein die Diskussion um Immobilienkonzerne: Sechzig Prozent der Wohnungen in Deutschland werden von Einzeleigentümern oder Eigentümergemeinschaften vermietet.2
Bodenspekulation und Bodensteuer
Auch einzelne private Eigentümer profitieren vom Immobilienboom, und so mancher lässt moralische Skrupel hinter sich, vergoldet sein Erbe und überlässt langjährige Mieter ihrem Schicksal bei Aufkäufern und Aufteilern. Die explodierten Bodenpreise bringen Eigentümern unverdiente Gewinne. Wir brauchen eine neue Bodenordnung, sagt darum Hans-Jochen Vogel, ehemaliger SPD-Vorsitzender und früherer Bürgermeister von Berlin und davor von München: Großstädte sollten nach und nach Grundstücke kaufen oder notfalls enteignen, um dort Wohnungen zu bauen.3
Die steigenden Bodenpreise würden dadurch den Städten zukommen. Wo Private davon profitieren, sollte man deren Gewinne unter anderem durch eine Bodensteuer abschöpfen. Die fordert auch das Bündnis »Grundsteuer zeitgemäß« mit Naturschützern, Bürgermeistern und dem Deutschen Mieterbund. Durch die von ihnen geforderte Steuer sollen teure Grundstücke dichter bebaut werden. So sollen ländliche Gegenden vom Druck befreit werden, und vielleicht blieben manche Äcker und Wiesen dadurch unbebaut. Doch je zentraler die Lage, je teurer der Grund und je höher die Bodensteuer, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass gebaut wird, dicht gebaut wird und vielleicht sogar alte Häuser dafür abgerissen werden.
So formt sich eine merkwürdige Allianz für Neubau: Spekulanten und Spekulationsgegner wollen bauen, private Einzelinvestoren ebenso wie Bodensteuerfreunde. In der Art des Gebauten unterscheiden sich die Ziele, aber das Dogma des Bauens vereint sie alle. Das aber ist heute verhängnisvoller denn je.
Bauen bringt wenig: Bauüberfluss 2018
Könnte es sein, dass zu wenig gebaut wird und es deshalb an Wohnungen mangelt, wie der überwiegende Teil von Politikern ständig wiederholt, wiederholt, wiederholt …? Trotz der ständigen Forderung, mehr zu bauen, würde das den Wohnungsmangel nicht beheben, denn rein rechnerisch werden bereits zu viele Wohnungen gebaut. Diese Behauptung mag überraschen, doch ein einfaches Beispiel kann sie erklären: In Hamburg etwa betrug im Jahr 2018 die Zahl der neu gebauten Wohnungen mit etwa 10.000 genauso viel wie der Zuwachs der Einwohnerzahl. Weil eine Wohnung im Schnitt zwei Menschen beherbergt, wurden in Hamburg also 5.000 Wohnungen zu viel gebaut.
So ähnlich sah es in ganz Deutschland aus. Im Jahr 2018 betrug der »Bauüberfluss« in erster Näherung 172.400 zu viel gebaute Wohnungen; mindestens aber um die 100.000 Wohnungen zu viel, wenn man zu ersetzende Abrisse einrechnet (mehr dazu in Kapitel 3). Trotz dieser Bauwut suchen offensichtlich viele Menschen in Großstädten dringend Wohnraum, und darum bedeuten die Zahlen, anders gesagt: Neubau löst nicht die Probleme des Wohnungsmangels.
Das scheint absurd, zumal Analysten behaupten, wir müssten noch mehr bauen, jährlich an die 350.000 neue Wohnungen.4 Man versteht die Widersprüche durch einen Blick in die Analysen zum Wohnungsbedarf. Diese Vorhersagen gehen von falschen Voraussetzungen aus, denn sie schreiben Trends der letzten Jahre unbeirrt in die Zukunft fort: Demzufolge ginge die Wanderung von schrumpfenden in boomende Regionen weiter, sodass eines Tages alle in Berlin, Frankfurt und München leben, während der Rest Deutschlands sich leert.
Wie beim »Wo« des Wohnens schreiben die Analysten auch beim »Wie« Entwicklungen unbeirrt in die Zukunft weiter: Die immer kleiner werdenden Familien und Haushalte würden noch kleiner – so gesehen, wohnt angeblich irgendwann jeder allein in drei Wohnungen.5
Man kann Wohntrends nicht einfach linear fortschreiben. Aber immerhin benennen die Studien zum Wohnungsbedarf mit dem »Wo« und »Wie« des Wohnens zwei Ursachen, die (zusammen mit der Spekulation) dafür sorgen, dass Neubau nicht den Wohnungsmangel behebt. Stattdessen sollten wir die Ursachen direkt angehen. Darum geht es in Kapitel 10 und 11 dieses Buches. Neubau jedoch behebt den Wohnungsmangel nicht, schadet hingegen ökonomisch und ökologisch.
Bauen schadet viel
Ökonomisch schadet die Bauwut, da nicht allein private Investoren die Kosten tragen, sondern die Allgemeinheit. Das zeigen die aktuellen Pläne für gigantische Neubaugebiete, die so groß sind wie ganze Städte: Auf den Äckern und Wiesen von Hamburg-Oberbillwerder und Freiburg-Dietenbach sollen jeweils an die 15.000 Menschen wohnen. Allein dort zu planen und zu erschließen kostet wohl je über sechshundert Millionen Euro, das sind 80.000 Euro je Wohnung allein für die Vorbereitung, ohne einen Stein gebaut zu haben! Wohnraum ohne Neubau zu schaffen kostet auch Geld, aber tendenziell weniger als diese 80.000 Euro. Dazu kommen die eigentlichen Baukosten.
Neubaustadtviertel für 15.000 Menschen wecken ungute Erinnerungen an Großsiedlungen der 1960er- und 70er-Jahre. Deren Bau hatte man aus gutem Grund beendet. Heute wird man zwar die Fehler von damals nicht wiederholen, aber sicherlich neue Fehler im großen Maßstab machen.
Ökologisch schaden bereits die Baustoffe: Allein die Zementindustrie verursacht etwa acht Prozent der weltweiten Treibhausgase. Obendrein wird der Sand knapp, und für Kies werden Wälder abgeholzt (siehe Kapitel 2). Besseres Bauen löst diese Probleme nicht: Man kann zwar ökologischere Baustoffe wie Holz verwenden, das CO2 speichert, und bereits versiegelte Flächen in den Städten weiternutzen. Aber das Bauen selbst verbraucht auf jeden Fall Energie, um Glas und Stahl herzustellen, die Baustoffe zur Baustelle zu bringen und das Haus zu bauen. Selbst vermeintliche Energiesparhäuser sparen keine Energie, sie verbrauchen nur weniger Heizenergie als andere Häuser. Im gesamten Lebenszyklus erfordert bei modernen Häusern inzwischen das Bauen selbst den größten Anteil.6 Darum bedeutet massiver Neubau massive Klimazerstörung.
Bauscham statt Bauland
Es ist schizophren: Die Bundesregierung investiert seit 2019 mit dem Klimapaket Milliarden für den Klimaschutz, unter anderem für effizienteres Bauen und Heizen, doch gleichzeitig treibt sie mit Baulandkommission und Baukindergeld den Neubau von Wohnungen an, die klimaschädigend gebaut und danach geheizt werden. Am wenigsten Heizenergie verbraucht ein Raum, der gar nicht erst gebaut wird.
Die fünf Jahre von 2015 bis 2019 sind die heißesten, die je gemessen wurden; die Klimakrise hat begonnen. »Unser Haus brennt«, sagt Greta Thunberg.7 Nach ihrem Vorbild protestieren Millionen junge Menschen für die Rettung des Klimas und fordern von den Regierungen konsequenten Klimaschutz, weitere Millionen schließen sich ihnen an: Den Fridays For Future folgen Parents For Future, Scientists For Future und Architects For Future. Beim persönlichen Verhalten spricht man jedoch meist über Autofahren, Fliegen und Fleisch essen, seltener vom Bauen und Heizen. Das aber verursacht zwanzig bis dreißig Prozent der Treibhausgase.
Ein radikaler Wandel ist darum auch beim Bauen nötig: Keiner sollte mehr stolz darauf sein, gebaut zu haben – nach der Flugscham brauchen wir eine Bauscham!
Bauverbot konkret: Flächenfraß beenden
Am besten für das Klima wäre es, wir bauten gar nicht mehr. Mancher hält den Buchtitel »Verbietet das Bauen!« lediglich für provozierende Polemik, und natürlich soll er auch provozieren, aber nicht nur: Im geänderten vierten Kapitel »Bauverbot konkret« können Sie nachlesen, wie wir weniger Äcker und Wiesen in Straßen und Bauland verwandeln und den sogenannten Flächenverbrauch auf null senken können, was das Bauen erheblich einschränken würde.
In Bayern haben Naturschützer 2018 fast erreicht, den Flächenfraß zu begrenzen: Zwar hat der Bayerische Verfassungsgerichtshof das Volksbegehren »Betonflut eindämmen« vorerst gestoppt, aber nicht grundsätzlich abgelehnt. Man müsste nur genauer zeigen, wie die Kommunen das Ziel erreichen sollen. Dafür haben die Grünen 2019 einen neuen Entwurf vorgelegt. Sollte ein zweites Volksbegehren Erfolg haben, müsste das Land Bayern seinen Flächenverbrauch von derzeit über elf Hektar am Tag auf fünf Hektar mehr als halbieren. Das entspräche dem bayerischen Anteil am bundesweiten Flächenziel von dreißig Hektar.
Es wäre sogar möglich, ein Ende des Flächenverbrauchs festzuschreiben: Dreißig Hektar pro Tag, lautet das Ziel der Bundesregierung, aber null Hektar, keine Fläche mehr verbrauchen, empfahl ihr 2016 der eigene Sachverständigenrat für Umweltfragen. Dadurch dürfte nur noch Fläche verbraucht werden, wenn sie anderswo wieder der Natur zurückgegeben wird. Dann geht kein Acker mehr verloren, und das klimaschädliche Bauen hört fast auf. Bis 2030 sollte der Flächenverbrauch schrittweise von heute sechzig Hektar pro Tag auf null zurückgehen.
In diesen zehn Jahren würde insgesamt noch eine sehr große Fläche für Straßen und Bauen geopfert. Wer darf sie verbrauchen? Dafür schlägt der Sachverständigenrat Regeln vor. So würde die noch verfügbare Fläche unter den Ländern und Gemeinden verteilt; damit aber eine Gemeinde den ihr zustehenden Anteil nutzen darf, müsste sie bestimmte Bedingungen erfüllen, vor allem Innenentwicklung betreiben und den Leerstand erfassen.
Hier schließen sich die Vorschläge dieses Buches an: Es enthielt schon in der Erstauflage 50 Werkzeuge, die Neubau überflüssig machen. Diese Neuauflage bietet nun 100 Werkzeuge für Wohnraum und mehr Platz im Bestand. Einige davon könnte man Gemeinden zur Bedingung machen, damit sie noch bauen dürfen. Dadurch liefern die Werkzeuge ein politisches Programm gegen Flächenverbrauch. Sie sind ein Suffizienzprogramm für den Stadtwandel, von dem Uwe Schneidewind in seinem Vorwort schreibt.
Die Erweiterung auf hundert Werkzeuge ist das Ergebnis von fünf Jahren mit über hundert Vorträgen, zwei weiteren Sachbüchern und wissenschaftlicher Arbeit. Das führt zu weiteren politischen Forderungen, doch es wäre zu einfach, die Schuld nur bei »den Politikern« zu suchen. Auch persönlich kann jeder seinen Lebensstil überdenken.
Einfach anders wohnen
Nachhaltig zu leben verbindet sich im Idealfall damit, angenehmer zu leben, also das Gute zu tun und sich selbst dabei Gutes zu tun. Wer Biomöhren isst, schont die Äcker und lebt gleichzeitig gesund. Wer radelt, verbraucht kein Benzin und bleibt gleichzeitig fit. Solche idealen Lösungen gibt es auch beim Wohnen: Wer Platz spart und mit anderen zusammenrückt, befreit sich vom Überfluss, erlebt mehr Nähe und macht gleichzeitig durch einen geringeren Flächenverbrauch Neubau überflüssig. Das fängt bei der Schublade an und reicht bis ins Stadtviertel.
66 Raumwunder vom Kleinen bis zum Großen versammelt mein Ratgeber »Einfach anders wohnen«. Er entstand 2018 auch als Reaktion auf ein Missverständnis im Umgang mit dem Bauverbotbuch: Manche denken beim Schutz der Natur vor allem an die grüne Wiese gegenüber ihrer Wohnung und schließen sich darum der Forderung an, das Bauen zu verbieten. Nun ist es ganz normal, dass sich die Nachbarinnen und Nachbarn um bedrohtes Grün kümmern, wer sonst sollte sich vor Ort engagieren? Doch neben die politische Forderung, Freiräume zu schützen, sollte die persönliche Überlegung treten, Platz für andere zu schaffen. Wer überflüssigen Platz spart, lindert Wohnungsmangel.
Raumwunder beginnen mit dem Entrümpeln, reichen über clevere Möbel bis zu Einbauten und Umbauten. Wenn man überlegt, ob der gewonnene Platz anderen zugutekommen kann, bieten sich zwei Dutzend Formen gemeinschaftlichen Wohnens; da ist für jeden Geschmack etwas dabei. So kann man der Einsamkeit entgehen, die vor allem älteren Menschen droht. Die Lösung könnte zwar auch in einem neu gebauten Wohnprojekt liegen, wenn dieses durch Teilen von Wohnraum dabei hilft, dass die Einzelnen mit weniger Fläche auskommen. Doch vor allem gilt: Weniger bauen, mehr wohnen.
Auch die Entscheidung über den Wohnort trägt dazu bei, Flächenfraß zu mindern: In manchen Kleinstädten und ländlichen Gegenden gibt es mehr als genug Wohnraum und darüber hinaus Arbeitsplätze. Ein »Willkommensstadtprogramm« kann weniger beliebte Regionen aufwerten und die regionale Ungleichheit mindern (Werkzeuge Nr. 41 bis 49). Das hätte man beim Zuzug vieler Flüchtlinge 2015 und 2016 bedenken können. Und damit wären wir nach Enteignungsdebatte und verschärfter Klimakrise bei einer weiteren großen Veränderung seit Erscheinen der Erstauflage …
Willkommensstadt
Am 24. August 2015 erschien »Verbietet das Bauen!«. Eine Woche später sagte Angela Merkel, dass wir es schon schaffen werden, Flüchtlinge aufzunehmen und zu integrieren. Angesichts der großen Zahl von Zuzügen in kurzer Zeit fragten viele, ob die Bauverbotthesen nun überholt seien, weil man wegen der Flüchtlinge viel bauen müsse. Doch im Gegenteil: Flüchtlinge brauchen keinen Neubau, sie brauchen Wohnraum und Nachbarschaft. Integration gelingt im Altbau. Je bunter durchmischt unsere Häuser und Städte sind, desto eher werden sie zu Willkommensstädten.
Dieses Fazit ergibt sich aus der Geschichte der Wanderungen nach Deutschland seit 1945. Dem widmet sich mein Buch »Willkommensstadt. Wo Flüchtlinge wohnen und Städte lebendig werden« von 2016. Es beschreibt, wie man bei früheren Zuwanderungen Flüchtlinge danach verteilt hat, wo es Wohnraum und Arbeitsplätze gab: nach Flucht und Vertreibung von über zwölf Millionen Deutschen aus dem Osten Europas nach dem Zweiten Weltkrieg, aber auch vierzig Jahre später beim Zuzug von Aussiedlern und Spätaussiedlern aus der ehemaligen Sowjetunion. Ihnen wurde für einige Jahre ein Wohnort zugewiesen. Die meisten blieben auch danach am selben Ort, weil sie sich inzwischen eingelebt hatten.
Doch 2015 verteilten die Bundesländer Flüchtlinge nicht danach, wo es Platz gibt und wo Firmen nach Arbeitskräften und Auszubildenden suchen. Stattdessen entschied der »Königsteiner Schlüssel« nach Einwohnerzahl und Wirtschaftskraft. Das verstärkte vor allem in boomenden Städten das Problem, alle unterzubringen. Viele originelle Lösungen entstanden, und das Buch »Willkommensstadt« erzählt Geschichten des Gelingens der neuen Nachbarschaft.
Man musste im Herbst 2015 so schnell Menschen unterbringen, dass ohnehin keine Zeit für Neubau blieb. Stattdessen untersuchte man vielerorts schärfer denn je die Möglichkeiten der Altbauten und wurde endlich aktiver gegen Leerstand. Manche der Lösungen, die damals gefunden wurden, gehören nun zu den 100 Werkzeugen für Wohnraum in dieser Neuauflage.
Der unsichtbare Wohnraum
Gegen den sichtbaren Leerstand unternehmen viele Städte mehr, seit es dort an Wohnraum mangelt. Doch es gibt auch »unsichtbaren Wohnraum« von ungenutzten Zimmern in großen Wohnungen. So wohnen in Deutschland vier Millionen Menschen allein auf über achtzig Quadratmetern. Mancher wohnt allein im Haus, nachdem die Kinder auszogen. Der eine oder andere mag dabei zufrieden sein, doch viele haben das nicht gewollt, die vielen Zimmer belasten sie, und sie fühlen sich einsam. Um ihnen zu helfen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, sehr verschiedene, denn jeder Mensch hat andere Wohnwünsche: Umbau und das Abtrennen von Einliegerwohnungen, Umzug in eine kleinere Wohnung oder in ein Wohnprojekt, Untermieter vermitteln nach dem Modell »Wohnen für Hilfe«.
Mit diesen Möglichkeiten, den unsichtbaren Wohnraum zu entdecken und nutzbar zu machen, beschäftige ich mich seit 2019 im Projekt Optiwohn an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Manche der hundert Werkzeuge für Wohnraum entdeckte ich in Forschungsprojekten.
Eigentlich müssten sich die Ministerien für Wohnen und Heimat diesen Aufgaben widmen. Doch während sie Milliarden für das Bauen ausgeben, etwa wohl über zweieinhalb Milliarden Euro allein für Neubau beim Baukindergeld, vernachlässigen sie unsere Altbauten und die Wünsche ihrer Bewohner. Wenn die Ministerien weiter versagen, müssen wir es wohl selbst machen. Wenn Sie dazu beitragen möchten, den unsichtbaren Wohnraum zu entdecken, zu erforschen und zu nutzen, lesen Sie über die Idee einer Wohnstiftung in Werkzeug Nummer 100.
Regeln für Städte, Freiheit für den Einzelnen
Hundert Werkzeuge für Wohnraum im Bestand beweisen, dass wir nicht neu bauen müssen und dass es anders geht. Es ist ein positives Programm voller Möglichkeiten, was angesichts des Buchtitels vielleicht überrascht. Doch die Forderung nach einem Bauverbot soll nicht die Freiheit des Einzelnen beschränken, gut zu wohnen. Verbote brauchen wir auf einer höheren Ebene: klare Regeln für Städte und Gemeinden, um Flächenverbrauch zu beenden – Freiheit für den Einzelnen, Wohnwünsche zu erfüllen.
Der Traum vom Eigenheim kann sich auch in einem alten Haus erfüllen, und die Städte sollten das fördern. Wer sich verkleinern möchte, dem soll es ermöglicht werden, und dadurch wird Platz frei für andere. Die zweite Hälfte dieses Buches zeigt Möglichkeiten, Altbauten besser zu nutzen und zusammenzurücken. Doch bevor es um diese schönen Dinge geht, steht die harte Wirklichkeit an: das Bauen von heute, die Bauwut und ihre Folgen.
Vorwort zur Erstauflage
Uwe Schneidewind
Präsident und wissenschaftlicher Geschäftsführer, Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie
Die Nachhaltigkeitsforschung konzentrierte sich lange auf die Suche nach ökoeffizienten Lösungen, auch am Wuppertal Institut. Ernst Ulrich von Weizsäcker brachte seinen »Faktor 4« der gesteigerten Ökoeffizienz auf die einprägsame Formel »Doppelter Wohlstand bei halbiertem Umweltverbrauch«: ob bei Mobilität, bei Kühlschränken oder bei der Gebäudedämmung.
Doch es wird immer deutlicher, dass eine gesteigerte Ökoeffizienz alleine nicht ausreichen wird, um die Klimaziele zu erreichen: Denn effizienter Verbrauch verführt dazu, mehr vom Gleichen zu nutzen. Der Effizienzgewinn wird durch Wachstum kompensiert. Mit dem Begriff »Rebound« wird dieses Phänomen in der aktuellen Umweltdiskussion bezeichnet. Darum benötigen wir Strategien, die den Verbrauch absolut mindern. »Suffizienz« ist hierfür die Formel – mit weniger auskommen und dabei doch besser leben. Die intelligente Verknüpfung von Suffizienz und Effizienz wird damit zum Kompass für eine aufgeklärte Nachhaltigkeitspolitik.
Für die Gestaltung unserer Städte und Gebäude liegen erst wenige Vorschläge vor, wie Suffizienz konkret aussehen kann. Mit dem vorliegenden Buch legt Daniel Fuhrhop nicht weniger als eine Gesamtschau der Suffizienzstrategien rund um Städte vor. Er präsentiert einen »Stadtwandel«, eine Landkarte für zukunftsweisende urbane Transformationsstrategien.
Doch können solche radikalen Forderungen wie ein »Verbietet das Bauen!« auch Gegenstand wissenschaftlicher Analyse sein? Ja, das können sie! Die aktuelle Umweltsituation erfordert ein Nachdenken über die Bausteine einer »Großen Transformation«. Dafür braucht es auch den Mut zu radikalen Forderungen. Die regen den Austausch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie von praktischen Gestaltern des urbanen Wandels an. Und die Zukunft unserer Städte ist eines der wichtigsten Reallabore für eine nachhaltige Entwicklung.
Insofern ist es erfrischend, dass das vorliegende Buch einen Impuls »von außen« in die urbane Transformationsforschung gibt, von einem Fachmann für Architektur, Bauen und Immobilien, der ökonomische und soziokulturelle Argumente anregend verknüpft. Daniel Fuhrhop liefert mit dem Buch einen wichtigen Beitrag zur Suffizienzforschung und -politik und macht mit seinen Innovationsvorschlägen Lust auf suffiziente Städte.
So plakativ der Titel des Bauverbots, so pragmatisch sind doch gleichzeitig die Vorschläge, die dieses Buch präsentiert. Es regt regional und zeitlich begrenzte Baustopps an, durchaus begrenzt auf einzelne Segmente des Bauens wie Büro, Handel oder Wohnen. Daniel Fuhrhop bezieht sich dabei auch auf die Arbeiten von Michael Kopatz vom Wuppertal Institut, der ein starker Verfechter eines Wohnungsbaumoratoriums ist.
Am Wuppertal Institut verstehen wir die provokante Bauverbotsforderung als Auftrag für zukünftige Forschung. Suffizienz beim Bauen ist angesichts ihrer Bedeutung ein bisher unterentwickeltes Forschungsfeld. Es ist auf interdisziplinäre Ansätze angewiesen: Umweltökonomen, Raumplaner sowie Immobilienwirtschaftler und Juristen sind ebenso gefragt wie Architekten und Stadtplaner. Die Themen reichen von der kommunalen Praxis der Bauordnungen und Bebauungspläne bis zu landes- und bundesrechtlichen Regelungen zu Flächenverbrauch und Regionalplanung. Doch es geht auch um soziale und kulturelle Aspekte. Dies wird im Buch besonders deutlich, denn der Wandel unserer Städte berührt immer auch den Menschen. Suffiziente Politik soll gutes Leben einfacher machen, und nur wenig berührt unsere Lebensqualität so sehr wie die Lebendigkeit der Städte.
Das Buch begnügt sich nicht damit, anschauliche Beispiele vorzustellen, wie etwa durch gemeinschaftliches Wohnen weniger Fläche beansprucht wird oder wie Leerstand eingedämmt werden kann. Es geht weiter und berührt dabei auch den Eigentumsbegriff. Auch der darf kein absolutes Tabu sein, um Leerstand zu beseitigen. Überzeugende Beispiele aus den Niederlanden zeigen, wie hier interessante Wege möglich sind, ohne unsere Eigentumsordnung insgesamt infrage zu stellen.
Ähnlich weitgehend sind die Vorschläge Fuhrhops dafür, wie sich regionale und soziale Ungleichheit lindern lassen. Wenn er vorschlägt, die aktuelle regionale Tourismuswerbung und Wirtschaftsförderung auf den Prüfstand zu stellen oder gar in ihr Gegenteil zu verkehren, so ist diese Forderung mindestens so radikal wie die nach einem Bauverbot. Fuhrhop argumentiert konsequent systemisch – beim Bauen und Umbauen, beim Zugriff auf leerstehende Flächen sowie bei der regionalen Entwicklung.
Es lohnt, sich auf die Reise einzulassen, unsere Städte und Baupolitik radikal anders zu denken. Die Diskussion über eine »Große Transformation« braucht genau solche mutigen Impulse.
Wuppertal, Juni 2015
1
Bauwut
Das Oldenburger Gerichtsviertel befindet sich in idyllischer Lage direkt am Ufer der Hunte gegenüber vom Schlosspark. Auf mehrere Straßen verteilt, wuchs im Laufe von über hundert Jahren ein Ensemble aus jenen Gerichten, die dem Viertel ihren Namen geben: Das historistische Amtsgericht erinnert mit seinen groben Steinen am hohen Erdgeschoss an eine Burg, roter Backstein und ein gläsernes Dachgeschoss prägen das Landgericht; das Oberlandesgericht mit seinem eleganten ovalen Treppenhaus und einem zwölf Quadratmeter großen Glasmosaik im Foyer bildet einen Höhepunkt der Nachkriegsmoderne. Doch all das wollten Politiker verkaufen und teilweise zum Abriss freigeben. Sie träumten von einem neuen Justizzentrum, einem einzigen prestigeträchtigen Neubau auf einer Brache am Bahnhof zu Kosten von vermutlich 197 Millionen Euro. Dabei interessierten sie weder die lange Tradition des Gerichtsviertels noch dessen Platzreserven; immerhin stand ein ehemaliges Gefängnis leer. Es gab Protest, und schließlich wurden die rund 750 Mitarbeiter der Gerichte nach ihrer Meinung gefragt. Das Ergebnis war überdeutlich: 96 Prozent beteiligten sich an der Befragung, und über 72 Prozent von ihnen lehnten einen Neubau ab.
Skandalprojekte und Prestigebauten
Das Justizzentrum in Oldenburg konnte verhindert werden, aber in ganz Deutschland entstehen Prestigebauten: die Elbphilharmonie in Hamburg, das Humboldt-Forum in Berlin, ein Bahnhof samt neuem Stadtviertel bei Stuttgart 21. In dieser Parade der Verschwendung gehen »kleinere« Skandale fast unter: Der Neubau der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main kostete wohl etwa 1,3 Milliarden Euro,10 die Zentrale des Bundesnachrichtendienstes in Berlin (samt Umzug aus Pullach) liegt bei über 1,9 Milliarden Euro,11 wovon man viertausend Einfamilienhäuser bauen könnte. Jede Stadt, die etwas auf sich hält, leistet sich ihr eigenes Skandalprojekt (vielleicht diskutiert man deswegen in München über den Bau eines Konzerthauses). Nicht überall dauert es so lang wie beim Berliner Flughafen, der mindestens acht Jahre später als geplant fertig wird. Und nicht jedes Mal geht es so dramatisch schief wie beim Bau der Kölner U-Bahn, bei dem 2009 das Stadtarchiv einstürzte. Natürlich kann auch die Sanierung von Altbauten teuer werden, vor allem wenn man sie vorher nicht gut instand hielt und nötige Reparaturen verschleppte. Aber die hohen Kosten sind typisch für Neubauten, denn die sind ein gutes Geschäft für Planer und Baufirmen.
Die teuersten aktuellen Bauprojekte Deutschlands(Stand Anfang 2020 – ohne Garantie, dass es nicht noch teurer wird)
S 21 Bahnhof Stuttgart: über 8 Milliarden Euro
BER Flughafen Berlin-Brandenburg: über 6 Milliarden Euro
Terminal 3 des Flughafens Frankfurt am Main, rund 2,5 Milliarden Euro
BND Bundesnachrichtendienst Berlin, zuzüglich Umzug aus Pullach: etwa 1,9 Milliarden Euro
Elbphilharmonie Hamburg: etwa 789 Millionen Euro
Humboldt-Forum Berlin: etwa 595 Millionen Euro
Nichts zu kosten scheint das Bauen dagegen die Städte und Gemeinden, denn sie erhalten für sogenannte Leuchtturmprojekte Fördergeld vom Bund oder aus Europa, etwa für neue Stadthallen und Spaßbäder. Vor allem für deren Bau bekommen sie Geld, während sie den Betrieb oft alleine schultern müssen und daran oft scheitern. Dann wird kaputtgespart und neu gebaut, wie ein Beispiel aus der Kultur zeigt. Derzeit werden nämlich gleich drei Bauhaus-Museen geplant: In Dessau in Sachsen-Anhalt entstand 2019 ein Neubau für rund 28 Millionen Euro, von denen das Land etwa die Hälfte trug;12 nur hundertzwanzig Kilometer entfernt eröffnete man in Weimar ein weiteres Bauhaus-Museum für etwa 27 Millionen;13 und in Berlin soll das Bauhaus-Archiv zu 2022 einen Neubau für gut 40 Millionen Euro erhalten.14 Gleichzeitig kürzte das Land Sachsen-Anhalt 2015 seinen Theatern und Orchestern die Förderung um sechs Millionen von 36 auf 30 Millionen Euro – allein Dessau bekommt dann etwa drei Millionen Euro weniger pro Jahr!15
Über die Fördermillionen sprechen Politiker gerne, während sie die Folgekosten eines Prestigebaus lieber verschweigen. Wer Neubauten plant und deren Vorzüge preisen will, hat viele Tricks auf Lager. Einige davon lassen sich beispielhaft am Nordseeort Dangast zeigen. Dort hatten Politiker bereits in den 1970er-Jahren Millionen in ein Bad investiert, um mehr Besucher anzulocken. In den Achtzigerjahren entstand dann die Kuranlage Deichhörn: drei Backsteinbauten mit Läden und Büros. Doch die möchten Lokalpolitiker nach nur drei Jahrzehnten abreißen und stattdessen beim Quellbad neu bauen. Es ist lehrreich, mit welchen Kniffen sie das durchsetzten.
Wie Neubau durchgedrückt wird – das Beispiel Dangast16
Altbau schlechtgerechnet: Laut zwei Gutachten von 2013 zur Kuranlage Deichhörn könnte es über 1,5 Millionen Euro kosten, die drei Häuser zu sanieren, doch die Energiekosten würden dadurch angeblich nur um gut zwanzigtausend Euro jährlich sinken.17 Solche Zahlen lassen ein Gefälligkeitsgutachten vermuten, denn eine vernünftige Sanierung rechnet sich nicht erst nach 75 Jahren. Entweder man spart mehr, oder man saniert günstiger, aber so wird der Altbau schlechtgerechnet.
Neubau schöngerechnet: Das Quellbad zu erweitern ist vermeintlich günstiger, als die Kuranlage zu sanieren. Doch zum einen nahm man dabei stark steigende Besucherzahlen an und entsprechend hohe Einnahmen, zum anderen wurden die neuen Flächen wohl recht knapp geplant, damit die Ausgaben niedrig scheinen. Die teure Nachbesserung kündigt sich bereits an.
Tafelsilber verscherbeln: Um den Neubau zu finanzieren, möchte die Gemeinde den Kurpark verkaufen und einen Investor dort Hunderte Ferienwohnungen bauen lassen.
Äpfel und Birnen vermischen: In der Diskussion über Neubau oder Sanierung werden zwei Posten genannt, die nichts mit der Sache zu tun haben – die Altschulden des letzten Bauprojekts und die Kosten eines höheren Deiches.
Fehler zweimal machen: Kosten beim Umbau des Freibades 1998: rund sieben Millionen Euro; Kosten des neuen Projekts: ebenfalls rund sieben Millionen Euro.
Schönes Etikett anbringen: Die Politiker wollen angeblich nicht nur das Bad erweitern, sondern ein »Weltnaturerbeportal« zum Wattenmeer bauen mit einem Informationszentrum für Besucher. Vielleicht ist so ein Besucherzentrum tatsächlich sinnvoll, aber lässt es sich dann nicht ebenso gut in den Altbauten unterbringen?
Hilfe von oben nur für Neubau: