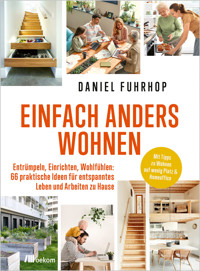Vorwort
Ein toter Junge am Strand. Verzweifelte Menschen an der ungarischen Grenze. Hunderte Flüchtlinge im Münchner Hauptbahnhof, denen hunderte Bürger applaudieren, und das strahlende Gesicht eines Jungen, dem ein Polizist seine Mütze aufgesetzt hat. Bilder, die sich einprägten, und dazu die Worte von Angela Merkel am 31. August 2015: »Wir schaffen das!«1 Weniger im Gedächtnis blieb, dass die Kanzlerin im gleichen Moment bereits von Deutschkursen sprach – und davon, wo die Menschen wohnen werden. Denn wie sie später sagte, lernen wir aus der Zeit der Gastarbeiter Anfang der 1960er Jahre: »Jetzt geht es um die richtige Integration.«2
Damals kamen vierzehn Millionen Migranten nach Deutschland, um dort zu arbeiten, elf Millionen reisten wieder in ihre Heimatländer zurück.3 Die anderen blieben, holten ihre Familien nach oder heirateten, bekamen Kinder und Enkel. Heute hat jeder fünfte Einwohner einen Migrationshintergrund, das heißt, entweder er selbst oder mindestens ein Elternteil hat (oder hatte) eine ausländische Staatsangehörigkeit.4
Nicht zum ersten Mal steht Deutschland also vor der Aufgabe, viele Menschen gut unterbringen und integrieren zu müssen. Auch ein Blick in die Nachkriegszeit kann uns beruhigen, denn damals war alles schwieriger: In kurzer Zeit kamen vierzehn Millionen Vertriebene in ein armes Land mit zerstörten Häusern.5 Doch unsere Städte sind »Auferstanden aus Ruinen«, wie es der Titel der DDR-Nationalhymne verkündete, und das galt erst recht für das Wirtschaftswunderland BRD. Heute sind die Ruinen längst vergessen. Wir haben Häuser gebaut, wohnen auf dreimal so viel Fläche wie 1950 – und über eine Million Wohnungen stehen leer.
Die Aufgabe, vor der wir heute stehen, soll hier nicht kleingeredet werden, aber der Blick zurück kann uns Mut machen und daran hindern zu übertreiben. Es gab eine Wohnungsnot in Deutschland nach dem Krieg, doch heute sollten wir eher von Wohnungsmangel in manchen Metropolen sprechen. In den großen Städten suchen Menschen Wohnungen, aber während die einen suchen, wohnen die anderen manchmal direkt nebenan allein auf hundert Quadratmetern. Und einige Kilometer weiter stehen Häuser leer, und ganze Landstriche entvölkern sich.
Können wir schrumpfende Orte durch Flüchtlinge neu beleben? Das wird nicht einfach, denn kleine Orte haben kleine Möglichkeiten. Und dazu stellt sich die Frage: Wie frei sollen Flüchtlinge ihren Wohnort wählen dürfen? Die Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg wurden teilweise in Wohnungen einquartiert, und wer dort vorher lebte, musste sich an die neuen Mitbewohner gewöhnen. Später kamen Aussiedler aus deutschen Familien im Osten Europas, und sie durften nicht frei entscheiden, in welche Stadt sie ziehen; von 1989 bis 2009 wurde ihnen der Wohnort vorgeschrieben. Insgesamt kamen von 1950 bis zur Jahrtausendwende 4,5 Millionen Aussiedler zu uns.6 Auch ihren Zuzug hat Deutschland bewältigt und sich dadurch verändert. Auf andere Weise wandelte sich das Land durch die Vertriebenen und die Arbeitsmigranten – Veränderungen aus sehr verschiedenen Gründen, die aber alle das Land kräftig durchwirbelten und modernisierten.
Nun hat nicht jeder Zuzügler ein eigenes Haus gebaut, sondern die meisten zogen erst einmal in bereits vorhandene Wohnungen. Wir sollten uns darum auch bei der aktuellen Ankunft von Flüchtlingen vor allem um unsere schon gebauten Häuser kümmern – und genau das hat 2015 begonnen, wie wir noch sehen werden: Abriss wird abgesagt, Leerstand mit neuem Schwung bekämpft. Nicht auf Neubau zu setzen, danach verlangt zudem der Klimaschutz, denn es ist meist ökologischer, Vorhandenes zu sanieren, als energieaufwändig neu zu bauen.7 Damit schließt sich ein Kreis, denn der Klimawandel führt bereits dazu, dass Menschen in manchen Gegenden Afrikas kaum noch leben können und sich nach Europa aufmachen.
Wer vor Klimawandel oder vor Krieg flüchtet, lässt nicht nur seine Wohnung zurück. Die alte Heimat geht verloren, die großen und kleinen Dinge: Haus und Hof, Tisch und Bett, Jacke und Hose. Das Lieblingsbuch, das Tagebuch, das Grundbuch. Verloren gehen die Häuser zur Linken und zur Rechten, die Heimatstadt, die Landschaft. Verloren gehen die Menschen, mit denen die Flüchtlinge ihr Leben teilten, Nachbarn und Kollegen, Freunde. Mancher ließ Frau und Kinder zurück, Bruder und Schwester, Vater und Mutter und machte sich allein auf die Flucht, gab dafür all sein Geld, stieg in ein Boot, überquerte Grenzen. Familien wurden auseinandergerissen, manche trafen sich später wieder.
Aus der Not heraus kommen Menschen zu uns und suchen Hilfe. Sie sehen in Deutschland ihre Zukunft, wollen die Sprache lernen, arbeiten oder eine Ausbildung beginnen. Wenn wir zusammenrücken und die Reserven unserer Wohnungen und Häuser nutzen, haben wir mehr als genug Platz für alle. Dabei geht es nicht allein darum, Flüchtlinge unterzubringen, sondern sie zum Teil der Gesellschaft werden zu lassen: in erfolgreichen und lebendigen Willkommensstädten.
1Was bisher geschah
Wenn man in winterlicher Stimmung im Januar 2016 von den Wohnhäusern der Straße Haferblöcken ostwärts schaut, blitzt das Weiß des Schnees auf dem zugefrorenen Öjendorfer See zwischen den Bäumen hindurch. Wer dann einen Feldweg entlanggeht, über eine Holzbrücke einen Bach überquert und zum Seeufer gelangt, sieht auf der gegenüberliegenden Seite Äcker und Wiesen, Haßloredder genannt, ein letztes Stück Hamburg kurz vor der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein. Man befindet sich hier im Landschaftsschutzgebiet, nahe beim Gartendenkmal Öjendorfer Park.
Kaum vorstellbar: An diesen Orten sollten innerhalb nur eines Jahres Wohnungen gebaut werden, die zusammen mit einem südlich des Sees gelegenen Baugebiet insgesamt viertausend Menschen beherbergen. Das war zumindest der Wille von Politikern des Hamburger Bezirks Mitte, zu dem der Stadtteil Billstedt gehört. Ihrer Meinung nach gab es keine andere Lösung, denn man müsse hier Flüchtlinge unterbringen. Womöglich in achthundert Wohnungen. Für dreitausend, viertausend Flüchtlinge, direkt am Öjendorfer See. Für viele Bürger klang das alles nach: Ghetto.
Ist dieser harte Begriff übertrieben? Ein »Ghetto«, so liest es sich in Wikipedia, bezeichnet heute umgangssprachlich ein »abgesondertes Wohnviertel«, in dem »vorwiegend bestimmte ethnische Gruppen (Segregation)« leben.8 Es ist also das Gegenteil von Integration, wenn mehrere tausend Flüchtlinge eng beieinander wohnen, abgesondert von der Bevölkerung, vorn durch den See, hinten durch die Autobahn und die Landesgrenze. Die Sorge, was in solchen Stadtvierteln passiert, beschrieb Elvis Presley in seinem Lied »In the Ghetto«: Ein Kind wird geboren, es wächst im Ghetto auf, lernt dort zu schlagen und zu stehlen, besorgt sich eine Waffe und wird schließlich erschossen – während gleichzeitig wieder ein Baby im Ghetto geboren wird. Freilich ist das lyrisch verdichtet und beschreibt ein Schicksal in amerikanischen Elendsvierteln, nicht in Hamburg-Billstedt.
Doch auch dort drohen Kinder in einem Kreislauf gefangen zu bleiben, denn in Deutschland schaffen es zu wenige aus einfachen Verhältnissen an die Hochschulen. Von den Kindern aus Billstedt erlangt nicht einmal jeder Zweite Abitur oder Fachhochschulreife, doppelt so viele – um die neunzig Prozent – sind es dagegen in den Elbvororten Blankenese, Othmarschen und Rissen!9 Und während dort kein Einziger ohne Abschluss die Schule verlässt, ist es in Billstedt jeder Dreizehnte.10
Amerikanische Zustände vermeiden und allen eine Chance geben, darum bemühen wir uns in Deutschland. Zum Beispiel in Dringsheide, einer Wohnsiedlung mit bis zu neun Stockwerken auf der westlichen Seite von den Haferblöcken: Dort arbeiten das Kinder- und Familienzentrum KiFaZ und die Kirchengemeinde. Sie betreuen Menschen verschiedenen Alters und vielerlei Herkunft, helfen ihnen bei Problemen und warnen sie davor, falsche Wege einzuschlagen. Vielleicht können sie sich zusätzlich um einige Flüchtlingskinder kümmern, aber sicher nicht um mehrere tausend Flüchtlinge, vom Krieg verstörte Menschen, die Hilfe und Betreuung brauchen.
Integration in derartigen »Ghettos« ist von vornherein zum Scheitern verurteilt, fürchten Bewohner am Öjendorfer See und gründeten auch aus dieser Sorge heraus zwei Bürgerinitiativen gegen die Neubaupläne. Beide setzen sich ausdrücklich für Integration ein – und stecken damit in einem Dilemma: Sagen sie etwas gegen geplante Flüchtlingsbauten, vermutet mancher, sie seien im Grunde gegen die Aufnahme von Flüchtlingen, ja gegen Flüchtlinge im Allgemeinen, gegen Ausländer, gegen Fremde. Sagen sie nichts, würde ein Weg eingeschlagen, von dem sie ahnen, wie schwierig es mit den Massenunterkünften würde, gut zusammenzuleben und sinnvoll zu helfen.
Die beiden Initiativen vertreten die gleichen Ziele: Sie wenden sich gegen die geplanten Bauten für mehrere tausend Flüchtlinge am Öjendorfer See. Um diese Pläne zu verhindern, organisierte die »Bürgerinitiative Öjendorfer Park« einen runden Tisch mit Vertretern von SPD, CDU, AfD, Bündnis 90/Die Grünen und der Linken. Die Bürgerinitiative »natürlich MITTEndrin« spricht hinter den Kulissen mit Politikern und beteiligt sich an den sogenannten Werkstätten, Arbeitstreffen mit Bürgern, in denen über die Pläne diskutiert wird. Beiden Initiativen geht es vor allem um das richtige Maß. Schließlich hat im Stadtteil Billstedt ohnehin über die Hälfte der Bewohner einen Migrationshintergrund, bei den unter 18-Jährigen sogar über zwei Drittel.11 Um den Stadtteil zu durchmischen, entstanden an den Haferblöcken in den letzten Jahren neue Einfamilien- und Reihenhäuser. Und genau hier sollen nun die Flüchtlingsbauten hin.
Wenn die Bürger neben ihrem Protest zugleich für Integration eintreten, sind das nicht nur Worte. So erklärt sich die Bürgerinitiative Öjendorfer Park bereit, Integrationspatenschaften zu übernehmen,12 und einige boten sogar an, sich im Gegenzug für eine maßvollere Bebauung vertraglich zur Integrationshilfe zu verpflichten.13 Die Initiative »natürlich MITTEndrin« gründet parallel zu ihrer Arbeit einen Verein, der sich für Umwelt und Integration einsetzt und mit dem sie einen interkulturellen Garten an den Haferblöcken betreiben möchte.
Was der Streit am Öjendorfer See eindrucksvoll zeigt, ist die Vielfalt der Aufgaben, vor denen wir angesichts der Aufnahme der Flüchtlinge stehen: Da ist die Sorge um die Natur, um Felder und Landschaft. Da geht es um Geld, zum Beispiel im Haßloredder am Ostufer des Sees, wo die Äcker Bauern gehören und die Stadt sie erst kaufen müsste. Doch zu welchem Preis? Dem von Ackerland oder von Bauland, was entweder fünfzig oder fünfhundert Euro pro Quadratmeter bedeuten könnte? Nicht zuletzt müssen wir für Integration sorgen. Ob sie gelingt oder nicht, fängt bereits mit der Lage an, und hier stellt sich wirklich die Frage, ob der Haßloredder optimal gewählt ist, ein Dutzend Kilometer vom Stadtzentrum entfernt und immerhin vier Kilometer vom nächsten U-Bahnhof. Mindestens so wichtig sind jedoch soziale Einrichtungen, und da warten selbst die bisherigen Bewohner an den Haferblöcken noch immer auf die versprochenen zwei Kitas, einen Bolzplatz, einen Kinderbauernhof und ein Haus der Jugend.14
Auch südlich des Öjendorfer Sees wurden Zusagen der Politik nicht eingehalten: So findet sich am Mattkamp seit Mitte der 1990er Jahre ein Pavillondorf für vierhundert Menschen, ursprünglich geplant für Aussiedler aus der früheren Sowjetunion. Damals hieß es, die Bauten sollten nur wenige Jahre stehen, doch nun sind daraus zwei Jahrzehnte geworden.15 Heute dienen die Pavillons Obdachlosen und Flüchtlingen.
Rund um den Öjendorfer See lässt sich die Geschichte der Zuwanderung nach Deutschland ablesen wie in einem Buch, in dem man immer weiter nach hinten blättert: von der aktuellen Debatte um Flüchtlinge an den Haferblöcken über den Zuzug der Aussiedler in den 1990er Jahren am Mattkamp bis zur Migration aus Südeuropa in den 1960ern, von der die bunt gemischte Herkunft der Menschen in Dringsheide herrührt. Von dem Zuzug der vertriebenen Deutschen aus Osteuropa in der Nachkriegszeit zeugen schließlich manche Eigenheime in den ehemaligen Kleingärten westlich des Sees.
Die idyllische Lage lockte in den letzten Jahren manch neue Bewohner an. Sie freuten sich darauf, am Park zu wohnen und auf den See zu blicken – ein vermeintlich unverbaubarer Blick am Rande des Landschaftsschutzgebiets Öjendorf-Billstedter Geest. Doch genau hier könnte nun innerhalb weniger Monate eine neue Siedlung entstehen: Änderungen im Baugesetzbuch ermöglichen es, manche Schritte, die bei der Ausweisung von Baugebieten sonst üblich sind, auszuhebeln. Für Flüchtlinge wäre es dann erlaubt, auch im Landschaftsschutzgebiet zu bauen. Nun könnte man sagen, eine schöne Aussicht sei derzeit wirklich weniger wichtig, aber das Angebot des Bezirks hat nun einmal viele erst dazu gebracht, hier ein Haus zu kaufen oder zu bauen. Im Vertrauen darauf und als Ausgleich für günstige Bodenpreise mussten die Käufer sich verpflichten, zehn Jahre im eigenen Heim wohnen zu bleiben. Darf diese Verpflichtung weiterhin gelten, wenn statt Feldern nun tausend Wohnungen und tausende Flüchtlinge die neuen Nachbarn werden? Und darf die Politik die Gesetze ändern und dadurch die Beteiligung der Bürger umgehen? Vielleicht werden diese Fragen vor Gericht geklärt, denn die Initiative »natürlich MITTEndrin« beauftragte einen Rechtsanwalt einer Kanzlei, die schon andernorts Baupläne für Flüchtlingsunterkünfte stoppte.
Initiativen für erfolgreiche Integration Hamburg – gegen große Siedlungen
Der Dachverband vereint Bürgerinitiativen in Hamburg mit dem Ziel, große Siedlungen zu verhindern und Flüchtlinge dezentral besser zu integrieren. Zum Verband gehören folgende Initiativen (Stand Mai 2016):
Bürgerinitiative Lebenswertes Klein-Borstel
Bürgerinitiative Lebenswertes Lemsahl-Mellingstedt
Bürgerinitiative VIN Rissen, Vorrang für Integration und Nachhaltigkeit
Bürgerinitiative Gemeinsam in Poppenbüttel
Bürgerinitiative LOB – Lurup-Osdorf-Bahrenfeld
Bürgerinitiative Neugraben-Fischbek, NEIN! zur Politik, JA zur Hilfe!
Erhalt der Hummelsbütteler Feldmark
Bürgerinitiative Integration: Ja! Ghetto: Nein! – Hamburg-Billwerder
Bürgerinitiative Neue Nachbarn Langenhorn e. V.
Sozial gerechtes Eidelstedt
Bürgerinitiative Marmstorf-Sinstorf
Eppendorf/Lokstedt Integration statt Großsiedlung
Interessengemeinschaft Duvenacker
Womöglich wird über den Neubau am Öjendorfer See sogar auf Landesebene entschieden, denn das Beispiel steht nicht allein: In Hamburg wehrt sich gleich ein Dutzend Bürgerinitiativen gegen große Flüchtlingssiedlungen.16 Insgesamt plante das Land anfangs den Bau von 5.600 Wohnungen für etwa 25.000 Flüchtlinge, wie der Senat im Herbst 2015 verkündete. Sie sollten auf Siedlungen mit bis zu 800 Wohnungen und 4.000 Bewohnern aufgeteilt werden. Um das zu verhindern, haben sich die Initiativen in einem Dachverband zusammengetan, den »Initiativen für erfolgreiche Integration Hamburg«. Sie sammelten Anfang 2016 innerhalb von nur vier Tagen weit über zwanzigtausend Unterschriften in einer Volksinitiative, die 2017/18 zum Volksentscheid führen könnte. Ihr Ziel: große Siedlungen verhindern und den Senat stattdessen zwingen, möglichst nur hundert Flüchtlinge an je einem Ort unterzubringen, höchstens aber dreihundert, und das in normalen Wohnungen dezentral auf die Bezirke verteilt.17 Daran habe die Landespolitik kein Interesse und bemühe sich noch nicht einmal um Angebote einzelner Wohnungen, sagen manche Bürger, und so kommt es vielleicht zur Abstimmung, auch aus Ärger über zu späte und zu sparsame Informationen. Womöglich aber einigt sich die Politik stattdessen in Verhandlungen mit der Initiative auf eine andere Art, die Flüchtlinge unterzubringen.
Die Initiativen in Hamburg und anderswo möchten die Flüchtlinge gut unterbringen, aber trotzdem keine Siedlungen bauen und keine Parks versiegeln. Langfristig führt das zu grundsätzlichen Fragen: Wo können wir die Menschen stattdessen aufnehmen? Wie verändert das unsere Städte, und welche Zukunft stellen wir uns für sie vor? Kurzfristig aber steht alles unter der Frage, wie wir genug Wohnraum bereitstellen können – und da helfen anfangs ohnehin keine Neubauten, deren Errichtung mindestens ein Jahr braucht. Doch seit dem Herbst 2015 hat sich Erstaunliches getan. Nach der Zeit der Turnhallen und Zelte fanden sich auf wundersame Weise nicht nur Zimmer, Wohnungen und Häuser, sondern auch originelle Orte. Schauen wir uns also an, was bisher geschah.
Platz schaffen
In der Mensa der Frankfurter Universität im Stadtteil Bockenheim hatte zehn Jahre lang niemand gegessen. Der letzte Duft von Essen und Kaffee hatte sich schon lange verzogen, nur nach Staub roch der sogenannte Labsaal. Dabei leistete er vier Jahrzehnte lang treue Dienste: 1962 wurde die Mensa eröffnet, ein schlichter Bau, quadratisch, praktisch, gut. Seine Fassade besitzt eine gewisse Eleganz, sie ist klar gegliedert, mit großen Fenstern, die von feinen Profilen gerahmt werden. Das ist Nachkriegsmoderne im besten Sinne, entworfen vom Architekten Ferdinand Kramer, den das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt 2016 mit einer Ausstellung ehrt. Doch trotz aller Anerkennung bei Fachleuten war es um die Mensa beinahe geschehen: Nachdem die Universität einen neuen Campus im Westend bezogen hatte, stand der Altbau leer und sollte schließlich abgerissen werden.
Dann aber kamen die Flüchtlinge, die Stadt Frankfurt suchte nach Räumen – und fand die Mensa. Die städtische Wohnungsgesellschaft ABG baute sie um, zog Trennwände ein, verlegte Heizungsrohre, baute Duschen und Toiletten. Die große Küche gab es ja bereits, und in ihr wird nun das Essen für 160 Flüchtlinge gekocht. Nach zehn Jahren Stille klappern hier wieder Tassen und Teller.
Im Erdgeschoss teilen sich je zwei Männer ein Zimmer, während im Obergeschoss bis zu sechs Betten pro Raum für Familien stehen. »Kramer hätte es wohl gefreut«, schreibt die Redakteurin Katrin Kimpel, denn er »war selbst Emigrant und verließ Deutschland 1933«.18 Flüchtlinge sorgen nun dafür, dass Kramers Mensabau vorerst gerettet wird.
Landauf, landab werden Häuser nun doch nicht abgerissen, sondern für Flüchtlinge genutzt. Oft wird der Abriss nur verschoben, aber selbst das bietet die Chance, noch einmal darüber nachzudenken, was unsere alten Häuser wert sind: Können manche schlichten Gebäude doch etwas leisten? Brauchen wir nicht gerade die einfachen Häuser, die wenig Geld kosten? Und haben wir nicht bisher viel zu voreilig abgerissen? Schließlich erhält man mit jedem Haus ein Stück Baukultur, wenn auch nicht immer so bedeutende Architektur wie die Mensa Ferdinand Kramers. Aber wer ein Haus rettet, rettet einen kleinen Teil der Stadt.
Die Stuttgarter Wohnungsgesellschaft »Flüwo Bauen Wohnen« knüpft bei einer derartigen Rettungsaktion an ihre eigene Geschichte an: Sie reißt drei Gebäude in der Julius-Keck-Straße in Göppingen vorerst nicht wie geplant ab, sondern bringt dort nun Flüchtlinge unter – und wird damit ihrem eigenen Namen gerecht, denn Flüwo stand ursprünglich für die »Flüchtlings-Wohnungsbaugesellschaft«,19 die 1948 von Vertriebenen gegründet wurde.
Diese Häuser in Göppingen sollten eigentlich abgerissen werden, um am gleichen Ort neu bauen zu können. Ganz anders in Kerpen-Manheim bei Köln, bekannt geworden durch die Kartbahn, auf welcher der siebenfache Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher fahren lernte: Da soll das ganze Dorf ersatzlos verschwinden! Sein Schicksal entschied sich unter der Erde, denn dort befindet sich Braunkohle. Die riesigen Bagger des Tagebaus rücken näher, und die Grundschule soll ebenso zerstört werden wie die Gaststätte Zum roten Hahn, die katholische Kirche St. Albanus und Leonhardus sowie – Protesten zum Trotz – auch die Kartbahn.20 Darum müssen die Bewohner bis 2022 ihre Häuser verlassen. Anfang 2016 lebten hier nur noch etwa vierhundert Menschen, früher waren es viermal so viele. Doch nun bekamen die Verbliebenen neue Nachbarn. Knapp dreihundert Flüchtlinge zogen in die leerstehenden Häuser.21 Wenn jetzt überraschend wieder Familien und Kinder in Häuser ziehen, die dem Abriss geweiht waren, führt uns das die Absurdität unseres Wirtschaftens vor Augen. Für Braunkohle zerstören wir heute Dörfer wie Kerpen-Manheim, die seit tausend Jahren bewohnt sind, anstatt konsequent auf erneuerbare Energien zu setzen und die Energiewende voranzubringen. Für ein paar Jahre Aufschub für die Energieträger von gestern soll ein Dorf geopfert werden, das Heimat von Menschen war und durch die Flüchtlinge nun wieder zur Heimat wurde.
Manchmal wird dank des Zuzugs der Flüchtlinge Abriss jedoch nicht nur aufgeschoben, sondern aufgehoben, etwa im Rahmen des Programms Stadtumbau Ost. Bislang wurden dabei faktisch Wohnungen in den neuen Bundesländern abgerissen, weshalb man das Programm korrekterweise Stadtabriss Ost nennen müsste.22 Nun hat aber zumindest das Bundesland Brandenburg umgedacht: Mit 17,5 Millionen Euro, die für Abriss vorgesehen waren, will man viertausend Wohnungen für Flüchtlinge herrichten, hieß es im September 2015.23 Und bis zum Jahresende hatten bereits 32 Städte Geld beantragt, um vom Abriss bedrohte Häuser nun doch zu sanieren und darin Flüchtlinge unterzubringen.24
Leerstand war einmal
Das Rathaus Wilmersdorf sollte ohnehin nur kurz leerstehen, um dann den Landesrechnungshof Berlins und das Landesarbeitsgericht aufzunehmen, doch es kam alles anders, und der Bau wurde zu einer der prominentesten Unterkünfte für Flüchtlinge weit über Berlin hinaus. Im Jahre 1943 wurde das Gebäude fertiggestellt, mit großzügigen Gesimsen, die dem Schwung der Fassade folgen, im klassizistischen Stil, weshalb der Bau mittlerweile unter Denkmalschutz steht. Von 1954 an diente er sechs Jahrzehnte lang dem Bezirk Wilmersdorf als Rathaus, im Zuge der Bezirksfusion in Berlin wurde er geräumt, 2014 harrte er schließlich seiner Sanierung, und es bot sich eine günstige Gelegenheit, als in kurzer Zeit viele Flüchtlinge untergebracht werden mussten.
Seit Herbst 2015 leben nun etwa tausend Menschen im alten Rathaus – und der solide Bau mit seinen massiven Wänden, unterteilt in viele Räume mit Strom- und Wasseranschluss, eignet sich im Unterschied zu manchem Provisorium recht gut dafür. Ergänzt werden musste nur wenig, vor allem Duschcontainer. Überregional bekannt wurde diese Unterkunft aber dank des Engagements der Anwohner: Durch die Hilfsbereitschaft tausender Charlottenburger und Wilmersdorfer verwandelte sich das Haus in mehr als eine Herberge.25
Da ertönen nun aus einem Raum deutsche und arabische Worte, denn das Rathaus wurde zur Sprachenschule. In der Kleiderkammer befühlt ein Mädchen die griffige Sohle von Turnschuhen, und sein kleiner Bruder streicht über die weiche Wolle eines Pullovers. Ein paar Meter weiter begrüßt uns der Essensduft der Kantine, in der Mahlzeit für Mahlzeit tausend Flüchtlinge versorgt werden. Verabschieden wir uns von deftiger Suppe, erleben wir einige Räume weiter den bitteren Geschmack mancher Medizin, für die es hier ein kleines Lager gibt. Und wenn wir weitergehen, sehen wir schließlich, dass selbst die herzliche Aufnahme in dieses wundersame Rathaus manches Flüchtlingskind nicht davor bewahrt, mit furchtsamem Blick einen besonderen Raum zu betreten: die Zahnarztpraxis.
Leerstehende Gebäude in Berlin, die jetzt für Flüchtlinge genutzt werden: Das Rathaus Wilmersdorf, das alte Rathaus Friedenau, die ehemalige Lungenklinik Heckeshorn am Wannsee – die Liste ließe sich fortsetzen. Derzeit gibt es in jeder Stadt Dutzende Bauten, deren Leerstand auf diese Weise beseitigt wird. Einfach ist das, wenn die Häuser ohnehin den Kommunen gehören, während private Immobilien erst angemietet oder gekauft werden müssen. Eine große Managementaufgabe oder – wie Dieter Heckmann, City-Manager von Sulzbach/Saar, es ausdrückt26 – »ein kleines Konjunkturprogramm für das Leerstandsmanagement«. Heckmann kümmert sich um die Vermietung leerstehender Läden und Wohnungen, um die Sulzbacher Innenstadt zu beleben. Seiner Beobachtung nach investieren viele private Vermieter jetzt und sanieren ihre Wohnungen, weil durch die Flüchtlinge die Nachfrage steigt; es sei also gleichzeitig »ein Konjunkturprogramm für das Handwerk und die Wirtschaft«.27
Nur wenige Städte und Gemeinden haben einen solchen Leerstandsmanager. Mehr noch: Zwei Drittel der Städte und Gemeinden wissen nicht einmal, wie viel bei ihnen leersteht.28 Auch wenn es aus der Not heraus geschieht, ist es erfreulich zu sehen, wie man jetzt allerorten sucht, registriert und katalogisiert und dadurch leere Büros, Wohnungen und Häuser findet, prüft und dort Menschen beherbergt.
Anteil leerstehender Wohnungen(nach dem Zensus 2011/revidiert 201429)
Mithilfe einer Onlineplattform will das Land Nordrhein-Westfalen nun Städte und Vermieter verbinden und so 80.000 leerstehende Wohnungen neu nutzen.30 Das erinnert an die Initiative Leerstandsmelder: Auch dort werden online leerstehende Büros und Häuser aufgeführt, allerdings als offene Plattform, in die jeder etwas eintragen kann.31 Inzwischen gibt es Leerstandsmelder in dreißig Städten.
Zu den ungewöhnlichsten leerstehenden Bauwerken gehören sicherlich Kirchen; hunderte sind es inzwischen, weil immer weniger Menschen den Kirchen angehören.32 Jetzt werden die Räume so mancher Kirchengemeinde für Flüchtlinge umgenutzt. Was bei den eigentlichen Kirchenräumen schwierig sein mag, gelingt in Nebenräumen, Gemeindezentren und Wohnräumen.33 Natürlich wird der eine oder andere Gläubige wehmütig, wenn seine Kirche nicht mehr als Gotteshaus dient. Aber gibt es einen besseren Ausdruck christlicher Nächstenliebe, als Menschen in Not Obdach zu gewähren?
Im Vergleich zu einer Kirche mag eine Kaserne weniger friedliche Gedanken wecken, doch als Gebäude ist sie für Flüchtlinge oftmals besser geeignet, schließlich wurde sie dafür gebaut, viele Menschen zu beherbergen. In den letzten Jahren wurde viel Raum frei, weil es immer weniger Soldaten in Deutschland gibt: Ihre Zahl sank seit der Wiedervereinigung um über eine Million.34 Das liegt nicht nur am Abzug der Alliierten, der nach wie vor weitergeht; allein von Briten und Amerikanern werden in den nächsten Jahren über zehntausend Wohnungen geräumt. Auch die Bundeswehr wird verkleinert, sie schließt ganze Standorte und gibt Kasernen ab.
Die riesigen Flächen zu verwerten ist die Aufgabe der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima), und die hatte bislang keinen guten Ruf bei den Kommunen. Ihr Auftrag besteht nämlich per Gesetz darin, möglichst viel Geld einzunehmen. Darum kam manche Gemeinde zu kurz und sah mit an, wie günstig gelegene Bauten an private Investoren gingen. Doch nun hat sich die Arbeit der Bima ebenso wie ihr Image radikal geändert – sie ist dafür zuständig, Flüchtlinge unterzubringen, und tut das mit großem Erfolg: Die Bima wurde zum größten Versorger Deutschlands! Etwa 170.000 Plätze hatte sie bis Mai 2016 geschaffen, davon gut 30.000 in teilweise noch genutzten Kasernen.35
Kreuzfahrtschiffe als Arche Noah
Noch vor wenigen Jahren konnte man mit der MS Solaris den Nil entlangfahren oder mit der MS Diana eine Flusskreuzfahrt auf der Donau machen. Doch was sich luxuriös anhört, bot nur einen bescheidenen Komfort; schließlich wurden die beiden Schiffe bereits 1982 (Solaris) beziehungsweise 1970 gebaut.36 Dementsprechend äußerten sich Reisende auf einem Touristikportal: »Das Schiff ist schon älterer Bauart, im Inneren dunkles Mobiliar, das teilweise erdrückend wirkt«, heißt es dort über die Solaris.37 Andererseits bietet sie hundert Menschen Platz, weitere achtzig befördert die Diana. Beide aber sind wie fast alle Kreuzfahrtschiffe nur im Sommer unterwegs, und im Winter liegen sie nutzlos herum.
Das ging den Touristikexperten der Consulting Partner Bremen durch den Kopf. Könnte man die Boote nicht zeitweise für Flüchtlinge zur Verfügung stellen? Sie sprachen mit Reedern und mit Städten, und dann ging alles schnell: Solaris und Diana liegen seit Ende 2015 im Dortmunder Hafen, und zwar gleich für zwei Jahre, weil die Stadt längerfristig planen möchte. Die Caritas betreibt die Schiffe als Unterkunft, und als christliche Einrichtung fiel ihr auf, wie sich dieser ungewöhnliche Ort deuten lässt: »Das biblische Symbol der Arche als Zufluchtsort ist Christen, Juden und Muslimen gleichermaßen vertraut«, zitiert die Caritas-Zeitschrift den Mitarbeiter Manfred von Kölln.38
Die Stadt achtet darauf, dass auf der »Arche« nicht jene Menschen untergebracht werden, die mit dem Schiff über das Mittelmeer geflüchtet sind und damit schreckliche Erinnerungen verbinden. Für alle anderen sind die Kreuzfahrtschiffe jedoch allemal besser als Zelte oder Turnhallen. Es ist also wörtlich zu nehmen, wenn Heinz Kolata von Consulting Partner Bremen sagt: »Das Boot ist noch nicht voll.«39
Geld verdienen
Die Immobilien Zeitung berichtet normalerweise über Bürohäuser, Shoppingcenter und Logistikhallen, doch im Oktober 2015 widmete sich die Zeitung auf sechs Seiten einem neuen Thema: Flüchtlingsunterkünften. Da geht es um die Umwandlung von Büros in Flüchtlingswohnungen, um Container und Kasernen, um Mietverträge und Vergaberecht. All das kommt seitdem regelmäßig vor, denn die Bau- und Immobilienwirtschaft steht vor einer ungewöhnlichen Aufgabe. Einerseits handelt es sich bei der Unterbringung um einen neuen Markt, in dem sich Geld verdienen lässt, andererseits geht es um eine soziale Frage. Als Fazit schreibt die Immobilien Zeitung: »Die Immobilienwirtschaft irrlichtert bei der Unterbringung von Flüchtlingen ohne Kompass zwischen Geschäft und Moral.«40 Es gebe Makler, die auf Provision verzichten, während andere die Lage ausnutzen.
Bei diesem heiklen Thema kam die Redaktion nur schwer an Informationen. Der Vermieter einer Unterkunft sagte ihr, er werde gleich doppelt angefeindet: von Flüchtlingsgegnern, weil er die Flüchtlinge in den Ort geholt habe, von Flüchtlingsfreunden, weil er sich an ihnen bereichere.41 Bereits im Sommer 2014 hatte die Immobilien Zeitung über das Thema berichtet. Damals war die Redakteurin Christine Rebhahn auf den Eigentümer und Unternehmer Willi Wittenzellner aus dem niederbayerischen Ort Regen gestoßen, der drei ehemalige Pensionen vermietete.42
Gemeinsam mit seiner Familie betrieb er die Unterkünfte und arbeitete mit Betreuern und ehrenamtlichen Helfern zusammen. Eigentlich hatte er andere Pläne, wollte einige Häuser für Senioren umbauen. Doch nun hatte sich die Vermietung für Asylbewerber zur gar nicht mehr so kurzfristigen Zwischennutzung entwickelt. Dabei hielt er sich nicht an die Vorgaben des Sozialministeriums, die jedem Bewohner nur sieben Quadratmeter zugestehen. Das gebe Unruhe, sagte Wittenzellner der Zeitung, schließlich handele es sich um Geflüchtete, von denen manche traumatisiert seien. Bei ihm erhalte jeder zwölf bis vierzehn Quadratmeter. Außerdem bilde er Wohngruppen mit acht bis zehn Personen, möglichst gleicher Nationalität. Man müsse die Wohnungen so einrichten, dass die Flüchtlinge sich wohlfühlen könnten, und man müsse sie gut betreuen. Wer nur auf schnelles Geld aus sei, werde bald Probleme bekommen.
Leider sehen es manche Vermieter nicht als Problem an, viele Menschen auf wenig Raum für viel Geld unterzubringen. Einige Hostels und Anbieter von Ferienwohnungen vermieten nun an Flüchtlinge, weil das Geschäft sich lohnt: Die Ämter zahlen bis zu 50 Euro pro Nacht und Person, 1.500 Euro im Monat manchmal für nur ein Zimmer.43 Für dieses Geld könnte man eigentlich besser wohnen, aber unter Druck ließen sich Behörden auf dubiose Angebote ein. Mancher Vermieter bringt sechs Personen in einer Dreizimmerwohnung unter und bekommt dafür 9.000 Euro – im Monat!44
Zum Glück sind das Ausnahmen. Und es besteht auch kein Grund dafür, nun unmoralisch zu handeln, denn so komisch das klingen mag: Für die Immobilienwirtschaft ist die Lage mehr als günstig. Plötzlich steigt nämlich die Nachfrage nach Flächen aller Art, sogar schlichte Wohnhäuser oder seit langem leerstehende Büros können jetzt vermietet werden und damit gerade jene Altbauten, die bislang keine Nutzer fanden. Endlich werden Häuser, die mitunter seit Jahren leerstanden, wieder belebt. Doch noch sehen nicht alle Eigentümer die Chance, die sich ihnen bietet, geschweige denn die Verantwortung, in der sie nun stehen.
Beschlagnahmen
Als der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer im August 2015 zum ersten Mal öffentlich drohte, leerstehende Häuser notfalls zu beschlagnahmen, löste das großen Wirbel aus. Die Medienberichte stapelten sich. Politiker und Verbände protestierten. Doch in den nächsten Monaten erschien die reine Drohung harmlos, weil manche Städte tatsächlich Gebäude beschlagnahmten. So konfiszierte Berlin kurzerhand das ehemalige Gebäude der Landesbank an der Bundesallee, einen zehn Stockwerke hohen Bau mit 18.000 Quadratmetern.45 Das Haus gehörte dem Bund, und ihm bot das Land an, es zu kaufen, was dann auch geschah.46 Entscheidend war aber der Zeitgewinn: Es dauerte bis zum 1. Januar 2016, den Kauf zu klären, doch durch die Beschlagnahme konnte das Gebäude bereits im September genutzt werden.
Schnell auf Gebäude zugreifen zu können ist der große Vorteil einer Beschlagnahmung.47 Erinnern wir uns daran, wie in Berlin und München tausende Flüchtlinge an nur einem Wochenende eintrafen: Die Behörden mussten für jeden sofort einen Platz und ein Bett organisieren. Kurzerhand belegten sie Turnhallen und Messehallen – doch gleichzeitig stehen anderswo Büros und Wohnungen leer, weil Eigentümer sich nicht entschließen können, an wen sie diese zu welchem Preis vermieten sollen! In dieser Notlage dürfen Behörden leerstehende Häuser sicherstellen. Dabei handelt es sich nicht um eine Enteignung, denn die Eigentümer bleiben dieselben. Sie bekommen Geld für die beschlagnahmten Gebäude, eine Entschädigung. Man drängt sozusagen einem unentschlossenen Vermieter die Miete auf.
Möglich wird die Beschlagnahmung durch das Polizei- und Ordnungsrecht der Bundesländer; es gibt den Behörden das Recht, bei drohender Obdachlosigkeit Flächen sicherzustellen, um dort Menschen unterzubringen. Nach dem Motto »doppelt hält besser« haben die Länder Bremen und Hamburg darüber hinaus neue Landesgesetze erlassen. Diskutiert haben die Politiker dabei vor allem darüber, ob auch Wohnungen beschlagnahmt werden sollen oder nur Gewerbebauten