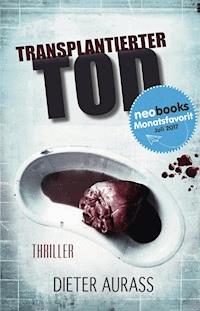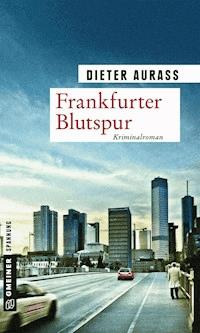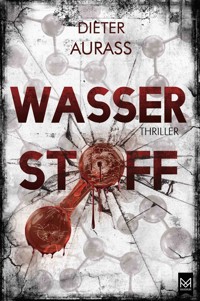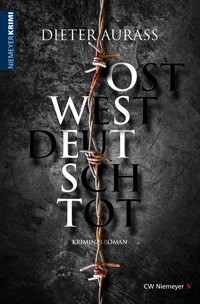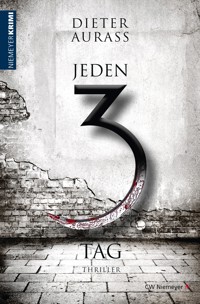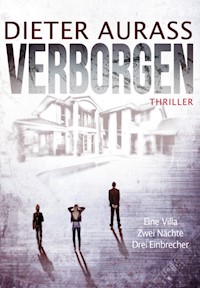
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Drei Einbrecher begehen jeder allein einen Einbruch, Alle drei brechen in eine Villa ein, jeder auf einem anderen Weg, alle drei aus unterschiedlichen Gründen, aber … ohne vorher etwas voneinander zu wissen, zur selben Zeit und in dieselbe Villa! Ein Dieb, eine ehemalige Hausangestellte und ein Psychotherapeut sehen sich nicht nur plötzlich miteinander konfrontiert, sondern auch mit dem Problem, etwas zu finden, was sie verborgen in der Villa vermuten. Jeder sucht etwas Anderes und kann es nur finden, wenn sie sich zusammenraufen und gemeinsam versuchen, das Geheimnis der Villa zu lüften. Aus anfänglicher Gegnerschaft entwickelt sich eine zunächst widerwillige Zusammenarbeit, in deren Verlauf sie sich gegenseitig ihre Geheimnisse anvertrauen. Gemeinsam kommen sie schließlich einem Geheimnis v on ungeahnten Ausmaßen auf die Spur … und geraten dadurch in Lebensgefahr.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieter Aurass
Verborgen
Eine Villa, zwei Nächte, drei Einbrecher
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Titel
Widmung
Kapitel 1 - der Dieb
Kapitel 2 - der Psychologe
Kapitel 3 - die Angestellte
Kapitel 4 - im heißen Süden
Kapitel 5 - Überraschung!
Kapitel 6 - aller guten Dinge sind …
Kapitel 7 - Abtasten
Kapitel 8 - Katrins Erinnerung
Kapitel 9 - Was ist wo?
Kapitel 10 - der Safe
Kapitel 11 - nächtliche Begegnungen
Kapitel 12 - der verborgene Raum
Kapitel 13 - Benjamins Erinnerungen
Kapitel 14 - New Orleans II
Kapitel 15 - Tor Eins, Zwei oder Drei?
Kapitel 16 - der verschlüsselte Schlüssel
Kapitel 17 - New Orleans III
Kapitel 18 - Sesam öffne dich
Kapitel 19 - Kalles Erinnerungen
Kapitel 20 - Retten, was geht!
Kapitel 21 - neue Erkenntnisse und Beweise
Kapitel 22 - die Truppen rücken an
Kapitel 23 - Gegenmaßnahmen
Kapitel 24 - New Orleans IV
Kapitel 25 - drastische Maßnahmen
Kapitel 26 - späte Rache
Kapitel 27 - Aktion und Reaktion
Epilog
Nachwort
Danksagung
Impressum neobooks
Titel
Verborgen
Ein Thriller
von
Dieter Aurass
Copyright Dieter Aurass 2017
Neuauflage 2022
Cover: vercodesign
Widmung
Für meine Mutter,
die den Wunsch hatte, dass ich endlich mal einen
unblutigen Thriller ohne Leichen schreibe.
Bitteschön!
Kapitel 1 - der Dieb
Lustig, dachte er bei sich, als er sich durch dunkle Ecken schleichend langsam seinem Ziel näherte. Die sind einfach alle zu blöd. Was sind das wohl für Sicherheitsexperten, die die Superreichen beraten und denen einen solchen Scheiß andrehen?
Bereits früh in seiner Karriere hatte er gelernt, dass jede Alarmanlage ihre Schwachstelle hatte, auch wenn die Verkäufer dieser Anlagen dies immer leugneten. Wie kann man sonst Sicherheit verkaufen, wenn man sich nicht wirklich sicher ist. Also wird von Schwachstellen einfach nicht geredet. Was für ein Glück für mich. Wenn die so gut wären, wie sie sein könnten, hätte ich ja keine Chance. Also sei einfach froh!
›Und wenn du so gut wärst, wie du meinst, würdest du an deinem Schwachsinnsplan wenigstens zweifeln!‹
Die innere Stimme, die ihn in letzter Zeit mehr als nervte, musste ihn unbedingt wieder quälen. Seit etwa drei Monaten erklang sie immer wieder und meist zu Zeiten, in denen er gut auf sie hätte verzichten können. Eine Zeitlang hatte er den Verdacht gehabt, er würde verrückt. Dann hatte er Bücher über Schizophrenie, die Macht des Unterbewusstseins, Geisteskrankheiten im Allgemeinen, gespaltene Persönlichkeiten und Ähnliches gelesen. Aber dieser ganze Psychoquatsch war ihm zu hoch und hatte auch nicht geholfen, die Stimme loszuwerden. Völlig ignorieren konnte er sie allerdings nicht. Also hatte er angefangen, mit ihr zu diskutieren oder wenigstens versucht, sie in ihre Schranken zu weisen. Allerdings zweifelte er um so mehr an seinem bisschen Restverstand. Aber er wollte sich so kurz vor dem Ziel nicht von seinem Plan abbringen lassen.
»Ach halt’s Maul!«, knurrte er zwischen zusammengepressten Zähnen hervor. Für den Moment schwieg die Stimme.
Er verdrängte diese Gedanken und konzentrierte sich auf die eigentliche Aufgabe. In dem Villenviertel, unmittelbar am Rhein, war um 03:30 Uhr nachts kein Mensch mehr auf der Straße. Zu spät, um nochmal den Hund auszuführen, zu früh für Frühaufsteher und zudem wohnten in dieser Gegend nicht die jungen Leute, die kurz vor Morgengrauen erst nach Hause kamen.
Kalle Anders näherte sich der Verzweigungsstelle der Stromversorgung und holte sein Spezialwerkzeug hervor. Eigentlich war es lächerlich, wie einfach der Kasten zu öffnen war, aber die tatsächliche Schwierigkeit zeigte sich erst danach, als er das Gewirr hunderter von Kabeln und Anschlüssen vor sich sah. Es wäre kein Problem gewesen, die Stromversorgung des gesamten Viertels lahmzulegen, aber das hätte sofort den Energieversorger auf den Plan gerufen. Eine Störung solchen Ausmaßes musste selbstverständlich sofort behoben werden, dafür würden aufgebrachte Anwohner sehr schnell sorgen. Das war aber genau das, was er unter allen Umständen verhindern wollte. Sein Augenmerk lag ganz alleine auf einer Villa, deren Stromversorgung er unterbrechen wollte. Zu diesem Zweck nahm er ein Gerät aus seiner schwarzen Umhängetasche, an dem ein Drehregler und zwei Drähte mit Krokodilklemmen befestigt waren. Diese zwei Klemmen schloss er nacheinander an verschiedene Drähte an und drehte dann sehr vorsichtig an dem Regler. Dabei beobachtete er die Straßenbeleuchtung in der näheren Umgebung.
Geduld war keine seiner großen Tugenden und sehr schnell wurde er ungehalten und fluchte leise vor sich hin. Als nach vierzig Versuchen noch immer nichts passiert war, wurde er langsam sauer. Nach mehr als fünfzig Versuchen sah er erstmals das Flackern einer Laterne in etwa hundert Metern Entfernung.
Aha, langsam kommen wir der Sache näher. Der benachbarte Anschluss in dem Verteilerkasten ließ eine Laterne Flackern, die nur noch fünfundsiebzig Meter entfernt lag. Drei Anschlüsse später flackerten zwei Lampen direkt vor dem richtigen Grundstück. Beherzt kappte er die beiden Drähte in dem Verteilerkasten. Der nächste Test ließ zwei weitere Lampen vor dem Grundstück flackern und er kappte auch diese Leitungen. Eine Minute später war er sicher, dass das Gebiet der Villa nun vollständig ohne Strom sein musste - und ohne Strom funktionierte auch die beste Alarmanlage nicht mehr. Die Kosten für eine eigene Stromversorgung scheuten selbst Millionäre, zumindest in Ländern, in denen Stromausfälle nicht an der Tagesordnung waren.
Nun war er nicht mehr weit von dem größten Coup entfernt, den er jemals gelandet hatte. Er grinste zufrieden in sich hinein.
Diesmal schaffe ich es. Das wird das größte Ding, das ich je abgezogen habe.
Sorgfältig verschloss er den Verteilerkasten wieder, packte seine Gerätschaften in die Umhängetasche und schlenderte langsam und ohne Hast in Richtung der Villa Helmholtz, dem Ziel seiner Träume. Er pfiff ganz leise vor sich hin. Überrascht stellte er fest, dass er, ohne es geplant zu haben, die Melodie von »die Männer sind alle Verbrecher« pfiff. Seltsam, was einem das Unterbewusstsein manchmal für Streiche spielte. Er schüttelte den Kopf, konnte aber nicht aufhören zu grinsen.
Er hatte sich bereits vor der Ausführung seines Plans dafür entschieden, das Haus ganz frech durch die Vordertür zu betreten, zumal dieser Bereich nun in absoluter Dunkelheit lag. Die schwarzen Klamotten, ein grob gestrickter schwarzer Pullover, eine schwarze Lederhose, schwarze Turnschuhe und sehr dünne Lederhandschuhe, ließen ihn mit der Dunkelheit verschmelzen. Über die mittelbraunen halblangen Haare hatte er zur Komplettierung noch eine schwarze Pudelmütze gezogen.
Die Morgendämmerung war derzeit - Mitte Juli - nicht mehr weit entfernt und durch den wolkenverhangenen Himmel beleuchtete der aktuell abnehmende Halbmond die Wolken nur insoweit, dass keine wirklich absolute Dunkelheit vorherrschte. Die Beleuchtung der Stadt wiederum erhellte die Wolken von unten, so dass er sich ohne Taschenlampe bewegen konnte und keine Angst haben musste, nicht zu sehen, wohin er trat.
Das Schloss der Haustür stellte keine wirkliche Herausforderung dar. Er hatte das erforderliche Werkzeug und die Kenntnisse, die zum Öffnen fast jedes Schlosses notwendig waren. Als die gut geölte Tür aufschwang, ohne dass das Licht eines Bewegungsmelders anging oder ein nervtötender Alarm losplärrte, konnte er sich nicht mehr zurückhalten. Er lachte halblaut auf und knurrte: »So du altes Arschloch, jetzt mach ich dich so arm wie eine Kirchenmaus!«
›Wer’s glaubt, wird selig, du einfältiger Depp!‹
Er ignorierte die Stimme, weil ihm im Moment nicht danach war zu argumentieren oder etwas abzustreiten.
Obwohl er sich sicher war, dass sich keiner der Bewohner im Haus befand, schlich er auf leisen Sohlen durch den Flur hinter der Eingangstür. Seine extrem starke Taschenlampe, bestehend aus zweiunddreißig in Stufen schaltbarer, stromsparender LEDs hatte er auf die allerniedrigste Stufe geschaltet, die nur ein mattes Glimmen erzeugte, was aber in absoluter Dunkelheit für eine Orientierung völlig ausreichend war.
Obwohl er gemeint hatte, auf alle Eventualitäten vorbereitet gewesen zu sein, schrak er zusammen, als er ein schabendes Geräusch hörte. Sofort schaltete er die Taschenlampe aus, verharrte auf der Stelle und lauschte angestrengt in die Dunkelheit.
Kapitel 2 - der Psychologe
Niemals hätte er es für möglich gehalten, dass es so einfach sein würde, in das Haus einzudringen.
Dr. Benjamin Bennedikt hatte weder Erfahrungen mit Einbrüchen noch mit Alarmanlagen. Aber er war schon von Berufswegen ein sehr bedachtsamer Mensch, der sorgfältig nachdachte, bevor er etwas tat und sich in die voraussichtliche Verhaltensweise seiner Mitmenschen hineindenken konnte wie kaum ein Zweiter. Als psychologischer Psychotherapeut hatte er schon mehrere Bereiche des beruflichen Spektrums abgedeckt. Direkt nach dem Studium der Psychologie hatte sich sein Interesse auf das kriminelle Verhalten von Menschen konzentriert und er hatte mehrere Jahre für die Polizei als Profiler gearbeitet. Dabei war er allerdings mit einigen sehr unschönen und grausamen Dingen in Kontakt geraten, was ihn dazu bewogen hatte, das Feld zu wechseln. Krasser hätte ein Berufswechsel kaum ausfallen können, denn er war in die freie Wirtschaft gegangen und hatte dort Werbefirmen dahingehend beraten, welchen Einfluss Werbung auf bestimmte Kundengruppen hatte. Es war faszinierend vorherzusagen, wie ein bestimmtes Plakat auf ledige Frauen unter dreißig und ein anderes auf verheiratete Männer über fünfzig wirken würde. Aber wiederum wenige Jahre später waren die Skrupel aufgetaucht. Er manipulierte Menschen und verleitete sie dazu, etwas zu tun - respektive zu kaufen - was sie eigentlich weder wollten noch brauchten. Das hatte ihn dazu veranlasst, nebenher eine Zusatzausbildung in der Psychotherapie zu machen und danach eine Praxis zu eröffnen. Sehr schnell hatte er festgestellt, wie befriedigend es sein konnte, Menschen mit Problemen bei der Lösung derselben zu helfen. Mit der Zeit hatte er sich einen gewissen Ruf erarbeitet und seine Praxis lief gut, ja sogar sehr gut.
Bis zu dem Tag, an dem diese eine Patientin bei ihm aufgetaucht war. Sie war der Grund, warum er nun in einem Schrank im Schlafzimmer dieses Hauses saß und darauf wartete, ungestört in der Villa nach dem zu suchen, was sein Leben wieder in die richtige Bahn bringen würde.
Sein Plan, in die Villa einzudringen, war gleichermaßen einfach und genial gewesen. Er hatte das Haus unauffällig beobachtet und dabei sowohl die Reisevorbereitung der Bewohner mitbekommen, als auch die Rhythmen des Personals, das sich um die Reinigung und Instandhaltung des Anwesens kümmerte. Immer freitags kam eine Reinigungskraft und montags erschienen sowohl der Gärtner als auch der Poolreiniger. Der Montag war ihm als der ideale Tag erschienen, da es leichter war, zwei Personen von einem Haus wegzulocken als eine Einzelne. Um die beiden vom Haus zu entfernen, hatte es lediglich ein paar wenige Utensilien gebraucht: Ein Smartphone, das er fernsteuern konnte, eine Audiodatei, die er aus einem Actionfilm extrahiert hatte und einen batteriebetriebenen Lautsprecher, der in der Lage war, eine gewisse Leistung zu erbringen. Alle Teile hatte er in einer Hecke am Rand des Gartens versteckt, als der ältere Gärtner und der junge Poolreiniger noch nicht erschienen waren. Die Abreise der Bewohner hatte er am Samstag aus der Ferne beobachtet. Bei der Menge an Gepäck, das ein schwitzender Taxifahrer in seinen Kleinbus lud, waren die Medienberichte, sie würden für zwei Wochen ihre Tochter in den USA besuchen, sicherlich nicht übertrieben gewesen. Dann hatte er gesehen, wie zuerst der Gärtner erschienen war, die Alarmanlage mit einem Code ausgeschaltet hatte und begonnen hatte aus einem Schuppen an der riesigen Doppelgarage sein Gartengerät zu holen. Dann war der Poolreiniger erschienen, der ebenfalls seine Utensilien aus dem Schuppen zusammensuchte und an den Pool brachte. Die beiden hatten gerade mit ihrer Arbeit begonnen, als er von seinem Smartphone das Signal gab, welches die Audiodatei auf dem versteckten Gerät startete.
Wenige Sekunden später erscholl aus Richtung der Hecke ein infernalisches Kreischen von Gummireifen auf Asphalt und kurz darauf ein noch viel lauteres metallisches Krachen, Scheppern und zum Abschluss eine donnernde Explosion. Er erschrak nur deshalb nicht, weil er die Audiodatei kannte und genau wusste, was da ertönte.
Die beiden Männer im Haus waren hingegen total geschockt.
»Leck mich fett«, schrie der Poolreiniger, »wassen da passiert? Da is aber ordentlich was in die Luft geflogen!« Der Gärtner starrte ihn mit offenem Mund an und nickte heftig.
Da die Hecke an der Stelle, von der das Geräusch gekommen war, dicht geschlossen und zwei Meter hoch war, verschwendeten beide keinen Gedanken daran, dorthin zu laufen und zu versuchen, hindurchzusehen. Stattdessen eilten sie, so schnell sie konnten zum Gartentor, stürmten hindurch und bogen um die nächste Ecke, um den vermeintlichen Unfall zu sehen.
Die ihm zur Verfügung stehende Zeit war ausreichend gewesen, um ungesehen durch die offene Gartenpforte zu schlüpfen und danach durch die Innentür der Garage in das Haus zu gelangen. Nach einigem Suchen hatte er im Obergeschoss das Schlafzimmer der Ehefrau gefunden, was er an dem Schminkspiegel und dem Schränkchen davor unschwer erkannt hatte. Die vielen Fläschchen, Tiegel, Cremes, Bürsten, Pinzetten und Gerätschaften, deren Bedeutung ihm größtenteils unbekannt waren, hätten einer Parfümerie gut zu Gesicht gestanden.
In dem riesigen begehbaren Kleiderschrank hatte er es sich auf dem Teppichboden bequem gemacht. Er war davon ausgegangen, dass weder der Poolreiniger noch der Gärtner hier etwas verloren hatten, und hatte sich deshalb ausreichend sicher gefühlt. Das hatte allerdings dazu geführt, dass er mangels Beschäftigung immer müder geworden und schließlich eingeschlafen war.
Als er vor wenigen Augenblicken wach geworden war, war es stockdunkel. Einen kurzen Moment lang war er so verwirrt, dass er nicht wusste, wo er war. Als ihm das ganze Geschehen um sein Eindringen in dieses Haus wieder einfiel, schaltete er sein Smartphone ein und sah die Uhrzeit: 03:40 Uhr!
Du meine Güte! Ich habe ja die meiste Zeit verschlafen. In anderthalb Stunden setzt schon die Dämmerung ein.
Er überlegte gerade, wie er nun am besten vorgehen sollte, als er das Geräusch hörte. Es war nicht laut, aber das scheppernde Klirren erinnerte ihn an das Zerspringen einer Vase oder Glasschüssel auf einem harten Steinboden.
Verdammt, ich bin nicht allein!
Kapitel 3 - die Angestellte
Es gelang ihr einfach nicht, ihre zitternden Hände unter Kontrolle zu bringen.
Warum muss ich mein großes Schandmaul aber auch immer so weit aufreißen.
Vor ihrer besten Freundin Sylvia hatte sie geprahlt, dass sie sich das nicht bieten lassen würde, dass sie sich rächen würde und das ihr angetane Unrecht gebüßt werden würde. Jetzt gab es keinen Weg mehr zurück.
Verdammt. Scheißegal, da muss ich jetzt durch.
Sie blickte durch die dichte Hecke über die große Wiese genau auf die Terrasse und die dort befindliche Terrassentür. Links von der Tür befand sich das Tastenfeld, in dem der Code für die Entsperrung der Alarmanlage eingegeben werden musste, wenn man von außen die Tür öffnen wollte. Sie hoffte, dass die Familie diese Nummer nicht geändert hatte, seit sie nicht mehr im Dienst der Helmholtz´ stand. Obwohl sie öfter als einmal die Alarmanlage ausgeschaltet hatte, wusste sie nicht mehr, ob es einen Bewegungsmelder im Garten gab, oder ob vielleicht beim Überqueren des Rasens plötzlich Scheinwerfer angehen würden. Vor einer Minute war die Straßenbeleuchtung rund um das Anwesen der Helmholtz ausgegangen, was ihr Eindringen in das Grundstück durch die nun vorherrschende Dunkelheit wesentlich erleichterte. Sie betete, dass es nicht gerade dann wieder anging, wenn sie über den Zaun vor der Hecke stieg.
Na ja, selbst wenn, um diese Uhrzeit ist doch keine Sau mehr auf der Straße und Schichtarbeiter, die mitten in der Nacht aufstehen müssen, wird es in dieser Gegend auch nicht allzu viele geben, oder?
Zumindest was ihre Kleidung anging, hatte sie ein wenig überlegt, bevor sie den Plan gefasst hatte, heute Nacht in die Villa einzubrechen. Sie hatte einen bequemen Jogginganzug und Laufschuhe angezogen - den dunkelsten Anzug, den sie hatte. Ihren Haarschopf hatte sie unter einer dunkelblauen Skimütze versteckt.
Als ob mir einer abkaufen würde, dass ich um halb vier Uhr morgens am Rhein jogge - lächerlich.
Mühsam überstieg sie den Zaun und musste sich wieder einmal eingestehen, dass es einen Fehler darstellte, in ihrem Alter von gerade mal achtundzwanzig Jahren keinerlei Sport zu treiben. Die Zeit dazu hätte sie gehabt, denn seit ihrem Hinauswurf bei der Familie Helmholtz hatte sie keinen Job mehr bekommen können. Sie hatte sogar schon in Erwägung gezogen, den Großraum Koblenz zu verlassen, aber dank ihres ehemaligen Arbeitgebers hatte sie leider eine nationale Berühmtheit erlangt - wenn man die vernichtenden Artikel über sie in der Klatschpresse als ›Berühmtheit‹ bezeichnen durfte.
Ihre Kiefer mahlten fast schmerzhaft aufeinander, als sie sich an die Ungerechtigkeit erinnerte, die ihr widerfahren war. Sie hasste die Familie Helmholtz mit einer Inbrunst, die ihr die notwendige Kraft gab, sich über den Zaun zu schwingen und den Mut, von oben in den schmalen Spalt zwischen Zaun und Hecke zu springen. Als Nächstes suchte sie eine Lücke, durch die sie in den Garten gelangen konnte, was sich schwieriger gestaltete, als sie gedacht hatte. Erst nach einigen Metern gelangte sie an eine Stelle, die den Eindruck machte, als könne man sich durch sie durch die Hecke schlängeln.
Wieder war es ihre Wut und die Aussicht auf Rache, die sie befähigten, sich durch die bei weitem nicht ausreichend große Lücke zu pressen, wobei sie in Kauf nahm, dass Äste ihre unbedeckte Haut zerkratzten.
Scheiß drauf, es wird sich sicherlich lohnen, dachte sie zornerfüllt. Zorn auf die Hecke, Zorn auf ihre ehemaligen Arbeitgeber und letztendlich Zorn auf das Schicksal, das ihr so übel mitgespielt hatte.
Ich bin … keine … Lesbe! Und ich habe … nichts … Falsches … getan!
Immer und immer wieder gingen ihr diese beiden Aussagen wie ein Mantra durch den Kopf, als wolle und müsse sie sich selbst davon überzeugen, indem sie es sich lautlos vorsagte. Egal was in der Klatschpresse stand, egal was das halbe Land von ihr dachte. Was die Familie ihr angetan hatte, musste richtiggestellt und gesühnt werden. Eine Zeitlang hatte sie Mordgedanken gehegt. In allen Farben und Variationen hatte sie sich vorgestellt, wie sie das Ehepaar leiden lassen würde, wie sie die beiden erniedrigt und sie anschließend erstochen, erschossen, erwürgt oder qualvoll vergiftet hatte.
Aber die Realität hatte sie immer wieder eingeholt. In Form von Absagen bei der Suche nach einem neuen Job, in Form von auflauernden Paparazzi oder Reportern und anschließenden neuen Berichten in der Presse und in Form von Schulden, Gerichtsvollziehern und schließlich sogar der Kündigung durch ihren Vermieter. Inzwischen war sie so weit unten angekommen, dass sie keine Angst mehr vor einem sozialen Abstieg haben musste - es ging nicht weiter nach unten!
Das war der Punkt gewesen, an dem sie sich zum Handeln gezwungen sah. Sie hatte sich entschlossen, in der Villa dieser beiden verkommenen Lügner und Betrüger nach Beweisen für ihre Unschuld zu suchen. Der große Artikel in der gleichen Presse, von der sie so erfolgreich in den Abgrund gestoßen worden war, hatte den Ausschlag gegeben:
»Das Supermodel, der Manager-Vater und das Familientreffen in Florida!«
Zwei Wochen würde die Villa verwaist sein. Das sollte reichen, um das Unterste nach oben zu kehren und zu finden, was sie finden musste - auch wenn sie noch keine genaue Vorstellung davon hatte, was das sein könnte.
Nachdem sie die Hecke durchquert hatte, schlich sie in gebückter Haltung über den Rasen in Richtung Terrasse.
Warum bücke ich mich so runter? Es ist doch stockdunkel und niemand kann mich sehen?
Den Kopf über sich selbst schüttelnd streckte sie sich auf ihre vollen 1,75, nahm die Skimütze vom Kopf, schüttelte ihr halblanges blondes Haar kurz aus und ging dann erhobenen Hauptes auf die Terrasse zu. Erst unterwegs schoss ihr der Gedanke durch den Kopf, dass sie gar nicht wusste, ob es Bewegungsmelder im Garten oder vielleicht sogar Überwachungskameras gab. Ohne darüber nachzudenken, setzte sie die Skimütze wieder auf, was nicht wirklich helfen würde, ihre Identität zu verheimlichen.
Ach was, scheiß drauf. Ich will meinen Ruf wiederherstellen. Sollen sie doch sehen, wer da eingebrochen ist und sich die Beweise geholt hat. Das spielt dann wirklich keine Rolle mehr.
Nachdem sie sich so Mut gemacht hatte, schritt sie weiterhin aufrecht und mit trotzigem Blick über den Rasen auf die Terrasse zu. Sie kämpfte die Zweifel und das mulmige Gefühl nieder und betrat die einen Meter über der Rasenfläche liegende Plattform, auf der die abgedeckten Gartenstühle und Tische standen.
Direkt links neben der über vier Meter breiten Front aus Glasschiebetüren befand sich das elektronische Zahlenschloss, mit dem über einen Code die Verriegelung der Tür geöffnet werden konnte. Obwohl sie der Meinung gewesen war, das Tastenfeld wäre nachts erleuchtet, konnte sie in der dunklen Nacht lediglich die Umrisse des kleinen rechteckigen Kästchens erkennen. Widerwillig zog sie die kleine Taschenlampe aus der Seitentasche ihrer Trainingsjacke, schaltete sie ein und leuchtete das Tastenfeld an. Die Angst, die Familie hätte vielleicht die Ziffernkombination zwischenzeitlich geändert, ließ sie einen Moment zögern, aber dann gab sie beherzt die ihr in Erinnerung gebliebenen Zahlen ein: 5 - 4 - 2 - 8 - 8 - 1.
Nichts!
Kein Ton, kein Piepen oder auch nur Aufleuchten. Das Feld, in dem normalerweise ein Sternchen für jede eingegebene Ziffer erschien, blieb einfach dunkel.
Was ist das denn jetzt für ein Mist?
Langsam begann ihr zu dämmern, dass sie nicht etwa eine falsche Kombination eingegeben hatte, sondern die Apparatur einfach nicht funktioniert. Aber warum nicht? Konnte es etwas damit zu tun haben, dass auch die Straßenbeleuchtung in der Umgebung der Villa nicht mehr funktionierte? Ein Stromausfall! Ja, das musste es sein. Damit erklärte sich die Dunkelheit in der Umgebung des Hauses und auch, warum dieses blöde elektronische Teil nicht mehr funktionierte. Aber wie sollte sie nun in das Haus kommen? Ihre Kenntnis der Zahlenkombination war ihr einziger Trumpf gewesen und ihr fiel keine Alternative ein.
Verdammt. Wütend trat sie gegen die Hauswand und fluchte im nächsten Augenblick, denn sie hatte sich den großen Zeh so fest angestoßen, dass sie einen Moment lang sicher war, er sei gebrochen.
»Ouuu, ouuu, Scheiße, verdammt.« Sie taumelte, hüpfte auf einem Bein seitwärts und hielt den schmerzenden Fuß in beiden Händen. Für den Augenblick war ihr egal, ob jemand ihr Geheule hören könnte.
Dann verlor sie das Gleichgewicht und drohte umzufallen. Ihr blieb keine Wahl, als den verletzten Fuß auf den Boden zu setzen und gleichzeitig nach einem Halt zu suchen. Ihre linke Hand griff blindlings zur Seite und bekam einen Griff zu fassen. Im gleichen Moment, als sie versuchte, sich an diesen Griff zu klammern und ein Hinfallen zu verhindern, bewegte sich ihr vermeintlicher Anker unter dem Gewicht ihres seitlich fallenden Körpers von ihr weg.
Was zum Teufel …?, konnte sie noch denken, bevor sie schmerzhaft auf ihren Hintern fiel. Sie blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen und versuchte, durch tiefes Ein- und Ausatmen ihren Puls wieder auf ein erträgliches Maß hinunterzubringen. Mit beiden Händen tastete sie um sich herum den Boden ab, um die verlorene Taschenlampe zu finden, von der sie hoffte, dass sie noch funktionstüchtig war.
Sie lag näher an ihrem Körper als vermutet und ließ sich ohne Probleme anschalten. Sie leuchtete in die Richtung, wo sie versucht hatte, sich an irgendetwas festzuhalten … und zog überrascht die Luft ein, als sie es sah:
Es war der Griff der Terrassentür gewesen, an den sie sich geklammert hatte. Er war nicht etwa abgebrochen, sondern hatte sich - wie es seine Bestimmung war - zusammen mit der Tür bewegt. Diese stand nun in einer Breite von etwa vierzig Zentimetern offen.
Sie war sich sicher, dass die Tür nicht offen gestanden hatte, als sie sich an der elektronischen Verriegelung zu schaffen gemacht hatte.
Ob das mit dem Stromausfall zu tun hat?
Egal, Hauptsache ich komme rein, dachte sie und rappelte sich mühsam auf. Dabei bemerkte sie erstmals wieder ihren schmerzenden rechten großen Zeh. Die Schmerzen hatte sie in ihrem Erstaunen über die offene Tür für einen kurzen Moment verdrängt. Humpelnd bewegte sie sich auf den Spalt zu, der ihr breit genug erschien, dass sie sich seitwärts hindurchdrücken konnte. Die Taschenlampe schaltete sie aus und verstaute sie wieder in ihrer Jackentasche.
Den schweren Fehler bemerkte sie erst, als sie in der im Wohnzimmer vorherrschenden Dunkelheit schmerzhaft mit dem Schienbein gegen eine Tischkante stieß und erneut vor Schmerz aufheulte. Humpelnd bewegte sie sich seitwärts, um im nächsten Moment erneut gegen ein Hindernis zu stoßen. Nur eine Sekunde später hörte sie das krachende Klirren, als etwas auf dem Marmorfußboden zerschellte.
O Gott, die chinesische Vase, die auf diesem Sockel steht, schoss es ihr durch den Kopf. Als ihr die Schuldgefühle bewusst wurden, die sie im Zusammenhang mit der Zerstörung dieses wertvollen Stückes ansprangen, musste sie laut auflachen.
»Bin ich denn nur blöd?«, rief sie in die Dunkelheit. »Ihr habt mein Leben zerstört und ich mache mir Vorwürfe wegen so einer scheiß Vase. Das geschieht euch recht, hört ihr? Und ich werde noch mehr kaputtmachen, wenn ich nicht finde, wonach ich suche!«
Zufrieden mit sich selbst, ihrem Wagemut, ihrem erfolgreichen Eindringen in das Haus und dem Umstand, dass bisher eigentlich nichts wirklich schiefgelaufen war, grinste sie in die Dunkelheit. Sie lauschte … und hörte das, was sie zu hören gehofft hatte: Nichts!
Gut so, dachte sie und knipste die Taschenlampe wieder an.
Kapitel 4 - im heißen Süden
Heinz Helmholtz wälzte sich in dem verschwitzten Laken von einer Seite auf die andere. Zum hundertsten Mal in den vergangen zwei Tagen verfluchte er seine bescheuerte Tochter, die ihr Domizil ausgerechnet im Süden der USA aufschlagen musste.
Er sehnte sich nach dem Bett in seiner Villa am Rhein, wo es reichte, wenn man ein Fenster öffnete, um eine angenehme Temperatur zu erreichen - auch im Juli. In New Orleans, der größten Stadt des amerikanischen Bundesstaats Louisiana, herrschten um diese Jahreszeit tropische Verhältnisse. Die Temperatur ging zwar selten über 33 Grad Celsius, aber die Luftfeuchtigkeit erreichte viel zu oft bis zu 95 Prozent - vor allem nach den Regenfällen, die zu dieser Jahreszeit ebenfalls sehr häufig vorkamen. Selbstverständlich lag die Villa im noblen ›Garden District‹, unweit des Stadtzentrums, und sie war vollständig klimatisiert. Aber er hasste Klimaanlagen. Genauso sehr, wie er diese schwüle, laute und in seinen Augen schmutzige Stadt hasste.
Alles nur wegen ihrer bescheuerten Vorliebe für Jazz, den Karneval im Süden der USA, dieses wahnsinnige Mardi Gras, und die angebliche Beschaulichkeit des Lebens im Süden. Hat die blöde Kuh sich eigentlich vorher mal einen Atlas angesehen? New Orleans lag auf dem gleichen Breitengrad wie Marokko, Kairo oder Kuwait City. Aber das Fräulein Supermodel hatte sich in den letzten beiden Jahren vollständig abgenabelt und auch als ihr Manager hatte er nicht mehr den Einfluss auf ihre Entscheidungen, den er gerne gehabt hätte.
Sie hatte sich nicht reinreden lassen, als sie vor einem Jahr diesen hirnlosen amerikanischen Rocksänger geheiratet hatte und inzwischen war sie die getrenntlebende Mrs. Gerritsson. Allerdings war sie mit beachtlichen Geldmitteln sowohl durch ihren Mann als auch aus ihren eigenen Verdiensten, ausgestattet, von denen sie sich diese Villa gekauft hatte.
Alles, wobei Tatjana ihm noch freie Hand ließ, waren die Verträge, die er mit Werbefirmen, Designern oder den Medien für ihre Engagements und Auftritte abschloss. Dieses undankbare Miststück hatte vergessen, dass er es gewesen war, der sie groß herausgebracht hatte. Ihm alleine hatte sie es zu verdanken, dass sie zu den am besten verdienenden Supermodels gehörte und sich all das leisten konnte, wovon er eigentlich ebenfalls vorgehabt hatte, zu profitieren.
Und nun lag er in der beschissensten Jahreszeit in dieser Sauna, die sich als Stadt ausgab, wälzte sich um halb elf Uhr nachts schwitzend in seinem Bett herum und fand keinen Schlaf. Von nebenan hörte er überdeutlich das Summen der Klimaanlage und das Schnarchen seiner Frau Tanja, die nach dem Genuss mindestens einer halben Flasche Scotch so tief schlief, dass nicht einmal eine Bombe sie hätte wecken können.
Er hasste sie genauso wie seinen Aufenthalt hier in den USA, aber die geschäftlichen Verpflichtungen ließen ihm keine andere Wahl, als ein paar Mal im Jahr für ein bis zwei Wochen seine Tochter hier zu besuchen und mit ihr die weiteren Pläne abzusprechen, Vertragsverhandlungen zu führen und den blöden Papierkram zu erledigen. Seine Frau Tanja lebte schon seit einigen Jahren ihr eigenes Leben und er ließ sie gewähren.
Soll sie sich doch zu Tode saufen oder ficken, mir ist es egal.
Er überlegte einen Moment lang, ob er aufstehen und seinen Laptop anwerfen sollte, um die neuesten Nachrichten und Aktienkurse zu kontrollieren, entschied sich aber dagegen. Zu Hause war es jetzt 03:30 Uhr und er würde schon lange tief und fest schlafen. Um den Jetlag zu bekämpfen, sollte er auch hier langsam Schlaf finden, sonst würde er noch länger tagsüber schlaff und müde sein. Das konnte er sich angesichts der bevorstehenden Vertragsverhandlungen nicht leisten.
Kapitel 5 - Überraschung!
Er wusste nicht, wie er auf das Geräusch reagieren sollte, das er soeben gehört hatte. Auf jeden Fall konnte es nur ein Fehler sein, hier im begehbaren Kleiderschrank des Schlafzimmers zu bleiben. Nun war Beweglichkeit und eine irgendwie geartete Reaktion gefragt. Er war sich sicher, dass das Geräusch aus dem Untergeschoss gekommen war. Also verließ er eilig den Schrank und schlich auf Socken aus dem Schlafzimmer und zur ausladenden und in einem Halbkreis geschwungenen Treppe. In der Villa war es stockdunkel und von draußen drang lediglich ein diffuser Schimmer herein, der vermutlich von dem auf die Wolkendecke scheinenden Halbmond verursacht wurde. Er tastete sich mehr die Treppenstufen auf Marmor hinunter, als dass er sie hätte erkennen können. Ihm kam nun zugute, dass er ohne Schuhe unterwegs war. Seine bestrumpften Füße verursachten auf diesem Untergrund kein Geräusch. Zudem konnte er weitaus besser die Stufenkanten erfühlen.
Er hatte noch nicht einmal die Hälfte der Strecke nach unten zurückgelegt, als er ein Lachen hörte. In dem Bestreben, ganz leise zu sein, war auch sein Gehör aufs Äußerste geschärft und das Geräusch erschien ihm unnatürlich laut. Noch während die Stimme, die vermutlich einer Frau gehörte, etwas rief, dass er nur in Bruchstücken verstand, bewegte er sich weiter die Treppe hinunter und orientierte sich an den Geräuschen. Er verstand nur Wortfetzen wie »scheiß Vase«, »kaputtmachen« und »finden«. Aber es reichte aus, um sich in die richtige Richtung zu bewegen und er war sich sicher, dass die Stimme aus dem Wohnzimmer kam. Seine Augen hatten sich zumindest so weit an die Dunkelheit gewöhnt, dass er den Umriss des bogenförmigen Zugangs zu diesem Raum erkannte. Bevor er sich allerdings dem Raum weiter näherte, zog er seine Waffe und die mitgebrachte Meg-Lite Taschenlampe hervor und betrat dann, beide Hände mit seinen Mitbringseln nach vorne gestreckt vorsichtig den Raum.
Je näher er dem Durchgang zum Wohnzimmer kam, um so deutlicher vernahm er ein leises Gemurmel der mutmaßlichen Frau. In dem sicheren Glauben, dass er mit der Dunkelheit im Rücken aus dem Raum heraus nicht zu sehen sein würde, betrat er, mit ausgestreckten Armen voran, das Wohnzimmer. Die Waffe hielt er ein wenig verkrampft in der rechten, die noch ausgeschaltete Meg-Lite in der linken Hand.
Es mochte ein unbewusstes Räuspern oder sein hektisches Atmen gewesen sein, aber auf jeden Fall musste er sich verraten haben, denn kaum hatte er das Zimmer betreten, als eine in seine Richtung gehaltene Taschenlampe aufleuchtet, ihm direkt in die Augen schien und ihn sofort blendete.
In dem reflexartigen Versuch, seine eigene Lampe anzuknipsen, vertat er sich in der Aufregung und anstatt den Schalter der Meg-Lite zu betätigen … zog er den Abzug der Waffe durch. Sein Fehler wurde ihm einen Bruchteil einer Sekunde zu spät bewusst und er konnte die Krümmung des Zeigefingers nicht mehr bremsen.
Mit einer Mischung aus Schock und Erleichterung registrierte er mit einer gewissen Verspätung das kalte Klicken, als der Hammer der Pistole ins Leere schlug … er hatte vergessen, die Waffe durchzuladen.
Noch immer geblendet nahm er die Hand mit der Waffe schützend vor die Augen und knipste nun seine Taschenlampe an.
»Wer sind Sie?«, erklang seine Frage fast zeitgleich mit der gleichen, von der Frau gestellten Frage.
»Sie zuerst!«
Das gibt’s doch gar nicht, dachte er erschrocken. Wiederum hatte die Frau die gleiche Aufforderung wie er fast zeitgleich ausgestoßen. Seine Gedanken überschlugen sich in dem Bestreben, etwas Sinnvolles zu einer, wenn sie so fortgeführt würde, zum Scheitern verurteilten Konversation beizutragen. Was er auf die Schnelle hatte erkennen können, war, dass es sich um eine noch recht junge, schlanke Frau zu handeln schien, die in einer Hand die Taschenlampe hielt, aber die andere Hand, wie abwehrend mit der geöffneten Handfläche nach vorne hielt.
Er entschied sich für einen drastischen Schritt. Nachdem er die Taschenlampe ausgeschaltet hatte, steckte er die sowieso unnütze Waffe in den Hosenbund. Die Lampe landete in der dafür vorgesehenen Halterung am Gürtel und er streckte beide Arme mit den Handflächen nach vorne zur Seite von sich.
»Ich gehe davon aus«, begann er ganz langsam und bedächtig, »dass Sie, Gnädigste, sich in gleichem Maße unberechtigt in diesem Anwesen aufhalten, wie ich. Deshalb scheinen wir zumindest …«, er machte eine kleine Sprechpause, » … na sagen wir mal … ähnliche Ziele zu verfolgen.«
Er kniff die Augen gegen die blendende Helligkeit ihrer Taschenlampe zusammen. »Würde es Ihnen viel ausmachen, mir mit ihrem Scheinwerfer nicht direkt in die Augen zu leuchten? Sie sehen ja, dass ich meine Waffe weggesteckt habe.« Er zuckte wie entschuldigend mit den Schultern. »Ich denke, unbewusst habe ich die Waffe sowieso nie wirklich einsetzen wollen, sonst hätte ich nicht vergessen, sie durchzuladen.«
Sicher konnte er nicht sein, aber der kurze Augenblick, in dem er die junge Frau gesehen hatte, war ausreichend gewesen, ihm einen Eindruck zu vermitteln … und der war das Gefühl von Harmlosigkeit gewesen. Unter anderen Umständen hätte er sie als attraktiv und interessant eingeschätzt. Der erste Eindruck hatte ihm eine etwa einsfünfundsiebzig große, schlanke, aber dennoch gut proportionierte, Frau von etwa Ende zwanzig, maximal dreißig Jahren gezeigt. Die Haarfarbe hatte er aufgrund der schwarzen Mütze nicht erkennen können und für weitere Einzelheiten war die Zeit zu kurz gewesen.
Der Lichtstrahl ihrer Taschenlampe verließ sein Gesicht und wanderte langsam an seinem Körper entlang nach unten, bis er schließlich bei seinen Füßen angekommen war.
»Ihr Anzug verrät Sie nicht gerade als Einbrecher«, stellte sie mit einem seltsamen Unterton fest. »Aber irgendwie bin ich mir trotzdem ziemlich sicher, dass sie sich nicht wirklich befugt hier aufhalten.«
Was für ein Wunder, dachte Benjamin, schließlich bin ich ebenfalls mit einer Taschenlampe bewaffnet und schleiche hier im Dunkeln herum. Gerade als ihm der Gedanke kam, was dagegensprach, dass er vielleicht ja der bewaffnete Bewohner des Hauses sein könnte, der einen Einbrecher überraschen wollte, offenbarte sie ihm: »Und dass Sie nicht hier im Haus wohnen, weiß ich sicher, denn die Bewohner kenne ich sehr gut. Also, wer sind Sie und was wollen Sie hier?«
Nachdem die Einschränkung seiner Sehfähigkeit durch das Blenden mit ihre Lampe nachgelassen und er sich wieder an die vorherrschende Dunkelheit gewöhnt hatte, konnte er im Licht der auf den Boden zwischen ihnen gerichteten Taschenlampe ihr Gesicht relativ gut erkennen. Er sah die zusammengezogenen Augenbrauen und den neugierigen Ausdruck, der an ihrem Blick und der Kopfhaltung zu erkennen war.
»Da mir Ihr Erscheinungsbild signalisiert, dass es sich bei Ihnen wohl eher um einen Einbrecher, respektive eine Einbrecherin, zu handeln scheint, sehe ich keine große Gefahr darin, mich vorzustellen.« Nach einer angedeuteten kleinen Verbeugung fuhr er fort, »Mein Name ist Dr. Benjamin Bennedikt, Bennedikt ohne ›c‹, und ich habe einen persönlichen Grund für meine Anwesenheit, der jedoch nichts mit einem gemeinen Einbruch zu tun hat.«
Sie verzog den Mund zu einem indigniert wirkenden Grinsen. »Häh, wieso ohne ›c‹? Wo kommt denn ein ›c‹ in Bennedikt vor? Was für eine Art Doktor sind Sie denn? Reden Sie immer so geschwollen?«
Benjamin seufzte. »Nun, Reden gehört zu meinem Beruf, ich bin Psychotherapeut, und der Umstand, dass Ihnen meine Redeweise ›geschwollen‹ vorkommt, scheint mir eine Frage des Standpunktes und der persönlichen Sprachbildung zu sein.«
Nun fing sie an, schallend zu lachen und präsentierte dabei eine in der Dunkelheit leuchtende Reihe fast perfekter Zähne mit einer kleinen Zahnlücke zwischen den beiden mittleren oberen Schneidezähnen. Er kam nicht umhin, sie süß zu finden. Sein Beruf hatte ihn gelehrt, aufgrund von Äußerungen seiner Mitmenschen nicht so leicht beleidigt zu reagieren. Sie entsprangen in der Regel dem persönlichen Empfinden der Menschen und waren dadurch begründet. Ob sie zutrafen, war eine andere Sache, aber es lag ja an ihm, den Eindruck zu korrigieren, wenn er es für notwendig erachtete.