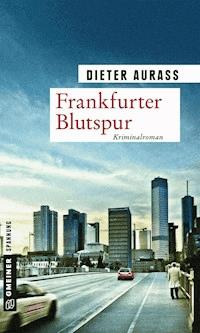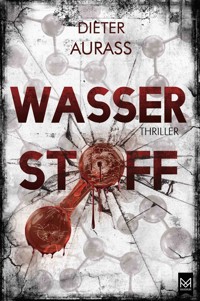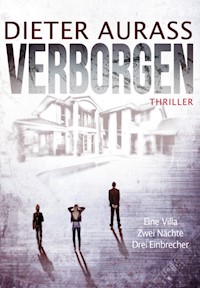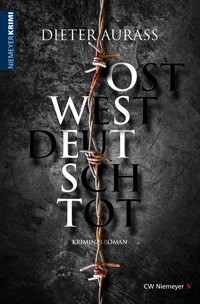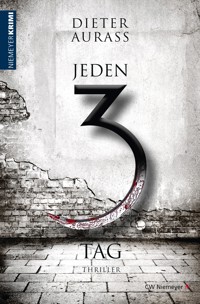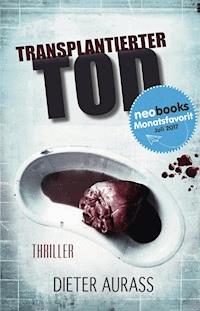
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eigentlich wollte er lediglich herausfinden, wer der Spender seines neuen Herzens war, wie dieser gelebt hatte, wie er gestorben war und woher diese seltsamen Déjà-vus kamen. Als der freie Münchner Journalist Eduard von Gehlen im Alter von 31 Jahren beim Jogging einen schweren Herzinfarkt erleidet, geben ihm die Ärzte nur noch ein halbes Jahr. Sie setzen ihn auf die Transplantationsliste und gemahnen ihn zur Geduld. Allerdings bleibt ihm kaum Zeit, mit dem Schicksal zu hadern, denn überraschenderweise erhält er bereits zwei Wochen später ein neues Herz. In der Genesungsphase hat er seltsame, Déjà-vus-ähnliche Erlebnisse, Erinnerungen an Dinge, die ihm fremd vorkommen, und sein Geschmack in vielen Dingen hat sich geändert. Er beschließt, etwas über den Spender seines neuen Herzens in Erfahrung zu bringen. Was sich zunächst aufgrund der Gesetzgebung bezüglich der Anonymität von Spender und Empfänger als nicht ganz einfach darstellt, führt schließlich, dank seiner Verbindungen und Erfahrungen als Enthüllungsjournalist mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsspionage, Computerkriminalität und die nationale Hacker-Szene, doch zum Erfolg. Eduard gerät in einen Strudel von Ereignissen rund um die Hamburger Reederei-Dynastie Ahlsbeek, die nun in Form des Herzens des letzten männlichen Erbens ein Teil von ihm ist. Auf der Suche nach dem Grund für den angeblichen Selbstmord seines Herzspenders, Liam Ahlsbeek, erlangt er Kenntnisse über Intrigen, Familiengeheimnisse und verbrecherische Machenschaften von internationalen Ausmaßen. Bei seinen Nachforschungen wird er lediglich von der jüngeren Schwestern Liams, der bezaubernden Gwendolyn, und seinem Hacker-Freund Benjamin vom Chaos Computer Club unterstützt. Je besser ihre gemeinsamen Ermittlungen vorankommen und mit jedem Stück an neuer Information geraten die Drei in größere Lebensgefahr.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieter Aurass
Transplantierter Tod
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Widmung
Fabel
Zeitungsmeldung
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Zwischenspiel
Kapitel 15
Kapitel 16
Zwischenspiel
Kapitel 17
Kapitel 18
Zwischenspiel
Kapitel 19
Kapitel 20
Zwischenspiel
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Epilog
Nachwort des Autors / Danksagungen
Andere Bücher des Autors Dieter Aurass
Bücher von Francis Fein
Impressum neobooks
Widmung
Für Ellen,
meine liebe Frau, die es noch immer geduldig erträgt, dass ich bei den interessantesten Fernsehsendungen, wie z.B. »Shopping Queen« oder »Das perfekte Dinner« neben ihr auf der Couch sitze und in meine eigene Welt - lesend oder schreibend - vertieft bin.
Danke für dein Verständnis!
Fabel
Zwei Mäuse fallen in einen Topf mit Sahne. Die Erste gibt schnell auf und ertrinkt. Die Zweite aber strampelt mit aller Kraft weiter. Mit Erfolg: Die Sahne wird zu Butter und die Maus überlebt.
Und die Moral?
Gib niemals auf, sondern strample um dein Leben, denn wer zu früh aufgibt, stirbt!
Zeitungsmeldung
Jogger im Olympiapark tot zusammengebrochen
Am gestrigen Mittag brach der 31-jährige Eduard G. beim Joggen im Olympiapark vor den Augen zahlreicher Touristen und Familien mit Kindern ohne Vorwarnung tot zusammen.
Nur dem beherzten Eingreifen eines Passanten und der schnellen Ankunft der Rettungskräfte ist es zu verdanken, dass der junge Mann noch vor Ort wiederbelebt werden konnte und sich inzwischen nach Informationen des Krankenhauses wieder auf dem Weg der Besserung befindet.
In diesem Zusammenhang weisen wir auch auf unsere Serie (Seite 24) ›gesund Sport treiben‹ hin.
Notiz auf Seite 12 (Lokales) des Münchner Merkur, vom Freitag, 14.08.2014
Prolog
Eduard von Gehlen, 31 Jahre alt, ledig und ungebunden - war tot gewesen.
Nicht tot im übertragenen Sinne wie zum Beispiel bei »haha, ich lach mich tot« oder »ich will tot umfallen, wenn ich das nochmal mache«. Nein, richtig tot. Mausetot ... wie unmittelbar vor einer Beerdigung.
Dem aufmerksamen Leser wird an der Formulierung auffallen, dass die Aussage: ›er war tot gewesen‹, impliziert, dass er es nun nicht mehr war. Richtig. Die Hintergründe dieser Aussage müssen selbstverständlich erläutert werden.
Eduard von Gehlen war schon immer sportlich gewesen und hatte sich eingebildet, relativ gesund zu leben. Er rauchte nicht, trank nur mäßig Alkohol und hatte einen relativ soliden Lebenswandel. Selten hatte er eine Nacht durchgemacht, exzessiv getrunken und am nächsten Morgen nicht mehr gewusst, was in der vergangenen Nacht passiert war. Sein Leben war weitestgehend in Ordnung. Der Job war erfüllend und er war sogar recht erfolgreich.
Als freier Journalist hatte er einige Aufsehen erregende Artikel über Industriespionage, Computerkriminalität und die geheime Hackergemeinschaft veröffentlicht. Sein Appartement in der Innenstadt von München war klein, schön eingerichtet und teuer. Aber er fühlte sich dort wohl und es war sein Rückzugsgebiet, wenn er von seinen Recherchereisen zurückkam. Dort konnte er sich erholen, seine Notizen aufarbeiten, schreiben und die nächste Reise vorbereiten. Dort war auch der Startpunkt, wenn er zu seinen regelmäßigen Joggingtouren aufbrach. Fünf Stationen mit der U-Bahn brachten ihn zum Olympiapark, wo seine Laufstrecke begann. Insgesamt waren es lediglich läppische zehn Kilometer, die er üblicherweise in etwa 45 Minuten lief – wenn er es nicht ausnahmsweise eilig hatte oder eine neue Bestleistung aufstellen wollte. An diesem heißen Nachmittag im August hatte er nicht das Gefühl, dass er einen Rekord aufstellen könnte. Die ungewöhnliche Schwüle machte ihm zu schaffen und schon nach einem Kilometer hätte er am liebsten aufgehört. Aber das ließ sein Stolz nicht zu. Manchmal musste man auch den inneren Schweinehund überwinden und irgendwann lief es dann wieder besser. Da musste man einfach durch.
Als er nach zwei Kilometern ein Stechen in der Brust bemerkte, verfluchte er sein ausgiebiges Frühstück, das er für das vermeintliche Seitenstechen verantwortlich machte. Es war zwar ungewöhnlich, aber er hatte von anderen Läufern schon mal Ähnliches gehört.
Nie wieder vor dem Joggen ausgiebig frühstücken, dachte er gerade, als er einen Schmerz verspürte, als habe ihm jemand ein Messer in die Brust gerammt. Der damit verbundene Schweißausbruch hatte nichts mit der sportlichen Aktivität zu tun. Es fühlte sich an wie der kalte Schweiß, der einem bei großer Übelkeit bisweilen ausbricht. Erst als ihm mit einem Mal die Luft wegblieb und die Knie weich wurden, kam ihm erstmals der Gedanke, dass es vielleicht doch etwas anderes als Seitenstechen sein könnte. Die Schmerzen, als er auf die Knie fiel, spürte er nicht, da das Stechen in der Brust so intensiv war, dass er sich mit beiden Händen dorthin fasste und seine Finger sich tief ins Fleisch krallten. Obwohl ihm das Wasser in die Augen schoss, sah er mit völliger Klarheit die Landschaft vor sich: den sich schlängelnden Weg zwischen den grünen Hügeln des Olympiaparks. Im Hintergrund das berühmte Olympiadach, dieses zeltartige Monstrum aus Glas und Stahl, das sich klar gegen den strahlend blauen Himmel abgrenzte. Er sah die Gruppen von Menschen, die sich in die verschiedensten Richtungen bewegten, Kinder, ältere Menschen, Pärchen, Touristen, Rentner, Eltern mit Kinderwagen, eine zerlumpte Frau unbestimmbaren Alters mit einem Einkaufswagen voller Plastikpfandflaschen, einen Asiaten mit mehreren umgehängten Video- und Fotokameras, zwei händchenhaltende Mädchen, die sich ...
Das Olympiadach begann langsam nach rechts zu kippen und auf einmal kam von links eine grüne Wiese in seinen Blick. Bevor er realisieren konnte, was da genau geschah, schlug er mit dem Kopf auf den Laufweg, was erstaunlicherweise nicht einmal schmerzte.
Er sah keinen Film seines bisherigen Lebens, ihm gingen keine Gedanken des Bedauerns oder die Frage nach dem Grund oder gar, warum es ausgerechnet ihn traf, durch den Kopf. Stattdessen wurde es einfach dunkel ... und er war tot.
Kapitel 1
Wenn man tot ist, hört man nichts mehr. Er konnte auch nicht von oben auf seinen Körper herabsehen und etwa beobachten, wer und wie man sich um seinen toten Körper kümmerte. Was er sah, war das kalte Krankenhauslicht, als er langsam erwachte. Er konnte nicht mehr sagen, wann genau er die Schwelle von der Bewusstlosigkeit ins Wachbewusstsein überschritten hatte, als ihm klar wurde, dass er lebte ... irgendwie. Sein gesamter Körper schmerzte und er konnte sich kaum bewegen. Sein Singledasein hatte den entscheidenden Nachteil, dass bei seinem Aufwachen niemand an seinem Bett saß, seine Hand hielt und ihn freudig begrüßte, mit Aussagen wie: »Oh, wie schön, dass du wieder da bist. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Jetzt wird alles gut. Du wirst wieder gesund.«
Seine Eltern waren sehr früh gestorben und er hatte keine Geschwister. Also saß niemand an dem Krankenbett und erzählte ihm irgendwelchen Unsinn, der ihn aufheitern, ihn motivieren sollte. Um ihn herum standen Unmengen elektronischer Geräte, deren Bedeutung er nur zum Teil verstand. Ihm war aus zahlreichen TV-Krankenhausserien selbstverständlich bekannt, dass die grüne Zackenlinie und das rhythmische Piepsen seinen Herzschlag darstellten. Von den Werten, die daneben zu lesen waren, hatte er noch in Erinnerung, dass es sich um Sauerstoffsättigung und Blutdruck handeln musste. Was die Werte allerdings genau aussagten, wusste er beim besten Willen nicht mehr zu sagen.
Bei dem Versuch, nach einer Schwester oder einem Pfleger zu rufen, musste er feststellen, dass seine Kehle zu rau war, um ihr mehr als ein Krächzen zu entlocken. Er musste längere Zeit intubiert gewesen sein. Also tastete er mit der rechten Hand neben seinem Körper über die Matratze des Krankenhausbettes und fand, was er suchte: ein Gerät mit Rufknopf.
Es dauerte nach dem Drücken gefühlte fünf Minuten, bis eine Schwester erschien, aber er hatte ja sowieso gerade nichts anderes zu tun, als herumzuliegen und darauf zu warten, dass ihm jemand erklärte, was eigentlich passiert war.
»Aha, da ist ja jemand wieder unter den Lebenden. Wie schön, dass wir Sie wiederhaben. Wäre doch schade um so einen attraktiven jungen Mann gewesen.«
Die fröhliche Art der etwas molligen Schwester, die gut und gerne seine Mutter hätte sein können, war vermutlich dazu gedacht, ihn aufzuheitern oder seinen Lebenswillen anzustacheln. Ihm hingegen kam es vor, als behandle ihn jemand wie ein Kleinkind. Das war nichts, was ihm gefiel, aber in diesem Moment erschien es ihm nicht ratsam, mit einer solchen Person zu diskutieren. Ganz abgesehen davon wäre er gerade überhaupt kaum in der Lage gewesen, eine längere Diskussion zu führen.
»Wasser ... trinken«, war das Einzige, was er äußern konnte.
»Natürlich! Wie unaufmerksam von mir. Natürlich sind Sie durstig, mein armer Junge.«
Ihre mütterliche Art ging ihm sehr auf die Nerven. Aber was hätte er tun sollen? Was hätte er in dieser Situation tun können? Also fügte er sich in sein Schicksal und trank aus der Schnabeltasse, die sie ihm zum Mund führte.
»Was ... passiert?«, krächzte er mühsam die minimalistische Frage nach seinem Schicksal heraus. Er hatte zwar einen Verdacht, war sich aber nicht ganz sicher. Er wollte ... er brauchte Bestätigung, Information, was auch immer, warum er hier lag.
Die Schwester, die er inzwischen auf etwa Mitte fünfzig schätzte, schaute ihn auf eine Art und Weise an, die sie vermutlich für verschmitzt hielt.
»Na ja, man kann sagen, Sie sind auferstanden. Das klingt vielleicht ein wenig dramatisch, aber Sie waren tot. Zumindest eine ganze Weile. Was man so hört, war es hart an der Grenze, was den Zeitraum angeht, bis irreparable Hirnschäden entstehen.«
Sie hielt erschrocken inne, als ihr klar zu werden schien, was sie ihm da gerade eröffnet hatte.
»Also ... ich will nichts Falsches sagen ... ich denke nicht, dass Sie ... äh ... Sie fühlen sich doch wohl, oder?«
In einer besseren körperlichen Verfassung hätte er vermutlich gelacht, um ihr dann freundlich die Hand auf den Arm zu legen und zu sagen: »Na, das fällt Ihnen aber reichlich spät ein. Was, wenn ich nun wirklich einen bleibenden Hirnschaden hätte?«
Aufgrund der inzwischen wieder mit normaler Geschwindigkeit ablaufenden Denkprozesse und Überlegungen war er sich allerdings relativ sicher, dass er keinen Hirnschaden erlitten hatte. Er überlegte und passte die folgenden Fragen, so gut es ging, an seine derzeit reduzierte Sprachfähigkeit an.
»Was ... passiert? Wie ... lange?«
Trotz seiner durch Husten unterbrochenen Fragen schien sie zu verstehen, auf welche Informationen es ihm ankam. Die Erleichterung darüber, dass er offensichtlich nicht hirntot war und sich noch in der Lage sah, halbwegs vernünftige Fragen zu stellen, war ihr anzusehen.
»Sie hatten einen schweren Herzinfarkt beim Joggen. Ihr Herz hat aufgehört zu schlagen. Aber Näheres dazu kann Ihnen nur der Doktor sagen. Das darf ich nicht ... und ich könnte es auch gar nicht«, gab sie nach kurzem Zögern zu.
»Wo ...?«
Seine Frage wurde durch einen erneuten Hustenanfall unterbrochen, aber sie hatte ihn auch so verstanden.
»Sie sind selbstverständlich im Krankenhaus, aber Sie können natürlich nicht wissen, in welchem. Sie befinden sich im Klinikum rechts der Isar und glauben Sie mir«, sie machte eine bedeutungsschwere Pause, »hier sind Sie in den allerbesten Händen.«
Da er keinerlei Grundlage für irgendwelche Zweifel an ihren Worten hatte, blieb ihm nichts anderes übrig, als ihr für den Moment zu glauben.
»So, junger Mann, jetzt ist es aber mal gut. Sie sollten sich zu Anfang auf keinen Fall überanstrengen. Ich stelle Ihnen hier noch eine Tasse mit einem Trank hin, der Ihren malträtierten Hals schnell wieder auf Vordermann bringt.«
Sie zwinkerte ihm zu. »Ich kann mir vorstellen, dass Sie der Typ sind, der dem Doktor Löcher in den Bauch fragen möchte. Da wollen wir doch nicht, dass die Stimme versagt, oder?«
Er nickte mit letzter Kraft und versank kurz darauf in einen erschöpften Schlaf.
Die nächsten zwei Tage verbrachte er in einem Schwebezustand zwischen Wachen und Schlafen. Er zwang sich, so viel wie möglich zu schlafen, denn er konnte sich vorstellen, dass er die Kraft brauchen würde. Langsam stieg allerdings die Ungeduld bezüglich eines klärenden Gesprächs mit dem behandelnden Arzt. Da er keine Angehörigen hatte, die Druck beim Oberarzt oder sogar der Klinikleitung hätten machen können, blieb es an ihm hängen, die Schwestern und Pfleger damit zu nerven, den Arzt endlich sprechen zu wollen. Aber man vertröstete ihn damit, dass er an einem Donnerstag eingeliefert, am späten Freitag erstmals erwacht war und nun halt eben Wochenende sei. Er müsse sich bis Montag gedulden und bis dahin damit beschäftigen, zu genesen. Ha, ha, sehr lustig.
Um zehn Uhr an diesem schicksalshaften Montag, den er sein Leben lang nicht vergessen würde, erschien der Oberarzt mit vollständiger Entourage, Stationsarzt, Assistenzärzte, Schwestern, jeder Menge Kladden und Akten ... und einer Leichenbittermiene, die ihm nichts Gutes verhieß. Schon bei den ersten Sätzen wurde ihm klar, warum der Arzt sich das Wochenende über gedrückt hatte oder vielleicht auch hatte warten wollen, bis er wieder ein wenig bei Kräften war.
»Herr ... von Gehlen«, er sah von seiner Kladde auf und es fiel ihm sichtlich schwer, ihm in die Augen zu sehen, »ich habe keine wirklich guten Nachrichten für Sie, es tut mir sehr leid.«
»Darf ich fragen, was genau die nicht guten Nachrichten sind?« Er hatte keine Lust auf Smalltalk und der Arzt musste es seiner Stimme angehört haben, denn er kam sofort zur Sache.
»Nun, Sie hatten einen schweren Herzinfarkt, wie Sie vermutlich schon wissen. Es ist den Einsatzkräften zwar gelungen, Sie nach einem Herzstillstand wiederzubeleben, aber ihr Herz hat schwere Schädigungen erfahren. Leider irreparable Schädigungen, wenn Sie verstehen, was ich meine.«
Ihm war zwar ungefähr klar, was er meinte, aber er hatte keine Lust, diesem um den heißen Brei herumredenden Halbgott in Weiß die Arbeit zu erleichtern. »Nein, das ist mir nicht ganz klar. Was bedeutet irreparabel in diesem Zusammenhang? Gibt es keine Operation, die mir helfen könnte, ein Bypass oder etwas Vergleichbares?«
Der Doktor seufzte schwer. Aber es blieb ihm nichts anderes übrig, als einem medizinischen Laien nun die Feinheiten zu erläutern, gleichgültig, wie unangenehm es ihm war.
Er sah vor sich auf den Boden und seine Blicke gingen unstet von rechts nach links und wieder zurück.
»Ihr Herz hat so viel Schaden genommen, dass es keine Möglichkeit gibt, durch eine Operation etwas zu beheben. Es bleibt eigentlich nur eine Option.«
Eduard hätte ihn fragen können, welche das sei, aber er ahnte es bereits. Sollte er sich doch selbst durchringen, das Thema zur Sprache zu bringen. Also ertrug er die sich hinziehende Stille und wartete geduldig. Geduld war immer eine seiner Stärken gewesen.
»Die einzige Option, die uns bleibt, ist eine Herztransplantation. So ist es leider.«
Eine Transplantation. Also tatsächlich. Er wusste nicht viel über Herztransplantationen, aber ihm war bekannt, dass sie nur vorgesehen wurden, wenn ein Herz unrettbar verloren war. Und unrettbar hieß, dass es in einer absehbaren Zeit seinen Geist aufgeben würde. Also war seine nächste Frage vorprogrammiert:
»Wie lange noch?«
»So genau kann man das nicht sagen. Das hängt von verschiedenen Parametern ab. Je nachdem wie ...«
»Wie lange?«, unterbrach er ihn barsch. »Ich will die Wahrheit wissen, und zwar ohne irgendwelche Beschönigungen, ist das klar? Darauf habe ich ein Anrecht. Ansonsten muss ich mir vermutlich einen kompetenteren behandelnden Arzt suchen.«
Das Herumgedruckse hatte ein Ende und er sah dem Arzt an, dass er ihn genug verärgert hatte, um ihn dazu zu bringen, ihm seine penetrante Insistenz heimzuzahlen, indem er ihm die schonungslose Wahrheit sagte.
»Schön, Herr von Gehlen, wenn Sie es so wollen. Wir gehen von einer Überlebensdauer von etwa sechs Monaten aus ... im günstigsten Fall neun Monate, auf keinen Fall mehr.«
Er war sich nun nicht mehr sicher, ob es die richtige Strategie gewesen war, den Doktor dazu zu bringen, ihm die schonungslose Wahrheit zu sagen. Dieser schien die Wirkung seiner Offenbarung auf ihn zu bemerken, denn er beeilte sich, ihm wieder Hoffnung zu machen.
»Wir haben Sie allerdings bereits auf die Transplantationsliste von EUROTRANSPLANT gesetzt, um ein passendes Spenderherz zu finden. Es ist also noch nicht alles verloren. Geben Sie die Hoffnung nicht auf.«
Er gab den Schwestern noch einige Anweisungen und beeilte sich dann, gemeinsam mit seiner gesamten Entourage das Zimmer zu verlassen.
Dabei ließ er ihn in einem Zustand zurück, den man gemeinhin als wie vor den Kopf geschlagen bezeichnete. Eduards größte Befürchtung war, dass er nun in ein tiefes Loch fallen würde, gefüllt mit grüblerischen Gedanken, Verzweiflung und Todesangst. Sollte er anfangen seine Angelegenheiten zu regeln oder sich ums Überleben kümmern? Gab es andere Chancen oder musste er sich hilflos in die Hände der Ärzte geben?
Am meisten belastete ihn im Augenblick, dass er in dieser bisher schwersten Stunde seines Lebens niemanden hatte, der ihm zur Seite stehen könnte. Sei es mit Rat und Tat oder einfach nur zum Trösten.
Bisher hatte er das ungebundene Singleleben ohne Verantwortung oder Verpflichtung einfach nur genossen. In diesem Moment fragte er sich erstmals, ob sich dieser so ideal erscheinende Lebenswandel genau jetzt erstmals auf sehr grausame Weise rächte.
Also, fragte er sich voller Verzweiflung, was tun? Was könnte der nächste Schritt sein? Er war völlig ratlos.
Kapitel 2
Das Taxi näherte sich einem von außen nicht einsehbaren Gelände, das von einem riesigen Metallgittertor zwischen zwei gemauerten Säulen abgeschottet wurde. An der linken Seite des Tores war die Kommunikationsanlage zu erkennen, die man mit bestem Willen nicht mehr als Klingel bezeichnen konnte.
»Soll ich auf Sie warten und Sie dann durch das Tor bis vor die Tür fahren? Vielleicht werden Sie ja gar nicht auf das Gelände gelassen. Bei diesen Typen weiß man das nie.«
Eduard sah keinen Grund, dem Taxifahrer auf die Nase zu binden, dass er einen Termin hatte und somit fest davon ausging, eingelassen zu werden. Außerdem wollte er die paar Schritte von dem Tor bis zum Haus an der frischen Luft zu Fuß gehen. Das würde ihm sicher guttun.
»Nein danke, Sie können sofort fahren.«
Der fragende und zweifelnde Blick des Taxifahrers zwang Eduard, seine Ansage auch noch zu begründen.
»Sollte ich Sie bald oder später wieder brauchen, habe ich ja die Nummer Ihrer Taxigesellschaft.«
Er wedelte kurz mit dem Kärtchen des Taxiunternehmens, steckt es in seine Brieftasche und entnahm ihr gleichzeitig das Geld, um die Fahrt vom Bahnhof bis hierher nach Hamburg-Blankenese zu bezahlen. Da er keine Lust auf eine weitere Diskussion hatte, gab er ihm reichlich Trinkgeld, was den Taxifahrer offensichtlich dafür entschädigte, dass er ihn nicht bis vor die Haustür fahren durfte.
Er beobachtete noch, wie der Wagen sich von dem Einfahrtstor entfernte, dann ging er zu der Kommunikationsanlage in der gemauerten Säule zur linken Seite des Tores.
Er hatte noch nie eine Sprechanlage mit verschiedenen Klingeln gesehen, die allerdings nicht mit den Namen unterschiedlicher Bewohner eines Hauses versehen waren, sondern mit einer Klassifizierung der Personen, die hier klingeln wollten.
In einer vergoldet wirkenden Tafel waren vier tellergroße Vertiefungen mit jeweils einem Knopf in der Mitte eingelassen. Daneben befanden sich gravierte Tafeln mit den Beschriftungen:
- Familie und Freunde
- Besucher
- Firmenangehörige
- Lieferanten
Im ersten Moment erschloss sich ihm das Erfordernis für eine solche Regelung nicht. Doch nach einiger Überlegung erkannte er den Grund ... oder vermutete zumindest ihn zu erkennen. Auf der Zugfahrt von München hatte er sich im Internet das Grundstück aus der Vogelperspektive über die Satellitenansicht in Google Maps angesehen ... und war von der Größe mehr als beeindruckt gewesen. Was im Internet von oben aus nicht so deutlich wurde, war, dass von seinem Standort aus die eigentliche herrschaftliche Villa nicht einsehbar war. Dazu war der Baumbestand in dieser parkähnlichen Anlage zu dicht. Ihm war zuvor nicht bewusst gewesen, dass es derart abgeschottete Grundstücke in den Nobelvierteln von Hamburg überhaupt gab. Die Villa in der Mitte des schätzungsweise 40.000 Quadratmeter großen Grundstücks war über Zufahrten zu erreichen, die an verschiedene Stellen des Hauses führten. Er ging davon aus, dass der Lieferant jemand anderen durch sein Klingeln erreichte, als der Besucher oder der Firmenangehörige.
Für wen genau die Klingel ›Familienangehörige‹ gedacht sein sollte, war ihm dagegen nicht klar. Seine Internetrecherche zur Familie Ahlsbeek hatte gezeigt, dass diese nicht groß genug war, als dass es sich gelohnt hätte, für zahlreiche Familienangehörige eine eigene Klingel einzurichten, da man nicht entsprechend viele Schlüssel ausgeben wollte.
Da es keinerlei Zweifel gab, welcher Kategorie er zuzuordnen war, zögerte er nicht länger und drückte den Knopf neben ›Besucher‹. Es dauerte erstaunlich lange, bis eine Reaktion erfolgte, was ihn zu der Überzeugung brachte, dass es keinen Wachmann oder etwas Vergleichbares gab, der darauf wartete, dass jemand läutete. Nach etwa zwei Minuten ertönte aus versteckten Lautsprechern in völlig klarem Ton und nicht etwa in dem blechernen Krächzen, wie man es von normalen Gegensprechanlagen gewohnt war, eine weibliche Stimme, deren Besitzerin er auf ein Alter jenseits der 60 schätzte.
»Ja bitte, der Herr, Sie wünschen?«
Die Ansprache machte ihm klar, dass die Sprecherin ihn sah, obwohl er nirgends eine Kamera entdecken konnte. Somit war ihm auch nicht klar, wohin er sich bei seiner Antwort wenden sollte, also versuchte er es erst gar nicht. Er blieb da stehen, wo er stand, sah unbeteiligt in Richtung des Tores und versuchte den Anschein zu erwecken, als würde er nicht ständig aus dem Nichts heraus angesprochen.
»Guten Tag, mein Name ist von Gehlen und ich habe einen Termin mit der Familie Ahlsbeek.«
Selbst für ihn klang seine Aussage seltsam. Wie kann man mit einer Familie einen Termin haben? Mit einem Ehepaar, mit Vater und Mutter, mit Herrn oder Frau sowieso, ja, aber mit einer Familie? Aber genau so war seine ganze Kommunikation in der Vorbereitung dieses Besuchs gelaufen. Er hatte über elektronische Mail mit dem Sekretariat der Firma Ahlsbeek Shipping Holding kommuniziert und alles, was er hatte erreichen können, waren jeweils Aussagen gewesen, wie:
»Ich werde die Familie kontaktieren und nachfragen, Herr von Gehlen.« »Ja, die Familie sieht das Erfordernis eines Gespräches für gegeben an, Herr von Gehlen.« »Die Familie hat heute in drei Tagen ein Zeitfenster für Ihren Besuch eingeplant, Herr von Gehlen.«
Zu keiner Zeit war ihm die Gnade gewährt worden, mit einem Mitglied der Familie Ahlsbeek persönlich zu sprechen. Außer den Informationen, die er sich als verantwortungsvoller Journalist selbstverständlich im Internet recherchiert hatte, waren die Ahlsbeeks für ihn bisher nur die Familie. Selbstverständlich kannte er inzwischen die Namen aller Familienmitglieder, aber er hatte feststellen müssen, dass es erstaunlich wenig Fotografien dieser Dynastie im Netz gab. Eduard hatte sich schon mehr als einmal gefragt, ob es zum typisch hanseatischen Understatement gehörte, dass eine Familie mit solcher Macht und solchem Reichtum im Netz so wenig präsent war. Gleichzeitig hatte er sich gefragt, was es wohl kosten mochte, eine solche Nicht-Präsenz aufrechtzuerhalten. Sie mussten die besten und teuersten Computerspezialisten bezahlt und damit beauftragt haben, ständig das Netz nach Informationen über sie zu durchforsten und diese so weit wie möglich zu entfernen. Der Mangel an Bildmaterial über die Ahlsbeeks sprach für den Erfolg dieser Maßnahme.
Statt einer erneuten Nachfrage der ältlichen Stimme oder einem Summen, wie man es von Türöffnern gewohnt war, sprang eine kleine, in das riese Gittertor eingelassene Tür, lautlos auf und schwang nach außen. Das konnte er wohl als Aufforderung einzutreten auffassen, was er auch ohne zu zögern tat. Langsam und bedächtig ging er den gekiesten Weg, der sich von dem Tor aus in das Innere des Grundstücks schlängelte entlang und bereits nach der zweiten Biegung zeigte sich ihm erstmals das Haus. Man musste es schon als Villa bezeichnen, die ihn eher an ein kleines Waldschlösschen erinnerte. Es war ein wirklich beeindruckendes Gebäude mit zwei Etagen, deren Abmessungen auf sehr hohe Räume schließen ließen. Es gab zahlreiche Ausbuchtungen und Erker, wobei er die Rückseite der Villa noch nicht gesehen hatte. Darüber gab es ein drittes Geschoss, welches mit leichten Dachschrägen zusätzliche Zimmer zur Verfügung stellte. Seitlich abgesetzt standen kleine Nebengebäude und eine nach unten führende Zufahrt, was ihn dort eine Tiefgarage vermuten ließ.
In der geöffneten Haustür, die man über drei halbrunde Treppenstufen erreichen konnte, stand eine älter wirkende Frau in einer Uniform, wie er sie bisher nur in Spielfilmen oder Bühnenaufführungen gesehen hatte: eine schwarze Bluse, ein schwarzer halblanger Rock, eine weiße Spitzenschürze und auf dem Kopf ein Häubchen, ebenfalls mit Spitze an den Rändern.
Bereits als er die Stufen hinaufschritt, begrüßte sie ihn in einem völlig neutralen Tonfall, der nichts über ihre Gefühlslage verriet.
»Willkommen Herr von Gehlen. Ich darf Sie in den Salon führen und bitten, dort zunächst Platz zu nehmen. Die Familie wird sich in Kürze zu Ihnen gesellen.«
Erst als er das Ende der drei Stufen erreicht hatte, stellte er fest, dass er die vermeintliche Hausdame mit seinen 1,92 Körpergröße um mindestens 40 Zentimeter überragte. Aus der Nähe wirkte sie nicht nur klein, sondern auch zerbrechlich, was sie noch älter erscheinen ließ.
Ohne eine Antwort auf ihre Begrüßung abzuwarten, drehte sie sich um und ging voraus. Er folgte ihr in den besagten Salon, ein etwa 50 Quadratmeter großes Zimmer mit Blick in den Park, einem Kamin und reichlich Sitzmöbeln. Es handelte sich um zwei Ledergarnituren unterschiedlichen Alters, eine dunkelrote Stoffgarnitur aus einzelnen Mehrsitzern mit Holzlehnen und eine moderne Sitzlandschaft, die Bequemlichkeit schrie. Dazu standen über den Raum verteilt, ein schwerer Holztisch mit soliden hochlehnigen Holzstühlen und diverse Ohrensessel im Halbrund um den Kamin. Noch während er das Ambiente aus einer Zusammenstellung sowohl moderner als auch klassischer Möbel in sich aufnahm, sprach ihn die Hausdame – als Dienstmädchen wollte er sie aufgrund ihres Alters nicht ansehen - ein zweites Mal an.
»Bitte nehmen Sie Platz. Darf ich Ihnen einen Kaffee oder Tee bringen lassen?«
Kaffee und Tee schieden aus, weshalb er um ein Mineralwasser ohne Kohlensäure bat, was Sie mit einem leichten Kopfnicken entgegennahm. Noch während ihm durch den Sinn ging, dass die Ausdrucksweise bringen lassen zusätzliches Personal unterstellte, machte er sich parallel Gedanken darüber, wo er in diesem Sammelsurium von Sitzmöbeln platznehmen sollte.
Er hatte sich nach einiger Überlegung in einem kleineren Sessel in der Nähe eines Beistelltisches niedergelassen, als ein älterer Mann in der Kleidung eines Butlers erschien. Er balancierte geschickt ein kleines Silbertablett mit einer Flasche und einem Kristallglas darauf. Für einen kurzen Moment erwog Eduard, aufzustehen, tat den Gedanken dann aber als unpassend ab und blieb sitzen.
»Bitte schön, junger Herr.«
Mit diesen Worten stellte er das Tablett auf den Beistelltisch, zog einen Öffner für Kronkorken aus einer kleinen Tasche seiner Weste und öffnete die Flasche. Danach schenkte er das Glas zur Hälfte voll und verstaute den Öffner wieder in der Westentasche.
»Auf Ihr Wohlsein, junger Herr.«
Mit diesen Worten machte er eine kleine Verbeugung, anschließend eine fast militärisch anmutende Kehrtwendung und verließ mit für sein offensichtliches Alter erstaunlich federnden Schritten den Raum.
Hätte er es nicht besser gewusst, wäre ihm die gesamte Szene wie aus einem Rosamunde-Pilcher-Film und der Darstellung eines Geschehens in einem hochherrschaftlichen englischen Adelssitz vorgekommen. Er konnte nicht umhin, verwundert, aber auch ein wenig amüsiert, den Kopf zu schütteln.
Während er das Wasser in kleinen Schlucken trank und sich nach fünf Minuten auf eine längere Wartezeit einstellte, wanderten seine Gedanken wie zwangsläufig zurück zu den Ereignissen, die ihn an diesen seltsamen Ort geführt hatten.
Kapitel 3
Nach der Eröffnung des behandelnden Arztes, dass ihm nicht mehr viel Zeit bliebe, er aber auf der Transplantationsliste von EUROTRANSPLANT stände, ergab sich die naheliegende Frage bereits am nächsten Tag. Da er noch keine Gelegenheit hatte, jemanden damit zu beauftragen, ihm seine Arbeitsutensilien - den Laptop und die erforderliche Hardware, um auch an diesem Ort im Internet zu surfen - vorbeizubringen, blieb ihm keine andere Möglichkeit, als jemandem die Frage zu stellen, die ihm am meisten auf der Seele brannte.
Wie lange war die durchschnittliche Wartezeit, bis man von EUROTRANSPLANT mit einem passenden Herzen bedient wurde?
Wie es wahrscheinlich jeder in einer vergleichbaren Situation wie seiner getan hätte, fragte er die erste Person, die ihm am Morgen zu Gesicht kam: die Krankenschwester.
Diesmal handelte es sich um eine jüngere Version der Schwester vom Vortag, an deren Namen er sich beim besten Willen nicht mehr erinnern konnte. Die recht unattraktive junge Dame hieß laut Namensschild Ming-Tra, war offensichtlich asiatischer Herkunft, sprach aber ein sehr gutes Deutsch.
»Schwester Ming-Tra, darf ich Sie etwas fragen?«
»Aber natürlich. Was möchten Sie wissen?«
»Wie lange muss man durchschnittlich warten, bis man ein Spenderorgan bekommt?«
»Das ist ganz unterschiedlich, aber so im Schnitt ...«, sie nahm sein Krankenblatt aus der Halterung am Fußende des Bettes und warf einen Blick darauf, »... oh ... äh ... also so genau kann ich Ihnen das doch nicht beantworten. Warten Sie lieber, bis der Doktor um 10:00 Uhr zur Visite kommt, und fragen Sie ihn am besten dann direkt.«
Sie hatte es plötzlich sehr eilig, sein Zimmer zu verlassen, was er als schlechtes Zeichen wertete.
Es fiel ihm erwartungsgemäß schwer, die Wartezeit bis zur Visite durchzustehen, aber schließlich war der Zeitpunkt gekommen und der Oberarzt betrat erneut das Krankenzimmer mit seiner gesamten Mannschaft im Gefolge.
»Auf ein Wort, Herr Doktor. Sie sind mir noch eine wichtige Auskunft schuldig.« Er wollte ihm bewusst keine Zeit lassen, ihn mit dem üblichen »na, wie geht’s uns denn heute?« Geschwätz von der drängendsten Frage abzulenken, die ihm auf der Seele brannte. Der Arzt sah ihn mit hochgezogenen Augenbrauen fragend an.
»Wie lange ist im Durchschnitt die Wartezeit auf ein passendes Spenderherz?«
Sein Blick und die zusammengepressten Lippen sprachen Bände, aber der Arzt rang sich schließlich durch und gab ihm Antwort.
»Im Durchschnitt etwa sechs bis zwölf Monate, das kommt darauf an.«
Gar keine schlechte Chance, bei einer prognostizierten Restlebensdauer von sechs bis neun Monaten. Erst nach einigen Sekunden drang die gesamte Antwort weit genug in sein benebeltes Gehirn ein, um alle Implikationen verstehen zu können.
»Auf was kommt es an? Bitte werden sie ein wenig spezifischer.«
Eduard hatte den Nagel auf den Kopf getroffen. Der Doktor bekam wieder diesen unsteten Blick und hätte sich am liebsten um die Antwort gedrückt.
»Äh ... nun ja ... vor allem auf die Kompatibilität, die zum Beispiel sehr stark von der Blutgruppe abhängig ist.«
»Welche Blutgruppe habe ich?«
Für solche Themen hatte er sich als relativ junger Mensch bisher noch nicht wirklich interessiert und es hatte bis zu diesem Tag niemals die Notwendigkeit bestanden, seine eigene Blutgruppe zu kennen. Eduard fiel auf, dass auch die Begleiter des Oberarztes alle in irgendwelche Richtungen blickten, nur nicht in seine.
»AB positiv«, presste der Weißkittel schließlich zwischen zusammengepressten Kiefern durch.
Als würde ihm diese medizinische Ausdrucksweise in irgendeiner Form weiterhelfen.
»Und was bedeutet das genau?«
»Die ist leider ziemlich selten.«
»Wie selten?« Er hatte es langsam leid, dem Mediziner alle Würmer aus der Nase ziehen zu müssen.
»Etwa vier Prozent der deutschen Bevölkerung haben diese Konstellation.«
Er musste Eduards entsetzten Blick bemerkt haben, als sich dessen Gedanken überschlugen, während er die Prozentzahl in eine Chance umzurechnen versuchte, weshalb er unnötigerweise nachsetzte.
»Aber Sie haben noch Glück im Unglück. Sie hätten auch die allerseltenste Kombination haben können, AB negativ, die haben nur ein Prozent der Bevölkerung.«
Was für eine Erleichterung. So ein Glück. Eduard legte den Kopf ein wenig schief und sah ihn an, wie man einen Komiker betrachten würde, der einen Witz gemacht hatte, über den beim besten Willen niemand lachen konnte. »Sie würden vermutlich einem zum Tode durch den elektrischen Stuhl Verurteilten noch einen Vortrag über den Segen der Elektrizität halten, was? Sagen Sie mir, wie bei den Patienten mit dieser Blutgruppe die durchschnittliche Wartezeit ist, oder muss ich den Klinikleiter anrufen?«
»24 bis 36 Monate«, kam es sehr leise und gepresst aus seinem Mund.
Das war nun endgültig sein Todesurteil, daran hatte er nicht den geringsten Zweifel.
Überraschenderweise blieb ihm kaum Zeit, mit seinem schlimmen Schicksal zu hadern, denn es überforderte ihn schon, seine Angelegenheiten in Ordnung zu bringen. Wie geht man mit seiner Habe um, wenn man niemanden hat, dem man sie vererben kann? Was sollte eine soziale Einrichtung mit seinem Laptop, seinem Computer, seiner Stereoanlage oder der Sammlung von Science-Fiction-Heften anfangen? Möbel und Kleidung war sicherlich unter die Leute zu bringen, aber seine persönlichen Sachen? Seine Reiseandenken, die Fotos von Urlaubsorten, die Ordner mit seinen Artikeln und den Recherchen. Würde sein ganzes bisheriges Leben zuerst in einem Müllcontainer und schließlich auf einer riesigen Müllkippe landen?
Erstmals wurde ihm bewusst, wie alleine auf der Welt er tatsächlich war. Seine Eltern waren gestorben, als er erst siebzehn war. Er hatte keine Geschwister und seine Eltern hatten ebenfalls keine Geschwister gehabt, weshalb ihm auch Onkel, Tanten, Cousins oder Cousinen fehlten. Was blieb da noch? Arbeitskollegen und Kumpel vielleicht. Da er zeit seines Lebens immer ein Einzelgänger gewesen war, als freier Journalist nicht in einer Redaktion gearbeitet und den Kontakt zu seinen Studienkollegen nie gepflegt hatte, fehlten ihm nun jegliche sozialen Kontakte, wie ein normaler Mensch sie zu Dutzenden hatte. Diese Erkenntnis brachte ihn fast mehr zur Verzweiflung als der Umstand, dass sein Leben in einigen Monaten enden sollte.
Seit der niederschmetternden Diagnose waren gerade einmal drei Wochen vergangen und er befand sich gerade in einer Phase tiefster Depression, als ihn ein Anruf erreichte, der ihn sofort in das Münchner Transplantationszentrum berief.
»Umgehend und ohne jede Verzögerung«, war der genaue Wortlaut gewesen, was in ihm die Hoffnung weckte, dass der Grund keine neuerliche Untersuchung war, sondern vielleicht tatsächlich ein neues, für ihn gefundenes Herz sein könnte.
Nur sieben Stunden später schlug ein neues Herz in seiner Brust. Es als neu zu bezeichnen, entsprach zwar nicht ganz den Tatsachen, aber er betrachtete es als für sich neu, auch wenn das Herz an sich schon gebraucht war.
Ein gebrauchtes Herz ... alleine der Begriff warf ihn aus der Bahn und schürte jede Menge ungewollter Fragen. Wie gebraucht war es? Wer war der Spender? Was hatte ihm passieren müssen, damit er davon profitieren konnte?
An dieser Stelle seiner Überlegungen musste er sich beschämt eingestehen, dass er nicht nur selbstkein Organspender gewesen war, sondern sich im Vorfeld der Operation noch nicht einmal Gedanken über einen möglichen Spender gemacht hatte. Zu sehr war er von der Überzeugung beeinflusst gewesen, dass er eh sterben würde, bevor der unwahrscheinliche Fall eintreten könnte, dass ein passendes Organ für ihn verfügbar wäre.
Die ersten drei Tage nach der OP dämmerte er in der Intensivstation vor sich hin und im Nachhinein konnte er nicht mehr alle Gedanken rekapitulieren, die ihm in dieser Zeit durch den Kopf gegangen waren. Als er am fünften Tag wieder aufstehen konnte und erste Übungen machen musste, arbeitete sein Gehirn allerdings auf Hochtouren. All die Gedanken zur Herkunft des Spenderorgans nahmen immer mehr Gestalt an und er musste sich einfach Gewissheit verschaffen.
Also löcherte er unmittelbar, nachdem er dazu in der Lage war, den Professor, der ihn operiert hatte, mit genau diesen Fragen.
»Herr Professor, wer war der Spender meines neuen Herzens?«, hatte er blauäugig gefragt, ohne sich im Vorfeld über die Rechtslage zu informieren.
»Bedaure, Herr von Gehlen, das dürfen wir Ihnen nicht mitteilen. Das Transplantationsgesetz sieht vor, dass eine Organspende für beide Seiten anonym ist.«
»Was heißt ›für beide Seiten‹? Dem Spender können Sie ja nicht mehr mitteilen, wer sein Organ erhalten hat, oder haben Sie als Halbgott einen besonderen Draht nach oben?«
Er hatte den zynischen Tonfall nicht vermeiden können. Der Satz war raus, bevor er darüber nachdenken konnte, ob es klug war, so mit dem Professor zu reden. Aber der schien diesbezüglich glücklicherweise nicht sonderlich empfindlich zu sein.
»Nein, aber den Angehörigen eines Spenders. Selbst einer Ehefrau, Kindern oder Eltern, darf nicht offenbart werden, wer das Organ ihres Angehörigen erhalten hat. Lediglich, dass eine Verpflanzung stattgefunden und ob sie erfolgreich war. Das ist alles.«
»Kann ich erfahren, wie mein Spender ums Leben gekommen ist?«
»Auch das unterliegt der Schweigepflicht. Ich könnte es Ihnen nicht mal sagen, wenn ich wollte, denn die Todesumstände werden von EUROTRANSPLANT nicht mitgeteilt. Was ich weiß, sind die rein medizinischen Daten, die Sie sich eigentlich selbst denken könnten. Der Spender hatte die gleiche Blutgruppe wie Sie, war in etwa im gleichen Alter und das Organ war kerngesund.«
Er machte eine kurze Pause und bemerkte die unübersehbare Enttäuschung, die sich in Eduard breitmachte.
»Sie werden damit leben müssen, dass ein junger Mensch gestorben ist und Sie deshalb weiterleben können.«
Wenn er schon nicht mehr aus ihm herauslocken konnte, so regte sich zumindest seine journalistische Neugier.
»Ist das nicht ein sehr unwahrscheinlicher Zufall, dass so kurz nach meiner Diagnose just im richtigen Moment der passende Spender stirbt?«
Der Professor lachte laut auf und schien sich köstlich zu amüsieren. Erst als er Eduards erbost zusammengezogenen Augenbrauen sah, riss er sich zusammen und würdigte ihn einer Antwort.
»Ich wusste ja, dass Sie Journalist sind, und ich kann mir vorstellen, dass Sie eine blühende Phantasie benötigen, um in Ihrem Beruf weiterzukommen, aber was Sie da andeuten ... nein, nein. Sie brauchen keine Verschwörungstheorien über Organhandel oder ähnlichen Unsinn aufzubauen. Wenn Sie ein Milliardär wären, könnte ich solche Ideen vielleicht noch verstehen, aber in Ihrem Fall ist das nicht nur abwegig, sondern völlig unangebracht. Glauben Sie mir ... Sie haben einfach unheimliches Glück gehabt. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht mal so schlecht, wie auf einen Sechser im Lotto, und Sie wissen ja, jedes Wochenende gibt es einen neuen Lottomillionär. Also seien Sie einfach froh und steigern Sie sich nicht in etwas Unsinniges und nicht Zielführendes hinein.«
Er wandte sie zum Gehen, machte aber in der Tür noch einmal halt, wandte sich um und sah Eduard sehr ernst und nachdenklich an.
»Sollten Sie aber Probleme damit haben, diesen Glücksfall anzunehmen und bedingungslos zu akzeptieren, kann ich Ihnen gerne einen sehr guten Psychotherapeuten empfehlen. Es tut Ihrer Genesung auf keinen Fall gut, wenn Sie in Grübeleien verfallen. Denken Sie mal darüber nach.«
Eduard dachte darüber nach. Als Journalist mit einer schier unstillbaren Neugier, einem Hang zur Detailtreue und einer peniblen Recherche, war er beileibe nicht der Typ, der sich mit einem ›finden Sie sich damit ab‹ zufriedengeben konnte. Je unwahrscheinlicher es erschien, dass Nachforschungen zu einem Ergebnis führen würden, desto reizvoller war ihm stets die Aufgabe erschienen.
Also ging er strukturiert an die Recherche, wie es sich für einen ordentlichen Journalisten gehörte. Zuallererst erforschte er EUROTRANSPLANT, die, wie er herausfand, Stiftung für die ›optimale Verfügbarkeit von Spenderorganen‹. Entgegen der Meinung, die Stiftung agiere europaweit, hatten sich in ihr lediglich die Länder Deutschland, Österreich, Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Slowenien, Kroatien und Ungarn zusammengefunden.
Alle Bedingungen für die Entnahme von Organen und den Umgang mit deren Spendern und Empfängern waren im Transplantationsgesetz (TPG) von 1997 geregelt. Darüber hinaus war er nicht wenig überrascht, dass es ergänzende Gesetze gab, wie zum Beispiel das Gewebegesetz und das Transfusionsgesetz.
Entscheidend für sein Wissensdefizit war der § 14 TPG, der vorschrieb, dass alle Daten über Spender und Empfänger dem Datenschutz unterlagen und somit an niemanden außerhalb des bei Transplantationen handelnden Personenkreises weitergegeben werden durften.
Wenn er seinem Professor Glauben schenken wollte, musste er davon ausgehen, dass selbst das Krankenhaus nicht über die vollständigen Informationen verfügte. Sie erhielten nur die Daten, die sie für eine erfolgreiche Durchführung der Transplantation brauchten. Dazu gehörten leider weder der Name des Spenders noch seine Todesumstände. Sie beinhalteten noch nicht einmal die Nationalität, weshalb es vorstellbar war, dass in seiner Brust nun ein niederländisches oder ungarisches Herz schlug.
Nicht, dass ihm das etwas ausgemacht hätte. Er empfand sich selbst als Europäer und hatte keinerlei pauschalisierende Vorbehalte gegen die Einwohner anderer Länder. Aber es erschwerte die Suche nach dem Spender zusätzlich. Die einzige Stelle, an der er die erforderlichen Informationen mit Sicherheit würde finden können ... war EUROTRANSPLANT. In ihm wuchs eine Idee heran, die sich hauptsächlich auf seine bisherige Arbeit gründete und von der er überzeugt war, dass sie funktionieren könnte. Allerdings benötigte er dazu fremde Hilfe, und er war sich nicht sicher, ob er sie erhalten würde.
Noch bevor er das Vorhaben in Angriff nehmen konnte, machte er jedoch einige sehr erstaunliche und vor allem verwirrende Erfahrungen.
Bereits kurz nach seinem Wechsel von der Intensivstation auf die normale Station hatte er merkwürdige Träume. Es waren keine Sexphantasien, wie sie vermutlich jeder Mann irgendwann mal hatte, sondern eher romantische Träume voller Liebe, Sehnsucht und Hingabe. Seltsamerweise handelten sie von einer Asiatin ... und er hatte noch nie ein spezielles Faible für Asiatinnen gehabt. Es wäre noch erklärbar gewesen, wenn es sich bei der Stationsschwester Ming-Tra um eine hübsche oder besonders attraktive Asiatin gehandelt hätte, was aber nicht der Fall war. Die einzige sonstige Asiatin, mit der er im Krankenhaus Kontakt hatte, war eine Physiotherapeutin, eine Chinesin, die allerdings bereits jenseits der 60 war und noch nicht einmal sonderlich gut aussah.
Diese Merkwürdigkeit alleine hätte ihm nicht so zu denken gegeben, wären da nicht auch noch die ... Geschmacksverwirrungen ... gewesen. Ihm fiel kein besserer Begriff ein, zumal es auf beide Vorkommnisse zutraf, die ihn überraschend ereilten. Das erste Ereignis traf ihn beim Essen der ihm aufgrund seines noch geschwächten Zustandes vorgesetzten Schonkost. Schon als Kind hatte er gedünsteten Rosenkohl gehasst wie die Pest, und daran hatte sich auch mit zunehmendem Alter nie etwas geändert. Als ihm an diesem Tag allerdings der Geruch des Gemüses in die Nase stieg, begann ihm das Wasser im Mund zusammenzulaufen. Überrascht begann er den Rosenkohl zu essen ... und er schmeckte so hervorragend, dass er nicht mehr verstehen konnte, warum er ihn nie gemocht hatte.
Das zweite Vorkommnis ereignete sich, als er zu einer der Physiotherapiesitzungen bei besagter Chinesin antrat. Aus versteckten Lautsprechern in dem Behandlungszimmer drang leise aber deutlich vernehmbare Musik. Unerwarteterweise handelte es sich aber nicht um asiatische Musik oder irgendwelche esoterische Entspannungsklänge, sondern um klassische Musik. Er liebte Rock, Pop und Countrymusik, aber Klassik war noch nie etwas gewesen, was er gerne gehört hatte. Eduard verstand nichts davon, konnte die einzelnen Komponisten nicht voneinander unterscheiden und der Unterschied zwischen einer Sonate und einer Sinfonie war ihm absolut unbekannt. Was dort allerdings in unaufdringlicher Lautstärke an seine Ohren gelangte, gab ihm sofort die Gewissheit, dass es sich um eine Klaviersonate von Wolfgang Amadeus Mozart handeln musste. Er blieb wie angewurzelt stehen und war von der Erkenntnis, dass er dieses Wissen nie bewusst gehabt haben konnte, total überrascht und sogar erschrocken,
Woher kam diese Erkenntnis? Oder war es etwa nur Einbildung und in Wirklichkeit handelte es sich um ein Werk von Beethoven oder Haydn? Hatte er es irgendwann schon mal gehört, vielleicht unbewusst und jemanden sagen hören, dass es sich um ein Stück von Mozart handelt?
»Oh, Sie mögen die Sonate Nr. 17 in B-Dur? Ich liebe die späten Werke von Mozart aus seiner Wiener Zeit. Sind Sie auch ein Kenner?«, riss ihn die Stimme der chinesischen Therapeutin aus seinen Gedanken ... um ihn sofort in noch tiefere Verwirrung zu stürzen.
Was ging hier vor? Woher kamen diese seltsamen Geschmacksverwirrungen? Nicht dass sie ihm unangenehm gewesen wären, im Gegenteil. Aber er erreichte langsam die Grenzen seiner Phantasie. Der absurde Gedanke, es könne etwas mit seinem neuen Herzen zu tun haben, setzte sich in ihm fest und ließ sich nicht mehr verdrängen oder wegleugnen.
Er versuchte vergeblich, sich einzureden, dass es eine andere Erklärung geben musste, als dass er Erinnerungen und Vorlieben des Spenders in sich aufgenommen hatte. Er war belesen genug, um zu wissen, dass die Philosophen des Altertums das Herz als den Sitz der Seele angesehen hatten. Andererseits war er zu sehr wissenschaftlich orientiert, als dass er es nachvollziehen konnte oder auch nur in Betracht ziehen würde.
Sein Wunsch, mehr über den Spender des Organs zu erfahren nahm innerhalb kürzester Zeit fast wahnhafte Züge an. Die Angst, nicht mehr er selbst, sondern eine Mischung aus zwei verschiedenen Menschen zu sein, begann immer stärker an ihm zu nagen. Er musste einfach etwas unternehmen, koste es, was es wolle.
»Ja, wer stört«, drang die näselnde, für einen Mann etwas zu hohe Stimme aus seinem Handy an sein Ohr.
»Ich bin’s, Eddy, hallo Ben. Wie geht’s?«
»Mensch, Eddy, das ist aber schön mal wieder was von dir zu hören. Tja ... mir geht’s gut, wie immer, weißt du doch ... schlechten Menschen geht’s immer gut, hä hä hä. Aber sag mal, wie bist du denn so drauf? Immer noch keine Schnecke gefunden, hä? Ich habe ja schon ... na was ... mindestens drei Monate nichts mehr von dir gehört. Was macht die Kunst? Wieder an einer heißen Story dran, was? Natürlich bist du das, deshalb meldest du dich ja bei mir. Soll ich mal wieder irgendwo für dich einbrechen? Kein Problem, mach ich doch gerne, aus alter Freundschaft, was?«